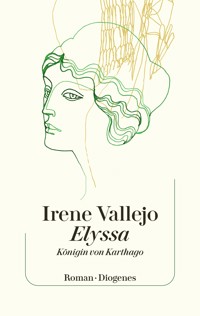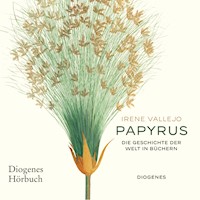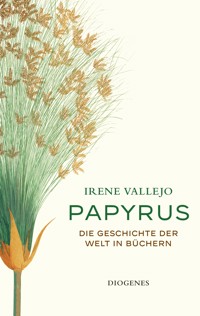
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Buch ist eine der schönsten Erfindungen der Menschheit. Bücher lassen Worte durch Zeit und Raum reisen und sorgen dafür, dass Ideen und Geschichten Generationen überdauern. Irene Vallejo nimmt uns mit auf eine abenteuerliche Reise durch die faszinierende Geschichte des Buches, von den Anfängen der Bibliothek von Alexandria bis zum Untergang des Römischen Reiches. Dabei treffen wir auf rebellische Nonnen, gewiefte Buchhändler, unermüdliche Geschichtenerzählerinnen und andere Menschen, die sich der Welt der Bücher verschrieben haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 947
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Irene Vallejo
Papyrus
Die Geschichte der Welt in Büchern
Aus dem Spanischen von Maria Meinel und Luis Ruby
Diogenes
Meiner Mutter, fester Hand aus Watte
Wenn sie so eine Weile verharre, würde das, was sie erwartete, umgekehrt geschehen:
Die Buchstaben würden allmählich sie ansehen. Und ihr Geschichten erzählen. Sie alle sähen wie Zeichnungen aus, doch in den Buchstaben steckten Stimmen. Jedes Blatt sei ein Gehäuse für unendlich viele Stimmen.
Mia Couto, Imani
Die leblosen Zeichen des Alphabets werden im Kopf zu lebenden Bedeutungen. Die Lese- und Schreibfähigkeit scheint, wie alle erlernten Tätigkeiten, die Organisation unseres Gehirns zu verändern.
Siri Hustvedt, Leben, Denken, Schauen
Ich liebe die Verfasser meiner tausend Bücher. Mir gefällt die Vorstellung, wie verblüfft der alte Homer – wer immer das war – darüber wäre, seine Epen im Regal eines so unvorstellbaren Wesens wie mir vorzufinden, auf einem noch nicht mal durch Gerüchte bekannten Kontinent.
Marilynne Robinson, When I Was a Child I Read Books
Das Lesen ist immer ein Umzug, eine Reise, ein Fortgehen, um sich zu finden. Das Lesen ist zwar üblicherweise eine sesshafte Handlung, aber es führt uns zurück zu unserem Wesen als Nomaden.
Antonio Basanta, Leer contra la nada
Bücher sind vor allem Gefäße, in denen die Zeit zur Ruhe kommt. Ein wundersamer Trick, durch den die menschliche Intelligenz und Sensibilität die vergänglichen, fließenden Zustände überwunden haben, die die Erfahrung des Lebens ins Nichts des Vergessens sinken ließen.
Emilio Lledó, Los libros y la libertad
Prolog
Seltsame Gruppen berittener Männer durchstreifen die Straßen Griechenlands. Die Bauern beobachten sie misstrauisch von den Feldern aus oder von den Hüttentüren. Aus Erfahrung wissen sie, dass nur gefährliche Leute reisen: Soldaten, Söldner, Sklavenhändler. Sie runzeln die Stirn und knurren, bis die Männer wieder am Horizont versinken. Sie mögen keine bewaffneten Fremden.
Die Reiter nehmen von den Dorfbewohnern keine Notiz. Monatelang haben sie Berge bestiegen, Schluchten genommen, Täler durchquert, Flüsse durchwatet und sind von Insel zu Insel gesegelt. Ihre Widerstandskräfte und Muskeln sind stärker geworden seit dem Antritt ihrer sonderbaren Mission. Um diesen Auftrag zu erfüllen, müssen sie sich in die rauen Territorien einer sich ständig bekriegenden Welt vorwagen. Sie jagen nach einer ganz besonderen Beute. Einer stillen Beute, einer schlauen, die nicht die geringsten Spuren hinterlässt.
Wenn sich diese unheimlichen Gesandten in irgendeine Hafenkneipe setzen, Wein trinken, gebratenen Tintenfisch essen, sich mit Fremden unterhalten und gemeinsam betrinken würden (aus Vorsicht tun sie das nie), könnten sie großartige Reisegeschichten erzählen. Sie hatten sich in Pestgebiete gewagt. Waren durch niedergebrannte Gegenden gereist und hatten die heiße Asche der Zerstörung und die Brutalität der Rebellen und Söldner auf Kriegspfaden gesehen. Landkarten von ausgedehnten Gebieten gab es noch nicht, und so verirrten sie sich und wanderten tagelang ziellos bei sengender Sonne und Stürmen umher. Sie mussten ekelhaftes Wasser trinken, das ihnen heftigen Durchfall bescherte. Wenn es regnete, blieben die Karren und Maultiere in Pfützen stecken; mit Rufen und Flüchen zerrten sie dann an ihnen, bis sie selbst auf die Knie gingen und in den Schlamm fielen. Wurden sie fern jeder Bleibe von der Nacht überrascht, schützte sie nur ihr Mantel vor den Skorpionen. Sie kennen die irren Läuseplagen und die ständige Angst vor Räubern, die sich auf den Straßen herumtreiben. Oft stockt ihnen das Blut in den Adern, wenn sie durch die Einsamkeit reiten und sich vorstellen, dass sie eine Gruppe von Banditen mit angehaltenem Atem belauert, sich hinter irgendeiner Biegung des Weges versteckt, um über sie herzufallen, sie kaltblütig zu ermorden, auszurauben und ihre noch warmen Leichen im Gebüsch zurückzulassen.
Logisch, dass sie Angst haben. Der König von Ägypten hatte ihnen große Summen anvertraut, bevor er sie zu ihrem Auftrag auf der anderen Seite des Meeres entsandte. Zu jener Zeit, nur wenige Jahrzehnte nach Alexanders Tod, war das Reisen mit großem Vermögen sehr riskant, fast selbstmörderisch. Und obwohl Diebesdolche, ansteckende Krankheiten und Schiffbrüche eine so kostspielige Mission zu zerschlagen drohten, bestand der Pharao darauf, seine Agenten aus dem Land des Nils über Grenzen und große Entfernungen hinweg in alle Richtungen auszusenden. Ungeduldig, voll quälender Habgier brennt er auf jene Beute, die seine heimlichen Jäger allen fremden Gefahren zum Trotz für ihn aufspüren.
Die neugierig vor ihren Hütten lungernden Bauern, die Söldner und die Banditen hätten ungläubig Mund und Augen aufgerissen, wenn sie gewusst hätten, worauf die fremden Reiter aus waren.
Bücher. Sie suchten Bücher.
Es war das bestgehütete Geheimnis des ägyptischen Hofs. Der Herrscher zweier Kulturen, einer der mächtigsten Männer der damaligen Zeit, gäbe das Leben dafür (das der anderen natürlich, so ist das immer bei Königen), um alle Bücher der Welt in seiner großen Bibliothek von Alexandria zu versammeln. Er träumte von der vollkommenen Bibliothek, einer Sammlung aller Werke aller Autoren seit Anbeginn der Zeit.
Ich scheue mich immer vorm Schreiben der ersten Zeilen, vorm Überschreiten der Schwelle zu einem neuen Buch. Wenn alle Bibliotheken durchforstet sind und meine Hefte strotzen vor fieberhaften Notizen, wenn mir weder vernünftige noch dumme Ausreden einfallen wollen, die das Warten erklärten, zögere ich es noch ein paar Tage hinaus, in denen mir klar wird, worin die Feigheit besteht. Ich fühle mich einfach unfähig. Alles sollte da sein: der Ton, der Humor, die Poesie, der Rhythmus, die Versprechen. Die noch ungeschriebenen, ums Geborenwerden ringenden Kapitel sollten sich im Keimbett der gewählten Anfangsworte schon erahnen lassen. Aber wie macht man das? Was ich derzeit habe, sind Zweifel. Mit jedem Buch kehre ich zum Ausgangspunkt zurück, zum schlagenden Herzen aller ersten Male. Schreiben ist der Versuch herauszufinden, was man schreiben würde, wenn man schriebe, so formulierte es Marguerite Duras und geht vom Infinitiv zur Bedingungsform und dann zum Irrealis über, als spürte sie den Boden unter ihren Füßen bröckeln.
Das unterscheidet sich im Grunde kaum von anderen Dingen, die wir ahnungslos beginnen: eine andere Sprache sprechen, Auto fahren, Mutter sein. Leben.
Eines heißen Julinachmittags, nach all den quälenden Zweifeln, den aufgebrauchten Vorwänden und Alibis, stelle ich mich der Einsamkeit des leeren Blattes. Ich werde meinen Text mit dem Bild von ein paar rätselhaften Jägern auf der Suche nach Beute eröffnen. Ich identifiziere mich mit ihnen, ich mag ihre Geduld, ihren Gleichmut, die verlorene Zeit, die Langsamkeit und das Adrenalin bei der Suche. Jahrelang habe ich recherchiert, Quellen konsultiert, alles dokumentiert und mich mit der Aneignung des historischen Materials befasst. Doch zur Stunde der Wahrheit scheint die wirkliche, dokumentierte Geschichte, die ich entdecke, so erstaunlich, dass sie in meine Träume eindringt und, ohne mein Zutun, die Form einer Erzählung annimmt. Ich bin versucht, in die Haut dieser Büchersucher auf den Straßen eines antiken, gewalttätigen, zuckenden Europas zu schlüpfen. Und wenn ich zu Beginn ihre Reise beschreibe? Könnte funktionieren, aber wie gelingt es, das darunterliegende Faktenskelett von den Muskeln und dem Blut der Fantasie abzugrenzen?
Ich glaube, der Ausgangspunkt ist so fantastisch wie die Suche nach den Minen König Salomos oder nach dem verlorenen Schatz, aber die Dokumente belegen, dass die Büchergier im Größenwahndenken der ägyptischen Könige wirklich existierte. Vielleicht war es damals, im dritten Jahrhundert v. Chr., zum ersten und letzten Mal möglich, den Traum vom Versammeln ausnahmslos aller Bücher der Welt in einer Universalbibliothek zu verwirklichen. Heute erscheint uns das wie die Handlung einer Fiktion von Borges oder vielleicht seine große erotische Fantasie.
So etwas wie einen internationalen Handel mit Büchern gab es zur Zeit des großen alexandrinischen Projekts nicht. Man konnte sie in kulturhistorisch bedeutenden Städten kaufen, aber nicht im jungen Alexandria. Die Quellen berichten, dass die Könige ihre absolutistische Macht nutzten, um ihre Sammlung zu bereichern. Was sie nicht kaufen konnten, konfiszierten sie. Und wenn es nötig war, Kehlen durchzuschneiden oder Ernten zu zerstören, um an ein begehrtes Buch zu gelangen, gaben sie den Befehl dazu; der Ruhm des Landes, sagten sie sich, sei wichtiger als die kleinen Skrupel.
Natürlich gehörte auch der Betrug zum Repertoire ihrer Zielstrebigkeit. Ptolemaios III. verlangte es nach dem Staatsexemplar der Tragödien von Aischylos, Sophokles und Euripides, die seit ihrer Uraufführung bei den Theaterspielen im Athener Archiv aufbewahrt wurden. Die Botschafter des Pharaos liehen sich die wertvollen Schriftrollen aus, um von ihren akribischen Abschreibern Kopien fertigen zu lassen. Athens Behörden verlangten ein Wucherpfand von fünfzehn Talenten Silber, nach heutigem Maß einige Millionen Dollar. Die Ägypter zahlten, bedankten sich devot, schworen den feierlichen Eid, die Leihgabe vor Ablauf von – sagen wir – zwölf Monden zurückzugeben, drohten sich selbst mit schaurigen Flüchen, wenn die Bücher nicht in einwandfreiem Zustand zurückkämen, um sie sich schließlich anzueignen; das Pfand ließen sie verfallen. Athens Stadtoberhäupter mussten die Unverschämtheit ertragen. Die stolze Hauptstadt der Perikles-Zeiten war zur Provinzstadt eines Königreichs geworden, machtlos gegen ein Ägypten, das den Handel mit Getreide dominierte, dem Öl der damaligen Zeit. Alexandria war der bedeutendste Hafen des Landes und neuer Lebensmittelpunkt. Wirtschaftsmächte dieser Größenordnung können Grenzen locker überschreiten. Alle in diese Hauptstadt einlaufenden Schiffe, gleich welcher Herkunft, wurden sofort registriert. Die Zöllner beschlagnahmten jedes Schriftstück an Bord, ließen es auf neue Papyri kopieren, gaben die Kopien zurück und behielten die Originale. Diese gekaperten Bücher wurden mit einer Notiz zur Herkunft (»aus den Schiffen«) in die Bibliotheksregale gestellt.
Wer an der Weltspitze steht, tut keine großen Gefallen. Es hieß, dass Ptolemaios II. Boten zu den Fürsten und Herrschern aller Länder entsandte und in einem versiegelten Brief darum bat, sie mögen ihm doch für seine Sammlung einfach alles schicken: die Werke der Dichter und Prosaschriftsteller, der Redner und Philosophen, der Ärzte und Wahrsager, der Historiker und aller anderen.
Ägypten schickte außerdem – und das war mein Aufmacher für diese Geschichte – Agenten durch die rauen Gefilde und Meere der bekannten Welt, die die Taschen voll und den Auftrag hatten, so viele Bücher wie möglich zu kaufen und jeweils die ältesten Exemplare zu finden. Diese Gier nach Büchern und die dafür gezahlten Preise zogen Schurken und Kopisten an. Sie boten Papyri mit Fälschungen wichtiger Texte an, bürsteten die Rollen auf alt, machten mehrere Werke zu einem, um sie zu verlängern, und erfanden viele weitere clevere Tricks. Irgendein Weiser mit Sinn für Humor hatte Spaß daran, geschickt gefälschte Werke zu schreiben, regelrechte Attrappen, um die Ptolemäer zu locken. Die Titel waren amüsant und wären heute gut zu vermarkten, etwa: »Was Thukydides verschwieg«. Man ersetze Thukydides durch Kafka oder Joyce und stelle sich vor, welches Interesse ein Fälscher mit Fake-Memoiren und Geheimnissen des Autors unterm Arm beim Erscheinen in der Bibliothek wecken würde.
Trotz des leisen Verdachts auf Betrug hatten die Bibliotheksankäufer Angst, ein womöglich wertvolles Buch zu verpassen und die Wut des Pharaos zu riskieren. Von Zeit zu Zeit besichtigte der König die Schriftrollen der Sammlung mit demselben Stolz wie eine Truppenparade. Dabei fragte er Demetrios von Pharos, den Bibliothekar, wie viele Schriften sie schon hätten. Und Demetrios brachte ihn auf den neuesten Stand; es seien bereits mehr als zwanzigmal zehntausend, und er bemühe sich, die fünfhunderttausend in Kürze voll zu machen. Die in Alexandria entfesselte Büchergier entwickelte sich langsam zu leidenschaftlichem Wahn.
Ich wurde in einem Land und zu einer Zeit geboren, wo Bücher leicht zu haben sind. Bei mir zu Hause sind sie überall. In arbeitsintensiven Phasen, wenn ich Dutzende davon aus Bibliotheken leihe, die mich bei diesen Recherchen unterstützen, liegen sie auf Stühlen aufgetürmt oder sogar auf dem Boden. Oder bäuchlings aufgeschlagen, wie Satteldächer auf der Suche nach einem zu schützenden Haus. Derzeit staple ich die Bücher auf der Kopfstütze der Couch, damit mein zweijähriger Sohn keine Seiten zerknittert, und wenn ich mich dann zum Ausruhen hinsetze, spüre ich die Kanten in meinem Nacken. Rechnete man den Preis dieser Bücher zur Miete dazu, nähmen sich die Bücher als ziemlich teure Mitbewohner aus. Doch sie alle machen das Zuhause gemütlicher, von den großen Fotobänden bis hin zu den alten Taschenbüchern mit Klebebindung, die immer zusammenklappen wie Muscheln.
Die Geschichte von den unternommenen Anstrengungen, Reisen und Sanktionen, um die Regale der Bibliothek von Alexandria zu füllen, mag verlockend exotisch erscheinen. Es sind seltsame Begebenheiten, Abenteuer, vergleichbar mit den fabelhaften Seereisen in die Neue Welt, auf der Suche nach Gewürzen. Hier und heute sind Bücher so alltäglich, so althergebracht, dass man ihnen schon den Untergang prophezeit. Zuweilen lese ich in den Zeitungen sogar vom Aussterben der Bücher, die durch elektronische Geräte ersetzt würden und den vielfältigen Unterhaltungsangeboten unterlegen seien. Die größten Unheilsverkünder behaupten, wir stünden kurz vor dem Ende einer Ära, vor einer wahren Apokalypse schließender Buchhandlungen und menschenleerer Bibliotheken. Glaubte man ihnen, stünden Bücher bald in den Vitrinen der ethnologischen Museen, gleich neben den prähistorischen Speerspitzen. Mit diesen Bildern im Kopf wandert mein Blick über die endlosen Reihen von Büchern und Vinyl-Schallplatten daheim, und ich frage mich, ob die liebenswerte alte Welt im Begriff ist zu verschwinden.
Sind wir uns dessen sicher?
Das Buch hat sich im Laufe der Zeit bewährt, es hat sich als Langstreckenläufer erwiesen. Wann immer wir aus dem Traum der Revolutionen oder dem Albtraum der Katastrophen erwachten, war das Buch noch da. Es ist, so sagte Umberto Eco, »ein technisch vollendetes Meisterwerk (wie der Hammer, das Fahrrad oder die Schere), das sich, soviel man auch erfinden mag, nicht mehr verbessern läßt«.
Natürlich ist die Technik potent genug, um die alten Monarchien zu stürzen. Dennoch sehnen wir uns nach verloren gegangenen Dingen – nach Fotos, Datenträgern, vormaligen Jobs, Erinnerungen –, weil alles so schnelllebig ist und so schnell veraltet. Zuerst waren da die Lieder auf den Kassetten, dann die auf VHS aufgenommenen Filme. Erfolglos versuchen wir zu sammeln, was die Technik aus der Mode kommen lässt. Als die DVD herauskam, hieß es, wir hätten das Problem der Archivierung endlich endgültig gelöst, aber schon locken neue, kleiner formatierte Speichermedien, die stets auch die Anschaffung neuer Geräte erfordern. Das Kuriose ist, dass wir ein vor mehr als eintausend Jahren geduldig kopiertes Manuskript noch immer lesen können, ein Video oder eine Diskette von vor wenigen Jahren aber nicht mehr, es sei denn, wir verwahrten all die Generationen von Rechnern und Wiedergabegeräten in den Lagerräumen unserer Häuser wie in einem Museum für Verfall.
Eines sollten wir nicht vergessen: Das Buch ist seit vielen Jahrhunderten unser Verbündeter in einem Krieg, der in keinem Geschichtsbuch steht. Es ist der Kampf um die Bewahrung unserer wertvollen Schöpfung: der Worte, die kaum mehr als nur ein Lufthauch sind; der Fiktionen, die wir erfinden, um dem Chaos einen Sinn zu geben und in ihm zu überleben; die wahren, falschen und immer vorläufigen Erkenntnisse, die wir in den harten Fels unserer Unwissenheit ritzen.
Deshalb habe ich beschlossen, in diese Nachforschungen einzutauchen. Am Anfang waren die Fragen, Unmengen von Fragen: Wann entstanden die ersten Bücher? Welches Geheimnis verbirgt sich hinter den Bemühungen, sie zu vervielfältigen oder zu vernichten? Was ging unterwegs verloren, was wurde gerettet? Warum wurden einige zu Klassikern? Wie viele fielen dem Zahn der Zeit, den Klauen des Feuers, dem Gift des Wassers zum Opfer? Welche Bücher wurden im Zorn verbrannt, welche mit größter Leidenschaft kopiert? Waren es dieselben?
Diese Geschichte ist der Versuch, das Abenteuer jener frühen Bücherjäger fortzuschreiben. Ich möchte sie begleiten auf ihren Reisen, auf ihrer Suche nach verlorenen Manuskripten, nach unbekannten Geschichten und fast verstummten Stimmen. Vielleicht waren diese Kundschafter nur Schergen im Dienste größenwahnsinniger Könige. Vielleicht begriffen sie die Tragweite ihrer Aufgabe gar nicht, fanden sie absurd und murmelten nachts, wenn sie die Glut des Feuers löschten, dass sie es leid seien, ihr Leben für den Traum eines Irren zu riskieren. Sicher wären sie lieber auf eine Mission mit besseren Aufstiegschancen geschickt worden, zur Niederschlagung einer Revolte in der Nubischen Wüste etwa oder zur Inspektion der Beladung von Lastkähnen auf dem Nil. Stattdessen aber suchten sie nach der Spur von Büchern wie nach einem verstreuten Schatz und legten damit, nichtsahnend, das Fundament unserer Welt.
IGriechenland denkt in die Zukunft
Die Stadt der Freuden und Bücher
1
Die Kaufmannsfrau ist jung und langweilt sich, und sie schläft allein. Zehn Monate ist es nun her, dass ihr Mann von der Mittelmeerinsel Kos in See gestochen ist, mit Kurs auf Ägypten, und seitdem ist nicht ein Brief von ihm gekommen. Sie ist siebzehn, hat noch keine Kinder und kann es kaum ertragen, allein im Frauentrakt herumzusitzen und darauf zu warten, dass etwas passiert. Das Haus zu verlassen steht außer Frage, es soll ja kein Gerede entstehen. Und so bleibt nicht viel zu tun. Am Anfang fand sie es noch unterhaltsam, die Sklavinnen zu schikanieren, aber ihre Tage füllt das bei Weitem nicht aus. Umso mehr freut sie sich, wenn andere Frauen zu Besuch kommen. Es spielt keine große Rolle, wer an die Haustür klopft, sie sehnt sich einfach verzweifelt nach Ablenkung, nach Leichtigkeit in den bleiernen Stunden.
Eine Sklavin kündigt die alte Gyllis an. Die Kaufmannsfrau strahlt, das verspricht ein wenig Kurzweil: Ihre alte Amme Gyllis nimmt kein Blatt vor den Mund und ist auf lustige Weise vulgär.
»Mütterchen Gyllis, du warst seit Monaten nicht bei mir.«
»Ach, du weißt ja, Tochter, ich hab’s weit und kaum noch so viel Kraft wie eine Fliege.«
»Also bitte«, sagt die Kaufmannsfrau, »du hast noch Kraft genug, um mehr als einen so zu umarmen, dass er’s spürt.«
»Mach du dich nur lustig«, erwidert Gyllis, »aber das bleibt euch jungen Hühnern vorbehalten.«
Nach ein paar klugen Einleitungsworten lächelt die alte Frau verschmitzt und gibt endlich preis, was sie zu ihrem Besuch veranlasst. Ein kräftiger, gutaussehender junger Mann, zweimaliger Olympiasieger im Ringkampf, hat ein Auge auf die Kaufmannsfrau geworfen, er kommt fast um vor Begierde und möchte ihr Liebhaber werden.
»Jetzt werd nicht gleich sauer, hör dir erst mal seinen Vorschlag an. Dem steckt die Leidenschaft wie ein Stachel im Fleisch. Gönn dir doch ein paar schöne Stunden mit ihm. Oder hast du vor, hier immer nur Däumchen zu drehen?«, sucht Gyllis sie zu locken. »Ehe du dich’s versiehst, bist du alt, und deine Jugendfrische ist nur noch Staub und Asche.«
»Ach, sei still …«
»Was glaubst du, was dein Mann in Ägypten treibt? Er schreibt dir keine Briefe, hat keinen Gedanken für dich übrig, bestimmt kühlt er die Lippen schon an einem anderen Pokal.«
Um den letzten Widerstand der jungen Frau zu brechen, malt Gyllis ihr in beredten Worten aus, was Ägypten und ganz besonders Alexandria dem fernen, undankbaren Gemahl zu bieten haben: Reichtum, ein durchgehend warmes, sinnenfrohes Klima, Sporthallen, Schauspiel, massenhaft Philosophen, Bücher, Gold und Wein, dazu hübsche Knaben und so viele bezaubernde Frauen, wie Sterne am Himmel glühen.
Ich übersetze hier frei den Anfang eines kurzen griechischen Theaterstücks, das im 3. Jahrhundert v. Chr. verfasst wurde und einen intensiven Eindruck vom Alltagsleben vermittelt.
Kleine Werke wie dieses kamen vermutlich nicht zur Aufführung, es sei denn als dramatisierte Lektüre. Humoristisch, zuweilen schelmisch, öffnen sie Fenster zu einer Welt jenseits der gesellschaftlichen Regeln, in der sich verprügelte Sklaven und grausame Herren tummeln, Gelegenheitsmacher, Mütter, deren heranwachsende Sprösslinge sie an den Rand der Verzweiflung treiben, und sexuell unbefriedigte Frauen. Gyllis ist eine der ersten Kupplerinnen der Literaturgeschichte, eine professionelle Gelegenheitsmacherin, die alle Kniffe ihres Metiers kennt und geradewegs auf die größte Schwachstelle ihrer Opfer zielt: die universelle Angst vor dem Alter. Doch trotz ihres grausamen Talents wird Gyllis dieses Mal scheitern. Der Dialog endet mit der liebevollen Schelte der jungen Frau, die ihrem abwesenden Mann treu bleibt oder, wer weiß, vor den erheblichen Risiken eines Ehebruchs zurückschreckt. »Ist dir das Hirn weich geworden?«, fragt die Kaufmannsfrau, tröstet Gyllis aber auch, indem sie ihr einen Schluck Wein anbietet.
Neben seinem Humor und der Frische des Tons ist der Text insofern interessant, als er uns einen Blick auf die gewöhnlichen Leute erlaubt, die zur damaligen Zeit in Alexandria lebten, der Stadt der Freuden und Bücher, der Metropole der Erotik und des Wortes.
2
Die Legende von Alexandria hörte nicht auf zu wachsen. Zwei Jahrhunderte nach dem Dialog zwischen Gyllis und der jungen Frau, die sie in Versuchung führen will, wird Alexandria zum Schauplatz eines der größten erotischen Mythen überhaupt: der Liebesgeschichte von Kleopatra und Marcus Antonius.
Als Marcus Antonius zum ersten Mal nach Alexandria kam, war Rom zwar das Zentrum des größten Reichs im Mittelmeerraum, aber doch nur ein Labyrinth aus dunklen, verschlammten Straßen. Auf einmal fand er sich in einer berauschenden Stadt wieder, deren Größe von Palästen, Tempeln, Boulevards und Denkmälern unterstrichen wurde. Die Römer, die sich ihrer Militärmacht sicher waren, fühlten sich als die Herren der Zukunft, aber mit der Anziehungskraft einer goldenen Vergangenheit und des dekadenten Luxus, der sie dort umgab, konnten sie nicht mithalten. In einer Mischung von Erregung, Stolz und taktischem Kalkül gingen der mächtige General und die letzte Königin Ägyptens eine politische und sexuelle Allianz ein, die für die traditionsbewussten Römer ein Skandal war. Eine noch größere Provokation waren die Gerüchte, Marcus Antonius plane, die Hauptstadt des Imperiums nach Alexandria zu verlegen. Hätte das Paar tatsächlich die Macht im Römischen Reich errungen, so würden wir heute vielleicht in Massen nach Ägypten reisen und uns in der dortigen Ewigen Stadt fotografieren lassen, vor ihrem Colosseum mitsamt den Marktplätzen im Hintergrund.
Genau wie ihre Stadt verkörpert Kleopatra die ganz besondere Verbindung alexandrinischer Kultur und Sinnlichkeit. Plutarch zufolge war Kleopatra keine große Schönheit, nach der sich die Leute auf der Straße umgedreht hätten. Dafür besaß sie Charme, Intelligenz und Wortgewandtheit im Überfluss. Das Timbre ihrer Stimme war so süß, dass keiner, der ihr lauschte, davon loskam. Und ihre Zunge, fährt der Geschichtsschreiber fort, fügte sich an jede Sprache, die sie sich erschließen wollte, wie ein Musikinstrument mit vielen Saiten. Sie war in der Lage, ohne Dolmetscher mit Äthiopiern zu kommunizieren, mit Juden, Arabern, Syrern, Medern und Parthern. Listig und gut informiert, konnte sie im Kampf um die Macht mehrere Teilsiege erzielen, auch wenn sie die entscheidende Schlacht verlor. Leider haben vor allem ihre Feinde über sie berichtet.
Auch in dieser stürmischen Geschichte spielen Bücher eine wichtige Rolle. Als Marcus Antonius sich kurz vor der Weltherrschaft wähnte, überkam ihn der Wunsch, Kleopatra mit einem großen Geschenk zu beeindrucken. Er wusste: Gold, Geschmeide oder ein Festmahl würden in den Augen seiner Geliebten, die es gewohnt war, das alles täglich uneingeschränkt zu genießen, kein Licht des Erstaunens entzünden. So hatte die Königin an einem trunkenen Morgen aus provokanter Prahlerei eine riesige Perle in Essig aufgelöst und wie einen Drink heruntergestürzt. Marcus Antonius entschied sich daher für ein Geschenk, das Kleopatra nicht mit gelangweilter Miene zur Kenntnis nehmen könnte: Er ließ ihr 200000 Bände für die Große Bibliothek zu Füßen legen. In Alexandria waren Bücher Treibstoff für Leidenschaften.
Im 20. Jahrhundert wurden zwei Schriftsteller zu Führern durch die geheimen Winkel der Stadt und fügten dem Mythos von Alexandria ein paar weitere Schichten hinzu. Der griechischstämmige Konstantinos Kavafis war ein unbedeutender Beamter im Ministerium für Öffentliche Bauten der britischen Verwaltung in Ägypten, der in der Abteilung für Wasserwirtschaft arbeitete, ohne jemals aufzusteigen. Nachts jedoch tauchte er in eine Welt der Lüste ein und mischte sich unter die Kosmopoliten und Angehörigen der Halbwelt aus aller Herren Länder. Das Labyrinth der Bordelle von Alexandria, die einzige Zuflucht für seine »streng verbotene und verachtete« Homosexualität, kannte er wie seine Westentasche. Kavafis war ein leidenschaftlicher Leser der Klassiker, Dichter fast nur im Geheimen.
In seinen heute bekanntesten Werken lässt er reale und erfundene Figuren aus Ithaka, Troja, Athen oder Byzanz wiederaufleben. Andere, augenscheinlich persönlichere Gedichte erkunden sein eigenes Reifen zwischen Ironie und innerer Zerrissenheit: die Sehnsucht nach seiner Jugend, das Erlernen der Lust oder das beklemmende Verrinnen der Zeit. Diese thematische Differenzierung ist allerdings eine künstliche. Gelesene und vorgestellte Vergangenheit ging Kavafis ebenso nahe wie seine Erinnerungen. Wenn er durch Alexandria streifte, sah er unter der realen Stadt die abwesende Stadt pulsieren. Obwohl die Große Bibliothek verschwunden war, hingen ihr Echo, ihr Flüstern und Wispern weiter in der Luft. Für Kavafis machte diese große Gemeinschaft von Gespenstern die kalten Straßen, durch die einsam und gequält die Lebenden wandeln, überhaupt bewohnbar.
Die Protagonisten des Alexandria-Quartetts, Justine, Darley und vor allem Balthazar, der behauptet, Kavafis gekannt zu haben, denken immer wieder an ihn zurück, »den alten Dichter der Stadt«. Gleichzeitig erweitern die vier Romane von Lawrence Durrell – einer der englischen Autoren, denen im eigenen Land der Puritanismus und das Klima die Luft abschnürten – den erotischen und literarischen Resonanzraum des Mythos von Alexandria. Durrell lernte die Stadt in den turbulenten Jahren des Zweiten Weltkriegs kennen, als das von britischen Truppen besetzte Ägypten ein Nest von Spionen und Verschwörern war und wie immer im Zeichen der Lüste stand. Niemand hat die Farben Alexandrias und die körperlichen Eindrücke, die der Ort in ihm auslöste, präziser beschrieben als er. Die erdrückende Stille und den hohen Sommerhimmel. Die Tage in sengender Hitze. Das strahlende Blau des Meeres, die Wellenbrecher, die gelben Ufer. Im Landesinneren der Maryut-See, zuweilen so konturenlos wie eine Fata Morgana. Zwischen den Wassern des Hafens und des Sees unzählige Straßen voller Staub, Bettler und Fliegen. Palmen, Luxushotels, Haschisch, Trunkenheit. Die trockene, vor Elektrizität knisternde Luft. Abende in Zitronengelb und Lila. Fünf große Ethnien, fünf Sprachen, ein Dutzend Religionen, das Spiegelbild von fünf Flotten im öligen Wasser. In Alexandria, schreibt Durrell, erwacht das Fleisch zum Leben und rüttelt an den Gitterstäben seines Gefängnisses.
Im Zweiten Weltkrieg erlebte die Stadt schwere Zerstörungen. Im letzten Roman des Quartetts beschreibt Clea eine melancholische Landschaft. Gestrandete Panzer am Meeresufer, die Dinosaurierskeletten gleichen, die großen Kanonen wie umgestürzte Bäume in einem versteinerten Wald, die Beduinen, die sich in Minenfelder verirren. Die Stadt, schon immer ein Ort der Perversionen, schließt er, ähnelt jetzt einem riesigen öffentlichen Pissoir. Nachdem Lawrence Durrell Alexandria 1952 verlassen hatte, kehrte er nie wieder dorthin zurück. Die jahrtausendealten Gemeinschaften von Juden und Griechen flohen nach der Suezkrise, im Nahen Osten endete eine Epoche. Reisende, die heute aus der Stadt zurückkommen, erzählen mir, die kosmopolitische, sinnliche Stadt sei ausgewandert ins Gedächtnis der Bücher.
Alexander: Die Welt ist nicht genug
3
Alexandria gibt es mehr als nur einmal. Eine ganze Reihe von Städten dieses Namens markiert den Vormarsch Alexanders des Großen von der Türkei bis zum Indus. Die verschiedenen lokalen Sprachen haben den ursprünglichen Klang des Namens verändert, doch manchmal hört man die ferne Melodie noch durch. Alexandretta, Iskenderun auf Türkisch. Alexandria von Karmanien, heute Kerman im Iran. Alexandria in Margiana, jetzt Merw in Turkmenistan. Alexandria Eschatê, was so viel heißt wie Alexandria am Ende der Welt, heute Chudschand in Tadschikistan. Alexandria Bukephalos, gegründet im Gedenken an das Pferd, das Alexander von Kindheit an begleitet hatte, später dann Jhelam in Pakistan. Der Krieg in Afghanistan hat uns noch andere antike Alexandrias in Erinnerung gebracht: Bagram, Herat, Kandahar.
Plutarch erzählt, Alexander habe siebzig Städte gegründet. Er wollte ein Zeichen seiner Anwesenheit hinterlassen, so ähnlich wie die Kinder, die ihren Namen an Wände oder Toilettentüren kritzeln (»Ich war hier«, »Ich war hier siegreich«). Für den Eroberer war der Weltatlas die lange Mauer, auf der er ein ums andere Mal seine Signatur hinterließ.
Der Drang, dem Alexander folgte, der Grund für die überbordende Energie, die ihn dazu trieb, einen Eroberungsfeldzug über 25000 Kilometer zu führen, war sein Durst nach Ruhm und Bewunderung. Er glaubte tief und fest an Heldensagen; mehr noch, er lebte und wetteiferte mit den Heroen. Ein obsessives Band verknüpfte ihn mit Achill, dem mächtigsten und gefürchtetsten Krieger der griechischen Mythologie. Schon als Junge hatte Alexander ihn sich ausgesucht, als er von seinem Lehrer Aristoteles in die homerische Dichtung eingeführt wurde, und träumte seither davon, ihm gleichzukommen. Er brachte ihm dieselbe leidenschaftliche Bewunderung entgegen, die heutige Kinder für ihre Sportidole empfinden. Angeblich schlief Alexander immer mit seinem Exemplar der Ilias und einem Dolch unter dem Kissen. Das Bild lässt uns schmunzeln, wir stellen uns einen Jungen vor, der neben seinem offenen Heft mit Fußballbildern eingeschlafen ist und im Traum unter dem enthusiastischen Jubel des Publikums eine Meisterschaft gewinnt.
Nur dass Alexander seine wildesten Erfolgsfantasien Wirklichkeit werden ließ. Die Liste seiner in nur acht Jahren erzielten Eroberungen – Anatolien, Persien, Ägypten, Zentralasien und Indien – katapultiert ihn auf den Gipfel der kriegerischen Glanztaten. Im Vergleich dazu wirkt Achill, der sein Leben bei der zehn Jahre dauernden Belagerung einer einzigen Stadt verlor, wie ein blutiger Anfänger.
Das ägyptische Alexandria wurde, wie könnte es anders sein, aus einem literarischen Traum geboren, einem homerischen Wispern. Im Schlaf sah Alexander, wie ein grauhaariger alter Mann an seine Seite trat. Der rätselhafte Unbekannte rezitierte einige Verse aus der Odyssee, in denen von einer Insel namens Pharos die Rede ist, die umgeben vom Meeresrauschen vor der ägyptischen Küste liegt. Die Insel gab es wirklich, nahe der Schwemmebene, in der sich das Nildelta mit den Wassern des Mittelmeers vereint. Alexander sah in dieser Vision, wie damals üblich, ein Vorzeichen und gründete dort die vorbestimmte Stadt.
Er fand die Gegend wunderschön. Die Sandwüste traf auf die Wüste aus Wasser, zwei einsame Landschaften, endlos, wechselhaft und vom Wind geformt. Also zeichnete er mit Mehl die Umrisse der Stadt auf den Boden, ein nahezu vollkommenes Rechteck; er markierte die Stelle, die für den Hauptplatz vorgesehen war, und bestimmte, welchen Göttern Tempel erbaut und wie die Stadtmauer angelegt werden sollte. Später wurde die kleine Insel durch einen langen Deich mit dem Delta verbunden und erhielt mit dem Leuchtturm von Pharos eines der sieben Weltwunder.
Während der Bau begann, setzte Alexander seinen Weg fort. Zurück blieb eine kleine Bevölkerung aus Griechen, Juden und einigen Hirten, die zuvor in den umliegenden Dörfern gewohnt hatten. Der kolonialen Logik aller Epochen folgend, wurden die ägyptischen Einheimischen zu Bürgern zweiten Ranges erklärt.
Alexander sollte die Stadt nicht wiedersehen. Weniger als ein Jahrzehnt später wurde sein Leichnam dorthin zurückgebracht. Im Jahr 331 v. Chr. jedoch, als er Alexandria gründete, war er vierundzwanzig Jahre alt und fühlte sich unbesiegbar.
4
Er war jung und unbezähmbar. Auf seinem Weg nach Ägypten hatte er das Heer des persischen Königs der Könige zweimal hintereinander geschlagen. Nun sicherte er sich die Macht in der Türkei und Syrien und erklärte sie für vom persischen Joch befreit. Er eroberte den Streifen Palästina und Phönizien; alle Städte ergaben sich ihm widerstandslos, bis auf zwei: Tyros und Gaza. Als sie nach sieben Monaten Belagerung fielen, kannte der Befreier keine Gnade. Die letzten Überlebenden wurden der Küste entlang gekreuzigt – zweitausend Leiber nebeneinander im Todeskampf am Meer. Kinder und Frauen wurden in die Sklaverei verkauft. Den Befehlshaber der gequälten Stadt Gaza ließ Alexander an einen Streitwagen binden und zu Tode schleifen, so wie es in der Ilias Achill mit Hektor getan hatte. Bestimmt gefiel Alexander die Vorstellung, sein eigenes episches Gedicht zu leben, und so imitierte er gelegentlich eine Geste, ein Symbol, eine legendäre Grausamkeit.
Bei anderen Gelegenheiten erschien es ihm als eines Helden würdiger, sich gegenüber den Besiegten großzügig zu zeigen. Als er die Familie des persischen Königs Dareios gefangen nahm, behandelte er die Frauen mit Respekt und verzichtete darauf, sie als Geiseln einzusetzen. Stattdessen gab er Befehl, sie in ihren Unterkünften unbehelligt zu lassen und Kleider und Schmuck nicht anzutasten. Auch gestattete er ihnen, ihre in der Schlacht gefallenen Toten zu bestatten.
Als er das Zelt des Dareios betrat, sah er Gold, Silber und Alabaster, nahm den intensiven Geruch nach Myrrhe und andere Düfte wahr, die schmuckvollen Teppiche, Tische und Schränke, ein Überfluss, wie er ihn am provinziellen Hof seiner Heimat Makedonien nicht kennengelernt hatte. Alexander sagte zu seinen Freunden: »Das ist also wohl das Königsein.« Da brachte man ihm ein Kästchen, den kostbarsten und außergewöhnlichsten Gegenstand in Dareios’ Heerlager, und er fragte seine Männer, welcher Wertgegenstand ihrer Meinung nach am ehesten hineingelegt werden sollte. Jeder trug seine Meinung vor: Gold, Geschmeide, Essenzen, Gewürze, Kriegstrophäen. Alexander schüttelte den Kopf und befahl nach kurzem Schweigen, seine Ilias hineinzulegen, von der er sich niemals trennte.
5
Nie hat er eine Schlacht verloren. Die Mühen der Feldzüge nahm er als einer unter vielen auf sich, ohne Vorrechte zu beanspruchen. Kaum sechs Jahre nachdem er seinem Vater mit fünfundzwanzig auf den makedonischen Thron gefolgt war, hatte er das größte Heer seiner Zeit besiegt und die Schätze des Persischen Reichs in seinen Besitz gebracht. Aber das genügte ihm nicht. Er zog weiter bis ans Kaspische Meer, durchquerte das heutige Afghanistan, Turkmenistan und Usbekistan, erklomm die verschneiten Pässe des Hindukusch und eine Wüste aus trügerischem Sand, bis er den Fluss Oxus erreichte, der heute Amudarja heißt. Danach stieß er in Gegenden vor, die kein Grieche je betreten hatte (nach Samarkand und in den Punjab). Aber er erntete keine glänzenden Siege mehr, sondern rieb sich in einem zermürbenden Guerrillakrieg auf.
Die griechische Sprache hat ein Wort, das Alexanders Obsession beschreibt: póthos. Es bezeichnet das Verlangen nach etwas Abwesendem oder Unerreichbarem, ein Verlangen, das Leid verursacht, weil es unmöglich zu stillen ist. Die Unrast von Verliebten, deren Gefühle nicht erwidert werden, und auch den Kummer von Trauernden, die unerträgliche Sehnsucht nach einem verstorbenen Menschen empfinden. Alexander konnte in seiner Getriebenheit, immer weiter vorzudringen, um der Langeweile und dem Mittelmaß zu entgehen, keine Ruhe finden. Er war noch keine dreißig Jahre alt und fürchtete schon, dass ihm die Welt nicht groß genug sein würde. Was sollte er tun, wenn eines Tages keine Länder mehr zu erobern blieben?
Aristoteles hatte ihn gelehrt, das Ende der Welt liege auf der anderen Seite des Hindukusch, und Alexander wollte diese letzte Grenze erreichen. Der Gedanke, am Rand der Welt zu stehen, zog ihn magisch an. Würde er auf das große Außenmeer stoßen, von dem sein Lehrer ihm erzählt hatte? Würde der Ozean wie ein Wasserfall in einen bodenlosen Abgrund stürzen? Oder wäre das Ende unsichtbar, ein dichter Nebel und ein langsames Ausblenden ins Weiß?
Doch Alexanders Männer, krank und missgelaunt unter dem Monsunregen, weigerten sich, noch weiter nach Indien einzudringen. Sie hatten Nachricht von einem gewaltigen, unbekannten indischen Reich jenseits des Ganges erhalten. Die Welt schien nicht bald enden zu wollen.
Ein Veteran sprach im Namen aller: Unter dem Befehl ihres jungen Königs hatten sie Tausende von Kilometern zurückgelegt, hatten unterwegs mindestens 750000 feindliche Krieger niedergemetzelt. Sie hatten ihre im Kampf gefallenen Freunde begraben müssen. Sie hatten Hunger und Eiseskälte ertragen, hatten Durst gelitten und unter großen Strapazen Wüsten durchquert. Viele waren an unbekannten Krankheiten gestorben wie Hunde am Straßenrand oder waren schrecklich verstümmelt worden. Den wenigen, die überlebt hatten, fehlte die Kraft ihrer Jugend. Jetzt hinkten die Pferde mit schmerzenden Fesseln, und die Wagen, die den Proviant transportierten, blieben in vom Monsun verschlammten Wegen stecken. Selbst die Gürtelschnallen waren rostig geworden, und die Essensvorräte schimmelten von der Feuchtigkeit. Die Männer trugen seit Jahren durchlöcherte Stiefel. Sie wollten zurück nach Hause, wollten ihre Frauen liebkosen und ihre Kinder umarmen, an die sie sich kaum noch erinnern konnten. Sie hatten Heimweh nach dem Land, in dem sie geboren waren. Wenn Alexander darauf bestand, seine Expedition fortzusetzen, so sollte er mit seinen Makedoniern nicht rechnen.
Alexander war erzürnt und zog sich wie Achill am Anfang der Ilias unter Drohungen in sein Zelt zurück. Ein psychologischer Krieg begann. Zunächst verhielten sich die Soldaten still, später wagten sie es, ihren König dafür zu schmähen, dass er die Beherrschung verloren hatte. Sie waren nicht bereit, sich von ihm demütigen zu lassen, nachdem sie ihm die besten Jahre ihres Lebens geschenkt hatten.
Die Spannung hielt zwei Tage lang an. Dann machte das große Heer kehrt und brach in Richtung Vaterland auf. Am Ende hatte Alexander also doch noch eine Schlacht verloren.
Der makedonische Freund
6
Ptolemaios war Alexanders Weggefährte und vertrauter Freund. Wie er stammte er aus Makedonien und hatte zu Ägypten keinerlei persönliche Verbindung. Als Abkömmling einer adeligen, aber unbedeutenden Familie hätte er sich nie träumen lassen, dass er eines Tages Pharao in dem reichen Land am Nil werden sollte, das er mit fast vierzig Jahren erstmals betrat, ohne die Sprache und Sitten des Landes oder dessen komplexe Verwaltungsstrukturen zu kennen. Doch Alexanders Eroberungen und ihre weitreichenden Folgen waren eine der historischen Überraschungen, die kein noch so analytischer Geist voraussieht, bevor sie eintreten.
Obwohl die Makedonier stolz waren, wussten sie, dass der Rest der Welt sie für ein rückständiges, von Stammesstrukturen geprägtes und unbedeutendes Volk hielt. Im Mosaik unabhängiger griechischer Staaten standen sie jedenfalls viele Stufen unter den angesehenen Athenern oder Spartanern. Während die Mehrzahl der hellenischen Stadtstaaten mit ausgeklügelten neuen Regierungsformen experimentierten, hielten sie an der traditionellen Monarchie fest. Und was die Sache noch schlimmer machte: Sie sprachen einen Dialekt, der für die übrigen Griechen schwer zu verstehen war. Als einer ihrer Könige an den Olympischen Spielen teilnehmen wollte, wurde er erst nach sorgfältiger Prüfung zugelassen. Mit anderen Worten, man nahm sie eher widerwillig in die Gemeinschaft der Griechen auf. Für den Rest der Welt existierten sie überhaupt nicht. Damals war der Orient die Wiege der Zivilisation und geschichtlich hell erleuchtet; der Westen dagegen war ein dunkles, wildes Gebiet, in dem Barbaren lebten. Im Atlas der geografischen Wahrnehmungen und Vorurteile befand sich Makedonien am Rand der zivilisierten Welt. Wahrscheinlich wären daher wenige Ägypter in der Lage gewesen, die Heimat ihres zukünftigen Königs auf einer Karte zu finden.
Alexander bereitete dieser geringschätzigen Haltung ein Ende. Er war eine derart mächtige Gestalt, dass ihn alle Griechen als einen der Ihren annahmen. Tatsächlich wurde er mit der Zeit zu einem nationalen Symbol. Als Griechenland über Jahrhunderte unter osmanischer Herrschaft stand, spannen die Griechen Legenden, in denen der große Held Alexander ins Leben zurückkehrte, um sein Vaterland vom fremden Joch zu befreien.
Auch Napoleon stieg als korsischer Hinterwäldler, der Europa eroberte, zum Franzosen ohne Fehl und Tadel auf: Triumphe sind ein Ausweis, gegen den niemand Einwände erhebt.
Ptolemaios blieb stets in Alexanders Nähe. Als langjähriger Gefolgsmann des Prinzen am makedonischen Hof begleitete er ihn bei seinem kometenhaften Aufstieg und war als Mitglied der handverlesenen persönlichen Reiterei des Königs und seiner vertrauten Leibwache bei all seinen Eroberungen dabei. Nach der Meuterei am Ganges erfuhr er die Mühen des Rückwegs, die selbst die schlimmsten Erwartungen übertrafen, die geballten Bedrohungen durch Malaria und Dysenterie, von Tigern, Schlangen und giftigen Insekten. Immer wieder attackierten die rebellischen Stämme am Indus das Heer, das von den Märschen in der feuchten tropischen Hitze erschöpft war. Bei Einbruch des Winters war nur noch ein Viertel der Männer am Leben, die am Indienfeldzug teilgenommen hatten.
Auf all die Siege, Leiden und Verluste folgte im Jahr 324 v. Chr. ein bittersüßer Frühling. Ptolemaios und der Rest der Truppe genossen in der Stadt Susa, im Südwesten des heutigen Irans, eine kurze Rast, als Alexander sie damit überraschte, dass er ein grandioses Fest anberaumte – einschließlich einer Massenhochzeit für ihn und seine Offiziere. Während der spektakulären, fünf Tage anhaltenden Feierlichkeiten verheiratete er achtzig Generäle und Weggefährten mit Frauen, oder wahrscheinlich eher Mädchen, aus der persischen Aristokratie. Er selbst fügte dem Kreis seiner Gattinnen – nach makedonischer Sitte war Polygamie erlaubt – die erstgeborene Tochter des Dareios und eine weitere Frau aus einer mächtigen östlichen Sippe hinzu. In einer theatralischen, wohlkalkulierten Geste bezog er seine Truppen in die Zeremonie mit ein. Zehntausend Soldaten, die sich ebenfalls Frauen aus dem Orient nahmen, erhielten dafür eine königliche Mitgift. Ein vergleichbarer Versuch zur Förderung von Mischehen ist nie wieder unternommen worden. In Alexanders Geist brodelte die Vorstellung eines Reichs, in dem sich die Völker und Kulturen vermischten.
Auch Ptolemaios hatte Anteil an der Massenhochzeit von Susa: Er erhielt die Tochter eines reichen persischen Satrapen zur Frau. Wie den meisten Offizieren wäre ihm womöglich lieber gewesen, für die geleisteten Dienste eine Belobigung zu erhalten und die Erlaubnis, fünf Tage lang über die Stränge zu schlagen. Im Allgemeinen hegten Alexanders Männer nicht den geringsten Wunsch, mit den Persern zu fraternisieren, geschweige denn familiäre Bande zu knüpfen. Schließlich hatten sie deren Verwandte noch bis vor Kurzem auf dem Schlachtfeld niedergemetzelt. In dem neuen Reich zeigten sich erste Spannungen zwischen nationalistischen Tendenzen und dem Ideal einer kulturellen Durchmischung, ein Konflikt, der bald zum Ausbruch kommen sollte.
Alexander blieb nicht die Zeit, seine Vision durchzusetzen. Am Anfang des darauffolgenden Sommers starb er im Alter von zweiunddreißig Jahren in Babylonien an hohem Fieber.
7
Während ein hochbetagter Ptolemaios mit den Zügen von Anthony Hopkins in Alexandria seine Erinnerungen diktiert, gesteht er dem Schreiber ein Geheimnis, das ihn verfolgt und quält: Alexander ist keines natürlichen Todes gestorben. Er selbst und andere Hauptleute haben ihn vergiftet. Der Film Alexander von 2004, unter der Regie von Oliver Stone, macht aus Ptolemaios eine düstere Gestalt, einen griechischen Macbeth, der als loyaler Krieger Alexanders Befehle befolgt, dann aber zu seinem Mörder wird. Am Ende des Spielfilms reißt er sich die Maske ab und zeigt sein wahres Gesicht. Ist es möglich, dass es sich so verhielt? Oder sollen wir denken, dass Oliver Stone wie in JFK mit einem Augenzwinkern auf Verschwörungstheorien anspielt und auf die verbreitete Faszination für ermordete Anführer?
Gewiss, Alexanders makedonische Offiziere waren im Jahr 323 v. Chr. angespannt und verärgert. Zu diesem Zeitpunkt bestand sein Heer bereits mehrheitlich aus Persern oder Indern. Alexander ließ Barbaren inzwischen sogar in die Eliteeinheiten eintreten und hatte einige von ihnen in den Adelsstand erhoben. In seiner obsessiven Orientierung an Homers Lob der Tapferkeit war er darauf aus, die Besten um sich zu scharen, unabhängig von ihrer Herkunft. Für seine alten Waffenbrüder war dieses Vorgehen ein Affront und ein Ärgernis. Aber konnte das Grund genug sein, um gegen eine tief verankerte Loyalität zu verstoßen und die enormen Risiken einzugehen, die es mit sich brachte, den König zu eliminieren?
Wir werden nie mit Sicherheit erfahren, ob Alexander ermordet wurde oder ob eine Infektion (aufgrund von Malaria oder einer simplen Grippe) seinen erschöpften Körper dahinraffte. Im Laufe seiner Feldzüge war er neunmal schwer verwundet worden und hatte fast unmenschliche Anstrengungen auf sich genommen. In jenen Tagen wurde Alexanders Tod zu einer politischen Waffe, die seine Nachfolger im Kampf um die Macht skrupellos einsetzten, indem sie einander des Königsmords bezichtigten. Das Gerücht vom Giftmord verbreitete sich rasch; es war die schockierendste, dramatischste Version der Ereignisse. Angesichts der wirren Quellenlage aus Pamphleten, gegenseitigen Beschuldigungen und Nachfolgeinteressen stehen die Historiker vor einem unlösbaren Rätsel, und ihnen bleibt nur, die Pros und Kontras der jeweiligen Hypothese abzuwägen.
Ptolemaios als treuer Freund oder möglicher Verräter ist so für immer in Dämmerlicht getaucht.
8
Die zwei Hobbits Frodo und Sam haben die düstere Gegend in den westlichen Bergen von Mordor erreicht, in der die Treppen von Cirith Ungol warten. Um ihre Angst zu bekämpfen, reden sie über ihre unerwarteten Abenteuer. Das alles spielt kurz vor dem abrupten Ende von Die zwei Türme, dem zweiten Teil von J.R.R. TolkiensDer Herr der Ringe. Samweis, dessen größte Freuden auf der Welt eine schmackhafte Mahlzeit und eine tolle Geschichte sind, sagt: »Ich wüsste gern, ob wir jemals in Liedern und Geschichten vorkommen werden. Wir sind natürlich in einer, aber ich meine, in Worte gefasst, weißt du, am Kamin erzählt oder aus einem großen, dicken Buch mit roten und schwarzen Buchstaben vorgelesen, Jahre und Jahre später. Und die Leute werden sagen: ›Lass uns von Frodo und dem Ring hören.‹ Und sie werden sagen: ›Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten.‹«
Das war Alexanders Traum: selbst zur Legende zu werden, in die Literatur einzugehen, um in Erinnerung zu bleiben. Und das hat er geschafft. Sein kurzes Leben ist ein Mythos in Ost und West, im Koran wie in der Bibel wird auf ihn Bezug genommen. In Alexandria entwickelte sich in den Jahrhunderten nach seinem Tod eine fantastische Erzählung über seine Reisen und Abenteuer, die auf Griechisch niedergeschrieben und dann ins Lateinische, ins Syrische und in Dutzende weiterer Sprachen übersetzt wurde. Wir kennen sie unter der Bezeichnung Alexanderroman, und sie kursiert mit zahlreichen Variationen und Auslassungen bis in unsere Tage. So delirant und aberwitzig der Alexanderroman auch ist, einige Gelehrte halten ihn – von gewissen religiösen Texten abgesehen – für das meistgelesene Buch der vormodernen Welt.
Im 2. Jahrhundert fügten die Römer Alexanders Namen den Zusatz Magnus (der Große) hinzu. Die Anhänger von Zoroaster dagegen nannten ihn den Verfluchten. Sie verziehen ihm nie, dass er den Palast von Persepolis in Brand gesetzt hatte, wo die königliche Bibliothek abgebrannt war. So ging unter anderem das heilige Buch der Zoroastrier, das Avesta, in Flammen auf, und die Gläubigen mussten das Werk aus dem Gedächtnis neu aufschreiben.
Alexanders helle und dunkle Seiten, die Widersprüche in seinem Charakter, werden bereits bei den Historikern der Antike deutlich, die ihn in einer ganzen Galerie unterschiedlicher Porträts darstellen. Arrian ist von ihm fasziniert, Curtius Rufus entdeckt einige Schatten, Plutarch kann spannenden Episoden nicht widerstehen, ob dunkel oder hell. Jeder von ihnen fantasiert. Sie lassen Alexanders Biografie in die Fiktion abgleiten, geben ihren schriftstellerischen Instinkten nach, sobald sie eine große Geschichte wittern. Ein Reisender und Geograf der römischen Zeit kommentiert ironisch, denen, die über Alexander schrieben, sei stets das Wunderbare lieber als die Wahrheit.
Die Sichtweise moderner Historiker richtet sich nach dem Ausmaß ihres Idealismus und der Epoche, in der sie schreiben. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts erfreuten sich Helden noch guter Gesundheit; nach dem Zweiten Weltkrieg, dem Holocaust, der Atombombe und der Dekolonisierung sind wir inzwischen skeptischer geworden. Jetzt gibt es Autoren, die Alexander auf die Couch legen und ihm Größenwahn diagnostizieren, Grausamkeit und Gleichgültigkeit gegenüber seinen Opfern. Die Debatte setzt sich immer weiter fort, nuanciert durch neue Empfindlichkeiten.
Mich überrascht und fasziniert dabei, dass ihn die Populärkultur nicht ablegt wie ein Fossil aus anderen Zeiten. Ich bin an den unerwartetsten Orten auf glühende Alexander-Fans gestoßen, die imstande waren, auf einer Serviette die Truppenbewegungen seiner großen Schlachten zu skizzieren. Und die Musik seines Namens hallt weiter nach. Caetano Veloso widmet ihm auf seinem Album Livro das Lied Alexandre, während die britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden mit Alexander the Great einen ihrer emblematischen Songs vorlegte. Bei der Fangemeinde löst dieses Stück eine geradezu religiöse Hingabe aus. Die Band aus Leyton spielt es grundsätzlich nicht live, und unter den Fans geht das Gerücht, dass es erst bei Iron Maidens letztem Konzert erklingen soll. Fast überall auf der Welt nennen die Leute ihre Söhne weiterhin Alexander – oder Sikander, so die arabische Version des Namens – im Gedenken an den Krieger. Jedes Jahr ziert sein Konterfei Millionen von Produkten, die der echte Alexander noch nicht einmal zu benutzen wüsste, von T-Shirts, Krawatten und Handyhüllen bis hin zum Cover von Videospielen.
Alexander, der Jäger der Unsterblichkeit, hat die Legende hinterlassen, von der er träumte. Und dennoch – um es noch einmal mit Tolkien zu sagen –, wenn man mich fragte, welche Geschichte ich am Feuer am liebsten erzählt höre, dann würde ich weder Siege noch Reisen wählen, sondern das außerordentliche Abenteuer der Bibliothek von Alexandria.
9
»Der König ist tot«, notierte ein babylonischer Schreiber auf seiner astrologischen Tafel. Durch Zufall ist uns das Dokument fast unbeschädigt überliefert. Es war der 10. Juni des Jahres 323 v. Chr., und man brauchte nicht in den Sternen zu lesen, um zu erkennen, dass sich gefährliche Zeiten anbahnten. Alexander hinterließ zwei labile Erben: einen Halbbruder, den alle für mehr oder minder geistesschwach hielten, und ein noch ungeborenes Kind im Bauch von Roxane, einer seiner drei Ehefrauen. Der babylonische Schreiber, der sich in der Geschichte und den monarchischen Gepflogenheiten auskannte, mag an jenem unheilschwangeren Abend über die Wirren von Nachfolgefragen nachgegrübelt haben, die undurchsichtige, grausame Kriege auslösen. Das jedenfalls befürchteten damals viele, und genau so trat es auch ein.
Nicht lange, und die Bluternte nahm ihren Lauf. Roxane ließ die anderen beiden Witwen Alexanders ermorden, um sicherzustellen, dass ihr Kind keine Konkurrenten haben würde. Die mächtigsten makedonischen Generäle erklärten einander den Krieg. Binnen einiger Jahre fielen sämtliche Mitglieder der königlichen Familie kaltblütigen Mordtaten zum Opfer: der geistesschwache Halbbruder, Alexanders Mutter, seine Frau Roxane und ihr Sohn, der keine zwölf Jahre alt wurde. Währenddessen fiel das Reich auseinander. Seleukos, einer von Alexanders Offizieren, verkaufte die indischen Eroberungen an einen örtlichen Fürsten. Er ließ sich dafür mit stolzen fünfhundert Kriegselefanten bezahlen, die er alsbald im Kampf gegen seine makedonischen Rivalen zum Einsatz brachte. Söldnerheere traten jahrzehntelang in den Dienst dessen, der sie am besten bezahlte. Nach anhaltenden Schlachten, Gewalttaten, Racheakten und vielen, vielen Toten blieben drei Kriegsherren übrig: Seleukos in Asien, Antigonos in Makedonien und Ptolemaios in Ägypten. Von ihnen starb Ptolemaios als Einziger eines natürlichen Todes.
Er hatte sich in Ägypten niedergelassen und sollte dort den Rest seines Lebens verbringen. Jahrzehntelang bekämpften er und seine früheren Gefährten einander in den Diadochenkriegen bis aufs Blut. Doch hielt er sich auf dem Thron und versuchte, sobald ihm die internen Zwistigkeiten der Makedonier eine Atempause verschafften, das riesige Land kennenzulernen, über das er herrschte. Alles war staunenswert: die Pyramiden; die Ibisse; die Sandstürme; die Wellenbewegung der Dünen; die galoppierenden Kamele; die merkwürdigen Götter mit ihren Tierköpfen; die Eunuchen; die Perücken und rasierten Schädel; die Menschenströme an Festtagen; die heiligen Katzen, die zu töten als Verbrechen galt; die Hieroglyphen; das Palastzeremoniell; die Tempel mit ihrer übermenschlichen Größe; der weitreichende Einfluss der Priester; der schwarze, schlammige Nil, der zäh durch sein Delta zum Meer strömte; die Krokodile; die Ebenen, auf denen sich reiche Ernten von den Gebeinen der Toten nährten; das Bier; die Nilpferde; die Wüste, wo nichts Bestand hat als die Zeit, die alles zerstört; das Einbalsamieren; die Mumien; das Leben im Rhythmus der Rituale; die Liebe zur Vergangenheit; der Todeskult.
Ptolemaios muss sich verwirrt gefühlt haben, desorientiert, abgeschnitten von der Welt. Er konnte kein Ägyptisch, trat bei den Zeremonien gern mal ins Fettnäpfchen und argwöhnte, dass sich die Höflinge über ihn lustig machten. Aber er hatte von Alexander gelernt, wagemutig vorzugehen. Wenn du die Symbole nicht verstehst, denk dir andere aus. Wenn dich Ägypten mit seinem sagenhaften Alter herausfordert, verleg die Hauptstadt nach Alexandria, die einzige Stadt ohne Vergangenheit, und mach sie zum bedeutendsten Zentrum des gesamten Mittelmeerraums. Wenn deine Untertanen Neuem misstrauen, dann sorg dafür, dass alle Kühnheit des Denkens und der Wissenschaft in ihrem Land zusammenfließt.
Ptolemaios wandte große Reichtümer dafür auf, das Museum und die Bibliothek von Alexandria zu errichten.
Gleichgewicht am Rande des Abgrunds: die Bibliothek und das Museum von Alexandria
10
Obwohl nichts dergleichen überliefert ist, erlaube ich mir den kühnen Gedanken, dass die Idee einer Weltbibliothek in Alexanders Kopf entstand. Der Plan hat die Ausmaße seines Ehrgeizes, er scheint geprägt von seinem Durst nach etwas Allumfassendem. »Die Erde«, erklärte Alexander in einem seiner ersten Erlasse, »sehe ich als mein Eigentum.« Sämtliche Bücher zusammenzutragen, die es gab, war eine weitere – symbolische, geistige, friedfertige – Form, die Welt zu besitzen.
Die Leidenschaft des Büchersammlers gleicht der eines Reisenden. Jede Bibliothek ist eine Reise; jedes Buch ist ein Fahrschein mit unbegrenzter Gültigkeit. Alexander zog durch Afrika und Asien, ohne sich von seinem Exemplar der Ilias zu trennen, Historikern zufolge suchte er darin Rat und nährte seine Sehnsucht nach höherer Bedeutung. Die Lektüre eröffnete ihm, wie ein Kompass, Wege ins Unbekannte.
In einer chaotischen Welt ist der Umgang mit Büchern ein Drahtseilakt. Zu diesem Schluss gelangt Walter Benjamin in seinem glänzenden Essay Ich packe meine Bibliothek aus. »Die alte Welt erneuern – das ist der tiefste Trieb im Wunsch des Sammlers, Neues zu erwerben«, schreibt Benjamin. Die Bibliothek von Alexandria war eine magische Enzyklopädie, die das Wissen und die Erzählungen der Antike versammelte, um zu verhindern, dass sie zerstreut würden und verloren gingen. Aber sie sollte auch ein neuer Raum sein, von dem aus Wege in die Zukunft führten.
Zuvor hatte es Privatbibliotheken gegeben, spezialisiert auf Themen, die ihren Besitzern Nutzen boten. Selbst diejenigen, die zu größeren Schulen oder Berufsvereinigungen gehörten, waren nur ein Instrument im Dienst von deren ureigenen Bedürfnissen. Die Vorgängerbibliothek, die der von Alexandria am nächsten kam – die von Assurbanipal in Ninive, im Norden des heutigen Irak –, war für den persönlichen Gebrauch des Königs bestimmt. Die vielfältige und immens gut ausgestattete Bibliothek von Alexandria dagegen enthielt Bücher zu allen möglichen Themen, geschrieben in jedem Winkel der bekannten Welt. Ihre Tore standen jedem offen, den es nach Wissen verlangte, Gelehrten jeglicher Herkunft und allen, die ihre literarischen Ambitionen bewiesen hatten. Sie war die erste Bibliothek ihrer Art und diejenige, die dem Ziel am nächsten kam, sämtliche damals verfügbaren Bücher zu vereinen.
Außerdem kam sie dem Ideal eines kulturell durchmischten Reichs nahe, wie Alexander es erträumt hatte. Der junge König, der drei Frauen aus der Fremde geheiratet und mit ihnen Kinder gezeugt hatte, die halbe Barbaren waren, beabsichtigte dem Historiker Diodor zufolge, einen Teil des Volkes von Europa nach Asien zu verpflanzen und umgekehrt, um eine Gemeinschaft aus freundschaftlichen und familiären Banden zwischen den zwei Kontinenten zu errichten. Sein plötzlicher Tod hinderte ihn daran, sein Deportationsprojekt zu vollenden, diese merkwürdige Mischung aus Gewalt und Verbrüderungswünschen.
Die Bibliothek öffnete sich der ganzen weiten Welt. Sie schloss die wichtigsten Werke aus anderen Sprachen ein, die ins Griechische übersetzt wurden. Ein Gelehrter aus Byzanz schrieb über jene Zeit: »Aus jedem Volk wurden Weise gewählt, die nicht nur die eigene Sprache beherrschten, sondern auch über hervorragende Griechischkenntnisse verfügten; allen Gruppen wurden ihre jeweiligen Texte anvertraut und so von allem eine Übersetzung gefertigt.« Dort entstand die griechische Version der jüdischen Tora, die als Septuaginta bekannt ist. Die Übersetzung der Zoroaster zugeschriebenen Schriften aus dem Persischen, mehr als zwei Millionen Verse, galt noch Jahrhunderte später als denkwürdiges Unternehmen. Ein ägyptischer Priester namens Manetho stellte für die Bibliothek eine Liste der pharaonischen Dynastien und ihrer Errungenschaften seit mythischer Zeit bis zur Eroberung durch Alexander zusammen. Um dieses Kompendium der ägyptischen Geschichte auf Griechisch schreiben zu können, suchte, konsultierte und exzerpierte er Originaldokumente, die in Dutzenden von Tempeln aufbewahrt wurden. Ein anderer zweisprachiger Priester, Berossos, ein Kenner der Keilschriftliteratur, übertrug die babylonischen Traditionstexte ins Griechische. Natürlich konnte in der Bibliothek eine Abhandlung über Indien nicht fehlen, verfasst von einem griechischen Gesandten auf Grundlage örtlicher Quellen am Hof von Pataliputra im Nordosten Indiens an den Ufern des Ganges. Nie zuvor war ein Übersetzungsprojekt von solcher Reichweite angegangen worden.
Die Bibliothek ließ den besseren Teil von Alexanders Traum Wirklichkeit werden: seine Universalität, seinen Wissensdrang, seine ungewöhnliche Sehnsucht nach Verschmelzung. In den Regalen von Alexandria wurden die Grenzen abgeschafft, und dort lebten die Worte der Griechen, Juden, Ägypter, Perser und Inder endlich in Ruhe zusammen. Dieses geistige Territorium war vielleicht der einzige Raum, der sie alle willkommen hieß.
11
Auch Borges stand im Bann des Gedankens, die Gesamtheit aller Bücher umfassen zu können. Seine Erzählung Die Bibliothek von Babel führt uns in eine wundersame Bücherwelt, das vollständige Labyrinth der Träume und Wörter. Doch wird uns klar, dass dieser Ort etwas Beunruhigendes hat. Wir erleben, wie unsere Fantasien sich albtraumhaft färben, verwandelt in ein Orakel der Ängste unserer Zeit.
Das Universum (das andere die Bibliothek nennen), schreibt Borges, ist eine Art monströser Bienenstock, den es schon immer gegeben hat. Sie setzt sich aus einer unbegrenzten und vielleicht unendlichen Zahl sechseckiger Galerien zusammen, die über eine spiralförmige Treppe verbunden sind. In jedem Sechseck finden wir Lampen, Regale und Bücher. Links und rechts am Gang befinden sich zwei winzig kleine Kabinette. In dem einen kann man im Stehen schlafen, in dem anderen seine Notdurft verrichten. Darauf beschränken sich alle Bedürfnisse: Licht, Lektüre und Latrinen. In den Korridoren leben sonderbare Beamte, die der Erzähler – wie den Menschen überhaupt – als unvollkommene Bibliothekare definiert. Jeder in dem endlosen geometrischen Bau ist für eine bestimmte Anzahl von Galerien zuständig.
Die Bücher der Bibliothek enthalten alle möglichen Kombinationen der zweiundzwanzig Buchstaben des Alphabets zuzüglich Punkt, Komma und Leerraum, mithin alles, was sich irgend ausdrücken lässt: in sämtlichen Sprachen, den erinnerten und den vergessenen. Somit, erklärt uns der Erzähler, steht an irgendeinem Ort in den Regalen die wahrheitsgetreue Darstellung deines Todes. Und die bis ins Einzelne gehende Geschichte der Zukunft, die Autobiografien der Erzengel, der getreue Katalog der Bibliothek, Tausende und Abertausende falscher Kataloge. Die Bewohner des Bienenstocks unterliegen denselben Beschränkungen wie wir: Sie beherrschen nur wenige Sprachen, und ihre Lebenszeit ist kurz. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in den unermesslichen Gängen ein gesuchtes Buch findet oder auch nur eines, das er verstehen kann, verschwindend gering.
Und das ist das große Paradox. Durch die Sechsecke des Bienenstocks streifen Büchersucher, Mystiker, zerstörungssüchtige Fanatiker, selbstmörderische Bibliothekare, Pilger, Götzendiener und Irre. Aber niemand liest. Im erschöpfenden Überfluss zufälliger Seiten erlischt die Lust an der Lektüre. Sämtliche Energien verpuffen beim Suchen und Entziffern.
Wir können Borges’ Geschichte schlicht als ironische Erzählung verstehen, die biblische und bibliophile Mythen verwebt in einer Architektur, die von den Gefängnissen Piranesis oder den endlosen Treppen Eschers inspiriert ist. Und doch fasziniert die Bibliothek von Babel uns Leserinnen und Leser der Gegenwart als prophetische Allegorie der virtuellen Welt, der Maßlosigkeit des Internets, dieses gigantischen Netzes aus Informationen und Texten, gefiltert durch die Algorithmen der Suchmaschinen, in dem wir uns verirren wie Gespenster in einem Labyrinth.
In einem überraschenden Anachronismus sagt Borges die heutige Welt voraus. Die Erzählung enthält gewiss eine Intuition unserer Zeit: Das elektronische Netz, das, was wir jetzt World Wide Web nennen, ist eine Kopie der Funktionsweise von Bibliotheken. In den Ursprüngen des Internets lebte der Traum, ein globales Gespräch anzuregen. Dafür musste man Routen abstecken, Straßen bauen, Luftwege für Worte. Jeder Text benötigte eine Referenz – einen Link –, damit ihn die Lesenden von jedem Computer in jedem Winkel der Welt finden könnten. Timothy John Berners-Lee, der mit seinen Konzepten wesentlich zur Struktur des WWW beigetragen hat, bezog seine Inspiration aus dem geordneten und flexiblen Raum der öffentlichen Bibliotheken. Indem er deren Mechanismen nachahmte, ordnete er jedem virtuellen Dokument eine ganz bestimmte Adresse zu, durch die es von anderen Computern aufgerufen werden konnte. Diese universelle Adresse – fachsprachlich URL – ist das genaue Äquivalent der Signatur in einer Bibliothek. Später ersann Berners-Lee das Übertragungsprotokoll für Hypertext, bekannt unter dem Kürzel http; es entspricht einem der Leihzettel, die man ausfüllt, um sich von einem Bibliothekar das gewünschte Buch bringen zu lassen. Das Internet ist eine – vertausendfachte, schier endlose, ätherische – Emanation der Bibliotheken.
Das Gefühl, die Bibliothek von Alexandria zu betreten, stelle ich mir so ähnlich vor wie das, was ich empfand, als ich zum ersten Mal im Internet surfte: die Überraschung, das schwindelerregende Gefühl unermesslicher Räume. Mir ist, als beobachtete ich einen Reisenden, der in den Hafen von Alexandria einläuft und mit eiligen Schritten das Bollwerk der Bücher aufsucht – einen ähnlich lesehungrigen Menschen wie mich, überwältigt, fast geblendet von den aufregenden Möglichkeiten der Fülle, die er hinter den Säulen der Bibliothek zu erahnen beginnt. Er in seiner, ich in meiner Zeit, beide wohl mit demselben Gedanken: An keinem Ort waren jemals so viele Informationen versammelt, so viel mögliches Wissen, so viele Erzählungen, durch die sich Angst und Wonne des Lebens erfahren lassen.
12
Kehren wir zurück in eine Vergangenheit, in der die Bibliothek noch nicht gebaut ist. Ptolemaios’ großspurige Vorstellungen von einer griechischen Metropole in Ägypten stießen auf eine eher unschöne Wirklichkeit. Zwei Jahrzehnte nach seiner Gründung war Alexandria eine langsam wachsende Kleinstadt, bevölkert von Soldaten und Seeleuten, einer kleinen Gruppe von Bürokraten, die gegen das Chaos kämpften, und der eigentümlichen Fauna aus cleveren Geschäftsleuten, Gesetzesbrechern, Abenteurern und zungenfertigen Betrügern auf Chancensuche an einem jungfräulichen Ort. Die von einem griechischen Architekten entworfenen schnurgeraden Straßen waren verdreckt und stanken nach Kot. Die Rücken der Sklaven waren mit den Narben von Peitschenhieben übersät, es herrschte eine Atmosphäre wie in einem Western, durchzogen von Gewalttätigkeit, Tatendrang und Plünderergeist. Der tödliche Chamsin, der Wind, der ein paar Jahrtausende später die Truppen Napoleons und Rommels quälen sollte, kam über die Stadt, sobald es Frühling wurde. Aus der Ferne glichen die Stürme am Himmel blutigen Flecken. Später löschte der hereinbrechende Abend das Licht, und der Sturm traf die Stadt und erhob Mauern von Staub, der einem die Sicht und den Atem raubte, in alle Ritzen drang, Hals und Nase austrocknen ließ, die Augen reizte und Wahnsinn, Verzweiflung und Verbrechen säte. Nach Stunden drückenden Wirbelns stürzten die Staubmauern schließlich über dem Meer zusammen, begleitet von einem Aufschluchzen der rauen Luft.
Doch genau an diesem Ort hatte Ptolemaios beschlossen, sich mit seinem gesamten Hof niederzulassen und die besten Wissenschaftler und Schriftsteller der Zeit in ein Ödland am Rande des Nichts zu locken.
Frenetische Bauarbeiten begannen. Auf Ptolemaios’ Geheiß wurde ein Kanal angelegt, der den Nil mit dem Mareotis-See und dem Meer verband. Dazu ließ er einen prächtigen Hafen und den durch einen Deich beschützten Palast am Meer erbauen, eine gewaltige Festung, in die er sich vor Belagerern zurückziehen konnte, eine kleine Verbotene Stadt, zu der nur wenige Zugang haben sollten – der Hort des unverhofften Königs in seiner unwahrscheinlichen Metropole.
Um diese Träume Gestalt annehmen zu lassen, nahm Ptolemaios sehr viel Geld in die Hand. Er hatte sich zwar nicht den größten, wohl aber den einträglichsten Teil von Alexanders Reich gesichert. Ägypten war ein Synonym für Reichtum. An den fruchtbaren Ufern des Nils wuchsen sagenhafte Mengen Korn – das Gut, das die Märkte jener Epoche beherrschte wie heutzutage das Erdöl. Außerdem exportierte Ägypten den gängigsten Beschreibstoff der damaligen Zeit: Papyrus.