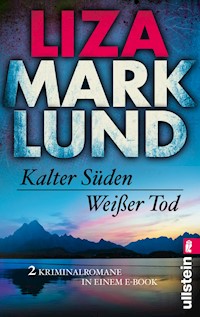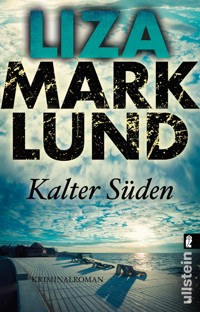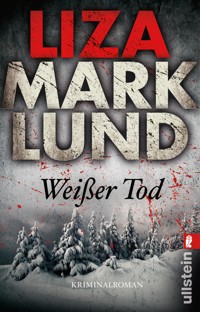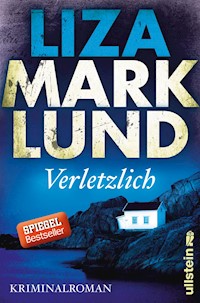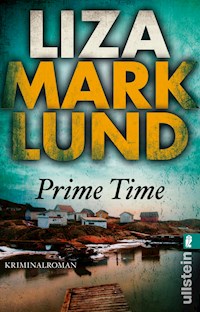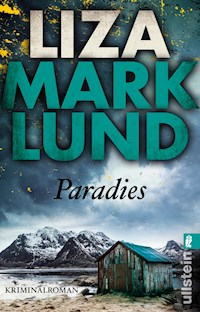
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Ein Doppelmord im Stockholmer Hafen sorgt für fieberhafte Arbeit im Abendblatt, in dessen Redaktion Annika gerade Nachtschicht hat. Während die Kollegen den Fall bearbeiten, macht sich die Nachwuchsjournalistin an die Recherche über eine Organisation namens Paradies, die verfolgten Menschen neue Identitäten verschafft. Doch was als Routinearbeit beginnt, entpuppt sich als Fall mit tödlichen Konsequenzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Annika Bengtzon kämpft um den beruflichen Durchbruch beim „Abendblatt“, sie will endlich als richtige Reporterin arbeiten und entsprechend ernstgenommen werden. Während ihre Kollegen an einem Fall arbeiten, bei dem es um eine verschwundene Ladung geschmuggelter Zigaretten geht, die eine Millionensumme wert ist, nimmt sie einen Anruf entgegen, der ihre Neugier, aber auch ihr Misstrauen weckt. Die private Organisation PARADIES bietet illegalen Einwanderern und anderen Menschen, die verfolgt werden, neue Identitäten. Doch erst als sich im Umfeld dieser Organisation ein Mord ereignet, wird aus der Geschichte ein richtiger Fall. Kann Annika ihren Informationsvorsprung nutzen?
»Liza Marklund ist zweifellos eine Klasse für sich.« Henning Mankell
Die Autorin
Liza Marklund, geboren 1962 in Piteå, arbeitete als Journalistin für verschiedene Zeitungen und Fernsehsender, bevor sie mit der Krimiserie um Annika Bengtzon international eine gefeierte Bestsellerautorin wurde.
Von Liza Marklund sind in unserem Hause bereits erschienen:
In der Reihe „Ein Annika-Bengtzon-Krimi“:
Olympisches FeuerStudio 6ParadiesPrime TimeKalter SüdenWeißer TodJagdVerletzlich (HC-Ausgabe)
Liza Marklund
Paradies
Kriminalroman
Aus dem Schwedischenvon Paul Berf
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-taschenbuch.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen,wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung,Speicherung oder Übertragungkönnen zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Dieser Roman erschien erstmals im Jahr 2002 auf Deutsch.
Neuausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Juli 2016
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016
Alle Rechte für die Übertragung ins Deutsche bei Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
© 2000 by Liza Marklund
Published by agreement with Salomonsson Agency
Titel der schwedischen Originalausgabe: Paradiset (Piratförlaget, Stockholm, 2000)
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Titelabbildung: FinePic®, München, © Stefan Schurr / plainpicture
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-8437-1290-3
PROLOG
Die Zeit ist abgelaufen, dachte sie. So ist es also, wenn man stirbt. Sie schlug mit dem Kopf auf den Asphalt auf, ihr Bewusstsein trübte sich. Die Angst verschwand zusammen mit der Wahrnehmung von Geräuschen. Es herrschte Stille.
Ihre Gedanken waren ruhig und klar. Bauch und Geschlecht pressten sich auf die Erde, Eis und Schotter an Haar und Wange.
Wie eigentümlich doch alles sein konnte, wie wenig man im Grunde vorhersehen konnte. Wer hätte ahnen können, dass es ausgerechnet hier geschehen würde? An einer fremden Küste, hoch im Norden.
Dann sah sie den Jungen wieder vor sich, seine ausgestreckten Arme, empfand das Entsetzen, hörte die Schüsse, wurde von Tränen und dem Gefühl der eigenen Unvollkommenheit erfüllt.
»Verzeih«, flüsterte sie. »Verzeih mir meine Feigheit, meine erbärmliche Unfähigkeit.«
Plötzlich spürte sie wieder den Wind. Er schmerzte, zerrte an ihrer großen Tasche. Die Geräusche kehrten zurück, ihr Fuß tat weh. Sie wurde sich der Kälte und der Feuchtigkeit bewusst, die durch ihre Jeans krochen. Sie war nur gestolpert, nicht getroffen worden. Ihr Kopf leerte sich wieder, bis nur ein einziger Gedanke blieb.
Weg hier.
Sie stemmte sich hoch auf alle viere, der Wind warf sie wieder zu Boden, sie stand auf. Die umstehenden Gebäude machten die Windböen unberechenbar, sie fuhren, vom Meer kommend, die Straße herauf wie unbarmherzige Stockschläge.
Ich muss hier weg. Sofort.
Sie wusste, dass der Mann irgendwo hinter ihr war. Er versperrte ihr den Weg zurück in die Stadt, sie saß fest.
Ich darf nicht im Scheinwerferlicht stehen bleiben. Ich muss fort.
Fort!
Eine neuerliche Windbö verschlug ihr den Atem. Sie schnappte nach Luft, drehte ihr den Rücken zu, noch mehr gelbe Scheinwerfer, die aus all dem Schäbigen Gold machten, wo sollte sie hin?
Sie nahm die Tasche und lief mit dem Wind im Rücken auf ein Gebäude zu, dessen Längsseite parallel zum Wasser verlief. Ein langer Ladekai führte daran vorbei. Der Wind hatte einiges Gerümpel umgeweht, was zum Teufel war das? Eine Treppe? Ein Schornstein! Möbel. Ein gynäkologischer Behandlungsstuhl. Ein Ford-T. Das Cockpit eines Kampfflugzeugs.
Sie schwang sich auf den Kai hinauf, riss die Tasche hoch, kreuzte zwischen Badewannen und Schulbänken hindurch und verkroch sich hinter einem alten Schreibtisch.
Er findet mich, dachte sie. Es ist nur eine Frage der Zeit. Er wird niemals aufgeben.
Sie kauerte sich zusammen wie ein Embryo, schwankend, keuchend, nass von Schweiß und Straßendreck. Begriff, dass sie in die Falle gegangen war. Hier kam sie nicht mehr weg. Er brauchte nur zu ihr zu kommen, den Revolver an ihren Hinterkopf zu setzen und abzudrücken.
Vorsichtig lugte sie an den Schubladen vorbei, konnte aber nichts sehen außer Eis und Lagerhallen, die in gelbes Scheinwerfergold getaucht waren.
Ich muss warten, dachte sie. Ich muss herausfinden, wo er ist. Dann erst kann ich versuchen abzuhauen.
Nach ein paar Minuten taten ihr die Kniekehlen weh. Ober- und Unterschenkel wurden taub, die Fußgelenke brannten, besonders das linke. Sie musste es sich bei ihrem Sturz verstaucht haben. Blut tropfte aus einer Wunde an der Stirn auf den Kai.
Dann sah sie ihn. Er stand an der Kaikante, drei Meter von ihr entfernt, sie sah sein markantes Profil im Dunkeln vor dem gelben Lichtschein. Der Wind trug sein Flüstern zu ihr.
»Aida.«
Sie krümmte sich zusammen und schloss fest die Augen, machte sich klein, zu einem unsichtbaren Tier.
»Aida, ich weiß, dass du hier bist.«
Sie atmete mit offenem Mund und wartete. Der Wind war auf seiner Seite, machte seine Schritte lautlos. Als sie das nächste Mal aufschaute, ging er auf der anderen Seite der breiten Straße am Zaun entlang, die Waffe diskret unter der Jacke in Bereitschaft. Sie atmete schneller, in unregelmäßigen Schüben, ihr wurde schwindlig. Als er um die Ecke und in das blaue Lagerhaus hineinglitt, stand sie auf, sprang auf den Asphalt hinunter und lief. Ihre Füße donnerten, verräterischer Wind, die Tasche schlug gegen den Rücken, sie hatte Haare in den Augen.
Sie hörte den Schuss nicht, spürte nur, wie die Kugel an ihrem Kopf vorbeipfiff, und begann Zickzack zu laufen, schlug abrupte, willkürliche Haken. Ein neues Pfeifen, ein neuer Haken.
Plötzlich endete das Land, und die rasende Ostsee lag vor ihr. Wellen wie Segel, scharf wie Glas. Sie zögerte nur einen Moment.
Der Mann trat an die Kaikante, von der die Frau gesprungen war, und spähte auf das Meer hinaus. Seine Augen verengten sich zu Schlitzen, die Waffe war schussbereit. Vergeblich versuchte er, ihren Kopf zwischen den Wellen auszumachen.
Das würde sie nie schaffen. Es war zu kalt, der Wind war zu stark. Es war zu spät.
Zu spät für Aida aus Bijeljina. Sie war zu groß geworden. Sie war zu einsam.
Er blieb noch einen Moment in der beißenden Kälte stehen. Der Wind schlug ihm entgegen, schleuderte Eisstücke in sein Gesicht. Das Geräusch, das der Anlasser des Scania hinter ihm machte, wurde verweht, fort, nach hinten, drang niemals zu ihm durch. Der Sattelschlepper glitt im Goldschein lautlos, spurlos davon.
TEIL 1
OKTOBER
Ich bin kein böser Mensch
Ich bin ein Produkt meiner Lebensbedingungen und der Umstände. Alle Menschen werden in das gleiche Leben geboren, nur die Voraussetzungen unterscheiden sich: die genetischen, kulturellen, sozialen.
Ich habe getötet, das ist wahr, aber letztlich uninteressant. Die Frage ist vielmehr, ob ein Mensch, der nicht mehr lebt, es überhaupt noch verdient hat, zu leben. Ich kenne meinen Standpunkt, aber er braucht nicht mit dem anderer übereinzustimmen.
Man mag mich gewalttätig finden, was aber nichts mit Bösartigkeit zu tun haben muss. Gewalt ist Macht, genau wie Geld oder Einfluss. Wer sich entschließt, Gewalt als ein Werkzeug zu benutzen, kann dies auch ohne Bösartigkeit tun. Den Preis muss man allerdings immer bezahlen.
Der Griff zur Gewalt ist nicht gratis, du musst deine Seele dafür verpfänden. Dadurch sind die Einsätze unterschiedlich hoch, für mich gab es nicht viel zu verlieren.
Die Leere wird anschließend mit den notwendigen Voraussetzungen gefüllt, um die Gewalt wirklich ausüben zu können, die Bösartigkeit ist eine davon, Verzweiflung eine andere, Rache eine dritte, rasende Wut eine vierte, und bei den Kranken die Lust.
Und ich bin kein böser Mensch.
Ich bin ein Produkt meiner Lebensbedingungen und der Umstände.
SONNTAG, 28. OKTOBER
Der Securitas-Wachmann war aufmerksam. Überall konnte man die Verwüstungen durch den nächtlichen Orkan sehen – umgestürzte Bäume, Blechteile von Lagerhallen und Dächern, verstreute Waren.
Als er den Freihafen erreichte, bremste er abrupt. Auf dem breiten Platz direkt am Meer lag das Innere eines Flugzeugcockpits, medizinische Ausrüstung, Teile eines Badezimmers. Es dauerte ein paar Sekunden, bis der Wachmann begriff, was er betrachtete: Wrackteile aus dem Requisitenvorrat des schwedischen Fernsehens.
Die toten Menschen sah er erst, als er den Motor abgestellt und den Gurt gelöst hatte. Seltsamerweise war er weder entsetzt noch schockiert. Die schwarz gekleideten Leichen lagen vor der beschädigten Treppe aus einer längst abgesetzten Fernsehserie. Noch ehe er aus dem Wagen gestiegen war, wusste er, dass die zwei Männer ermordet worden waren. Dazu bedurfte es keiner größeren Kombinationsfähigkeit. Die Schädel der beiden fehlten zum Teil, und etwas Klebriges war stattdessen auf den vereisten Asphalt gelaufen.
Ohne sich Gedanken über seine eigene Sicherheit zu machen, verließ der Wachmann sein Auto und ging zu den Männern, die nur wenige Meter von ihm entfernt lagen. Seine Reaktion ließ sich am ehesten noch mit Verwunderung vergleichen. Die Leichen sahen äußerst seltsam aus, wie kleine Brüder von Marty Feldman. Die Augen waren ihnen halb aus den Höhlen getreten, die Zungen hingen heraus, beide hatten eine kleine Markierung auf dem Kopf, und beiden fehlte ein Ohr und, wie gesagt, große Teile von Hinterkopf und Hals.
Der Lebende betrachtete die beiden Toten eine Weile, wie lange, konnte er später nicht genau sagen, bis eine verspätete Sturmbö zwischen den Silos der Raiffeisenkooperative hindurchfuhr und ihn zu Boden warf. Er fing sich mit den Armen ab und setzte dabei unabsichtlich die rechte Hand in die ausgelaufene Hirnsubstanz einer der Leichen. Das Gefühl des kalten, zähflüssigen Breis zwischen den Fingern löste bei dem Lebenden augenblicklich heftige Übelkeit aus. Er erbrach sich auf die Stoßstange seines Autos und wischte die klebrige Masse anschließend wie wild an den Plüschbezügen des Fahrersitzes ab.
Um 05.31 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Polizei auf Kungsholmen in Stockholm vom Freihafen aus alarmiert. Drei Minuten später erreichte die Nachricht das Abendblatt. Es war Leif, der anrief.
»Wagen 1120 und zwei Krankenwagen sind unterwegs zum Värtanhafen.«
Um diese Uhrzeit, neunundvierzig Minuten nach Redaktionsschluss und sechsundzwanzig Minuten bevor die Zeitung in Druck ging, herrschte in der Redaktion wie gewöhnlich ein konzentriertes und kreatives Chaos. Die Redakteure hackten mit rot unterlaufenen Augen die letzten Überschriften in den Computer, gaben Formulierungen in Aufmachern und Bildtexten den letzten Schliff und berichtigten Satzfehler. Jansson, der Nachtchef, war damit beschäftigt, Umbrüche zu prüfen und Seiten auf der neuen elektronischen Datenautobahn zur Druckerei zu schicken.
Die Mitarbeiterin, die in dieser Situation die Informationen von außen entgegennehmen musste, war die Textredakteurin der Nachtredaktion, Annika Bengtzon.
»Das heißt?«, fragte sie und machte sich in Windeseile Notizen auf einem Post-it-Zettel.
»Mindestens zwei Morde«, erwiderte Leif und brach das Gespräch ab, um die Neuigkeit auch noch bei der nächsten Zeitung als Erster verkünden zu können. Wer als Zweiter mit einem Tipp kam, erhielt kein Geld.
Annika stand auf und ließ gleichzeitig den Hörer auf die Gabel fallen.
»Zwei Tote im Värtan, möglicherweise Mord, nicht bestätigt«, sagte sie zu Janssons Hinterkopf. »Willst du es in der überregionalen Ausgabe bringen?«
»Nein«, sagte der Hinterkopf.
»Soll ich es Carl und Bertil geben?«, erkundigte sie sich.
»Ja«, antwortete der Hinterkopf.
Sie ging zum Reporterstand, den gelben Zettel wie eine Flagge an ihrem Zeigefinger festgeklebt.
»Jansson möchte, dass du dir das mal anschaust«, sagte sie und zielte mit dem Finger auf den Reporter.
Carl Wennergren zog den Zettel mit einem leicht angeekelten Gesichtsausdruck ab.
»Bertil Strand ist gekommen, falls ihr rausfahren müsst«, sagte sie.
»Er ist unten im Fotolabor.«
Annika machte auf dem Absatz kehrt und ging weg, ohne Carls Antwort abzuwarten. Die beiden hatten nicht gerade das herzlichste Verhältnis. Sie ließ sich auf ihren Stuhl fallen, ihr Kopf war müde. Es war eine sehr anstrengende Nacht gewesen, mit zahlreichen Paraden auf der Torlinie. Ein Orkan war am gestrigen Abend über Schonen hinweggefegt und dann Richtung Norden über das ganze Land gezogen. Das Abendblatt hatte sich viel Mühe gegeben, den Verlauf des Unwetters zu verfolgen, und war dabei ausgesprochen erfolgreich gewesen. Sie hatten es geschafft, Reporter und Fotografen mit dem letzten Flug zum Malmöer Flughafen Sturup zu bringen, um die Redaktion in Malmö zu verstärken. Die Journalisten in Växjö und Göteborg hatten die ganze Nacht durchgearbeitet, unterstützt von einer ganzen Heerschar freier Mitarbeiter für Text und Fotos. Das ganze Material war auf dem Nachtdesk gelandet, und Annikas Aufgabe war es gewesen, die einzelnen Artikel zusammenzustellen und zu strukturieren, was bedeutete, dass sie jeden einzelnen von ihnen umschreiben musste, damit sie zueinander und in den Zusammenhang passten. Trotzdem war ihr Name in der Zeitung nirgendwo zu lesen, wenn man einmal von der Faktenübersicht über Orkane absah, die sie schon im Voraus erarbeitet hatte. Sie war Textredakteurin, eine von all jenen anonymen Journalisten, die im Hintergrund arbeiteten.
»Verdammter Mist!«, schnauzte Jansson plötzlich. »Das dämliche Gelb im Bild auf der ersten Seite ist nicht rübergegangen. Verdammter Mist …«
Er warf sich in Richtung Fotodesk und rief nach dem Fotoredakteur Pelle Oscarsson. Annika lächelte matt, du schöne, neue Welt. Wenn man den Zukunftspropheten Glauben schenkte, würde die digitale Technik alles schneller, sicherer, einfacher machen. In Wirklichkeit wohnte aber ein kleiner Teufel in der ISDN-Leitung zur Druckerei, der in unregelmäßigen Abständen eine der Farbdateien schluckte, meistens die gelbe. Wenn der Fehler nicht entdeckt wurde, führte dies zu äußerst eigenartigen Fotos in der Zeitung. Jansson behauptete, der Farbfresser sei der gleiche Teufel, der auch in seiner Waschmaschine wohne und andauernd einen Strumpf esse.
»ISDN«, schnaubte der Nachtchef hinter seinem Platz, nachdem er die Katastrophe abgewendet und das Bild erneut losgeschickt hatte. »Ich Schluck Die Nachricht.«
Annika packte die Sachen auf ihrem Tisch zusammen.
»Ist doch alles ganz gut geworden, oder?«, fragte sie.
Jansson ließ sich auf seinen Stuhl fallen und steckte sich eine unangezündete Blend zwischen die Zähne.
»Du hast verdammt gut gearbeitet heute Nacht«, sagte er und nickte anerkennend. »Ich habe die Originaltexte gesehen. Du hast sie echt klasse zusammengestrickt.«
»Es ist ganz okay geworden«, meinte Annika verlegen.
»Was sind das für Tote im Hafen?«
Annika zuckte mit den Schultern.
»Keine Ahnung. Soll ich mich mal umhören?«
Jansson stand auf und ging zur Raucherecke.
»Tu das«, sagte er.
Sie fing mit der Notrufzentrale an.
»Wir haben zwei Krankenwagen geschickt«, bestätigte der dortige Einsatzleiter.
»Keine Polizeileichenwagen?«, wollte Annika wissen.
»Darüber haben wir nachgedacht, aber es war ein Wachmann, der anrief. Wir haben Krankenwagen geschickt.«
Annika machte sich Notizen. Leichenwagen wurden nur dann geschickt, wenn es völlig sicher war, dass die Opfer tot waren. Nach den geltenden Regeln durften Polizisten erst dann Polizeileichenwagen anfordern, wenn der Kopf des Opfers vom Körper abgetrennt war.
Es war nicht leicht, bei der Einsatzzentrale der Polizei durchzukommen. Es dauerte mehrere Minuten, ehe jemand an den Apparat ging. Dann dauerte es weitere fünf Minuten, bis der Dienst habende Beamte sich freimachen konnte. Als er schließlich den Hörer ergriff, waren seine Auskünfte klar und präzise.
»Wir haben zwei Tote«, sagte er. »Zwei Männer. Erschossen. Wir können noch nicht sagen, ob es sich um Mord oder Selbstmord handelt. Sie müssen später noch einmal anrufen.«
»Sie wurden im Freihafen gefunden«, sagte Annika schnell. »Was sagt Ihnen das?«
Der Wachhabende zögerte.
»Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Schlussfolgerungen ziehen«, meinte er. »Aber Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.«
Als sie den Hörer aufgelegt hatte, wusste sie, dass der Doppelmord die Zeitung für mehrere Tage dominieren würde. Aus irgendeinem Grund waren zwei Morde nicht nur doppelt so aufregend wie ein Mord, sondern noch viel sensationeller.
Sie überlegte, ob sie sich einen Becher Kaffee holen sollte. Sie hatte Durst und war schlapp, er würde ihr gut tun. Aber Koffein um diese Zeit des Tages würde sie bis weit in den Vormittag hinein hellwach an die Decke starren lassen, während ihr die Müdigkeit in allen Knochen steckte.
Ach, was soll’s, dachte sie und ging zum Automaten.
Sie setzte sich an ihren Platz am Nachtdesk und legte die Füße auf den Schreibtisch.
Ein kleiner Doppelmord im Freihafen, so kann es gehen.
Sie blies auf den Kaffee.
Dass die Opfer erschossen worden waren, wies darauf hin, dass hier keine Unglücksbrüder im Suff aneinander geraten waren. Penner brachten sich gegenseitig mit Messern, Flaschen, Fäusten, Tritten oder Stößen vom Balkon um. Wenn sie an Waffen herangekommen wären, hätten sie sie verhökert und sich Schnaps dafür gekauft.
Sie kippte das Getränk herunter, warf den Plastikbecher weg, ging auf die Toilette und trank Wasser.
Zwei Männer, das ließ nun wirklich nicht auf Mord und darauf folgenden Selbstmord schließen, nicht im Freihafen während eines Orkans. Eifersucht schied als Motiv aller Voraussicht nach aus, was bedeutete, dass Spekulationen über journalistisch etwas ergiebigere Motive Tür und Tor geöffnet waren. Eine Abrechnung unter Kriminellen, von Motorradgangs über verschiedene Mafiagruppierungen bis hin zu wirtschaftlichen Syndikaten. Politische Motive. Internationale Verwicklungen.
Annika ging zu ihrem Platz zurück. Eines wusste sie mit Sicherheit: Sie würde nicht einmal ansatzweise in die Nähe dieser Morde gelangen. Andere würden den Fall für das Abendblatt verfolgen. Sie holte ihre Jacke.
An den Wochenenden gab es keine spezielle Morgenredaktion, sodass Jansson bleiben würde, bis alle Vorortauflagen auch in Druck gegangen waren. Annika hörte um sechs Uhr auf.
»Ich hau jetzt ab«, sagte sie, als der Nachtchef an ihr vorbeikam. Er sah todmüde aus, hätte gern gesehen, dass sie noch blieb.
»Willst du nicht auf die Zeitung warten?«, fragte er.
Die Zeitungsstöße kamen eine Viertelstunde nach Andruck mit einem Botenwagen aus der Druckerei. Annika schüttelte den Kopf, bestellte sich ein Taxi, stand auf, zog Jacke, Schal und Handschuhe an.
»Könntest du heute Abend vielleicht ein bisschen früher kommen?«, rief Jansson ihr hinterher. »Um nach dieser Orkanhölle aufzuräumen?«
Annika hob ihre Tasche hoch und zuckte mit den Schultern.
»Wer hat schon ein Privatleben?«
Thomas Samuelsson berührte leicht den Bauch seiner Frau. Die frühere Härte war verschwunden, die Haut war weich und warm unter seinen Händen. Seit Eleonor Büroleiterin in der Bank war, hatte sie einfach nicht mehr die Zeit, so hart zu trainieren wie früher.
Er ließ seine Hand langsam über den Nabel herabgleiten, fand die Leiste, folgte mit dem Zeigefinger sachte der Falte und glitt zwischen die Schenkel, fühlte das Haar, fand die Feuchtigkeit.
»Lass das«, murmelte seine Frau und drehte sich von ihm weg.
Er seufzte und rollte sich auf den Rücken, seine Erregung pochte wie ein Hammer. Er verschränkte die Finger, legte die Hände unter den Kopf und starrte an die Decke. Er hörte, wie ihre Atemzüge wieder flach und ruhig wurden. In letzter Zeit wollte sie nie. Ärgerlich schlug er die Decke beiseite und ging nackt in die Küche, wobei sein Schwanz herabbaumelte wie eine vertrocknete Tulpe. Er trank Wasser aus einem ungespülten Glas, gab Kaffeepulver in einen neuen Filter und schaltete die Kaffeemaschine ein, ging auf die Toilette und pinkelte. Im Badezimmerspiegel sah er, dass ihm die Haare zu Berge standen, was ihm ein unbeschwertes Aussehen gab, das besser zu seinem Alter passte. Er fuhr sich mit den Händen durch die Haarmähne.
Es ist noch zu früh für eine Midlife-Crisis, dachte er. Viel zu früh. Er ging in die Küche zurück, stellte sich ans Fenster und starrte auf das Meer hinaus. Es war schwarz und wild. Der nächtliche Sturm war am Schaum und den hohen Wellen noch zu erkennen, die Sonnenuhr der Nachbarn lag wie besoffen neben ihrer Verandatür.
Was hat das nur für einen Sinn?, dachte er. Warum macht man weiter?
Eine große und dunkle Melancholie ergriff Besitz von ihm, und er war sich bewusst, dass sie fast schon an Selbstmitleid grenzte. Es zog vom Fenster her, dieser verdammte Pfuschbau, er bekam eine Gänsehaut, seufzte und holte seinen Bademantel, ein Weihnachtsgeschenk seiner Frau, grün, blau und weinrot, teuer, von NK, dazu passende Pantoffeln, die er nie getragen hatte.
Die Kaffeemaschine gurgelte. Er nahm eine Tasse mit dem Logo der Bank heraus und schaltete das Radio ein, suchte den Sender mit den Nachrichten. Die Meldungen wurden durch Überdruss und Kaffee gefiltert und trafen planlos. Der Orkan, der über Südschweden hinweggezogen war und große Schäden verursacht hatte. Haushalte ohne elektrischen Strom. Die Versicherungsgesellschaften versprechen. Zwei Männer tot. Die Sicherheitszone im südlichen Libanon. Kosovo.
Er schaltete ab, ging in den Flur hinaus, zog sich die Stiefel an und holte stattdessen die Zeitung aus dem Briefkasten. Der Wind zerrte an den Seiten, fuhr unter seinen Frotteemantel, kühlte seine Schenkel. Er blieb stehen, schloss die Augen, atmete. Eis lag in der Luft, das Meer würde gefrieren.
Er sah zum Haus hinunter, zu dem schönen Haus, das ihre Eltern hatten bauen lassen, von einem Architekten speziell entworfen. In der Küche im oberen Stockwerk war das Licht an, die Lampe über dem Tisch von einem Designer, dessen Name er vergessen hatte. Der Lichtschein war grünlich und kalt, ein böses Auge, das über das Meer wachte. Die hellen Ziegelsteine waren grau im Licht der Dämmerung. In den Augen seiner Mutter war es immer Vaxholms schönstes Haus gewesen. Sie hatte angeboten, Gardinen für alle Zimmer zu nähen, als sie einzogen. Eleonor hatte sie davon abgebracht, höflich, aber bestimmt.
Er ging wieder hinein, blätterte die einzelnen Zeitungsteile durch, ohne sich konzentrieren zu können, blieb wie üblich bei den Wohnungsanzeigen hängen. 5-Zimmer-Wohnung in Vasastan, Kachelöfen in jedem Zimmer. 2-Zimmer-Wohnung in Gamla Stan, Dachwohnung mit frei liegenden Balken, Aussicht in drei Himmelsrichtungen. Holzhütte außerhalb von Malmköping, Elektrizität und fließendes Wasser im Sommer, Herbstpreis!
In seinem Innern hörte er die Stimme seiner Frau.
Tagträumer! Wenn du nur halb so viel Zeit auf den Aktienmarkt verschwenden würdest wie auf Wohnungsanzeigen, wärst du längst Millionär.
Sie war es bereits.
Er schämte sich augenblicklich. Sie meinte es nur gut. Ihre Liebe war unerschütterlich. Das Problem war er, er war es, der nicht mehr konnte. Es war gut möglich, dass sie Recht hatte, dass er Probleme hatte, mit ihrem Erfolg umzugehen. Vielleicht sollten sie doch zu diesem Therapeuten gehen, trotz allem.
Er faltete die Zeitung wieder so, wie sie ursprünglich gewesen war, denn Eleonor wollte keine abgenutzten Artikel lesen, und legte sie auf das Sideboard für Post und Zeitschriften. Anschließend ging er ins Schlafzimmer zurück, ließ seinen Bademantel fallen und glitt unter die Decke. Sie wand sich im Schlaf, als sie seinen kalten Körper spürte. Er zog sie an sich, pustete in ihren weichen Nacken.
»Ich liebe dich«, flüsterte er.
»Ich dich auch«, murmelte sie.
Carl Wennergren und Bertil Strand trafen um den Bruchteil einer Sekunde zu spät im Freihafen ein. Als sie den Dienst-Saab des Fotografen parkten, sahen sie die Krankenwagen vorfahren und die Absperrungen passieren. Der Reporter konnte sich einen frustrierten leisen Fluch nicht verkneifen. Bertil Strand fuhr immer so unglaublich vorsichtig, hielt sich an die vorgeschriebenen fünfzig oder sogar dreißig Stundenkilometer, obwohl kein Schwein auf den Straßen unterwegs war. Der Fotograf bemerkte die unausgesprochene Kritik und wurde ärgerlich.
»Jetzt mecker nicht rum«, sagte er zu dem Reporter.
Die Männer trotteten zur Plastikabsperrung, und eine Lücke zwischen ihnen markierte ihre gefühlsmäßige Distanz zueinander. Als die Blaulichter und die Bewegungen der Polizisten deutlich wurden, verschwand das Misstrauen, die Ereignisse nahmen sie gefangen.
Die Bullen waren heute schnell gewesen, hatten wohl nach dem Unwetter viel Adrenalin im Blut. Das abgesperrte Gebiet war groß. Es erstreckte sich vom Zaun links bis hin zu dem Bürogebäude rechts. Bertil Strand ließ den Blick über das Gelände schweifen, harte Gegend. Fast mitten in der Stadt und dennoch völlig ab vom Schuss. Gutes Licht, klar, aber dennoch warm. Magische Schatten.
Carl Wennergren knöpfte seinen Ölmantel zu, verdammt, war das kalt.
Sie sahen nicht besonders viel von den Opfern. Gerümpel, Polizisten und Krankenwagen versperrten ihnen die Sicht. Der Reporter stampfte mit den Füßen, zog die Schultern bis zu den Ohren hoch und steckte die Hände in die Manteltaschen; er hasste die Morgenschicht. Der Fotograf fischte das Kameragehäuse und das Teleobjektiv von seinem Rücken und bewegte sich entlang der Absperrung. Ganz links konnte er ein paar gute Aufnahmen schießen, Uniformen im Profil, schwarze Leichen, in Zivil gekleidete Techniker mit Mützen.
»Fertig«, rief er dem Reporter zu.
Carl Wennergrens Nase war rot geworden, ein kleiner Tropfen durchsichtiger Rotze hing an der äußersten Spitze.
»Was für ein beschissener Ort zum Sterben«, sagte er, als der Fotograf zurückkam.
»Wenn wir heute noch was darüber in die Vorortauflagen bekommen wollen, müssen wir jetzt los«, meinte Bertil Strand.
»Aber ich bin noch nicht fertig«, erwiderte Carl Wennergren. »Ich hab doch noch nicht einmal angefangen.«
»Du wirst vom Auto aus anrufen müssen oder von der Redaktion. Beeil dich, versuch etwas Lokalkolorit aufzuschnappen, damit du das Ganze ein wenig ausschmücken kannst.«
Der Fotograf ging zum Wagen, sein Rucksack hüpfte auf und ab. Auf der Rückfahrt nach Marieberg schwiegen sie.
Anders Schyman klickte gereizt die Meldungen der Nachrichtenagentur weg, sie waren wie eine Droge. Man konnte den Computer so einstellen, dass er die Agenturmeldungen nach Themengebieten sortierte, Inland, Ausland, Sport, Feature, aber Schyman zog es vor, alles in einem Verzeichnis zu haben. Er wollte alles wissen, gleichzeitig.
Er drehte eine Runde in seinem engen Büro, seinem Aquarium, rollte ein wenig mit den Schultern. Dann setzte er sich auf das stinkende Sofa und griff sich die aktuelle Ausgabe mit dem Sonderteil über den Orkan. Er nickte zufrieden vor sich hin, seine Vorstellungen waren umgesetzt worden. Die einzelnen Abteilungen hatten genau so zusammengearbeitet, wie er es vorgeschlagen hatte. Jansson hatte ihm erzählt, dass Annika Bengtzon für die praktische Koordination verantworlich gewesen sei, was sehr gut funktioniert habe.
Annika Bengtzon, dachte er und seufzte.
Das Schicksal der jungen Textredakteurin war auf zufällige und bedauerliche Weise mit seiner eigenen Stellung bei der Zeitung verknüpft. Er und Annika Bengtzon waren im Abstand von nur wenigen Wochen zur Redaktion gestoßen. Sein erster Konflikt mit den übrigen Ressortleitern hatte mit ihr zu tun gehabt. Es war um eine längerfristige Vertretung in der Nachrichtenredaktion gegangen, und in seinen Augen war Annika Bengtzon dafür die erste Wahl gewesen. Sicher, sie war zu jung, zu unreif, zu hitzig und hatte zu wenig Routine, aber ihre Begabung lag in seinen Augen weit über dem Durchschnitt. Sie war nicht sehr gebildet, hatte aber ein Bewusstsein für ethische Fragen. Sie wurde unbestreitbar von einem großen Gerechtigkeitssinn angetrieben. Sie war schnell und schrieb stilsicher. Außerdem hatte sie etwas von einem Panzer, was für einen Reporter bei einer Abendzeitung von ungeheurem Vorteil war. Wenn sie ein Hindernis nicht umgehen konnte, walzte sie es platt, gab niemals auf.
Die restliche Redaktionsleitung, abgesehen von Nachtchef Jansson, war nicht seiner Meinung gewesen. Sie wollten Carl Wennergren einstellen, den Sohn eines Aufsichtsratmitglieds, einen hübschen und reichen Jungen mit erheblichen moralischen Defiziten. Er nahm es weder mit der Wahrheit noch mit dem Schutz seiner Informanten so genau. Unverständlicherweise sah die restliche Redaktionsleitung darin nichts Unehrenhaftes oder zumindest nichts Fragwürdiges.
Die Führungsebenen des Abendblatts bestanden ausschließlich aus weißen, heterosexuellen Männern mittleren Alters mit Auto und hohem Gehalt, den Stützen und gleichzeitig den Nutznießern der Gesellschaft wie der Zeitung. Anders Schyman hatte den Verdacht, dass Carl Wennergren diese Männer an ihre eigene Jugend erinnerte oder dass er vielmehr die Illusion ihrer eigenen Jugend personifizierte.
Schließlich hatte er Bengtzon eine Schwangerschaftsvertretung als Textredakteurin in Janssons Nachtschicht angeboten, die sie angenommen hatte. Es hatte Streit mit der Zeitungsleitung gegeben, ehe seine Entscheidung akzeptiert worden war. Annika Bengtzon wurde zu dem Fall, bei dem er nicht locker lassen durfte, um seine Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Die Sache nahm ein Ende mit Schrecken.
Wenige Tage nachdem die Anstellung offiziell bestätigt worden war, hatte das Mädchen ihren Freund getötet. Sie hatte ihn mit einer Eisenstange geschlagen, sodass er in einen stillgelegten Hochofen im Stahlwerk von Hälleforsnäs gestürzt war. Schon in den allerersten Gerüchten war zwar von Notwehr die Rede gewesen, aber Anders Schyman erinnerte sich noch gut an seine erste Reaktion, an den Wunsch, im Erdboden zu versinken, und an den anschließenden Gedanken: So ist das also, wenn man aufs falsche Pferd gesetzt hat. Am Abend hatte sie ihn zu Hause angerufen, wortkarg und noch unter Schock bestätigt, dass das Gerücht der Wahrheit entsprach. Sie war verhört worden und stand unter dem Verdacht der fahrlässigen Tötung, war aber nicht verhaftet worden. Sie würde ein paar Wochen in einer Hütte im Wald wohnen bleiben, bis die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen wären, und wollte von ihm wissen, ob sie ihre Stelle beim Abendblatt noch habe.
Er hatte ihr gesagt, dass sie, wie die Dinge lagen, die Vertretung hatte, auch wenn es Leute bei der Zeitung gab, die das bedauerten, denn sie war nicht sehr beliebt bei der Gewerkschaft. Eine fahrlässige Tötung bedeutete eine Form von Unglück. Falls sie wegen eines Unfalls verurteilt wurde, bei dem jemand ums Leben gekommen war, war das zwar bedauerlich, aber kein Kündigungsgrund. Wenn sie allerdings zu einer längeren Gefängnisstrafe verurteilt wurde, würde es natürlich schwierig werden, eine Verlängerung der Vertretung zu bekommen, dessen sollte sie sich bewusst sein.
Als er so weit gekommen war, hatte sie angefangen zu weinen. Er hatte gegen seinen instinktiven Wunsch angekämpft, sie anzuschnauzen, ihr diese ungeheure Ungeschicklichkeit vorzuwerfen, und dass sie ihn mit in den Dreck gezogen hatte.
»Ich bekomme keine Gefängnisstrafe«, hatte sie in den Hörer geflüstert. »Er oder ich, eine andere Wahl hatte ich nicht. Er hätte mich umgebracht, wenn ich nicht auf ihn eingeschlagen hätte. Das weiß auch der Staatsanwalt.«
Sie hatte in der Nachtschicht angefangen, wie es vorgesehen gewesen war, blasser und magerer als je zuvor. Sie unterhielt sich manchmal mit ihm, mit Jansson, Berit, Bild-Pelle und ein paar anderen, aber ansonsten hielt sie sich zurück. Wenn man Jansson Glauben schenken wollte, leistete sie nachts verdammt gute Arbeit, schrieb um, ergänzte, kontrollierte Fakten, schrieb Bildtexte und Aufmacher, spielte sich niemals auf. Die Gerüchte verstummten schneller, als er gedacht hätte. Die Zeitung beschäftigte sich tagtäglich mit Morden und Skandalen, da gab es Grenzen dafür, wie lange man sich über einen tragischen und unglücklichen Todesfall das Maul zerreißen konnte.
Der Prozess um den verunglückten Bandyspieler Sven Matsson aus Hälleforsnäs, der Frauen misshandelt hatte, war für das Amtsgericht in Eskilstuna nicht sonderlich wichtig. Die Anklage lautete auf Totschlag oder fahrlässige Tötung. Das Urteil war kurz vor Mittsommer des vorangegangenen Jahres gesprochen worden. Annika Bengtzon wurde vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen, aber im weniger schwer wiegenden Anklagepunkt verurteilt. Es wurde eine Bewährungsstrafe verhängt. Zu den Bewährungsauflagen gehörte, dass sie eine Zeit lang eine Art Therapie machen musste, aber soweit er wusste, war die Sache aus Sicht der Justiz zu den Akten gelegt worden.
Der Ressortleiter ging zu seinem Schreibtisch zurück und klickte wieder die Meldungen an, überflog alle, die in den letzten Minuten neu hinzugekommen waren. Die Sportergebnisse vom Sonntag trudelten langsam ein, die Nachwirkungen des Orkans setzten sich fort, eine Reihe von Samstagsnachrichten wurde wiederholt. Er seufzte erneut, alles ging einfach immer nur weiter, es nahm nie ein Ende, nirgendwo, und jetzt sollte es wieder umorganisiert werden.
Chefredakteur Torstensson wollte eine neue Chefebene einführen, die Beschlüsse zentralisieren. Das Modell existierte bereits bei ihrer direkten Konkurrenz und ein paar anderen überregionalen Medien. Torstensson hatte beschlossen, dass auch für das Abendblatt die Zeit reif war, umzustrukturieren und ein »modernes« Unternehmen zu werden. Anders Schyman dagegen war unschlüssig. Es gab alle Vorzeichen einer herannahenden Katastrophe: sinkende Auflagenzahlen, schlechte Geschäftsergebnisse, die immer düsterer wirkenden Mienen der Aufsichtsratsmitglieder. Die Redaktion, die mit einem schadhaften Ruder und einem halb kaputten Radar Schlagseite bekam. In Wahrheit wusste das Abendblatt nicht, wohin es unterwegs war oder warum. Er hatte es, trotz großer Seminare und Konferenzen zu den Bedingungen und der Verantwortung der Medien, einfach nicht geschafft, ein kollektives Bewusstsein dafür aufzubauen, wo die Grenzen verliefen. Regelrechte publizistische Havarien konnten zwar vermieden werden, seit er bei der Zeitung tätig war, aber die Reparaturarbeiten an früheren Schäden schritten nur langsam voran.
Außerdem, und das bereitete ihm etwas größeres Kopfzerbrechen, als er zugeben wollte, hatte Torstensson Details über einen anderen Job fallen lassen, einen ehrenvollen Auftrag in Brüssel. Vielleicht hatte er es deshalb so eilig mit seiner Umorganisation. Torstensson wollte bleibende Spuren hinterlassen, und das hatte er durch seine publizistischen Leistungen weiß Gott nicht getan. Schyman stöhnte und klickte sich wieder ungeduldig durch die Liste der Meldungen.
Es musste bald etwas passieren.
Die Dunkelheit lauerte bereits in den Ecken, als sie erwachte. Der kurze Tag hatte aufgegeben, während sie sich schwitzend im Bett gewälzt hatte, sie hätte die letzte Tasse Kaffee nicht trinken dürfen. Sie atmete ein paar Mal tief ein, zwang sich, still zu liegen, und horchte in sich hinein, wie es ihr ging. Sie hatte nirgendwo Schmerzen. Ihr Kopf war ein bisschen schwer, aber das lag an der andauernden Umstellung des Tagesrhythmus. Sie sah zu der fleckigen grauen Decke hinauf. Der Vormieter hatte die alte Leimfarbe mit Acrylfarbe überstrichen, die ganze Decke war voller Risse in verschiedenen Nuancen. Ihr Blick folgte den Rissen, ihrem brüchigen und unregelmäßigen Muster. Fand den Schmetterling im Muster, das Auto, den Totenschädel. Ein einsamer Ton begann in ihrem linken Ohr zu pfeifen, der Einsamkeitston, und trudelte ein wenig auf der Tonleiter auf und ab.
Sie seufzte, musste pinkeln, wie lästig. Sie stieg aus dem Bett, und das Holz fühlte sich rau an unter ihren Füßen, manchmal riss sie sich einen Splitter ein. Sie zog ihren Bademantel an, der Stoff war seidig und kalt auf der Haut, sie schauderte. Sie öffnete die Wohnungstür und lauschte ins Treppenhaus hinaus. Hinter dem Ton war alles still. Schnell trippelte sie eine halbe Etage tiefer zur Gemeinschaftstoilette, und ihre Fußsohlen wurden augenblicklich kalt und schmutzig, aber das war ihr jetzt egal.
Sie bemerkte den Luftzug, als sie wieder in die Wohnung kam. Die dünnen Gardinen bauschten sich, obwohl sie gar kein Fenster geöffnet hatte. Sie schloss die Tür hinter sich, die Gardinen kamen zur Ruhe. Sie putzte sich die Füße an der Flurmatte ab und ging ins Wohnzimmer.
Eine der oberen Fensterscheiben war während der Nacht zu Bruch gegangen, vom Wind eingedrückt oder von umherfliegenden Gegenständen eingeschlagen worden. Die äußere Fensterscheibe der Doppelverglasung schien völlig zu fehlen, von der inneren waren noch einige große Scherben am Rand übrig geblieben. Auf dem Fußboden unter dem Fenster lagen Putz und Glas, und sie betrachtete die Bescherung, schloss die Augen, strich sich über die Stirn.
Das ist ja wieder einmal typisch, dachte sie und hatte nicht die Energie, das Wort »Glaser« zu formulieren.
Es zog um die Beine, und sie verließ das Wohnzimmer und setzte sich in die Küche. Sie schaute zum Fenster hinaus, sah in die Wohnung im zweiten Stock des Vorderhauses hinein. Ein Bauunternehmen benutzte sie als Wohnung für Gäste, das Badezimmer hatte ein Fenster aus Milchglas. Die Menschen, die dort ein oder zwei Nächte wohnten, machten sich keine Gedanken darüber, dass man sie sehen konnte, wenn sie auf die Toilette gingen. Sobald sie das Licht anmachten, waren ihre welligen Konturen durch die Scheibe zu erkennen. Sie hatte mehr als zwei Jahre lang beobachtet, wie die Kunden des Bauunternehmens sich liebten, auf die Toilette gingen und Tampons wechselten. Anfangs war es ihr peinlich gewesen, aber nach einer Weile fand sie es lustig. Dann machte es sie ärgerlich, sie wollte niemanden pinkeln sehen, wenn sie zu Abend aß. Mittlerweile war es ihr einfach egal. Die Besucher in der Wohnung wurden seltener, das Gebäude war mittlerweile so heruntergekommen, dass man damit niemanden mehr beeindrucken konnte. Im Moment war die Scheibe grau, stumm, leer.
Während der Nacht war viel Putz von der Hausfassade heruntergefallen und lag, mit klumpigem Schneematsch vermischt, auf dem Hinterhof. Im ersten Stock waren zwei Scheiben zu Bruch gegangen. Sie stand auf, ging zum Fenster und sah die schwarzen Löcher. Der elektrische Heizkörper in der Küche wärmte ihre Beine, und sie blieb an ihm stehen, bis die Hitze zu groß wurde. Sie hatte keinen Hunger, obwohl sie etwas essen sollte, und trank stattdessen ein paar Schluck Wasser direkt aus dem Hahn.
Es geht mir gut, dachte sie. Ich habe alles, was ich will.
Rastlos ging sie wieder ins Wohnzimmer, setzte sich auf die Couch, legte die Füße auf das Kissen, schlang die Arme um die Knie und schaukelte ein wenig. Sie atmete tief durch, ein und aus und ein und aus, es war ziemlich kalt. Das Gebäude hatte keine Zentralheizung, und die einzelnen Heizkörper, die sie gekauft hatte, schafften es kaum, die Wohnung warm zu halten, selbst wenn die Fensterscheiben ganz waren. Die wenigen Sachen, die sie besaß, stammten vom Flohmarkt und von Ikea, Sachen, mit denen sie keine gemeinsame Geschichte verband.
Sie sah sich im Zimmer um, schaukelte, sah zu, wie die Schatten einander jagten. Das reine Licht, das sie anfangs so sehr geliebt hatte, war nicht mehr weiß. Die schimmernde Mattheit der Wände, die das Licht mit der gleichen Bewegung zu absorbieren und wiederzugeben pflegte, war jetzt eingetrocknet und verstummt. Der Tag reichte nicht länger in ihr Zimmer hinein. Alles blieb grau, trotz des Wechsels der Jahreszeiten. Die Luft war schwer und dumpf wie Lehm.
Die Couch scheuerte, und der grobe Stoff hinterließ Abdrücke auf ihren Pobacken. Sie kratzte sich, während sie wieder in das Schlafzimmer zurückging und unter das verschwitzte Bettzeug sank. Sie zog sich die Bettdecke, unter der es feucht war, über den Kopf. Es wurde schnell warm und roch ein wenig säuerlich. Der Hardrocker aus der unteren Etage warf seine Stereoanlage an, und die Bässe drangen durch die Steinwände und ließen ihr Bett zittern. Der Ton in ihrem Ohr kehrte irritierend hoch zurück, und sie zwang sich, liegen zu bleiben. Es waren immer noch viele Stunden, bis ihre Schicht begann.
Sie drehte sich zur Wand um, starrte die Tapete an. Sie war mit dünner weißer Grundfarbe überstrichen, aber das alte Muster schien durch, Medaillons. Die Nachbarn auf der anderen Seite des Treppenhauses kamen nach Hause, und Annika hörte, wie sie die Füße abtraten und lachten. Sie legte sich das Kissen auf den Kopf, das Lachen wurde dumpfer, der Ton höher.
Ich will schlafen, dachte sie. Lasst mich nur noch ein bisschen schlafen, dann kann ich vielleicht weitermachen.
Der Mann steckte sich eine Zigarette an, inhalierte tief und zwang das Chaos in seinem Gehirn zu verschwinden. Er wusste nicht, welches Gefühl am stärksten war: die Wut über den Verrat, die Angst vor den Folgen, die Scham darüber, hereingelegt worden zu sein, oder der Hass auf die Schuldigen.
Er würde sich rächen, zum Teufel, dafür würden sie bezahlen.
Er rauchte die Zigarette in zwei Minuten auf, sie verwandelte sich in eine Aschesäule, die am Ende wie eine Scheißwurst herabhing.
Er zerrieb die Kippe auf dem Fußboden der Bar und bestellte mit einem Wink einen weiteren Schnaps. Nur einen, nur diesen noch, er musste einen klaren Kopf bewahren, musste sich bewegen können. Er kippte den Drink herunter, das Halfter scheuerte angenehm in den Achselhöhlen, verdammt, jetzt war er lebensgefährlich.
Eine Erklärung, dachte er. Ich muss mir eine verdammt gute Erklärung dafür einfallen lassen, dass die Sache so schief gehen konnte. Er wollte gerade noch einen bestellen, hielt jedoch mitten in der Bewegung inne.
»Einen Kaffee. Schwarz.«
Er konnte es einfach nicht fassen. Er begriff nicht, was passiert war, und er hatte keine Ahnung, wie er das Geschehene seinen Vorgesetzten erklären sollte. Sie würden einen vollständigen Schadensersatz fordern. Die Leichen waren nicht das Problem, auch wenn diese Art von Verlust niemals gut war. Ermordete Menschen zogen die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich und machten für einen gewissen Zeitraum größere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Das Problem war der Lastwagen. Es reichte nicht, die Ware ausfindig zu machen und sicherzustellen, er würde persönlich gezwungen werden, aufzuräumen und den Schnitzer auszubügeln. Jemand hatte gesungen. Er musste die Ladung finden, und er musste diejenigen finden, die für ihr Verschwinden verantwortlich waren.
Wie sehr er es auch drehte und wendete, er kam zu dem Schluss, dass es etwas mit der Frau zu tun haben musste. Sie musste dabei eine Rolle spielen, sonst wäre sie nicht da gewesen.
Er trank den Kaffee auf die gleiche Art wie seinen Drink, in einem Schluck, und verbrannte sich die Kehle.
»Du bist tot, Hure.«
Die Aufzugbeleuchtung war kalt wie immer, und sie sah aus wie ein toter Fisch. Annika schloss die Augen, um ihrem Spiegelbild zu entkommen. Sie hatte nicht wieder einschlafen können und war stattdessen in den Rålambshovpark hinausgegangen, hatte Luft und Licht gesucht, ohne es zu finden. Die Erde war vom Regen und von Tausenden Füßen weich getrampelt, matschig und braun. Sie war zur Zeitung gegangen.
Die Redaktion war sonntäglich leer und trostlos. Sie ging zu ihrem Platz, der Nachrichtenchef Ingvar Johansson saß gerade dort und telefonierte. Sie blieb stehen und ging stattdessen in die Kriminalredaktion. Vollkommen leer im Hirn, ließ sie sich auf Berit Hamrins Platz fallen und rief ihre Großmutter an.
Die alte Frau war in ihrer Wohnung in Hälleforsnäs, um zu waschen und Einkäufe zu erledigen.
»Wie geht es dir?«, wollte sie wissen. »Hat der Wind dich erwischt?«
Annika lachte.
»Ja, das kann man wohl sagen, eines meiner Fenster ist zu Bruch gegangen!«
»Du bist doch nicht verletzt?«, fragte die alte Frau beunruhigt.
»Aber nein, sei nicht so ängstlich. Wie sieht es bei dir aus? Steht der Wald noch?«
Ihre Großmutter seufzte.
»Einigermaßen, aber es sind viele Bäume umgestürzt. Heute Morgen waren sie im Ort eine Zeit lang ohne Strom, aber jetzt funktioniert offenbar wieder alles. Wann kommst du vorbei?« Annikas Großmutter bewohnte nach langen Jahren als Haushälterin auf dem Repräsentations- und Erholungsgut des Ministerpräsidenten auf den Ländereien von Gut Harpsund eine kleine Hütte ohne Elektrizität und fließendes Wasser, in der Annika alle Schulferien verbracht hatte, an die sie sich erinnern konnte.
»Ich arbeite heute Abend und noch eine Nacht, ich komme dann irgendwann am Dienstagnachmittag zu dir«, meinte Annika. »Soll ich unterwegs etwas besorgen?«
»Nicht doch«, erwiderte ihre Großmutter. »Bring dich selber mit, dann habe ich alles, was ich brauche.«
»Du fehlst mir«, sagte Annika.
Sie nahm eine Zeitung und blätterte pflichtschuldigst darin. Die heutige Ausgabe des Abendblatts war von ziemlich guter Qualität.
Die Orkanartikel kannte sie und übersprang sie deshalb. Carl Wennergrens Artikel über den Doppelmord im Freihafen war dagegen nichts, womit man sich schmücken konnte. Den toten Männern war in den Kopf geschossen worden, stand dort, und die Polizei schloss Selbstmord aus. Ach was. Anschließend folgte eine Beschreibung des Freihafens, die tatsächlich nicht ohne poetische Qualitäten war. Carl hatte offensichtlich ein wenig von der Stimmung aufgenommen. »Hübsch heruntergekommen« war es dort und »voll kontinentaler Atmosphäre«.
»Hallöchen, Süße, qué pasa?«
Annika schluckte.
»Hallo, Sjölander«, sagte sie.
Der Leiter der Kriminalredaktion setzte sich vertraulich auf den Schreibtisch neben ihr.
»Wie geht’s?«
Annika versuchte ein Lächeln.
»Danke, gut. Bin vielleicht ein bisschen müde.«
Der Mann boxte sie leicht gegen die Schulter und zwinkerte ihr zu.
»Anstrengende Nacht, was?«
Sie stand auf, nahm ihre Zeitung, sammelte Tasche und Jacke auf.
»Wahnsinnig anstrengend. Ich und sieben Jungs.«
Sjölander lachte glucksend.
»Du weißt, wie man’s anstellen muss.«
Sie hielt dem Leiter der Kriminalredaktion die Zeitung unter die Nase.
»Ich habe gearbeitet«, sagte sie. »Was ist denn im Freihafen los?« Er sah sie ein paar Sekunden an und strich sich dann das Haar aus der Stirn.
»Die Leichen hatten keine Ausweispapiere bei sich«, erwiderte er, »keine Schlüssel, kein Geld, weder Waffen noch Kaugummis, noch Kondome.«
»Gefilzt«, kommentierte Annika.
Sjölander nickte.
»Die Polizei hat keinerlei Anhaltspunkte, nicht einmal, was die Identität der Opfer betrifft. Ihre Fingerabdrücke sind jedenfalls in Schweden nicht registriert.«
»Dann haben sie wirklich keine Ahnung? Was ist denn mit ihren Kleidern?«
Sjölander ging zu seinem Schreibtisch und schaltete den Computer an.
»Die Mäntel, Jeans und Schuhe stammen aus Italien, Frankreich, den USA, aber die Unterhosen sind mit kyrillischen Buchstaben beschriftet.«
Annika blickte auf.
»Ausländische Markenkleidung«, sagte sie, »aber billige einheimische Unterwäsche. Aus der früheren Sowjetunion, dem ehemaligen Jugoslawien oder Bulgarien.«
»Du stehst ein bisschen auf Kriminalfälle, was?«, sagte er grinsend. Er wusste Bescheid, alle wussten Bescheid. Sie zuckte mit den Schultern.
»Du weißt schon, wie das ist. Es bleibt immer was kleben.«
Dann drehte sie sich um und ging zum Nachtdesk. Hinter sich hörte sie ihn schnauben. Warum spiele ich da mit?, dachte sie.
Sie schaltete den Computer an, der rechts neben dem des Nachtchefs stand, zog die Beine auf den Bürostuhl hoch und machte es sich mit dem Kinn auf dem Knie gemütlich. Am besten, sie sah einmal nach, ob etwas passiert war. Geduldig wartete sie, bis der Computer hochgefahren war, und klickte anschließend die Nachrichtenagentur an, las, überflog, klickte weiter.
»He, Bengtzon! Was hast du für eine Nummer?«
Sie blickte sich um, sah Sjölander mit einem Hörer winken, rief ihm die Nummer zu und hatte ihn am Apparat.
»Da ist eine Tante am Telefon, die über das Sozialamt reden will. Es geht irgendwie um Frauen, denen es schlecht geht«, sagte der Kriminalchef. »Ich habe dafür jetzt keine Zeit. Das ist doch wohl eher deine Kragenweite, nicht? Kannst du drangehen?«
Sie schloss die Augen, atmete durch, schluckte.
»Ich habe eigentlich noch gar nicht angefangen«, antwortete sie.
»Ich wollte nur ein bisschen …«
»Übernimmst du das Gespräch jetzt, oder soll ich sie aus der Leitung schmeißen?«
Sie seufzte.
»Okay, stell sie rüber.«
Eine kühle und ruhige Stimme war zu hören.
»Hallo? Ich möchte vertraulich mit jemandem sprechen.«
»Wir hier bei der Zeitung unterliegen immer der Schweigepflicht, wenn Sie es wünschen«, erwiderte Annika und überflog die Agenturmeldungen auf dem Bildschirm. »Worum geht es denn?« Klick, klick, unentschieden im Derby.
»Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich bei Ihnen richtig bin. Es geht um eine neue Organisation, eine neue Möglichkeit, Menschen zu schützen, die unter Morddrohungen stehen.«
Annika hörte auf zu lesen.
»Aha«, sagte sie. »Wie denn?«
Die Frau zögerte.
»Ich habe Informationen über eine einzigartige Methode, bedrohten Personen zu einem neuen Leben zu verhelfen. Die Arbeitsweise ist den allermeisten nicht bekannt, aber ich bin berechtigt, die Informationen in den Medien zu verbreiten. Ich würde dies gern auf solide und kontrollierte Weise tun, und deshalb möchte ich wissen, ob es bei Ihrer Zeitung jemanden gibt, an den ich mich wenden kann.«
Sie wollte nicht hinhören, wollte sich nicht dafür interessieren. Starrte auf den Bildschirm, eine Reihe von Haushalten noch ohne Strom, neue Raketenangriffe auf Grosny, sie stützte den Kopf auf.
»Können Sie uns einen Brief oder ein Fax schicken?«, fragte sie. Die Frau blieb lange stumm.
»Hallo?«, sagte Annika, bereit, mit einem Gefühl der Erleichterung aufzulegen.
»Ich möchte die Person gern treffen, mit der ich mich unterhalte, und zwar an einem sicheren Ort«, sagte die Frau.
Annika sackte an ihrem Schreibtisch zusammen.
»Das geht nicht«, erwiderte sie. »Hier ist im Moment niemand.«
»Und was ist mit Ihnen?«
Sie strich das Haar nach hinten, suchte nach einer Ausrede.
»Wir müssen wissen, worum es geht, ehe wir jemanden losschicken«, sagte sie.
Die Frau am anderen Ende der Leitung verstummte wieder. Annika versuchte das Gespräch zu beenden.
»Wenn Sie nicht noch etwas anderes vorzubringen haben, dann …«
»Wussten Sie, dass hier, in diesem Moment, in Schweden Menschen im Untergrund leben?«, fragte die Frau leise. »Frauen und Kinder, die misshandelt werden und in Schwierigkeiten sind?« Nein, dachte Annika. Alles, nur das nicht.
»Vielen Dank für Ihren Anruf«, antwortete sie, »aber das ist leider kein Thema, mit dem wir uns heute Abend beschäftigen können.« Die Frau im Hörer sprach jetzt lauter.
»Wollen Sie jetzt etwa auflegen? Bin ich und was ich tue Ihnen völlig egal? Wissen Sie eigentlich, wie vielen Menschen ich schon geholfen habe? Sind Ihnen Frauen, die verfolgt werden, wirklich völlig egal? Ihr Journalisten sitzt da in euren Zeitungsredaktionen und habt nicht die geringste Ahnung, wie es in der Gesellschaft um euch herum aussieht.«
Annika war schwindlig, sie bekam keine Luft mehr.
»Sie wissen nichts über mich«, sagte sie.
»Die Medien sind überall gleich. Ich habe geglaubt, das Abendblatt wäre besser als die renommierten Zeitungen, aber Ihnen sind misshandelte und bedrohte Frauen und Kinder offensichtlich genauso egal.«
Das Blut schoss ihr in den Kopf.
»Sagen Sie mir nicht, wofür ich stehe«, sagte Annika viel zu laut.
»Kommen Sie hier nicht an und behaupten Sachen, über die Sie nichts wissen.«
»Warum wollen Sie mich dann nicht anhören?«
Die Frau am anderen Ende der Leitung klang verärgert.
Annika legte die Hände vors Gesicht und wartete.
»Es geht um Menschen, die isoliert sind«, erklang die Stimme der Frau im Hörer, »die Morddrohungen erhalten, um ihr Leben bangen. Wie sehr sie sich auch verstecken, es gibt doch immer jemanden oder etwas, das dafür sorgt, dass man sie aufstöbern kann – ein Sachbearbeiter auf dem Sozialamt, ein Gericht, ein Bankkonto, ein Kindergarten …«
Annika antwortete nicht, lauschte stumm in den Hörer hinein.
»Die meisten sind natürlich Frauen und Kinder, wie Sie sich vielleicht denken können«, fuhr die Frau fort, »sie leben in unserer Gesellschaft am gefährlichsten. Andere Betroffene sind Zeugen, denen jemand droht, Menschen, die bei diversen Sekten ausgestiegen sind oder von der Mafia gejagt werden, Journalisten, die Enthüllungen gemacht haben, aber vor allem geht es natürlich um Frauen und Kinder, die Morddrohungen erhalten haben.«
Annika griff unschlüssig nach einem Stift und begann sich Notizen zu machen.
»Wir bilden eine Gruppe«, sagte die Frau, »die auf diesem neuen Betätigungsfeld aktiv ist. Ich bin die Geschäftsführerin. Sind Sie noch dran?«
Annika räusperte sich.
»Was unterscheidet Sie von herkömmlichen Frauenhäusern mit geheim gehaltenen Adressen?«
Die Frau im Hörer seufzte resigniert.
»Einfach alles. Die Frauenhäuser werden mit völlig unzulänglichen öffentlichen Geldern finanziert. Sie haben einfach nicht die Mittel, das zu leisten, was wir tun. Wir sind eine rein private Initiative mit ganz anderen Möglichkeiten.«
Der Stift versagte den Dienst. Annika warf ihn in den Papierkorb und kramte einen neuen hervor.
»Inwiefern?«
»Mehr möchte ich am Telefon lieber nicht sagen. Könnten wir uns vielleicht treffen?«
Annika sackte in sich zusammen, wollte nicht, hatte nicht die Kraft.
»Bengtzon!«
Ingvar Johansson baute sich vor ihr auf.
»Einen Moment, bitte«, sagte sie in den Hörer und drückte ihn an die Brust. »Was ist?«
»Wenn Sie sonst nichts zu tun haben, können Sie das doch eingeben.« Der Nachrichtenchef hielt ihr einen Stapel Sportergebnisse aus den unteren Ligen entgegen.
Die Frage traf Annika wie ein Faustschlag in den Magen. Nein, verdammt noch mal! Sie wollten sie für etwas ausnutzen, was sie als Vierzehnjährige beim Katrineholms-Kuriren gemacht hatte: Ergebnisse in Tabellen einfügen.
Sie wandte sich von Ingvar Johansson ab, hob den Hörer wieder ans Ohr und sagte:
»Ich könnte mich jetzt mit Ihnen treffen, auf der Stelle.«
Die Frau war freudig überrascht.
»Schon heute Abend? Wie schön!«
Annika biss die Zähne zusammen, spürte den Blick des Nachrichtenchefs im Nacken.
»Wo wäre es Ihnen recht?«, fragte sie.
Die Frau nannte den Namen eines Hotels in einem Vorort, wo Annika noch nie gewesen war.
»Sagen wir, in einer Stunde?«
Ingvar Johansson war nicht mehr da, als sie auflegte. Schnell zog sie ihre Jacke an, hängte sich die Tasche über die Schulter und sprach mit dem Hausmeister. Natürlich waren keine Dienstwagen da, sodass sie sich ein Taxi rief. In ihrer Freizeit machte sie immer noch, was sie wollte.
Füll deine dämlichen Tabellen doch selber aus, du Wichser.
»Bist du fertig, Liebling?«
Seine Frau stand im Mantel im Türrahmen des Wohnzimmers und zog sich ihre Nappalederhandschuhe an.
Er hörte seine eigene Verwunderung.
»Fertig für was?«
Sie zerrte gereizt an dem dünnen Leder.
»Der Bund der Selbstständigen«, antwortete sie. »Du hast versprochen mitzukommen.«
Thomas faltete seine Abendzeitung zusammen und setzte die Füße auf den gekachelten Fußboden mit Fußbodenheizung.
»Ja, natürlich«, sagte er. »Entschuldige. Das hatte ich völlig vergessen.«
»Ich geh schon mal raus und warte auf dich«, meinte sie, machte auf dem Absatz kehrt und verschwand.
Er seufzte leise. Zum Glück hatte er sich wenigstens schon geduscht und rasiert.
Er ging ins Schlafzimmer hinauf, zog Jeans und T-Shirt unterwegs aus, warf sich in ein weißes Hemd und einen Anzug, schlang sich eine Krawatte um den Hals. Er hörte den BMW draußen starten und ungeduldig aufheulen.
»Ja, ja«, sagte er.
Das Licht war im ganzen Haus noch an, aber er hatte weiß Gott nicht vor, eine Runde zu drehen und alles auszumachen. Er ging mit dem Mantel über dem Arm und ungeschnürten Schuhen hinaus, rutschte auf einer vereisten Stelle aus und wäre beinahe hingefallen.
»Man könnte übrigens Sand streuen«, kommentierte Eleonor.
Er antwortete nicht, schlug die Beifahrertür zu und stützte sich am Armaturenbrett ab, als sie auf die Östra Ekuddsgatan bog. Seine Krawatte band er während der Fahrt, die Schnürsenkel würde er zuknoten, bevor er hineinging.
Es war dunkel geworden. Wohin war dieser Tag verschwunden? Er ging zu Ende, ehe er richtig begonnen hatte. War es überhaupt hell gewesen?
Er seufzte.
»Wie geht es dir, mein Lieber?«, fragte sie, jetzt freundlich.
Er starrte zum Fenster auf das Meer hinaus.
»Ich fühle mich nicht so gut«, sagte er.
»Vielleicht ist es dieses Virus, das auch Nisse hatte«, meinte sie. Er nickte desinteressiert.
Der örtliche Bund der Selbstständigen. Er wusste genau, worüber sie reden würden, über Touristen. Wie viele es waren, wie man mehr anlocken und diejenigen an sich binden konnte, die einmal den Weg in ihre Stadt gefunden hatten. Man würde die Probleme diskutieren, die man mit Geschäftsbesitzern hatte, die nur während der Sommermonate da waren und den Ortsansässigen den Verdienst abspenstig machten. Man würde über das gute Essen im Vaxholms Hotel, die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt, die Öffnungszeiten abends und am Wochenende reden. Alle würden da sein. Alle würden froh und engagiert sein. So war es immer, ganz gleich, zu welcher Veranstaltung sie gingen. In der letzten Zeit war es oft um Kunst gegangen, aber auch um die Gemeinde und darum, alte Häuser und Gärten zu bewahren, und wenn möglich sollte immer jemand anders dafür bezahlen.
Er seufzte wieder.
»Jetzt reiß dich zusammen«, sagte seine Frau.
»Annika Bengtzon? Ich bin Rebecka Björkstig.«
Die Frau war jung, viel jünger, als Annika geglaubt hatte. Klein, schmal, zerbrechlich wie Porzellan. Sie gaben sich die Hand.
»Ich muss mich für den seltsamen Treffpunkt entschuldigen«, sagte Rebecka Björkstig, »aber wir können nicht vorsichtig genug sein.«
Sie gingen durch einen verlassenen Korridor und gelangten in eine Hotellobby mit Bar. Die Beleuchtung war spärlich, und die Atmosphäre erinnerte an die staatlichen Hotels in der alten Sowjetunion. Runde braune Tische mit Sesseln, deren Rücken- und Armlehnen in der gleichen Farbe gehalten waren. In der gegenüberliegenden Ecke unterhielten sich leise ein paar Männer, ansonsten war das Lokal leer.
Annika hatte das surrealistische Gefühl, in einem alten Agentenroman gelandet zu sein, und verspürte intensiv den Wunsch zu fliehen. Was machte sie hier bloß?
»Wie schön, dass wir uns so kurzfristig treffen konnten«, sagte Rebecka Björkstig und setzte sich an einen Tisch, wobei sie über ihre Schulter vorsichtige Blicke zu den Männern im hinteren Teil des Raums warf.
Annika murmelte etwas Unverständliches.
»Wird das morgen in der Zeitung erscheinen?«, wollte die Frau wissen und lächelte hoffnungsvoll.
Annika schüttelte den Kopf. Ihr war in der stickigen Luft leicht schwindlig.
»Nein, sicher nicht. Es ist noch gar nicht gesagt, dass wir überhaupt etwas darüber bringen. Der Herausgeber entscheidet über alle Veröffentlichungen.«
Sie sah auf die Tischplatte hinunter, verlogen, ausweichend.
Die Frau strich ihren hellen Rock glatt, fuhr sich über das streng nach hinten gekämmte Haar.
»Über welche Themen schreiben Sie denn so?«, erkundigte sie sich und versuchte Annikas Blick auf sich zu ziehen. Ihre Stimme war hell und ein wenig matt.
Annika räusperte sich.
»Im Moment besteht meine Arbeit vor allem darin, Texte zusammenzustellen und durchzugehen«, erwiderte sie wahrheitsgemäß.
»Welche Art von Texten?«
Sie strich sich über die Stirn.
»Alle möglichen. Heute Nacht ging es um den Orkan, vor ein paar Tagen habe ich den Fall eines behinderten Jungen bearbeitet, bei dem sich die Stadtverwaltung geweigert hat, ihrer Verantwortung gerecht zu werden …«
»Ah!«, sagte Rebecka Björkstig und legte die Beine übereinander.
»Dann fällt unser Tätigkeitsbereich ja genau in Ihr Ressort. Städte und Gemeinden sind unsere wichtigsten Auftraggeber. Könnte ich bitte eine Tasse Kaffee bekommen?«
Ein Kellner mit einer schmutzigen Schürze war neben ihnen aufgetaucht. Annika nickte kurz, als er fragte, ob sie auch eine wolle. Ihr war schlecht, sie wollte nach Hause, wollte weg. Rebecka Björkstig lehnte sich gegen die geschwungene Rückenlehne ihres Stuhls. Ihre Augen waren hell und rund, sanft und ausdruckslos.
»Wir sind eine gemeinnützige Stiftung, aber unsere Arbeit muss natürlich bezahlt werden. Es sind häufig die Sozialämter in verschiedenen Städten im ganzen Land, die unsere Unkosten tragen. Wir verdienen keinen Pfennig daran.«
Die Stimme war immer noch gleich bleibend sanft, aber dennoch hatten die Worte einen harten Klang.
Sie ist nur aufs Geld aus, dachte Annika und sah zu der Frau auf. Sie macht das, um sich auf Kosten von bedrohten Frauen und Kindern zu bereichern.
Die Frau lächelte.
»Ich weiß, was Sie denken. Ich versichere Ihnen, dass Sie sich irren.«
Annika sah zu Boden, fingerte an einem Zahnstocher herum.
»Warum haben Sie gerade heute Abend gerade uns angerufen?« Rebecka Björkstig seufzte und wischte sich die Fingerspitzen an einer Serviette ab, die sie in der Tasche hatte.
»Offen gesagt, wollte ich nur anrufen, um mich zu erkundigen«, meinte sie. »Ich habe in der Zeitung über die Verwüstungen durch den Orkan gelesen und sah die Telefonnummer im Impressum. Wir erwägen schon eine ganze Weile, mit unserer Arbeit an die Öffentlichkeit zu treten, aber mein Anruf war ein wenig spontan, könnte man sagen.«
»Ich habe noch nie von Ihrer Organisation gehört«, sagte Annika. Die Frau lächelte wieder. Es war ein Lächeln, das so flüchtig war wie der Luftzug in einem Raum.
»Bislang hatten wir noch nicht die Mittel, den Zustrom aufzufangen, der aller Wahrscheinlichkeit nach auf uns zukommen wird, wenn wir an die Öffentlichkeit gehen, aber das hat sich geändert. Heute haben wir die Mittel und die Kompetenz, zu expandieren, und deshalb ist es uns wichtig, nicht länger zu zögern. Es gibt so viele, die unsere Hilfe benötigen.«
Annika holte Stift und Notizblock aus ihrer Tasche.
»Erzählen Sie mir, worauf das Ganze hinausläuft.«
Die Frau warf erneut einen Blick in die Runde und wischte sich die Mundwinkel ab.
»Unsere Arbeit setzt da an, wo die Möglichkeiten der Behörden erschöpft sind«, sagte sie ein wenig gehetzt. »Wir sind ausschließlich dafür zuständig, wirklich bedrohten Menschen zu einem neuen Leben zu verhelfen. Drei Jahre lang haben wir dafür gearbeitet, dass unser System funktioniert. Jetzt sind wir sicher, dass es klappt.«
Annika wartete schweigend.
»Und wie?«
Der Kellner kam mit dem Kaffee. Er war grau und bitter. Rebecka Björkstig legte eine Serviette zwischen Tasse und Untertasse und rührte mit dem Löffel in dem Gebräu.
»Unsere Gesellschaft ist heute auf allen Ebenen so computerisiert, dass niemand ihr entgehen kann«, sagte sie leise, nachdem die Bedienung wieder verschwunden war. »Wohin diese Menschen sich auch wenden, es gibt immer Personen, die ihre neue Adresse, neue Telefonnummer, neue Kontonummer, ihren neuen Mietvertrag kennen. Auch wenn alle Angaben streng vertraulich behandelt werden sollten, so sind sie doch verfügbar in Krankenblättern im Krankenhaus, auf dem Sozialamt, beim Amtsgericht, in Steuerregistern, Firmenregistern, überall.«
»Kann man da nicht irgendetwas machen?«, fragte Annika vorsichtig. »Gibt es keine Möglichkeit, die Adressen aus den Registern zu streichen, eine neue Personennummer zu bekommen und so weiter?«
Der Frau entfuhr ein weiterer schwacher Seufzer.
»Oh, doch, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das Problem ist nur, dass sie nicht funktionieren. Unsere Stiftung hat einen Weg gefunden, Menschen vollständig zu löschen. Wussten Sie, dass es über sechzig öffentliche Computerregister gibt, in denen praktisch alle Schweden verzeichnet sind?«
Annika brummte verneinend, der Kaffee war wirklich widerwärtig.
»Das erste halbe Jahr habe ich nur damit verbracht, all diese Register aufzulisten. Ich arbeitete Pläne und Vorgehensweisen aus, um sie zu umgehen. Es gab zahlreiche offene Fragen, und die Antworten waren manchmal nur schwer zu finden. Die Organisation, die aus unserer Arbeit entstanden ist, ist einzigartig.«
Die letzten Worte hingen im Raum. Annika nahm einen Schluck von der grauen Brühe und verschüttete ein wenig, als sie die Tasse abstellte.
»Was hat Sie dazu bewegt, sich in dieser Sache zu engagieren?«, fragte sie.
Das Schweigen wurde beklemmend.
»Ich bin selbst Opfer solcher Bedrohungen gewesen«, antwortete die Frau.
»Aus welchem Grund?«, hakte Annika nach.
Die Frau räusperte sich, zögerte, wischte sich mit der Serviette die Handgelenke ab.
»Sie müssen entschuldigen, aber ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Es ist ein so lähmendes Gefühl. Ich habe mir mein neues Leben hart erarbeitet und will mir meine Erfahrungen zu Nutze machen.«
Annika sah Rebecka Björkstig an, die so kalt und gleichzeitig sanft war.
»Erzählen Sie mir mehr über Ihre Arbeit«, sagte sie.
Rebecka Björkstig schlürfte vorsichtig etwas Kaffee in sich hinein. »Wir machen unsere Arbeit in Form einer gemeinnützigen Stiftung, der wir den Namen Paradies gegeben haben. Im Grunde machen wir gar nichts Besonderes, wir geben den bedrohten Menschen nur ihren Alltag zurück. Aber für jemanden, der verfolgt wurde und weiß, was Terror und Schrecken bedeuten, für einen solchen Menschen ist sein neues Dasein das reinste Paradies.« Annika starrte, von dem banalen Klischee peinlich berührt, auf ihren Notizblock.
»Und wie stellen Sie das an?«
Die Frau lächelte kurz, klang selbstsicher und unbeirrbar.