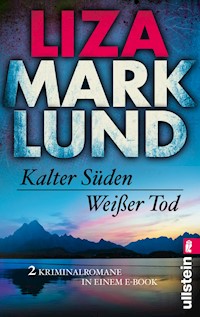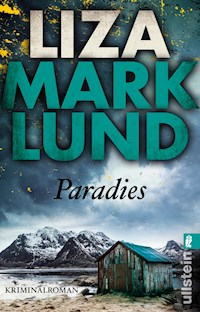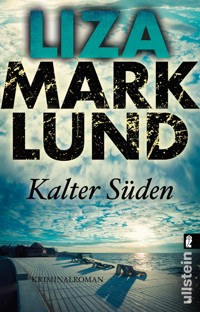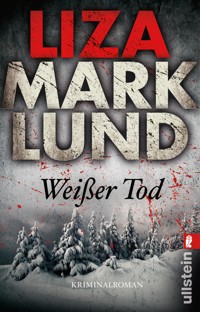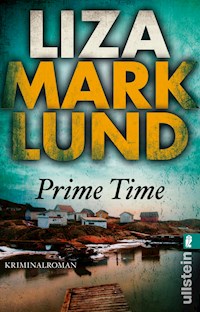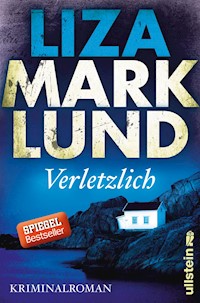
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Ein Highlight des Schweden-Krimis Plötzlich findet sich die Journalistin Annika Bengtzon in der Hölle wieder. Dabei wollte sie mit ihrer neuen großen Liebe Jimmy Halenius und den Kindern in Stockholm einen Neuanfang wagen. Privat mit Vielem abschließen, sich beruflich verändern. Doch plötzlich ist ihre Schwester Birgitta verschwunden. Auf der Suche nach ihr begegnet Annika ein letztes Mal den Dämonen ihrer Vergangenheit. Ausgezeichnet mit dem Radio Bremen Krimipreis!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Plötzlich findet sich die Journalistin Annika Bengtzon in der Hölle wieder. Dabei wollte sie eigentlich mit ihrer neuen großen Liebe Jimmy Halenius und den Kindern noch einmal einen Aufbruch wagen. Privat mit Vielem abschließen, sich beruflich verändern. Doch plötzlich ist ihre Schwester Birgitta verschwunden. Auf der Suche nach ihr begegnet Annika den Dämonen ihrer Vergangenheit.
Die Autorin
Liza Marklund, geboren 1962 in Piteå, arbeitete als Journalistin für verschiedene Zeitungen und Fernsehsender, bevor sie mit der Krimiserie um Annika Bengtzon international eine gefeierte Bestsellerautorin wurde.
Liza Marklund
Verletzlich
Kriminalroman
Aus dem Schwedischen
von Dagmar Lendt
Ullstein
Die Originalausgabe erschien 2015
unter dem Titel Järnblod
bei Piratförlaget, Stockholm.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1314-6
© 2015 by Liza Marklund
© der deutschsprachigen Ausgabe
2016 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © Plainpicture.de / Anders Tukler
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Montag, 1. Juni
Dies war die letzte Leiche.
Es war ein starkes Gefühl, wie ein Abschied. Er atmete tief ein, ließ sein ganzes Ich vom Rauschen der Baumkronen durchdringen.
Wie schön war dieser Ort in seiner Kargheit und Genügsamkeit, fast sakral war er mit den Jahren geworden: der Moränenboden, das silbergrau schimmernde Totholz, die Birken mit ihren Kätzchen.
Acht hatten sie hier abgelegt, dies war die neunte. Er erinnerte sich an jede einzelne, nicht so sehr an ihre Gesichter wie an ihre Töne, ihre Frequenzen, an die Schwingungen, die ihr Leben ausgemacht hatten.
Jetzt nicht mehr.
Die letzte Leiche.
Er blickte auf den toten Körper zu seinen Füßen.
Jeans und Turnschuhe, T-Shirt, Gürtel, braune Jacke. Ein prächtiges Exemplar des Homo sapiens, er hatte Gelegenheit gehabt, dieses hier näher kennenzulernen. Ordentliche Kleidung, wie sie ihm selbst auch gefallen hätte. Manchmal tat es ihm weh, dass er all die schönen persönlichen Dinge vernichten musste, er, der in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen und dazu erzogen worden war, dankbar und verantwortungsvoll mit den Ressourcen der Erde umzugehen.
Er betrachtete den Himmel. Wie niedrig er hier oben am Polarkreis war, die Wolken zogen tief über den Köpfen der Menschen hinweg, kämmten ihre Augenbrauen. Bald würde die Sonne nicht mehr untergehen, erst wieder im Herbst, wenn die Kälte das Laub von den Bäumen biss und der russische Winter aus dem Osten hereinbrach.
Er trauerte um seinen Bruder.
Ihr Leben lang waren sie eins gewesen, einer das Spiegelbild des anderen, hatten Gedanken und Gefühle geteilt, doch nun ahnte er den Abgrund. Er hielt sich auf dem Laufenden über die Ereignisse im Gerichtssaal, aber die Einsamkeit quälte ihn, und Qualen hatte er noch nie gut ertragen.
Sorgfältig wischte er das Bolzenschussgerät am Moos ab.
Er musste den Schmerz mit jemandem teilen.
»Sie sind zusammengebrochen«, sagte die Psychologin. »Was ist passiert?«
Annika Bengtzon wand sich im Sessel, sie fühlte sich schmal und verloren in dem klobigen Möbel. Sie umklammerte die Armlehnen, um nicht zu ertrinken, ihre Handflächen waren feucht. Wie viele hatten vor ihr hier gesessen und Blut und Wasser geschwitzt? Hatten ihre angsterfüllten Ausdünstungen in den groben Stoff einziehen lassen? Sie nahm hastig die Hände von den Armlehnen und faltete sie fest auf dem Schoß.
»Ich war im Gesundheitszentrum und beim Betriebsarzt«, sagte sie. »Man hat mich von Kopf bis Fuß gründlich untersucht, aber körperlich fehlt mir nichts … Ja, und da meinte Jimmy, das ist mein Lebensgefährte, dass ich hierher gehen sollte.«
»Es war also nicht Ihre eigene Entscheidung?«
Eine sachliche Frage, die keine Kritik enthielt. Annika sah schnell zu der Frau auf der anderen Seite des Holztisches hinüber, deren Gesicht ebenso neutral war wie ihre Stimme und Frisur. Was dachte sie eigentlich? Fand sie es albern, dass Annika in ihre Sprechstunde kam? Dass sie jemandem, der es wirklich nötig hatte, den Platz wegnahm? Oder freute sie sich einfach über das Geld?
Annika griff nach dem Glas Wasser auf dem Tisch. Neben dem Glas stand eine Pappschachtel mit Papiertaschentüchern. Wurde von ihr erwartet, dass sie hier saß und heulte? Taten das alle? Und wenn sie nicht weinte, machte sie dann etwas falsch?
»Ich musste etwas unternehmen, wegen der Kinder. Ich mache ihnen Angst. Oder besser gesagt, ich habe ihnen Angst gemacht, an dem Tag.«
»Als die Kinder Sie während einer Panikattacke fanden?«
Annika rutschte wieder im Sessel herum, ihre Beine waren taub wie zwei Stöcke, ihr Rücken verspannt und hart. Es war unmöglich, eine bequeme Stellung zu finden, sie gab es auf und versuchte, sich zu entspannen.
»Können Sie mir mehr über die Attacke erzählen?«
Das Licht der Deckenlampe spiegelte sich in der Brille der Psychologin, für die es ein ganz normaler Arbeitstag war, vielleicht würde sie in der Mittagspause Lasagne essen, einen Spaziergang machen und Kleider aus der Reinigung abholen.
»Ich … es war in der Diele. Ich bin einfach zusammengesackt, bekam keine Luft mehr, mir wurde schwarz vor Augen … Genau in dem Moment sind Serena und Jacob von der Schule gekommen, das sind Jimmys Kinder, und … na ja, sie haben den Rettungswagen gerufen.«
Sie trank noch etwas Wasser, es war lauwarm und schmeckte scheußlich.
»Die Sanitäter sind mit Trage und allem Drum und Dran nach oben gekommen, aber ich konnte sie ja gleich wieder wegschicken.«
»Also wussten Sie, was mit Ihnen los war?«
Das Dunkel, das dort draußen lauerte, unmittelbar außerhalb ihres Blickfelds, die Schatten, die sie umkreisten und ihr den Atem und die Sinne und das Bewusstsein raubten, sie waren nicht gefährlich, nicht gefährlich, nicht gefährlich, sie verschwanden auch wieder, man starb nicht davon. Man fühlte, wie die Hände brannten und es in den Augen stach und der Kopf in den Nacken fiel, wie einem die Beine versagten und die Luft ausging, und dann kam die Dunkelheit und verschluckte einen und man fiel und fiel und fiel. Es war nicht gefährlich, man starb nicht davon, bisher nicht, nie.
Sie räusperte sich.
»Mir fehlt nichts. Ich bin kerngesund.«
»Wissen Sie, was ein Paniksyndrom ist?«
Ja, sie hatte gegoogelt, verschämt, heimlich. Gewöhnliche, normale, gesunde Menschen ließen sich nicht von Dunkelheit und Gespenstern beherrschen.
»Aber jetzt ist mein Leben wieder in Ordnung, jetzt geht es mir überhaupt nicht schlecht. Ich habe keine Angst, wirklich nicht.«
»Man kann durchaus Angst haben, ohne es zu wissen«, sagte die Psychologin. »Viele Leute, die eine Panikattacke erleiden, halten es für einen Herzinfarkt und fahren in die Notaufnahme.«
»Aber warum ist es schlimmer geworden?«
»Die Anfälle werden also schwerer, meinen Sie?«
Annika blickte aus dem Fenster. Es hatte den ganzen Morgen geregnet, die Tropfen liefen immer noch langsam die Scheibe herunter, vielleicht hatte es inzwischen aufgehört, oder wenigstens fast.
»Ich verstehe das gar nicht, mir ist es noch nie so gut gegangen. Ich … wir haben eine wunderbare Beziehung, mit den Kindern läuft es auch gut, ich habe einen Job, der mir Spaß macht, mein Exmann benimmt sich zivilisiert. Ich habe mich sogar mit Sophia angefreundet, das ist die Frau, mit der er mich früher betrogen hat …«
»Was meinen Sie denn selbst, woran es liegt?«
Plötzliche Wut flammte aus dem Nichts auf, musste sie denn jetzt alle Antworten parat haben? Wofür bezahlte sie eigentlich so viel Geld? Sie spürte, wie ihre Kiefermuskeln sich anspannten.
»Ihr Vater ist gestorben, als Sie ein junges Mädchen waren«, fuhr die Psychologin fort und blätterte in ihren Unterlagen. »Standen Sie ihm nahe?«
Ah ja, jetzt sollte sie also ihre Kindheit ausbreiten. Annika wischte sich die Hände an den Oberschenkeln ab.
»Das ist schon so lange her, über zwanzig Jahre …«
Es wurde still im Zimmer. Draußen auf der Straße lärmte der Verkehr. Die Papiertaschentücher im Pappkarton wehten leicht in einem unsichtbaren Luftzug. Der Sesselbezug kratzte im Rücken.
»Aber Ihre Mutter lebt noch? Wie ist Ihre Beziehung zu ihr?«
Annika blickte auf ihre Armbanduhr.
»Wie lange müssen wir noch machen? Wann kann ich gehen?«
Die Psychologin lehnte sich in ihrem Sessel zurück, spürte sie auch, dass der Bezug kratzte?
»Wir können sofort aufhören, wenn Sie möchten.«
Annika blieb sitzen, fühlte sich auf einmal bleischwer, wurde sie jetzt rausgeworfen? Obwohl sie diese Sitzung bezahlte? Mit elfhundert Kronen pro Stunde?
»Wollen Sie, dass ich gehe?«
Die Psychologin warf einen Blick zur Uhr an der Wand.
»Die Zeit ist noch nicht um«, sagte sie. »Sie können selbst entscheiden, ob Sie gehen oder bleiben möchten.«
Der Raum zog sich zusammen, drückte auf ihren Nacken, war sie denn nicht hier, um Hilfe zu erhalten? Beratung?
Die Frau lächelte sie an.
»Ich hätte gern, dass Sie bleiben.«
Der Verkehrslärm entfernte sich. Wonach hatte sie gefragt? Nach ihrer Mutter, Barbro?
Annika nahm innerlich Anlauf, die Dunkelheit wirbelte hinter ihrem Rücken.
»Sie … meine Mutter kann mich nicht leiden.«
»Warum glauben Sie das?«
»Meine Eltern mussten heiraten, weil ich unterwegs war, Mama konnte ihre Ausbildung als Künstlerin nicht machen. Das hat sie mir nie verziehen.«
Die Psychologin sah sie eine ganze Weile stumm an, dann blickte sie wieder auf ihre Notizen.
»Sie haben eine Schwester, Birgitta …? Wie ist Ihr Kontakt zueinander?«
Annika versuchte zu lächeln.
»Als sie ihr Kind bekam, habe ich es auf Facebook erfahren, ich wusste gar nicht, dass sie schwanger war.«
»Ist das schon immer so gewesen?«
»Als Kinder haben wir uns ein Zimmer geteilt, bis zu meinem Auszug, und jetzt weiß ich nicht mal, wo sie wohnt.«
Die Psychologin nickte und machte sich Notizen auf ihrem kleinen Block.
»Auf dem Formular, das Sie vor der Sprechstunde ausgefüllt haben, geben Sie unter ›Sonstiges‹ an, Sie seien vor fünfzehn Jahren wegen einer Straftat verurteilt worden. Möchten Sie mir mehr darüber erzählen?«
»Fahrlässige Tötung. Zwei Jahre auf Bewährung. Mein Freund, Sven. Das war … ja, ein Unfall, kann man sagen …«
Die Worte hallten durch das kleine Zimmer. Die Psychologin zeigte keine Reaktion. Sie saß in ihrem Sessel auf der anderen Seite des Tisches, die Beine übereinandergeschlagen und die Hände auf dem Schoß gefaltet.
»Was fühlen Sie, wenn Sie darüber sprechen?«
Ein Pfeifen ertönte in Annikas Kopf, ein durchdringender, hartnäckiger Ton aus dem Nichts. Sie musste lauter reden, um sich selbst zu hören.
»Nichts Besonderes. Fünfzehn Jahre, das ist eine lange Zeit.«
»Wo im Körper sitzt das Gefühl? Im Bauch, im Hals, in der Brust?«
Es waren nur Worte. Sie konnten ihr nichts anhaben. Wenn sie einfach das Rauschen ausblendete, konnte sie reden, es hatte keine Bedeutung mehr, ihr Ich musste nur kompakter werden als die Dunkelheit draußen, dann konnte sie atmen.
Die Hauptredaktion des Abendblatts schimmerte wie immer in einem bläulichen Licht. Als sie Berit Hamrin an ihrem Rechner sitzen sah, fiel alle Spannung von Annika ab, nur ein leichter Kopfschmerz blieb. Seit fünfzehn Jahren verbrachte sie den größten Teil ihrer wachen Zeit in diesem Raum, auf der nie endenden Jagd nach dem, was passiert war oder passieren könnte, und fast ebenso lange saß ihre Kollegin Berit Hamrin auf dem Stuhl neben ihr.
Sie ließ ihre Tasche auf Berits und ihren gemeinsamen Schreibtisch fallen, zog die Jacke aus und warf sie über die Armlehne ihres Stuhls. Ihre Kollegin war älter als sie, hatte erwachsene Kinder und wohnte mit ihrem Mann auf einem Bauernhof auf dem Land.
»Wie steht’s mit dem Twitter-Streit?«, fragte Annika.
Berit seufzte leicht.
»Die Fernsehfrau hat sich in einem neuen Tweet für ihre Behauptung über den Soap-Star entschuldigt, und der Soap-Star hat die Entschuldigung in einem Post auf Facebook angenommen.«
Das enge Sprechzimmer der Psychologin glitt davon und löste sich in Luft auf.
»Ist das nicht schön, alle haben sich wieder lieb«, sagte Annika.
Das Dunkel um sie herum, alles, was sie verschluckte und erstickte, zog sich in einen fernen Winkel zurück. Wenn sie in der Redaktion war, blieb es fast immer an seinem Platz. Hier gab es ein Licht, technisch und künstlich, das die Welt klar und deutlich machte. Die Deutung der Wirklichkeit, die verschiedenen Auflagen, die konstante Veränderung – sie, Annika, war ein funktionierender, integrierter Teil davon. Die Waldauflage, genannt Fünfkreuz, die Ausgabe der Zeitung, die als Erstes rausging, von Auftragsdruckereien draußen im Land gedruckt oder per Transportflugzeug im Morgengrauen ausgeliefert; Dreikreuz, die aktualisierte Vorstadtauflage, per Lastwagen im gesamten Mälardalen ausgeliefert; Einkreuz, die Innenstadtauflage für Katastrophen und Prinzessinnenverlobungen: Das war die Wirklichkeit, strukturiert und leicht zu handhaben.
Und dann gab es noch Siebenkreuz, ihr ganz persönliches Hassobjekt, die Ausgabe, die nur im internen Netzwerk der Redaktion existierte.
Annika packte den Laptop aus und holte sich einen Kaffee, während der Computer hochfuhr. Anschließend setzte sie sich mit dem bitteren Gebräu in der Hand an den Rechner und wappnete sich innerlich.
Siebenkreuz enthielt, was die Ressortchefs sich an Nachrichten für die morgige Ausgabe wünschten, die Zukunft, wie sie sein sollte, mit fertigen Schlagzeilen und oft auch schon mit Fotos und Bildunterschriften, es lag nur noch an den Reportern, die Wirklichkeit so einzufügen, dass sie zur Utopie passte.
Aufmacher der hypothetischen morgigen Ausgabe war Berits Story: Die Fernsehfrau – sie war Leitartikel-Redakteurin bei einer Lokalzeitung und moderierte jeden dritten Mittwoch eine Satiresendung, die das Frühstücksfernsehen parodierte – hatte eine bösartige Bemerkung über die Gewichtszunahme einer ehemaligen Soap-Darstellerin getwittert. Patrik Nilsson, Nachrichtenchef des Abendblatts, besaß ein unglaubliches Talent, die besonders unbedeutenden und gedankenlosen kleinen Gemeinheiten aus dem Internet zu fischen und sie in der Zeitung zu einem richtigen Skandal aufzublasen. Und auch diesmal hatte er sich nicht lumpen lassen:
TV-MODERATORIN: ROSA IST ZU FETT
lautete die gewünschte Schlagzeile. Unter dem Foto, auf dem eine spindeldürre Blondine zu sehen war, stand: »Rosa ist tief gekränkt über das Mobbing der TV-Moderatorin.«
»Die geplante Empörung in den sozialen Medien ist leider ausgeblieben«, sagte Berit.
Annika verstand. Den Shitstorm im Internet, aus dem das Abendblatt eigentlich zitieren wollte, hatte es nie gegeben (ein paar Postings im Stil von »wieso muss das Aussehen von Frauen immer kommentiert werden« hätten notfalls gereicht, aber offenbar gab es nicht einmal die), und damit würden Rosa und ihre angebliche Kränkung auf den Müllhaufen der Massenmedien wandern, noch ehe es überhaupt so etwas wie eine Kränkung gegeben hatte.
»Ich finde eher, Rosa sollte ein paar Kilo zulegen«, sagte Berit. »Würde ihr nicht schaden. Was machst du heute?«
»Den Mord an Josefin«, erwiderte Annika.
Berit blickte auf und nahm die Brille ab.
»Ich erinnere mich. In dem Sommer, als Schweden eine Bananenrepublik war. Es war heiß wie im Backofen, wir hatten eine irre hohe Inflation und waren Spitze im Fußball.«
»Das ist fünfzehn Jahre her«, sagte Annika. »Damals habe ich das erste Mal einen Artikel mit meinem Namen unterzeichnet.«
Berit setzte die Brille auf und widmete sich wieder dem Rosa-Mobbing. Annika suchte ihr Hintergrundmaterial zusammen.
Im Frühjahr hatten die Leser abgestimmt, über welches zurückliegende Verbrechen sie mehr lesen wollten (das nannte sich Interaktivität und war das Leitwort der neuen Zeit). Annika hatte Artikel und Videoclips über mehrere der alten Strafsachen produziert, die meisten erhielten im Internet eine enorme Anzahl von Klicks. Die Sonderausgaben der Sonntagszeitungen verkauften sich auch gut. Sie war erstaunt über die Popularität der retrospektiven Berichterstattung, die Medien richteten den Blick zurück, in allen Formaten. Das Fernsehen brachte Dokumentarfilme und Reportagen, alle Zeitungen produzierten Sonderbeilagen, bekannte Schriftsteller verfassten Sachbücher über alte Kriminalfälle.
Sie las die Zusammenfassung des Falles durch:
SEXUALMORD AUF DEM FRIEDHOF
An einem brütend heißen Samstagmorgen war die neunzehnjährige Josefin Liljeberg tot hinter einem Grabstein gefunden worden, nackt und erwürgt. Der Mord wurde nie aufgeklärt.
Annika klickte das Abiturfoto der jungen Frau an und betrachtete das Porträt, die weiße Studentenmütze auf den blonden Haaren, die strahlenden Augen. Sie hatte als Stripperin im Sexclub Studio 6 gearbeitet. Annika glaubte zu wissen, wer sie umgebracht hatte: Joachim, Josefins Freund, dem der Sexclub gehörte. Den Club gab es schon lange nicht mehr, aber Joachim war irgendwo da draußen, geisterte vermutlich aalglatt und eiskalt durch die Unterwelt, die sein Zuhause war.
Berit seufzte und blickte auf ihre Armbanduhr.
»Ich glaube, ich muss die arme Rosa fallenlassen«, sagte sie und klappte ihren Laptop zu.
»Gehst du zur Verhandlung?«
Berit beobachtete den Prozess gegen den Holzhändler Ivar Berglund, in den Schlagzeilen »Zimmermann« genannt. Die zweite Verhandlungswoche im Sicherheitssaal des Stockholmer Amtsgerichts hatte gerade begonnen.
»Heute soll die Polizistin aussagen, die ihn festgenommen hat. Weißt du, was Berglund mit dem gefolterten Politiker in Solsidan zu tun hat?«
Annika strich sich die Haare zurück und zwirbelte sie zu einem Knoten zusammen.
Es war nicht leicht, den Überblick über den Fall zu behalten. Der alleinstehende Fünfundfünfzigjährige aus Vidsel in Norbotten war angeklagt, vor einem Jahr einen Stadtstreicher in Nacka brutal ermordet zu haben. Annika hatte die Artikel geschrieben, die zu seiner Festnahme führten. Deshalb hatte sie auch als Erste erfahren, dass er verhaftet worden war. Das Abendblatt war an jenem Nachmittag Gewinner des Auflagenkrieges. Später schrieb sie lange Hintergrundberichte über den Mann, filmte sein Haus und sein Firmengelände. Sie las alle zugänglichen Jahresbilanzen seines Unternehmens, sprach mit seinen Kunden und Nachbarn, kurz gesagt, produzierte das, was im Vokabular der Zeitung »Dramadokumentation« genannt wurde.
»Die Polizistin ist Nina Hoffman, sie hat ihn verhaftet«, sagte Annika. »Wir haben oft darüber geredet, und schreiben darf ich das nicht, aber Nina ist überzeugt, dass der Mord an dem Penner und die Folterung von Ingemar Lerberg auf das Konto von ein und demselben Täter gehen. Zwischen den Verbrechen lagen nur wenige Tage, und es gibt mehrere Hinweise, dass die Fälle zusammenhängen.«
»In der Anklageschrift wird davon nichts erwähnt«, sagte Berit.
»Stimmt. Aber der ermordete Penner war Strohmann in Nora Lerbergs Firma in Spanien. Die Polizei hat am Tatort in Nacka eine Kinderzeichnung gefunden, und genau solche Zeichnungen lagen bei Familie Lerberg im Kinderzimmer. Außerdem war der Typus der Gewalt vergleichbar. Das sind keine Beweise, aber Zufall kann es auch nicht sein. Die Fälle müssen miteinander in Verbindung stehen.«
»Die Anklage gegen Berglund steht auf ziemlich wackligen Beinen«, sagte Berit. »Bin mal gespannt, ob es für eine Verurteilung reicht.«
»Hast du Patriks feuchten Traum im Siebenkreuz gesehen?«, fragte Annika.
Die Wunschschlagzeile im Intranet der Zeitung lautete:
DAS DOPPELLEBEN DES ZIMMERMANNS
So jobbte er als Killer.
Berit schüttelte den Kopf, schulterte ihre Tasche und ging in Richtung Hausmeisterei.
Annika nahm sich wieder Siebenkreuz vor. An diesem Vormittag waren noch weitere erhoffte Nachrichten eingeplant worden. Der Nationalfeiertag rückte näher, und es wurde spekuliert, ob Prinzessin Madeleine sich wohl aufraffte, über den Atlantik zu jetten und gemeinsam mit dem Rest der Königsfamilie an den Feierlichkeiten in Skansen teilzunehmen (Wunschschlagzeile war: LässtMADDE DAS SCHWEDISCHE VOLK IM STICH?, so als bangte die ganze Nation mit angehaltenem Atem, ob das jüngste Königskind seine Wohnung in Manhattan verlassen und in die schlechtsitzende Landestracht schlüpfen würde). Außerdem wurde von einem Spitzensportler erwartet, dass er die ganze Wahrheit über einen möglichen Dopingskandal erzählte, eine Hitzewelle drohte, und die jüngste Meinungsumfrage ergab eine Niederlage für die Regierung bei der Reichstagswahl im Herbst.
»Annika, kannst du was zur Hitzewelle machen?«
Patrik hatte sich vor ihr aufgebaut. Annika warf einen Blick auf ihr Handydisplay.
»Tut mir schrecklich leid«, sagte sie. »Ich habe gleich einen Termin bei der Staatsanwaltschaft.«
Der Nachrichtenchef stöhnte theatralisch und machte auf dem Absatz kehrt. Er wusste genau, dass sie vom Tagesgeschäft freigestellt war, aber wer konnte ihm verdenken, wenn er es trotzdem versuchte?
Sie klappte ihren Rechner zu und packte ihre Sachen zusammen.
Anders Schyman blickte auf den Redaktionssaal, im Bauch ein seltsames Ziehen. Hinter der Glaswand leuchtete der Newsdesk, Patrik Nilsson telefonierte mit zwei Handys gleichzeitig, Sjölander hackte konzentriert seinen nächsten Artikel über Prinzessin Madeleine in die Tastatur, Annika Bengtzon marschierte mit ihrer Schultertasche Richtung Ausgang, und die Ventilatoren der Computer ließen die Luft flimmern.
Die Szene war schmerzhaft vertraut und gleichzeitig so unbeschreiblich fremd, und bald würde es vorbei sein.
Er lehnte sich schwer auf seinem Stuhl zurück und griff nach der Mappe, die ganz oben auf dem Stapel neben ihm lag. Das Protokoll der Vorstandssitzung vom letzten Freitag. Der 29. Mai, das Datum würde in die Geschichte eingehen: Der Tag, an dem der Anfang vom Ende begann. Gutenbergs Zeit war vorbei, das gedruckte Wort hatte ausgedient.
Schyman erhob sich ruhelos und stellte sich so dicht an die Glaswand, dass von seinem Atem die Scheibe beschlug. Was hätte er anders machen können?
Der schwedische Journalismus war fast hundert Jahre lang Hand in Hand mit dem »Volksheim« einhergegangen, war die Verbindung zwischen Staatsmacht und Bürgern gewesen, wenn das eine zusammenbrach, ging das andere unweigerlich denselben Weg. Die Medienwissenschaftler hatten schon vor zwanzig Jahren behauptet, man könne »1990 als Ende einer Epoche betrachten, der Zeit des nationalen Wohlfahrtsstaates und des Journalismus«.
Er hatte ein Vierteljahrhundert, den größten Teil seiner Karriere, auf geborgte Zeit gelebt.
Kein Grund zum Weinen, er konnte das »Volksheim« nicht ganz allein wieder aufbauen.
In einem plötzlichen Impuls drehte er sich um und zog das Buch »Die redigierte Gesellschaft« von Jan Ekecrantz und Tom Olsson aus dem Regal. Er las die unterstrichenen Zeilen im Vorwort, obwohl er sie auswendig kannte:
»… der referierende und reportierende Journalismus ist immer mehr ersetzt worden durch abstrakte Situationsbeschreibungen, bei denen Akteure sich in oft unsichtbare Quellen verwandeln. Der heutige Journalismus ist von einer informierten Vernunft geprägt, die dazu tendiert, Gesellschaftsprobleme in Informationsprobleme und das öffentliche Gespräch in Talkshows und Infotainment zu verwandeln. Offen kommerzieller und Partei ergreifender Journalismus erhält immer größeren Spielraum. Die traditionellen journalistischen Ideale (das zu spiegeln, was tatsächlich geschieht, die Macht zu kontrollieren und zu kritisieren, als Kanal zwischen Regierenden und Regierten zu fungieren) werden kontraproduktiv …«
Er schlug das Buch zu und schloss die Augen.
Wir leben unser Leben, wie wir unsere Tage leben hatte auf der Frühstücksrechnung eines Hotels in Oslo gestanden, wo er im letzten Herbst ein Seminar mit der Eignerfamilie besucht hatte. Die Worte hatten ihn ins Mark getroffen, er erinnerte sich noch genau an seine Reaktion, kalter Schweiß auf den Handflächen: Wie lebte er seine Tage? Wie hatte er sein Leben bisher gelebt? Wie an jenem Tag in Norwegen, in diesem fensterlosen Konferenzraum, als über die Digitalisierung der Medien diskutiert wurde, oder wie am heutigen Tag, an dem die Hoffnung auf die morgigen Schlagzeilen von skrupellosen Frauen abhing, die Gehässigkeiten in sozialen Netzwerken verbreiteten, die niemand las?
Seine Knie schmerzten, er setzte sich wieder und fingerte an den Papierstapeln auf seinem Tisch herum.
Zeit war im Überfluss vorhanden, bis zu dem Moment, an dem sie beinahe zu Ende war. Vielleicht hätte er eine Firma gründen, ein Haus bauen, ein Kind zeugen sollen, etwas schaffen, das Bestand hatte. Aber er hatte nichts von alldem getan, er hatte für den Tag gebaut, nicht für die Zukunft. Sein ganzes Berufsleben hatte er damit verbracht, die Gesellschaft, in der er lebte, zu definieren und zu erklären, sie besser zu machen, gerechter. Was er hatte, war sein Ruf, seine Rolle in der Geschichte der Medien, etwas anderes würde er nicht hinterlassen.
Er blickte auf die Redaktion. Wie sollte er es schaffen?
In all diesen Jahren bei der Zeitung hatte er an ihrer Weiterentwicklung gearbeitet, ununterbrochen, hatte Mitarbeiter für die Stellen herangebildet, die nötig waren, um schwarze Zahlen und fette Schlagzeilen zu schreiben. Aber nicht nur die Branche selbst, auch die Zeiten änderten sich unaufhörlich; ohne Landkarte, getrieben von Adrenalin und Instinkt, steuerte er durch den Dschungel, ein ständiger Slalom zwischen Treibsand und Tretminen. Es war ihm gelungen, eine Reihe von Mitarbeitern zu Schlüsselpersonen im Unternehmen aufzubauen, in den Ressorts Nachrichten, Sport, Unterhaltung, Web, Kultur und TV. Sie mussten sich ihr Arbeitsfeld in der neuen, unbeackerten medialen Landschaft selbst erschließen, und er war stolz auf sie, auf sich, auf seine Weitsicht.
Aber eine weitreichende Funktion hatte er nicht geschafft zu erneuern, eine Version seiner selbst, Anders Schyman 2.0. Ein Publizist mit Meinungsfreiheit im Blut, Respektlosigkeit im Herzen, mit der Technik im Stirnhirn und einem Kompass im Schwanz. Er hatte es nicht geschafft, die Tage waren zu kurz gewesen, zu schnell verstrichen, und jetzt war es zu spät.
Zeit im Überfluss, bis sie plötzlich zu Ende war.
Der objektive, investigative, informierende Nachrichtenjournalismus, wie ihn alle kannten, alle heutigen Akteure – der würde nur ein kurzer Abschnitt in der Geschichte der Menschheit sein, und er, Schyman, er persönlich hatte das Ruder in der Hand gehabt, während sie direkt auf den Untergang zusteuerten.
Der Nieselregen vom Morgen hatte aufgehört und die Straßen matt und dunkel zurückgelassen. Am Nachmittag, wenn die Regenfront nach Norden abgezogen war, würde die Mittelmeerhitze Svealand erreichen, Annika konnte bereits spüren, wie die Feuchtigkeit auf der Haut klebte. Der Verkehr floss zäh wie Sirup, sie hatte darauf verzichtet, den Bus zu nehmen, zu Fuß war sie schneller.
Sie nahm die Abkürzung durch den Rålambshovsparken und tauchte ein in das Labyrinth von Kungsholmen, fand ihren Weg durch Straßen und Gassen, ohne darüber nachzudenken. Sie konnte gehen und gehen und plötzlich irgendwo sein, ohne dass ihr bewusst gewesen wäre, wie sie dorthin gekommen war. Die Häuser neigten sich ihr vertraulich zu, flüsterten Willkommensworte in den Wind, die Steine vergaßen nicht. In diesem Viertel war sie gelandet, als sie damals nach Stockholm zog, in einem heruntergekommenen Mietshaus in der Agnegatan, ohne Warmwasser, das Bad quer über den Hof im Keller. Später hatte sie hier in einer großbürgerlichen Wohnung mit Zimmerflucht zur Hantverkargatan gelebt, zusammen mit Thomas, als die Kinder noch klein waren. Sie hatten ihre Hochzeit dort gefeiert. Und nach der Scheidung von Thomas hatte sie eine Dreizimmerwohnung im Viertel bezogen.
Und es war das Stadtviertel, in dem Josefin Liljeberg gearbeitet hatte, hier war sie gestorben. Annika ging an der Hantverkargatan vorbei, sah das Untersuchungsgefängnis Kronoberg hinter der Feuerwache aufragen, die Trampelpfade, die Grasflächen, die Laubbäume, deren Blätter noch nicht alle dieselbe chlorophyllsatte Grünfärbung hatten. Der Spielplatz an der Kronobergsgatan war voller Leute, Mütter mit ihren Kindern, aber auch einige Väter, das Gelächter und Gekreische berührte etwas in ihr, eine Trauer über das, was gewesen war. Sie ging an Sandkästen, Klettergerüsten, Rutschbahnen vorbei und hinauf zur Hügelkuppe.
»Sexualmord auf dem Friedhof« hatte man den Mord an Josefin genannt, aber das war nicht ganz richtig.
Der Ort, an dem man Josefin gefunden hatte, war ein ehemaliger jüdischer Friedhof, Ende des achtzehnten Jahrhunderts am äußersten Stadtrand angelegt, inzwischen jedoch eingebettet in einen der großen innerstädtischen Parks. Und sie war nicht Opfer eines Sexualmörders, sondern von ihrem Freund erwürgt worden.
Annika ging langsam auf den Zaun zu. In späteren Jahren hatte man den Platz restauriert, die wild wuchernden Pflanzen entfernt, die umgestürzten Grabsteine wieder aufgerichtet. Zweihundertneun Verstorbene ruhten hier, hatte sie gelesen, das letzte Begräbnis hatte 1857 stattgefunden.
Es war etwas Magisches an diesem Ort. Der Lärm der Stadt versank, hier war ein Loch in der Zeit, eine durchsichtige Stille. Sie legte die Hand an die kalten eisernen Zaunstäbe, fuhr mit den Fingern die Kreise und Bögen nach, die stilisierten Davidsterne.
Dieser heiße Sommer damals, ihr erster beim Abendblatt, sie machte Urlaubsvertretung und musste die Anrufe am Lesertelefon entgegennehmen. Das hier war ihre Chance gewesen, sie hatte darauf bestanden, über Josefin schreiben zu dürfen, die ersten Artikel mit ihrem Namen darunter.
Dort hatte Josefin gelegen, gleich hinter dem Zaun.
Im Hintergrund das stumpfe Grau des Steins, die welken Pflanzen, das Schattenspiel der Blätter, die Feuchtigkeit, die Hitze.
Annika hatte in Josefins Augen geblickt, die trüb waren und grau, hatte ihren lautlosen Schrei gehört.
»Er ist davongekommen«, flüsterte sie Josefin zu. »Er hat im Gefängnis gesessen, aber nicht für das, was er dir angetan hat. Vielleicht ist es zu spät.«
Sie merkte, wie ihr die Tränen kamen. Das war die erste Wahrheit gewesen, die sie nie geschrieben hatte, mit den Jahren sollten andere hinzukommen. So lange her und doch so nah. In jenem Sommer lebte Sven noch, sie spürte seine Wut in der Dunkelheit um sich, wie aufgebracht und enttäuscht er gewesen war, dass sie einen Job in Stockholm angenommen hatte, von ihm wegwollte, liebst du mich nicht mehr? Unsicherheit und Angst gingen Hand in Hand, was würde aus ihrem Leben werden?
Das ist daraus geworden, dachte sie und wischte sich die Tränen ab.
Ich bin hiergeblieben, weil ich hierhin gehöre.
Sie ließ den eisernen Zaun los, holte ihre kleine Videokamera heraus und filmte den Friedhof aus freier Hand (sie hatte keine Lust gehabt, ein Stativ mitzunehmen), zoomte auf die Stelle, wo Josefin gelegen hatte, und ließ den Fokus schließlich in den Baumkronen verschwinden. Notfalls musste sie noch einmal herkommen und ein stand-up vor dem Tatort machen, im Moment wusste sie noch nicht, was sie in dem Fall in die Kamera sagen sollte, sie musste erst das Material schneiden und strukturieren.
Sie wandte sich vom Friedhof ab, hatte es plötzlich eilig, von hier wegzukommen, sie wollte nicht Josefin sein, nicht in der Nähe sein.
Rasch machte sie sich auf den Weg zur Staatsanwaltschaft auf Kungsbron. Es war warm geworden, sie begann zu schwitzen. Der Asphalt roch nach Teer.
Ermittlungsakten waren praktisch nie öffentlich zugänglich, so auch im Mordfall Josefin, aber Annika wusste ziemlich genau, was sie enthielten. Aus ihnen war ersichtlich, dass Joachim, Josefins Freund, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ihr Mörder war. Annika hatte beantragt, das Material einsehen zu dürfen, vollständig oder teilweise: Informationen, die als nicht entscheidend für die Aufklärung eingestuft wurden, konnten in Ausnahmefällen herausgegeben werden, auch wenn keine Anklage erhoben worden war.
Der Wind war aufgefrischt, die Wolkendecke riss auf. Sie beschleunigte ihre Schritte.
Fünfzehn Jahre waren vergangen, aber nach dem Mord an Olof Palme war die Verjährungsfrist für Mord abgeschafft worden. Es blieb immer noch Zeit, das Verfahren neu aufzurollen, falls neue Fakten auftauchten oder falls ein Zeuge plötzlich redete, weil jemand einfach die richtigen Fragen stellte.
Das Handy klingelte in den Tiefen ihrer Umhängetasche, sie blieb stehen und kramte es ganz unten zwischen den Kugelschreibern hervor. Auf dem Display sah sie, dass es Barbro war, ihre Mutter.
Annika meldete sich, abwartend.
»Wo bist du?«, fragte Barbro.
Annika blickte sich um, Bergsgatan Ecke Agnegatan, direkt am Polizeihaus.
»Bei der Arbeit, oder, ja, auf dem Weg zu einem Interview mit der Staatsanwaltschaft, wegen einem Mordfall.«
»Geht es um diesen Zimmermann?«
»Nein, um einen anderen …«
»Weißt du, wo Birgitta ist?«
Sie blickte hinauf zu den Dächern, die Wolken flogen über den Himmel. Im Hintergrund lauerte die Dunkelheit.
»Nein, keine Ahnung. Wieso?«
Annika hörte die Angst in ihrer eigenen Stimme. Was hatte sie jetzt wieder falsch gemacht?
»Wann hast du zuletzt von ihr gehört?«
Ja, lieber Himmel, wann war das? Annika strich sich die Haare aus der Stirn.
»Das muss vor gut einem Jahr gewesen sein, sie brauchte einen Babysitter für ein langes Wochenende. Sie und Steven wollten nach Norwegen, sich einen Job suchen.«
»Ja, und danach?«
Annika merkte, wie sich bei ihr Trotz mit Unsicherheit mischten, ihre Kiefermuskeln spannten sich.
»Mama, Birgitta und ich … wir reden nicht so oft miteinander.«
Warum sagte sie das? Warum sagte sie nicht, wie es war? »Meine Schwester und ich haben überhaupt keinen Kontakt, ich weiß nicht mal, wo sie wohnt«.
Sie hörte, wie ihre Mutter in den Hörer schluchzte.
»Was ist denn los?«, fragte Annika und bemühte sich, freundlich zu klingen (nicht ängstlich, nicht sauer, nicht zu unverbindlich).
»Sie ist gestern nicht von der Arbeit nach Hause gekommen.«
»Arbeit?«
»Sie hatte die Tagschicht bei MatExtra. Steven und ich machen uns solche Sorgen.«
Ja, das musste wohl so sein, wenn Barbro sich die Mühe machte, Annika anzurufen.
Sie stellte sich bequemer hin.
»Habt ihr auf ihrer Arbeitsstelle angerufen? Bei ihren Freunden? Sara, habt ihr die gefragt?«
»Steven hat mit ihrer Chefin telefoniert, ich habe mit Sara gesprochen.«
Annika überlegte fieberhaft.
»Ihre alte Zeichenlehrerin, Margareta, die beiden hatten doch viel Kontakt, früher jedenfalls, habt ihr …?«
»Wir haben alle angerufen.«
Natürlich. Annika stand als Letzte auf der Liste.
»Kannst du dir vorstellen, was für Sorgen wir uns machen?« Barbros Stimme wurde schrill.
Annika schloss die Augen, es spielte keine Rolle, was sie sagte oder tat. Sie sah ihre Mutter vor sich, wie sie die Hände rang, mit dem Weinglas spielte, verzweifelt jemanden suchte, dem sie die Schuld geben konnte. Sie konnte ebenso gut sagen, was sie dachte.
»Mama«, sagte sie langsam, »glaubst du, dass Steven die Wahrheit sagt?«
Eine Sekunde Stille.
»Wie meinst du das?«
»Ich könnte mir vorstellen, dass er Birgitta … nicht gut behandelt. Ich fand, er ist ziemlich grob mit ihr umgesprungen, mir kam es fast so vor, als hätte sie Angst vor ihm.«
»Was redest du da? Steven ist in Ordnung.«
»Bist du sicher, dass er sie nicht schlägt?«
Wieder eine Sekunde Pause. Als ihre Mutter antwortete, war ihre Stimme scharf.
»Birgitta ist nicht wie du.«
Damit brach sie das Gespräch ab.
Annika strich sich die Haare aus dem Gesicht. Sie legte den Kopf zurück und schaute die Fassade hinauf, dort oben lag ihre alte Wohnung, in der jetzt ihr Exmann wohnte, oh Gott, diese Straßen hier waren voller Gespenster.
Ein Streifenwagen fuhr langsam vorbei und bog auf den Hof des Untersuchungsgefängnisses. Sie sah flüchtig einen jungen Mann mit wirren Haaren auf dem Rücksitz, vielleicht sollte er verhaftet oder eingesperrt, vielleicht nur verhört werden, und falls er nicht kriminell war, hatte er sich jedenfalls zur falschen Zeit am falschen Ort aufgehalten, oder er wusste etwas, was er besser nicht wissen sollte.
Sie hatte auch einmal in einem Streifenwagen gesessen, damals an jenem Sommertag vor der Fabrik in Hälleforsnäs, als Sven starb, sie hatte ihren toten Kater im Arm gehalten und sich geweigert, ihn herzugeben, den kleinen Whiskas, ihr gelbes Kätzchen, am Ende hatte sie ihn mit ins Auto nehmen dürfen und in sein Fell geweint.
Birgitta hatte ihr das mit Sven nie verziehen. Ihre Schwester war in Sven verknallt gewesen, auf eine irritierende, anhängliche, kleinmädchenhafte Art. Er hatte sich immer einen Spaß daraus gemacht, Birgitta festzuhalten und abzukitzeln, bis sie kreischte, es war etwas unangenehm Intimes an ihren Spielen, Birgitta war ja nur zwei Jahre jünger als sie, blond und zuckersüß.
Annika zog die Schultern hoch und rückte die Tasche zurecht, zögerte einen Moment, tippte dann aber »Birgitta Bengtzon« auf der Mobilapp von hitta.se ein (Birgitta hatte Stevens Nachnamen, Andersson, bei ihrer Heirat nicht angenommen).
Ein Treffer, Branteviksgatan 5 F in Malmö.
Malmö? Hatte sie nicht nach Oslo ziehen wollen?
Thomas sah, wie Annika ihr Handy in die grauenhaft hässliche Umhängetasche steckte und eilig Richtung Scheelegatan ging, ein kleiner wippender Kopf vier Stockwerke unter ihm, dunkles Haar, das im Wind wehte, ohne Schnitt oder Frisur. Er folgte ihr mit den Blicken, so lange er konnte, aber schon nach wenigen Sekunden war sie verschwunden, verschluckt von Autos und Baumkronen. Sein Herz sank, der Puls ging zurück. Er hatte sie zufällig entdeckt (oder vielleicht gab es keinen Zufall, nur Energieströme zwischen Menschen, vielleicht hatte sein Unterbewusstsein ihre Anwesenheit registriert, ihre Gedanken gespürt, die sich um ihn drehten, und er hatte aus dem Fenster schauen müssen, um nachzusehen, was da so brannte), wie auch immer: Da stand sie, den Kopf in den Nacken gelegt, und starrte hinauf zu seinem Schlafzimmerfenster. Er war davon ausgegangen, dass sie ihn besuchen wollte, und hatte beschlossen, nicht zu öffnen; er hatte ihr nichts zu sagen, sie konnte gerne da draußen stehen bleiben, ausgesperrt, und sich hinein sehnen.
Und dann hatte sie einfach auf dem Absatz kehrtgemacht und war gegangen.
Aus der Enttäuschung wurde stechende Wut.
Er war niemand für sie, ein Niemand, an dessen Fenster man vorbeiging und dann stehen blieb und telefonierte, vielleicht mit ihrem neuen Mann, er hoffte es, denn sie wirkte genervt, er sah es sofort daran, wie sie die Hände spreizte. Trouble in paradise? Schon?
Bei dem Gedanken besserte sich seine Laune, er merkte plötzlich, dass er hungrig war, und im Kühlschrank stand leckeres Essen, für Feinschmecker, er brauchte es nur noch aufzuwärmen.
Denn er aß und trank gerne gut, legte Wert auf Lebensqualität und verwandte viel Energie und Engagement darauf, den Alltag stilvoll zu gestalten. Er war so erzogen worden, tatsächlich hatte er schon früh erkannt, wie wichtig und vorteilhaft ein gepflegtes Erscheinungsbild, korrektes Auftreten, ein entgegenkommendes Wesen und gute sprachliche Ausdrucksform waren.
Und deshalb passte er überhaupt nicht in diese schreckliche Wohnung, drei Zimmer unterm Dach in einem alten Arbeiterbezirk ohne Stil und Niveau.
Er öffnete die Kühlschranktür mit dem Haken, nahm die Seezungenfilets mit der Hand (der einzigen) heraus und stellte den Teller in die Mikrowelle.
Und vor allen Dingen war er eigentlich kein Behinderter, es war so wahnsinnig ungerecht, dass es gerade ihn getroffen hatte.
Die Mikrowelle begann zu summen. Ein leichtes Fischgericht zu Mittag, denn am Abend war er zu einem großen Essen geladen, ein repräsentatives Bankett im Speisesaal der Regierungskanzlei.
Der Job dagegen passte ausgezeichnet zu ihm. Seine derzeitige Aufgabe im Justizministerium war hoch angesiedelt; als Beamter mit der Erstellung eines großen Gutachtens für einen parlamentarischen Ausschuss betraut zu werden, das widerfuhr nur Leuten wie ihm.
Er untersuchte die Frage der Anonymität im Internet (ja, offiziell war ein alter, abgedankter Minister der Gutachter, aber er war derjenige, der die ganze Arbeit machte) und sollte eine Abwägung zwischen persönlicher Integrität und Verbrechensbekämpfung treffen. Der Hass im Internet war ein wachsendes Problem. Der Staat brauchte schärfere Werkzeuge, um Menschen zu identifizieren, die andere im Internet beleidigten. Aber wer durfte nach IP-Adressen forschen, wann und mit welchen Mitteln? Die Polizei, die Anklagebehörde oder war dazu ein Gerichtsbeschluss erforderlich? Wie sollte die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden aussehen, welche Auswirkungen hatte es, wenn die Server im Ausland standen? Wie üblich entwickelten sich Technik und Kriminalität schneller, als Behörden und Polizei reagieren konnten, und die Gesetzgebung bildete zweifellos das Schlusslicht.
Staatssekretär Halenius und der Justizminister hatten zusammen mit dem Verwaltungsdirektor die Direktive für die Untersuchung ausgearbeitet, und die sollte nicht zielorientiert, sondern ergebnisoffen sein. Manchmal gab die Regierung eine Untersuchung nur in Auftrag, um sich etwas bestätigen zu lassen, was längst beschlossen war, aber nicht in diesem Fall. Wie das Ergebnis ausfiel, stand also nicht von vornherein fest, sondern lag ganz in seiner Hand. Er konnte seine Arbeitszeit selbst bestimmen, kommen und gehen, wann er wollte, und jetzt war die Untersuchung praktisch abgeschlossen, der Bericht konnte bei der nächsten Kabinettssitzung vorgestellt und danach zur Stellungnahme an die betroffenen Behörden verteilt werden.
Er war, kurz gesagt, ein Vertreter der Macht, jemand, der Verantwortung übernahm und die Zukunft gestaltete.
Die Mikrowelle machte pling, die Seezungen waren heiß, aber sie mussten noch etwas warten. Stattdessen ging er zu seinem Rechner und loggte sich über einen anonymen Server ein, so dass seine IP-Adresse nicht zurückverfolgt werden konnte. Er klickte sich zu einem Diskussionsforum durch, wo er sich eine alternative Identität geschaffen hatte. Dort nannte er sich Gregorius (nach Hjalmar Söderbergs Antiheld Doktor Glas, der von seiner Frau betrogen, von seinem Arzt ermordet worden war). Er hatte in dem Forum vor längerer Zeit mal einen Beitrag gepostet, nur um zu sehen, was passierte. Darin ging es um Annikas Chefredakteur, der Kerl war wirklich ein arroganter Schnösel. Immer noch schrieben Leute Kommentare in seinen Thread, er fand es interessant zu verfolgen, wie sich die Debatte entwickelte.
Er musste eine Weile suchen, bis er seinen Thread fand, der ziemlich tief in der Versenkung verschwunden war, aber dann hatte er ihn.
Gregorius:
Anders Schyman gehört mit einem Baseballschläger in den Arsch gefickt. Auf dass die Splitter einen blutigen Trauerkranz um seinen Anus bilden.
Ihm wurde immer ein bisschen warm, wenn er diese Zeilen las, der Puls ging schneller und auf der Oberlippe bildeten sich kleine Schweißperlen. Es waren keine neuen Kommentare hinzugekommen, seit er das letzte Mal nachgesehen hatte, wie er ein wenig enttäuscht bemerkte. Also scrollte er zu den Kommentaren hinunter, die schon länger dort standen. Der allererste in der Reihe, »hahaha, way to go man! U buttfuck him real good«, war ziemlich repräsentativ für alle, die folgten. Das Niveau der Postings war nicht gerade hoch, zugegeben. Manche Poster regten sich über seine Wortwahl auf, nannten ihn vulgärer Idiot und hirntote Amöbe, aber wie geschmackvoll und geistreich drückten sie sich denn aus?
Nicht, dass er nun gerade stolz auf seinen Thread war, aber wer hatte sich noch nie einen Ausrutscher erlaubt?
Außerdem zeugte es von Interesse und Motivation, dass er sich Kenntnisse aus erster Hand über den Gegenstand seiner Untersuchung verschaffte. Demokratie beruhte darauf, dass auch unangenehme Dinge ein Daseinsrecht hatten. Voltaire hatte gesagt, »Ich verachte Ihre Meinung, aber ich gäbe mein Leben dafür, dass Sie sie sagen dürfen« (obwohl, tatsächlich gesagt hatte er es nicht, aber diese Einstellung ging aus seinem Brief vom 6. Februar 1770 an Abbé le Riche hervor).
Thomas ließ den Blick wieder über seinen Beitrag wandern.
Anders Schyman gehört mit einem Baseballschläger in den Arsch gefickt …
Die Worte standen da, für alle Ewigkeit gesagt, kommentiert und bestätigt.
Er holte tief Luft und klickte die Seite weg. Ruhe breitete sich in ihm aus, der Haken hörte auf zu jucken. Sollte Annika doch unten auf der Straße stehen mit ihrem Handy und der hässlichen Tasche.
Jetzt hatte er ordentlich Hunger, und die Seezungen waren genau richtig durcherhitzt.
Bewundert, respektiert, gefürchtet.
Jemand.
Annika meldete sich am Empfang der Staatsanwaltschaft City an und musste in einem Raum warten, der gut und gerne zu einer Zahnarztpraxis gepasst hätte. Es roch nach Wartezimmer, Putzmitteln und diffusem Unbehagen. Sie war allein, und dafür war sie dankbar.
Oberstaatsanwalt Kjell Lindström, der die Voruntersuchungen im Mordfall Josefin geleitet hatte, war inzwischen im Ruhestand, jetzt hatte Assistenzstaatsanwältin Sanna Andersson den Fall auf dem Tisch.
Diskret holte Annika die Kamera aus der Tasche und filmte minutenlang Einrichtung und Hinweisschilder, vielleicht konnte sie es als Material für den Filmschnitt verwenden. Sie steckte die Kamera wieder ein und griff nach einer alten Nummer von Illustrierte Wissenschaft mit einem Artikel darüber, wie Fische vor 150 Millionen Jahren an Land sprangen, Gliedmaßen entwickelten und später zu Reptilien, Säugetieren und Menschen wurden.
»Annika Bengtzon? Staatsanwältin Andersson hat jetzt Zeit für Sie.«
Sie legte die Zeitschrift weg, nahm ihre Tasche, wurde einen Korridor hinunter geschickt und landete in einem engen Büro. Die Frau, die Annika mit ausgestreckter Hand begrüßte, war knapp dreißig.
»Guten Tag«, sagte sie mit dünner, heller Stimme.
Natürlich, was hatte Annika denn erwartet? Der Fall lag fünfzehn Jahre zurück, klar, dass Josefin im Prioritätensumpf der Justiz wie ein Stein untergegangen war.
»Entschuldigung, dass Sie warten mussten«, sagte Sanna Andersson. »Ich habe in einer Dreiviertelstunde eine Verhandlung im Amtsgericht. Sie sind wegen der Sache Liljeberg gekommen?«
Annika setzte sich auf einen Stuhl und wartete, bis Sanna Andersson an ihrem Schreibtisch Platz genommen hatte.
»Ich habe Einsicht in die Ermittlungsakte beantragt, Josefin Liljeberg war am 28. Juli vor fünfzehn Jahren im Kronobergsparken auf Kungsholmen tot aufgefunden worden …«
»Richtig«, sagte die Assistenzstaatsanwältin, zog eine Schublade auf und nahm eine dicke Akte heraus. »Vor einem Jahr wurde der Fall wieder aufgegriffen, ein Mann hatte gestanden, den Mord begangen zu haben.«
Annika nickte.
»Gustav Holmerud«, sagte sie. »Der Serienmörder. Er hat auch noch andere unaufgeklärte Frauenmorde gestanden.«
Sanna warf ihr einen schnellen Blick zu und widmete sich dann wieder der Akte.
»Ja, er hat im Prinzip wohl alle gestanden, die wir hier haben, und wurde sogar in fünf Fällen verurteilt, bevor jemand die Notbremse gezogen hat. Ich weiß, dass der Generalstaatsanwalt mehrere der Urteile dahingehend überprüft, ob Revision eingelegt werden soll. Hier haben wir es.«
Sie strich mit der Hand über eine Seite der Akte.
»Josefin Liljeberg. Tod durch Erwürgen. Ich bin das gestern Abend noch mal durchgegangen. Eigentlich ein ganz unkomplizierter Fall.«
Sie schlug das Vorsatzblatt auf und überflog das Inhaltsverzeichnis.
»Und Sie haben also die Herausgabe der kompletten Akte beantragt?«
»Ich habe den Fall damals verfolgt, über die gesamte Entwicklung berichtet …«
Sanna Andersson beugte sich über die Papiere.
»Da sind ja einige sensationelle Ingredienzien dabei, ein stadtbekannter Sexclub, ein Minister, der vernommen wurde … Interessieren Sie sich deshalb für den Fall?«
Sie sah Annika ausdruckslos an. Annika öffnete den Mund, konnte aber nicht antworten.
Nein, nicht deshalb. Josefin ist mir zu nahe gekommen, ich wurde sie, sie wurde ich. Ich habe in dem Sexclub, in dem sie arbeitete, einen Job angenommen, ich trug ihren Bikini, ihre Höschen.
»Soweit ich weiß, ist der Fall polizeilich aufgeklärt«, sagte sie stattdessen. »Joachim, ihr Freund, ist schuldig. Er wurde nur deshalb nicht angeklagt, weil sechs Personen ihm ein Alibi gegeben haben.«
Sanna Andersson schlug die Akte wieder zu.
»Völlig richtig«, sagte sie. »Gewalt in der Beziehung muss als Problem für die Volksgesundheit angesehen werden.«
Sanna Andersson warf einen Blick auf das Display ihres Handys.
»Kann ich Sie damit zitieren?«, fragte Annika.
Die Staatsanwältin lächelte.
»Natürlich«, sagte sie und erhob sich. »Ich habe entschieden, dass Sie die Namen der sechs Zeugen erhalten, die Josefins Freund ein Alibi gegeben haben.«
Annika stand ebenfalls auf, völlig verblüfft über die Autorität und Effizienz der jungen Frau.
»Sie haben bei der Vernehmung gelogen«, sagte die Staatsanwältin, »das könnte den Tatbestand der Strafvereitelung erfüllen, und das ist eine Straftat. Aber die ist lange verjährt, rein rechtlich riskieren die Zeugen nichts, wenn sie ihre Aussage jetzt ändern. Vielleicht wollen sie jetzt reden, wenn nicht mit uns, dann vielleicht mit Ihnen.«
Sanna Andersson hielt ihr ein Dokument hin und griff gleichzeitig nach einem braunen Aktenkoffer, der sehr schwer zu sein schien.
»Kann ich zitieren, was Sie über den Generalstaatsanwalt gesagt haben?«, fragte Annika. »Dass er die Möglichkeit prüft, die Verfahren gegen Gustav Holmerud erneut aufzurollen?«
Die Staatsanwältin lachte.
»Netter Versuch! Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss mich wirklich beeilen …«
Annika folgte ihr im Laufschritt, um den Anschluss nicht zu verlieren.
Alles in allem lag Josefin doch nicht auf dem Grund des Prioritätensumpfs.
Der kleine Sicherheitssaal des Stockholmer Amtsgerichts lag ganz oben unterm Dach, strategisch günstig, um Flucht- und Befreiungsversuche zu erschweren. Die Angeklagten hätten ein langes Labyrinth von Fluren und Stockwerken zu überwinden, falls sie auf die Idee kämen zu fliehen.
Nina Hoffman stieg atemlos die letzten Treppenstufen hinauf und blickte zum Eingang des Sicherheitssaals.
Das Aufgebot der Massenmedien war groß, auch an diesem Nachmittag. Die meisten der landesweiten Medien waren vor Ort, sie entdeckte die Reporterin Berit Hamrin vom Abendblatt in der Schlange, die sich an der Sicherheitskontrolle vor den Zuschauerplätzen gebildet hatte.
Nina wies sich aus und wurde in einen engen, fensterlosen Raum gelassen. Die Vertreter der Anklage und der Verteidigung waren bereits da. Eine Energiesparlampe an der Decke verbreitete karges kaltweißes Licht, das nicht ganz bis in die Ecken reichte.
»Bereit, Hoffman?«, fragte Svante Crispinsson und begrüßte sie herzlich. »Die Verteidigung wird Sie hart anpacken, nehmen Sie es nicht persönlich.«
Nina nickte kurz, sie hatte es nicht anders erwartet.
»Behalten Sie einfach einen kühlen Kopf.«
Svante Crispinsson war einer der gewieftesten Juristen bei der Staatsanwaltschaft Norrort, Nina hatte schon oft mit ihm zu tun gehabt. Er galt als ziemlich unstrukturiert, was die eigentliche Ermittlungsarbeit betraf, aber im Gerichtssaal war er ein großer Gewinn, unerschrocken, hartnäckig und unbequem.
»Mal sehen, ob wir die Schöffen wach halten können«, sagte der Staatsanwalt. »Der Herr ganz links nickt gerne zwischendurch ein.«
Nina nahm sich einen Becher Kaffee und setzte sich auf einen Stuhl neben der Tür. Crispinsson beugte sich über seine Unterlagen, blätterte darin und murmelte unhörbar vor sich hin. Sein Anzug war eine halbe Nummer zu groß und sein Haar zu lang, er machte einen etwas verwirrten und wehrlosen Eindruck und wirkte dadurch ehrlich und sympathisch.
Sie straffte die Schultern und starrte an die gegenüberliegende Wand.
Ivar Berglund war schuldig, da war sie sich hundertprozentig sicher. Sein bescheidenes Auftreten war so echt wie eine Drei-Kronen-Münze. Unter seinem unscheinbaren Äußeren lag etwas kriechend Unangenehmes, die kühle Ungerührtheit des Schwerverbrechers. Sie kannte das von früher, sie hatte damit gelebt, viel zu nah, als sie noch viel zu klein dafür war.
Der Kaffee schmeckte bitter.
Als Zeugin auszusagen war der Teil ihrer Arbeit, den sie am wenigsten mochte. Die Hauptverhandlung war ein Schauspiel im Dienst der Rechtssicherheit, Richter und Schöffen sollten überzeugt werden, dass die Kette der Indizien bis zum Urteilsspruch hielt. Sie selbst zog die Dunkelheit hinter den Kulissen vor, die knifflige Spurensuche, das Anpirschen und Einkreisen.
Ein Gong ertönte aus dem Lautsprecher, und die Parteien wurden zur Fortsetzung der Hauptverhandlung im Strafprozess wegen Mordes beziehungsweise Beihilfe zum Mord aufgerufen, Staatsanwalt und Verteidigerin gingen in den Sicherheitssaal. Nina blieb sitzen und wartete, reglos.
Es war üblich, dass zuerst der Angeklagte gehört wurde und danach die Zeugen der Anklage, aber Berglund hatte beantragt, nach allen anderen aussagen zu dürfen. Das war ungewöhnlich, der Richter hatte seinem Antrag jedoch stattgegeben, da Crispinsson zugesichert worden war, er könne einige Zeugen im Anschluss erneut aufrufen.
Kontrolle, dachte Nina. Er will nicht reden, bevor er gehört hat, was alle anderen sagen.
Die Tür zum Gerichtssaal öffnete sich, Nina stand auf und trat in das blendende Tageslicht, ging geradewegs auf den Zeugenstand zu, ohne nach rechts oder links zu schauen. Alle Blicke ruhten auf ihr, als sie den Raum durchquerte: die der Zuhörer auf der anderen Seite der Panzerglasscheibe, Berglunds ausdrucksloser Blick, der offen provozierende der Verteidigerin, Svante Crispinssons mit einem angedeuteten Lächeln darin.
Sie hob die Hand, um den Zeugeneid abzulegen, die Jacke spannte am Rücken, sie hatte Muskeln zugelegt, seit sie den Anzug das letzte Mal getragen hatte, wann war das gewesen? Bei ihrer vorigen Zeugenaussage vermutlich.
Sie, Nina Victoria Hoffman, versicherte auf Ehre und Gewissen, die ganze Wahrheit zu sagen und nichts wegzulassen, hinzuzufügen oder zu verändern.
Crispinsson hustete in die Hand, bevor er das Wort ergriff, und raufte sich die Haare.
»Nina Hoffman, was sind Sie von Beruf?«
Sie stand kerzengerade da, bemüht, ihre berufliche Rolle nach außen hin zu verkörpern. Eigentlich hätte sie den Hosenanzug nicht gebraucht, um als Polizistin in Zivil erkennbar zu sein, sie wusste, dass sie so aussah, streng und aufrecht, nüchtern, farblos.
»Ich bin Polizistin, Kriminologin und Verhaltenswissenschaftlerin. Derzeit arbeite ich als operative Analytikerin bei der Reichskriminalpolizei in Stockholm.«
Der Protokollführer schrieb, das Sonnenlicht spiegelte sich im Panzerglas. Eine der Eigenheiten der Sicherheitssäle war die Absperrung zum Publikum, das Glas, das die Öffentlichkeit von den Prozessbeteiligten trennte. Sie wusste, dass die Pressemeute sie durch einen Lautsprecher mit einer Nanosekunde Verzögerung hörte.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.