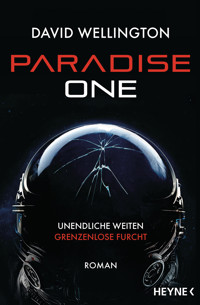
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Sonnensystem ist besiedelt, und die Menschheit breitet sich im All aus. Es gibt sogar eine extrasolare Kolonie, Paradise-1, auf der Tausende Kolonisten ein neues Leben begonnen haben – bis die Kommunikation abgebrochen ist. Jetzt wird Agentin Alexandra Petrowa und die Crew der Artemis auf die lange Reise nach Paradise-1 entsandt, um herauszufinden, was passiert ist. Doch das, was sie dort finden, übertrifft ihre schlimmsten, grauenvollsten Albträume.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 912
Ähnliche
Das Buch
Das Sonnensystem ist besiedelt, und die Menschheit breitet sich im All aus. Es gibt sogar eine extrasolare Kolonie, Paradise-1, auf der Tausende Kolonisten ein neues Leben begonnen haben – bis die Kommunikation abgebrochen ist. Jetzt werden Agentin Alexandra Petrowa und die Crew der Artemis auf die lange Reise nach Paradise-1 entsandt, um herauszufinden, was passiert ist. Doch das, was sie dort finden, übertrifft ihre schlimmsten, grauenvollsten Albträume.
Der Autor
David Wellington, geboren in Pittsburgh, Pennsylvania hat sich mit seinen Romanen um die Vampirjägerin Laura Caxton in die Herzen der Horror- und Dark-Fantasy-Fans geschrieben. Sein Science-Fiction-Roman »Die letzte Astronautin« wurde für den Arthur C. Clarke Award nominiert. Wenn er nicht schreibt, arbeitet David Wellington als Archivar für die Vereinten Nationen. Der Autor lebt in New York.
Mehr über den Autor und sein Werk erfahren Sie auf:
www.diezukunft.de
DAVID WELLINGTON
PARADISE ONE
ROMAN
Aus dem Englischen von Jürgen Langowski
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Titel der Originalausgabe: PARADISE-1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstausgabe: 08/2024
Copyright © 2023 by David Wellington
Copyright © 2024 dieser Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Joern Rauser
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, GbR, nach einem Coverdesign von Sean Garrehy – LBBG, unter Verwendung von Shutterstock (AlenD, Andrey Benardos, IvaFoto, Sergey Nivens)
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-31748-5V001
diezukunft.de
Für Sie, meine Leser. 2003 habe ich den ersten Roman verfasst. Zwanzig Jahre und zweiundzwanzig Bücher später möchte ich allen danken, die mir auf diesem Weg Gesellschaft geleistet haben!
1
Noch drei Tage bis zum Anbruch der Dämmerung auf Ganymed. Die Kälte schien durch den Raumanzug bis in ihre Knochen einzudringen. Jupiter, die einzige Lichtquelle, stand als schmale braune und orangefarbene Sichel reglos am Nachthimmel. Hin und wieder zuckte ein Blitz über den weitgehend dunklen großen Planeten. Die Entladungen waren so gewaltig, dass sie sogar über eine Entfernung von einer Million Kilometern hinweg lange schwarze Schatten auf das Eis des Mondes warfen.
Alexandra Petrowa ließ die Schultern kreisen und wackelte im pulvrigen Eis mit den Zehen, um die Blutversorgung der Beine in Gang zu bringen. Seit schon fast sechs Stunden lag sie auf der Kuppe eines Höhenzuges, weit entfernt von der Wärme und der erheblich besseren Luft des Habitats im Selket-Krater. Vielleicht zahlte sich die Tortur ja doch noch aus.
»Brandwache Eins-Vier, ich habe Sichtkontakt«, flüsterte sie. Das Anzugmikrofon erfasste die Meldung und sendete sie zu einem Satelliten, der sie an einen Funker in einem Kontrollturm im Krater weiterleitete. Von dort aus wurde sie in die hübschen, gemütlichen Büros der Brandwache Vierzehn übermittelt – zum Hauptquartier der Militärpolizei auf Ganymed. »Zielperson ist etwa dreihundert Meter entfernt und bewegt sich nach Nord-Nordwest.«
Sie blieb so still wie möglich liegen, weil sie ihre Position keinesfalls verraten wollte. Direkt unter dem Höhenzug sprang ein Mann vorsichtig bergab, indem er von Felsblock zu Felsblock hüpfte. Er bewegte sich auf ein Gewirr schmaler kleiner Canyons zu. Der Mann trug einen hautengen, leuchtend gelben Raumanzug. Kein großes Visier, nur eine dunkle Schutzbrille. Die Hälfte aller Arbeiter auf Ganymed verwendete solche Anzüge – sie waren billig und ließen sich leicht flicken, außerdem wurden sie in Signalfarben geliefert, damit man die Leiche problemlos auf der vereisten Oberfläche fand, falls der Träger dort draußen starb. Der Barcode auf dem Rücken verriet ihr, dass der Anzug einer gewissen Margaret Dzama gehörte.
Petrowa wusste, dass dieser Anzug gestohlen war. Der Mann, der ihn jetzt trug, ein ehemaliger Medizintechniker namens Jason Schmidt, war vermutlich der schlimmste Serienmörder in der jahrhundertelangen Geschichte der Ganymed-Kolonie. Petrowa hatte in mehr als zwanzig Vermisstenfällen Beweise gefunden, die direkt zu Schmidt führten. Man hatte zwar keine einzige Leiche entdeckt, aber das war gar nicht so überraschend. Ganymed galt zwar als einer der am dichtesten besiedelten Orte im ganzen Sonnensystem, da draußen gab es jedoch viel Eis, das noch niemand erforscht hatte. Also war dies genau der richtige Ort, um Tote zu verstecken.
»Brandwache Eins-Vier«, sagte sie. »Bitte um Erlaubnis, einen gewissen Schmidt, Jason festzunehmen. Die Dokumente habe ich bereits eingereicht, mir fehlt nur noch die Genehmigung für den Vollzug.«
»Verstanden, Lieutenant«, antwortete Eins-Vier. »Wir gehen den Fall gerade durch und vergewissern uns, dass Sie auch wirklich zuständig sind. Wir werden das umgehend klären. Bitte warten.«
Die Beweise, die gegen ihn vorlagen, mochten nur indirekt sein, aber Schmidt war der richtige Mann, da war sie sicher.
Das musste sie auch sein. Ihre ganze Laufbahn hing von diesem Fall ab. Als Lieutenant-Inspektorin der Brandwache verfügte sie über weitreichende Kompetenzen, um selbstständig Ermittlungen durchzuführen, aber diesen Einsatz durfte sie auf keinen Fall vermasseln. Ihren Job und den Rang hatte sie nur dank ihrer persönlichen Beziehungen ergattert. Das Problem bestand nur darin, dass dies auch alle anderen wussten. Ihre Mutter Ekaterina Petrowa war früher die Direktorin der Brandwache gewesen. Petrowa war also in die Firma der Familie eingetreten, und jetzt glaubten alle, die einflussreiche Mutter könnte der Tochter einen allzu leichten Zugang zur Akademie verschafft haben.
Wenn sie diesen Fall aber löste, konnte sie den Neidern zeigen, dass sie mehr war als nur die Tochter ihrer Mutter und dass sie fähig war, diesen Job wirklich auszufüllen. Die Leitung der Brandwache hatte die vielen Vermisstenfälle einfach zu den Akten gelegt – wahrscheinlich war Lang, die neue Direktorin, der Ansicht, ein paar vermisste Bergleute auf Ganymed seien nicht wichtig genug, um wertvolle Ressourcen für die Suche zu verschwenden. Schmidts Verhaftung wäre jedoch ein echter Gewinn für Lang und auch für Petrowa selbst. Damit würde die Brandwache gut dastehen – die Menschen auf Ganymed würden sehen, dass die Brandwache zur Verfügung stand, um sie zu beschützen. Es wäre ein PR-Coup.
Sie musste nur noch jemanden im Selket-Krater überzeugen, ihr die Erlaubnis zu geben, damit sie die Verhaftung vornehmen konnte. Das sollte doch eigentlich nicht so schwierig sein. Warum ließen sie sich so viel Zeit?
»Brandwache, ich brauche die Genehmigung, die Verhaftung durchzuführen. Bitte um Entscheidung.«
»Verstanden, Lieutenant. Wir warten noch auf die endgültige Bestätigung.«
Unterhalb von ihr blieb Schmidt auf einem Felsblock stehen, drehte den Kopf hin und her und betrachtete die Umgebung. Konnte er sie irgendwie bemerkt haben? Oder hatte er sich im Zwielicht verirrt?
»Verstanden«, antwortete sie. Dann kroch sie einen Meter weiter nach vorn. Gerade so weit, dass sie Schmidt im Auge behalten konnte. Wohin wollte er? Wahrscheinlich hatte er sich hier draußen im Eis eine Art Lager eingerichtet, vielleicht einen Raum, in dem er die Trophäen seiner Morde aufbewahrte. Sie beschattete ihn schon seit einer ganzen Weile und wusste inzwischen, dass er oft die Wärme der Siedlung verließ und mehrere Stunden allein auf der Oberfläche verbrachte. Das war ihr ganz recht. Draußen fiel es nämlich leichter, ihn zu schnappen. In der dicht bevölkerten Stadt dagegen war es für ihn einfach, in der Menge unterzutauchen.
Dies wäre eine ausgezeichnete Gelegenheit. Sie konnte ihn hier im Eis vermutlich sogar lebend fassen und ihn zum Verhör in einen geheimen Stützpunkt der Brandwache bringen. Sie griff nach unten, tastete nach der Pistole, die an der Hüfte im Holster steckte, und vergewisserte sich, dass die Waffe geladen und schussbereit war. Leider gab es da ein Problem. Das kleine Licht am Gehäuse der Waffe glühte nach wie vor unfreundlich bernsteingelb. Das bedeutete, dass sie noch keine Schussfreigabe hatte.
»Brandwache, ich brauche die Erlaubnis«, drängte sie. »Gebt meine Waffe frei. Warum dauert das so lange?« Sie sprach leise, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre. Ganymeds Atmosphäre war kaum mehr als ein hauchzarter Schleier. Im Eis trugen die Geräusche nicht weit. Trotzdem, ein bisschen paranoide Übervorsicht konnte einem manchmal helfen, den Tag zu überleben.
Schließlich bewegte sich Schmidt weiter, sprang von seinem Felsblock herunter und kam in einem lockeren Haufen von Eisbrocken auf. Er landete auf dem Hintern und stützte sich mit den Händen auf dem Boden ab. Offensichtlich war er unbewaffnet. Ein leichtes Ziel.
»Erlaubnis noch nicht erteilt. Direktorin Lang hat bestimmt, dass sie persönlich eingeschaltet werden muss. Bitte um Geduld«, antwortete die Brandwache.
Petrowa atmete langsam ein und wieder aus. Direktorin Lang wollte hier persönlich entscheiden? Vielleicht war das gar kein so schlechtes Zeichen. Möglich, dass sich die Vorgesetzten wirklich für ihre Fähigkeiten interessierten. Im Augenblick bedeutete es allerdings erst einmal ein unerfreuliches Hemmnis. Auf die Erlaubnis der Direktorin zu warten, zog die Dinge furchtbar in die Länge. Oder noch schlimmer – vielleicht beorderte Lang sie aus reiner Bosheit auch einfach zurück.
Als Petrowas Mutter vor anderthalb Jahren in den Ruhestand gegangen war, hatte Lang mehr als deutlich erklärt, dass sie der Tochter ihrer Vorgängerin keinerlei Sonderrechte einräumen würde. Wenn Petrowa Pech hatte, erfror sie hier draußen im Eis, bevor Lang den Zugriff genehmigte.
Zum Teufel damit, sie wollte sofort losschlagen. Sobald sie genügend Beweise gegen Schmidt in der Hand hatte, würde niemand mehr ihren Kopf fordern.
Sie stemmte die Füße auf den Boden und sprang. In der niedrigen Schwerkraft fühlte es sich beinahe so an, als fliege sie. Vielleicht lag es auch an dem Adrenalin, das in ihren Kreislauf schoss. Aber ihr war es ganz gleich. Sie kam direkt hinter ihm problemlos auf zwei Füßen und einer geballten Faust auf. Mit der freien Hand zog sie die Waffe und zielte. »Jason Schmidt«, sagte sie. »Kraft meiner Befugnisse als Beamtin der terranischen Regierung und der Brandwache nehme ich Sie hiermit fest.«
Schmidt fuhr herum und sprang auf. Er war schneller und beweglicher als erwartet.
In diesem Augenblick meldete sich jemand in ihrem Ohrstöpsel. »Hier ist Brandwache Eins-Vier …«
Schmidt ging direkt auf sie los, als wollte er sie angreifen. Das war eine absolut schwachsinnige Idee. Sie zielte doch mit der Waffe auf ihn. Zusätzlich hob sie noch die andere Hand und stützte die Waffe. Die perfekte Schussposition. Sie konnte ihn gar nicht verfehlen.
»… Genehmigung wurde überprüft …«
Schmidt wurde nicht langsamer. Er versuchte auch nicht, es ihr auszureden. Aufgrund der geringen Entfernung konnte er sie weder überlisten noch dem Schuss ausweichen. Sie drückte auf den Abzug. Wenn er wirklich so viele Menschen getötet hatte …
»… und abgelehnt. Wiederhole, Genehmigung zur Verhaftung ist abgelehnt.«
Das Licht auf dem Gehäuse der Pistole wechselte von Bernstein nach Rot. Der Abzug war blockiert – ganz egal, wie fest sie drückte, er rührte sich nicht mehr.
»Lieutenant, stellen Sie die Operation sofort ein und kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Dies ist ein Befehl.«
Petrowa hatte gerade noch Zeit, sich zu ducken, bevor Schmidt sie rammte und auf das Eis warf. Unter der Wucht des Aufpralls zerbarst es, und ein Schneeschauer stob hoch. Atemlos schnaufte sie und konnte vorübergehend nichts mehr sehen. Sofort rappelte sie sich wieder auf und wollte Schmidt packen, doch sie verfehlte ihn und stürzte ein weiteres Mal mit dem Visier voran in den Schnee. Unbeirrt kam sie wieder hoch, drehte sich und wischte sich den Schnee vom Helm, damit sie ihn sehen konnte …
Er war längst verschwunden. Natürlich. Und jetzt wusste er, dass sie hinter ihm her war. Er würde fliehen. Sich so weit entfernen, wie er nur konnte. Vielleicht würde er Ganymed sogar ganz verlassen und seine Mordserie woanders fortsetzen. Sie legte den Kopf in den Nacken und verfluchte die gleichgültigen Sterne.
2
»Lieutenant, bitte bestätigen Sie den letzten Befehl. Lieutenant? Hier ist Brandwache Eins-Vier, bitte bestätigen Sie …«
Sie ging zu der Stelle, wo die Waffe heruntergefallen war und halb verschüttet im Pulverschnee lag, hob sie auf und schob sie ins Holster. Das Eis von Ganymed war dunkelgrau bis braun, doch das galt nur für die Oberfläche. Wo die Waffe eingesunken war, strahlte ein reinweißes Loch.
Ihre Stiefel und der Sturz in den Schnee, als ihr der Verdächtige entwischt war, hatten ähnliche Spuren hinterlassen.
Ebenso gut erkennbar waren auch die Abdrücke, die Jason Schmidt hinterlassen hatte. Sie führten um einen großen Felsblock herum und zielten auf die Schatten vor dem Höhenzug. Helle weiße Fußabdrücke, die sich deutlich von dem dunklen Eis abhoben. Und was war das dort drüben? Es konnte durchaus ein Licht sein. Ein künstliches Licht, das die dunkle Oberfläche anstrahlte. Offenbar befand sich dort eine Art Bauwerk. Ein Unterschlupf.
Vielleicht der Raum mit den Trophäen.
»Lieutenant? Bitte bestätigen Sie.«
Sie schlich um den Felsblock herum und sah genau das, was sie vorzufinden erwartet hatte. Das Licht kam aus einer alten Notunterkunft, im Grunde handelte es sich nur um den Bunker eines Prospektors. Mitten im Eis saß eine große metallene Luke, auf der langsam ein Licht blinkte – an-aus, an-aus –, das allgemein bekannte Signal dafür, dass sich die Anlage hinter dieser Luke in Betrieb befand und dass man dort Wärme und Atemluft erwarten durfte. Jason Schmidt war wie ein gehetztes Kaninchen in seinen Bau gerannt.
Sicher wäre es selbstmörderisch, ihm dort hinein zu folgen. Sie würde in seinen Unterschlupf eindringen, während er wusste, dass sie kam. Und ihre Waffe war blockiert.
»Lieutenant? Melden Sie sich, Lieutenant. Hier ist Brandwache Eins-Vier. Lieutenant, können Sie mich hören?«
Petrowa drückte auf einen großen Knopf auf der Luke, woraufhin die Luftschleuse die Atmosphäre abließ, um den Druck auszugleichen. Sie trat ein und schloss hinter sich die Außentür. Gleich danach glitt das innere Schott auf, und sie starrte in die Dunkelheit.
»Eins-Vier, ich verfolge den Verdächtigen. Ich melde mich, sobald ich eine Gelegenheit finde.«
Dann schaltete sie das Funkgerät aus. Der Apparat würde ihr sowieso nichts sagen, was sie hören wollte.
Hinter der inneren Tür der Luftschleuse führte ein betonierter Gang spiralförmig tief ins Eis hinein. Wo sie vorbeikam, flammten winzige Leuchten in der Decke und den Wänden hell auf und verblassten hinter ihr wieder. Unter der Decke dehnte sich das vollkommen reine Kondenswasser zu langen Stalaktiten. In Ganymeds niedriger Schwerkraft mussten die Tropfen lange warten, bis sie endlich auf den Boden platschen durften. Am unteren Ende mündete der spiralförmige Gang in einen größeren Raum. Sie rechnete damit, dort eine Art Lager mit Kisten voller Notvorräte und altem Bergbauzubehör zu finden.
Doch der Hauptraum des Bunkers war leer, offenbar vollständig ausgeräumt. Der Betonboden hatte Flecken, war aber frei von Abfall. Von dem Hauptraum zweigten ringsherum dunkle Kammern ab. Im Grunde waren es Höhlen, die ihr vor Augen führten, wie groß die ganze Anlage tatsächlich war. Dies war nicht einfach nur eine Notunterkunft. Es handelte sich um ein regelrechtes Bergwerk, das man offenbar aber aufgegeben hatte.
Sie glaubte, sie hätte etwas gehört – ein Geräusch von außen, das durch die Betongänge hallte, die mit brauchbarer Atemluft gefüllt waren. Vorsichtshalber ging sie in die Hocke und wartete reglos ab. Hier gab es keine guten Verstecke, aber vielleicht hatte Schmidt sie noch nicht bemerkt.
So kauerte sie geduckt im Schatten, während er aus einer abzweigenden Höhle herauskam. Den Anzug hatte er bis zur Hüfte heruntergekrempelt. Die Ärmel und der Helm pendelten hinter ihm. Er schleppte eine große Kiste, deren Inhalt er einfach auf dem Boden auskippte. »Ich bin wieder da«, rief er in einer Art Singsang, als wollte er Haustiere anlocken, die seine Rückkehr zu Hause erwartet hatten.
Petrowa betrachtete den Inhalt der Kiste, der auf den Boden rutschte. Es waren Hunderte in Silberfolie verpackte Rationen. Die bunten Aufkleber zeigten jeweils eine appetitliche Portion der Nahrungsmittel. Pürierte Möhren. Pilzeintopf. Algensalat. Ebenso wie jeder andere, der eine Weile auf Ganymed gelebt hatte, erkannte sie die Verpackungen sofort. Die hübschen Bilder waren nichts als Lügen. In den Folien befand sich tatsächlich Nahrung, die einen Menschen am Leben halten konnte, ohne den verlockenden Abbildungen jemals gerecht zu werden. Vielmehr handelte es sich eher um eine dünne graue Pampe, die in einem großen Bioreaktor gezüchtet worden war: Proteine und Kohlenhydrate in einer Brutkammer voller Zuckerlösung, ausgeschieden von genetisch manipulierten Bakterien. Das war genau die Art Nahrung, die ein Arbeiter bekam, der sich nichts Besseres leisten konnte, weil ihm das Glück nicht mehr hold war. Die Regierung von Ganymed ließ niemanden verhungern, aber was einen da vor dem Verhungern rettete, war alles andere als ein Leckerbissen.
»Kommt und holt es euch«, rief Schmidt in demselben Singsang.
Als sie loslaufen und ihn endgültig festnehmen wollte, bemerkte sie in einer der Höhlen eine Bewegung. Dort drüben funkelten helle Augen, in denen sich das Licht spiegelte. Gleich darauf eilte das schmutzigste, ungepflegteste Menschenwesen heraus, das sie je gesehen hatte. Es rannte beinahe auf allen vieren und trug nichts als Lumpen. Das Gesicht war so schmutzig, dass sie weder das Geschlecht noch das Alter erkennen konnte. Vorsichtig, als hätte es Angst, näherte es sich Schmidt. Es sagte kein Wort und murmelte nicht einmal eine Begrüßung.
»Alles für euch.« Schmidt zog sich von den aufgehäuften Proviantpackungen zurück.
Nun bemerkte Petrowa auch in einer anderen Höhle eine Bewegung. Dann in einer weiteren – und kurz danach kamen aus einem Dutzend Richtungen gleichzeitig Menschenwesen zum Vorschein, die so schmutzig und verwahrlost wirkten wie das erste. Rasch schnappten sie sich die silbernen Päckchen von dem Stapel und rannten in die Höhlen zurück, als fürchteten sie, jemand könne ihnen das Essen wieder wegnehmen. Mit den Zähnen rissen sie die Packungen auf und steckten die Finger hinein. Sie kippten sich das Essen direkt in den Mund, wobei ebenso viel auf der Haut und in den Bärten landete wie zwischen den Lippen. Dabei wirkten sie beinahe selig, als hätten sie tagelang gehungert und als wäre dies das Beste, was sie je gekostet hatten.
Petrowa hatte keine Ahnung, was dies zu bedeuten hatte. Es wurde Zeit, die Antworten zu finden.
Sie richtete sich auf. »Schmidt«, rief sie. »Halten Sie die Hände so, dass ich sie sehen kann.«
Schmidt zuckte zusammen, ging dieses Mal aber wenigstens nicht wie ein wilder Stier auf sie los.
»Jason Schmidt, Sie sind verhaftet. Gehen Sie dort hinüber und drehen Sie das Gesicht zur Wand«, befahl sie.
Er schüttelte den Kopf. Er hatte die Hände gehoben, hielt sie aber so vor sich, dass sie nicht erkennen konnte, ob er bewaffnet war. Vielmehr machte er eine flehende Geste. Beinahe sah es aus, als wollte er auf die Knie fallen und sie um Gnade bitten.
Sie brauchte Antworten. Sie musste herausfinden, was hier vor sich ging. »He, Sie«, rief sie dem nächsten ungewaschenen Menschen zu. »Hält Sie dieser Mann hier gefangen? Brauchen Sie Hilfe?«
Der Mann – zumindest hatte das Wesen einen Bart – sah sie an, als hätte er sie jetzt erst bemerkt. Er ließ das Päckchen fallen, stolperte auf sie zu und tastete ziellos umher, als wollte er die leere Luft packen. Unwillkürlich wich Petrowa einen Schritt zurück. Sein Mund stand offen, doch der Laut, der herauskam, war kein Wort. Einfach nur eine ungeformte Silbe, die keinerlei Bedeutung hatte.
»Brauchen Sie Hilfe?«, fragte Petrowa noch einmal. »Wollen Sie mich um Hilfe bitten?«
»Das kann er nicht«, erklärte Schmidt. Sie richtete die Waffe auf ihn, woraufhin er verstummte und die Hände noch etwas höher hielt.
Das Opfer kam näher und griff nach Petrowas Arm. Sie entzog sich zwar, doch dann fasste der Mann nach ihrem Helm und bekam eine seitlich angebrachte Lampe zu fassen. Er krächzte laut und riss den Mund so weit auf, dass der Speichel in alle Richtungen flog. Sie musste ihn kräftig stoßen, damit er losließ.
Jemand anders zischelte wie eine Schlange. Auch die übrigen Opfer gaben jetzt unartikulierte Laute von sich, offenbar weil sie keine ganzen Worte bilden konnten.
»Was hat das zu bedeuten?«, fragte Petrowa. »Was haben Sie den Leuten getan?«
Ob dies die Vermissten waren, denen sie auf der Spur war? Sie hatte angenommen, Schmidt habe sie alle ermordet, aber sie waren hier, sie lebten noch und waren anscheinend seine Gefangenen …
Inzwischen hatten sich alle in Bewegung gesetzt und torkelten auf sie zu. Mit den Händen machten sie unbestimmte Gesten oder griffen ins Nichts. Ihre Gesichter zeigten Ausdrücke, die sie nicht einordnen konnte. Und ständig stießen sie einsilbige Laute aus: ph, kr, la.
Sie griffen nach ihr und hielten sie an den Beinen und den Armen fest. Petrowa musste sich eilig rückwärts in Sicherheit bringen. Besonders kräftig waren sie nicht – aus der Nähe konnte sie erkennen, wie ausgemergelt und krank sie unter dem Schmutz wirklich waren. Vor allem aber waren es viele.
»Zurück«, befahl sie. »Haltet euch zurück! Brandwache!«
»Die verstehen Sie nicht«, rief Schmidt.
Schmidt – sie hatte vorübergehend nicht mehr auf ihn geachtet. Als die geifernden, gestikulierenden Leute auf sie zugekommen waren, hatte sie ganz vergessen, ihn im Auge zu behalten. Jetzt fuhr sie herum und sah, dass er die Rampe hinauf in Richtung Oberfläche schlich. Er hatte immer noch die Hände gehoben, doch er entfernte sich.
Eines seiner Opfer knurrte und hob die Stimme. Es war eine Frau, die nun mit schwachen Fäusten auf Petrowas Rücken einschlug. Petrowa stieß einen erschrockenen Schrei aus.
Dann stieß sie die Frau fort, vielleicht fester als nötig. Allmählich bekam sie Angst. Sie fürchtete sich vor diesen verwahrlosten Menschen – und sie brauchte unbedingt einen klaren Kopf.
Ja, es schien ihr wichtig, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Und sie wusste genau, wo sie damit anfangen musste. Schmidt wollte fliehen und rannte die Rampe hinauf. Sie stürmte ihm hinterher und drosch ihm den Griff der Pistole in den Nacken. »Runter!«, befahl sie. »Runter auf den Boden, und bleib liegen, du Arsch!« Sie schlug noch einmal zu, und er stürzte. »Was haben Sie getan?«, fragte sie, als er sich wieder aufrichten wollte. Noch einmal schlug sie zu. »Was haben Sie gemacht?«
Schmidt rollte weg, bis er auf dem Rücken lag. Er hob die Hände ans Gesicht, und jetzt sah sie, dass er schluchzte.
Was bedeutete das schon wieder?
Sie zog ein Paar intelligente Handschellen aus der Gürteltasche. Mit geübten Bewegungen packte sie Schmidt und drückte ihn mit dem Gesicht an die Betonwand. Sobald die Fesseln seine Haut berührten, aktivierten sie sich und legten dicke Plastikstränge um seine Handgelenke und die Finger, damit er sich nicht mehr bewegen konnte. Er leistete keinen Widerstand.
»Gott sei Dank«, stöhnte er. Er sprach sehr leise und hatte die Augen fest geschlossen. »Ich danke Ihnen.«
»Mann, was ist denn mit Ihnen los?«, fragte sie.
»Jetzt ist es vorbei«, antwortete er. »Endlich ist es vorbei.«
»Was haben Sie mit den Leuten gemacht? Was fehlt ihnen?«
»Es ist eine akute Aphasie, es ist …«
»Sie können nicht sprechen«, unterbrach Petrowa ihn. »So viel habe ich begriffen. Aber warum? Haben Sie … Haben Sie etwas mit ihnen gemacht?«
»Ich habe sie gerettet«, wimmerte Schmidt.
Sie starrte seinen Hinterkopf an. Sie begriff es einfach nicht. Und sie hatte keine Ahnung, was hier los war. Dann fiel ihr Blick auf die Pistole. Sie zeigte wieder das stetige, unveränderliche Bernsteingelb. Wundervoll.
»Erzählen Sie mir alles«, befahl sie. »Dann entscheide ich, was ich mit Ihnen mache.«
3
Seine Miene veränderte sich dramatisch, und sein betretenes Nicken wirkte, als hätte er jegliche Hoffnung verloren.
»Kommen Sie … einfach mit. Ich möchte Ihnen etwas zeigen.«
Sie half ihm beim Aufstehen. »Wir gehen nirgendwohin, bis meine Verstärkung eintrifft«, erwiderte sie. Sie blickte zu den nackten, schmutzigen Menschen dort unten hinüber. Inzwischen rissen sie wieder die Proviantpäckchen auf und verschlangen deren Inhalt. Das schien sie so sehr in Anspruch zu nehmen, dass sie gar nicht mehr auf sie und Schmidt achteten.
Mit gerunzelter Stirn überlegte sie, wie es jetzt weitergehen sollte. Ich brauche Antworten, dachte sie. »Erzählen Sie mir einfach, was passiert ist. In allen Einzelheiten. Los.«
Dieses Mal fügte er sich tatsächlich. Er begann zu reden und klang bald wieder wie jemand, der daran gewöhnt war, über die gesundheitliche Verfassung seiner Patienten zu berichten. »Es hat zweihundert Kilometer von hier entfernt im Krankenhaus der Siedlung im Nergal-Krater begonnen. Zuerst ist es nur einer gewesen, ein älterer Mann. Bei ihm wurde, wie ich schon sagte, eine Aphasie diagnostiziert. Die Ärzte konnten keine Ursache dafür finden. Er hatte kein körperliches Trauma erlitten, es gab auch keine Anzeichen einer Krankheit. Er war völlig gesund, konnte aber nicht mehr sprechen. Noch schlimmer, er konnte überhaupt nicht mehr kommunizieren.«
»Was meinen Sie damit?«, hakte Petrowa nach.
»Genau das, was ich sage. Wenn jemand nicht mehr sprechen kann, bleibt er sogar bei einer schweren Aphasie normalerweise immer noch fähig, sich irgendwie mitzuteilen. Manchmal können die Betroffenen dann noch lesen und schreiben, oder sie sind wenigstens in der Lage, sich mit Gesten und Mienen verständlich zu machen. Man bemerkt auch, wenn sie verstehen, was man ihnen sagt. Sie können schreien oder die Stirn runzeln, um zu zeigen, dass sie Schmerzen haben. Dieser Patient wollte sich zwar eindeutig mitteilen, doch was er äußerte, blieb unverständlich.« Schmidt schüttelte traurig den Kopf. »Er fuchtelte mit den Händen herum, verdrehte das Gesicht zu Ausdrücken, die niemand zu deuten wusste …«
»Das war aber nur ein Patient«, wandte Petrowa ein. »Hier unten habe ich fast zwanzig gesehen.«
Schmidt nickte. »Ja. Die Zweite war eine Jugendliche. Das fand der Arzt wirklich beunruhigend. Bei älteren Patienten kennt man alle möglichen neurologischen Beschwerden, aber bei jungen Menschen kommt so etwas selten vor. Sogar sehr selten. Als Nächstes kam eine ganze Familie, und die Ärzte fürchteten zwar, es könne etwas Ansteckendes sein, konnten aber keinerlei Pathogene und keine Ursache finden. Bald war eine ganze Krankenstation mit solchen Patienten gefüllt …
Und dann hat es sich verändert. Die Ärzte kamen zu dem Schluss, dass man den Betroffenen nicht helfen könne. Es gab keine Behandlung, die wir ihnen anbieten konnten.« Schmidt schniefte laut. »Sie wollten die Patienten in eine besondere Einrichtung schicken. Mir war klar, was das bedeutete. Die Menschen wären dann keine Patienten mehr. Man wollte sie als Testpersonen benutzen, bis man alle nur denkbaren Tests durchgeführt hatte, und dann … dann sollten diese armen Leute seziert werden.« Schmidt machte eine gequälte Miene. Petrowa war sicher, dass er die Wahrheit sagte. »Das durfte ich nicht zulassen.«
»Also haben Sie einige Patienten aus einem Krankenhaus entführt und hierhergebracht?«
»Ja«, bestätigte Schmidt. »Um sie zu retten.«
»Und jetzt …«
»Jetzt versorge ich sie. Ich gebe mir Mühe, damit sie gesund bleiben. Meine Möglichkeiten sind zwar begrenzt, aber ich … ich konnte sie doch nicht einfach …« Er riss die Augen weit auf. »Was wollen Sie jetzt mit ihnen tun?«
»Das habe nicht ich zu entscheiden.«
Er sah sie lange und forschend an. Vielleicht suchte er tatsächlich Gnade. Sie wünschte sich wirklich, sie könnte ihm irgendetwas anbieten. Nach einer Weile nickte er nur. Vielleicht nahm er resigniert hin, dass die Dinge nun nicht mehr in seiner Hand lagen.
»Ich kann sie nicht mehr ansehen«, gestand er, als er sich umdrehte und auf der Rampe nach oben blickte. »Bitte. Es gibt dort einen Raum, wo wir auf Ihre Freunde warten können. Könnten wir dorthin gehen?«
Er wirkte wie ein geprügelter Hund und machte keine Anstalten mehr, vor ihr zu fliehen. Trotzdem, sie musste sich absichern. Sie zog ihm den Anzug ganz herunter und bedeutete ihm herauszusteigen. Ohne Anzug konnte er nicht mehr entkommen – er würde sterben, sobald er die Luftschleuse verließ. Sie nickte und zeigte auf die Rampe. »Gehen Sie vor.«
Schmidt führte sie zu einer Tür, die sich fast am oberen Ende der Rampe befand. Als Petrowa bemerkte, dass in dem Raum ein eigenartiges Licht brannte, sagte sie: »Keine Bewegung.« Er gehorchte sofort, rutschte an der Wand herunter, hockte sich auf den Boden und ließ den Kopf zwischen den Knien hängen. Er schien niedergeschlagen und erledigt.
Sie berührte den Türöffner, worauf die Tür geräuschlos aufglitt. Auf den ersten Blick konnte sie nicht viel erkennen, nur einen Haufen Computerteile in einer Ecke. Daneben flackerte ein instabiles Hologramm, das einen kleinen, leuchtenden Jungen zeigte. Er hockte in einer ähnlichen Haltung wie Schmidt und hatte ebenfalls den Kopf zwischen die Knie gezogen. Das rötliche Hologramm war die einzige Lichtquelle in dem ganzen Raum.
»Verdammt, was ist das?«, fragte Petrowa. Unwillkürlich war sie einen Schritt in den Raum hineingegangen.
»Das ist ein alter KI-Kern. Sie sollten mal mit ihm sprechen.«
»Was?«, fragte sie. Sie war so fasziniert, dass sie kaum noch auf den Mann achtete.
Der Junge im Hologramm richtete sich langsam auf. Gleichzeitig färbte sich das Licht, das von ihm ausging, dunkelrot. Sie fragte sich, was dies zu bedeuten hatte.
Auf Schmidt achtete sie gar nicht mehr. Ein dummer Fehler. Auf einmal schloss er die Tür mit einem Tritt, und sie hörte, wie der Riegel einrastete.
»Nein!«, rief sie. »Nein!« Sie ließ die Pistole fallen und eilte zur Tür, um mit beiden Händen auf den Öffner zu drücken. Vergeblich. Von innen ließ sich die Tür nicht öffnen. Immer wieder hämmerte sie dagegen. »Schmidt! Schmidt!« Sie bekam keine Antwort.
Verdammt auch!, dachte sie. Was für ein dummer Fehler – ein echter Anfängerfehler. Ihre ganze Ausbildung, all die Mühen, ihren Job richtig zu erlernen … und dann diese eine Dummheit, die eine Inspektorin niemals begehen durfte. Sie hatte einen Verdächtigen unterschätzt.
Du musst hart sein, um diesen Job auszufüllen. Saschenka, du bist nicht hart.
Das hatte ihre Mutter hundertmal oder noch öfter zu ihr gesagt. Ihre Mutter, die selbst schon diesen Job gehabt hatte. Die im Grunde alle Vorschriften entwickelt hatte. Vielleicht hatte ihre Mutter sogar recht. Petrowa sank das Herz. Aber sie hatte keine Zeit für ihre inneren Abgründe. Auf einmal hörte sie hinter sich ein Geräusch. Es klang wie das Rascheln von Papier, oder – nein. Es war eine leise Stimme, die ihr etwas zuflüsterte.
Starr vor Schreck hielt sie inne.
Wieder hörte sie das Flüstern. So leise, kaum vernehmbar. Sie konnte nicht verstehen, was die Stimme sagte, war aber sicher, dass sie zu dem kleinen Jungen gehörte. Zu dem Hologramm. Die KI wollte mit ihr reden. Das rote Licht warf tiefe, lange Schatten auf den Boden.
»Was willst du von mir?«, fragte sie.
Das Flüstern machte sie neugierig. Hin und wieder fing sie ein Wort auf und war sicher, sie könne alles verstehen, was der Junge sagte, wenn sie sich nur noch ein wenig mehr anstrengte. Ja, sie wollte sich unbedingt umdrehen und den Jungen ansehen. Bestimmt war sie in der Lage, alles zu erfassen, sobald sie es tat.
Allerdings hörte sie noch eine andere Stimme. Es war die ihrer Mutter, die sie immer noch wegen ihrer Dummheit schalt, doch nun kam außerdem eine Warnung hinzu.
Dummes Mädchen, dreh dich nicht um. Wenn du dich umdrehst, verlierst du dich.
Das Flüstern setzte sich fort. So viele Worte, die sie ganz gewiss verstehen konnte, wenn sie sich nur umdrehte, richtig hinsah und die Lippen des Jungen beobachtete …
Der Drang war überwältigend. Als wäre es völlig sinnlos, sich dagegen zu sträuben. Ihr dämmerte, dass es nicht einmal ihre eigenen Gefühle waren, auch wenn sie nicht sagen konnte, was das überhaupt bedeuten sollte.
Dann wurde ihr bewusst, dass sie heftig keuchte.
Irgendwann hatte sie die Augen fest geschlossen. Langsam und behutsam schlug sie die Augen wieder auf. Sie machte Anstalten, sich umzudrehen und den Jungen anzusehen. Dabei war ihr klar, dass sie nicht mehr aus ihrem Gedächtnis würde auslöschen können, was sie gleich dort drüben in der Ecke betrachten würde. Doch der Impuls, sich umzudrehen, war übermächtig.
Schau nicht hin, Saschenka. Jetzt musst du wirklich stark sein.
Sie sollte dort nicht hinsehen. Sie durfte einfach nicht. Der Anblick würde sie auf eine Art und Weise, die sie sich nicht einmal vorstellen konnte, dem Untergang weihen. Sie war sicher, dass dies ihr Ende wäre.
Sie durfte nicht hinschauen.
Sie durfte einfach nicht.
Sie konnte es aber kaum noch vermeiden.
Beinahe weinte sie, weil die Anstrengung, dem Drang zu widerstehen, so groß war. Sie musste gegen ihren ganzen Körper ankämpfen, der es so dringend wollte. Was für eine Erleichterung es wäre, wenn sie einfach nachgab! All ihre Probleme und ihre Sorgen wären so schnell vorbei. Sie musste sich nur fügen.
Sich umdrehen.
Hinschauen.
Sie setzte an, wollte sich dem Jungen nähern …
Dann hielt sie inne. Sie hatte etwas vor ihren Füßen bemerkt. Nur einen farbigen Fleck. Der ganze Raum war von dem Licht blutrot verfärbt, nur der kleine Flecken auf dem Boden, der freundlich und einladend grün strahlte, bildete eine Ausnahme.
Das grüne Licht kam aus dem Lämpchen auf dem Gehäuse ihrer Pistole, die sie fallen gelassen hatte.
Drüben in der Brandwache Eins-Vier hatte ihr endlich jemand die Erlaubnis erteilt, die Waffe zu benutzen.
Sie hob sie mit beiden Händen hoch, drehte sich mit geschlossenen Augen um und feuerte auf den alten KI-Kern. Immer wieder drückte sie ab, bis das Flüstern endlich aufhörte. Als sie zur Tür stürzte, kam sie wieder zu sich. Der Ausgang war verschlossen, doch ein paar rasche Stiefeltritte brachen die Tür auf.
Mit weit aufgerissenen Augen sprang sie in den Gang. Sie hatte keine Ahnung, was gerade geschehen war. Oder was noch geschehen wäre, wenn sie nicht … wenn sie …
Nein, darüber wollte sie jetzt nicht nachdenken. »Schmidt«, rief sie. »Schmidt! Sie kommen mit. Wir klären das, und dann …«
Er befand sich unmittelbar hinter ihr. Benommen und konfus, wie sie war, hatte er sie mit dem ältesten Trick auf der Welt hereingelegt. Er hatte sich mit einem großen Schraubenschlüssel bewaffnet und schlug halbhoch nach ihrer Hüfte. Auf den Teil des Anzugs, der am schwächsten gepanzert war. Der Schlag traf sie, und sie ging vor Schmerzen keuchend zu Boden. Sie wollte sich umdrehen und in die richtige Position kommen, um sich zu wehren.
»Sie haben ihn getötet«, klagte Schmidt. »Sie haben ihn getötet, Sie haben ihn …«
Er weinte. Die Tränen sammelten sich in der niedrigen Schwerkraft rings um die Augen und rannen nur zögernd die Wangen hinunter. Der Ausruf verwandelte sich in ein gequältes Heulen, während er noch einmal den Schraubenschlüssel hob, um sie zu schlagen.
»Nicht«, rief sie beinahe flehend. Wenn er sie angriff, blieb ihr nichts anderes übrig, als sich zu verteidigen. »Lassen Sie das … fallen!«
Er ließ den Schraubenschlüssel aber nicht fallen. Er hörte nicht auf, sondern brüllte, ging wieder auf sie los und legte es offensichtlich darauf an, ihren Helm zu zertrümmern.
Sie zielte und schoss.
4
Irgendjemand gab Petrowa einen Becher warmes Wasser mit Zitronengeschmack. Es war ein kleiner Akt der Freundlichkeit, der sie fast zu Tränen rührte. Sie fühlte sich wund, als hätte man eine Schicht ihres Gehirns abgeschält. Immer wieder zuckte sie zusammen und wollte sich verkriechen.
Die Verstärkung war schon vor einer Weile eingetroffen. Es waren so viele, dass sie den Hauptraum des verlassenen Bergwerks füllten, als hätte man sie mit Gewalt hineingestopft. Unterdessen hockte Petrowa neben der spiralförmigen Rampe auf einer Kiste, der Oberfläche so nahe, wie sie nur konnte. Wo sie niemandem im Weg war.
Sie hatte den Tod von Jason Schmidt gemeldet und geschildert, was er getan hatte. Die Vorgesetzten hatten bemerkenswert schnell reagiert.
Die Brandwache Eins-Vier hatte ein ganzes Team von Technikern und Analysten geschickt, die überall Proben nahmen – vom Tau an der Decke und aus der chemischen Toilette im Unterschlupf. Längere Zeit beschäftigten sie sich auch damit, Schmidts Leiche zu fotografieren.
Einige Computertechniker zerlegten den zerstörten KI-Kern und transportierten ihn ab. Petrowa würdigte die Computerteile keines Blickes, als sie hinausgetragen wurden.
Polizisten in schwerer, bisssicherer Kampfmontur scheuchten die Bewohner – Schmidts Opfer – in die Höhlen zurück. Petrowa sah nicht, was dort mit ihnen geschah.
Ständig kamen Ermittler und stellten ihr Fragen. Immer wieder die gleichen Fragen. Die nackten Tatsachen der Angelegenheit. Wann immer sie neue Informationen anbieten oder irgendeine Art von Analyse formulieren wollte, unterbrachen sie ihre Aussage. Sie wollten lediglich einen Zeitstrahl der Ereignisse bekommen.
Sie hatte auch selbst viele Fragen. Doch niemand wollte ihr Antworten geben. Man sagte ihr nur, sie solle warten, bis ein höherer Polizeioffizier eintraf. Stunden vergingen, und sie bekam immer wieder die gleiche Antwort – abwarten, bis die Vorgesetzten eintrafen. Das war alles, was man im Augenblick von ihr verlangte.
Petrowa war nicht sonderlich überrascht. Die Brandwache wühlte gern in den Geheimnissen anderer Leute herum, gab aber möglichst wenig von sich selbst preis. Unter der Leitung ihrer Mutter hatte sich die Organisation immer weiter abgekapselt und war geradezu paranoid geworden. Ekaterina Petrowa hatte regelmäßig ihr Offizierskorps gesäubert, damit alle bei der Stange blieben. Die neue Direktorin hielt die Zügel zwar ein wenig lockerer, aber nach wie vor waren alle viel zu ängstlich, um irgendwie aufzufallen oder etwas zu tun, das den Vorschriften zuwiderlief.
Sie wünschte sich, sie könnte sich irgendwo an einem warmen Ort unter die Dusche stellen. Nach einer Weile hörten die Ermittler sogar damit auf, ihr immer wieder die gleichen Fragen zu stellen. Von da an konnte Petrowa tatsächlich nichts anderes mehr tun, als untätig herumzusitzen.
Endlich, nach mehreren Stunden, entstand am Eingang des Unterschlupfes etwas Unruhe, und alle zogen sich zurück und machten Platz, als jemand den Bunker betrat.
Direktorin Lang war eingetroffen.
Die Direktorin persönlich. Mamas Nachfolgerin. Die Usurpatorin, wenn man den Gerüchten glauben wollte. Was hatte Lang hier zu suchen? Ihr Büro befand sich auf dem irdischen Mond. War sie zufällig in der Nähe gewesen und hatte beschlossen, sich persönlich um diesen Fall zu kümmern? Petrowa mochte nicht glauben, dass eine so wichtige Frau mit einem schnellen Schiff nur darum bis zum Jupiter flog, weil sie einen Tatort besichtigen wollte.
Und doch war sie da.
Die Direktorin hob die Hand und berührte den Verschluss am Kragen, der den Helm löste. Er zerlegte sich in seine Bestandteile und verschwand hinter ihrem Kopf im Anzug. Dann atmete sie tief ein, als wollte sie die Luft im Bergwerk prüfen. Ihrer Miene nach gefiel ihr jedoch nicht, was sie roch.
Sie war etwa sechzig Jahre alt und hatte sehr kurz geschnittenes eisengraues Haar. Mit ihrem gepanzerten Anzug erinnerte sie ein wenig an Boudicca, eine Kriegerkönigin mit stählernen Augen. Sie kam direkt zu Petrowa herüber und baute sich bolzengerade vor ihr auf.
»Lieutenant, sind Sie verletzt?«, fragte die Direktorin. Sie sprach knapp und präzise, beinahe wie eine britische Adlige. Einen solchen Tonfall bekam man auf Ganymed nur selten zu hören. »Körperliche Verfassung?«
»Nichts Wesentliches, Madam«, erwiderte Petrowa. Sie machte Anstalten, steifbeinig von der Kiste herunterzuklettern und Haltung anzunehmen. »Ich habe ein oder zwei größere Prellungen. Vorübergehend schwebte ich in Gefahr, konnte mich aber selbst schützen, und …«
Direktorin Lang versetzte ihr eine Ohrfeige. Der harte Handschuh warf Petrowas Kopf zur Seite. Sie hatte das Gefühl, die Zähne wackelten im Unterkiefer.
»Sie sind ohne Erlaubnis hier hereinmarschiert. Das bedeutet, Sie haben Befehle missachtet. Dafür könnte ich Sie vor ein Kriegsgericht stellen.«
Petrowa fasste es nicht. Sie nahm Haltung an, um der Direktorin keinen weiteren Anlass zu liefern, sie zu züchtigen. »Madam, dieser Verdächtige – Schmidt – er war ein …«
»Eine Zielperson«, fiel ihr Lang ins Wort.
»Das … genau. Eine Zielperson in einer laufenden Ermittlung. Ich nahm an, er hätte mit einer Reihe von Vermisstenfällen zu tun, die bisher nicht aufgeklärt sind, und deshalb habe ich ihn bis hierher verfolgt. Ich arbeite schon seit Wochen daran.«
»Die Brandwache beobachtet Jason Schmidt bereits seit fast einem Jahr«, erwiderte die Direktorin.
Petrowa runzelte die Stirn. Sie verstand es nicht. »Aber es gibt … keine offizielle Akte über ihn. Niemand hat mir irgendetwas gesagt. Niemand hat mich gewarnt, den Fall nicht weiterzuverfolgen.«
»Sie haben die Anweisung bekommen, auf die Genehmigung zu warten. War das nicht deutlich genug? Vielleicht hätten wir Sie in aller Form darum bitten sollen, dass Sie darauf verzichten, eine der komplexesten Ermittlungen in der Geschichte der Brandwache zu sabotieren. Denn genau das haben Sie heute getan.«
Petrowa starrte ihre Füße an. Ein Jahr … fast ein Jahr, hatte Lang gesagt. Das bedeutete allerdings, dass die Brandwache über ihn Bescheid wusste, und zwar, seit seine vermeintliche Mordserie begonnen hatte. Offenbar hatte ihn die ganze Zeit über niemand daran gehindert, die Menschen zu entführen und hier zu verstecken. Hatte die Brandwache etwa von Anfang an gewusst, wo sich die Opfer befanden? »Dieser Mann musste ausgeschaltet werden. Schließlich war er kein gewöhnlicher Verbrecher.«
Lang reckte das Kinn und legte den Kopf zurück. Es sah aus, als müsste sie sich mühsam beherrschen, um nicht noch einmal zuzuschlagen. »Ich werde mit Ihnen nicht über Ihre Befehle diskutieren. Sie können von Glück reden, dass Sie überhaupt noch einen Job haben.« Dann drehte sie sich um, als wollte sie weggehen und es auf sich beruhen lassen.
Dazu war Petrowa jedoch nicht bereit. »Irgendjemand hat mir die Genehmigung erteilt, die Waffe zu benutzen«, erklärte sie. »Irgendjemand hat mich die ganze Zeit beobachtet, sogar nachdem ich hier eingedrungen war.«
»Ja«, bestätigte Lang. »Jemand hat die Genehmigung erteilt. Dieser Jemand war nicht ich.«
Petrowa begriff es nicht sofort. »Aber wer dann?«, fragte sie impulsiv. Sie sah die Antwort, ehe Lang ihr antworten konnte.
»Es gibt in dieser Organisation Personen, die immer noch glauben, Ihre Mutter sei eine Heldin gewesen, die niemals etwas Falsches getan hätte. Diese Leute meinen, wenn Ekaterina Petrowas Tochter auf jemanden schießen will, dann sei sie auf jeden Fall dazu berechtigt.«
»Madam«, entgegnete Petrowa, »ich habe nie um eine Vorzugsbehandlung gebeten …«
»Nein. Das war auch nicht nötig.« Lang hob den Kopf und sah sich um. »All die Vorteile, die Ihre Mutter Ihnen verschafft hat. Die Gelegenheiten und besonderen Aufträge und Empfehlungen, die in die richtigen Ohren geflüstert wurden … und trotzdem haben Sie es vermasselt.«
»Madam«, sagte Petrowa.
»Die Vetternwirtschaft wird die Brandwache am Ende noch ruinieren. Sie erkennen das Problem, oder? Die Menschen hier draußen, besonders im Bereich der äußeren Planeten, hängen von uns ab. Wir sind die einzigen Sicherheitskräfte, die sie überhaupt kennen. Unter mir arbeiten Leute, die im Grunde Ihren Posten verdient hätten. Leute, die ihr Handwerk tatsächlich beherrschen. Deshalb entbinde ich Sie von Ihren gegenwärtigen Aufgaben.«
Petrowas ganzer Körper brannte lichterloh. Sie leckte sich über die Lippen und wollte unbedingt etwas sagen. Irgendetwas zu ihrer Verteidigung vorbringen. Mit einem erstickten Grunzen unterdrückte sie, was ihr auf der Zunge lag: Sie haben keine Ahnung, was meine Mutter mir gegeben hat und worin ihr Vermächtnis tatsächlich besteht.
Sie wollte es herausschreien.
Aber dies war weder die richtige Zeit noch der richtige Ort.
»Ja, Madam«, sagte sie. »Ich verstehe.«
»Ich habe einen neuen Auftrag für Sie«, fuhr Direktorin Lang fort. »Einen Auftrag, der Sie eine Weile woanders beschäftigen wird, wo ich Sie nicht sehen muss.«
»Darf ich fragen, worum es geht?«
»Ich schicke Sie zu Ihrer Mutter, damit Sie sich vergewissern können, wie es ihr in ihrem neuen Leben geht.«
Petrowa meinte nicht richtig zu verstehen. »Zu meiner Mutter? Ich soll … was? Meine Mutter besuchen?« Sie schüttelte den Kopf. Was für ein Unsinn. »Sie ist doch im Ruhestand. Sie ist auf eine neue Koloniewelt gegangen. Nach Paradise-1«, erklärte sie. »Der Planet ist hundert Lichtjahre entfernt, und … oh.«
Endlich verstand sie es. Die Reise nach Paradise-1 würde Monate dauern. Genug Zeit, damit Lang aufräumen und Ekaterinas alte Freunde aus den Büros entfernen konnte.
»Abgesehen davon, Sie zu ärgern, hat diese Reise tatsächlich einen tieferen Sinn, Lieutenant. Auf Paradise-1 muss dringend eine Sicherheitsanalyse durchgeführt werden. Eine Lieutenant-Inspektorin muss dorthin reisen und sich vergewissern, dass die Kolonie wohlauf und produktiv ist. Und Sie sind genau die Richtige für den Job.«
»Ja, Madam«, bestätigte Petrowa, weil es sonst nichts zu sagen gab.
Nach Ekaterinas Pensionierung hatte es Gerüchte gegeben, dass sie nicht ganz freiwillig abgetreten sei. Lang habe sie mit einem unblutigen, geräuschlosen Coup beseitigt. Ekaterina hatte ganz sicher ein paar Feinde gehabt. Viele hätten es nur zu gern gesehen, wenn man sie ins Gefängnis gesteckt oder hingerichtet hätte, statt ihr zu erlauben, würdevoll zurückzutreten. Als sie erklärte, sie werde auf eine ferne Kolonie umziehen, hieß es sogar, das sei eine Umschreibung dafür, dass sie ins Exil ging.
Nun sah es ganz danach aus, als sollte die Tochter der Mutter auf dem Fuße folgen.
Wie es schien, war Direktorin Lang mit ihr und dem Bunker fertig. Sie drehte sich um und entfernte sich. Petrowa wusste, dass sie jetzt eigentlich beschämt den Kopf senken und so tun sollte, als sei sie gar nicht mehr da. Sie konnte nicht anders, sie musste fragen.
»Was ist diesen Menschen zugestoßen?«
Lang drehte sich halb um und sah Petrowa über die Schulter an.
»Ich weiß nicht, was Sie damit meinen.«
»Ich meine diese … all die Leute hier, die Schmidt aus dem Krankenhaus entführt hat. Er hat sie hier unter schrecklichen Bedingungen festhalten, und am Ende waren sie … sind sie …«
»Ich bin vollständig über den Fall informiert«, erwiderte Lang. »Solche Menschen existieren nicht. Der Stand der Dinge ist, dass Menschen wie diese noch nie existiert haben. Ist das klar?«
Petrowa blickte in die dunkle Höhle, wo die Opfer festgehalten wurden. Aus dieser Richtung hatte sie schon eine ganze Weile keinen Laut mehr gehört. Das Blut lief ihr wie Eiswasser durch die Adern.
»Ja, Madam.«
5
Zhang Lei schloss die Augen. Er öffnete sie wieder, als er eine lange Wendeltreppe ohne Geländer hinunterging. Es war so dunkel, dass er nichts sehen konnte, doch er wusste, dass jede Stufe mit Toten bedeckt war. Mit Gerippen. Das Gewebe war verwest, die Haut war fort, die Kleidung nur noch Fetzen. Lediglich die Knochen blieben.
Es war finster. So dunkel. Er hatte Angst, er würde stürzen. Wenn er hinfiel, würde er unter lautem Klappern mitten in dem Knochenhaufen landen.
Es gab nichts, woran er sich festhalten konnte. Er drehte sich zur Seite, um einen Fuß, vorsichtshalber mit den Zehen voran, auf die nächsttiefere Treppenstufe zu setzen. Behutsam stieß er ein Brustbein und einen Brustkorb zur Seite, um Platz für sich zu schaffen und gefahrlos den nächsten Schritt zu tun.
Nun war er einen Schritt tiefer, blieb stehen und atmete tief durch. Dann schob er ebenso vorsichtig den anderen Fuß vor und tastete so lange, bis er sicher war, auf kein Hindernis zu treten. Sobald er sich vergewissert hatte, dass die Stufe sein Gewicht tragen konnte, atmete er aus und tastete nach der nächsten Stufe …
… und berührte mit dem Fuß sofort einen Schädel, der unter ihm wegrutschte. Er kippte nach vorn, streckte die Hände aus, um den Sturz abzufangen, und hatte auf einmal einen Oberschenkelknochen in der Hand. Kreischend warf er ihn weg, während die andere Hand nichts als leere Luft spürte. Schneller und schneller taumelte er vorwärts und abwärts, die Steinstufen kamen ihm viel zu schnell entgegen und seinem Gesicht viel zu nahe, rings um ihn klapperten und hüpften die Knochen, ein Erdrutsch aus Staub und zerbrochenen, rasiermesserscharfen Splittern ergoss sich die Treppe hinunter, und er konnte nichts weiter tun als …
Er schloss die Augen.
Öffnete sie wieder und sah sich an einem anderen Ort. Allein, halb eingeschlafen in einem Zug, während Jupiter als Sichel am Himmel stand. Wie ein Fluch.
Nach und nach kam er zu sich.
Nach und nach erinnerte er sich, wo er sich befand. Auf Ganymed. Genau dort, wo er sein sollte.
Er rieb sich die Augen und die Stirn, um den Traum abzuschütteln. Manchmal fiel ihm das ziemlich schwer. Und manchmal ließ ihn der Traum sogar den ganzen Tag nicht mehr los.
Er bemühte sich, nur an die Dinge zu denken, die er kannte und von denen er wusste, dass sie real waren. Dinge, die er beweisen konnte.
Der Zug schwebte auf Magnetfeldern, die ihn vorwärtszuschieben schienen wie ein Floß auf einem Fluss. Er schwebte über einer Landschaft aus grauem Eis und braunem Pulverschnee, in dem sich hier und dort die helleren Ovale flacher Krater abhoben wie stinkende Tümpel in einer verfallenen Welt.
Er war allein im Zug. Das gefiel ihm, weil er auf keinen Fall wollte, dass ihn jemand in seinem gegenwärtigen Zustand sah.
Doch es war auch schlecht, weil er nicht sicher war, ob er wohlbehalten ankommen würde.
Sein Herz hämmerte wie wild in der Brust. Er hatte das Gefühl, mit ihm ginge es zu Ende. Die Lösung war natürlich, möglichst ruhig zu bleiben. Ruhige Gedanken denken. Er war Arzt. Er kannte den Unterschied zwischen einem Herzanfall und einer Panikattacke.
Winzige Stacheln bohrten sich in sein Handgelenk. Er schnappte nach Luft, doch sobald die Mittel in seinen Blutstrom eindrangen, entspannte er sich wieder. Medikamente, die den rasenden Puls beruhigten und den Blutdruck auf einen ungefährlichen Wert absenkten.
Sein Blick fiel auf die filigrane goldene Armschiene, die er am linken Unterarm trug. Die glänzenden Ausläufer wanderten zielstrebig über die Haut. Einer presste sich fest auf sein Handgelenk, und als er sich nach kurzer Zeit wieder zurückzog, waren auf einer Vene zwei winzige blutige Punkte wie ein Schlangenbiss zu erkennen. Das Gerät hatte ihm noch einmal Medikamente verabreicht. Es hatte ihn nicht um Erlaubnis gebeten und ihn auch nicht wegen der Dosierung zurate gezogen. Die Leute, die das Gerät entwickelt und für ihn kalibriert hatten, waren gar nicht auf die Idee gekommen, dass er fähig sein sollte, die Anwendungen anzupassen oder ganz zu verweigern.
Wahrscheinlich hatte er ihnen genügend Gründe geliefert, ihm nicht zu trauen.
In einem Hotel auf dem Mars hatte er eine üble Nacht erlebt. Er hatte sich eingeschlossen, und als sie endlich die Tür aufgebrochen hatten – na ja, irgendjemand hatte das Reinigungspersonal bezahlen müssen und Zhang hatte mehrere Stunden auf dem Operationstisch verbracht. Aber jetzt ging es ihm wieder gut. Sie hatten ihn gefragt, was geschehen sei, und er hatte erklärt, er sei gerade in einer schlimmen Phase. Der verantwortliche Arzt hatte es einen psychotischen Schub genannt. Jetzt ging es ihm wieder besser. Er war ja selbst Arzt und durchaus fähig, so etwas festzustellen. Es ging ihm gut. Ja, wirklich, es ging ihm gut.
Das sagte er sich jeden Morgen, wenn er aus dem Traum mit der Treppe erwachte. Und jeden Abend, wenn er sich schlafen legte, ehe der Traum wieder einsetzte, sagte er es sich wieder. Diese Bekräftigungen setzten hübsche kleine Klammern um die Träume.
Es geht mir gut. Alles wird gut.
Zhang musste einen klaren Kopf bekommen. Wenn er diese Gedanken weiter im Kreis durch seinen Kopf rasen ließ, musste sich die Angst ja verstärken, und am Ende würde er sich auf diese Weise noch ein echtes medizinisches Problem zusammendenken. Er stand auf und ging zum vorderen Ende des Waggons, wo ein großes Fenster eingelassen war. Dort blickte er zu dem graubraunen Schnee hinaus in die Richtung, in der sein Ziel lag. Da drüben, ein paar Kilometer entfernt, gab es eine zerbrechliche kleine Seifenblase. Das war der Raumhafen, zu dem er wollte. Es sah aus, als könnte die Blase jeden Augenblick zerplatzen. Oben auf der Blase hockte ein schneller Transporter – wie ein Vogel auf dem Horst. Das Schiff hieß Artemis und hatte eine elegant geschwungene Form und einen spitzen Bug. Mit diesem Schiff würde er eine kleine Reise unternehmen. Vielleicht ginge es ihm sogar besser, wenn er das Sonnensystem ganz verließ.
Er setzte sich auf seinen Platz und wartete darauf, dass die Wirkung der Medikamente einsetzte. Tatsächlich wurde er bereits ruhiger und der Herzschlag verlangsamte sich. Gut, dachte er. Gut, ich schaffe das.
Einatmen, ausatmen, sagte er sich. Frische Luft hinein, verbrauchte Luft hinaus. Er schloss die Augen. Ohne Vorwarnung zuckte ihm eine Erinnerung durch den Kopf, als wäre ein Pfeil von einem Bogen abgeschossen worden.
Er war wieder auf Titan in einer Höhle. Atemlos raste er einen Gang hinunter. Voller Angst. »Holly!«, rief er im Rennen. »Holly, ich glaube, da ist etwas passiert.« Er wollte die Luftschleuse zur medizinischen Abteilung öffnen, doch sie war verriegelt.
Er verstand es nicht. Wie hatte er sich denn aus seiner eigenen Klinik aussperren können?
Holly kam, blieb vor der Innentür stehen und sah ihn durch die Scheibe an.
»Holly«, sagte er und lachte sogar etwas. »Lass mich bitte rein. Ich muss mich irgendwie ausgesperrt haben«, erklärte er ihr.
Ihre Lippen bebten. Es sah aus, als müsste sie gleich weinen. Ihr Gesicht war gerötet, wurde sogar hellrot, während ihre Lippen blass wirkten. Die ersten Anzeichen des Roten Würgers.
Er presste die Handflächen an die Scheibe. »Holly, bitte.« Wegen der heißen Tränen, die ihm in die Augen quollen, konnte er sie kaum noch sehen.
Sie atmete nicht. Ihre Lippen färbten sich dunkel, sie bekam eine Zyanose. Dann trübten sich ihre Augen, und ihre Gesichtshaut schmolz und tropfte als zähflüssiges Protoplasma auf den Boden, bis darunter der gelbe Schädelknochen zum Vorschein kam …
Er schlug die Augen auf, sah sich um und starrte den Zug und das Eis von Ganymed draußen vor den Fenstern an. Sein Kopf dröhnte, als würden ringsherum große Glocken angeschlagen werden. Dann wurde ihm bewusst, dass er seine eigene Stimme hörte.
Seinen eigenen Schrei, der laut hallte.
Die goldenen Zähne bohrten sich wieder und wieder in sein Handgelenk.
6
Wenige Minuten später fuhr der Zug in den Bahnhof unter dem Raumhafen ein.
Leise öffneten sich die Türen, doch ehe er aussteigen konnte, kam jemand herein und baute sich vor ihm auf.
»Zhang Lei?«
»Der bin ich«, antwortete er, ohne den Kopf zu heben.
Eine Frau bewegte sich um ihn herum und trat in sein Sichtfeld. Sie war kleiner als er und wirkte, als sei sie unter hoher Schwerkraft auf der Erde aufgewachsen. Die Erdleute konnte man an dem rötlichen Teint und der gesunden Ausstrahlung leicht erkennen. Sie besaßen eine Kraft und Energie, die von frischer Luft und Sonnenlicht herrührte. Jemandem wie Zhang, der aus dem äußeren System stammte, kamen sie irgendwie unwirklich vor. Seiner Erfahrung nach sollten Menschen groß, schmal und sehr bleich sein und tiefe Ringe unter den Augen haben. Die Leute von der Erde sahen dagegen wie Comicfiguren aus.
»Lieutenant Alexandra Petrowa. Sie können mich Sascha nennen. So halten es hier alle.« Sie gab ihm die Hand.
»Oh«, antwortete er. »Tut mir leid. Ich berühre andere Menschen nicht, wenn ich es vermeiden kann.«
»Ach ja, richtig.« Sie lächelte breit, als hätte er gerade einen Scherz gemacht. Das war seltsam, weil er nichts dergleichen getan hatte. »Man sagte mir, Sie seien eine Art Facharzt. Spezialgebiet interplanetarische Medizin, nicht wahr? Da gehört eine gesunde Abneigung gegen Keime vermutlich zum Grundstudium.«
»Wirklich?«
Ihr Lächeln flackerte wie eine Birne mit Wackelkontakt. Zhang war klar, dass er gerade einen schlechten Eindruck hinterließ.
»Tut mir leid.« Er zwängte sich an ihr vorbei zum Eingang des Raumhafens. »Ich würde gern noch weiter mit Ihnen reden, aber ich möchte meinen Flug nicht verpassen.«
»Ich … ich weiß«, gestand sie. »Ich bin bei der Brandwache.« Dann lächelte sie ihn an und folgte ihm einen langen, aufwärts verlaufenden Gang hinauf. »Falls Sie meine Uniform nicht gleich erkannt haben. Keine Sorge, ich habe nicht vor, Sie zu verhaften oder so etwas.« Sie lachte, und er dachte gleich, sie versuchte schon wieder, witzig zu sein, obwohl ihn die Vorstellung, festgenommen zu werden, sehr beunruhigte.
»Das freut mich zu hören. Hat man Sie geschickt, um sicherzustellen, dass ich wirklich an Bord der Artemis gehe? Ich habe unbedingt vor, genau das zu tun, sofern es keine weiteren Verzögerungen gibt.«
Ihr Lächeln verschwand schon wieder. »Ich … ich fliege ebenfalls mit diesem Schiff.«
»Ah«, antwortete er. »Dann sind Sie jetzt meine Babysitterin.«
»Doktor …«
»Wir können das abkürzen. Damit Sie mich nicht den Rest des Tages über beschatten müssen, sage ich Ihnen, was ich jetzt vorhabe: Ich werde ein braver Junge sein und meine Befehle befolgen. Ich gehe an Bord dieses Raumschiffs, suche mir eine Koje und packe meine Sachen aus. In zwei Stunden stecken sie mich dann in eine Kryokapsel, in der ich drei Monate schlafen werde. Ich glaube, ich werde vorher noch mal masturbieren. Sollte ich Stuhlgang haben, werde ich ihn gern in einer Plastiktüte aufbewahren, damit Sie ihn später untersuchen können.«
Ihre Miene blieb unbewegt und sehr angespannt.
Ihm wurde bewusst, dass er etwas ziemlich Unschönes gesagt hatte. Manchmal rutschte ihm so etwas heraus.
»Ich bin nicht hier, um Sie zu überwachen. Mein Aufgabengebiet ist die strategische Analyse«, erklärte sie. »Ich soll den Sicherheitsstatus der Kolonie Paradise-1 beurteilen. Wir werden in den nächsten sechs Monaten zusammenarbeiten oder sogar noch länger. Ich bin nicht Ihre Vorgesetzte. Wir sind Kollegen. Ich wollte mich Ihnen vorstellen.«
»Sie heißen Petrowa«, entgegnete er. »Ich bin Zhang. So. Wir haben uns einander vorgestellt.« Er marschierte an ihr vorbei und betrat die Abflughalle. Er wollte es einfach nur hinter sich bringen.
7
Sam Parker bemerkte nicht einmal, dass seine Passagiere in die Lounge kamen. Er war vollauf mit den Startvorbereitungen für die Artemis beschäftigt. Sein neues Schiff war ein schlanker, aerodynamischer Transporter, der mit einer unglaublichen Geschwindigkeit die Passagiere von einem Ende der Galaxis zum anderen befördern sollte. In den zehn Jahren, die er mittlerweile als Pilot tätig war, hatte man ihm noch nie ein so fortschrittliches Raumfahrzeug anvertraut.
Er war nicht ganz sicher, warum er dieses Mal den Job bekommen hatte.
Früher hatte Parker Träume gehabt. Er wollte Testpilot werden und sein Leben riskieren, indem er Raumschiffe über die Belastungsgrenzen trieb, einfach nur um zu beweisen, dass er dazu in der Lage war. Gern hätte er eine solche Aufgabe übernommen und beim Militär allen gezeigt, was für ein toller Hecht er war. Deshalb hatte er sich mit achtzehn Jahren, so früh es überhaupt ging, bei der Brandwache beworben. Für einen Jungen wie ihn war es nicht gerade leicht gewesen, denn er war im falschen Teil des Sonnensystems geboren worden, zu weit von der Sonne entfernt. Seine Jugend hatte er auf Welten mit niedriger Schwerkraft in Wohnkuppeln verbracht, sodass er sehr groß und schmal geworden war. Darum hatte man sich sogar gefragt, ob er überhaupt ins Cockpit der modernen Kampfraumschiffe passte.
Am Ende hatte es nicht an den linkisch abstehenden Knien und Ellenbogen gelegen. Sein eigener Stolz hatte ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ein Fluglehrer hatte ihn eines Tages gefragt, ob er mit seinen Knochen überhaupt die G-Kräfte überstehen konnte, die in einem Jäger der Corsair-Klasse bei schnellen Manövern auftraten, woraufhin Parker versuchte, diesem Typen zu zeigen, wie hart seine Fingerknöchel waren.
Wie sich herausstellte, hatte dieser Fluglehrer Knochen aus Roheisen gehabt. Er hatte Sams Faustschlag einfach hingenommen und sofort zurückgeschlagen. Die Nachwirkungen spürte Parker – wenn er sich in einer Atmosphäre mit hoher Luftfeuchtigkeit aufhielt – noch heute in seinem Kiefer. Er schnitt eine trotzige Grimasse. Der Fluglehrer hatte ihn zurückgestellt und ihn einfach nicht mehr fliegen lassen. Parker hatte jeden Job angenommen, den er nur ergattern konnte, um hinter die Steuerung eines Raumschiffs zu kommen – er hatte für die Wohnkuppeln, die Neptun umkreisten, Baustoffe befördert, Müll in den Tiefraum geschleppt und auf dem Mars sogar als Shuttlepilot für VIPs gearbeitet. Es hatte Jahre gedauert, und jetzt …
Vor ihm in der Abflughalle schwebte eine maßstabgerechte holografische Darstellung der Artemis. Sie war wirklich ein wunderschönes Schiff. Man sah ihr an, wie schnell und kraftvoll sie war. Ähnlich wie ein Hai, mit anmutig geschwungenen Linien, die in der Brücke zusammenliefen, sodass der Bug an den Schnabel eines Raubvogels erinnerte. Eigentlich sollte er jetzt die Reaktorabschirmung des Schiffs überprüfen, doch er konnte nicht anders, er hob eine Hand und strich über die glatte Außenfläche.
Das holografische Modell des Schiffs wurde mit einer neuen Technik erzeugt, die man als »hartes Licht« bezeichnete. Das Bild selbst bestand natürlich aus nichts anderem als Licht, das von entsprechend gebrochenen Laserstrahlen erzeugt wurde. Er berührte überhaupt nichts. Doch die Projektion fühlte sich unter seiner Hand fest an. Dabei kam eine Technik zum Einsatz, die auf Raumschiffen die künstliche Schwerkraft erzeugte. Es war eine einfache Rückkopplung. Der Computer, der das Hologramm erzeugte, berechnete, wo seine Hand die Darstellung berühren – und mit welcher Art von Textur die Hand rechnen – würde. Und dann projizierte er dort das richtige Maß an Widerstand.
Solche technischen Spielereien sah man sonst nur in militärischen Einrichtungen und nicht in einem zivilen Raumhafen. Vermutlich kostete der Betrieb dieses Hologramms mehr, als er in den nächsten sechs Monaten verdienen würde. Aber was er da fühlte, mochte er sehr.
Endlich hatte er den Eindruck, voranzukommen. Er konnte der Welt etwas beweisen. Schließlich wusste er, dass er ein ausgezeichneter Pilot war. Vielleicht sahen es allmählich auch die herrschenden Mächte ein. Freilich waren seine Aufgaben recht begrenzt, denn das Schiff verfügte über eine erstklassige, hochmoderne KI, die den größten Teil der Flugmanöver steuern würde. Er würde nur im Notfall oder in Situationen eingreifen, mit denen die KI nicht zurechtkam, was aber höchst unwahrscheinlich war. Trotzdem, irgendjemand hatte beschlossen, ihm Vertrauen entgegenzubringen und ihm diese Aufgabe zu übertragen.
»Sie ist schön«, sagte eine Frau hinter ihm.
»Wenn Sie das Hologramm für schön halten, kann ich Ihnen verraten, dass ich die Schlüssel für das Original besitze. Wollen Sie mal eine Probefahrt machen?« Er lächelte breit und drehte sich zu der Frau um. Vor den Startprozeduren hatte er die Passagierliste überflogen, sich aber natürlich keinen Namen eingeprägt. Diese Frau arbeitete für die Brandwache, so viel wusste er, und …
… als er sich umdrehte, wurde ihm klar, dass er einen Fehler gemacht hatte. Er hätte die Namen aufmerksamer lesen sollen. Dann wäre er jetzt nicht so in Verlegenheit geraten.





























