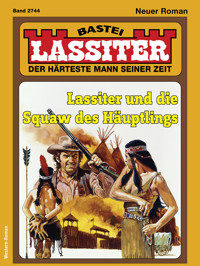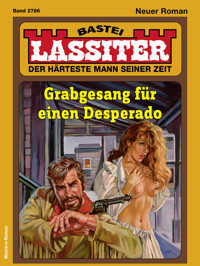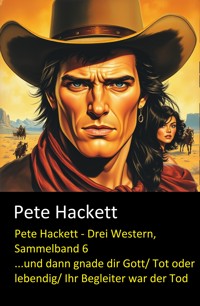
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Ebook enthält drei Western
...und dann gnade dir Gott
Tot oder lebendig
Ihr Begleiter war der Tod
Drei Western von Deutschlands Top-Western-Autor Pete Hackett. Archaisch, bleihaltig, authentisch. Selten istes gelungen, den amerikanischen Westen der Pionierzeit so hart zu schildern, wie er wirklich war. Pete Hackett hat viele der Schauplätze, an denen seine Romane spielen selbst bereist und für seine Romane recherchiert.
Das merkt man seinen Erzählungen an.
Ein CassiopeiaPress E-Book
Cover: Steve Mayer
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Pete Hackett - Drei Western, Sammelband 6
...und dann gnade dir Gott/ Tot oder lebendig/ Ihr Begleiter war der Tod
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenDrei Western – Sammelband 6
von Pete Hackett
Ein CassiopeiaPress E-Book
© by Author
© der Digitalausgabe 2014 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
www.AlfredBekker.de
Das Ebook enthält drei Western
...und dann gnade dir Gott
Tot oder lebendig
Ihr Begleiter war der Tod
… dann gnade dir Gott
Der Krieg war seit über vier Monaten zu Ende. Viele Südstaatensoldaten waren in die Heimat zurückgekehrt. Ein großer Teil aber fand den Weg nach Hause nicht. Als Entwurzelte ließen sie sich treiben. Die einen landeten auf dem schmalen Pfad der Gesetzlosigkeit, andere in der Gosse. Sie zogen als Landstreicher, Satteltramps, Abenteurer und Banditen durchs Land, und am Ende hielt für eine ganze Reihe von ihnen das Schicksal ein Stück heißes Blei oder einen soliden Hanfstrick bereit.
Douglas Howard war nicht heimgekehrt. Jeden Morgen, wenn sich die Sonne über die Gebirgszüge im Osten schob, stieg Flint Howard auf den Hügel, an dessen Fuß die Loyal Valley Ranch lag, um angestrengt Ausschau zu halten. Ein Reiter, der sich der Ranch näherte und der sich als sein Sohn entpuppte, kam jedoch nicht.
Ein Stück südlich der Ranch mündete der Threadgill Creek in den Llano River. Das Land, das Flint Howard gehörte, war grün und fruchtbar. Auf den Weiden standen Longhorns über Longhorns. Während des Krieges hatten sie sich vermehrt wie Karnickel.
Flint Howard beschäftigte eine große Cowboymannschaft. Viele von ihnen waren Heimkehrer. Nach der fürchterlichen Schlacht bei Appomattox waren die Truppen der Konföderierten endgültig aufgerieben worden. Zwei der Cowboys hatten zusammen mit Douglas in derselben Kavallerieeinheit gedient. Über seinen Verbleib konnte sie nichts berichten. Sie hatten sich abgesetzt, als General Lee kapitulierte.
Auch an diesem Tag kehrte Flint enttäuscht vom Hügel zurück. Seine Frau hatte das Frühstück auf der Veranda bereitet. Es war noch kühl, aber der Morgendunst war Vorbote der kommenden Hitze. Flint schwieg düster. Sein Schweigen verriet seine Enttäuschung. Heather sagte: „Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, Flint. Unser Junge lebt. Auf den Listen mit den Gefallenen stand sein Name jedenfalls nicht. In Appomattox war er noch dabei. Das wissen wir von Slim und Lane. Wahrscheinlich befindet er sich in einem Kriegsgefangenenlager der Yankees. Eines Tages kehrt Doug heim. Ich weiß das.“
„Dein Wort in Gottes Gehör, Heather“, murmelte Flint rau, mit einem zweifelnden Unterton. Es war deutlich, dass er die Zuversicht seiner Frau nicht teilen konnte. Er vollführte eine ausholende Bewegung mit dem Arm über die Ranch und das Areal rundherum. „Für wen hätten wir das alles geschaffen, wenn Doug nicht mehr heim käme? Wir beide haben ihm einen soliden Grundstein gelegt mit der Ranch - den Grundstein für ein Rinderreich. - Dieser verdammte, unselige Krieg!“
Er setzte sich nieder. Heather goss ihm Kaffee ein. Er griff nach dem Toast und biss hinein. Lustlos kaute er. Dazu trank er kleine Schlucke des heißen Kaffees.
Eine Handvoll fix und fertig angekleideter Cowboys verließen den Küchenanbau, in dem sie gefrühstückt hatten. Sie grüßten herüber, stapften zum Corral und fingen sich Pferde, legten ihnen die Sättel auf und zäumten sie. Staub wolkte dicht.
Als sie fortgeritten waren, sagte Flint: „Wenn ich nur wüsste, wo ich mit der Suche ansetzen müsste. Nichts würde mich hier halten, und ich würde nicht ruhen, bis ich Gewissheit über Dougs Schicksal hätte.“
Heather erhob sich, um das Frühstücksgeschirr wegzuräumen. Der Hufschlag des Reiterrudels, das die Ranch verlassen hatte, war verklungen. Auch Flint stand auf. Er ging zum Verandageländer, umspannte es mit beiden Händen, sein Blick verlor sich in der Ferne, wo die Konturen der Berge im rauchigen Dunst verschwammen.
Plötzlich war wieder Hufschlag zu vernehmen. Aber diesmal näherte er sich der Ranch. Der Reiter kam von Westen. Er benutzte den ausgefahrenen Weg, der nach Hedwigs Hill führte, und nun trieb er sein Pferd aus dem Einschnitt zwischen zwei Hügeln. Er lenkte es geradewegs auf die Ranch zu. Die Stirn Flint Howards legte sich in Falten. Der Rancher hatte das Funkeln an der linken Brustseite des Reiters wahrgenommen - jenes Funkeln, mit dem sich das Licht der Morgensonne auf dem Sheriffstern brach.
Es war Mathew Brady, der Sheriff von Hedwigs Hill.
Heather trat neben ihren Mann. Sie atmete schneller als normal. Das Herz schlug ihr hinauf bis zum Hals. Wenn der Sheriff zu ihnen kam, dann hatte das nichts Gutes zu bedeuten. Die Erregung strömte wie eine Welle durch ihren Körper.
Der Gesetzeshüter parierte sein Pferd. Er nahm den Hut ab, neigte den Kopf in Richtung der Frau, grüßte und dann saugte sich sein Blick am hageren, kantigen Gesicht Flints fest. Staubheiser, fast kratzend, sagte Mathew Brady: „Schlechte Nachrichten, Flint.“ Verunsichert irrte sein Blick ab, huschte über Heathers angespanntes, erwartungsvolles Gesicht hinweg, in seinen Augen war ein unbehagliches Flackern, verlegen knetete er die Zügelleinen in seinen Händen. „Ich will nicht lange drum herum reden. Es geht um deinen Sohn. Ich habe Nachricht über ihn erhalten.“
Die beiden Menschen auf der Veranda waren wie elektrisiert. Herzschlag und Puls rasten bei ihnen plötzlich. Flint schluckte trocken. Er verspürte das schwindelerregende Gefühl, die Kontrolle über sich zu verlieren, aber dann überwand er sich und er fand zu der ihm eigenen Ruhe und Besonnenheit zurück.
„Spuck es schon aus, Mathew. Was immer es auch ist - ob gut oder schlecht - ich will die ungeschminkte Wahrheit erfahren. Also heraus mit der Sprache.“
Der Sheriff schien im Sattel regelrecht zusammenzuschrumpfen. Er zog den Kopf zwischen die Schultern. Plötzlich aber griff er in die Innentasche seiner Lederweste. Als seine Hand wieder zum Vorschein kam, hielt sie ein zusammengefaltetes Blatt Papier fest. „Lies selbst.“ Er reichte es Flint.
Der Rancher faltete den Bogen auseinander. Seine blauen Augen hefteten sich auf die Buchstaben. Ein betroffener Ton entfuhr ihm. Er staute den Atem und las zu Ende. Scharf stieß er die verbrauchte Luft durch die Nase aus.
Es war ein Steckbrief. Gesucht wurde - Douglas Howard. Tot oder lebendig. Die Belohnung, die auf seinen Kopf ausgesetzt worden war, betrug 1000 Dollar. Die Beschreibung stimmte. Sechs Fuß zwei Zoll groß, hager, blond, blauäugig, Mitte zwanzig. Douglas wurde wegen Bankraubs gesucht, ein Mann war bei dem hold up auf die Bank von Wichita Falls getötet worden.
Flint Howard wurde von einem Taumel erfasst. Sekundenlang schienen die Buchstaben vor seinen Augen zu verschwimmen. Er hatte das Gefühl, unter seinen Füßen wankte der Erdboden. Er wollte etwas sagen, aber seine Lippen waren so trocken wie seine Kehle. Sein vom panischen Schrecken erfasster Verstand wirbelte und fabrizierte verworrene Bilder. Er reichte seiner Frau den Steckbrief, und jetzt entrang es sich ihm mühsam und heiser vor Erregung: „Du hast recht, Heather, Douglas lebt. Aber wenn das stimmt, was hier steht, dann wäre es besser, er wäre auf dem Schlachtfeld geblieben.“
Der Sheriff hatte sich den Hut wieder auf den Kopf gestülpt. Betreten gab er zu verstehen: „Ein ganzer Stapel Steckbriefe kam heute mit der Postkutsche an. Ich werde sie überall im Distrikt aushängen müssen. Es ist eine ganze Bande, Flint. Ich wollte, es ...“
Er brach ab, denn Heather entrang sich ein Ton, der sich anhörte wie das Japsen eines Erstickenden. Tränen perlten über die Wangen der Frau. Der Steckbrief segelte auf die Veranda, die Frau schlug die Hände vor das Gesicht und schluchzte auf. Sie wankte und drohte zu stürzen. Der Schock, den die Hiobsbotschaft in ihr auslöste, drohte ihr den Verstand zu rauben.
Schnell sprang Flint hinzu, um sie zu stützen. Da aber warf sich Heather herum und lief ins Haus. Es mutete an wie eine Flucht.
„Sie wird es wohl nicht verkraften“, murmelte der Sheriff. „Es tut mir leid, Flint. Vielleicht hätte ich es schonender ...“
Die Rechte des Ranchers wischte durch die Luft. „Mach dir keine Gedanken, Mathew“, schnappte er. Die Bestürzung wich dem Zorn - Zorn auf seinen Sohn, der ihm, seinem Vater, vor allem aber Heather, seiner Mutter, eine derart grenzenlose Enttäuschung bereitete. Es gab keinen Zweifel. Auf dem Steckbrief stand der Name, und bei dem Mann, der auf dem Steckbrief beschrieben wurde, handelte es sich um keinen anderen als Douglas. Eine Verwechslung war kaum möglich. „Heather ist eine starke Frau. Sie wird den Schock verwinden. Mag die Wahrheit noch so schrecklich und niederschmetternd sein.“
„Was wirst du tun, Flint?“
Der Rancher zuckte mit den Achseln. „Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.“ Es klang irgendwie resignierend und hoffnungslos. Eine Welt begann für Flint Howard zusammenzubrechen. Seine Gefühle schwankten. Nach dem Zorn kam die Bitterkeit. Sie überschwemmte ihn wie eine heftige Flut. Sein erschütterter Blick voll Qual verlor sich wieder in der Ferne. „Weißt du etwas über den Mann, der durch die Schuld meines Sohnes ums Leben kam, Mathew?", fragte er nach kurzer Zeit der Versunkenheit.
„Er war Clerk in der Bank von Wichita Falls, und er hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.“
„O mein Gott.“ Das Kinn Flints sank auf die Brust. Er schien plötzlich um Jahre gealtert. Sein Gesicht war Spiegelbild seiner Empfindungen. „Es ist schlimm“, murmelte er, und seine Stimme klang brüchig. „Ich werde ...“ Er brach ab. Sein Kopf ruckte hoch. Eiserne Entschlossenheit zeigte sich plötzlich in seiner Miene. Und als er sprach, fielen seine Worte mit der Härte und Entschiedenheit eines Mannes, der es gewohnt ist, seinem Willen Geltung zu verschaffen. Er sagte:
„Ich reite nach Wichita Falls, Mathew. Ich kann der Frau zwar nicht den Mann und den Kindern nicht den Vater zurückgeben, aber ich kann versuchen, den Schaden durch finanzielle Zuwendungen zu begrenzen. Und dann suche ich meinen Sohn. Ich will ihn zwingen, mir in die Augen zu sehen, wenn ich ihn nach seinen Beweggründen frage.“
„Du zweifelst überhaupt nicht an seiner Schuld, wie?“, fragte der Sheriff. Seine Stirn lag in Falten.
„Du etwa, nach allem, was auf dem Steckbrief steht?“, kam es wie aus der Pistole geschossen zurück.
Der Sheriff wiegte den Kopf. „Ich kenne Doug, seit er lebt. Ich sah ihn heranwachsen. Sicher, er war immer ein wilder Bursche, aber in ihm steckte nichts von einem skrupellosen Banditen. Vielleicht ... Ach was, ich weiß selbst nicht, was ich denken soll. Du weißt jetzt jedenfalls Bescheid, Flint. Ich reite zurück in die Stadt.“
Mathew Brady tippte mit dem Zeigefinger seiner Linken an den Hutrand, zog das Pferd herum und trieb es mit einem Schenkeldruck an. Die Hufe des Tieres rissen kleine Staubfontänen in die sich schnell erwärmende Luft. Gedankenverloren blickte Flint Howard hinter ihm her.
Sein Entschluss stand fest.
Keine Macht der Welt sollte ihn davon abbringen können. Noch mehr, nachdem die letzten Worte des Sheriffs wieder Zweifel in ihm geweckt hatten. Er war entschlossen, die Wahrheit zu ergründen. Alles andere war plötzlich unwichtig - war zweitrangig geworden, versank in der Bedeutungslosigkeit. Er bückte sich, hob den Steckbrief auf, legte ihn sorgfältig zusammen und steckte ihn ein. Dann wandte er sich um. Mit hängendem Kopf ging er ins Haus.
*
Tampico, Hall County, eine ruhige, kleine Town im südlichen Panhandle von Texas. Es war später Nachmittag. Die Sonne schien heiß. Kein Windhauch regte sich. Die Town bereitete sich auf den Feierabend vor.
Frank Slater, der Barbier, verließ sein Geschäft, um die Tafel wegzuräumen, die er vor seinem Laden am Rand des Sidesteps aufgestellt hatte und auf der er seine Dienstleistungen feilbot. Er schwenkte seinen Blick die Straße hinauf und hinunter. Spielende Kinder, dösende Hunde, eine Gruppe Frauen, hier und dort ein Mann, der irgendeine Arbeit erledigte. Dem Barbier bot sich das alltäglich Bild - das Bild von Frieden, Ruhe und Beschaulichkeit.
Er langte nach der hüfthohen Schiefertafel mit dem abgegriffenen Holzrahmen, verhielt aber in der Bewegung und lauschte. Und schon im nächsten Moment war er sich sicher, dass er keiner Täuschung erlegen war. Der Stadt näherte sich tosender Hufschlag. Er kam von Südosten, und er war nur als fernes Rumoren zu vernehmen. Aber schnell wurde er deutlicher. Und dann schlug er heran wie eine Brandungswelle.
Im Südosten der Stadt gab es keine Ranch. Außerdem war Mittwoch, und keine der Cowboymannschaften käme auf die Idee, während der Woche in der Stadt den Teufel aus dem Kasten zu lassen.
Wer also näherte sich der Town mit Höllengeschwindigkeit? Eine seltsame Unruhe erfasste den Barbier. Er starrte in die Richtung, aus der sich der Reiterpulk näherte. Auch die Frauen hatten ihre Unterhaltung unterbrochen, und auch ihre Aufmerksamkeit galt dem heranprallenden Hufgetrappel. Es mutete den Barbier an wie eine Botschaft von Untergang und Verderben. Seine Hände umspannten den Tafelrahmen. Unheil schien in der Luft zu liegen. Er glaubte es regelrecht riechen zu können. Und seine Stimmbänder wurden mehr von der jähen Unrast als vom Verstand diktiert, als er schrie: „Geht nach Hause, ihr Frauen, und sorgt dafür, dass die Kinder von der Straße verschwinden. Es ...“
Er brach ab, verschluckte sich fast, denn in diesem Moment bogen die Reiter um einen Knick der Main Street. Es waren über ein halbes Dutzend, und sie kamen in einer breiten Reihe. Staub schlug unter den wirbelnden Hufen ihrer Pferde auseinander, der prasselnde Hufschlag prallte gegen die Häuserfronten und wurde zurückgeworfen, das trommelnde Stakkato erfüllte die ganze Stadt.
Der Barbier ließ die Tafel fallen. Er wirbelte herum. Die Tafel zerbrach, als sie auf den Gehsteigbohlen aufschlug. Als säße ihm der Leibhaftige im Nacken hetzte er in sein Geschäft. Die Türglocke bimmelte wie verrückt. Das in den oberen Teil des Türblattes eingesetzte Glas klirrte, als er hinter sich die Tür zuwarf. Unter dem Fenster ging Frank Slater in Deckung. Die zitternde Anspannung seiner Nerven entlud sich in einem ächzenden Laut, der sich ihm entrang und der einer panikartigen Überreaktion entsprang, die ihn in diesem Augenblick überwältigte. Das Herz klopfte dumpf in seiner Brust; das Pochen in seinen Schläfen war das Echo seiner Pulsschläge.
In den Hufschlag mischte sich Geschrei. Die Frauen vor dem General Store spritzten auseinander wie eine Hühnerschar, zwischen die der Habicht stieß. Einige Hunde bellten wie von Sinnen. Die Kinder flohen schreiend in verschiedene Richtungen. Plötzlich war die Straße wie leergefegt. Und nun peitschten Schüsse. Unwillkürlich zog Frank Slater den Kopf ein. Glas klirrte. Die Geräusche vermischten sich zu einer höllischen Symphonie.
Der Barbier fasste all seinen Mut zusammen und äugte wieder über die Fensterbank nach draußen. Soeben galoppierte die Kavalkade in sein Blickfeld. Die Männer waren maskiert. Sie hatten sich die Halstücher über Mund und Nase gezogen. Blindlings ballerten sie ihr Blei in die Runde. Eine Wolke von Staub hüllte sie ein.
Frank Slater erbebte bis in seinen Kern. Seine Zähne schlugen aufeinander wie im Schüttelfrost. Die Angst würgte ihn mit unsichtbaren Händen.
Vor der Bank rissen die Kerle ihre Pferde zurück. Zwei von ihnen sprangen ab und stürmten zur Tür. Unter einem wuchtigen Tritt flog sie auf. Die anderen fünf Banditen trieben ihre Pferde vor der Bank auf und ab und sicherten den hold up. Sie feuerten um sich und hielten so die Menschen in den Häusern in Schach.
Die beiden Clerks in der Bank warfen die Arme in die Höhe, noch ehe sie dazu aufgefordert wurden. Sie erbleichten bis in die Lippen. In ihren Gesichtern zuckten die Nerven. Ihre Hände zitterten.
Die beiden Banditen glitten mit den Colts im Anschlag an den Schalter heran. Einer der Kerle - er war über sechs Fuß groß, unter seinem schwarzen, flachkronigen Stetson lugten blonde Haare hervor -, fauchte: „Packt alles Geld ein! Pronto, pronto! Beeilt euch! Andernfalls machen wir euch Beine. Ich gebe euch zwanzig Sekunden! Wenn sie vorbei sind, kracht es.“
Aus eiskalten, blauen Augen starrte er die Clerks zwingend an - Augen, die Bände sprachen, die alles über die Skrupellosigkeit und Unbarmherzigkeit verrieten, die in dem Manne steckten.
Ungeduldig wedelte er mit dem Colt. Sein Daumen lag quer über der Hammerplatte. Wie das hohle Auge eines Totenschädels starrte die Mündung abwechselnd auf die beiden Angestellten.
Und die beiden beeilten sich. Mit fliegenden Händen packten sie zwei kleine Jutesäcke voll mit Papiergeld. Als sie auch das Hartgeld in einen Sack füllen wollten, winkte der blondhaarige Outlaw ab. Er warf einen der Beutel seinem Komplicen zu, den anderen klemmte er sich unter den linken Arm, dann stieß er unter der Maske hervor: „All right. Bestellt dem Sheriff schöne Grüße von Douglas Howard! Falls er ein Yankee ist, dann sagt ihm, dass der Krieg zwischen Nord und Süd noch nicht zu Ende ist. Nun auf den Boden mit euch. Und versucht besser nicht, uns aufzuhalten. Euch beide auf die lange Reise zu schicken kostet uns ein Lächeln.“
Die Clerks warfen sich regelrecht auf die gebohnerten Dielen. Die beiden Banditen zogen sich zurück. Ehe sie die Bank verließen, jagte der blondhaarige Bandit noch zwei Schüsse über die Schaltertheke hinweg. Die Kugeln hieben in die Wand und ließen den Kalk spritzen.
Die Outlaws warfen sich auf ihre Pferde. Eines der Tiere stieg auf die Hinterhand und ließ die Vorderhufe durch die Luft wirbeln. Wiehern erklang. Ein scharfer Befehl ertönte, und dann stoben die Reiter davon. Ihren Abgang begleitete das trockene Dröhnen ihrer Colts.
Ein Mann fasste sich ein Herz. Er feuerte aus einem Fenster auf das höllische Rudel. Einer der Kerle warf beide Arme gleichzeitig in die Höhe, dann flog er rücklings vom Pferd, als hätte ihn die göttliche Faust aus dem Sattel gewischt. Er überschlug sich auf der Fahrbahn und blieb mit ausgebreiteten Armen auf dem Rücken liegen. Sein Pferd sprengte im Pulk der anderen weiter. Dem Mann, der geschossen hatte, wurden regelrecht die Beine vom Boden weggerissen. Er krachte gegen die Hauswand, dann schlug er schwer auf den Vorbau.
Doch jetzt wurden die Banditen auch aus anderen Häusern unter Beschuss genommen. Sie warfen sich flach auf die Pferdehälse und feuerten die von der Schießerei schon total verstörten Tiere mit den Sporen, den langen Zügelenden und abgehacktem, heiserem Geschrei an. Die Hufe schienen kaum noch den Boden zu berühren.
Ein Pferd brach zusammen. Es begrub seinen Reiter unter sich. Das Tier wieherte. Es hörte sich an wie der Todesschrei eines Menschen. Es bockte hinten hoch, rollte verzweifelt mit den Augen, dann kippte es zur Seite. Die Hufe keilten noch einmal aus, dann lag das Tier still. Fluchend und brüllend gelang es dem Reiter, sein Bein unter dem Kadaver hervorzuziehen. Er wankte hoch. Sein Colt lag irgendwo im knöcheltiefen Staub. Aus flackernden Augen, aus denen die Angst zu brüllen schien, schaute er sich um.
Seine Kumpane kümmerten sich nicht um ihn. Sie hatten keine Notiz davon genommen, dass ihm das Pferd unter dem Hintern weggeschossen worden war. So hatte es zumindest den Anschein. Der Bandit schnappte sich sein Gewehr aus dem Scabbard und warf sich hinter dem getöteten Pferd in Deckung. Kugeln pfiffen wie giftige Insekten über ihn hinweg. Am liebsten hätte er sich in die Straße eingegraben.
Die Horde hatte den Knick erreicht. Im nächsten Moment war sie verschwunden. Der Hufschlag brach abrupt ab. Stille senkte sich zwischen die Häuser von Tampico. Aus den Häusern zu beiden Seiten wagten sich zaghaft und mit der gebotenen Vorsicht einige beherzte Männer, die Waffen im Anschlag, angespannt bis in die letzte Muskelfaser.
Da steilte der Hufschlag wieder in die Höhe. Die Bande kam zurück. Schießend jagte sie die Fahrbahn herunter. Pulverdampf und aufgewirbelter Staub verschmolzen zu einer wabernden Masse. Wie der Blitz verschwanden die Bürger wieder in ihren Häusern. Der Bandit bei dem toten Pferd stemmte sich hoch. Er machte sich sprungbereit. Aus verschiedenen Fenstern zu beiden Seiten leckten wieder ellenlange, grellgelbe Feuerzungen. Die Stadt war voll vom infernalischen Lärm. Eine Salve aus den Waffen seiner eigenen Kumpane mähte den Banditen bei dem toten Pferd von den Beinen. Er brach zusammen und war tot, ehe er begriff, dass er nicht gerettet, sondern mundtot gemacht werden sollte. Ein Pferd sprang über ihn hinweg. Dann jagten die Outlaws in eine Seitenstraße. Der wogende Staub senkte sich. Die Waffen schwiegen. Der Hufschlag entfernte sich schnell. Und dann hing eine entsetzliche, unerträgliche Ruhe über der Town.
Ein Bürger Tampicos hatte seinen Mut mit dem Leben bezahlt. Die beiden Banditen, die auf der Straße lagen, waren ebenfalls tot. Alles, was in der Town zwei gesunde Beine hatte, drängte auf die Straße...
*
Flint Howard traf in Wichita Falls ein. Zwölf Meilen weiter nördlich begann das Indianerterritorium Oklahoma. Das Indianerterritorium bot Banditen und ganzen Banden tausende von Schlupfwinkeln. Kaum dass der Fuß eines Gesetzesbeamten dieses unwirtliche, gefährliche Gebiet betrat.
Der Fünfzigjährige hatte die Stagecouch benutzt. Als er die Stadt erreichte, war er durch und durch geschüttelt, er spürte jeden Knochen in seinem Körper, seine Muskeln und Sehnen waren wie gelähmt, er war erschöpft bis in seinen Kern.
Ehe er sich aber im Hotel ein Zimmer mietete, um sich auszuschlafen und zu erholen, erkundigte er sich beim Officer des Postdepots nach Lydia Benton, der Frau des ermordeten Bankclerks. Der Mann beschrieb ihm den Weg zum Haus der Frau, ohne irgendwelche Fragen zu stellen.
Flint fand das Haus. Zwiespältige Gefühle beschlichen den Mann, als er daran dachte, dass hier der Mann wohnte, den sein Sohn tötete. Er stellte die Reisetasche zwischen seinen Füßen ab und klopfte. Gleich darauf wurde ihm geöffnet.
Lydia Benton war eine verhärmte Frau. Der gewaltsame Tod ihres Mannes hatte sie sehr mitgenommen. Als Flint seinen Namen nannte, prallte sie zurück. Dann aber fing sie sich, und sie stieß im jähen Aufruhr ihrer Gefühle hervor: „Ein Howard hat meinen Mann auf dem Gewissen. Douglas Howard! Seine Beschreibung passt auf Sie. Allerdings sind sie etwa fünfundzwanzig Jahre zu alt, um der Mörder zu sein.“
Ihre Verbitterung, der anklagende Ton in ihrer Stimme, der Ausdruck einer immensen, innerlichen Erschütterung in den Augen - das alles ließ erahnen, wie es um die Psyche dieser Frau bestellt war. Flint schluckte trocken. Mit einer Stimme, die ihm selbst fremdartig und klanglos vorkam, sagte er:
„Die Sache mit Ihrem Mann tut mir leid, Mrs. Benton. Ja, ich bedauere den Tod Ihres Mannes von ganzem Herzen. Und es ist kein Zufall, dass ich bei ihnen aufkreuze. Wie es aussieht, war es mein Sohn, der zusammen mit einer Bande gewissenloser Schurken die Bank überfiel, in der Ihr Mann arbeitete. Ich lebe in der Nähe von Hedwigs Hill, das ist ein kleines Nest im Mason County, etwa zweihundertfünfzig Meilen südlich von hier. Ich erfuhr von der Sache durch unseren Distriktsheriff. Von ihm bekam ich auch den Steckbrief meines Sohnes. Ich bin sogleich aufgebrochen, um ...“
„Was wollen Sie?“ Die Stimme der Frau war von stählerner Härte. „Mir Ihr Mitgefühl ausdrücken?“ Hassvoll starrte sie ihn an. Ihre Wangen vibrierten vor innerer Erregung. Ihre Brust hob sich unter einem tiefen Atemzug. Dann presste sie mit von der Leidenschaft verdunkelter Stimme hervor: „Sie sind der Vater des Mannes, der meinen Mann ermordete. Er ist Ihr Sohn - Ihr verdammtes Fleisch und Blut. Auch mein Mann hatte Söhne. Zwei kleine Jungs, acht und zehn Jahre alt - alt genug, um die schreckliche Wahrheit zu begreifen. Mein Mann war ihnen ein guter Vater. Sie müssen es akzeptieren, dass er nicht mehr da ist. Sie werden es aber nie verwinden, dass es Banditenhand war, die seinem Leben ein jähes Ende bereitete. - Sie kommen daher und rühren in eine offene Wunde, Mister. Sicher, Sie können nichts für Ihren Sohn. Und wahrscheinlich bedauern sie es wirklich, was geschehen ist, dass Ihr Sohn unbeschreibliches Leid über uns brachte. Aber Ihr Mitleid hilft uns nicht weiter. Darum sollten Sie jetzt gehen. Ich will es meinen Jungs ersparen, dem Mann gegenüberzustehen, dessen Sohn ihren Vater ermordete. Gehen Sie!“
Wenn ihre Stimme ab der zweiten Hälfte ihrer Rede weicher und ruhiger geworden war, so kam dieser letzte Befehl wieder schroff und scharf, ohne die Spur von Wärme, Entgegenkommen oder Verbindlichkeit.
Bei Flint brach etwas durch, das er bisher selbst nicht an sich kannte. Es war wie eine trotzige Reaktion, ein Aufbegehren, ein sich Auflehnen gegen diese ungerechtfertigte - wenn auch verständliche - Reaktion der Frau, mit der sie ihm Unrecht zufügte und ihn mit dem Mörder ihres Mannes mehr oder weniger auf eine Stufe stellte.
„O nein, Ma’am“, entrang es sich ihm schwer, und er stellte schnell seinen Fuß in die Tür, ehe sie sie zuschlagen konnte. „Ich habe mich nicht zweihundertfünfzig Meilen weit durchschütteln lassen, um mir von Ihnen diese herbe und ungerechtfertigte Abfuhr zu holen. Ich verstehe Ihren Schmerz, Ihre Trauer und Ihre Verbitterung, und ich kann Ihnen die Hilflosigkeit, die Ohnmacht, mit der sie allem gegenüberstehen, nachfühlen. Ihren Mann kann ich Ihnen leider nicht zurückgeben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Ihnen und Ihren Söhnen nach seinem Tod an einigem mangelt. Um wenigstens materielle Not von Ihnen und Ihren Söhnen ...“
Sie unterbrach ihn schroff: „Wollen Sie Ihren missratenen Sohn freikaufen von seiner blutigen Schuld?“, fragte sie, und es klang auf besondere Art sarkastisch. „Soll ich mir von ihnen den Tod meines Mannes bezahlen lassen? Ich pfeife auf Ihr Geld, Howard. Ich pfeife auf alles. Nur noch Sühne zählt. Und wenn man Ihren verbrecherischen Sohn eines Tages aufhängt, werde ich in der vordersten Reihe stehen, um zuzusehen.“
Das Gesicht der Frau hatte sich auf erschreckende Art verändert. Es war nur noch eine Physiognomie des tödlichen, unauslöschlichen Hasses. Sie versetzte Flint einen Stoß vor die Brust, der ihn zurücktaumeln ließ. Krachend flog die Tür ins Schloss. Flint stand zutiefst erschüttert da. Wie Fieber durchrann es seine Blutbahnen. Der Name Howard hatte plötzlich einen schlechten Klang bekommen. Douglas hatte ihn entehrt. Er hatte die Ehre seines Vaters in den Schmutz getreten. Es setzte sich in Flint fest, ließ ihn nicht mehr los, und über seine Lippen brach es rau:
„Ich werde dich finden, Douglas. Und dann werde ich dir Fragen stellen - eine Reihe von Fragen. Und sollte es sich bewahrheiten, sollte es sich herausstellen, dass du tatsächlich eine den niedrigsten Trieben gehorchende menschliche Bestie geworden bist, dann gnade dir Gott!“
Er wollte sich abwenden, als er angesprochen wurde. Er versteifte. Die Stimme trieb von links heran. Böser Spott schwang in ihr. Sie sagte: „Wieviel Geld wolltest du meiner Schwägerin denn bieten, Howard? Führe das Gespräch mit mir fort. Ich reagiere weniger emotional als Lydia. Sie steckt noch viel zu sehr im Klammergriff der furchtbaren Ereignisse, die dein Sprößling zu verantworten hat.“
Der Mann trat hinter dem Haus hervor. Er war groß und breitschultrig. Ein hämisches Grinsen zog seine Mundwinkel nach unten. Vom ersten Moment an empfand Flint Abneigung gegen ihn. Die Verkrampfung in ihm löste sich, er maß den anderen von oben bis unten, machte sich ein Bild von ihm, dann murmelte er: „Sie sind der Bruder des Getöteten, wie?“
„So ist es. Seit seinem Tod kümmere ich mich etwas um Lydia und die beiden Boys. Es ist wohl tatsächlich so, dass der jähe Ausfall ihres Ernährers große Probleme aufwirft.“
Der Bursche legte den Kopf etwas schief, grinste abstoßend, er verschränkte die Arme vor der Brust und nahm die Beine etwas auseinander. Es war eine herausfordernde Haltung, die er einnahm.
Flint stellte sich auf Verdruss ein. Was er sah, gefiel ihm nicht. Die Augen des anderen waren gerötet und wässrig. Seine Sprache war etwas schwerfällig, um nicht zu sagen lallend. Dieser Mister war angetrunken. Und er verströmte aufdringliche Boshaftigkeit. Sein niederträchtiges, ironisches Grinsen war Spiegelbild einer niederen Gesinnung. Flints Instinkt programmierte seinen Verstand auf Abwehr...
*
Flint versetzte grollend: „Gerade darüber wollte ich mit Ihrer Schwägerin sprechen, Mann. Sie hat mir vor der Nase die Türe zugeschlagen. Was sie mir zu sagen hatte, haben Sie gewiss mitbekommen. Sie standen ja sicherlich schon länger hinter der Hausecke. Falls Sie es jedoch nicht richtig verstanden haben sollten, Mister, wiederhole ich es: Sie will nichts von einem Howard. Alles, was sie will, ist meinen Sohn mit einem Strick um den Hals an einem Ast zu sehen.“
„Der Schmerz hat ihr wahrscheinlich den Verstand geraubt“, gab der Bursche zu verstehen, und nach dem letzten Wort kicherte er. „Sie und ihre beiden Söhne nagen am Hungertuch, Mister. Also spuck es schon aus: wie sollte denn die finanzielle Hilfe aussehen, die du ihr zukommen lassen wolltest? Sollte es eine einmalige Abfindung sein, oder etwa gar eine Rente?“
Flint ahnte, dass sich der Bursche nicht so leicht abschütteln ließ. Er war sicherlich zwanzig Jahre jünger und dreißig Pfund schwerer. Eine Waffe war an ihm nicht zu entdecken. Aber das besagte gar nichts. Man konnte einen Colt oder einen Dolch verborgen mit sich herumschleppen. Flint sagte gedehnt: „Um mit Ihnen zu verhandeln, bin ich gewiss nicht nach Wichita Falls gekommen, Mister ... Haben Sie auch einen Namen?"
„Natürlich. Samuel Benton. Also - wieviel?“
„Zunächst hätte ich Ihrer Schwägerin 1000 Dollar geboten. Diesen Betrag dürfte ein Bankclerk in zwei Jahren verdienen. Nach zwei Jahren ...“
„Das ist genau der Betrag, den sie auf deinen Ableger ausgesetzt haben, Amigo!“, stieß Benton hervor und lachte grölend. „Ein Menschenleben scheint in diesem Lande 1000 Dollar wert zu sein. Aber Spaß beiseite, Howard. Rück das Geld raus. Ich werde es Lydia geben, sobald sie sich beruhigt hat. Ihr Auftauchen hat scheinbar einen Sturm der Gefühle in ihr ausgelöst. Ich werde ihr zu gegebener Zeit die 1000 Bucks als Trostpflaster auf ihre Wunden legen. Ich denke, das ist eine lobenswerte Geste von dir. Also lass die Greenbucks herüberwachsen, Howard. Und lass mir deine Adresse hier, damit ich - damit Lydia sich beizeiten bei dir melden kann.“
Flint hob seine Rechte, streckte den Zeigefinger aus und stieß ihn in Bentons Richtung. „Sie, Mister, kriegen von mir nicht mal einen rostigen Cent. Und nun treten Sie zur Seite. Ich habe eine lange Reise hinter mir, bin hungrig, durstig und müde. Sprechen Sie von mir aus mit Lydia. Wenn Sie sie beruhigen können, ist sie vielleicht bereit, noch einmal mit mir zu sprechen. Sie findet mich dann im Hotel.“
Mit seinem letzten Wort bückte Flint sich nach der Reisetasche. Er achtete in diesem Moment nicht auf Sam Benton. Flints rechte Hand schloss sich um den ledernen Griff. Bentons Bein zuckte hoch. Es war ein hundsgemeiner Tritt, und ehe Flint reagieren konnte, knallte ihm der Fuß mit der Wucht eines Pferdetrittes gegen die Brust. Das Schienbein Bentons traf seine linke Gesichtshälfte, aber diesen Treffer registrierte lediglich sein Unterbewusstsein. Echt zu schaffen machte ihm der Tritt vor die Brust. Er drückte ihm mit einem Schlag die Luft aus den Lungen. Flint ließ die Tasche fahren, wankte rückwärts, japste, sein Gesicht lief dunkel an. Er hatte beide Hände in seinen Brustkorb gekrallt. Der Schmerz verkrampfte seine Kiefer.
Aber dann kam der befreiende Atemzug. Es war, als löste sich etwas in ihm. Die Schleier vor seinen Augen rissen. Deutlich sah er Sam Benton auf sich zukommen, die rechte Faust zum Schlag erhoben. Benton knirschte: „Ich schlage dich in Stücke, Howard, und kein Mensch in dieser Stadt wird einen Finger für dich krumm machen. Ein verdammter Howard wird als skrupelloser Mörder in die Annalen der Town eingehen, und von dir, seinem Erzeuger, wird in Wichita Falls kein Straßenköter ein Stück Brot nehmen. Du hast jetzt die Wahl, Mister: entweder du rückst die Bucks freiwillig heraus, oder ich hole sie mir. Wählst du die erste Alternative, dann kommst du ungeschoren davon. Wenn nicht, kriechst du auf allen vieren zurück zum Depot der Overland Mail Company.“
Einen Herzschlag lang wollte Furcht vor dem jüngeren und gewiss auch stärkeren Mann nach Flint greifen, aber dann gewannen Kampfgeist und Stolz die Oberhand und er erwiderte gequält keuchend, aber unbeeindruckt und unerschrocken: „Okay, Benton. Ich sehe es schon: Sie sind keinen Deut besser als diejenigen, die die Bank hier überfielen und den Clerk töteten. Sie sind Banditen, denen ein Menschenleben gerade den Preis für eine Kugel wert ist; Sie sind ein Straßenräuber der übelsten Sorte. Ihr Kerle seid alle von derselben niederträchtigen Spezies und seid die Luft nicht wert, die ihr atmet. Na komm schon, du kleiner Halsabschneider, und versuch, mit die 1000 Bucks abzunehmen.“
Flint hatte, während er sprach, die Arme angewinkelt und die Hände zu Fäusten geballt. Er spreizte die Beine etwas, um festeren Stand zu haben. Sein Gesicht war hart und kantig geworden. Das eckige Kinn verriet viel von der Energie und der Willensstärke des Mannes vom Threadgill Creek.
Einen Augenblick zeigte Sam Benton Verunsicherung. Sie äußerte sich darin, dass er seinen Kopf zwischen die ausladenden Schultern zog und den Worten Flints hinterherzulauschen schien. Er zwinkerte, presste die Zähne aufeinander, dass die Backenknochen hart hervortraten, dann spuckte er aus und zischte gehässig: „Dann werde ich dich jetzt ungespitzt in den Erdboden schlagen, alter Knabe. Pass auf, ich komme jetzt.“
Das letzte Wort war noch nicht über seine Lippen, als er sich Flint entgegenwarf. Ja, er ließ sich einfach nach vorne kippen, vollführte mit dem linken Fuß einen Ausfallschritt, um nicht das Übergewicht zu verlieren, im selben Moment schickte er seine rechte Faust auf die Reise und ließ die linke sogleich folgen.
Seine Absicht war es, mit dieser Kombination den Gegner von der ersten Sekunde an kampfunfähig zu schlagen und ihn dann zu zertrümmern. Aber er hatte Flint unterschätzt. Flint duckte sich gedankenschnell. Die Fäuste pfiffen über seinen Kopf hinweg. Er drückte sich ab und rammte Benton die Schulter in den Leib. Zugleich landete er einen Haken mitten in Bentons Gesicht, den der Bursche mit einem wütenden und zugleich schmerzhaften Aufschrei quittierte. Blut sickerte aus seiner Nase, lief über seinen Mund und sein Kinn. Er versuchte sich rückwärtsgehend von seinem Gegner abzusetzen, um Distanz und Zeit zu gewinnen, aber Flint blieb dicht am Mann. Er schlug eine Doublette und traf Benton am Kinn und am Ohr. Die beiden Schwinger ließen den Kopf des Burschen von einer Schulter auf die andere fliegen.
In jeden seiner Schläge lag Flints Zorn auf diesen großspurigen Kerl, der in einer geradezu impertinenten Art und Weise versucht hatte, ihn um 1000 Dollar zu erpressen. Auch ein gewisses Maß an Enttäuschung über die Abfuhr, die ihm von Lydia Benton erteilt worden war, begleitete seine Treffer. Er brauchte ein Ventil, um Dampf abzulassen. Und jeder Hieb befreite ihn stärker von seiner Wut und der Verbitterung, die in ihm lebten und ihm zusetzten.
Doch Benton war hart im Nehmen. Vielleicht gab ihm auch der Gedanke an die 1000 Dollar Auftrieb. Jedenfalls gelang es ihm, sich mit einem kraftvollen Sprung zur Seite von seinem Gegner abzusetzen und Luft zu schöpfen. Und als sich ihm Flint wieder wild und ungestüm zuwandte, rannte er geradewegs in einen weiteren Fußtritt des gemeinen Burschen hinein.
Ein Gurgeln, das in einem Röcheln endete, brach aus Flints Kehle. Er beugte sich nach vorn und bekam Bentons Knie mitten ins Gesicht. Der Treffer richtete ihn auf. Blut rann aus seiner aufgeplatzten Lippe. Vor seinen Augen tanzten feurige Garben, seine Umgebung versank, und dann krachten zwei bretterharte Schwinger in seinen Magen und gegen seinen Kinnwinkel. Die beiden Treffer warfen ihn um. Er lag auf dem Bauch, seine Finger verkrallten sich im Boden, einige seiner Nägel brachen. Rasselnd ging Flints Atem.
Wie aus weiter Ferne vernahm er Stimmen. Sie erreichten nur den Rand seines Bewusstseins. Verbissen stemmte er sich gegen die Nebel der Benommenheit, die auf ihn zuzukriechen schienen. Sein schmerzender Verstand hämmerte ihm ein, dass er wohl tatsächlich gegen diesen Sam Benton eine schmähliche Niederlage würde einstecken müssen. Fairneß kannte dieser grobschlächtige Bursche nicht. Er war aus gnadenloser Härte, Brutalität und Gewissenlosigkeit zusammengesetzt. Eine absolut tödliche Mischung.
Alles in Flint begann sich gegen die drohende Niederlage aufzulehnen. Mit unmenschlicher Willenskraft verhinderte er ein Abgleiten in die Besinnungslosigkeit. Er kam hoch auf die Knie. Ein nahezu dämonischer Selbsterhaltungstrieb riss ihn hoch. Mit dem Handrücken wischte er sich die Tränen aus den Augen. Er schüttelte den Kopf, um die Benommenheit zu vertreiben. Sein Blick erfasste Lydia Benton. Sie stand zwischen ihm und ihrem Schwager. Ein Stück weiter hatten sich einige Neugierige eingefunden. Ohne jede Anteilnahme oder sonstige Gemütsregung musterten sie ihn.
Jetzt schob Sam Benton seine Schwägerin einfach beiseite. Er stampfte auf Flint zu. Flint hatte ihm Schmerzen zugefügt, und das machte ihn rasend. Er wollte nur noch zerschlagen, vernichten und zerstören.
Flint war ziemlich angeschlagen. Aber er war noch nicht außer Gefecht gesetzt. Das musste Sam Benton nun schmerzlich erfahren. Er war sich seiner Überlegenheit sehr sicher - viel zu sicher. Und das machte ihn leichtsinnig. Er baute sich vor dem knienden Gegner auf und giftete: „Jetzt kriegst du den Rest, Banditenvater. Wie ich schon sagte: du wirst zum Postkutschendepot kriechen.“
Flint schlug zu. Seine Faust bohrte sich in den Leib Bentons. Der Schläger knickte in der Mitte ein, in diesem Moment drückte sich Flint hoch und rammte ihm den Kopf unter das Kinn. Unter Flints Schädeldecke explodierte der Schmerz, aber er blieb auf den Beinen. Benton hingegen wurde zurückgestoßen. Seine Zähne schlugen aufeinander, er knickte in den Knien ein, sein Kopf wackelte vor Benommenheit. Flint plazierte zwei Schwinger im ungedeckten Gesicht Bentons, dann bückte er sich blitzschnell, schlang seine Arme um Bentons Beine und riss sie ihm vom Boden weg. Brüllend schlug Benton mit dem Rücken auf. Und als der Oberkörper des Schlägers wieder hochruckte, knallte ihm Flint die Faust auf das bereits von seinem Kopfstoß malträtierte Kinn. Er traf genau den Punkt. Sam Benton fiel schwer zurück, seufzte, und streckte sich. Sein Atem ging stoßweise. In seinem Gesicht vermischten sich Blut und Schweiß.
Ringsum war Gemurmel. Lydia Bentons erregte Stimme erklang: „Das war alles andere als in meinem Sinne, Howard. Mein Schwager hat sich auf eigene Faust an Sie herangemacht. Noch einmal: ich will nichts von Ihnen. Vor Sam jedoch sollten Sie sich in acht nehmen. Er - ach was, Howard. Setzen Sie sich in die nächste Kutsche und fahren Sie wieder nach Hause. Irgendwie tun Sie mir sogar leid. Es muss schlimm sein für einen Vater, wenn er erfährt, dass sein Sohn ins Banditentum abgeglitten ist.“
Flint nickte und nahm seine Tasche. Das Gurgeln und Stöhnen Sam Bentons erreichte sein Gehör, rührte ihn aber keineswegs. Auch er hatte Federn lassen müssen. Und hätte sich Benton weniger überheblich und leichtsinnig gezeigt, dann läge sicherlich er jetzt an seiner Stelle am Boden, und er würde wohl tatsächlich als geschlagener Mann Wichita Falls verlassen.
Es gab für Flint nichts mehr zu sagen. Die Frau hatte ihren Standpunkt klar gemacht. Auf tauben Beinen verließ er diesen Platz. Blutig, angeschlagen, geschwächt und voll verbitterter Enttäuschung schritt er zur Main Street. Seine Füße hinterließen Schleifspuren im Staub.
*
Flint Howard mietete sich ein Zimmer. Er ignorierte den Rat Lydia Bentons, die Stadt mit der nächsten Kutsche zu verlassen. Die weite Reise hatte ihn ziemlich mitgenommen, und nach dem Kampf mit Sam Benton fühlte er sich wie eine hohle Nuss.
Er lag auf dem Bett und hatte die Arme hinter dem Kopf verschränkt. Blicklos starrte er hinauf zur Decke. Er sinnierte. Seine Gedanken drehten sich um Douglas. Immer wieder stellte er sich die Frage, was seinen Sohn auf die schiefe Bahn getrieben haben konnte. Hatte ihm der blutige Krieg den Glauben an das Gute, an Recht und Ordnung und an Gott genommen?
Er schreckte hoch, als jemand an die Zimmertür klopfte. Sofort dachte er an Sam Benton, und er nahm seinen Colt zur Hand. Ein zweites Mal wollte er sich diesen Mister mit der Waffe vom Leibe halten.
Flint öffnete die Tür. Den Mann, der ihm gegenüberstand, hatte er nicht nie vorher gesehen. Er trug einen Stern an der Brust, sein Gesicht war wie versteinert, seine Augen blickten ausdruckslos. Flint ließ die Hand mit dem Colt sinken. Der Deputy sagte: „Sie haben wohl unliebsamen Besuch erwartet, Howard. Aber keine Sorge. Benton liegt zu Hause und leckt seine Wunden, und ich will Ihnen nicht ans Leder.“
„Was führt Sie zu mir?“, fragte Flint misstrauisch. Er rechnete nicht mit Freundlichkeit oder Entgegenkommen in dieser Stadt. Sogar der glatzköpfige Bursche unten hinter der Rezeption hatte ihm nur widerwillig ein Zimmer vermietet.
Der Deputy schürzte die Lippen. „Es gibt neue Nachricht von Ihrem Sohn, Howard. Hier ...“
Er hielt Flint eine zusammengerollte Zeitung hin. Flints Herzschlag beschleunigte sich. Sein Hals trocknete aus. Er griff nach der Gazette. Sie war eine Woche alt und stammte aus Lubbock.
„Ein Reisender hat sie in der Stagecouch liegen lassen“, erklärte der Deputy mit unbewegter Miene. „Sieht aus, als hätte ihr blutrünstiger Sprößling vor, den Krieg auf eigene Faust weiterzuführen.“
Flint las. Seine Zähne knirschten übereinander. In der Gazette wurde der Überfall auf die Bank von Tampico beschrieben. Es war wieder Blut geflossen. Die Äußerungen des Anführers der Bande waren wörtlich zitiert. Kraftlos sank Flints Hand nach unten. Die Zeitung entglitt ihm. Er taumelte zum Bett und setzte sich auf die Kante. Sekundenlang barg er das Gesicht in beiden Händen. Das alles mutete ihn an wie ein schrecklicher Alptraum - ein Alptraum, der zur grauenhaften Realität geworden war. Der Kampf, der sich in seinem Bewusstsein abspielte, war deutlich von seinen verkrampften Zügen abzulesen, als er jetzt den Gesetzeshüter anblickte. Als er sprechen wollte, versagten ihm die Stimmbänder zunächst den Dienst, schließlich aber würgte er hervor: „Ich werde morgen aufbrechen und mich nach Tampico begeben. Vielleicht gelingt es mir, die Spur der Bande aufzunehmen. Ich muss Gewissheit haben, ob es sich tatsächlich um Douglas handelt, der all diese scheußlichen Verbrechen ausgeheckt und durchgeführt hat. Ich - ich kann es einfach nicht glauben.“
Der Deputy lachte blechern auf. „Sie zweifeln daran?“, stieg es ungläubig aus seiner Kehle. „Gütiger Gott, Mann, Ihr Sohn wurde eindeutig identifiziert. Und bald schon wird es einen neuen Steckbrief von ihm geben, denn nach der blutigen Sache von Tampico wird er im Wert steigen. Ich schätze, dass man die Belohnung verdoppelt. Kopfgeldjäger und Staatenreiter werden sich bald auf seiner Fährte tummeln. Man wird ihn jagen wie einen tollwütigen Hund.“
Nach diesen mitleidlosen Worten bückte sich der Deputy nach der Zeitung. Nachdem er sich wieder aufgerichtet hatte, knurrte er düster: „Und sollten Sie am Ende irgendwo in der Schusslinie herumstehen, Howard, wird kaum jemand zögern, Sie zusammen mit ihrem Sohn aus den Stiefeln zu putzen. Denn dann wird man Vater und Sohn über einen Kamm scheren. Darum sollten Sie sich nicht auf die Suche nach Douglas Howard machen. Überlassen Sie das den Männern, deren Job es ist, Verbrecher zu fangen.“
Er machte kehrt und ließ Flint alleine mit all seinen nagenden Gedanken und Empfindungen, die sein Bewusstsein wie ätzende Säure durchdrangen und sich wie ein giftiger Stachel in sein Gemüt bohrten.
Am nächsten Tag verließ Flint die Stadt. Er hatte sich im Mietstall ein Pferd und die Ausrüstung für einen langen Ritt besorgt. Flint ritt nach Westen. Sein Ziel war Tampico.
*
Das Wetter hatte umgeschlagen. Es regnete. Mond und Sterne waren hinter einer dunklen Wolkendecke verschwunden. Ein bretterharter Wind trieb peitschende Regenschauer schräg über das Land.
Die beiden Schlutter-Wagen rumpelten durch die Nacht. Jedes der Fuhrwerke wurde von vier Kaltblütern gezogen. Die Straße war aufgeweicht, tief sanken die Hufe der Pferde und die eisenumreiften Räder im Schlamm ein. Vor den Fuhrwerken ritten zwei Soldaten. Vier folgten dem Transport. Die gelben Halstücher und die Gesichter unter den Mützen waren nur helle Flecken in der Dunkelheit. Der Transport kam von Amarillo und war auf dem Weg nach Fort Sill im Indianerterritorium. Sie waren dem Salt Fork Red River gefolgt, bis dieser nach Süden abknickte, um an der Grenze zwischen Texas und dem Indianerterritorium in den Red River zu münden.
Die Männer waren in mürrisches Schweigen versunken. Die Soldaten auf den Böcken der Fuhrwerke ließen die Peitschen knallen. Die Achsen quietschten in den Naben. Die Gefährte waren kaum gefedert und so wurden die Männer auf den harten Sitzen durch und durch geschüttelt.
Im Norden buckelten Höhenzüge. Zu sehen waren sie von der Straße aus in dieser stockfinsteren Nacht nicht. Der Zug bewegte sich nach Osten. Rechterhand zog sich Wald. Am Waldsaum wucherte dichtes Gestrüpp. Der Wind strich klagend durch die Kronen und löste monotones Rauschen aus.
Einer der Soldaten vor der Kutsche fluchte, dann grollte sein Organ: „Dieses verdammte Dreckwetter. Ich bin durchnässt bis auf die Haut. Noch dreißig Meilen bis Fort Sill. Wenn es die ganze Zeit über regnet, dann holen wir uns den Tod.“
„Solche Aufträge lassen mich die verdammte Armee hassen!“, versetzte sein Kamerad. „Du hast recht. Eine Lungenentzündung ist wohl das mindeste, was wir uns zuziehen. Die ganze Zeit über war es heiß und trocken. Und nun, da wir uns auf dem Trail befinden, gießt es wie aus Kübeln. Und der verdammte Wind gibt uns den Rest.“
„Wir sollten unsere Zelte aufschlagen und campieren“, knurrte wieder der erste Sprecher. „Dann befänden wir uns wenigstens im Trockenen. Es ist mir ein Rätsel, weshalb wir nur in der Nacht ziehen sollen. Fürchtet der Lieutenant etwa Indsmen? Hier? Das ist lächerlich.“
„Wohl eher die Howard-Bande“, rief der andere in den Lärm hinein, den sie verbreiteten. „Douglas Howard hat uns Yankees den Krieg erklärt. Er will sich nicht damit abfinden, dass die Konföderation zerschlagen wurde.“ Der Kavallerist lachte fast belustigt auf. „Auch einer von jenen Patrioten, die unsere Jungs eines Tages standrechtlich erschießen oder schmählich aufknüpfen werden.“
In diesem Augenblick raunte im dichten Gebüsch am Wegrand eine vor Anspannung heisere Stimme: „Seid ihr bereit, Männer?“
Ebenso raunende, heisere Stimmen bestätigten die tödliche Bereitschaft der Männer, die hier im Hinterhalt lagen und deren Fäuste sich um die Schussbereiten Gewehre klammerten.
Die Soldaten in den blauen Uniformen hörten nichts. Die Geräusche ringsum gingen unter im Klirren der Gebissketten, im Rumpeln, Knarren und Ächzen der Fuhrwerke und im heulenden Wind, der die Wagenplanen schlagen ließ.
Eine Salve aus fast einem Dutzend Gewehre peitschte. Der bleierne Tod griff mit unbarmherziger Klaue nach den Soldaten. Die Mündungslichter rissen wie Blitze die schaurige Szene aus der pechigen Finsternis. Auf einem der Wagenböcke richtete sich der Kutscher auf. Seine Hände verkrampften sich vor dem Leib, langsam neigte sich die Gestalt vornüber, schwer stürzte sie zwischen die Sielen. Das Gespann hielt an. Auch der Kutscher des folgenden Fuhrwerks wurde vom Bock gefegt, und auch dieser Wagen kam von selbst zum Stehen. Die Sättel der beiden Pferde vor dem Transport waren leer. Die beiden Soldaten lagen sterbend im Morast. Die Tiere wieherten und stiegen erschreckt, und im nächsten Moment stürmten sie voll Panik davon.
Aus dem Pulk der Soldaten hinter den Fuhrwerken stieg bestürztes Geschrei. Einer von ihnen wurde vom Pferderücken gerissen. Die anderen sprangen ab und rannten in Deckung. Ein Pferd brach zusammen. Schlamm spritzte.
„Ausschwärmen!“, befahl im Wald eine wilde Stimme. „Macht sie fertig! In diesem Krieg gibt es keine Gefangenen!“
Irre Besessenheit schwang in den Worten mit. In den Büschen raschelte es. Hartes, metallisches Knacken lag in der Luft, als die Banditen ihre Gewehre durchluden. Dürre Äste brachen unter Stiefelsohlen. Schritte trampelten.
Die Soldaten, die von der ersten Salve nicht getötet worden waren, lagen am Straßenrand. Nur mühsam bezwangen sie ihre Panik. Sie hatten die Colts gezogen. Die Gewehre aus den Scabbards zu ziehen hatten sie nicht die Zeit gefunden. Es waren noch drei Mann, und das Grauen durchzog ihr Bewusstsein wie ein Atem des Todes. Mit der Intensität von Männern, nach denen der Tod bereits die knöcherne Faust ausstreckte, spürten sie das Verhängnis, das sich um sie herum zusammenzog.
Sie nahmen huschende Schemen war. Die Nacht verkündete Unheil. Die Finsternis schien voll Leben zu sein. Sie stand wie eine Mauer zwischen ihnen, umschloss jeden und machte jedem die Einsamkeit bewusst in der er sich trotz des engen Zusammenseins mit den Gefährten befand.
Und dann spielten ihre Nerven nicht mehr mit. Einer von ihnen begann auf die Schatten zu feuern, die ihm seine überreizten Sinne vorgaukelten. Und die anderen beiden folgten seinem Beispiel. Die Nacht war voll vom Dröhnen der Detonationen, vom Pfeifen der Geschosse und vom grässlichen Jaulen der Querschläger.
Die Banditen hielten unerbittlich auf die zuckenden Mündungsblitze. Geisterhafte Reflexe huschten über den Boden und die Front der Büsche. Es gab keine Gnade und kein Erbarmen. Es gab nur den Tod, und der war unersättlich in seiner Gier. Die Soldaten bäumten sich auf, ihre Lippen sprangen auseinander, ihre Todesschreie aber erstickten im Ansatz. Sie fielen übereinander. Die Echos der Schüsse verebbten und versanken schließlich im Rauschen des Regens und dem Heulen des Windes.
Gestalten schälten sich aus der Dunkelheit. Die Bande hatte Verstärkung bekommen. Sie zählte jetzt ein Dutzend Männer. Und jeder von ihnen war ein kaltblütiger Killer. Sie umringten die Fuhrwerke. Einer rief hohnlachend: „Fette Beute, Colonel. Wir haben es den blaubäuchigen Bastarden besorgt. Wetten, dass in spätestens einer Woche jedes Fort in Texas und im Grenzland in Alarmbereitschaft versetzt sein wird."
Zwei - drei andere stimmten in sein Gelächter ein.
Der Anführer des Rudels befahl: „James, Brad, ihr übernehmt die Wagen. Ihr anderen holt unsere Gäule. Wir bringen die Fuhrwerke in unser Camp. Der Regen wird unsere Spuren auslöschen.“
Zwei der Kerle kletterten auf die Wagenböcke und angelten sich die Leinen. Die anderen liefen in den Wald. Zweige peitschten. Schon bald kamen sie zurück. Sie führten ihre Pferde. Auf dem Weg saßen sie auf. Auch der Anführer stieg in den Sattel. Sie nannten ihn Colonel. Die Horde setzte sich in Bewegung. Die Abdrücke der Räder und Hufe im weichen Untergrund füllten sich mit Wasser. Ja, das Unwetter würde ihre Fährte auslöschen. Die Mörder verschwanden mit ihrer Beute in der Nacht.
Auf dem Weg regte sich der Mann, der in der Vierergruppe geritten war und den das Banditenblei gleich zu Beginn des Überfalls aus dem Sattel warf. Das Projektil steckte in seiner linken Schulter. Sein Arm war wie gelähmt. Der Schmerz wehte wie ein heißer Wind durch seinen Verstand, und als er versuchte, sich auf die Knie zu erheben, schien er in seinem Körper zu explodieren. Er brach sich Bahn aus seinem Mund in einem abgrundtiefen, gequälten Stöhnen. Still lag der Mann jetzt im Schlamm, aus dem die Kälte kroch und seine Kleidung durchdrang. Sein Hals war trocken. Sein Mund zitterte in den Winkeln heftig. Krampfhaft atmete er. Und er fragte sich, ob er der einzige Überlebende war. In der Ferne versickerte der Lärm, den die davonziehenden Banditen veranstalteten.
Der Regen prasselte auf ihn hernieder. Hier konnte er nicht liegen bleiben. Die Rebellion in seinem Innersten legte sich nach und nach. Und noch einmal bemühte er sich, hochzukommen. Sein Zahnschmelz knirschte. Er fühlte den pochenden Schmerz, der durch sein Gehirn raste und kämpfte verzweifelt gegen die Ohnmacht, die ihn in bodenlose Tiefen zu reißen drohte. In der Wunde pochte der Schmerz und eskalierte, als er sich hochstemmte. Es nötigte ihm alle Überwindung und all seinen Willen ab. Er stand schweratmend und schwankend wie ein Schilfrohr im Sturm, und es kostete ihm ungeheure Anstrengung, auf den Beinen zu bleiben. Doch ganz allmählich ließ der Schmerz nach und er entspannte sich.
Er taumelte vorwärts. Einmal stolperte er und nur im letzten Moment gelang es ihm, das Gleichgewicht zu bewahren. Durch die Dunkelheit sah er die länglichen, dunklen und regungslosen Bündel am Wegrand liegen. Es waren seine Kameraden. Er fiel bei ihnen auf die Knie. Seine Rechte tastete über sie hinweg. In keinem von ihnen steckte noch ein Funke Leben.
Der Mann kämpfte sich wieder auf die Beine. Er schluchzte trocken. Heiß stieg es in seiner Brust in die Höhe. Er taumelte weiter, strauchelte, fing sich, fand einen weiteren Toten, einen zweiten, und dann stieß er auf die beiden Männer, die an der Spitze des Transports geritten waren. Sie waren tot. Die Psyche des Soldaten wollte nicht mehr länger mitspielen. Aber er zwang sich, nicht die Beherrschung zu verlieren und hemmungslos zu heulen. In seiner Nähe war Hufestampfen. Er torkelte durch die Nacht. Regen peitschte sein Gesicht. Aus der Dunkelheit lösten sich die Konturen zweier Pferde. Die Tiere drängten sich ängstlich zusammen und peitschten nervös mit den Schweifen.
Es kostete dem Soldaten Mühe, in den Sattel zu klettern. Das Tier, das er sich ausgesucht hatte, scheute zurück, prustete erregt und warf den Kopf in den Nacken. Aber mit übermenschlichem Durchhaltewillen schaffte es der Soldat. Er ritt an. Die Lähmung in seinem linken Arm hatte sich gelöst. Er presste die Hand auf die Wunde. Mit der Rechten führte er die Zügel. Sein Oberkörper pendelte mit jedem Schritt des Pferdes vor und zurück. Und die Wunde meldete sich unablässig mit stechenden, anhaltenden Schmerzen.
*
Das Camp der Bande lag mitten in den Wichita Mountains, etwa fünfzig Meilen tief im Indianerterritorium. Es handelte sich um ein unzugängliches, unwirtliches Gebiet, um öde, von der Sonne verbrannte Felswildnis, in der lediglich Klapperschlangen und Eidechsen ihr Unwesen trieben.
Sie brauchten mit den tonnenschweren Fuhrwerken vier Tage, um ihren Schlupfwinkel zu erreichen. Es war ein Felskessel, der von einem schmalen Bach in zwei Hälften zerschnitten wurde und der über zwei Zugänge verfügte. Es gab zu beiden Seiten des Baches genug Gras für die Pferde. Einige Hütten - grob zusammengezimmert - und einige zerschlissene Armeezelte standen ein Stück vom Bachlauf entfernt. In einem kleinen Corral, der zum Wasser hin offen war, tummelten sich ein halbes Dutzend Pferde. Einige Frauen zeigten sich. Auch sie waren Gescheiterte, Gestrauchelte, die in irgendwelchen Saloons oder Bordells arbeiteten und sich irgendwann den Banditen angeschlossen hatten. Der Hauch des Verruchten und der Sündhaftigkeit haftete ihnen an. Ihre Herzen waren tot, ihre Seelen abgestumpft. Sie ließen sich im Strom der Gesetz- und Rechtlosigkeit treiben und lebten wie die wilden Tiere nur in der Gegenwart. Ihre Vergangenheit war tabu, eine Zukunft gab es für sie nicht - zumindest keine, über die es sich nachzudenken gelohnt hätte.