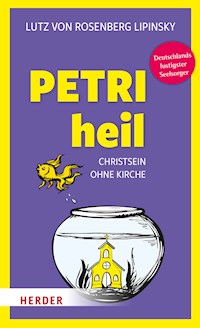
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Mitgliederschwund der Kirchen ist massiv. Christen fragen sich: Wie sollen wir ohne sie überleben? Ist das das Ende? Folgt dann das jüngste Gericht? Lutz von Rosenberg Lipinsky gibt den Ketzer und fragt: Kann das Ende der Institution nicht der Beginn einer neuen Bewegung sein!? Statt den Untergang des Abendmahls zu beweinen, erinnert der Kabarettist daran, wie viele Sorgen und Nöte die Kirchen ihrerseits bereitet haben. Wie oft man sich rechtfertigen musste, anstatt einzuladen zu können. Stellen wir uns vor: Wie man die richtigen Fragen stellt und sich nicht immer nur selbst infrage stellen lassen muss. Wie man sammelt, ohne Steuern abzubuchen. Wie man Menschen fischt – nicht nur im Netz. Das Kirchenschiff sinkt – wir machen den Freischwimmer! Ein Buch, das mit viel Humor neue Perspektiven aufzeigt und Stimmung in die Bude bringt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lutz von Rosenberg Lipinsky
Petri heil
Christsein ohne Kirche
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2021
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: ArtMari / shutterstock / Freepik.com
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster, Belgern
ISBN E-Book 978-3-451-82229-2
ISBN Print 978-3-451-39034-0
Inhalt
Fast Vorwort
1 Ende Gelände Corona, ein Vorgeschmack
2 Wer zuletzt lacht
3 Halleluja, Hauruck und Haudrauf
4 Gottes Kühlhaus
5 Konfessionen und Konfetti
6 Klerikalauer
7 Der Untergang des Abendmahls
8 Gähnende Lehre
9 »Oh Ohr voll Blut und Wunden«
10 Die guten Werke
11 Mission Impossible
12 Ausblick ohne Turm
Das nicht-existierende Kapitel 13
Über den Autor
Fast Vorwort
Das ist kein Vorwort. Auch keine echte Einführung. Vielleicht eine Geh- und Sehhilfe? Der Rollator im unwegsamen Gelände der christlichen Kirchen und was der Autor davon zu berichten weiß? Dieser Text ist eher eine Mischung aus Beipackzettel und Betriebsanleitung. Denn: Als Katholik muss ich die nicht zum Gebet, wohl aber zum besseren Erkennen der Schrift geneigten Leser*innen warnen. Herr von Rosenberg klingt seriös, ist es aber nicht. Er hat nichts, aber auch gar nichts, mit dem fränkisch-schwäbisch-katholischen Adelsgeschlecht derer von Rosenfels zu tun. Dafür ist der gebürtige Gütersloher und heutige Hanseat zu evangelisch. Er ist ein Nachfahre des Oskar von Rosenberg-Lipinsky. Der wurde, fast als Aprilscherz, am 2. April 1823 geboren. Über ihn sagt Wikipedia: Er war »ein deutscher Verwaltungsbeamter«. Das passt. Lutz von Rosenberg Lipinsky, der hanseatisch-protestantische Verwaltungsbeamte des deutschen Kabaretts mit ostwestfälischen Wurzeln. Aber dafür fehlt ihm der Bindestrich. Nein, nicht der zwischen Ost- und Westfalen. Der zwischen den Nachnamen. Verbindend ist er allerdings dann doch. Zwischen den Kirchen: Lutz von Rosenberg Lipinsky ist ständiges Mitglied im Ausschuss für Kunst und Kultur des Deutschen Evangelischen Kirchentages und gern gesehener Gast- beziehungsweise Leiharbeiter auch im Programm des Katholikentages. Und sogar zwischen den Religionen setzte er Bindestriche: Seit 2014 ist der studierte Theologe auch mit seinem muslimischen Kabarett-Kollegen Kerim Pamuk auf Tour und zeigt den interreligiösen Showkampf »Brüder im Geiste«.
Wes Geistes Kind er ist, zeigt der bekennende Fan von Arminia Bielefeld mal im Quatsch Comedy Club Berlin und dann wieder bei einer Veranstaltung der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung im Dorfgemeinschaftshaus Limburg-Lindenholzhausen. Die Übergänge sind fließend.
Woher ich das weiß? Ich kenne ihn. Und die Protestanten. Viele. Gefühlt alle. Kennt man alle, kennt man auch ihn. Und wie. Einmal jährlich treffen wir uns bei Kirchen- und Katholikentagen. Dort kommentieren wir abends unter dem Titel »Late Night« das jeweilige Tagesprogramm. Als letzte Veranstaltung. Bis 22.45 Uhr, kurz bevor alle Teilnehmenden den letzten Bus nehmen müssen, um pünktlich von Dortmund nach Herne zu kommen, um dort in der Turnhalle auf Isomatten zu übernachten. Nach uns gehen die Lichter aus. Die Christenheit muss zeitig ins Bett, weil sie schon morgens sehr früh die Welt rettet und die Kirche in der Welt von heute. Nur merkt man das kaum noch: Völlig unlustiger Missbrauch, unzeitgemäße Insidersprache, unerklärte Rituale und ein unattraktives Image wie die fleischgewordene deutsche Vereinsgemütlichkeit verdunkeln die eigentlich gute Nachricht, von altgriechisch εὐαγγέλιον – euangélion. Eine frohe Botschaft, die zum Evangelium wurde. Und da steckt er ja nun wieder drin, der Protestant, der Reformierte, der Evangelische an sich.
Genau deshalb will Lutz von Rosenberg Lipinsky bei Ihnen und Euch mit diesem Buch die Lampen angehen lassen. »Mehr Licht!« – wie weiland Goethe in seiner letzten Stunde, will Rosenberg Lipinsky mehr Glanz in die vielleicht letzten Stunden der uns bekannten Kirchen bringen. Er leuchtet aus, setzt gezielt einen Spot(t) oder hält einfach nur eine Funzel ins trübe Dickicht kirchlicher Realpräsenz. Lutz scheidet die Geister: Was sind Nebelkerzen, geworfen von Gottes protestantischem Bodenpersonal? Und wo ist es einfach nur katholischer Weihrauch?
Lesen Sie. Verstehen Sie. Wenn möglich. Aktive Christen in all ihrer Diversität werden sich sicherlich oft wiedererkennen. Als interessierter Laie (hier ausdrücklich nicht im katholischen Sinne als Nicht-Geweihter gemeint) werden Sie eher verunsichert staunen, sich fragend die Augen reiben und vielleicht doch zu dem guten Schluss kommen – ach, Christinnen und Christen sind auch nur Menschen. Aber eben mit der Option zum Heiligen. Das wird nicht immer sichtbar, ist aber da. Ein Zustand, den man auch kennt von den spielerischen Fähigkeiten des HSV.
Wie dessen Fans so ergeht es auch dem Autor dieses Buches und »Kicker«-Kolumnisten mit seiner Kirche: Er liebt sie. Gerade, weil sie mehr ist als ein Verein. Er sieht sie zu Höherem berufen, weil sie auch von daher kommt. Wenn, ja wenn da nicht die zweite Halbzeit im letzten Heimspiel, das Eigentor im Freundschaftsspiel gegen die C-Jugend oder der Streit zwischen Spielerrat und Trainer wäre.
Und der Titel? »Petri Heil«. Das wünscht der Angler, wenn er seinem Kameraden am Bachufer begegnet. »Petri Heil« setzt sich aus dem lateinischen Genitiv von Petrus und dem Wunsch nach »Heil« zusammen. Heil wie erfolgreich, wie »heil« für ganz, »heile« wie »heilen« und irgendwie auch »heilig«. Und das ist vielleicht auch der Gruß, wenn es keine Kirche mehr geben sollte und wir Christ*innen wieder freiberuflich aktiv werden müssen.
Petrus ist einer der biblischen Jünger Jesu und der, dem der symbolisch den Himmelsschlüssel überreicht. Ihn sehen die Katholiken (auch viele der Katholikinnen etc.) als so etwas wie den ersten Papst und Begründer einer Ämterreihe bis in die Gegenwart – die Protestanten wiederum interpretieren genau das irgendwie anders. Dieser biblische Petrus war wie die meisten der Kumpels von Jesus Berufsangler. Im Lukas-da-ist-es-wieder-Evangelium (Lk 5, 1–12) wird vom wunderbaren Fischfang am See Genezareth erzählt. Die Fischer, darunter auch Simon Petrus, hatten keinen Fang gemacht und kehrten in den Hafen zurück. Dort stieg Jesus ins Boot der enttäuschten Männer. (Frauen werden nicht erwähnt, womöglich, weil sie auch ohne Jesus erfolgreicher agiert hätten.) Denn: Sie hatten nichts gefangen. Jesus aber war nicht in der Stimmung, aus irgendwas Brot und Fisch zu zaubern. Vielmehr sollten sie noch einmal ihre Netze auswerfen. Die erfahrenen Fischer fanden das gar nicht lustig. Von dem Sohn eines Zimmermanns wollten sie sich nichts sagen lassen. Doch sie vertrauten ihm. Fuhren erneut hinaus und warfen wieder die Netze aus. Und fingen so viel, dass diese sogar zerbarsten.
Wenn man einem Angler also Petri Heil wünscht, hofft man, dass er so viele Fische fangen kann, wie Simon Petrus dereinst im Vertrauen und unter der Anleitung von Jesus. Die Tradition der Kirche folgt der Aussage Jesu, dass er seine Freunde zu Menschenfischern machen wollte – damit sie das Himmelreich finden.
Auch vor dem Angelsport machen allerdings die Anglizismen nicht halt: Statt »Petri Heil« wünschen sich Angler heute auch Tight Lines. Zu Deutsch »gespannte Leinen«. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und dass Sie die Linien bei Lutz von Rosenberg Lipinsky im Dickicht der faszinierenden Welt des Christentums immer wieder finden: Christsein mit sinkender Kirchenbindung, bei schwindenden Traditionen und leeren Kirchen. Das gibt es. Das geht. Lesen Sie selbst. Und der Rest ist Glaube.
Ach ja, und eines ist mir beim Lesen des Buches auch aufgefallen. Herr von Rosenberg Lipinsky geht sehr frei mit den Geschlechtern um. Also schriftlich. Man kann sich bei ihm – wie übrigens bei allen Theologen*innen und Kabarettisten:innen – nie sicher sein, ob er jetzt mit Küster tatsächlich nur einen Mann meint oder auch die Option einer Frau oder der Diversität. Manchmal waren es in der Kirche halt einfach auch nur Männer – oder sind es. Also: Bitteschön ab in die Verantwortung. Vielfalt ist auf jeden Fall nicht das Ding des Autoren, vielleicht fehlt ihm dafür einfach der katholische Überblick einer Weltkirche. Lesen Sie also einfach alles geschwisterlich mit und seien Sie auch sonst eines: gnädig. Herr von Rosenberg Lipinsky kann als Protestant nicht beichten gehen. Er ist auf Gnade angewiesen. Also schenken wir sie ihm. Er hat nichts Anderes verdient.
Marcus Leitschuh
1 Ende Gelände Corona, ein Vorgeschmack
»Am Anfang war das Wort«. So lautet der Beginn des Johannes-Evangeliums nach der Lutherbibel. Grammatikalisch richtig wäre allerdings auch die Übersetzung: »Das Papier lag auf der Behörde«. Handelte es sich bei der Heiligen Schrift um ein originär deutsches Buch, wäre dies sicherlich auch die angemessenere Fassung. Wir wollen aber um der Einfachheit und der Sinnhaftigkeit halber hier der Luther-Version folgen, vor allem, weil sie als deutlich poetischer gelten darf.
Auch dieses Buch, das Sie nunmehr in analoger oder digitaler Form in der Hand halten, beginnt nämlich erstens am Anfang und zweitens mit einem Wort, genau genommen mit dem »Am«. Das macht das »Am« zum Vorwort – was aber nichts Besonderes ist, denn bis auf das berühmte »letzte Wort« am Schluss des letzten Satzes im gesamten Werk ist ohnehin jeder Begriff genau genommen ein Vorwort. Erst danach kommt nichts mehr. Das erst wird das Ende sein – aber nur das der Ausdrücke. Das letzte Wort wird übrigens »Ewigkeit« sein. Ein positiver Gedanke. Als Nach-Wort. Nicht das erste und einzige, aber das letzte seiner Art.
Perspektiven der Pandemie
Dieses erste Kapitel ist trotz seines eröffnenden Charakters allerdings eigen- und vollständig – und doch zugleich ein Vorgeschmack. Wie wir ihn ab März 2020 erleben durften – oder mussten. Geschlossene Kirchen, leere und ungenutzte Gemeindehäuser, Predigten per Stream (von »live« konnte selten die Rede sein) – die Lage mutete vielen dystopisch an. Es entstand der Eindruck, wir könnten in die Zukunft gesehen haben: in der Kirchen keine Rolle mehr spielen. Wenn es sie überhaupt noch geben wird.
Die Jahre 2020 und 2021 wurden bekanntlich entscheidend geprägt von einer sogenannten »Pandemie«, einer weltweit grassierenden Schlacht um Gesundheit und Klickzahlen. Ein Massaker, allumfassend, pan, betreffend die gesamte Bevölkerung, das demos. Eine unvorstellbare Naturkatastrophe biblischen Ausmaßes, ähnlich einem Abstieg von Schalke 04 aus der Bundesliga, Vergleiche mit den sieben Plagen und anderen apokalyptischen oder dystopischen Visionen erscheinen keineswegs unangemessen. Zigtausende Tote weltweit, soziale Isolation durch Kontaktverbote, Wirtschaftskrisen, ganze Länder standen still, Verschwörungstheoretiker, Naturmystiker und Endzeitprediger dagegen traten auf. Und fanden im Internet als zeitweise einzig legitimem Kontaktmittel unerwartete Verbreitung.
Zunächst wurde die öffentliche Diskussion bestimmt von Wissenschaftlern und Forschern, und das politische Handeln basierte auf deren Einschätzungen und Prognosen. Dann kippte die Stimmung. Je weniger man durfte, umso mehr traute man sich. Mehr und mehr kamen die Zweifler und Besserwisser aus den Löchern und stellten den vernünftigen Argumenten und der wissenschaftlichen Wahrscheinlichkeit ihre schlichte Meinung und ihre – oft interessengeleitete – eigene »Wahrheit« entgegen. Getarnt als »alternative Strategie«.
Teilweise wurden Bewegungen sichtbar, virtuell und real, die die Existenz der Krankheit schlicht leugneten. Tausende von Menschen hielten internationale Verschwörungen für plausibler, in denen chinesische Telefonfirmen, amerikanische Milliardäre und die globale Pharmaindustrie organisiert zusammenarbeiten. Aufgedeckt wurden solche Zusammenhänge von veganen Köchen oder verwirrten Popstars, die allemal als zuverlässige Quelle gelten durften, auf einem Niveau mit medizinischen Fachleuten und erfahrenen Journalisten. Die Aufklärung war: futsch.
Sichtbar wurden vielmehr schlicht mittelalterliche Verhaltensmuster, vom einfachen Aberglauben bis hin zu offener Denunziation und gewalttätigen Übergriffen gegen sogenannte »Andersgläubige«.
Dabei verlief die Grenze nicht zwischen unterschiedlichen Formen des Glaubens, sondern – wie eigentlich gewohnt – zwischen Glauben und Denken. Zu Letzterem gehört bekanntermaßen die Anerkennung von Fakten, wie auch deren ständige Überprüfung und Infragestellung bei sich ändernder Lage. Aber die Komplexität der Virologie, die Fehlbarkeit und Flexibilität von Wissenschaft an sich, die Unerfahrenheit mit diesem Virus im Speziellen, zudem dessen ständige Mutation, die stete Änderung der Faktenlage und die Vielzahl der Interpretationsmöglichkeiten überforderte viele und ließ sie ratlos zurück. Zudem wirkt die Politik oftmals panisch oder zumindest hektisch. Es entstand ein Vakuum. Der Raum für klassische Religiosität jeder Art.
Letztlich aber folgten die meisten Menschen hierzulande deshalb dann doch sicherheitshalber lieber der Regierung, die dazu aufforderte: »Glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen.«
Aber allen gemeinsam war klar: Es muss geglaubt werden. So mag das sein. Glaube ersetzt ja oft den Zweifel und die Unwissenheit. Und gibt auch Hoffnung. Eigentlich sollte der Glaube auch befreien – so wie das Lachen. Dieses sollte uns nie und nimmer vergehen, wird die entscheidende Schlacht doch immer noch geschlagen im Angesicht von Krankheit und Tod. Erst wer wirklich bedroht ist und um sein Leben fürchten muss, kann zeigen, wie frei er ist. Und zwar nicht dadurch, dass er keine Maske trägt. Sondern dadurch, dass er der Letzte ist, der lacht.
Die Kirche glänzt – durch Abwesenheit
In dieser Situation stellte sich eine wesentliche Frage: Wo ist die Kirche? Religiöse Fragen, Existenznöte, Sorgen um geistiges und körperliches Wohlbefinden, Vereinsamung, Verwahrlosung – alle brauchten Hilfe. Unterstützung. Trost – alles Bestandteile unseres Glaubens. Aber wo war die Kirche? Natürlich ihrerseits zunächst auch hart getroffen vom Kontakt- und Veranstaltungsverbot. Die Geistlichen zogen sich zurück ins Gotteshaus und es wurde dort noch einsamer, als man es ohnehin schon gewohnt ist. Und das aus Sicherheitsgründen.
Die kirchlichen Funktionsträger waren schlicht rücksichtsvoll und wollten niemanden in Gefahr bringen. Als ob man das nicht ohnehin gewesen wäre. Und woanders vielleicht sogar mehr. Besonders gefährdete Menschen aber waren die Alten. Gewissermaßen entsprach die angestammte Zielgruppe der Kirche der des Virus – genannt: Risikogruppe. Also wurde Vorsicht das neue Leitmotiv.
Angesichts gesundheitlicher Risiken mieden die meisten Menschen einander. Die gesamte Welt schien erkrankt und entmutigt. Dass Schulen zeitweise geschlossen wurden, haben viele verschmerzt, insbesondere die Betroffenen: Die Jugend blieb einfach im Bett und die Lehrkräfte nutzten die Zeit, um sich auf ihrem Atari 1450XLD eine von diesen neuartigen E-Mail-Adressen einzurichten.
Geselligkeit war jetzt verpönt, Feiern und Veranstaltungen jeder Art wurden als gefährlich eingestuft. Insbesondere, wenn Alkohol im Spiel ist, also auch Gottesdienste mit Abendmahl. Wie der Gesundheitsminister dann erklärte, macht Alkohol nämlich unaufmerksam. Seien wir ehrlich: Dessen waren wir uns immer bewusst. Genau genommen ist diese sedierende Wirkung einer der Gründe, warum man überhaupt trinkt.
Aber klar: Der Covid-19-Virus war und ist geradezu diabolisch. Die Menschen insbesondere dort anzugreifen, wo sie sich treffen, sprechen, vortragen, singen? Das klingt, als hätte man eine Krankheit erfunden, die sich speziell gegen jede Form von Kultur richtet. Quasi eine RTL-ZWEI-Infektion.
Theater und Kirchen wurden geschlossen. Ob in dieser Situation der Einschluss die Lösung sein kann? Um nicht auch noch andere zu gefährden? Verständlich, ja. Aber richtig? War es überhaupt ein Ein- oder nicht doch eher ein Ausschluss? Nämlich derjenigen, die Beistand womöglich am nötigsten gehabt hätten, sich aber jetzt vor verschlossenen Türen befanden? Seelsorge ja, aber mit Abstand?! Mit dem brandneuen Medium »Telefon«? Oder dieser brandheißen Sache aus dem Internet: »Spazierengehen«?
Ketzerisch gefragt: Was ist denn die christliche Antwort auf die Gefährdung menschlichen Lebens? »Schließt Euch ein und bleibt unter Euch!«?
Der vormalige evangelische Pfarrer Jürgen Fliege beendete jahrelang seine gleichnamige Fernweh-Talkshow mit ähnlichen Worten: »Passen Sie auf sich auf!« Das klang wie eine Drohung, wie: »Wir sind für Sie nicht mehr zuständig.« Der Mensch wird sich selbst überlassen und damit preisgegeben.
Angesichts einer weltweiten unsichtbaren Bedrohung wäre es vielleicht auch möglich gewesen, anders zu reagieren. Eine geistliche und vielleicht auch geistige Antwort zu finden auf die Angst der Menschen. Natürlich ohne ihre Gesundheit zu gefährden. Stattdessen aber kirchlicherseits: Stille.
Verschlossene Kirchen und geschlossene Gemeindehäuser. Verschobene Konfirmationen und gemeindelose Taufen im eigenen Garten, abgesagte Hochzeiten – und Beerdigungen ohne Trauergemeinde. Der Tod war in dieser Zeit ein einsamer Geselle.
Wandern im tiefen Digi-Tal
Es gab natürlich Ausnahmen. Totale Stille entspricht bekanntlich nicht wirklich dem christlichen Sendungsbewusstsein, der Empfänger muss versorgt werden. Mancherorts folgte daher eine hektische Digitalisierung. Größer als die Verzweiflung der christlichen Gemeinden war nur die etlicher Kulturschaffender, mussten diese doch auch noch mit ihrem digitalen Auftreten Umsätze generieren – ein im Internet quasi aussichtsloses Vorhaben. Das hielt aber viele Künstlerinnen und Künstler dennoch nicht davon ab, ihre Musik oder ihre Sprache oder ihr Gesicht kostenlos im WWW zu positionieren. Angeblich, um die Beschränktheit häuslichen Aufenthalts durch ihr Schaffen zu bereichern. Und die Menschen zu trösten, die doch angeblich so sehr litten unter geschlossenen Theatern und Museen und Clubs. Das Erstaunen war groß, als die ersten Lockerungen in Kraft traten und die Menschen trotzdem nicht wieder ins Kino gingen.
Kirchlicherseits war Monetarisierung sicher nicht das Ziel digitaler Auftritte. Diesbezüglich ist man ja durch Steuereinnahmen noch ausreichend abgesichert. Noch. Nein: Der Antrieb war eine Mischung aus Geltungsbewusstsein und dem guten Vorsatz, Kontakt zu den Gemeindemitgliedern zu halten. Oder gar neue zu gewinnen. Aber auch hier: Fehleinschätzung.
Mit einer Videokamera die leere Kirche zu filmen, kein gemeinsames Singen erleben zu können und somit gewissermaßen nur die Predigt anzuhören, war wohl doch nicht so reizvoll. Selbst die Stammbesucher der örtlichen Gottesdienste verzichteten oftmals auf den frustrierenden Anblick ihrer leeren Kirchenbänke und ihres einsamen Pfarrers und zogen es vor, Gott im Wald zu suchen. Und zwar im nicht übertragenen Sinne.
Die unsichtbare Kirche – Gespenstische Heilige
Das Positive an dieser nahezu protestlosen Verschlusshaltung war lediglich, dass die Kirche uns damit unfreiwillig einen Blick in die Zukunft ermöglicht hat. So konnten wir erleben, wie es hierzulande womöglich bald aussehen könnte: verschlossene Türen. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kirchen und Gemeindehäuser stehen leer. Als gäbe es keine Institution, keine Organisation – und erst recht keine Bewegung. Kirche war quasi unsichtbar, als die Not am größten war. Das war ein Vorgeschmack: nicht nur denk-, sondern auch sichtbar, dass Kirche bald gar nicht mehr vorhanden sein wird. In den ehemaligen Gotteshäusern könnten Restaurants oder Clubs eröffnen. Oder Moscheen. Das Haus bleibt heilig, aber die Religion wechselt. In der Gastronomie ein normaler Vorgang: Pächter kommen und gehen, das Paulaner aber bleibt.
Ein Jahr vor Beginn der Pandemie hatte passenderweise das Forschungszentrum Generationenverträge (FZG) der Universität Freiburg seine Prognose veröffentlicht. Derzeit bezeichnet sich nur knapp ein Viertel der Bevölkerung als agnostisch oder atheistisch. 54 Prozent sind hierzulande evangelische und katholische Kirchenmitglieder, die übrigen gehören einer Freikirche an, sind muslimisch, orthodox, jüdisch oder Angehörige einer anderen Religion. Doch der FZG-Prognose zufolge wird sich das ändern: Demzufolge wird der Anteil der Kirchenmitglieder an der Bevölkerung bis 2060 von derzeit 54 Prozent auf 29 Prozent sinken. Immerhin werden Christen damit immer noch die größte religiöse Gruppe stellen – es sei denn, Schalke 04 gelänge es, in dieser Zeit doch mal die Meisterschaft zu holen. Aber das muss doch als extrem unwahrscheinlich gelten.
Sicher ist: Die Kirche geht den Weg der SPD von der Volkspartei zur Splittergruppe. Selbst wenn die katholische Kirche auch eine Doppelspitze einführen sollte, würde sich daran wohl nichts mehr ändern. Der Weg von der Volkskirche zum Hauskreis scheint vorprogrammiert.
Dies ist das Szenario, auf das wir uns, nunmehr erfahrungsbasiert, einstellen können. »Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind …« – das wird bald wieder Wirklichkeit sein. Und wir können uns endlich darauf vorbereiten. Beim Gedanken daran packt viele Christinnen und Christen das blanke Entsetzen. Sie sehen das Ende der Kirche als Weltuntergang und befürchten im Anschluss unmittelbar das Jüngste Gericht. Oder sehnen es womöglich herbei.
Jedem Ende wohnt ein Anfang inne
Ja, jahrhundertealte Traditionen werden vergehen, Gewohnheiten, Rituale, vielleicht gar Überzeugungen. Aber womöglich entsteht daraus auch etwas Neues – Bewegung statt Institution.
Unsere Angst vor einem möglichen Ende der uns vertrauten Kirchen sollten wir überwinden, denn sie wird nicht helfen. Nehmen wir den Verlust als Chance, packen wir die Gelegenheit beim Schopfe. Lasst uns rausgehen, an die Hecken, an die Zäune, von Mensch zu Mensch, Auge in Auge, nicht mehr von oben herab, überwinden wir unsere institutionelle Kontaktsperre und lernen wir endlich, Antworten zu geben auf Fragen, die wirklich gestellt werden. Dieses Buch will dabei helfen.
Wir lieben unsere Kirche, ja. Aber sie war und ist auch oft ein Ballast, in all ihrer Macht, ihrer Gewalt, in ihrem Habitus. Wie oft mussten wir uns für sie rechtfertigen und erleben, wie die christliche Botschaft verschwand im Sog der religiösen Bannmeile, als die viele die Kirchen empfinden. Vielleicht sollten wir zur Kenntnis nehmen, dass wir auch ohne sie glauben können.
Wenn es keine Kirche mehr gibt, wird uns einiges fehlen. Aber an vielen Stellen wird es auch Erleichterung geben. Atmen wir einmal tief ein und spielen es gemeinsam durch.
Ausguck
Was wünscht man sich? Zu Geburtstagen oder Jubiläen? Gesundheit, Glück … und dann hört es meist schon auf.
Gesundheit gilt als besonderes Gut – gerade in fortschreitendem Alter. In dem man »ja alles schon hat«. Sie gilt, ähnlich wie Glück, als Geschenk. Etwas, das man sich nicht verdienen kann. Das aber auch nicht sicher ist. Und niemandem einfach zusteht.
Wir erlebten aber unlängst, wie eine gesamte Gesellschaft unter das Diktat ebendieser Gesundheit gestellt wurde. So, als wäre sie denn doch ein Verwaltungsakt oder der staatlichen Sicherheit unterworfen. Der Schutz bedrohten Lebens darf durchaus als gesellschaftlicher Konsens gelten – berührt wurden aber auch Fragen der Würde desselben. Darf man die Gesundheit von Menschen schützen, indem man sie voneinander trennt?
Viele Familien waren fassungslos, als sie die Großeltern nicht mehr besuchen durften. Oder sogar Angehörige verloren, ohne sie auf ihrem letzten Weg begleiten zu dürfen. Allein aber waren die Sterbenden nicht. Denn die Betreuung in Krankenhäusern und Altenheimen war vielerorts nicht nur professionell, sondern auch unglaublich intensiv und von großer Fürsorge; das persönliche Engagement der in der Pflege Beschäftigten teilweise übermenschlich.
Das dürfen wir für die Zukunft mitnehmen: Dass christliche Werke Gutes tun. Auch in unserem Namen. Und dass sie die Menschen eben nicht alleinlassen – auch dann, wenn wir selber nicht bei ihnen sein dürfen.
Und dies müssen wir mitnehmen: dass Gesundheit nicht alles ist, sondern dass jeder Mensch mehr braucht. Beispielsweise Nähe und Zuspruch. Das Leben ist ein Risiko und es hat in jedem Fall ein Ende. Lasst uns daher zukünftig grundsätzlich einfach mehr füreinander da sein. Und früher.
2 Wer zuletzt lacht Glauben und Humor
Ein Priester, ein Rabbi und der Papst kommen in eine Bar. Fragt der Barkeeper: »Soll das ein Witz sein?!«
So ist das wohl: Fromme Menschen gelten an sich als unlustig, werden aber ihrerseits oft zum Ziel von Gespött. Was womöglich daran liegt, dass sie als besonders ernst gelten. Ganz vielleicht auch als komisch – aber eher im Sinne von seltsam.
Dabei glauben sehr viele Menschen – aus vielen unterschiedlichen Gründen. Das beginnt durchaus bei Banalitäten: Wir Deutschen glauben zum Beispiel, es ergebe Sinn, eine Straße nur zu überqueren, wenn die Fußgängerampel uns auch »grün« zeigt. Dann aber wäre es sicher. Die Grenzen dieser Religiosität erfährt man oft allerdings schon wenige hundert Kilometer weiter südlich – in Italien kann aus diesem Glauben nämlich sehr schnell eine Nahtoderfahrung werden. Und zwar, wenn man dort von einem katholischen Priester überfahren wird, der, wie viele seiner Landsleute, Ampeln für eine überflüssige Form der Straßenbeleuchtung hält. Während der unsere Knochen unter den Rädern seines Fiat zermalmt, erklingt womöglich noch aus den dröhnenden Autoboxen seines Fahrzeugs: »Näher, mein Gott, zu Dir!« – und schon ist man im Paradies. Wofür viele teutonische Akademiker insbesondere die Toskana ohnehin halten.





























