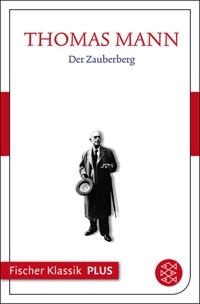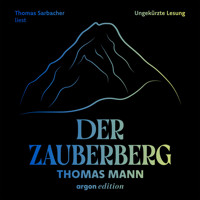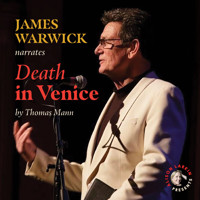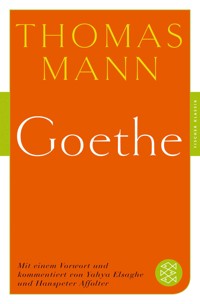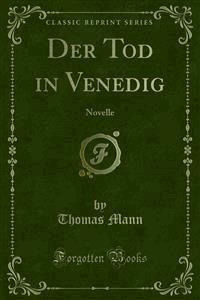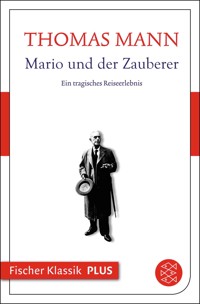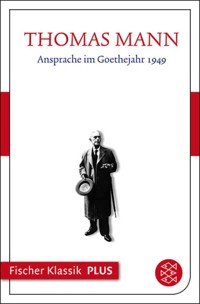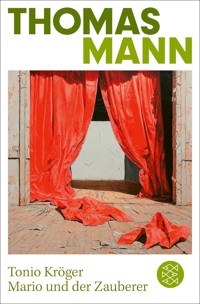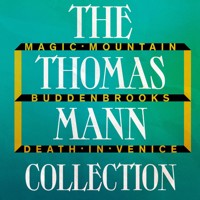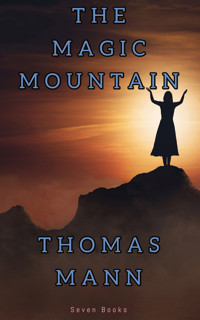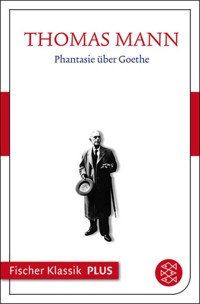
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Mit der Niederschrift der Einleitung zu beginnen, fiel Thomas Mann nicht leicht. Er hatte sich während der zweiten Septemberhälfte 1947 inhaltlich vorbereitet und sich dabei unter anderem auf eigene Notizen aus den frühen 1930er Jahren und aus der Konzeptionsphase seines Romans ›Lotte in Weimar‹ (1939) gestützt. Erst im Tagebuch vom 6. Oktober findet sich der Hinweis: »Schrieb einige Anfangszeilen zum ›Goethe‹ [. . .].« Am 23. November schloss Mann die Arbeit am Text ab. Die Idee eines von Mann herausgegebenen Sammelbandes mit Werken Goethes hatte der Übersetzer Alfred O. Mendel bereits im März 1946 aufgebracht und war damit bei Mann auf lebhaftes Interesse gestoßen. Der Band erschien 1948 unter dem Titel ›A Permanent Goethe‹ bei der Dial Press, einem Verlag, mit dem Mann bereits verschiedentlich zu tun gehabt hatte. Auf Deutsch wurde die Einleitung ebenfalls 1948 im Rahmen des Sammelbandes Neue Studien veröffentlicht (Bermann-Fischer Verlag, Stockholm). Sie erfuhr eine differenzierte und vielfältige Rezeption – Lob ebenso wie Kritik, die sich insbesondere auf das persönliche Goethe-Bild bezog, das Mann hier vermittelt, indem er sich auf den Menschen hinter dem Kult konzentriert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 70
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Thomas Mann
Phantasie über Goethe
Als Einleitung zu einer amerikanischen Auswahl aus seinen Werken
Essay/s
Fischer e-books
In der Textfassung derGroßen kommentierten Frankfurter Ausgabe(GKFA)Mit Daten zu Leben und Werk
{300}Phantasie über Goethe als Einleitung zu einer amerikanischen Auswahl aus seinen Werken
Das Kind, das am 28. August 1749, da die Uhr Mittag schlug, in einem Frankfurter Bürgerhause von einer achtzehnjährigen Mutter unter großen Anstrengungen geboren wurde, war schwarz und schien tot. Es schien das Licht nicht sehen, den Lebensweg, der dann so lang und weit führend, so reich umblüht, so gesegnet-mühsam, so menschlich erfüllt, so musterhaft werden sollte, garnicht erst antreten, sondern vom Mutterleibe sogleich zur Erde kehren zu sollen. Geraume Zeit währte es, bis die Großmutter hinterm Bett hervor der seufzenden Wöchnerin zurufen konnte: »Elisabeth, er lebt!« Es war ein Ruf von Frau zu Frau, animalisch frohe, häusliche Nachricht, nichts weiter. Und doch hätte er der Welt, der Menschheit gelten sollen, und doch hat er noch heute, nach zwei Jahrhunderten, vollen Freudengehalt und wird ihn wahren durch alle kommenden: Solange es Leben und Liebe geben wird auf dieser Erde, solange das Leben sich selber liebt, seiner süßen Not nicht müde wird, sich nicht im Überdruß von sich wendet, wird dieser Frauenruf, der ahnungslos große Verkündigung war, dauern und klingen: »Er lebt!«
Dem Menschenkinde, das damals so schwer, bereits erstickt, dem dunklen Schoß entbunden wurde, war ein ungeheuerer Lebensbogen vorgeschrieben, es war ihm beschieden, in mächtigem Aushalten ein wahrhaft kanonisches Leben zu führen, gewaltige Kräfte des Wachstums und der Erneuerung zu entfalten, das Menschliche ganz zu erfüllen und eine Majestät der Existenz zu gewinnen, vor der Könige und Völker sich beugten, und deren natürliche Entstehung er selbst wohl einmal, nicht {301}ohne Feierlichkeit, zum Gegenstand seiner Untersuchung machte. Dreiundachtzig Jahre nach jener Sommer-Mittagsstunde seiner Geburt – Massen von Geschichte hatten sich unterdessen vorbeigewälzt und seinen Geist bestürmt: der Siebenjährige Krieg, der Unabhängigkeitskampf Amerikas, die französische Revolution, Aufstieg und Fall Napoléons, die Auflösung des Heiligen Römischen Reiches, der Jahrhundertwechsel mit seinen physiognomischen und atmosphärischen Weltverwandlungen, der Anbruch des bürgerlichen, des Maschinen-Zeitalters, die Juli-Revolution – steht der alles überlebende Greis, schneeweiß und starr, um die Pupillen wunderliche Altersringe, die seinen braunen, nahe beisammenliegenden Augen etwas Vogelhaftes verleihen, – steht er an dem Pult seines absichtlich unbequem gehaltenen Arbeitszimmers zu Weimar, in dem Hause, das längst zu einer Wallfahrtsstätte der menschlichen Verehrungsbedürftigkeit geworden, und schreibt seinen letzten Brief, schreibt in sklerotischer Träumerei und klarer Betrachtsamkeit an einen alten Freund, den Sprachforscher und Staatsmann Wilhelm von Humboldt in Berlin:
»… Das beste Genie ist das, welches alles in sich aufnimmt, sich alles zuzueignen weiß, ohne daß es der eigentlichen Grundbestimmung, demjenigen, was man Charakter nennt, im mindesten Eintrag tue, vielmehr solches noch erst recht erhebe und durchaus nach Möglichkeit befähige … Die Organe des Menschen durch Übung, Lehre, Nachdenken, Gelingen, Mißlingen, Fördernis und Widerstand und immer wieder Nachdenken verknüpfen ohne Bewußtsein in einer freien Tätigkeit das Erworbene mit dem Angeborenen, so daß es eine Einheit hervorbringt, welche die Welt in Erstaunen setzt. – Treu angehörig J. W. v. Goethe.«
Großartige Naivität, naive Großartigkeit der Selbstschau! Sie {302}hat etwas Kindliches und Dämonisches, etwas Entzückendes und Schauder Erregendes zugleich. Siebzehn Jahre früher schon, er steht damals in später, dichterisch zweckhafter, jedenfalls dichterisch fruchtbarer Liebesleidenschaft zu einer ganz jungen, eben verheirateten Frau, Marianne von Willemer, der Suleika des »West-östlichen Divan«, – aber seine letzte Passion ist es durchaus nicht, die überwältigt ihn gar erst mit 74, als Seine Excellenz, der rangälteste Staatsminister des Großherzogtums Sachsen-Weimar und weltberühmte Dichter, in Marienbad noch einmal zum Tanzsaal-Löwen und Seladon wird, liebelt und liebt, scharmuziert und schnäbelt und durchaus eine 17jährige Mädchenblüte heiraten will, woraus aber nichts wird, da die Seinen sich dagegen in Positur setzen und auch die Kleine es doch lieber nicht möchte, übrigens ohne dann je einem anderen sich zu vermählen – mit sechsundsechzig also, über beide Ohren verliebt und unter den Augen des wohlwollenden Gatten schwärmerisch wiedergeliebt, gibt er im Gedicht ein Bild seiner Existenz, das ähnlich berührt und erschüttert, wie die Wendung von der in Erstaunen gesetzten Welt. Er reimt:
»Nur dies Herz, es ist von Dauer,
Schwillt in jugendlichstem Flor,
Unter Schnee und Nebelschauer
Rast ein Ätna dir hervor.
Du beschämst wie Morgenröte
Jener Gipfel ernste Wand,
Und noch einmal fühlet Hatem
Frühlingshauch und Sommerbrand.«
Der rasende Ätna ist eine poetische Übertreibung. Wie ich ihn kenne, hat sein Herz nie für eine Frau vulkanisch gerast; er war überhaupt gegen das Vulkanische, auch wissenschaftlich. Aber: »jener Gipfel ernste Wand« – welche Mächtigkeit, welche {303}durchaus nicht prahlerische, sondern ruhig und wahrheitsgemäß beschreibende Erhabenheit der Selbstempfindung! Von sich zu sagen, von sich sagen zu dürfen: Ich gleiche einem gewaltigen, hoch gipfelnden Bergmassiv, ehrfurchtgebietend, unzugänglich und abweisend in seinem steilen Ernst, doch zärtlich beschienen von einer Lieblichkeit, die grimme Größe nicht scheut, sondern sogar zu allererst sie küßt, verklärt, beschämt – von der Morgenröte!
Dabei ist dem nichtdeutschen Leser das Folgende bemerklich zu machen. Die Struktur des Gedichtes verlangt auf dies Wort »Morgenröte« im übernächsten Vers einen Reim, der orientalische Name Hatem aber, mit dem das innere Ohr abgespeist wird, ist kein solcher; der schelmisch versagte Reim, den das Ohr jedoch unwillkürlich, zugleich erheitert und erschrocken, vollzieht und vollziehen soll, ist der wirkliche Name, ist Goethe, – dies merkwürdige, heute nicht mehr vorkommende Sippenschild, welches, nachdem viele Schwache, Gleichgültige es getragen, durch den Einen, Späten, durch eine unvergleichliche Kraft, Erworbenes mit Angeborenem zu verbinden, zu einem Palladium der Menschheit, zum Namen für ganze Welten der Kunst, Weisheit, Bildung, Kultur geworden ist und nach der Sinnentwicklung, die er durchgemacht, an den Caesar-Namen erinnert; – dieser Name, in dem das Nordisch-Gothische (denn von »Gothe« kommt er doch wohl), das Barbarische also, durch den flötenhaften Umlaut ins Musische geläutert ist, und den sein Träger mit tiefem Gefühl auf das Holdeste reimt, was die sinnliche Welt zu bieten hat: auf die Morgenröte.
Wir haben da eine Art von großartigem Narzißmus, eine Selbsterfülltheit, viel zu ernst und um Selbstvervollkommnung, Steigerung und »Cohobation« des Gegebenen bis ans Ende bemüht, als daß ein Wort so kleinen Sinnes wie Eitelkeit {304}dafür brauchbar wäre, – eine tiefe Freude am Ich und seinem Werden, der wir »Dichtung und Wahrheit, Aus meinem Leben«, die beste und jedenfalls liebenswürdigste Autobiographie der Welt verdanken, einen Ich-Roman, der in unbeschreiblich angenehmem Tonfall darüber unterrichtet, wie ein Genie sich bildet, Glück und Verdienst nach irgendwelchem Gnadenschlusse sich unauflöslich verketten, eine Persönlichkeit unter der Sonne höherer Gunst sich entfaltet … Persönlichkeit! Goethe hat sie »das höchste Glück der Erdenkinder« genannt, aber was sie eigentlich ist, welche Bewandtnis es mit ihr hat, worin ihr Geheimnis besteht – denn ein Geheimnis ist es mit ihr – das hat auch er nicht gesagt und erklärt, – wie er denn, bei aller Liebe zum treffenden, das Leben genau aussprechenden Wort, überhaupt nicht der Meinung war, daß alles gesagt und erklärt werden müsse. Gewiß ist, daß wir mit diesem Wort, diesem Phänomen »Persönlichkeit« die Sphäre des bloß Geistigen, Vernünftigen, Analysierbaren verlassen und eintreten in eine Sphäre des Natürlichen, Elementaren, Dämonischen, welches »die Welt in Erstaunen setzt«, ohne weiter der Erörterung zugänglich zu sein.
Der erwähnte Wilhelm von Humboldt, ein ungemein kluger Mann, äußerte wenige Tage nach Goethes Tode: Das Merkwürdige sei, daß dieser Mensch gleichsam ohne alle Absicht; unbewußt, bloß durch sein Dasein so mächtigen Einfluß geübt habe: »Es ist dies«, schrieb er, »noch geschieden von seinem geistigen Schaffen als Denker und Dichter, es liegt in seiner großen und einzigen Persönlichkeit.« – Da sieht man, daß dieses Wort ein bloßer sprachlicher Notbehelf für etwas der Sprache nicht Zugängliches ist für eine Ausstrahlung, deren Gründe nicht im Geistigen, sondern im Vitalen zu suchen sind: sie muß die höchste Aufmerksamkeit erregende, höchste Anziehungskraft übende Wirkung einer besonderen, intensiven {305}und mächtigen, aber nicht groben, nicht einfachen, aus Kraft und Infirmität eigentümlich gemischten Vitalität sein, deren Zustandekommen ein Laboratoriumsgeheimnis der dunkel schaffenden Natur ist.
Ein Stammesblutwerk läuft da durch die Jahrhunderte deutschen Lebens, zufällig, unbeachtet, gewöhnlich, mit welchem die Allmutter gewiß kein Ziel verfolgt, das aber dem Effekt nach eines hat: den Einen. »Denn es erzeugt«, wird dieser seine Iphigenie sagen lassen,
»– denn es erzeugt nicht gleich
Ein Haus den Halbgott, noch das Ungeheuer;
Erst eine Reihe Böser oder Guter
Bringt endlich das Entsetzen, bringt die Freude
Der Welt hervor.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: