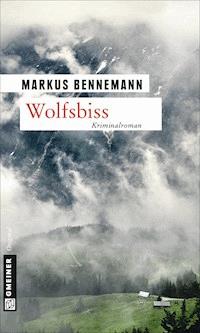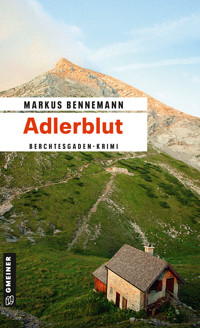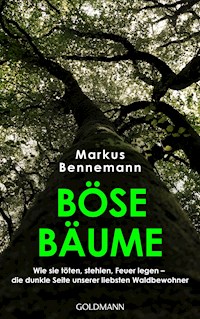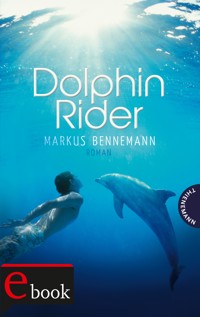Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In der Tiefe hört dich niemand schreien … Der kinoreife Thriller »Phantom – Gefahr aus der Tiefe« von Markus Bennemann jetzt als eBook bei dotbooks. Es wittert dich, es findet dich … An der Küste Floridas verschwinden Menschen. Unter den Anwohnern macht ein verstörendes Gerücht die Runde: Eine Meereskreatur soll mit kalter Berechnung nach Beute suchen! Doch bei den zuständigen Behörden nimmt niemand das Gerede ernst – bis auf die junge Polizistin Jessica Sanchez. Zusammen mit dem Meeresbiologen Steven Schuster folgt sie der Spur des mysteriösen Wesens, die nicht nur in die Abgründe des illegalen Tierhandels, sondern tief in die abgelegenen Dschungel Südamerikas führt. Dort haust etwas, von der modernen Welt vergessen … und jetzt auf Opfer aus: voller Wut, voller List und voll unstillbarem Hunger! Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der spektakuläre Blockbuster »Phantom – Gefahr aus der Tiefe« von SPIEGEL-Bestsellerautor Markus Bennemann liefert salzig-schaurigen Nervenkitzel für die Fans von Frank Schätzing, Preston & Child und der Actionfilme »Meg« und »Into the Blue«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 702
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Es wittert dich, es findet dich … An der Küste Floridas verschwinden Menschen. Unter den Anwohnern macht ein verstörendes Gerücht die Runde: Eine Meereskreatur soll mit kalter Berechnung nach Beute suchen! Doch bei den zuständigen Behörden nimmt niemand das Gerede ernst – bis auf die junge Polizistin Jessica Sanchez. Zusammen mit dem Meeresbiologen Steven Schuster folgt sie der Spur des mysteriösen Wesens, die nicht nur in die Abgründe des illegalen Tierhandels, sondern tief in die abgelegenen Dschungel Südamerikas führt. Dort haust etwas, von der modernen Welt vergessen … und jetzt auf Opfer aus: voller Wut, voller List und voll unstillbarem Hunger!
Über den Autor:
Markus Bennemann (geboren 1971) liebt das Meer und alles, was darin sein Unwesen treibt. Er war Journalist, Krimi-Autor fürs Fernsehen und taucht immer noch in blaue Tiefen ab, wann immer er kann. Sein Interesse für Biologie verarbeitete er in zahlreichen Sachbüchern und seinem Unterwasser-Blockbuster »Phantom – Gefahr aus der Tiefe«. Markus Bennemann lebt in Wiesbaden.
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seinen Tiefsee-Thriller »Phantom – Gefahr aus der Tiefe«.
***
Aktualisierte eBook-Neuausgabe Oktober 2023
Copyright © der Originalausgabe 2011 Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München
Copyright © der aktualisierten Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Golden Dayz, Yellow Cat, SHIN-db
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98690-838-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Phantom – Gefahr aus der Tiefe«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Markus Bennemann
Phantom – Gefahr aus der Tiefe
Thriller
dotbooks.
TEIL I
Erste Begegnungen
Ein Meer ohne namenlose Monster
wäre wie ein völlig traumloser Schlaf.
JOHN STEINBECK, Logbuch des Lebens
KAPITEL 1
Gleich nach der Schule gingen die anderen beiden ihre Räder holen, und um Punkt Viertel nach zwei trafen sie sich alle vor Petes Haus. Josie brachte sein vergilbtes Schnorchelzeug und seinen krummen alten Fischspeer mit, genau wie Pete erwartet hatte. Der kleine Abe Wyman hingegen hatte nichts dabei außer einer winzigen silbernen Digitalkamera, die vor seiner schmalen Brust baumelte wie bei einem Touristen. Pete bot ihm an, die Schnorchelmaske seiner Schwester zu benutzen. Aber da machte Abe ein Gesicht, als habe man ihm gerade gesagt, er solle vom Empire State Building springen.
»Bist du verrückt?«, rief er empört zu ihnen in die Garage. »Ich werd noch nicht mal in die Nähe des Wassers gehen.«
Pete drehte sich zu Josie um, der mit der Anprobe der neuen Tauchweste beschäftigt war, die Petes Vater sich kürzlich gekauft hatte. »Er geht noch nicht mal ins Wasser?«, fragte er verblüfft.
»Nö, macht nur Fotos«, erwiderte Josie und blickte gutgelaunt von dem Regler zum automatischen Aufblasen der Weste auf, an dem er gerade herumspielte. »Jede echte Expedition braucht einen Fotografen.«
Pete schüttelte unzufrieden den Kopf. Er war von Anfang an dagegen gewesen, die quengelige kleine Brillenschlange mitzunehmen. Doch Josie hatte sich irgendwie von Abe rumkriegen lassen, und jetzt wusste Pete nicht recht, wie er damit umgehen sollte. Schon hob er an, bei seinem besten Freund ein weiteres Mal gegen die Entscheidung zu protestieren. Aber irgendwas daran, wie erwachsen und männlich dieser in der Tauchweste wirkte, die er über seine muskulösen braunen Schultern gezogen hatte, hielt ihn davon ab. Und so fuhr er schließlich einfach mit leicht beleidigter Miene fort, seine Ausrüstung zu packen.
Er schob die teure neue Druckluftharpune in seinen Rucksack, die sich sein Vater zusammen mit der Weste gekauft hatte, und als darunter ein großes gezacktes Tauchmesser zum Vorschein kam, steckte er vorsichtshalber auch das mit ein. Dann stieg er auf sein Rad und machte sich mit den anderen auf den Weg nach Baker’s Point. Die nördliche Spitze der schmalen Barriereinsel, auf der sie lebten, lag nur etwa zehn Minuten von seinem Zuhause entfernt.
In der Sonne funkelnde weiße Wärmeschutzdächer, wie frisch gewaschen wirkendes Bermudagras – der tropische Sturm »Howard« war endlich weitergezogen. Drei Tage lang hatte Pete zu Hause sitzen und am Fernseher dabei zuschauen müssen, wie sich das sommerliche Unwetter immer weiter Floridas Ostküste hinaufschob. Als es mit seinen langen Wolkenarmen schließlich auch das kleine Amberly Beach unter sich bedeckte, das ziemlich genau in der Mitte des vor der Küste verlaufenden Inselstreifens lag, schien draußen vor den Fenstern endgültig die Welt unterzugehen. Jetzt jedoch war der Himmel wieder blau, alles glänzte, und nur hier und da erinnerte noch ein abgerissener Palmwedel oder eine aufgeplatzte Kokosnuss an die ungemütlichen Tage.
Sie folgten der langgezogenen Hauptstraße von Amberly Beach bis zu dem Punkt, wo eine Schiffsdurchfahrt den dünnen Landstreifen begrenzte. Dann stiegen sie von ihren Rädern und schoben sie einen schmalen, dicht umwachsenen Pfad entlang Richtung Strand. »Seid ihr sicher, dass es hier keine Schlangen gibt?«, fragte Abe ängstlich vom Ende ihres kleinen Trupps, und einmal mehr schüttelte Pete demonstrativ den Kopf.
Der Pfad führte zu einem alten, halb vom Sand begrabenen Parkplatz. Hier ließen sie ihre Räder liegen und bahnten sich durch hüfthohen Strandhafer und eng an den Boden geklammerte Tintenbeerenranken einen Weg über die Dünen. Etwas weiter rechts gingen die niedrigen Sandhügel in den sorgsam gepflegten Rasen von einem der großen Anwesen über, die an diesem Ende von Amberly Beach das Meeresufer säumten. Links trotzte ein halbverfallenes Hotel mit hohen, hölzernen Giebeln dem unsteten tropischen Wetter. Unmittelbar neben dem Hotel streckte sich eine Mole aus künstlich aufgeschütteten Felsen weit hinaus aufs Meer. Und hinter der Mole und hinter dem dunkelblauen Wasser des Schiffskanals waren die ersten Häuser von Tarpon Shores zu erkennen, der nächsten kleinen Inselgemeinde, die in nördlicher Richtung vor der Küste lag.
Pete stapfte den anderen voran die Dünen hinab und hielt dann direkt auf den alten Pier zu, der sich auf Höhe des Hotels wie ein riesiges, stelzbeiniges Tier aus dem Wasser erhob. Einst war er an die Terrasse des Hotels angeschlossen gewesen, doch Tornados und Sturmfluten hatten die Verbindung im Laufe der Jahre gekappt, und jetzt stand er nur noch mit sechs seiner hohen Holzbeine auf dem Strand. Der Zutritt war verboten, aber auf einer Seite führte eine rostige Treppe hinauf, und am Wochenende konnte man oft alte Schwarze oder junge Latinos sehen, die von der Gangway aus ihre Angel ins Wasser hielten.
Sie setzten sich auf den kleinen Sandwall, den die vom Sturm aufgepeitschte Brandung in den Strand modelliert hatte, und Pete und Josie fingen an, ihre Sachen anzuziehen. Als Pete übers Wasser blickte, fiel ihm erneut auf, wie friedlich und freundlich alles wieder aussah: der Himmel so klar, dass er beinah transparent wirkte, und das Meer wie eine Scheibe aus lichtdurchflutetem grünem Glas, was ihnen eine Sichtweite von bestimmt dreißig Metern verschaffen würde.
Trotzdem jedoch schien eine kleine glitschige Kreatur ihre langen kalten Arme in Petes Bauch auszustrecken, als er jetzt wieder an die Geschichte dachte, die Abe ihnen erzählt hatte. Und während er seine Flossen überstreifte und das große Tauchmesser an seiner dünnen Wade festschnallte, konnte er nicht umhin, ihn ein weiteres Mal über die genauen Details dieser Geschichte auszufragen.
»Also, wo in etwa meintest du, hat dein Bruder dieses ... was auch immer es gewesen sein soll, gesehen?«
»Er hat nur gesagt, dass er unter dem alten Pier speerfischen war, und dann ... Na ja, wie ich euch ja schon erzählt habe, dachte er zuerst, er hätte eine Leiche gesehen.«
»Eine Leiche«, wiederholte Pete. »Die aber nicht oben auf dem Wasser schwamm, wie es für eine Leiche normal wäre, sondern unten auf dem Meeresgrund lag. Und als dein Bruder zu ihr runtergetaucht ist ...«
»Da war sie plötzlich weg«, nickte Abe.
»Und dann ist dieses Ding auf ihn zugekommen«, sagte Josie.
»Er meinte, es sei gewesen, als käme ihm der Boden entgegen«, erklärte Abe. »Aber es war nicht der Boden, sondern irgendwas anderes. Irgendein Tier.«
Josie sah zu Pete hinüber und verengte fachmännisch die Augen. »Irgendein Rochen wahrscheinlich, der sich im Sand vergraben hat. Das machen die gerne.«
Pete nickte mit ähnlich expertenhafter Miene und merkte, wie die kleine Kreatur in seinem Bauch wieder ihre Arme einzog. Nur ein Rochen, dachte er, wie er seinen Vater damals einen auf den Bahamas hatte schießen sehen. Das Einzige, worauf man achtgeben muss, ist, dass einen der Schwanz nicht erwischt. Doch dann ergriff Abe erneut mit seiner hohen Quengelstimme das Wort und schien die heiße Strandluft mit seiner Ängstlichkeit förmlich zum Flimmern zu bringen.
»Ja, aber Jungs«, quietschte er. »Was es auch war, Clive hat gesagt, es war wirklich, wirklich groß. Ungefähr so groß wie er selbst, meinte er.«
»Wenn es ein Rochen war, kann er nicht so groß gewesen sein«, erklärte Josie mit schwer zu widerlegender Folgerichtigkeit, und Abe schluckte das ohne weiteren Kommentar.
Abes älterer Bruder Clive war ein guter Sportler und spielte jetzt wohl sogar im Lacrosse-Auswahlteam seines Colleges. Doch nachdem Abe in der Schule erzählt hatte, wie schmählich Clive vor dem Tier geflüchtet war, das er letzten Sonntag hier gesehen hatte, war sein Ansehen unter den Jungen der Amberly Junior High stark gesunken. Erblickte man in Florida etwas Seltsames im Meer, dann erlegte man es und nahm nicht davor Reißaus. Diese Aufgabe würden nun Pete und Josie erledigen – dafür waren sie hier – und durch das Ausstechen eines Jungen, der wesentlich älter war als sie, umso mehr Ruhm ernten.
»Fertig?«, fragte Josie, und obwohl Pete immer noch ein Gefühl im Bauch hatte, als würden kalte Finger sanft über seine Eingeweide streicheln, folgte er seinem Freund zum Wasser.
Die ersten Schritte ins Meer machten sie rückwärts, weil es mit den Flossen so leichter war. Abe kniete sich in den Sand, um Fotos zu schießen, und mit der großen Harpune in der Hand kam sich Pete ein bisschen vor wie James Bond, oder als wären sie tatsächlich Teil einer wichtigen wissenschaftlichen Expedition – ganz wie Josie vorhin gesagt hatte. Als ihnen das Wasser jedoch schließlich bis zum Bauch ging, drehten sie sich um, spülten ihre Masken aus und tauchten unter.
Sofort hatte Pete das Gefühl, in eine andere Welt hinübergewechselt zu sein, eine, die er wirklich mochte. Die Sicht war sogar noch besser als gedacht, und er hatte den Eindruck, gut und gerne vierzig Meter über den flach abfallenden Sandboden hinwegblicken zu können. Er sah einen Einsiedlerkrebs, der sich schnell wieder in sein Schneckenhaus zurückzog, als sie sich näherten. Gleich darauf stieß er auf ein paar winzige sandfarbene Fische, die nicht weniger hastig in alle erdenklichen Richtungen davonflitzten. Doch dann fiel ihm wieder ein, dass sie nicht zum Vergnügen hier waren, und er folgte Josies mühelos wirkenden, kraftvollen Flossenschlägen Richtung Pier.
Bald traten die dicken braunen Pfeiler des Piers vor ihnen aus dem blauen Wasser hervor. Obwohl sie noch beinah ganz im Schatten lagen, konnte man gut den schwarzen Kranz aus Miesmuscheln erkennen, der oben an jedem Pfeiler wuchs. Weiter unten bedeckten feine grüne Algenschlieren das Holz, und hier und da hatten sich einzelne weiße Seepocken festgesetzt.
»Du nimmst die Seite hier und ich die drüben«, erklärte Josie und begann dann sogleich, im Slalom die hintere Reihe der Pierpfeiler abzuschnorcheln.
Alte Dosen, kaputte Angelruten, ausgediente Liegestühle – staunend betrachtete Pete den unterm Pier angehäuften Müll, während er in gemächlicher Schlangenlinie die Pfeiler abschwamm. Ab und zu blickte er nach hinten; dabei merkte er zum ersten Mal, wie lang der Pier war, viel länger, als man vom Strand aus dachte. Je tiefer das Wasser wurde, umso dichter sammelten sich die Schatten unter der mächtigen alten Holzkonstruktion, und bald erhoben sich bereits die ersten kleinen Felsbuckel aus dem dunkelblauen Zwielicht, das den Boden unter der Gangway bedeckte. Weiter draußen lag ein großes Riff vor der Küste, und mit einem etwas mulmigen Gefühl dachte Pete an die dicken Zackenbarsche, schlanken Barrakudas und pfeilschnellen Haie, die dort hausten.
Plötzlich tauchte Josie auf der anderen Seite ab. Mit einem seiner kräftigen Arme zog er das Gummiband des Speers weit nach hinten, und Pete beobachtete gebannt, wie sein Freund im blauen Halbdunkel verschwand. Doch Josie kam sofort wieder hoch und winkte ab. Falscher Alarm, dachte Pete halb erleichtert, und auch auf seiner Seite stieß er auf nichts Auffälliges, nicht mal auf irgendeinen größeren Fisch, trotz der inzwischen recht beachtlichen Tiefe. Das Interessanteste waren noch die kleinen sandfarbenen Flitzer, die er bereits hinten im Flachwasser bemerkt hatte. Fasziniert sah er zu, wie sie sich um die Algen stritten, die eigentlich in Hülle und Fülle auf den Pfeilern vorhanden waren – als sich auf einmal etwas um seine Brust legte.
Mit rasendem Herzen schlug er um sich, schaffte es, sich von seinem Gegner zu befreien – erkannte dann jedoch, dass es sich dabei nur um ein abgerissenes Stück Angelschnur handelte. Mit ihrem kleinen silbernen Haken hatte sie sich im weichen Holz des Pfeilers verfangen und trieb jetzt im Wasser wie der dünne Fangarm einer Qualle.
Jesus Christus!, dachte Pete, sah sich verstohlen nach Josie um und schwamm dann weiter. Kaum richtete er jedoch seine Augen zurück auf den Grund, stockte sein Herz erneut: der dicke, grün-schwarz gemusterte Schwanz von etwas, direkt dort, wo der Schatten der Gangway anfing! Einen Moment schlängelte er sich gut sichtbar durchs helle Sonnenlicht, im nächsten war er schon wieder verschwunden.
Der Rochen!, schoss es Pete durch den Kopf. Du hast ihn gefunden – nichts wie hinterher. Doch seine Beine gehorchten nicht, sondern strampelten wie von selbst weiter von der Stelle weg statt darauf zu, genau wie eben, als ihn die Angelschnur attackiert hatte. Seine Hände verkrampften sich in die Harpune, sein Atem ging hastig in seinem Schnorchel auf und ab. Erschrocken blickte er zu dem Punkt zurück, wo er kurz zuvor den schlängelnden grünen Schweif gesichtet hatte.
Aber wie der Schwanz eines Rochens hat er eigentlich gar nicht ausgesehen, eher wie der einer Muräne. Pete schaute sich nach Josie um und überlegte kurz, ob er ihn rüberholen sollte. Dann erinnerte er sich jedoch an den alten Autoreifen, dessen schwarzen Umriss er etwas weiter hinten auf dem Grund hatte schimmern sehen. Bot der nicht genau die Art von Hohlraum, in den sich Muränen gerne einnisteten? Also war es wohl wirklich nur einer der relativ harmlosen, aalartigen Fische gewesen, und nichts anderes.
Erleichtert schwamm Pete weiter, sah dabei jedoch immer mal wieder besorgt nach hinten. Sehen war allerdings zu viel gesagt, denn plötzlich kam ihm seine Taucherbrille so beschlagen und trüb wie Milchglas vor. Hastig machte er noch ein paar Meter gut und tauchte dann auf, um sie auszuspülen.
Fehler, dachte er sofort, als er die Brille abgesetzt hatte. Wenn jetzt etwas von unten käme, würde er es natürlich erst recht nicht mitbekommen. Dass er sich die Harpune umständlich unter den Arm klemmen musste, um die Brille wieder aufzuziehen, machte die Sache nicht besser. Mit nervösen Fingern zerrte er sich das widerspenstige Gummiband über die Haare und glaubte gleichzeitig zu sehen, wie sich unter ihm ein großer Schatten aus der Tiefe löste. Es kommt, dachte er, es kommt direkt auf mich zu. Panisch riss er die Harpune unter seinem Arm hervor und steckte schnell den Kopf zurück ins Wasser.
»Bitte lächeln!«, rief in dem Moment jemand laut von oben – und Pete schoss hoch wie ein auftauchender Rettungsballon.
»Abe, um Himmels willen!«, entfuhr es ihm entgeistert, während der kleine Kerl grinsend ein Bild von ihm knipste. Irgendwie hatte der alte Schisser doch tatsächlich den Mut aufgebracht, auf den abbruchreifen Pier hochzusteigen! Jetzt blickte er mit seiner Kamera durch eins der großen Löcher, die in der verwitterten Gangway klafften, und lächelte so stolz, als habe er gerade ein Titelfoto für National Geographic geschossen.
»Mein Gott, Abe«, sagte Pete noch einmal und runzelte missmutig die Stirn. »Was zum Teufel tust du denn da oben? Das ist gefährlich, verdammt noch mal.«
»Wie soll ich denn sonst Aufnahmen von euch machen?«, erwiderte Abe entrüstet. »Ich bin doch euer Fotograf. Habt ihr schon was gefunden?«
Pete schaute zurück ins Wasser, wo sich der Schatten natürlich nur als Schatten entpuppt hatte, und schüttelte den Kopf. »Nein, nichts«, sagte er und sah sich dann nach Josie um, dessen rot markierter Schnorchel bereits fast ganz am Ende des Piers aus dem Wasser ragte. »Aber wenn’s was zu finden gibt, kannst du sicher sein, dass wir’s auch finden. Pass du nur mit den wackligen ollen Planken da oben auf. Ich habe keine Lust, hier noch den Lebensretter für dich spielen zu müssen.«
Damit steckte er sich den Schnorchel wieder in den Mund und setzte seinen Weg fort. Einerseits war er genervt, dass der kleine Streber es geschafft hatte, ihn dermaßen zu erschrecken. Andererseits war er ganz froh, dass dort oben jemand einen Blick auf alles hatte – und wenn es nur der quengelige kleine Abe war. Der Schreck saß Pete immer noch in den Gliedern. Um schneller zu Josie aufzuschließen, gab er den Slalomkurs auf und schwamm in gerader Linie an der Innenseite der Pfeiler entlang. Zwar suchte er dabei immer noch wie vereinbart den Grund ab und musterte aufmerksam jeden seltsam geformten Korallenstrauch und jedes geisterhaft wogende Büschel Seegras, das er im blauen Schummerlicht ausmachen konnte. Doch tat er das nicht wirklich aus Jagdeifer, sondern eher, um vor bösen Überraschungen gefeit zu sein. Das Wasser unterm Pier war jetzt bestimmt fast zehn Meter tief, und zusammen mit dem Bodenniveau war auch Petes Hunger nach Ruhm und Ehre beträchtlich gesunken. Welches rätselhafte Geschöpf sich auch in dem düsteren Schattenreich unter ihm verbergen mochte, seinetwegen konnte es ruhig dort bleiben.
Josie aber ließ sich natürlich nicht so leicht von seinem Ziel abbringen, und als Pete am Ende des Piers ankam, hatte sein Freund bereits begonnen, ein ums andere Mal in die Tiefe zu tauchen. Kurz vorm Ende der langen Landungsbrücke fiel der Meeresgrund scharf ab, und in der dahinterliegenden Senke ragten überall große Felsen aus dem Sand, welche die Bodenzone noch dunkler machten, als sie ohnehin schon war. Josie glitt wie selbstverständlich zwischen die Felsen hinab und stocherte mit seinem Speer so eifrig im Sand, dass er manchmal in den aufgewühlten Wolken kaum noch zu sehen war. Pete jedoch schaffte es kein einziges Mal in eine der düsteren Schluchten – stets war es kurz davor so, als würde ihn eine unüberwindliche Macht zum Stoppen zwingen. Trotzdem ging er immer wieder runter und spähte wenigstens aus sicherem Abstand in die dunklen Felsschlünde. Schließlich aber wartete Josie auf ihn an der Oberfläche.
»Bei dir alles in Ordnung, Pete?«, fragte er. »Du tauchst ja gar nicht bis ganz unten.«
»Ja, irgendwas stimmt nicht mit meinen Ohren«, log Pete. »Ist, als würden sie platzen, wenn ich zu tief gehe, egal wie oft ich den Druck ausgleiche. Vielleicht habe ich mir eine kleine Erkältung eingefangen oder so. Jeden Tag in dem Scheißregen nach Hause laufen, da muss man sich ja irgendwann was holen.« Josie sah ihn forschend an, zuckte aber gleich darauf mit den Achseln. »Dann überprüf doch einfach noch mal den Teil, den wir schon abgesucht haben«, sagte er, »und schwimm langsam Richtung Strand zurück. Ich schließe die Suche hier vorne ab und komm nach. Ich glaube sowieso nicht, dass wir was finden. Was auch immer Abes Bruder da gesehen haben mag, der Sturm hat es wahrscheinlich vertrieben.«
Pete war froh, so billig davonzukommen. Zügig schnorchelte er zwischen den Pfeilern zurück, und je seichter und heller der Boden wurde, umso mehr ließen auch die dunklen Ängste wieder von ihm ab, die ihm die ganze Zeit die Brust zugeschnürt hatten. Schon glaubte er, weiter vorne den Punkt zu erkennen, wo sich der blaue Schattenschleier ganz lichtete, und trotz der strammen Flossenschläge hörte sich sein Atem im Schnorchel zum ersten Mal nicht mehr an wie eine Lok, die einen Berg hochfährt. Gleichzeitig spürte er jedoch heiße Scham in sich aufsteigen. Einmal mehr blickte er sich verstohlen nach seinem besten Freund um.
Hatte Josie gemerkt, dass er ihn anlog, und deswegen so komisch geguckt? Wie peinlich auch, eine Erkältung vorzutäuschen – so was sah ihm doch eigentlich gar nicht ähnlich. Pete dachte an Ken Figgis aus der achten Klasse, mit dem Josie zusammen in der Leichtathletikmannschaft war, dann an die älteren Surfertypen, mit denen er ab und zu chillte und sogar schon mal Pot geraucht hatte. Wenn er in Zukunft lieber mit denen rumhängt, stehe ich mit Losern wie dem kleinen Abe da und kann den ganzen Tag über Fernsehserien reden. Oder über die Schule, Himmel hilf, und mir von seiner Mutter dazu Milch und Kekse reichen lassen.
Die Angst, die Pete davor hatte, war mindestens genauso groß wie die vor den dunklen Felsschluchten. Deshalb betrachtete er es als glückliche Fügung, als unter ihm plötzlich der alte Autoreifen von vorhin wieder auftauchte. Mochte er eben auch wie ein kleiner Feigling den Schwanz eingezogen haben: Jetzt würde er Josie ein für alle Mal beweisen, woraus er gemacht war!
Der Schatten der Gangway war etwas gewandert, so dass der in Seegras gebettete und mit Seepocken gesprenkelte Reifen inzwischen halb in der Sonne lag. Das bisschen Licht genügte in Petes Augen, um den schwarzen Gummiring der blauen Finsternis zu entreißen, die ihm vorhin eine so unvernünftige Angst eingejagt hatte. Also tauchte er die fünf, sechs Meter dazu hinab, um die große grüne Muräne aufzuscheuchen, die ganz sicher in dem Reifen hauste – und ihr mit seiner Harpune den Garaus zu machen.
Aus sicherer Entfernung stach er ein paarmal mit der Spitze der langen Waffe in die Mitte des Reifens. Dann stieg er wieder auf, um Luft zu holen, und ging ein zweites Mal runter.
Diesmal näherte er sich seinem Ziel in einem etwas anderen Winkel. Nervös stocherte er mit der Harpune in der dunklen Höhlung des Reifens herum und rechnete jeden Moment damit, dass das zähnestarrende Maul des Monsters daraus vorschoss. Doch es tat sich nichts, und schließlich musste Pete einsehen, dass der Meeresgrund hier so frei von gefährlichen Ungeheuern war wie überall sonst unterm Pier. Nirgendwo ein formidabler Gegner, mit dessen Bezwingen er sein peinliches Versagen von eben vergessen machen konnte.
Schon wollte er enttäuscht wieder auftauchen, da nahm er im Augenwinkel plötzlich eine Bewegung wahr. Verblüfft hob er den Kopf und blickte quer über den schattigen Sandboden zur anderen Seite des Piers hinüber.
Praktisch im selben Moment ging ihm erneut die Luft aus, und er musste zurück nach oben. Kaum aber hatte er mit einem tiefen Atemzug seine Lunge gefüllt, steckte er den Kopf wieder unter Wasser, um sich zu vergewissern, was er eben gesehen hatte – vielleicht einen halben Meter über dem Grund, direkt vor dem großen Pfeiler, der auf der anderen Seite stand ...
Josie, ja, es war tatsächlich Josie – mit seiner hellen gelben Badehose, den alten grünen Flossen und zum Schuss nach hinten gezogenem Speer. Josie, der genauso ruhig und konzentriert mit sanft schlagenden Beinen überm Boden schwebte wie eben, als er zwischen den Felsen im Sand rumstocherte.
Kurz war Pete überrascht, wie lange sein Freund den Atem anhalten konnte, aber dann auch wieder nicht, weil Josie eben Josie war. Schnell holte er noch mal Luft, kippte das Wasser aus seinem Schnorchel und steckte ihn wieder in den Mund. Auf dem Rückweg zum Strand musste Josie selbst auf die Muräne gestoßen sein, hatte sie in irgendeine Felsritze gescheucht und wartete jetzt mit brennender Lunge darauf, dass sie wieder rauskam. Über sich hörte Pete Schritte – vermutlich Abe, der gleich wieder mit seiner Kamera an irgendeinem Loch auftauchte. Doch um ihm zu sagen, was los war, blieb keine Zeit. Hastig tauchte Pete unter.
Wieder spürte er sein Herz rasen. Doch diesmal war es nicht die peinliche, kleinliche Angst von eben, die es dazu brachte, sondern das echte, erregende Fieber der Jagd. Plötzlich war die Furcht vor dem dunkelblauen Zwielicht unter der Gangway wie weggeblasen, und Pete schwamm ohne zu zögern hindurch – in direkter, diagonaler Linie auf seinen knapp überm Boden schwebenden Freund zu. Eine Art Besitzerstolz erfüllt ihn, als er sich bewusst wurde, wie lange dieser jetzt schon die Luft anhielt, und er freute sich bereits auf die verdutzte Miene, die Josie machen würde, wenn er sah, dass er ihm zu Hilfe kam.
Furchtlos in der Jagd vereint – und gleich würden sie gemeinsam das große grüne Monstrum aus dem Wasser ziehen, und Abe würde jede Menge Fotos machen. Dann würden alle sehen, was für gute Freunde er und Josie waren – ein unschlagbares Team –, und es würde niemals, niemals wieder anders sein.
Wären ihm in dem Moment nicht verfrühte Glückstränen in die Augen gestiegen, wäre Pete vielleicht das eine oder andere seltsame Detail an seinem besten Freund aufgefallen. Zum Beispiel, dass Josies Speer genau dort endete, wo er ihn in der Hand hielt, und auch die weiche, wogende Art, mit der er die Beine bewegte – fast, als seien sie aus Gummi.
Doch der absurde Gedanke, dass das, worauf er gerade zuschwamm, gar nicht Josie sein könnte, kam Pete erst, als es schon zu spät war. Und sich ein großes gelbes Auge auf der Brust seines Freundes öffnete, das ihn mit kaltem, abschätzendem Blick ansah.
KAPITEL 2
Steven tauchte den Arm in Herbs Aquarium, trug den kleinen Kraken, der ungefähr die Größe einer Honigmelone hatte, zum ersten Aquarium des Parcours und ließ noch mal einen prüfenden Blick über alles schweifen.
Sämtliche Luken, welche die lange Reihe aus Plexiglasaquarien vor ihm miteinander verbanden, waren verschlossen. Am anderen Ende des Labors stand Dekan Duffy neben der großen Stoppuhr auf Stevens Schreibtisch und ließ seine Hand über den noch unbewegten roten Digitalziffern schweben. Und an der mit Lüftungsrohren überzogenen, leise vor sich hin rauschenden Decke waren alle Strahler auf volle Leistung gestellt, damit Senator Carter – entscheidende Stimme bei der jährlichen Erneuerung von Stevens Forschungsstipendium und auf seiner üblichen Herbsttour durchs Institut – auch nicht das kleinste Detail von dem verpassen würde, was gleich in den Aquarien zu sehen wäre.
»Fertig?«, fragte Steven.
Er sah hinüber zum Dekan, der auf seinen Blick mit einer schiefen Grimasse antwortete. Dann ließ er Herb ins Wasser gleiten und stellte sich seitlich neben das Aquarium. Auf der anderen Seite kam auch Carter näher und beugte sein rundes, sonnenverbranntes Gesicht zu dem komplizierten Gewirr aus Plexiglasröhren hinab, welches das erste Hindernis des Parcours darstellte.
»Wie kann ich wissen, dass Sie ihm nicht einfach beigebracht haben, wie er am schnellsten durchkommt?«
»In dem Punkt müssen Sie mir einfach vertrauen, Senator. Ich habe ihn noch nicht mal dabei zusehen lassen, wie ich es zusammenbaue. Nur um auf Nummer sicher zu gehen.«
Steven grinste Carter verschmitzt an. Doch dieser schien sich nicht sicher zu sein, ob er wirklich scherzte, und runzelte als Antwort nur leicht die Stirn. Steven legte die Hand auf die herausziehbare Platte, mit der die erste Luke verschlossen war. »Okay. Auf die Plätze, fertig – los!«
Duffy ließ die Hand auf die Stoppuhr niedersausen, und Herb quetschte seinen Körper in die erste Röhre, die etwa den Durchmesser eines Tennisballs hatte. Mit weit nach vorne gestreckten Armen bewegte er sich rasch vorwärts und wirkte in der durchsichtigen Röhre beinah wie eine braune Flüssigkeit, die dort hindurchgespült wurde. Doch sah man genau hin, konnte man erkennen, wie er in einem fort seine kleinen weißen Saugnäpfe aufs Glas setzte und sich damit voranzog.
An der ersten Gabelung bog er falsch ab, erkannte aber schnell seinen Fehler, als er mit einem seiner langen Arme den Deckel berührte, mit dem die Röhre vorne verschlossen war. Sofort kehrte er um, glitt in die andere Öffnung und rutschte rasch ein korkenzieherförmiges Rohr hinab, das sich wie eine gläserne Wasserrutsche bis auf den Boden des Labors hinunterzwirbelte. »Wow«, rief Carter begeistert, worauf Steven dem Dekan einen triumphierenden Blick zuwarf. Doch der verdrehte nur angewidert die Augen.
Eilig kletterte Herb eine Röhre hinauf, die ihn wieder auf Höhe der Aquarien brachte, und glitt dann geschickt durch verschiedene Loopings und ineinander verschlungene Windungen. Trotzdem hatte Steven den Eindruck, dass sein dressierter Lieblingskrake heute etwas lahm unterwegs war. Und tatsächlich: Noch bevor Herb das nächste Hindernis erreicht hatte, musste Steven einmal laut gegen das Plexiglas klopfen – um so dem klugen Tier zu signalisieren, dass die ersten zwanzig Sekunden der insgesamt zwei Minuten, die es zur Bewältigung des Parcours hatte, bereits abgelaufen waren.
»Das verstehe ich immer noch nicht ganz«, sagte der Senator.
»Ich dachte, die Viecher seien taub.«
»Er kann die Schwingungen spüren«, erklärte Steven. »Mit Hilfe eines speziellen Organs, in dem winzige Härchen sitzen.«
Er und Carter gingen seitlich am Parcours entlang, während Herb sich mit dankenswerter Schnelligkeit durch die nächsten Aquarien arbeitete. In diese führten jeweils drei Luken, die mit verschiedenen Farben markiert waren und von Steven bei jedem Lauf neu angeordnet wurden. Nur die grüne Klappe öffnete sich, wenn Herb durchzuschwimmen versuchte.
»Dann ist diese Sache, dass Tintenfische farbenblind sein sollen, also Unsinn?«
Steven war überrascht. Zum ersten Mal schien sich der Senator tatsächlich ein wenig auf seinen Besuch vorbereitet zu haben. Und Steven war keineswegs sicher, ob ihm das wirklich lieb war. »Manche Forscher behaupten, sie könnten keine Farben sehen«, sagte er. »Aber denken Sie nur mal daran, wie bunt diese Tiere sind – oder zumindest sein können, wenn sie wollen. Und dann farbenblind? Das habe ich noch nie für eine besonders schlüssige Theorie gehalten.«
Steven hoffte, Carter würde glauben, er habe diesen Teil des Parcours absichtlich so gestaltet, um die angebliche Farbenblindheit von Tintenfischen zu widerlegen. Doch der pedantische alte Dekan konnte seine Worte natürlich nicht einfach so stehen lassen.
»Es ist durchaus möglich, dass sie keine Farben wahrnehmen können, sondern nur unterschiedliche Helligkeitsstufen«, erklärte er. »Dann hätten sie ihre Körperfarben auf die gleiche Weise entwickelt wie ein Hase sein braunes Fell. Dieselbe Farbe wie die Erde oder ein buntes Riff zu haben kann einem das Leben retten, selbst wenn man nicht den blassesten Schimmer hat, wie man aussieht. Andererseits hat auch Professor Schuster ein paar recht gute Argumente auf seiner Seite, namentlich dass ...« Obwohl die letzten zwanzig Sekunden der ersten Minute noch nicht angebrochen waren, klopfte Steven laut gegen das Glas. Gleichzeitig warf er Duffy einen bösen Blick zu, um ihn zu erinnern, dass das hier seine Show war. Herb schwamm durch weitere Aquarien, in denen die richtigen Luken statt mit einer besonderen Farbe jeweils mit waagrechten, senkrechten oder schrägen Streifen markiert waren. Dann quetschte er sich wieder in eine Röhre. Diese war nicht sonderlich lang, hatte allerdings einen Durchmesser, der gerade mal so groß war wie ein Vierteldollar.
»Unglaublich«, sagte Carter und schaute fasziniert zu, wie Herbs Arme auf der anderen Seite wieder herauskamen wie die im Zeitraffer wachsenden Triebe irgendeines seltsamen Rankengewächses. »Und mir fällt es schon schwer, mit meinem Allerwertesten in einen Flugzeugsitz reinzukommen.«
Gerade als Steven zum dritten Mal gegen das Glas klopfte, hatte Herb sich vollständig durch die enge Röhre gequetscht – hier hatte er wieder etwas Zeit gutmachen können. Als Nächstes war jedoch ein besonders schwieriger Abschnitt des Parcours dran. Dass Herb gelernt hatte, auch diesen Teil zu bewältigen, war selbst für ein so hochintelligentes Tier wie einen Kraken ungewöhnlich. Die Luken waren jetzt mit verschiedenen Symbolen markiert: jeweils mit einem Kreis, einem Quadrat und einem Dreieck. Um die richtige Luke herauszufinden, musste Herb jedoch auf einen kleinen Zettel schauen, der über dem Wasser klebte. Steven hatte erwartet, es würde Jahre dauern, dem Kraken dieses Kunststück beizubringen. Doch der clevere kleine Bursche hatte praktisch sofort verstanden, was er von ihm wollte – beinah so, als könne er Gedanken lesen.
Aber so gut er sich eigentlich damit auskannte: Aus irgendeinem Grund kam Herb heute nicht halb so schnell durch diesen Abschnitt wie sonst. Vielleicht blendeten ihn die hellen Deckenstrahler, wenn er aus dem Wasser sah, jedenfalls brauchte er gefühlte Stunden, um von einem Aquarium zum anderen zu gelangen. Beim letzten hebelte er sogar wie verbohrt an der Luke mit dem Quadrat herum, obwohl oben auf den Zettel ganz klar ein Kreis gemalt war – als könne er sich unmöglich irren. Zum Glück war jeder seiner acht Arme mit einem eigenen kleinen Gehirn ausgestattet, und einer von ihnen offenbar noch etwas schlauer als sein Besitzer selbst. Während Herb immer noch mit aller Kraft versuchte, die widerspenstige Luke aufzubrechen, streckte dieser Arm sich zu den beiden anderen Luken aus und fand die richtige sozusagen auf eigene Faust.
Herb war noch nicht ganz fertig damit, seinen elastischen braunen Körper ins nächste Aquarium fließen zu lassen, als Steven schon zum vierten Mal gegen das Glas klopfen musste. Nicht mal vierzig Sekunden blieben seinem achtarmigen Schützling jetzt noch, um die letzten beiden Abschnitte hinter sich zu bringen, und einen Moment lang sah Steven nervös zu, wie auf der Stoppuhr Ziffer um Ziffer unerbittlich umsprang.
Im Grunde war dieses ganze Rennen natürlich nur ein Jux. So fragwürdig die akademische Expertise von Senator Carter, Sprössling der berühmten Ananas-Carters aus Broward County, auch sein mochte: Die Vorstellung, er könnte die Vergabe eines so wichtigen Forschungsstipendiums tatsächlich davon abhängig machen, ob ein kleiner brauner Krake einen selbstgebauten Hindernisparcours schnell genug absolvierte, war geradezu absurd.
Andererseits hatte Herb in all den Jahren, in denen Carter hier pünktlich zur Mitte des Herbstsemesters aufgetaucht war, noch kein einziges Mal versagt. Und während der bereits ungewöhnlich abgekämpft wirkende Krake einen Arm aus dem Wasser streckte und auf die hohe Plexiglaswand setzte, die er als vorletztes Hindernis des Parcours überwinden musste, fragte sich Steven besorgt, was wäre, wenn es diesmal dazu käme. Auf der anderen Seite des Labors klebten Mike und Trish, die beiden Kopffüßer, die Steven seine ersten zwei Jahre an der Florida Atlantic University gesichert hatten, an der Frontscheibe ihrer Aquarien; anscheinend verfolgten sie den eigenartigen Wettkampf ebenso gespannt wie er. Der Senator hatte sich tief über den Parcours gebeugt, den Steven jedes Jahr ein bisschen für ihn um- und ausbaute, und sah dem kleinen Kraken mit demselben hochroten Kopf zu wie ein Spielsüchtiger einem Rennpferd. »Auf, Herb«, sagte Steven leise und verfluchte sich insgeheim dafür, die blöde Plexiglaswand nicht etwas niedriger angelegt zu haben.
Das wissenschaftliche Ziel dieses Hindernisses bestand darin, zu zeigen, dass Herb zeitsparende Entscheidungen treffen konnte. Vor der aus dem Wasser ragenden Wand führte ein Loch in ein Röhrensystem hinab, über das man ebenfalls auf die andere Seite gelangen konnte. Doch in den Röhren konnte man sich leicht verirren, und Herb wusste, dass es in der Regel schneller ging, wenn er das Wasser verließ – was er normalerweise nicht ohne sehr triftigen Grund tun würde.
Der Krake war eigentlich recht gut darin, sich mit Hilfe der doppelten Reihe aus Saugnäpfen, die er an jedem Arm trug, die glatte Wand hochzuziehen. Heute jedoch kam Steven der ganze Akt geradezu unerträglich langsam vor. Außerhalb des Wassers verwandelte sich der runde Körpermantel des Tiers in eine große schlaffe Hauttasche, in der es seine inneren Organe mit sich rumschleppte. Wie ein Sack Steine hing diese Tasche noch von der Wand, während drüben schon zwei Arme das Wasser berührten, und Steven musste stark an sich halten, um nicht einfach die Hand auszustrecken und dem kleinen Kraken über die Kante zu helfen.
»Jetzt mach schon, Kumpel!«, drängte er erneut.
Herb war der schlauste Krake, der Steven jemals untergekommen war, aber nicht unbedingt der mutigste, und hatte er seinen Körper erst einmal oben auf die Wand gehievt, ließ er sich für gewöhnlich so vorsichtig auf der anderen Seite wieder hinunter, dass der Abstieg fast genauso lange dauerte wie der Aufstieg. Heute aber war es, als könne er Steven tatsächlich hören, selbst hier draußen an der Luft. Kaum spürte er, wie sich sein Gewicht nach vorne verlagerte, warf er alle Vorsicht über Bord und ließ sich einfach fallen – etwas, was er bisher nur ein einziges Mal gemacht hatte, und das Stevens Überzeugung nach eher aus Versehen als aus Absicht.
»Jippiee!«, rief Senator Carter und störte sich auch nicht an dem Wasser, das ihm auf den Schlips spritzte.
Herb war geistesgegenwärtig genug, den Schwung, mit dem er ins Wasser plumpste, zu nutzen, um gleich durch die Luke des nächsten Aquariums zu gleiten. Noch ein kleiner Schub aus seinem Sipho, seiner körpereigenen Wasserdüse, und er hatte seine letzte Aufgabe erreicht, die in der Mitte des Aquariums trieb wie ein achtlos weggeworfenes Stück Plastikmüll.
Steven klopfte zum fünften und letzten Mal gegen das Glas, und selbst Duffy konnte nicht verhindern, dass ihm ein leiser Anfeuerungsruf entwich. Als Dekan durfte es ihn natürlich nicht kaltlassen, einen Batzen Forschungsgeld und damit möglicherweise eine ganze Abteilung seiner Universität den Bach runtergehen zu sehen. Doch Steven wusste, dass Duffy insgeheim gar nicht so traurig gewesen wäre, ihn und seine achtarmigen Studienobjekte loszuwerden. Deshalb war er angenehm überrascht, festzustellen, dass selbst der strenge alte Griesgram gegen gelegentliche Anwandlungen von Menschlichkeit nicht immun war.
»Ist das dieselbe wie letztes Jahr?«, fragte Carter enttäuscht, als er sah, wie Herb seine Arme um die große weiße Plastikflasche schlang.
»Nein«, erwiderte Steven. »Der Verschluss ist diesmal kindersicher. Und es steckt auch keine Belohnung in der Flasche, sondern etwas, das er braucht, um an sie heranzukommen.«
Die Miene des Senators hellte sich auf wie die eines Jungen, der gerade erfahren hatte, dass hinter dem Weihnachtsbaum noch ein weiteres Geschenk für ihn versteckt war. Er legte seine roten Hände auf den Rand des Aquariums und schien kurz davor zu sein, den Kopf ins Wasser zu tauchen, um auch ja jede von Herbs Bewegungen mitzubekommen.
Herb zog die Flasche zu sich herab, stülpte seinen Körper über ihren Verschluss und drehte sie mit den Armen gegen den Uhrzeigersinn. Geschickt drückte er dabei das Gefäß fest an sich, um die Kindersicherung zu lösen. Diesen Trick hatte der kleine Krake erst vor kurzem gelernt, und Stevens Studenten fanden ihn so cool, dass sie eine Aufnahme davon bei YouTube eingestellt hatten. Noch länger hatte Herb allerdings gebraucht, um zu begreifen, dass er die Flasche erst mit Wasser volllaufen lassen und dann auf den Kopf stellen musste, wenn er an den kleinen weißen Ball kommen wollte, der sich darin verbarg.
»Ein Golfball!«, rief der Senator entzückt, dessen hervorragendes Handicap Steven wohlbekannt war.
»Er weiß, dass er nicht einfach mit einem seiner Arme reingreifen und ihn rausholen kann«, erklärte er. »Die Öffnung der Flasche ist exakt so groß, dass gerade nur der Ball durchpasst.«
Obwohl er wirklich stolz darauf war, dass Herb diese schwierige Nummer gelernt hatte, wünschte er sich doch, er hätte diesen letzten Abschnitt nicht ganz so aufwendig gestaltet. Zwar hatte Herb es geschafft, den Ball in Rekordgeschwindigkeit aus der Flasche zu holen. Doch all die Zeit, die er vorher verloren hatte, konnte er damit nicht wieder wettmachen. Jetzt blieben ihm nur noch ein paar Sekunden, um den Parcours zu vollenden.
Steven fragte sich, warum er Herb nicht einfach ein großzügigeres Zeitlimit gesetzt hatte. Ansonsten lasse ich alles schleifen, dachte er unglücklich, aber ausgerechnet hier entwickle ich einen solchen Ehrgeiz, dass es mich wahrscheinlich die Karriere kostet. Eigentlich sagte er sich ja immer, dass er gar nichts groß dagegen hätte, mal wieder was anderes zu machen – eine eigene Tauchschule zu eröffnen zum Beispiel oder wie früher an einer von Onkel Jacks verrückten Schatzsuchen teilzunehmen. Doch jetzt merkte er plötzlich, dass sein Herz in seiner Brust schlug wie ein Presslufthammer.
»Na los, Herb!«, rief er laut, während dieser den Golfball vom Boden aufhob und damit Richtung Wasseroberfläche schoss. Mit der Zielgenauigkeit und Geschicklichkeit eines Basketballprofis hob er einen Arm über den Kopf und versenkte den Ball in einer Plexiglasröhre, die vor ihm aus dem Wasser ragte. Der Ball sank rasch auf den Boden der Röhre und drückte hier das Ende eines langen Hebels nach unten – dessen anderes Ende daraufhin die Klappe hochzog, mit der die letzte Luke des Parcours verschlossen war.
Herb quetschte sich eilig durch, Duffy betätigte natürlich nicht den Stoppschalter, bevor nicht auch der letzte Zipfel der acht Arme des Kraken auf der anderen Seite angelangt war, und Steven warf einen bangen Blick zum Display hinüber.
00:01:59 – Herb hatte es geschafft!
»Puh«, machte Steven und schüttelte die übers Zielaquarium gestreckte Hand von Senator Carter. Der Politiker strahlte, als habe einmal mehr nicht Steven, sondern der öffentliche Haushalt Floridas dieses seltsame Rennen gewonnen.
Vor dem Rennen hatte Steven dem Senator die neuesten Projekte vorgestellt, mit denen sich seine Abteilung beschäftigte, und ihn wie immer durch die große Sammlung von Kraken, Kalmaren und Sepien geführt, die er in seinem Labor unterhielt. Aufgrund der vielen von der Uni finanzierten Forschungsreisen, die Steven machte, wuchs diese Sammlung ständig weiter an; doch dass er inzwischen eigentlich kaum noch etwas anderes tat als reisen, hatte er gegenüber dem wichtigen Mann natürlich nicht erwähnt. Auch Dekan Duffy, der sich in letzter Zeit immer öfter wegen dieser Tatsache beschwerte, war erfreulich still darüber hinweggegangen – vermutlich weil er wusste, dass Carter letztlich weder Stevens Leistungen als Lehrkraft noch als Forscher wirklich interessierten.
Wie jeden Herbst hatte der Politiker zuerst seinen offiziellen Auftritt auf dem Hauptcampus der Uni in Boca Raton absolviert, dann aber auch noch den langen Weg hier hoch nach Fort Pierce gemacht, zum Harbor Branch Institut für Meereskunde. Das allerdings nicht, weil er eine so große Vorliebe für die Malakologie hegte, die wissenschaftliche Erforschung von Tintenfischen und anderen Weichtieren. Nein, er wollte schlicht Herb sehen: den kleinen braunen Kraken und die Show, die er in Stevens selbstgebautem Hindernisparcours jedes Jahr aufs Neue für den hohen Besuch abzog.
»Brillant«, sagte er. »Diesmal haben Sie sich wirklich selbst übertroffen, Professor Schuster. So macht Wissenschaft Spaß! Wirklich außerordentlich.«
»Ja, gut gemacht, Schuster«, sagte Dekan Duffy in nüchternem Ton und fasste Carter dabei bereits am Ellbogen, um ihn aus dem Raum zu führen. »Eine beeindruckende Darbietung. Wir sprechen uns dann morgen.«
Als sich die Tür hinter den beiden schloss, atmete Steven auf. Wie jedes Jahr würde Duffy ihn am Tag nach Carters Besuch anrufen, um ihm mitzuteilen, ob dieser der Verlängerung seines Stipendiums zustimmte, womit der Antrag bei der offiziell dafür zuständigen Behörde nur noch eine reine Formsache wäre. Aber darum machte Steven sich jetzt keine Sorgen mehr.
Er ging zurück zu Herb, der sich längst an dem großen Taschenkrebs gütlich tat, der seine Belohnung dafür darstellte, den Parcours in der vorgesehenen Zeit absolviert zu haben. Der Geruch des toten Krebses zog sich durch sämtliche Aquarien, wurde mit jedem Hindernis, das Herb hinter sich ließ, intensiver und brachte den kleinen Kraken überhaupt erst dazu, all die Mühen auf sich zu nehmen, die zur erfolgreichen Beendigung des Parcours notwendig waren. Hätte Herb es nicht geschafft, hätte Steven den Krebs aus dem Wasser genommen, und Herbs Anstrengungen wären allesamt umsonst gewesen. So gern Steven ihn hatte, anders konnte auch er den kleinen Kopffüßer nicht dazu bringen, mit ihm zusammenzuarbeiten.
»Den hast du dir diesmal wirklich verdient, mein Freund«, sagte er und sah noch eine Weile zu, wie der Krake den Krebs unter der schirmartigen Haut zwischen seinen Armen hungrig bearbeitete. Doch dann erinnerte er sich wieder, dass Carters Besuch in diesem Jahr genau auf Halloween fiel, und blickte hoch zu der großen runden Analoguhr, die über seinem Schreibtisch hing.
Hier unten in den künstlich beleuchteten Kellerräumen bekam man ja kaum was davon mit, aber inzwischen war es schon später Nachmittag. Als Herb vorhin fast versagt hätte, hatte Steven sich geschworen, sich in Zukunft wieder ernsthafter seinen Studien zu widmen und nicht nur immer das zu tun, was ihm Spaß machte. Jetzt jedoch hatte er bereits wieder das Gefühl, noch ewig für diesen Neuanfang Zeit zu haben, und er erinnerte sich plötzlich an die Halloweenparty, zu der ihn gestern zwei Studentinnen nach seiner Vorlesung über das sexuelle Farbtäuschungsverhalten südaustralischer Riesensepien eingeladen hatten.
»Keine dämlichen Verkleidungen«, hatten sie gesagt, »nur ein bisschen am Pool rumhängen, ein paar Cocktails trinken und ein, zwei Joints rauchen.« Auch ein bisschen Apfeltauchen sei vielleicht drin, hatte Cindy, die hübschere von beiden, hinzugefügt und dabei unauffällig ihre Bücher von unten gegen ihre Auslage gedrückt.
Steven ging zu dem Telefon auf seinem Schreibtisch und bat einen seiner Assistenten, Herb zurück in sein Aquarium zu setzen und den restlichen Kopffüßern in seiner Sammlung ihr Abendessen zu geben. Dann schulterte er seine Tasche, machte das Licht aus und verließ das Labor. Einen guten Grund zu feiern hatte er ja schließlich heute.
KAPITEL 3
»Chachi! Chachi, meine Süße! Wo steckst du denn nur?«
Eigentlich mochte Howard Allmayer den Hund seiner Frau gar nicht besonders, aber dass er jetzt verschwunden war, nervte ihn irgendwie. Er ging ins Haus, um nachzusehen, ob das verfressene kleine Vieh dort jemanden um Futter anbettelte. Dann lief er auf die große Terrasse zurück, wo seine jährliche Halloweenparty wie immer ein voller Erfolg war, um hier nach dem als Hummer verkleideten Jack-Russell-Terrier zu suchen.
Wie alle Schoßhunde neigte Chachi zur Hysterie. Hatten Howard und seine Frau zum Beispiel Besuch oder kam auch nur irgendein Lieferant zur Tür rein, wetzte die kurzbeinige Töle wie wild im Kreis um den Eindringling und kläffte sich dabei die Seele aus dem Leib. Oft genug verlor sie vor lauter Aufregung sogar die Kontrolle über ihre Blase und hinterließ große Pisskreise auf dem schwarzen Marmor, die Howard dann in der Regel wegwischen durfte, weil er anscheinend der Einzige im Haus war, der sich an so was störte. War es da ein Wunder, dass er sich manchmal wünschte, das weiß-braune Nervenbündel einfach ins Intracoastal zu schmeißen?
Seit heute Nachmittag war jedoch alles anders.
Das Motto der diesjährigen Party lautete »Neptuns Reich«. Er und Marie hatten Anfang des Jahres das große Haus hier auf Seashell Isle gekauft, diesem künstlichen Inselchen, das ein paar clevere Bauunternehmer einfach mitten im Intracoastal Waterway aufgeschüttet hatten, und da hatte sich die Idee praktisch von selbst ergeben. Howard trug einen weißen Bart, einen grünen Plastikharnisch und goldene Sandalen, Marie ein Kleid, das so teuer war wie ein Segelboot. Noch besser als sie beide zusammen sah jedoch Chachi aus, deren rotes Hummerkostüm neben Schwanz und Scheren sogar eine kleine Kappe mit Fühlern beinhaltete, die aufrecht zwischen ihren Ohren in die Höhe standen.
Howard hatte es zuerst albern gefunden, den Hund zu verkleiden. Doch als er dann in der Dämmerung auf dem Dock stand und die ersten Boote mit Gästen den Kanal runterkamen, der zwischen Tarpon Shores und Amberly Beach in die Lagune führte, hatte er sich mit Chachis Anblick schnell angefreundet. Natürlich hatte sie wieder jeden Neuankömmling wie verrückt angekläfft und ihre hysterischen Runden um die Beine der Verkleideten gedreht. Allerdings veränderte ihr Kostüm die Lage völlig. Plötzlich wirkte das Ganze wie ein beabsichtigter Begrüßungsgag, statt wie üblich ein schlechtes Licht auf seine und Maries erzieherische Fähigkeiten zu werfen, und brach bei jedem Gast das Eis, noch bevor er überhaupt richtig auf der Party angekommen war. Später auf der Terrasse war es dasselbe: Wenn Chachi jemanden ankläffte, wackelten ihre drahtverstärkten Scheren, als wollte sie ihr Gegenüber damit in die Knöchel zwicken, was automatisch für die gute Laune sorgte, die Howard sonst erst mühsam unter seinen Gästen anheizen musste. Der kleine Hundehummer war der absolute Partyrenner, und jeder, der ihn sah, klopfte sich vor Vergnügen auf die Schenkel.
Deswegen schmerzte es Howard umso mehr, dass er ihn jetzt nicht mehr bei sich hatte. Erstaunlicherweise war Chachi, die sonst klug genug war, seine Nähe zu meiden, ihm in seiner Verkleidung als Meeresgott so gehorsam auf dem Fuß gefolgt wie ein Deutscher Schäferhund. Nur eben hatte er den Fehler begangen, sich zu lange mit der hübschen jungen Nixe zu unterhalten, die einer seiner lüsternen alten Freunde mit auf die Party gebracht hatte, und damit vermutlich ihr eifersüchtiges kleines Hundeherz gekränkt. Verzweifelt drängelte sich Howard zwischen einem Tiefseetaucher und einer Piratin durch, suchte den Außenbereich der Terrasse ab, fragte dann eine Auster, ob sie den Hummerhund gesehen habe, und ging schließlich zu Marie hinüber.
»Chachi ist verschwunden«, sagte er, stellte seinen Gummidreizack auf den Boden und wunderte sich einmal mehr, wie man für etwas, das aussah wie aus blauen und grünen Kleiderresten zusammengenäht, so viel Geld verlangen konnte. »Ich kann sie nirgendwo finden.«
»Sie wird in ihrem Körbchen liegen und schlafen«, sagte Marie. »So wie du die ganze Zeit auf dem Dock mit ihr rumgealbert hast, ist sie bestimmt müde.«
»Da hab ich schon geschaut, da ist sie nicht«, erwiderte Howard. »Außerdem würde sie sich niemals schlafen legen, solange hier noch so viele Leute zum Anbellen rumlaufen.«
»Wenn du sie plötzlich so genau kennst, dann geh du sie auch suchen«, sagte Marie. »Vielleicht ist sie ja hinterm Haus und frisst sich an dem Meeresfrüchtebüfett satt, das du zu früh hast in die Sonne stellen lassen. Wenn sie die ganze Nacht kotzt, machst du sauber.«
»Mach ich doch sowieso immer«, grummelte Howard und zog weiter. Er ging auf die rechte Seite des Hauses und versuchte, an der Hauswand entlang nach hinten zu sehen. Doch es war zu dunkel, und im Grunde hielt er den verwöhnten Köter ohnehin für zu wählerisch, um sich mit angegammeltem Fisch abzugeben. Schon wollte er die Suche aufgeben und sich einfach an der Tiki-Bar einen weiteren Drink holen, als er trotz der schallenden Rhythmen der Calypso-Band ein hohes, heiseres Kläffen vernahm.
»Chachi?«, rief er laut. »Chachi, bist du das, meine Kleine?« Natürlich kam keine Antwort, aber sie kläffte weiter. Wen mag sie da wohl anbellen?, fragte sich Howard. Einen Waschbären? Ein bumsendes Pärchen? Einen Einbrecher? Oder einfach nur jemanden vom Partypersonal?
Kurz sah er sich um und überlegte, ob er ein, zwei Matrosen als Verstärkung mitnehmen sollte. Doch dann besann er sich seines göttlichen Status und seines muskelbepackten Brustharnischs und schritt mutig in die Dunkelheit.
Einmal mehr fluchte er darüber, dass an den Seiten des Hauses keine Bewegungslichter angebracht waren. Das struppige Gras kitzelte ihn an seinen halbnackten Füßen, und er hatte höllische Angst, jeden Moment mit seinen ungeschützten Zehen gegen einen Sprinklerkopf zu stoßen. Gerade glaubte er, eins der tückischen Dinger vor sich im Mondlicht glänzen zu sehen, da hörte er ein lautes Rascheln. Es kam aus dem hohen Streifen aus Farnen und Arekapalmen, der das Grundstück zur Lagune hin begrenzte. Erschrocken blickte Howard auf und sah ein Monstrum mit grotesk verformtem Kopf und weit auseinanderstehenden Glubschaugen aus dem Gebüsch hervorbrechen.
»Gütiger Himmel!«, rief er, sprang entsetzt zur Seite und hielt dem Untier seinen Dreizack entgegen.
Das nestelte jedoch nur kurz an seinem Hosenlatz und ging dann wankend davon. Aber klar: Viele Gäste waren natürlich als Figuren aus dem Film mit den toten Piraten gekommen, den alle so toll fanden, und der hier hatte den beängstigend echt wirkenden Latexschädel eines Hammerhais auf dem Kopf. Howard fasste sich ans Herz, das wie rasend hinter seinem Harnisch pochte, und atmete erleichtert auf. »Drinnen sind jede Menge Klos«, rief er dem unerzogenen Gartenpisser hinterher und überlegte flüchtig, ob er ihn von der Party schmeißen lassen sollte. Aber dann drang wieder Chachis Kläffen an sein Ohr, das noch viel hysterischer und erregter klang als irgendwann sonst an diesem Abend, und er setzte seinen Weg fort.
Bei dem Anblick, der sich ihm gleich darauf hinter der Hausecke bot, begann sein Herz jedoch sofort aufs Neue, einen Takt schneller zu schlagen.
Er und Marie hatten den Fehler begangen, den Pool in einen abgelegenen Winkel hinterm Haus versetzen zu lassen, wo ihn nie jemand benutzte. Dort im Mondschein entdeckte er jetzt Chachi: Sie stand breitbeinig vor den hüfthohen Sträuchern, die den Pool vom Rest des Gartens abgrenzten, und kläffte diese aus vollem Leibe an. Natürlich war sie nach wie vor verkleidet, und obwohl ihr Kostüm im fahlen Mondlicht viel von seiner Wirkung einbüßte, sah sie mit ihren wütend wippenden Scheren immer noch zum Schießen aus. Doch ihre weit zurückgelegten Ohren und die schrille Note in ihrer Stimme verrieten Howard sofort, dass sie keineswegs zum Spaßen aufgelegt war. Und auch wie sie hektisch vor und zurück sprang, als könnte sie sonst etwas erwischen, ließ ihn sofort spüren, dass dort etwas Lebendiges im Gebüsch lauerte – ein Eindringling!
Instinktiv senkte Howard seinen Dreizack und ging vorsichtig weiter. »Was ist los, Chachi?«, fragte er im verschwörerischen Flüsterton eines Jägers, der zu seinem Spürhund aufschließt. »Was bellst du denn da an?«
Chachi blickte sich kurz um, sah dann aber sofort wieder nach vorne und ging in ein tiefes Knurren über, zu dem Howard sie gar nicht für fähig gehalten hätte. Verunsichert hielt er inne und betrachtete den Gebüschstreifen genauer. Er bestand vollständig aus irgendwelchen dickblättrigen asiatischen Sträuchern, an deren Namen er sich nie erinnern konnte, und hatte an jedem Ende eine breite Lücke, durch die man zum Pool kam. Er war mehr als einen Meter breit, aber nicht wirklich so hoch, dass sich ein Mensch gut darin verstecken könnte, außer er duckte sich sehr tief auf den Boden oder legte sich sogar flach auf den Bauch.
»Was hast du entdeckt, mein Mädchen?«, flüsterte Howard und nahm den strengen Fischgeruch wahr, der von den Mülltonnen herüberdrang. »Was ist denn da nur?«
Doch ein Einbrecher?, fragte er sich beunruhigt. Aber welcher Einbrecher versteckte sich schon vor einem kleinen Hund in einem Hummerkostüm? Chachis Aggressionen schienen sich speziell gegen einen Strauch zu richten, der am vorderen Durchgang etwas versetzt stand. Howard machte einen Schritt vor, hörte in dem Moment aber ein seltsames Schmatzen und machte schnell wieder einen Schritt nach hinten. Chachi sprang ebenfalls zurück und fing erneut an, aufgeregt zu kläffen. Ohne den Strauch aus den Augen zu lassen, ging Howard ein paar Meter rückwärts und wedelte mit seinem Dreizack hinter sich in der Luft, damit einer der Wandscheinwerfer anging.
Das Licht reichte nicht ganz bis zu dem Gebüsch, trotzdem traten Farben und Konturen sofort viel deutlicher hervor. Aber was dort hinter dem blöden Busch hockte, war immer noch nicht zu erkennen. Es war ausgerechnet der dichteste von allen, und sosehr Howard auch seine Augen anstrengte, er konnte nichts außer einem verschlungenen Wirrwarr aus dunkelgrünen Blättern erkennen. Wieder hörte er das glitschige Schmatzen und war plötzlich überzeugt, eine Schlange lauere hinter dem Strauch. Eine Schlange, von denen es hier in Florida durchaus ein paar giftige gab – und vor der er seinen treuen Jagdhund und die Gäste seiner Party unbedingt schützen musste.
Wenn ich sie mit dem Dreizack ins Licht schleudere und ihr dann ein paarmal kräftig damit auf den Kopf haue, müsste sie erledigt sein. Die vielen Wodka-Martinis, die er im Laufe des Abends getrunken hatte, versicherten ihm, dass es wirklich so wäre. Eine laue Brise trug die fröhlichen Karibikklänge zu ihm herüber, und er malte sich bereits aus, wie er mit dem von den Zacken seiner Waffe hängenden Reptil zurück auf die Terrasse stolzierte.
»Soll ich sie für dich holen?«, fragte er Chachi und trat mutig auf den vorstehenden Strauch zu. »Soll ich die böse Schlange für dich holen, meine Süße?«
Wieder beschleunigte sich sein Puls, und in seinen feuchten Händen fühlte sich der lange Gummistab plötzlich selbst glitschig wie eine Schlange an. Der unangenehme Fischgeruch schien umso stärker zu werden, je näher er dem Gebüsch kam, was sein mulmiges Gefühl irgendwie noch verstärkte. Die Spitze des Dreizacks war jetzt nur noch ein paar Zentimeter von dem Strauch entfernt, und er fragte sich, ob er lieber vorsichtig damit den Boden abtasten oder einfach blindlings zustechen sollte, als plötzlich das Licht ausging.
Chachi sprang jaulend zur Seite. Auf einmal stand er ganz allein vor dem Gebüsch – und sah im jetzt noch fahler wirkenden Mondlicht, wie etwas ganz Unmögliches geschah.
Der Strauch, der viel riesiger war, als es ausgesehen hatte, fiel in sich zusammen und kroch auf seinen Wurzeln davon. Klatschend warf er die dicken Ranken, von denen jede allein so lang war wie eine große Schlange, auf die hellen Steinplatten und zog sich mit ungeheurer Geschwindigkeit daran entlang.
»Was um alles in der Welt?«, murmelte Howard perplex, während das gewaltige dunkle Ding erst im Schatten der Sträucher verschwand und dann laut in den Pool platschte. Er fühlte sich, als sei er von seiner fröhlichen Halloweenparty mitten in irgendeinen bizarren Horrorfilm gestolpert.
»Howard! Was zum Teufel treibst du denn da?«
Den Dreizack weiter aufs Gebüsch gerichtet, drehte sich Howard um. An der Hausecke stand Marie mit zwei Gästen. Doch er antwortete nicht, sondern hastete durch den hinteren Durchgang zum Poolhäuschen und schaltete das Licht ein.
»Kommt her!«, rief er. »Komm schnell her! Hier ist irgendein riesiges ... Tier im Pool. Chachi hat es aufgespürt und ich ... ich ... ich habe es ins Wasser gescheucht.«
Durch seinen erregten Ton alarmiert, eilte Marie mit den zwei Gästen – einem Admiral und einem Angler – sofort herüber. Den Dreizack wieder im Anschlag, stand Howard am Rand des Pools und blickte in das hellerleuchtete Blau. Er hätte gern was mit Whirlpool und Sprungbrett gehabt, aber Marie hatte ihn zu so einer schwulen Jugendstilgeschichte mit Meerjungfrauen, Delfinen und Seepferdchen überredet. Das bunte Bodenmosaik trug nicht gerade zur Übersichtlichkeit des Beckens bei. Trotzdem musste sich Howard nach ein paar Sekunden fieberhafter Suche eingestehen, dass es leer war.
Aber so schnell kann das Vieh doch unmöglich wieder rausgekrochen sein, dachte er verblüfft. Das hätte er gehört. Und außerdem müsste dort am Rand dann alles nass sein.
»Ein Tier?«, fragte der Admiral, der im echten Leben Steuerberater war. »Was war es denn? Ein Frosch? Oder ein Gecko?«
»Nein, etwas Riesiges«, erwiderte Howard unwillig und breitete die Arme aus. »Ich habe es genau gesehen. Da! Da schaut doch, wie der Hund bellt!«
Obwohl der Pool leer, stand der kleine Hundehummer am Rand und kläffte aufgeregt ins Wasser. Howard lief bei dem Anblick ein kalter Schauer über den Rücken. Marie jedoch schien er nicht sonderlich zu beeindrucken.
»Chachi ist total überdreht«, sagte sie, und nahm das kläffende Hündchen auf den Arm. »Und du bist anscheinend stockbesoffen. Kommt, wir verschwinden, dieser Gestank ist ja nicht zum Aushalten. Und du, Howard, mach wieder das Licht aus. Sonst kommt noch jemand auf die Idee, schwimmen zu gehen.«
Damit machte sie sich mit den anderen wieder auf den Weg Richtung Party. Howard sah erneut in den leeren Jugendstilpool hinab.
Aber ich bin doch nicht verrückt, dachte er verwirrt. Klar, das Licht war nicht gut gewesen, und er hatte ziemlich einen sitzen. Aber deswegen bildete er sich doch nichts ein!
Während er dastand und sich um seinen Geisteszustand sorgte, stieg jedoch plötzlich ein anderes Gefühl in ihm hoch. Auf einmal fühlte er sich ... beobachtet, und wie aus dem Nichts begann sein Herz heftiger zu rasen als je zuvor. Er blickte zum Haus, wo die anderen gerade um die Ecke bogen, daraufhin aber sofort wieder zum Pool zurück, in dem er aus dem Augenwinkel heraus eine winzige Bewegung wahrgenommen zu haben glaubte. Dann ging er schnell zum Poolhäuschen, schaltete mit zitternden Fingern das Licht aus und eilte dem sich entfernenden Kläffen Chachis hinterher auf die Terrasse.
KAPITEL 4
Am Morgen nach Halloween hatte Steven einen ziemlich dicken Schädel, aber auch ein paar hübsche Erinnerungen mehr. Um den Tag nicht zu stressig anfangen zu lassen, begann er ihn damit, Herb eine kleine Extrabelohnung für die gute Leistung zu spendieren, die er gestern gezeigt hatte: Er holte ein paar Garnelen aus dem großen Futterkühlschrank neben seinem Schreibtisch, taute sie auf, schraubte dann die Abdeckung von Herbs Aquarium ab und rollte seinen Stuhl vor den großen grünen Wasserbehälter. Er hatte gerade die ersten zwei Garnelen geschält und zu Herb ins Wasser geworfen, als es an der Tür klopfte und Dekan Duffy eintrat, ohne ein »Herein« abzuwarten.
»Hallo Schuster, ich war vorhin schon mal da. Aber da hatten Sie’s wohl noch nicht hergeschafft.«
»Nein, ich ... ähm, hatte mal wieder Probleme mit meiner alten Karre. Die Batterie, das feuchte Klima, Sie wissen ja, wie das ist.«
»Und ich dachte schon, Sie hätten die Verlängerung Ihres Stipendiums gefeiert. Danach sehen Sie jedenfalls aus.«
»Ich, ähm, nein. Natürlich habe ich mir schon gedacht, dass ... aber ... ich ...«