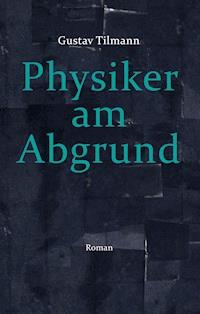
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein dramatisches und tragisches Wechselspiel zwischen Fiktion und Realität, in welchem die Inszenierung des Theaterstücks „Die Physiker“ in einer Haftanstalt noch die verlässlichste Ebene der Realität darstellt, beherrscht den Regisseur dieser Inszenierung, Franz Brix, ein ehemaliger Deutsch- und Theaterlehrer, der wegen eines Tötungsdelikts zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt ist. Das berühmte Theaterstück von Friedrich Dürrenmatt, das er mit vorwiegend jüngeren Häftlingen auf die Gefängnisbühne bringen will, besteht für ihn jedoch selbst aus trügerischen Wirklichkeiten. Es kreist, als Komödie getarnt, thematisch um den existenziellen Abgrund der Menschheit, vor dem auch Franz Brix gestanden hat. Die Liebesgeschichte zwischen Johannes, einem jugendlichen Häftling, der die Rolle des Physikers Möbius spielt, und der Sozialarbeiterin Vanessa, der Trägerin einer weiblichen Hauptrolle, bildet den anrührenden Rahmen, in welchem Franz Brix sich den Hintergründen seines eigenen Schicksals und dem seines toten Sohnes stellen muß.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meinem Sohn Jan gewidmet
Dank schulde ich meiner Familie für ihre Unterstützung, Randolph Hennig für das Lektorat, sowie Claudia Rouvel und Rudolf Wenzel für ihre literarische Beratung.
Alle kursiv gesetzten Passagen
sind Originalzitate aus dem
Textbuch “Die Physiker“,
Diogenes Verlag AG Zürich, 1998,
bei dem ich mich für die Genehmigung bedanke.
„Heute, bei einer flackernden Kerze in lauer Nacht und einem Glas Rotwein, schreibe ich dir von einer Insel, einer wirklichen, die dennoch ein Ort ist von zweifelhafter Realität. Die Gedanken, die sich hier einstellen, neigen zu einer Absolutheit, so als gäbe es nicht den geringsten Zweifel daran, dass die Dinge so und nicht ganz anders sind. Trotzdem kommt es einem so vor, als könne dies alles im nächsten Augenblick verschwinden. Es haftet der Insel etwas eigentümlich Momentanes an, so als existiere sie nur in der Gegenwart. Der Boden, auf dem man steht, ist zwar felsig, aber man weiß nicht, ob er tragfähig ist.“
Aus einem Brief von Franz Brix an Hanna
„Der Zufall in einer dramatischen Handlung besteht darin, wann und wo wer zufällig wem begegnet.“
Friedrich Dürrenmatt in 21 Punkte zu den „Physikern“, seinem berühmten Theaterstück, das in diesem Roman eine Hauptrolle spielt.
Der Pfad am Rand der Klippe, die durch Abbruch überhängender Felsen entstand, war nichts für ängstliche Menschen. Schwindelfrei sollte man schon sein. Das Meer fraß sich seit undenklichen Zeiten in die Sockelmasse der Insel. Immer wieder riss dann der Überhang ab, stürzte mit Getöse in die Tiefe und hinterließ, schweigend, eine neue Kontur in jenem fast halbkreisförmigen Verlauf der Klippe, die auf diese Weise irgendwann zu einer großen Bucht werden würde, mit einem Sandstrand und dem Bett eines steinigen Baches, der sich von den Höhen des felsigen Hügels hier ins Meer ergießen konnte.
Der Trampelpfad, der jetzt noch an der gefährlichen Klippe entlang führte, würde ebenfalls eines Tages verschwinden. Er war eine Herausforderung, denn wer ihn benutzte, konnte auf keinen Fall sicher sein, dass der Boden nicht gerade in diesem Augenblick in die Tiefe stürzte.
Franz Brix blickte, als er diesen Pfad betrat, in die Tiefe und dachte an Hölderlins Gedicht Hyperions Schicksalslied, dessen Versanordnung an eine überhängende Klippe erinnerte und vom Sturz der Menschheit in die Schicksalstiefen handelte. Gewaltige Wassermassen schäumten zwischen den aufgetürmten Felsbrocken auf und vereinigten sich, von magischer Kraft gezogen, wieder mit der türkisfarbenen, ultramarinblauen Weite des Meeres.
Brix befand sich auf einer Küstenwanderung, die ihn häufig von einer der bekannteren Badebuchten im Nordosten der Insel zu jenem ehemaligen Wehrturm führte, auf dessen nur über einen schmalen dunklen Gang und einige felsenartige Treppenstufen erreichbare Terrasse eine alte, wie von einem Piratenfilm übrig gebliebene Kanone lag. Immer wieder fragte er sich, wem die letzte Kugel aus diesem rostigen Rohr gegolten hatte und wann sie abgefeuert worden war. Brix mochte diesen Weg, weil das Meer bei jedem Schritt an seiner Seite war, und er spüren konnte, wie es atmete.
Sein eigener Atem war ihm dagegen eine Last.
Er dachte an die Anfänge der europäischen Theatergeschichte, die antike griechische Tragödie, in der die Helden durch Sühne einer Schuld, die sie nicht selten für andere, Vater, Mutter, Schwester oder Bruder leisten, erneut Schuld auf sich laden. Die Zuschauer erlebten diese Verkettung als Katharsis, eine Art Zusammenbruch oder Fassungslosigkeit, den Moment, in welchem die Einsicht in die Unausweichlichkeit der widersprüchlichen Schicksalsbestimmungen sich reinigend in ihrem eigenen Bewusstsein ausbreiten konnte.
Gnade kennt die Welt der Tragödie, der Verstrickung in immer neues Unheil, nicht. Ödipus zum Beispiel erschlägt ahnungslos seinen Vater und heiratet als König von Theben, ebenfalls ahnungslos und weiteres Unheil vorbereitend, seine Mutter Jokaste.
In diesen Tragödien kannte sich Brix als plötzlich aus der Bahn geworfener Deutschlehrer und Theaterpädagoge gut aus. Jetzt hatte er viel Zeit, sich daran zu erinnern.
Er hatte sich für seinen unbestimmt langen Aufenthalt auf der Insel ein abgelegenes Anwesen gemietet, vor dem an diesem Morgen mit wolkenlosem Himmel zwei schwarze Limousinen halt machten. Brix hatte sie vom Patio aus schon eine Weile im Blick gehabt, wie sie sich in der Ferne lautlos durch die verkarstete Hügellandschaft schlängelten. Einige dunkel gekleidete Männer mit Sonnenbrillen stiegen aus und bewegten sich rasch auf den Eingang des Wohnhauses zu. Unter ihren schwarzen Schuhen knirschte verhalten der Belag aus kleinen Stücken gelblich-rötlichen Marésgesteins.
Brix öffnete die Tür und grüßte in katalanischer Sprache „Bon dia.“
Die Männer sahen sich im glatt gefliesten Flur mit der schweren Truhe und den darauf angeordneten Familienfotos um. Einer folgte Brix ins Schlafzimmer, wo dieser ohne Nervosität seine wenigen Kleidungsstücke in die Reisetasche packte. Aus dem Bad, wo die Sonne, widergespiegelt von der Wasseroberfläche eines kleinen Pools hinter dem Haus infolge der Schlitze im Persiana-Fensterladen Streifen an die Balkendecke zeichnete, holte er seine dortigen Utensilien.
Dann nahm er von Regal und Schreibtisch zwei, drei Bücher und Manuskripte, die er seitlich in die Tasche steckte. Die Herren in Sonnenbrillen schienen nervös zu werden und beobachteten argwöhnisch, dass er noch einmal zurück ging, um einen Brief, den er auf der Tischfläche übersehen hatte, zu zerreißen und in den Papierkorb zu werfen.
Die Männer begleiteten Brix, nachdem sie die Schnipsel sorgfältig wieder zusammengesammelt und mit einem missbilligenden Blick und Kopfschütteln lose in eine Mappe gelegt hatten, nach draußen. Sie hielten sich vor und hinter ihm, bis sie die Autos erreichten. Die samtenen Klapp– und Sauggeräusche der Autotüren erfüllten für wenige Sekunden die Luft, deren schnelle Erwärmung im Laufe des Vormittags schon spürbar wurde. An Palmen, Pinien und Steineichen vorbei befand Franz Brix sich auf dem Weg in den spanischen Polizeigewahrsam, von wo er nach dem Fahndungserfolg von Interpol nach Deutschland überstellt werden sollte.
„Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden.“
Und was einmal getan wurde, erst recht nicht, dachte Franz Brix bitter, während seine Augen aus ihren Faltennestern jede Bewegung und das Minenspiel des jungen Schauspielers verfolgten.
„Der linke Scheinwerfer muss etwas ´runter gefahren werden“, rief er dem Beleuchter auf der Galerie zu, „es darf nicht so grell sein, das Licht, das Johannes´ Gesicht hervorhebt – ja, so ist es besser! Und nun musst du in dieselbe Richtung blicken, in die du sprichst, also leicht nach unten. Man soll deine Augenlider fast so sehen, als hättest du die Augen geschlossen. Du darfst nicht ganz so resigniert wirken wie eben, die Schultern nicht so weit nach vorne fallen lassen, wie du es eben gemacht hast. Das ist dein wichtigster Satz, Johannes. Da muss alles stimmen. Aber es war schon viel besser jetzt. Wir machen die ganze Szene noch mal, bitte. Vom Abgang des Fräulein Dr. von Zahnd und ihrer Bodyguards an.“
Dann fügte er hinzu: „Und Ihr beiden, ihr müsst euch am Anfang der Szene so aufstellen, dass ihr mit Johannes eine schräge Linie bildet, das ist dynamischer und man kann euch alle noch gut von jedem Platz aus sehen!“
Thomas und Sven, in den Rollen des Sir Isaak Newton und Albert Einsteins, nickten.
„Dann auf ein Neues!“
Thomas blickte auf seine Mitspieler und drehte den Kopf langsam zum Publikum. Dann schlurfte er zu dem waagerechten Balken, der ein Sofa darstellte, lehnte sich mit dem Gesäß dagegen und sagte wie zu sich selbst:
“Es ist aus.“
Sven war als Albert Einstein nun an der Reihe und sagte:
„Die Welt ist in die Hände einer verrückten Irrenärztin gefallen.“
Sven und Thomas standen nebeneinander und stierten mit leicht gesenktem Kopf nach vorn. Nun war Johannes an der Reihe und bemühte sich, alles richtig zu machen.
Mit klarer Stimme, aber aus einer resignierten Grundhaltung heraus, stellte er fest, dass es zwecklos ist, Gedachtes vor der Welt geheim halten zu wollen.
Johannes spielte den Physiker Möbius, dessen Versuch, das einmal Gedachte durch Verstecken der Manuskripte hinter der Fassade eines Geistesgestörten von der Menschheit fern zu halten, gescheitert ist. Die vorgespielte Geistererscheinung des König Salomon, der ihm, dem Physiker, angeblich die Naturgesetze, den Zusammenhang aller Dinge, das System aller möglichen Erfindungen, kurz: die berühmte Weltformel diktiere, ist aufgeflogen. Die Anstaltsleiterin, einzig Überlebende eines degenerierten Adelsgeschlechts, ist entschlossen, mit Hilfe der heimlich kopierten Manuskripte, als einzige und echte Verrückte in diesem Sanatorium, die Weltherrschaft anzutreten.
„Es ist jetzt noch viel besser gewesen, Johannes! Bevor du heute Nacht einschläfst, mach Dir noch mal bewusst, wie du es gemacht hast. Die Koordination von Körperhaltung und Mimik, die Rolle des Bühnenscheinwerfers, der dein Gesicht in dieser Szene sehr stark zeichnet und so weiter. Du wirst sehen, bei der nächsten Probe wird es noch besser!“
An alle gerichtet, sagte Brix:
„Danke schön, danke euch! Ach, Sven, wenn du ´rüber gehst zu dem Balken, dann bitte nicht Thomas ansehen, sondern ohne Kontakt zu ihm dich rumdrehen, anlehnen und nach vorn gucken, parallel zu seiner Blickrichtung. So – habt ihr noch was, sonst machen wir für heute Schluss. Wir müssen auch aufhören wegen der Dienstpläne von Frau Nicolai, oder besser, denen von Herrn Nicolai. Außerdem ist jetzt Abendessen.“
„Ja, ich würde gern mit Ihnen noch etwas klären“, sagte Johannes.
„So, um was geht es?“
„Ist was Persönliches!“
„Also gut, wir treffen uns nach dem Essen beim Umschluss im Aufenthaltsraum C!“
Dann verließen alle den Theaterraum, eigentlich eine kleine, renovierungsbedürftige Turnhalle, die für dieses Theaterprojekt jetzt eine kulturelle Funktion erhielt. Er knipste das Licht aus und als Orhan, der Beleuchter, an ihm vorbei kam, gab er ihm einen anerkennenden Klaps auf die Schulter,
„Bin froh, dass du bei uns mitmachst.“
„Ist schon gut, Doc, hab‚ ja auch was davon, ist eben nicht alles voll Scheiße hier.“
Dann machte Brix die Tür zu und drehte den Sicherheitsschlüssel, der mit zwei Bärten seitlich am Schaft ausgestattet war, in dem dafür vorgesehenen Schlitz um. Danach ließ er ihn in die Tasche gleiten, von wo eine Kette bis an seinen Gürtel führte. Dort war auch eine kleine Plastikhülle angebracht, in der sich eine rote Karte befand.
Inhaber einer roten Karte konnten sich im Haus und Gelände frei bewegen, um besondere Aufgaben wahrzunehmen. Insassen mit diesem Privileg galten als vertrauenswürdig, zuverlässig, und waren mit dem Prädikat „ gute Führung“ in den Akten ausgestattet.
Der Weg zur Kantine führte Brix am Freigelände der Untersuchungshäftlinge vorbei, das mit Nato-Stacheldraht auf dem Gitterzaun innerhalb der Haftanstalt gesichert war, und nun in einem schmutzigen Dämmerlicht dalag. Entlang an der grau verschossenen Außenmauer zu dem kleinen Tor, hinter dem der Weg in die Freiheit lag, falls man am Ende einen Entlassungsschein vorweisen konnte.
Brix dachte in diesem Augenblick, als er beim verantwortlichen Schließen der Tür zum Kantinengebäude sich selbst einschloss, an Johannes. Was wollte er mit ihm Persönliches besprechen? Im Gefängnis sind fast alle Angelegenheiten, die auch alle anderen betreffen, nur allzu schnell persönlich, denn das Persönliche, ging ihm durch den Kopf, ist verstümmelt und auf das Allgemeine reduziert, wie in diesem Augenblick, wenn er sich wie jeder andere anstellen musste für die Essensausgabe aus einem allgemeinen Topf, bei dem es keine Rolle spielt, ob es dir schmeckt oder nicht.
Hoffentlich ist bei Johannes nicht etwas im Gang, was seine Mitwirkung an dem Theaterprojekt gefährden könnte, grübelte Brix. Er ist kein einfacher Mensch, liebenswert zwar mit seinen klein wirkenden braunen Augen, mit denen er einen ansieht und die häufig ein wenig belustigt auf seinem Gegenüber ruhen. In seinem Innern spielt sich mehr ab, als sein anpassungsfähiges Auftreten vermuten lässt, dachte Brix.
Er kannte Johannes schon seit dessen Einlieferung vor knapp einem Jahr, als er mitbekam, wie Johannes sich zunächst gegen gar nichts auflehnte, alles mit sich geschehen ließ, wogegen junge Insassen sich häufig so lange zur Wehr setzten, bis sie genug Härte von Seiten des Bewachungspersonals zu spüren bekamen. Dann aber tobte Johannes sich völlig überraschend in einem Wutanfall an dem schweren Eisengestell des Bettes in seiner Zelle so heftig aus, dass die Längsholme verbogen und die Beine teilweise aus der Senkrechten geknickt waren. Diese Attacke galt als eine der schlimmsten Sachbeschädigungen in der letzten Zeit, wobei niemand Johannes diesen überaus massiven Krafteinsatz zugetraut hätte. Das „Accessment“ genannte, gefängnisinterne Verfahren für die Eingangsbeurteilung eines Insassen scheiterte bei Johannes erst einmal daran, dass die Bereitwilligkeit, Kreuzchen auf einen Fragebogen zu machen, mit der Kompliziertheit seiner mündlichen Aussagen kollidierte. Es war für die Gefängnisleitung nicht zu erkennen, ob er geeigneter für das berufsqualifizierende Programm in einer der Werkstätten war oder besser in die beruflich indifferente Künstlerwerkstatt passte oder aber sogar einem reinen Beschäftigungsprogramm zugeführt werden sollte, das zum Beispiel aus dem Verpacken von Jutetaschen für den Transport zu den Abnehmerfirmen bestand, wo diese in der Anstalt hergestellten Produkte vermarktet wurden. Wenn Johannes direkt gefragt wurde, was er, im jungen Leben erst einmal gescheitert, jetzt aus sich machen wolle, sagte er: „Das ist mir egal“.
„Was war das denn?“, mit dieser Frage stellte der Vater Johannes zur Rede, nachdem eine Lehrerin des Lessing-Gymnasiums sich die Mühe eines persönlichen Hausbesuchs gemacht und den Vater zu besserer Kontrolle seines schulschwänzenden Sohnes ermahnt hatte.
“Ich hatte keine Lust, bin ja viel älter als die anderen in der Klasse. Weil ich ja erst mit sieben in die Schule kam“, erklärte Johannes bündig.
„Noch lange kein Grund, sich auf der Straße herum zu treiben, ja!“
Die Lautstärke des Satzes schwoll an, beim Ja!“ brüllte der Vater und versetzte Johannes einen Schlag mit dem massigen Handrücken ins Gesicht. Aus der getroffenen Nase tropfte Blut. „Warum hast du mich nicht bei Mama gelassen damals“, schrie Johannes zurück, während er sich das Blut mit einem Stück Toilettenpapier abtupfte und die Nase hochzog.
“Wirf es in den Abfalleimer!“ befahl der Vater.
„Kannst von Glück reden, dass ich nicht zurück gehauen habe“, raunzte Johannes und blickte am Vater vorbei auf die verschossene Tapete, die mit grünen und braunen Hufeisenformen auf gelblichem Untergrund gemustert war. Um den Lichtschalter an der Tür gingen diese Farben in ein schmutziges Dunkelgrau über. Am Türrahmen klebte ein gelber Zettel, auf dem eine Geldsumme, ein Datum und eine Telefonnummer vermerkt waren. Vom Fenster aus konnte man auf die Seitenfläche eines Nachbarbalkons sehen, über der einige sparsam beblätterte Stängel einer Pflanze hingen, deren Vorfahren einst zur Flora eines Regenwaldes gehört haben mochten. „Das war noch gar nichts!“ brüllte der Vater wieder. „Wenn ich dich beim Schwänzen erwische, bekommst du es mit mir zu tun, du wirst mich kennen lernen, Früchtchen! Was glaubst du wohl, warum ich mir den Arsch aufreiße, für wen wohl, he?“
Der Vater arbeitete bei einer Baustoffhandlung als Fahrer eines Gabelstaplers, wofür er durch eine Umschulungsmaßnahme des Arbeitsamtes qualifiziert worden war. Gelernt hatte er Fliesenleger, konnte aber wegen eines Bandscheibenvorfalls nicht mehr in diesem Beruf arbeiten. Aber auch jetzt, in diesem Beruf, kam er meistens mit Rückenschmerzen nach Hause und war schon deswegen fast immer übel gelaunt, was seine Neigung zur Argumentation mit den Fäusten noch unterstützte.
Johannes schob beim Aufstehen den Stuhl zurück, auf den er sich kurz gesetzt hatte, um sich besser um seine Nase kümmern zu können, griff seine Jacke, die Mütze hatte er bereits auf dem Kopf und verließ schlurfend die Wohnung. Die Treppengeräusche prallten wie in einer Squash-Anlage von einer Wand zur anderen, als er die beiden Absätze heruntersprang.
Die Haustüre war noch nicht wieder in ihren Rahmen zurückgeschnappt, da war Johannes bereits vorne an der Straße angekommen, steckte die Hände in die Jackentasche und bewegte sich jetzt schlurfend in Richtung Katharinenplatz. Dort wartete Mehmet. Sie hatten sich per SMS verabredet.
„Was ist los, du machst Scheißgesicht“.
„Mein Vater hat Stress gemacht wegen Schule schwänzen“.
„Alter, hau doch ab!“
„Nee, geht nicht wegen Kohle und so.“
„Kannst selbst genug haben. Weiß was?“
„Was?“
„Da is so´n neuer Handyladen, Kumpel von mir. Eigentlich von mein Bruder, aber der is ok, kann ihn ablenken mit Fußballthema oder so. Cutter hab ich mit, ok?“
Johannes ließ sich, wie schon so oft, wieder darauf ein. Es lief alles ohne Probleme. Er schaffte drei in Verpackung. Brauchte nur die Kabelbinder am Regal durchzuschneiden und schnell die Nachbarschachteln ein wenig zu verschieben, dass keine große Lücke entstand. Mehmet hatte sich über die Sportseite einer türkischen Zeitung gebeugt und den Verkäufer, ein Mann von vielleicht dreißig Jahren, mit türkischen Kommentaren zu dem, was in dem Artikel zu lesen war, angelockt. Gemeinsam vertieften sie sich, auf die Ellenbogen gestützt, in die Zeitung.
„Was ist mit dein Fußball, hast mal wieder kein Tor geschossen?“ lachte Ali und kraulte freundschaftlich Mehmets Locken. Johannes hatte keine Lust, darüber nachzudenken, was an Ali hängen bleiben wird, wenn der Diebstahl herauskommt. Sie unterhielten sich nicht über Folgen oder Ursachen.
„Mittwoch bring ich dir Geld mit, jetzt lass uns allein gehen, abhauen“, lachte Mehmet versteckt.
Nachdem sie sich getrennt hatten, lief Johannes ohne bestimmtes Ziel in der Stadt herum.
Es waren keine großen Entfernungen zwischen den Kaufhäusern, die er durchstreifte, und der Steinbank, wo er schließlich landete, am Rande des Flusses.
Er setzte sich und zog die Beine an, um die Fersen auch noch auf der Betonbank unter zu bringen. Er umschlang seine Knie und schaukelte leicht vor und zurück. Ohne besonderes Interesse blickte er den Passanten, die an ihm vorbeiliefen, hinterher. Ein kleines Ausflugsboot, auf dem ein Fest gefeiert zu werden schien, tuckerte an ihm vorüber.
Auf der anderen Seite des Flusses quoll aus einem Schlot eine gelblichweiße Dampfwolke. Am Ufer harrten einige Angler aus, denen er gelangweilt zusah
Seine Nase schmerzte noch immer.
Da er bereits schon einmal sitzen geblieben war, musste er das Gymnasium schließlich verlassen. Er hatte es nur noch selten von innen gesehen und schon gar nicht pünktlich zu Beginn des Unterrichts. Die Polizei war seinetwegen mehrere Male sowohl in der Schule als auch zu Hause aufgetaucht und der Vater wurde immer gewalttätiger.
Johannes versuchte es auf der Hauptschule und nahm sich vor, dort wenigstens den erweiterten Abschluss zu machen. Da aber auch das nach einigen Monaten scheiterte, weil er das große Unbehagen in sich nicht bändigen konnte und wieder dem Unterricht fernblieb, war auf diese Weise weder an eine Lehrstelle, noch an irgendeine andere Fortsetzung der traurigen Schulzeit zu denken.
Auf einer Geburtstagsfete in der Clique, zu der auch Mehmet gehörte, betrank sich Johannes, kiffte und lachte.
Am frühen Morgen torkelte er mit einigen anderen grölenden jungen Leuten auf die Straße. Mehmet prahlte:
„War blöd, aber hab ich gemacht – hier!“, und zeigte Johannes zwei Handys.
„Wo hast du die her?“ herrschte Johannes ihn an.
„Von dem Geburtstagskind, der braucht doch nicht drei!“
„Hast ihm die geklaut, Mann?“
„Hab ich mitgehn lassen, ist besser.“
„Du Schwein, - so was - gehört sich nicht, Freunde beklauen“, lallte Johannes. „Du bringst die wieder hin, morgen, Alter, sonst - sind wir - auseinander, du Arsch, und ich klau- nix mehr mit Dir!“
„Fick dich!“
Eine andere Gruppe Jugendlicher, die sich auf der anderen Straßenseite bewegte und im fahlen Morgenlicht wie ein zottiger, müder Hund wirkte, wurde von Johannes lautem Geschimpfe und dem gebrüllten „Fick dich!“ von Mehmet wieder wach, und einer äffte Johannes nach: „… sonst sind wir - auseinander und ich klau- nix mehr mit dir, du Arsch.“
Da wurde Johannes ganz ruhig und sagte zu einem aus seiner Clique:
„Gib mir mal deinen Schläger“.
Gleichzeitig griff er ihm in die offene Bomberjacke und zog ein Metallrohr heraus, an das eine kräftige Zugfeder geschweißt war. Vorne war diese mit einem angespitzten Flacheisen bestückt. Damit lief er über die Straße, griff ohne zu überlegen den Nächstbesten an, schlug ihm mit dem Todschläger auf die Nase und die Augen.
Der Junge stürzte sofort zu Boden und es bildete sich eine Blutlache, in der sich schemenhaft einige fantasielose Hausfassaden spiegelten.
Johannes saß bereits mit angezogenen Beinen auf einem Tisch an der Wand und wartete. Er blickte vor sich auf den Boden, wo einige Schalen von Sonnenblumenkernen verstreut waren. Er wippte kaum merklich vor und zurück.
Einige andere Insassen kamen und gingen, setzten sich hierhin und dahin, spielten Karten oder schwiegen sich an und drehten ihre Kugelschreiber zwischen den Fingern.
Lieber wären ihnen Feuerzeuge gewesen, argwöhnte Brix, als er Johannes mit einem freundschaftlichen Klaps auf die Schulter begrüßte und sich setzte.
„Was ist los?“
Johannes sagte nichts, wippte weiter vor und zurück und blickte auf den Älteren schräg unter ihm. Er wusste nicht, wie er anfangen sollte.
„Na, komm schon, raus mit der Sprache!“
„Es – geht um - Vanessa.“ Pause. „Ich meine, es geht eigentlich nicht um sie, sondern es geht um sie und mich.“ Er rutschte vom Tisch und nahm sich einen Stuhl.
„Vanessa ist –“
„Ich weiß, - du magst sie.“
Johannes blickte ihn starr an.
„Ich bin - “
„Ich hoffe, du machst keine Dummheiten, Johannes!“
„Nein, mach ich nicht -, aber könnten wir-,“
„Was?“
„- die Rolle umbesetzen? – Ich will den Möbius nicht mehr spielen, ist sowieso nichts für mich, so ein Weltverbesserer.“
Brix spürte den inneren Kampf, die Hartnäckigkeit des Jungen, seine Anstrengung, sich richtig zu äußern, die seinem eher sanften Blick jetzt etwas Hartes verlieh. Er bemühte sich, diesem unbeweglichen Blick nicht auszuweichen. Zugleich merkte er eine Unruhe in sich aufsteigen, ein Gefühl des Versagens, Angst, dass sich die letzte Chance, ein trostloses Gefängnisleben wenigstens zeitweise wie in ein Leben jenseits dieser Mauern, jenseits des Verbrechens zu verwandeln, in Hoffnungslosigkeit auflösen könnte. Er dachte einen kurzen Moment an Falk, seinen Sohn, der in manchem Johannes sehr ähnlich war. Wenn er, Johannes, vom Scheinwerferlicht aus der Dunkelheit der verfallenden Turnhalle herausgehoben wurde, sah er eine Ähnlichkeit mit Falk mit seiner Sanftheit, einer gewissen Kühnheit, die sich mit den heiteren braunen Augen und den geschwungenen vollen Lippen zu einer idolhaft jugendlichen Erscheinung vereinigten. Ein tiefer Schmerz meldete sich. Er atmete durch und sagte zu Johannes:
„Bitte gib dir und uns eine Chance. Vanessa spielt die Schwester Monika so eindrucksvoll und du den passenden Möbius dazu. Es ist toll, euch so zu erleben.“
Johannes antwortete einsilbig: „So.“
Brix war sich bewusst, dass er Johannes keine Vorhaltungen machen konnte, wenn er jetzt wegen einer Verliebtheit alles hin schmeißen würde. Es wäre das Aus für ein Theaterprojekt, das nicht nur das größte Vertrauen beiderseits der Gittertüren mit den ewigen Schlössern voraussetzte, sondern dass es wegen der weiblichen Rollen, die auch nur mit Ihresgleichen besetzt werden konnten, ein besonders großes Entgegenkommen der Gefängnisleitung bedeutete, diese Rollen von Bediensteten der Haftanstalt spielen zu lassen.
Wahrscheinlich war Johannes sich dieses seltenen unbürokratischen Entgegenkommens, des Überspringens der üblichen Denkbarrieren und Verwaltungsvorschriften seitens des Direktors gar nicht bewusst, sagte sich Brix. Nur diesem Entgegenkommen war ja die Arbeit an einem Theaterstück im Knast, eine oder mehrere Aufführungen, anstaltsöffentlich aber auch außerhalb der Gefängnismauern, zu verdanken. Erworbene Privilegien stünden für die ganze Truppe möglicherweise auf dem Spiel. Wegen eines prekären Liebesverhältnisses, vor dessen möglichem, ja sogar wahrscheinlichem Auftreten die Anstaltspsychologen ihn, Brix, gewarnt hatten. Dies war auch der entscheidende, nahe liegende Einwand der Gefängnisleitung gegen das Mitwirken von Insassen aus dem streng abgeschotteten Frauentrakt der Haftanstalt. Die Furcht vor unkalkulierbaren Komplikationen führte schließlich dazu, für diese Rollen weibliche Bedienstete zu gewinnen.





























