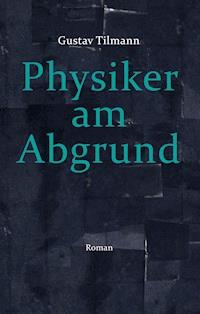Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Schwestern Agnes und Pauline verkaufen ein großes Gemälde ihrer Mutter, einer kaum bekannten, bereits verstorbenen Malerin, an eine Kunstgalerie. Dabei geraten sie an einen Betrüger, der sie zusammen mit einem Komplizen übervorteilen will. Sie hecken einen Plan aus, um dem Galeristen und seinem Spießgesellen ein Schnippchen zu schlagen. Nach monatelangen Vorbereitungen, die von Erinnerungen an ihre Mutter und den Vater begleitet werden, beginnen Agnes und Pauline zusammen mit Helfern aus Familie und Freundeskreis eine gewagte, abenteuerliche Aktion.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 111
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Liv
Ina und Julia
„Dies ist vielleicht das schönste Bild in unserer Sammlung“, sagte die schmächtige Museumsführerin, Claudia Würm und ihre dunklen Augen funkelten einen Moment der Begeisterung hinter ihrer Gleitsichtbrille.
„Schauen sie sich diese großartige Verbindung von Natur und Symbol an, die Schlichtheit der Bildsprache und das geheimnisvolle Beziehungsgeflecht, welches sich hinter der Ebene des Sichtbaren verbirgt. Es ist ein sehr großes Bild im Verhältnis zur wahren Größe der Lebewesen, Hennen und Gockel, die hier dargestellt sind.“ Sie legte eine bedeutungsvolle Pause ein. Mit einem schelmischen Gesichtsausdruck und erhobenem Zeigefinger, der zum gläsernen Dach der Gemäldegalerie zeigte, von wo die Helligkeit eines spätsommerlichen Vormittags diesig in den Saal drang, erklärte sie:
„Ich selbst habe kürzlich auf Mallorca einen urigen Geflügelgarten gesehen, wo auf schotterigem, mit Körnern übersätem Boden diverse Hühner, Hähne, Truthähne und alle möglichen Gänse friedlich durcheinander spazierten. Mich hat dieses Bild so an diese Szene erinnert, als hätte die Malerin hier einen Ausschnitt davon erfasst. Die erdig gedeckten Farbtöne des Bodens, auf dem frech das Weiß der Hühner mit ihren roten Kämmen steht, könnte der Boden jenes Gartens gewesen sein und der Hahn, der Gockel, stand ebenso dominant, aber auch einsam zwischen den Hennen, wie ich es auf Mallorca gesehen habe.“
„Darf ich mal fragen, in welcher Gegend Mallorcas dieser Hof war?“
„Es war glaube ich, in der Gegend von Capdepera auf dem Weg nach Font de sa Cala. Dort befindet sich eine sehr kleine, versteckte Bucht, die ich während meines Urlaubs gern aufgesucht habe.“
„Aha, ja, ja Capdepera, die Gegend kenne ich auch recht gut, danke schön. Es gibt so einen Hof, wie Sie ihn beschreiben, stimmt. Wie interessant.“ Damit schien die Neugier der Zuhörerin, die mit ihrer Frage die Ausführungen der Museumsführerin unterbrochen hatte, erst einmal befriedigt. Sie stand einen Moment wie abwesend in der Gruppe und lächelte. “Ja, es gibt diesen Hof, ich erinnere mich“, sagte sie dann wie zu sich selbst. „Er ist ziemlich dreckig, stimmt´s?“
„Ja, richtig“, antwortete Claudia Würm überrascht und sichtlich erfreut über den wohltuenden Austausch von gemeinsamen Erfahrungen jenseits der Kunst, deren museale Entrücktheit bei ihr immer häufiger ein wenig Atembeklemmungen verursachte, so gerne sie sich auch in den verbalen Höhen der Kunstvermittlung bewegte und die meist vorbehaltlose, schweigende Aufmerksamkeit der Zuhörer genoss.
„Ist Ihnen aufgefallen, dass die drei dargestellten Hennen im unteren Teil des Bildes angesiedelt sind, während der Gockel in der oberen Hälfte dargestellt ist? An diesen bildnerischen Sachverhalt lassen sich viele Deutungen knüpfen, von denen einige sich Ihnen sicherlich sofort aufdrängen. Vor allem, wenn man weiß, dass es ein kleines Pastell mit dem selben Motiv gibt, auf dem die drei Hennen nicht in ihrer Gänze zu sehen, sondern durch die Bildränder unten und seitlich angeschnitten dargestellt sind.“ Mit dieser Ausführung wandte sich die Kunsthistorikerin wieder ihrer Aufgabe zu. „Gerne wird hier in der Interpretation zum Beispiel die ironische Metaphorik in den Vordergrund gestellt, durch die dem Hahn eben die gesellschaftliche Rolle gewissermaßen eines Gockels eingeräumt wird. Von der Malerin wissen wir, dass sie eine sehr emanzipierte Frau war, die sich im Verhältnis zu Männern und ihrem eigenen Mann, mit dem sie zwei Töchter hatte, in ihrer Bedeutung nicht im Geringsten dezimiert vorgekommen sein dürfte. Sie war eine außerordentlich selbstbewusste Frau, die es dennoch verstand, diese Eigenschaft mit ausgeprägter Mütterlichkeit zu verbinden, ihren Kindern und Kindern im Allgemeinen gegenüber. Das wissen wir aus familiären Quellen. Ob die Malerin bei den Hühnern sich selbst und ihre Töchter vor Augen hatte, wissen wir allerdings nicht. Sie dürfen es gern vermuten und sie dürfen auch den Vorbehalt zu dieser Interpretation teilen. Denn es steht bei der Forschung zu diesem Bild ein Gerücht im Raum, dass es sich bei den erwähnten Anschnitten in dem erwähnten kleinen Format um die banale Ursache einer fehlerhaften Rahmung handele. Das kommt in der Kunstgeschichte immer wieder vor, dass Werke falsch gesehen und interpretiert werden, weil irgendein äußerliches Geschick ihr Erscheinungsbild maßgeblich verändert hat. Berühmt ist etwa der Echtheitsstreit einer Rembrandt-Grafik in der Staatsgalerie Stuttgart. Da hat man alles aufgeboten, was damals möglich war, um Echtheit zu beweisen oder eine Fälschung zu entlarven. Ein Informationswissenschaftler, der dieser Zeichnung mit semiotisch-statistischen Methoden auf den Leib rückte, kam zu dem Ergebnis, dass es sich um eine Fälschung handelt. Es meldete sich aber ein anderer Kenner zu Wort, der beweisen konnte, dass von dieser Zeichnung früher einmal, als sie noch nicht im Besitz der Staatsgalerie war, ein Streifen abgeschnitten worden war, damit es in irgendeinen Rahmen besser hineinpassen würde, fatal so etwas. Aber immerhin, sie war tatsächlich echt und die Staatsgalerie hatte nicht eine Million DM zum Fenster rausgeschmissen! - So, wir wenden uns dann dem nächsten Bild unserer Sammlung zu.“ Die Gruppe folgte Claudia Würm mit Ausnahme jener Dame, die sich nach dem Hühnerhof erkundigt hatte. Diese nahm jetzt auf einer gepolsterten Museumsbank Platz, genoss die Stille, die von dem sich entfernenden Schrittlärm hinterlassen wurde und betrachtete noch sehr lange das Bild ´Henne und Gockel.
Endlich war es dazu gekommen, dass sie dieses Werk ihrer Mutter im Original betrachten konnte. Sie kannte es bisher nur als Reproduktion und über den Hintergrund seiner Entstehung wusste sie noch kaum etwas. Mit ihrer Schwester hatte sie nur beiläufig Vermutungen dazu ausgetauscht. Ihre eigene Lebenssituation hatte sie zu sehr gefangen gehalten, als dass sie Muße zu intensiverer Beschäftigung gehabt hätte. Erst jetzt, da sie bei sich selbst angekommen war, konnte sie sich noch einmal neu der Geschichte ihrer Eltern zuwenden. Ihr besonderes Interesse galt dabei der Mutter, die inzwischen, seit ihr großes Werk im Museum hing, eine bekannte Malerin war.
Sie, Agnes, könnte durchaus eine der drei Hennen sein. Vielleicht eine von den beiden, die sich eher rechts oder in der Mitte am unteren Bildrand befanden. Sie war die ältere der beiden Töchter. Mit der linken Henne etwas weiter oben wäre dann die Mutter, Olivia, die Malerin selbst gemeint. Jedenfalls springt ins Auge, dachte Agnes, dass die drei Hennen die untere Hälfte eines Kranzes bilden, in dessen, etwas nach oben verschobenem Mittelpunkt der Gockel platziert ist, mit dem, da hatte Claudia Würm wohl recht, ironisch der Vater gemeint sein könnte.
Agnes rannen Tränen die Wangen herunter, die noch immer diese Glätte und Weichheit aufwiesen, die sie von ihrer Mutter geerbt und so sehr bei ihr geliebt hatte, wenn sie sich herzten und Wange an Wange lag.
Je weiter die Gruppe sich Gemälde für Gemälde von ihr entfernte und die Erläuterungen der Museumsführerin sich mit dem Hall der kleinen Schritte anderer Besucher in den Nachbarsälen vermischte, desto stärker ergriff Agnes ein Gefühl der Wärme und Liebe zu ihrer Mutter, die sie ihr vielleicht nicht immer hatte zeigen können. Es gab von Anfang an viele Hindernisse.
Agnes blieb allein mit dem Gemälde ihrer Mutter, das viele Erinnerungen in ihr lebendig werden ließ. Erinnerungen, deren Bogen sich weiter spannte und von dem Bild, das ihre Mutter gemalt hatte, jetzt immer mehr zum Vater führten.
Erst als die Mutter, kaum ein halbes Jahr nach Agnes Geburt, ihre berufliche Tätigkeit aufnahm, die damals noch weit von der späteren künstlerischen Laufbahn entfernt war, lernte sie, Agnes, die Nähe des Gockels kennen, wenn der Hahn denn im Bild tatsächlich ihren Vater repräsentierte. Sie erinnerte sich nicht an die Ereignisse, mit denen diese enge Beziehung zu ihrem Vater begann. Nur aus Erzähltem wusste sie, dass sie die ersten beiden Tage ohne ihre Mutter bei einer Tagesmutter verbringen musste, die außer ihr noch ein anderes Kind zu betreuen hatte. Den zwei Babies wurde die unbeweglich auf einer Couch sitzende, rauchende und eine Rassel schwingende Person nicht gerecht und so schrie Agnes aus Leibeskräften, offenbar während des ganzen Vormittags, jedenfalls konnte man das jämmerliche Weinen schon im Hausflur hören, als sie von der Mutter wieder abgeholt wurde. Am dritten Tag beschloss der Vater, der sie am Morgen dort wieder abliefern sollte, spontan, dies nicht zu tun. „Wir fahren ans Meer“ sagte er zu seinem „Agnes-Püppchen“, das mit ängstlichem Blick im Kindersitz festgeschnallt war. Dort, am Meer, das sich als eine riesige graublaue Fläche vor ihnen auftat, nahm der Vater Agnes auf den Arm, ließ die glücklich Gerettete so thronen, dass sie mit ihren Ärmchen und Händen alles erreichen konnte, was die Berührung und Erforschung lohnte und spazierte mit ihr entspannt und beruhigt an der Kaimauer entlang. Er beobachtete mit ihr die Schiffe, die am Hafen aus-und einliefen, kam zu dem roten Leuchtturm, der fremdartig verspielt wie aus einem großen maritimen Baukasten in den modernen Hafenanlagen stand. Er ließ Agnes, begleitet von ruhigen Erklärungen, das mit Farbe angestrichene Eisen der kegelförmigen Wand betasten, zeigte ihr den Horizont am Ende der schimmernden Wasserfläche, die Wolken und die wenigen Menschen, die sich zu dieser Zeit eines noch jungen Vormittags verloren am Kai bewegten. Erst nach einer guten Stunde, in der sie sich beide den Meereswind um die Nase wehen ließen, hob der Vater Agnes wieder in den Kindersitz, gab ihr das Fläschchen, das ihr von der schrecklichen Tagesmutter hätte verabreicht werden sollen, und fuhr wieder nach Hause, wo er sein Töchterchen, das ruhig und zufrieden eingeschlafen war, in ihr Bettchen legte und liebevoll zudeckte. Er war glücklich darüber, dass er sich von diesem Ausflug nicht von beruflichen Verpflichtungen hatte abhalten lassen.
Später, als Agnes alt genug war, um mit einem großen Hund herumtollen zu können und mit dem Vater an der dänischen Küste alles zum Drachen zu machen, was dem Wind eine Fläche anbieten konnte, sogar einen aufgeklappten Koffer, kam es wieder zu einem kleinen Privatausflug mit dem Vater. Er führte Agnes am wild tobenden Meer entlang und ließ sie aus einem anderen uferlosen Meer, dem der Steine, die dort den Strand bildeten, steinerne Kostbarkeiten finden, die dem Kind ins Auge stachen. Diese Steine bildeten später die Grundlage für eine Geschichte, die ihr Vater erzählte, aufschrieb und illustrierte: die Geschichte von der alten Dame und dem Schuh, welchen sie an einem solchen Strand aus Steinen verlor und nach Jahren an einem anderen ebensolchen steinigen Strand wieder fand, wo er inzwischen angespült worden war. Es war eine Geschichte der Einzigartigkeit eines Schuhs und einer Dame, beide in ihrer Art etwas Besonderes in der Weite der unüberschaubaren Vielfalt von Ähnlichem, wie es die rundgewaschenen Steine jener Strände waren. Als die alte Dame ihren Schuh wieder gefunden hatte, sah sie ihn mit neuem Blick und er glänzte in Farben, die sie nie zuvor an ihm entdeckt hatte.
Die Welt der Bilder, der Imagination, der Worte, die Welten entstehen ließen, verband Agnes immer mehr mit ihrem Vater, dessen Kopf als Hahn sich auf dem Bild der Mutter in die zufälligen linearen Muster der Hintergrundfläche aufzulösen schien. Nicht nur in diesem Bild, das für Agnes voller Rätsel war, verwandelte sich der Vater in einen Gockel, auch ohne dass damit auf die lächerliche Rolle eines geflügelten Patrons in der Familie angespielt werden mochte. In Agnes Erinnerung verwandelte er sich auch gerne in einen Affen, in eine Schildkröte, in ein Pferd, einen Esel, in verschiedene Hündchen und Hunde, in diverse Vögel, am liebsten in einen Zaunkönig oder einen Milan und er verwandelte sich sogar in eine Grille, in eine Schnake, oder – in eine Tomate. Er verwandelte sich gern und nicht selten dauerte es lang, bis er sich wieder in den vier Wänden seines eigenen Ichs einfand.
Agnes erinnerte sich an ein fürchterliches Ungeheuer, in das sich der Vater eines Tages mithilfe eines Schuhs verwandelt hatte, dessen Sohle, gelöst vom Oberleder, herunter klaffte. Furcht überfiel sie angesichts des bedrohlichen Schlundes, den der Vater mit dem künstlichen Fischmaul auftat. Damals wusste sie noch nicht, dass ihre eigene, so folgenschwere Leidenschaft für Experimente mit der Identität ganz offensichtlich ein väterliches Erbe war, dessen im Grunde spielerischer Charakter sich unversehens in bitteren Ernst verwandeln konnte. Dies hatte sie in den Jahren des Erwachsenwerdens erfahren, als ihr Wesen durch das Ich eines anderen Menschen so sehr geprägt werden konnte, als müsse sie sich in ihn vollständig hinein verwandeln.
Agnes atmete förmlich die Stille, mit der nun die Mittagszeit nahezu das gesamte Museum erfüllte. Nur gelegentlich hörte man ein paar Schritte und das leichte Schleifgeräusch, das durch das Öffnen der Eingangstür verursacht wurde.
Die Gegenwart des großen Gemäldes entrückte ihr das Bild ihrer Mutter, zu der es nicht passte, dass ihre unmittelbar empfundenen und mit intuitivem Geschick arrangierten Kompositionen im Bedeutungsraum einer öffentlichen Gemäldesammlung Aufhebens von sich machten. Hätte man sie zum Beispiel gefragt, warum sie die Mitte unterhalb der Gestalt des Gockels unbetont gelassen hatte so, als wäre diese Mitte zu sehr im Mittelpunkt, als dass sie sich mit ihr, der Mitte eines Bildes, hätte hervortun wollen. Dann hätte sie vielleicht amüsiert geantwortet, dass sie wahrscheinlich aus demselben Grund sich und ihre beiden Töchter als Hennen auch nicht in die Mitte gemalt hat. Mutter hätte sich aber über derlei Spitzfindigkeiten beim Malen keine Gedanken gemacht.
Dabei fiel Agnes ein, als sie noch einen Moment die Besonderheit der Komposition ins Auge fasste, dass es ihrer Mutter auch im Leben nichts ausgemacht hätte, wenn sie im Rahmen eines sozialen Gefüges, die Position ihrer eigenen Familienmitglieder diesem untergeordnet hätte in der Befürchtung, jemand könnte annehmen, sie würde ihre eigene Familie begünstigen.
So wie ihre Malereien zugunsten eines von ihr bevorzugten Blicks auf einen bestimmten, dem Betrachter vielleicht marginal erscheinenden