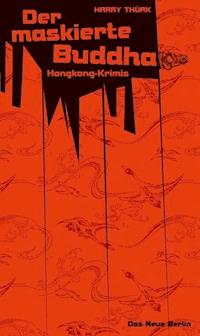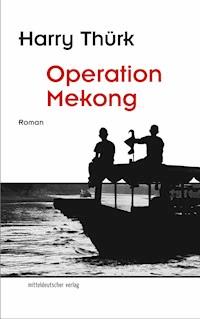7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Es beginnt mit einer Ladung »Hund«, wie in eingeweihten Schieberkreisen waffenfähiges Plutonium genannt wird. Aus unüberschaubaren russischen Kanälen soll es auf einem umgeflaggten ostdeutschen Schiff nach Südostasien geschmuggelt werden. Aber es kommt nie an. Beteiligte an dem Geschäft, der alte Kaufmann Iskander aus Johore, sein Schützling, die schöne Mara Toyabashi, und andere werden zusammen mit dem geriebenen Zwischenhändler Igor Sotis in Berlin in ein tödliches Abenteuer gestürzt. Ein ebenso illustres wie kriminelles Ensemble internationaler Geschäftemacher findet sich in diesem Roman von Harry Thürk zusammen. Der Autor führt die Skrupellosigkeit vor, mit der heute Gewinnmacher rund um den Erdball ihre Piratenspiele betreiben, wie sie vermeintliche oder echte Gegenspieler kurzerhand ausschalten. Ob es der tatsächliche Pirat Dando ist, der in der Straße von Malakka Schiffe ausraubt, ob der Armenier Viktor Sagarajan, der von Berlin aus überflüssig gewordene Ostblock-Waffen verhökert, oder der Indonesier Tobin, der für seinen Betrug die strengen Rauschgift-Bestimmungen Singapores nutzt - sie alle sind Produkte einer veränderten Welt, in der Moral zu einem leeren Wort verkommt. Harry Thürk, Autor vieler erfolgreicher Romane, leuchtet eine Szenerie aus, die den Leser mit dem, was es in ihr an krimineller Energie zu finden gibt, immer wieder überrascht. Zwischen Berlin und Singapore, zwischen Wien und dem winterlichen Hafen von Riga spielt die turbulente Handlung dieses Romans, der erstmals 1995 beim mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH erschien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Harry Thürk
Piratenspiele
Roman
ISBN 978-3-86394-808-5 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 1995 beim mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Der Tag hatte mühsam und unerfreulich angefangen.
Zuerst die lange Fahrt mit dem Dienstwagen von der Wohnsiedlung am Stadtrand Rigas bis fast an die Gegenseite, wo die Fabrik stand, und dazu noch zwei Unterbrechungen, als einmal die Zündung aussetzte und danach an einer Kreuzung der Kühler zu dampfen begann.
Während sich Kobzew am Straßenrand die Füße vertrat, unmutig über das feuchtkalte Nieselwetter des nahenden Frühlings, der ziemlich zögerlich kam, fluchte der Fahrer auf lettisch, damit die Umstehenden nicht provoziert wurden, dass die alte Mühle eben schrottreif sei. Er fluchte laut genug, um die Leute davon abzulenken, dass er einen Russen fuhr. Dann, in der Fabrik, die Versammlung. Von Letten einberufen, ohne formale Genehmigung der Direktion. Ein so genanntes Komitee für nationale Unabhängigkeit stand dahinter: Nach fünfzig Jahren sei Lettland nun endlich wieder ein freier Staat. Deshalb müsse mit dem Schwebezustand Schluss gemacht werden, der das Land immer noch mit rund dreißigtausend russischen Soldaten belastet. Sie sollen endlich nach Hause gehen. Mit ihnen all jene Russen, die in ihrem Gefolge nach Lettland gekommen waren, um hier zu kommandieren, um sich zu bereichern, um die Einheimischen zu erniedrigen, und die jetzt den Anschein zu erwecken versuchten, sie seien es, die ungerecht behandelt würden. Nur weil man sie aufforderte, dorthin zurückzugehen, woher sie vor geraumer Zeit gekommen seien, ungerufen. als Okkupanten, die ihren Raub der baltischen Länder mit jenem Herrn Hitler vereinbart gehabt hätten...
Der ganze politische Wust, der in diesen Tagen wieder und wieder hochkam. Und Kobzew, als Direktor, war gezwungen gewesen, sich das alles anzuhören. Höflich zu bleiben. Konnte nicht, wie in alten Zeiten, zum Telefon greifen, die "Organe" anrufen, auf dass sie für Ordnung sorgten. Musste nach außen hin erkennen lassen, dass er für den Unmut seiner lettischen Arbeiter und Techniker Verständnis aufbrachte. Die ganze Sache sollte wohl noch mehr angeheizt werden, das erkannte er aus den aufeinander abgestimmten Zwischenrufen. Kein Wahlrecht für Russen. Keine Pässe. Erhöhung des Mindestmonatslohnes, für den man gegenwärtig auf dem Schwarzmarkt etwa ein paar Schuhe kaufen konnte. Keine Erhöhung für Russen. Räumung des Kriegshafens Libau. Übergabe der Besatzerquartiere an Wohnungssuchende Letten...
Aber die Versammlungsleitung fing - diesmal noch, und wohl gewollt - den Tumult geschickt ab, indem sie die Zurufe zu einer Art Resolution bündelte, über die dann abgestimmt wurde. Es gab nur eine Handvoll Enthaltungen. Wie es schien, sollte die Zusammenkunft noch nicht zum Sturm ausarten. Auf seinem Schreibtisch in dem gediegen eingerichteten, mit Wandteppichen aus Südrepubliken geschmückten Büro fand Kobzew dann die aus dem "Baltic Observer", einer neuerdings in englischer Sprache erscheinenden Zeitung, herausgerissene Karikatur: Der sagenumwobene lettische Bärentöter Lacplesis, wie er mit dem Schwert auf den dreiköpfigen Drachen eindrischt. Die Köpfe mit den Inschriften "SU", "KPdSU" und "KGB". Er schmiss den Wisch zornig in den Papierkorb. Die Produktion hatte er vor geraumer Zeit schon zurückfahren lassen, auf etwa die Hälfte. In Russland gab es keine Käufer, und im Ausland hatte man keine Märkte mehr, wenn man davon absah, dass Kobzew die Chance wahrgenommen hatte, an den laschen Kontrollen vorbei einiges sozusagen "privat" zu exportieren. Bis vor einigen Monaten war der gesamte Absatz von Moskau aus dirigiert worden, jedenfalls soweit die Moskauer überhaupt die Zahlen kannten. Zuletzt war das so gegangen: Kobzew meldete das, was er nicht "privat" absetzen konnte, als Produktionsergebnis, und irgendein Außenhandelsbüro in der Metropole besorgte dann den Verkauf. Niemand erfuhr, wohin die Erzeugnisse gelangten, geschweige denn, was sie einbrachten. Dabei handelte es sich um hochwertige Artikel der Elektronik, besonders um Bauteile, die bis vor kurzem noch strenger Geheimhaltung unterlegen hatten. U-Boote brauchten sie, Raketen. Panzerkanonen, Kampfflugzeuge. Doch da war das große Loch entstanden, unbekannte Größen taten sich auf, nachdem man offiziell mit den Amerikanern vereinbart hatte, dieses oder jenes abzuschaffen. Für die Bereitschaft, das zu tun, oder es wenigstens offiziell anzukündigen, stand den neuen Politikern bare Valuta ins Haus, also gab es Bestimmungen zur Reduzierung der Produktion.
Ausweichen hätte man auf moderne Unterhaltungselektronik können, das war auch der erste Gedanke Kobzews gewesen, als die Dinge sich neu darstellten. Nur - wer heute ein leistungsfähiges elektronisches Gerät haben wollte, und wer imstande war, es auch zu bezahlen, kaufte sowieso auf dem Schwarzmarkt gegen Devisen Erzeugnisse von Weltfirmen aus Japan, Holland, Deutschland.
Die Misere, geschmückt mit der neuen Losung von der Marktwirtschaft und den leeren Sockeln der alten Denkmäler, den neuen Fahnen in den lettischen Farben, war vollständig. Kobzew hatte keine Antwort darauf. Niemand hatte eine. Jeder musste eine für seine eigene Person finden, das war die neue Lage: Rette sich wer kann! Aus dem brodelnden Lettland weg. Hinein in das, was die paar Moskauer Schlauköpfe mit ihren Harvard-Diplomen heute Marktwirtschaft nannten. Aber gefälligst dort, wo sie lief, nicht in dieser auseinander fallenden Union! Kobzew vertraute nur auf sich selbst. Hol der Teufel diesen ganzen so genannten "Umbau" der Gesellschaft, den der Kerl mit dem Klecks auf der Stirn begonnen hatte, indem er behauptete, nur so sei die Sowjetunion zu retten! Jetzt existierte sie schon nicht mehr, und der mit dem roten Klecks reiste mit der aufgehaltenen Hand durch die westlichen Lande, um ein bisschen Geld für das einzusammeln, was er eine Stiftung nannte und was wohl hauptsächlich ihn selbst und ein paar Vertraute am Leben erhalten sollte. Keine so schlechte Art, die Misere zu überstehen. Kobzew griff aus der Tasche eine Schachtel Marlboro, brannte eine der Zigaretten an. Wenigstens ein Plus: Die Zigaretten sind besser geworden!
Er drückte die Sprechtaste auf dem Schreibtisch und sagte: "Fräulein Marakis, ich möchte jetzt meinen Kaffee."
Die Blondine mit den ausladenden Hüften und den blauen Kulleraugen, die täuschend unschuldig blickten, erschien ein paar Minuten später und knallte das Tablett mit Kännchen und Tasse auf den Schreibtisch. Unter anderen Bedingungen hätte der notorische Junggeselle Kobzew mit ihr längst ein Verhältnis gehabt, aber er hatte früh genug von ihr angedeutet bekommen, dass sie als patriotische Lettin eine Affäre mit einem Russen bestenfalls noch als Vergewaltigung betrachten könnte.
"Danke", sagte Kobzew vorsichtig. Er hatte sich angewöhnt, mit seinen lettischen Angestellten umzugehen, als wären sie ihm gleichrangig, wenigstens gab er sich Mühe, das so erscheinen zu lassen. Bei der Marakis schien das doppelt angeraten. Sie war zwar seine persönliche Sekretärin, und es gab über ihre Arbeit keine Klagen, aber sie war in der letzten Zeit immer aggressiver geworden. Spürte, woher der Wind kam. Als das Parlament und die Fernsehstation von sowjetischen Truppen beschossen wurden, hatte sie zu den Verteidigern gehört, mit Gewehr und irgendwo aufgeklaubtem Stahlhelm. Erst als die Truppen sich zurückzogen, war sie wieder zur Arbeit erschienen.
Kobzew hatte es für ratsam gehalten, sie nicht zur Rede zu stellen. Einmal, als er unvorsichtigerweise auf ihre neue politische Überzeugung anspielte, hatte sie ihn mit einer Flut lettischer Worte überschüttet, und als er nicht verstand, sagte sie spitz: "Dann wird es Zeit, dass Sie die Sprache lernen! Sie wird Amtssprache sein, wir sind keine Kolonie mehr. Oder haben Sie das immer noch nicht gemerkt?"
Er hatte es sehr wohl bemerkt. Wladimir Kobzew brauchte keine Geschichtslektion. Dieser nicht sehr große, nicht sehr auffällig wirkende Mann hatte eine Vergangenheit als Diplomat hinter sich gebracht - Handelsattaché der sowjetischen Botschaften in Bangkok, Djakarta, Singapore, Tokio...
Eine kleine Unregelmäßigkeit, wie man im diplomatischen Dienst Nebengeschäfte mit Devisen nannte, war der Grund für seine vorzeitige Entlassung gewesen. Wobei er haarscharf an einer Bestrafung vorbeisegelte. Eine Anzahl ihm verpflichteter guter Bekannter im Ministerium und anderswo hatten dafür gesorgt, dass er nach Lettland versetzt wurde, aus der Schusslinie kam. "An die Basis", wie das genannt wurde, um den Anschein einer Bestrafung mit disziplinarischem Charakter zu wahren. Als ob Arbeit eine Strafe sein könnte! Dabei hatte er hier besser verdient, als es während seiner Diplomatenzeit jemals möglich gewesen war. Und die Chancen für dieses oder jenes Nebengeschäft waren in der Wirtschaft, wie jeder wusste, sehr viel besser.
Er blickte wohl etwas verwundert auf das Kaffeekännchen und die Tasse, denn die Blondine, die inzwischen an der Tür angelangt war und sich noch einmal umwandte, sagte herausfordernd: "Wenn Sie Zucker wollen, telefonieren Sie mit Kuba. Milch gibt's vielleicht in der Ukraine." Damit knallte sie die Tür zu.
Kobzew trank einen Schluck schwarzen Kaffee. Dünnes Gesöff. Vielleicht hatte sie hineingespuckt. Heute war einer solchen Nationalistin alles zuzutrauen. Es ist Zeit, Schluss zu machen. Kobzew sagte sich das nicht zum ersten Mal. Er gehörte seit Monaten zu den Leuten, die einsahen, dass es am besten war, wenn man dieses dümpelnde Schiff verließ. Ohne Umstände. Allerdings nicht ohne Gewinn. Und dafür hatte er rechtzeitig gesorgt.
Er griff nach dem Telefon, überlegte sich aber dann, dass die Marakis eventuell mithören könnte. Also nahm er aus der Schreibtischlade einiges, was ihm persönlich gehörte, aus einem Wandsafe ein Bündel Geld, zuletzt kroch er in den Mantel, setzte die Fellmütze auf und verließ das Büro, ohne sich auch nur noch einmal umzusehen. Einen Abschied sollte man nicht mit Gefühlen belasten, wenn er von dieser Art war.
Draußen im Vorzimmer blickte die Marakis gar nicht auf. als er ihr mitteilte, er habe etwas zu erledigen. Sie knurrte nur: "Erledigen Sie am besten sich selbst!" Dabei las sie seelenruhig weiter den "Baltic Observer", ein Blatt, das jedem anständigen Letten abverlangte, den nächstbesten russischen Okkupanten per Fußtritt ins große, ruhmreiche Vaterland zurückzubefördern.
Während Kobzew in den Fahrstuhl stieg und abwärts fuhr, während er sich in seinen Wolga setzte, den er jetzt selbst fuhr, aus gutem Grund, blickte er nicht zurück auf das immerhin imposante Direktionsgebäude. Er hob gelangweilt die linke Hand, als der Posten am Eingangstor ihn grüßte, und dann gab er Gas. Dieses Land, dachte er, hat endgültig die Geduld verloren. Er war damals hierher gekommen, ohne das eigentlich gewollt zu haben. Hatte sich schnell an den hohen Grad der Zivilisation gewöhnt, an eine gewachsene Kultur, von der er sich wie andere Russen auch, allerdings ziemlich ausgegrenzt fühlte. Damals feindete ihn noch niemand direkt an, wie etwa jetzt die Marakis. Im Lande herrschten Ruhe und Gehorsam, was manche Ordnung nannten. Aber Kobzew spürte schon, dass da gewissermaßen unter den Füßen die Erde rumorte. Jetzt spie sie Feuer. Ein Land der grünen Ebenen, der sanften Hügel, der dichten Wälder, der Seen und Moore, in seiner Schönheit betörend, und trotzdem ein Land, das in seiner Geschichte nur selten, und dann für sehr kurze Zeit, glücklich gewesen war.
Deutsche Herren waren zuerst gekommen, hatten Territorium in Besitz genommen. Polen und Litauen machten Ansprüche geltend. Auch Schweden. Bis das starke Russland der Zaren sich des so günstig am Meer gelegenen Gebietes annahm und es sich einverleibte. Für zwei Jahrhunderte waren es die Petersburger, die hier das Sagen hatten, die den Handel kontrollierten, der über die von der Hanse angelegten Häfen lief, und die dem Volk die Steuern abzwackten, nicht zu knapp.
Der Untergang des Zarenreiches machte auch Lettland wieder zum Zankapfel. Zuerst die Roten, dann die Deutschen gegen die Roten, dann die vom eigenen Landadel, im Schatten der abziehenden Deutschen, wiederum die Roten, danach erneut der Landadel, der so etwas wie Frieden mit den Moskauern schloss. Von kurzer Dauer, denn ein knappes Dreivierteljahr nachdem die Deutschen in Polen einmarschiert waren, damals, als Hitler und Stalin Osteuropa einvernehmlich untereinander aufgeteilt hatten, machten die Moskauer kurzen Prozess und verwandelten das Land, auf das sie schon so lange begehrliche Blicke geworfen hatten, in eine Unionsrepublik. Für immer, wie sie sagten. Doch die Voraussage erfüllte sich nicht. Wieder kamen die Deutschen, ein Jahr später nur. Und vier Jahre danach, als die Deutschen geschlagen waren, kamen die Moskauer zurück. Übten Rache an allen, die sich im Schatten der Deutschen wohler gefühlt hatten als in dem Moskaus.
Aber das alles war jetzt vorbei. Zumindest wohl für eine längere historische Periode. Die Union gab es nicht mehr. Das Imperium zerfiel. Die Leute an der lettischen Küste, die mit dem Meer und seinen Bewohnern ein besonderes Verhältnis hatten, sagten, dass es der Union gehe wie einem solchen Meeresbewohner, einem Fisch, der im Hochsommer bei Ebbe auf den Strand gespült wird. Er fängt an zu faulen. Zuerst fault der Kopf.
Als Kobzew die Stadt zur Hälfte durchquert hatte, überlegte er. dass die Küstenleute wohl recht gehabt hatten. Noch gab es hier und da ein paar verlorene Legionen fremder Truppen, eingezäunt, nach Feinden Ausschau haltend und überlegend, wie der Befehl der Moskauer Obrigkeit im Falle eines Angriffs lauten würde. Sicher war da nichts. Die Soldaten waren sozusagen die zuletzt verfaulenden Reste des Fisches. Der Kopf war lange hinüber.
Die Wohnung Kobzews war bereits leer. Gespenstisch kahle Wände, ein leidlich gepflegter Fußboden, mitten im größten Zimmer zwei handliche Koffer, schwarz, elegant, dazu eine Umhängetasche, in die Kobzew nur noch das kleine Etui mit den Toilettenutensilien stecken musste, das im Bad auf dem Bord unter dem Spiegel stand. Und dann war da das Telefon.
Kobzew warf den Mantel achtlos ab und schob die Mütze aus der Stirn. Griff sich den Telefonhörer und wählte nach dem Gedächtnis. Er war gut im Merken von Zahlen. Seine Funktion als Handelsattaché in fremden Ländern hatte das mit sich gebracht.
"Hallo!", rief er in die Muschel. Er nannte keinen Namen. Alles war vereinbart. Wenn er diesen Anruf tätigte, und wenn er in ihm den Namen eines bestimmten Tieres erwähnte, dann war das ein Signal, auf das der Empfänger seit einiger Zeit lauerte.
"Chef, ich höre", kam es zurück, in etwas akzentbeladenem Russisch. Im Hintergrund hörte Kobzew Musik. Gut für jedes Telefongespräch vertraulicher Natur.
"Ich wollte Sie zum Kartenspiel einladen", sagte er. "Für acht Uhr."
"Gut", antwortete der Angerufene. Nichts weiter. Und Kobzew verabschiedete sich mit dem Signal: "Bis dann, alter Partylöwe!"
Im Hafen von Riga trat danach aus einem Restaurant, das einem Russen gehörte und das auch Zimmer vermietete, halbstündlich oder für länger, ein untersetzter, wenig elegant wirkender Mann, der eine Kapitänsuniform trug und kein Gepäck mitführte. Er blickte missmutig auf den hier und da zu schmutzigen Haufen zusammengeschobenen Schnee, den letzten des Winters wohl, dann machte er sich auf den Weg zu den Piers. Hier lag schon seit längerem wegen angeblicher Ladeschwierigkeiten die "Belinda", deren Kapitän und zugleich Eigner der Mann aus dem Restaurant war.
In Wirklichkeit war die "Belinda" identisch mit der "Fortschritt" der Rostocker Seereederei, die aber war zu Beginn des Winters schon bei einem Sturm untergegangen. So wies es jedenfalls das Schiffsregister aus.
Für einen untergegangenen Tausendtonner war die "Fortschritt", die jetzt unter dem Namen "Belinda" lief, sehr seetüchtig. Und selbstverständlich war sie auch nicht untergegangen. Ihr ausgefuchster Kapitän, Ernst Wirgel, der kleine Mann aus dem Hafenrestaurant, hatte das gefingert, nachdem es den einst von den Sowjets geschaffenen östlichen deutschen Teilstaat nicht mehr gab. In dem heillosen Durcheinander, das bei der Umwandlung aller ehemaligen Staatsbetriebe in Privatbesitz heute noch dort herrschte, fragte kein Mensch lange nach einem Schiff, von dem SOS-Rufe aufgefangen worden waren, in Südschweden, und das dann einfach nicht mehr aufgetaucht war. Totalverlust. Es wurde ausgebucht, die Versicherung liquidiert, damit war der Fall erledigt.
Etwa um die Zeit, als in einem Büro in Berlin die Akte "Fortschritt" endgültig abgelegt wurde, war das Schiff in Riga von gut bezahlten russischen Soldaten, die ein ebenfalls gut dafür bezahlter Kommandeur aus seiner Kaserne für diese Dienstleistung abstellte, neu gespritzt und mit dem Phantasienamen "Belinda" geschmückt worden. Kapitän Wirgel, ein Mann mit wenig Skrupeln, wenn es darum ging, bare Münze zu verdienen, einigte sich mit seinem alten Freund Kobzew, den er kennen gelernt hatte, als er noch für die Rostocker Seereederei die Ostasienroute befuhr, und dem er damals einen kleinen Gefallen getan hatte, auf das weitere gemeinsame Vorgehen.
Ausgemacht war die ganze Sache ohnehin schon eine Weile gewesen, wie man auch das Zusammenklappen des zweiten deutschen Staates aus Moskauer Sicht ziemlich zeitig und genau hatte terminieren können. Wirgel bezog ein Handgeld und bekam eine Fifty-fifty-Beteiligung an künftigen Geschäften zugesichert. Danach brachte ein Vertrauter Kobzews aus Moskau, wo er in einschlägigen Kreisen bekannt war, für vertretbare Preise zuverlässige neue Dokumente. Schiffspapiere, einschließlich einer nicht im Londoner Register eingetragenen Lloyd-Versicherung. Seitdem war Wirgel. der vorher Wallmart geheißen hatte, Wirgel, und die "Fortschritt" war in dem Hafen, den sie als "Fortschritt" angelaufen hatte, nun die "Belinda", die für Antigua fuhr. Da hatten einige größere Dollarscheine ihren Besitzer gewechselt. Und in der relativ langen Zeit, die das Schiff schon hier verbracht hatte, waren in gewissen Abständen Lasten geladen worden, die aus der Fabrik Baitronic kamen, von Kobzew abgezweigt, was gar nicht weiter auffiel, zumal die Kontrollposten ohnehin mit Russen besetzt waren, die sich seit Beginn der Veränderungen im Lande ganz gern ein paar Dollar verdienten.
Nun ging Kapitän Wirgel an Bord. Zollformalitäten hatte er nicht zu befürchten. Für eine Handvoll Valuta stempelten die alten russischen Beamten, was immer man ihnen vorlegte.
Auch heute war ein guter Bekannter Wirgels im Dienst. Er war schon ein wenig angetrunken, sein Gesicht rötlich angelaufen, zumal in der Kontrollbude der Zöllner ein eiserner Ofen Hitze förmlich ausspuckte.
"Meine Leute an Bord?", erkundigte sich Wirgel, nachdem er dem Beamten die obligatorische Schachtel West über den Tisch geschoben hatte.
"Einer der Offiziere ist an Bord, zwei sitzen drüben in der Bierbar. Sie haben da heute litauisches Braunbier, deswegen. Drei Filipinos von der Mannschaft sind im 'Catfish' bei den Huren. Das Ding, das früher 'Roter Seemann' hieß. Danke für die Zigaretten!"
Er riss die Packung auf und rauchte.
"Sieht so aus, als ob es heute losgeht", bemerkte Wirgel. Der Zöllner nickte nur, verzog leicht die Mundwinkel und übergab ihm kommentarlos die Ladepapiere. Sie waren gestempelt.
Wirgel war froh, dass es endlich auf Fahrt ging. Er hatte eine Flagge Antiguas anfertigen lassen, und sich inzwischen über den Staat ins Bild gesetzt, der diese Flagge führte, auf der ein Stück Strand mit einer Sonnenscheibe zu sehen war. Englische Westindien-Kolonie, die über den Zwischenstatus als assoziiertes Commonwealthmitglied schließlich selbständig geworden war. Ein paar Inseln mit unbedeutender Wirtschaft. Günstig als Billigflaggenland. Aber niemand in Antigua hatte auch nur die leiseste Ahnung, dass die "Belinda" unter der Flagge mit Strand und Sonne fuhr.
Das Schiff würde, wenn es nach Kobzew und Wirgel ging, eines Tages in Asien stillschweigend verkauft werden, samt seiner von einer einschlägigen Agentur in Zypern vermittelten Filipino-Mannschaft. Für Wirgel, so stellte er es sich vor, würde ein Bungalow auf Bali dabei herausspringen, und eine Summe, die für eine Weile reichte. Bis sich neue Chancen ergaben, was in Asien nicht lange dauerte.
Er kletterte an Bord. Der Offizier, ein kleiner, sich gezielt forsch gebender Mann namens Ramirez, der mit Sicherheit nicht so hieß, was Wirgel allerdings gleichgültig war, berichtete, dass es keine besonderen Ereignisse an Bord gegeben hatte. "Hol' die Kerle zusammen", trug ihm Wirgel auf. "Wir sind die längste Zeit hier gewesen..."
Der Offizier war über diese Mitteilung höchst erfreut. Riga gefiel ihm sowieso nicht, und die Mädchen waren bei hohen Preisen auch noch rüde. Er machte sich auf den Weg.
Wirgel war sich ziemlich sicher, dass dies seine letzte Fahrt in diesen Gewässern sein würde. Außer dem, was er aus vergangenen Geschäften auf der Schweizer Kante hatte, spielte er mit der Absicht, in Singapore noch etwas Kapital zu machen. Es bestand die Möglichkeit, dort in das Unternehmen eines Indonesiers einzutreten, der seit Jahren eine Küstenreederei betrieb: Amir Tobin lebte in Lombok und hatte seinen Geschäftssitz in Singapore. War Dolmetscher der ehemaligen sowjetischen Botschaft dort gewesen, bis er über einige Unregelmäßigkeiten stolperte. Ähnlich wie Kobzew, nur früher, Tipps an bestimmte Firmen, mit denen die Sowjets Handel trieben. Er verdiente gut dabei, wie sich herausstellte. Kobzew hatte dafür gesorgt, dass die Sache damals unter den Teppich gekehrt wurde, mit der gängigen Ausrede, das gute Verhältnis zu Indonesien sollte nicht gefährdet werden.
Jetzt, so hatte Wirgel von Kobzew erfahren, dehnte sich das Geschäft, das Tobin inzwischen begründet hatte, so aus, dass er zuverlässige Leute brauchen konnte. Wirgel war zuverlässig.
Kobzew, der gerade seine beiden Koffer in den Wolga schob, blickte sich in der Gegend um. Zwischen den Betonklötzen des Neubauviertels gab es um diese Zeit kaum Bewegung. Ein paar Kinder, die Steine nach einer Straßenlaterne warfen, bis das Glas splitterte. Autos, die hier und da herumstanden, mit Planen gegen den Schnee abgedeckt. Fußgänger liefen vermummt auf ausgetretenen Bürgersteigen, die bereits abgetaut waren. Trotz seiner Überzeugung, dass niemand ihn beobachtete, fuhr Kobzew zunächst nur bis zur Einbiegung in die Hauptstraße und hielt dort an, bis er sicher war. dass niemand hinter ihm herfuhr. Es war auch wenig wahrscheinlich, denn das einst so dicht gewebte Netz der Kontrolle über so gut wie alle Lebensäußerungen der Leute hier existierte nicht mehr. Die berufsmäßigen Observer hatten sich zurückgezogen, um keinen Anlass für Zwischenfälle zu liefern, die leicht in blutigen Streit ausarten konnten. Den brauchte die neue Macht in Moskau jetzt weniger als je zuvor. Man legte es schließlich darauf an, in der Welt anders betrachtet zu werden als die Vorgänger. Und auch die Weltbank, von der man nicht gerade geringfügige Kredite erwartete, machte diese von gewissen politischen Grundbedingungen abhängig. Also igelte sich die Garnison der Moskauer Truppen ein und versprach baldigen Abzug. Wann das sein sollte, konnte niemand auch nur annähernd sagen.
Kobzew ließ den Wagen auf der breiten Schnellstraße zum Flugplatz laufen, was der Motor hergab. Überall in der Karosserie klirrte und schepperte es, aber diese Kisten hielten eine Menge aus, und so gelangte er ohne Zwischenfall zum Flughafen. Hier draußen war, wie in der Innenstadt auch, deutlich zu sehen, dass die kleine Republik in der letzten Zeit völlig neue Handelspartner hatte, auch neue Geldgeber wohl. Es waren eine Menge Läden voller westlicher Konsumgüter förmlich aus dem Boden geschossen, seit man den Rubel als Zahlungsmittel abgeschafft und eigenes Geld ausgegeben hatte. Selbst teure Juwelen und unbekannte Delikatessen erschienen hinter blankem Glas. Reklameschilder leuchteten überall.
Kobzew hatte Filme gesehen, die den Einmarsch der Sowjetarmee im Jahre 1940 in dieses Gebiet zeigten - heute war das ein anderes Land. So fremd wie einige Viertel in Moskau, in denen sich schäbig gekleidete Einwohner die Nasen an den Schaufenstern französischer Modeläden platt drückten.
"Flugschein, Pass", forderte das lettische Mädchen in ihrer Sprache sachlich, als Kobzew sein Gepäck am Schalter der SAS auf die Waage stellte. Sie streckte die Hand aus und nahm den Sowjetpass mit spitzen Fingern.
"Wenn Sie wieder einzureisen beabsichtigen, brauchen Sie ein Visum", teilte sie ihm mit. Er nickte nur.
Ein paar Griffe am Computer, dann schob das Mädchen ihm Pass, Ticket und Bordkarte hin, nachdem sie sich vergewissert hatte, dass das Gewicht des Gepäcks unter dem Limit lag. "Ist die Maschine pünktlich?", fragte er in seinem nicht sehr guten Lettisch, und das Mädchen deutete nur mit der ausgestreckten Hand auf die elektronische Anzeigetafel, die den Flug bereits ankündigte. Danach schwenkte sie die Hand seitwärts, wo der Durchgang lag. Sie hatte einen völlig gleichgültigen Ausdruck im Gesicht. Der veränderte sich schlagartig, als sich hinter Kobzew eine Lettin an den Schalter schob, die stolz ihren neuen Pass vorwies.
Die Kontrolleure hatten an Kobzew nichts auszusetzen, als er durch die Metallschranke ging. Sie gaben ihm gleichmütig seine Papiere zurück. Blickten ihn nicht einmal an dabei.
Er ging in die Wartehalle. Setzte sich auf eine gepolsterte Bank und las an der Tafel ab, dass noch zwei andere Maschinen vor der SAS abgefertigt werden mussten. Zog seine Zigaretten hervor, beklopfte sicherheitshalber die Innentasche des Jacketts, in der das Bündel mit den Dollarscheinen steckte. Es waren große Scheine, und sie würden eine Weile reichen, bis sich die Chance ergab, aus dem Depot, das er vorsichtshalber seit einiger Zeit in Zürich angelegt hatte, neues Geld anzufordern. Nachdem er die Zigarette angebrannt hatte, versank er in Nachdenken.
Moskau hatte sich geirrt, damals. Besser gesagt, vielleicht Stalin. Als er seinen Zugriff auf die nördlichen und westlichen Nachbarstaaten mit Hitler aushandelte, hatte er die strategischen Fernziele der Deutschen nicht durchschaut. Alles andere, was über diesen Pferdehandel auch später noch in die Welt gesetzt wurde, um ihn klug erscheinen zu lassen, hatte sich als schmückendes Lorbeerlaub für den Georgier erwiesen. Kobzew hatte in diesem Augenblick vor dem Abflug seiner Maschine, während er sich schon in der Wartehalle des so genannten internationalen Territoriums befand, plötzlich Mut zu einer Art Ironie, zu der er sich früher selten hatte überwinden können. Vaterland und Stalin, das war nicht so weit voneinander entfernt gewesen, bis in die letzten Jahre. Verhängnisvoller Irrtum des großen Mannes im Kreml, dass er gemeinsame Sache mit den Braunen machte. Weder die baltischen Kriegshäfen hatten mit dem Ausgang des Krieges Nennenswertes zu tun gehabt, wie sich später herausstellte, noch der Fetzen Land, den man den Finnen gleich darauf abgenommen hatte. Alles so genannte Vorfelder in Stalins Vorstellung, auf denen er eventuelle fremde Angriffe hatte abwehren wollen, bevor sie das eigene Land erreichten. Und das im Zeitalter einer technischen Entwicklung, die damals schon Entfernungen zusammenschrumpfen ließ wie in der Sonne gelagerte Rübenblätter.
Wladimir Kobzew hatte sich dafür entschieden, der Sache auszuweichen. Nicht jeder hatte in einem solchen Land wie Lettland für längere Zeit als Direktor eines Betriebes dessen Produktion auf Wege leiten können, die privat waren. Und das alles, ohne dass die Zentrale etwas davon merkte. Es gab die alte Zentrale heute nicht mehr, und die neue war noch nicht einmal richtig geboren.
Kobzew blickte auf die Uhr. Die Anzeigetafel gab keine Verspätung der Maschine an. Um ihn herum dösten gelangweilte Reisende, andere blätterten in Zeitschriften oder rutschten unruhig auf ihren Sitzflächen hin und her.
Ich werde in Berlin ein herrschaftliches Abendessen einnehmen, dachte Kobzew. Weg von hier, das ist die einzig richtige Entscheidung. Weg von Mütterchen Russland. Es ist verrückt geworden, das Mütterchen, mit seinen Zarenfahnen und Kreuzschwingern, den bettelnden Kriegsveteranen und den perlenbehängten Huren, die in die Mercedeswagen der neuen Schieber steigen. Kerle, die man früher in die Lager gesteckt hätte. Jetzt repräsentierten sie für die westlichen Geldgeber die Garanten des Verfahrens, das sie Marktwirtschaft nannten.
Tote, die früh am Straßenrand liegen. Vergewaltigte Weiber, die zeternd zur Miliz rannten, wo ein unausgeschlafener Korporal die Namen abfragte, registrierte und sie wieder wegschickte. Häufchen, die irgendwo abseits die rote Fahne schwenkten und Leninbilder. Denkmäler von einstmals heiligen Revolutionären, zerschlagen auf Stadtrandwiesen. Und Politiker, die man im Fernsehen beobachten konnte, amerikanische Bankiers oder deutsche Minister umtänzelnd, wie balzende Auerhähne. Dabei hatten sie ihre Konten längst auch in Zürich...
"Achtung, wir bitten die Passagiere des SAS-Fluges 311 zu den Bussen!" Die Stimme knarrte. Defekte Mikrofone und Lautsprecher waren die Besonderheit aller russischen Flughäfen, auch derer in den besetzten Baltenstaaten.
Beim Abschalten krachte es wie ein Blitzschlag. Sie sollten statt immer modernerer Autos für die Regierungsbonzen einmal neue Geräte für die Flughäfen anschaffen, dachte Kobzew. Aber dann erinnerte er sich mit grimmigem Humor daran, dass sie den Teufel tun würden, für die Letten Lautsprecher zu kaufen. Er erhob sich, nahm seine Kabinentasche über die Schulter und ging zum Ausgang, wo der Bus wartete. Niemand verschwendete auch nur einen Blick an ihn.
In der Berliner Kantstraße herrschte der übliche Abendverkehr. Die Autoschlangen rissen nur für kurze Intervalle ab, die den Ampeln zu verdanken waren.
Von der Joachimstaler Straße her kamen die Geschäftsleute aus dem Citybezirk, auf dem Weg in ihre Vorortvillen. Von Charlottenburg her rollten schon die ersten Leute aus den Randbezirken südlich des Olympiastadions heran, die in der City speisen, anschließend ein Theater besuchen oder ein paar Stunden in einer der unzähligen Bars verbringen wollten. Vielleicht eine einsame Dame finden, die Gesellschaft schätzte. Berlin hatte sich seit dem Abbau der trennenden Mauer schnell in eine Stadt verwandelt, in der das Leben hektischer verlief, als es zuvor in jeder der beiden Hälften verlaufen war. Aber nicht nur in der Erinnerung gab es die Vorstellung, dass es doch zwei recht ungleiche Hälften gewesen waren, die man da zusammengeklebt hatte...
Igor Sotis hatte die Veränderungen der letzten Zeit aus einer eher beobachtenden Position erlebt. Als Emigrant war er um die Mitte der siebziger Jahre hier angelangt. Wenigstens gab er sich als Emigrant aus.
Igor Sotis hatte ein Leben hinter sich, von dem er nicht gern sprach und das auch keiner in Berlin kannte. Man fand sich damit ab. dass er ziemlich verschlossen war, wenngleich freundlich, geschäftstüchtig. Immerhin hatte er bei seiner Einbürgerung vor der Behörde auf mehrjährigen Aufenthalt in sowjetischen Straflagern verwiesen und auf seine lettische Nationalität als Grund für Verfolgungen in dem Land, aus dem er kam.
Deutsche Beamte pflegten in jener Zeit stets ihr Bedauern darüber auszudrücken und Genehmigungen verschiedenster Art freizügig zu erteilen: Sowjetbürger contra System - wer weiß, wie man den später einmal brauchen kann!
Die wahre Geschichte lag um einiges anders, aber auch wiederum nicht besonders weit entfernt von einer Menge ähnlicher Schicksale. Der kleine Igor kam in einem schäbigen Spital in Riga zur Welt, nachdem die Rote Armee gerade die drei baltischen Länder besetzt und in ihr Staatssystem eingegliedert hatte. Die Mutter starb im Kindbett. Ein Vater war nie erschienen, um seinen Spross einzufordern. Wie es weiterging, daran hatte Igor Sotis nur vage Erinnerungen. Darin kam ein Waisenhaus vor, in dessen Esssaal ein buntes Porträt von Feliks Dsershinsky hing. Mit dem spitzbärtigen Heroen, der sein Bild bevorzugt in Waisenhäusern aufhängen ließ, ohne dass jemand den Grund dafür herausbekam, hatte Sotis nichts weiter im Sinn. Er erwies ihm die geforderte Ehrerbietung durch Auswendiglernen seiner Daten, und im Übrigen verwandte er seine ganze Aufmerksamkeit auf die Schlosserlehre, die er von allen Angeboten am lohnendsten fand.
Bis er, schon zwanzigjährig, eines Tages vom Geschäftsführer eines Gemischtwarenmagazins in einer größeren Stadt dabei überrascht wurde, wie er kurz nach Feierabend die enttäuschend unergiebige Kasse ausräumte. Er haute dem unerwartet auftauchenden Mann die leere Schublade auf den Schädel und verschwand.
Der Sicherheit halber wählte er seine nächste Lebensstation weit vom Tatort entfernt, in Odessa. In der ganzen Union war bekannt, dass sich gerade in dieser südlichen Hafenstadt das Gesetz als wenig wirksam herausgestellt hatte. Wenn es irgendwo noch fest gefügte Gemeinschaften von Blatnyes gab, dann war es Odessa. Und Blatnye nannte man solche Leute, die ihren Lebensunterhalt nicht durch die so genannte ehrliche Arbeit bestritten.
Bei den Leuten, die er in der ukrainischen Millionenstadt mit ihrem ausgeprägten Hafenstadtmilieu zuerst traf, handelte es sich meist um Georgier, Armenier. Aserbeidschaner, Osseten, Tschetschenen, und nur gelegentlich um ein paar Russen. Die Georgier beherrschten die Szene unter den Neuankömmlingen, den Kintos, eine Bezeichnung, die auch Sotis trug, bis er in einer der Rasborkas, einer auf Einbrüche spezialisierten Gang, zum Patzan wurde, wie man die Anfänger bezeichnete. Doch Sotis mit seinem Schlossertalent und dem wachen Verstand blieb kein Anfänger. Zwei Jahre und etwa hundertzwanzig Einbrüche später war er bereits ein erfahrener Domuschnik, wie die Wohnungseinbrecher hießen. Als er sich zum "Schwergewichtler" entwickelte und anfing, gemäß dem Berufsbild dieser höheren Kategorie Geschäfte auszunehmen, erwischte die Miliz ihn.
Das Lager, in das er nach dem Prozess kam, zusammen mit einer Anzahl anderer "Tätowierter", hieß einfach Strojka und lag am Jenissei. Die Häftlinge bauten hier lang gestreckte, einstöckige Gebäude, von denen nicht einmal das Wachpersonal wusste, wozu sie eines Tages dienen sollten.
Sotis baute genau vier Monate mit. Dann hatte er sich seine "Stameska"-Sammlung aus herumliegendem Baustahl zusammengebastelt, ein Dutzend hochwertiger Einbruchswerkzeuge, denen kein Schloss widerstand, auch nicht das des Karzers, in den er sich absichtlich einsperren ließ, weil er in der Nähe des am Wachgebäude außen angebrachten Sicherungskastens lag, unweit des elektrisch geladenen Zaunes.
Die Tür des Karzers war nicht der Rede wert, der Sicherungskasten auch nicht. Sotis brauchte für beides mit seinen Instrumenten nur Sekunden. Danach kroch er in der mitternächtlichen Dunkelheit über den Zaun und durch die Taiga, bis er am Fluss anlangte, wo der Chef des Lagers seinen Kajütenkreuzer liegen hatte. Er warf die dort residierende Zweitfrau des Herrn Obersten ins Wasser und brauste bis nach Krasnojarsk, wo er in einen Eisenbahnzug stieg, in dessen Speisewagen eine Hilfskraft willkommen war.
Einen Monat später war er wieder in Odessa, saß in der Tschernomorskaja mit ein paar alten "Schwergewichtlern" in einer Malina beim Cinandali, und hier wurde nach gründlichem Erwägen der internationalen Chancen für gewinnbringende Tätigkeit beschlossen, Igor Sotis mit sehr gut nachgemachten Papieren in die Weltstadt Berlin zu entsenden, gewissermaßen als Außenbeamten einer weit verzweigten Firma.
Dem Beamten der Einbürgerungsbehörde im damals noch "westlichen" Teil der deutschen Metropole wurde von einem unscheinbaren Herrn aus Karlshorst, Armenier, unverwechselbar, dezent ein Geldgeschenk überbracht, und wenig später sorgte derselbe Herr, der in Karlshorst gelegentlich auch Uniform trug, Offizierstuch, über seine ausgedehnten Verbindungen dafür, dass der Emigrant Sotis zunächst in der Kantstraße einen kleinen Laden samt Wohnung, Lagerraum und Garage mieten konnte. Der Weitgereiste stellte eine sehr junge Deutsche als Mädchen für alles an, ließ sie im Laden Feuerzeuge, Marienfiguren mit beleuchtbarem Heiligenschein, Präservative mit Mickymäusen an der Spitze, billige Fotoapparate, Transistorradios, japanische Hartgummi-Armbanduhren, Tränengassprays, parfümiertes Lampenöl, Schnupftabak, Taschenmesser, Kompasse, Blechbüchsen mit Berliner Luft, Stadtkarten mit den Stehplätzen der Strichmädchen, Nippesfiguren, Taschenrechner, Superklebstoff, Kugelschreiber, Kaminstreichhölzer und ähnlich originelle Artikel verkaufen, während er sich zunächst in mehreren Intensivkursen ausreichende Kenntnisse in der deutschen Sprache aneignete.
Hinweise des Herrn aus Karlshorst, der auf unergründliche Weise mit den Tätowierten Odessas verbunden war, wiesen ihm den Weg zu Leuten, die in Abstellräumen auf Hinterhöfen ganze Wagenladungen von Fernsehgeräten, Stereoanlagen, Blockbustern und anderen hochwertigen Apparaten lagerten. Sie hatten alle denselben Makel, sie waren gestohlen. Aber sie waren billig zu erwerben. Und - etwa in Moskau - konnte man ein Vermögen an Rubeln mit diesen Symbolen anspruchsvollen Privatlebens verdienen.
Die Rubel, diesen Weg fand Sotis mit Hilfe des Karlshorster Herrn schnell heraus, ließen sich auf verschiedenen Kanälen leicht in den Ostteil Berlins transportieren, dort zu Ostmark machen und dann durch Landsleute, die von Zollkontrollen aus diplomatischen Gründen befreit waren, in prall gefüllten Köfferchen in den Westteil der Stadt schaffen, wo Wechsler sie gegen jede beliebige Währung der Welt eintauschten. Sotis hatte nicht nur dem freundlichen Herrn aus Karlshorst ein gewisses Entgelt für seine Dienste zu zahlen, auch die Transporteure größerer Warenposten, meist Leute aus Karlshorst oder Wünsdorf, denen erlaubt war, "Privateigentum" in unkontrollierten Containern nach Moskau zu verschicken, mahnten Entlohnung an. Trotzdem - zwei Jahre nach seinem Einstieg in das Geschäft, das in dem kleinen Laden in der Kantstraße begann, hatte Igor Sotis die erste Million auf einem sicheren Zahlenkonto, außerdem hatte er das ganze Haus in der Kantstraße und eine Villa im Grunewald gekauft.
Außer der begehrten Unterhaltungselektronik verkaufte er inzwischen ganze Waggonladungen von Kühlschränken und Waschmaschinen ostwärts. Es gab eine Erscheinung, hinter die er erst nach einiger Praxis gekommen war: Mit der Menge der auf diese Weise "exportierten" Güter stiegen die Einnahmen, was ihm wiederum ermöglichte, bei den Beamten, die dafür zuständig und einem Zubrot zugeneigt waren, mit immer höheren Summen Stempel für immer umfangreichere Sendungen zu erstehen, und damit begann der Kreislauf von neuem - nur stetig anwachsend.
Igor Sotis, der fast jeden Tag in seinem abgewetzten Woolworth-Anzug in seinem kleinen Laden auftauchte, wo der Verkauf von Kleinigkeiten weiterging, war nicht der Einzige, den diese Art Geschäft reich machte, das im Grunde auf der unterschiedlichen technischen Entwicklung in verschiedenen Teilen der Welt beruhte. Auch seine ehemaligen Kumpane aus Odessa, die zum Teil jetzt bereits in Moskau als Empfänger von Sotis' Exporten residierten, mauserten sich zu respektablen Geschäftsleuten, denen der Umbruch im eigenen Lande zum Segen gereichte, weil er ihre Geschäfte offiziell machte. Und als der Abbruch der Grenzmauer in Berlin eine weitere Veränderung in das Geschäft brachte, verfügte Sotis längst über ein ausgedehntes Export-Import-Unternehmen mit weltweiten Verbindungen. In den industriell leistungsfähig gewordenen Staaten Asiens saßen seine wichtigsten Partner.
Aber auch ein gewisser Wladimir Kobzew aus Riga gehörte seit geraumer Zeit zu diesem Netz, als Billighersteller von Chips und gedruckten Schaltungen, die so mancher Fabrikant von Ramschware gern abnahm, weil sie immer noch zuverlässiger waren als das in den Hinterhofwerkstätten Taiwans hergestellte Zeug. Jetzt kam er mit der wohl letzten Schiffsladung, das heißt, das Schiff kam später, weil er selbst bequemer und schneller mit der SAS reiste...
"Nimm den Audi und hol ihn ab", trug Sotis seiner langjährigen Vertrauten Angela Lemnitz auf, die es vom Verkaufsmädchen in seinem Kramladen bis zu seiner engsten Vertrauten gebracht hatte, auch zu seiner zuverlässigsten und ausgekochtesten Mitarbeiterin.
Und das alles, ohne dass Sotis sie auch nur einmal angefasst hätte! Doch da machte Igor Sotis keine Fehler, dafür sorgte schon der Erfahrungsschatz aus Odessa.
Er hatte zugesehen, dass sie einen angemessenen Wohlstand erwerben konnte, aber er hielt sich strikt aus ihrem Privatleben heraus. Zumal er wusste, dass sie gelegentlich in ihrer Wohnung für eine Nacht den freundlichen Herrn aus Karlshorst empfing, der jetzt immer noch da war, aber eben keine Uniform mehr trug. Privatmann mit Geschäftsinteressen. Einwandfreie Papiere. Mochte sie mit ihm schlafen, für Igor Sotis gab es unter den Damen der Berliner Feierabendbranche genügend Möglichkeiten der Zerstreuung!
"Zu dir nach Hause?", erkundigte sich die Frau. Sie war groß, gut gewachsen, trug einen modisch schlappen Pullover aus irischer Wolle über der ebenfalls modisch nicht zu arg gestrafften Brust, und ihre Lagerfeld-Hose hatte mindestens das Monatsgehalt eines Chefarztes gekostet.
"Bist du plemplem?" Sotis tippte an die Stirn. "Was soll ich mit ihm bei mir? Quartiere ihn bei Steigenberger ein, dort ist alles vorbereitet. Richte ihm aus,. ich komme heute Nacht erst aus Tunis zurück. Bin morgen zum Brunch bei ihm. Für alle Fälle, damit er sich sicher fühlt, gib ihm meine Telefonnummer..."
Kobzew hatte damit gerechnet, dass er abgeholt würde, aber dass es eine gutaussehende Dame war. die da mit einem Schild hinter der Abfertigung stand, schmeichelte ihm zusätzlich. "Ich habe Sie gleich erkannt", begrüßte die Lemnitz ihn auf Englisch, bevor er sich vorstellen konnte. Sie riss das Pappschild mit seinem Namen in Fetzen und ließ es in einen Papierkorb fallen.
"Man hat aus einer langen Zusammenarbeit so seine Vorstellungen, auch wenn man den Partner nie gesehen hat - Willkommen in Berlin, Herr Kobzew. und eine Empfehlung von Herrn Sotis. Er lässt sich entschuldigen..." Sie sagte gekonnt ihren Spruch auf, und sie machte mit ihm gleich die Zeit für das späte Frühstück aus, zu dem Sotis kommen würde. Im Steigenberger gab es um diese Zeit Separées für ungestörte Zusammenkünfte.
Wladimir Kobzew gab sich Mühe, die seltsam anziehende und zugleich erstaunlich selbstsicher wirkende Frau nicht ungebührlich anzustarren. Er liebte diesen Typ. Vielleicht, weil es ihn um ihn herum nur selten gegeben hatte. Nicht männlich geworden, durch jahrelange Geschäftstätigkeit, und die weiblichen Attribute ebenso unauffällig wie gekonnt hervorhebend. Er lud sie zum gemeinsamen Abendessen ein. als er erfuhr, dass er im Steigenberger wohnen würde. Und er holte sich eine ebenso freundliche wie nachdrückliche Absage. Angela Lemnitz begleitete ihn bis auf sein Zimmer und überzeugte sich, dass es seinen Wünschen entsprach. Dann meldete sie ihn telefonisch in der Gaststätte an und ließ einen kleinen Tisch reservieren. Zuletzt schlug sie beiläufig vor: "Herr Kobzew, da ich leider anderweitig verpflichtet bin, nämlich innerhalb der Firma, solange Herr Sotis nicht zurück ist - ich schlage Ihnen vor, nach dem Essen die Hotelbar zu besuchen. Ein seriöser Platz, und dabei sehr gesellig. Da verkehren Leute aus Handel und Bankkreisen. Zuweilen verirren sich sogar ein paar Showgrößen hierher, der Ku-Damm liegt schließlich um die Ecke! Sie werden sicher Unterhaltung finden, ich glaube, es gibt auch ein Musik-Programm..." Da war nichts zu machen, das sah Kobzew ein. Die Frau war selbstverständlich vergeben, wie konnte ich auch auf den Gedanken kommen, ein solches Geschöpf würde ausgerechnet in Berlin nur noch auf mich warten!
"Ich freue mich auf Herrn Sotis, morgen", es klang trotz der Enttäuschung freundlich, und Angela Lemnitz registrierte, dass dieser Russe einer von denen war, die ihre Empfindungen weder auf der Zunge noch im Blick trugen.
"Clever?" Der kleine, freundliche Herr aus Karlshorst erwartete Angela Lemnitz im Parkhaus gegenüber dem Steigenberger. Die Frau öffnete sich die Tür zum Beifahrersitz selbst, während der Mann seelenruhig hinter dem Lenkrad sitzen blieb.
"Clever schon", gab die Lemnitz zurück, als sie neben ihm saß und nach einer Zigarette griff. "Aber er hat natürlich keine Ahnung von der Welt. Nur das Gefühl: Märchenprinz kommt in der Höhle an, in der sein geheimer Schatz gelagert ist."
"Hast du ihm die Bar offeriert?"
Sie lachte. "Musst du ewig alles nachprüfen? Du bist nicht mehr Zahlmeister in Karlshorst!"
"Gut, gut", brummte der kleine Herr verträglich. "Es ist nur so, dass man immer fürchtet, etwas vergessen zu haben..." Er ließ den Motor an und schaltete die Lampen ein. Otto Aberg, früher einmal höherer Bürosoldat in der obersten sowjetischen Militärbehörde für Ostdeutschland, damals dort als Victor Sagaradjan bekannt, war einfach verloren gegangen, als mit der Mauer in Berlin auch die sprichwörtliche Abgeschlossenheit der Besatzungstruppen ihr Ende fand. Er hatte seinen Abschied von den Streitkräften mit einer satten Summe aus Geschäften in der vorhergegangenen Zeit vorbereitet, auch mit einer kleinen Absteige im Hansa-Viertel, wo ihn die anderen beiden Mieter auf seiner Etage für einen wohlhabenden Kaufmann hielten, der schon ewige Zeiten in Deutschland weilte, zumal er so gut wie akzentfrei die Sprache des Landes beherrschte.