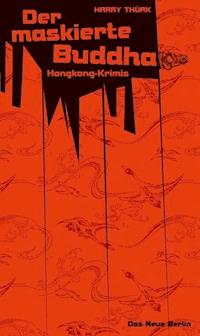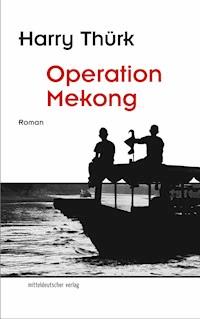Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mdv Mitteldeutscher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein fesselnder Tatsachenroman über die entscheidende Schlacht des ersten Indochinakriegs Indochina Mitte 1953: General Henri Navarre, neuer Oberkommandierender der französischen Truppen, weiß, dass er die vietnamesische Befreiungsarmee im Partisanenkampf nicht bezwingen kann. Er will der Viet Minh endlich in einer offenen Feldschlacht begegnen. Dien Bien Phu nahe der laotischen Grenze scheint ihm dafür geeignet. Fünfundfünfzig Tage und Nächte tobt der Kampf, dann fällt die Dschungelfestung der Franzosen – eine verheerende Niederlage für die Kolonialmacht. In seinem packenden Tatsachenroman um die entscheidende Schlacht während des ersten Indochinakrieges folgt der routinierte Erzähler Harry Thürk den historischen Ereignissen mit der Präzision des Berichterstatters und fesselt den Leser von der ersten bis zur letzten Seite mit den Wahrheiten und Schrecken des Krieges.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Harry Thürk
Dien Bien Phu
Roman
mitteldeutscher verlag
Vorher …
Nach Jahrhunderten, die erfüllt waren von Stammesfehden und feudalen Auseinandersetzungen, hatte Vietnams Kaiser Gia Long es zu Beginn des 19. Jahrhunderts geschafft, das von der südchinesischen Grenze bis zum Delta des Mekong reichende Land mit einem funktionierenden Staatsapparat zu versehen. Wirtschaft, Handel und Handwerk entwickelten sich, und die aus vielen Nationalitäten bestehende Völkerfamilie des Landes formierte sich zu einer Nation.
Frankreich erkannte den ökonomischen und strategischen Wert von Besitzungen in dem aufblühenden indochinesischen Land sehr bald. Es nahm die angebliche Gefährdung von dort arbeitenden christlichen Missionaren zum Vorwand, um im Herbst 1858 Teile seiner Kriegsflotte vor Da Nang auffahren zu lassen und die Übergabe der Hafenstadt zu erzwingen. Das war der Startschuß für eine in den nächsten fünfundzwanzig Jahren – Schritt für Schritt mit Schwert, Betrug, Erpressung, Täuschung und Bestechung durchgeführte Kolonialisierung ganz Vietnams.
Später wurden noch Laos und Kambodscha (Kampuchea) unterworfen, und von da an flossen Milliardeneinkünfte nach Frankreich, obgleich es in der einträglichen Kolonie niemals ruhig wurde: Bauernaufstände, Erhebungen nationaler Minderheiten, Demonstrationen und Arbeiterrevolten rissen nicht ab.
Überhaupt war es die sich im neuen, dem 20. Jahrhundert zur gesellschaftlichen Kraft formierende Arbeiterbewegung, die schließlich die voneinander unabhängig um Freiheit und Gerechtigkeit kämpfenden Kräfte im Lande vereinigte und damit größere Erfolge möglich machte. Ho Chi Minh, ein junger Patriot aus Zentralvietnam, der um diese Zeit in Frankreich arbeitete, begründete dort 1922 die »Liga der Völker der französischen Kolonien«. Französischen Kommunisten war er damals schon ein Bruder im gemeinsamen Kampf. 1930, nach den ersten großen Streikkämpfen illegaler indochinesischer Gewerkschaften, entstand folgerichtig die Kommunistische Partei Indochinas, die am Vorabend des zweiten Weltkrieges, 1937, den Zusammenschluß aller antifaschistischen, patriotischen und antikolonialistischen Kräfte der Nation zu einer gemeinsamen Front begann.
»Viet-nam doc lap dong minh« hieß die große Organisation, »Liga für den Kampf um die Unabhängigkeit Vietnams«. Sie erstarkte schnell im Widerstand gegen die japanischen Okkupanten, die mit den in der Kolonie verbliebenen französischen Militärkräften ein Stillhalteabkommen hatten, das von den hitlerfreundlichen Vichy-Kollaborateuren inspiriert war.
So blieben die Partisanen der Unabhängigkeitsliga, »Vietminh« abgekürzt, die einzigen ernsthaften Gegner der Japaner in Vietnam während des zweiten Weltkrieges. Kurz vor dem Zusammenbruch und der Kapitulation Japans waren im Norden Vietnams bereits sechs Provinzen völlig befreit, und diese Zone »Viet-Bac« wurde das Zentrum des bewaffneten Aufstands, der nun im ganzen Land losbrach.
Im August 1945 kapitulierte Japan. Die »Vietminh« schlugen überall gleichzeitig los. Sie entwaffneten die noch im Lande befindlichen Japaner und siegten binnen weniger Tage. Am 2. September bereits proklamierte Ho Chi Minh in Hanoi die Unabhängigkeit Vietnams.
An der ersten Provisorischen Regierung der Demokratischen Republik Vietnam, die sofort ein Programm des Aufbaus und der Reformen in die Wege leitete, waren Vertreter aller nationalen Gruppierungen beteiligt. Es schien so, als hätte die vietnamesische Bevölkerung endlich, nach fast hundert Jahren, Freiheit und Eigenstaatlichkeit errungen.
Frankreich jedoch gab seine mündig gewordene Kolonie nicht frei. Noch im September 1945 landeten zusammen mit britischen »Ordnungstruppen« die ersten französischen Soldaten in Saigon. Ein französisches Expeditionskorps unter General Leclerc folgte. Der Angriff auf die Volksmacht begann. Aber er traf auf stärkeren, bewaffneten Widerstand, als die Franzosen erwartet hatten.
Überall in der Welt, vor allem aber in Frankreich selbst, stieß das Vorgehen gegen Vietnam auf eindeutige Ablehnung. 1946 sah sich daher die französische Regierung genötigt, mit der Demokratischen Republik Vietnam zu verhandeln, die im Handstreich nicht auszulöschen gewesen war. Ho Chi Minh reiste nach Paris.
Im März 1946 anerkannte die französische Regierung in einem Abkommen, dessen Detailfragen 1947 geregelt werden sollten, grundsätzlich Vietnam als »freien Staat mit eigener Regierung, eigenem Parlament, eigenen Streitkräften und Finanzen«. Allerdings hatte sie dabei vorerst nur den Norden und die Mitte des Landes im Auge. Der Süden sollte später durch eine Volksabstimmung über seine Zugehörigkeit zur DRV entscheiden. Dennoch – Frankreich akzeptierte, Vietnam bis April 1951 völlig zu räumen.
Für die DRV war das Abkommen (auch als »modus vivendi« bezeichnet), nicht voll zufriedenstellend. Aber Ho Chi Minh unterzeichnete es trotzdem. Er wollte Franzosen wie Vietnamesen einen vielleicht jahrelangen, verlustreichen Kolonialkrieg ersparen.
Seine Friedensbereitschaft wurde nicht belohnt. Während in Hanoi eine Kommission der DRV-Nationalversammlung am Entwurf der ersten Verfassung arbeitete, provozierte die französische Flotte in Haiphong schwerwiegende Auseinandersetzungen. Einige tausend vietnamesische Opfer waren zu beklagen. Und Frankreichs Kommandeure erhielten aus Paris den Befehl, die Situation auszunutzen und mit jedem nur verfügbaren Mittel die Regierung der DRV zu entmachten. Der nächste Akt war ein französischer Angriff auf den Sitz des Präsidenten Ho Chi Minh, und danach die Aufforderung an die Streitkräfte der DRV, die Waffen niederzulegen.
Damit begann der französische Kolonialkrieg gegen den neuen Staat. Er sollte siebeneinhalb Jahre dauern. Dann war Frankreichs Expeditionskorps strategisch am Ende. Nur die Generale und die hinter ihnen verborgenen Interessengruppen aus Wirtschaft und Politik, für die Indochina unverzichtbar schien, wollten das Handtuch nicht werfen. Sie schickten Henri Navarre als neuen Chef des Expeditionskorps nach Vietnam. Er sollte die noch junge, in vieler Hinsicht schlecht ausgerüstete Volksarmee der DRV in eine sogenannte offene Feldschlacht locken, in der die Franzosen letztlich doch noch den Sieg zu erringen hofften.
General Navarre, mit dessen Dienstantritt in Vietnam dieses Buch beginnt, wählte als Platz für die Entscheidungsschlacht Dien Bien Phu aus. Er wußte genau, daß er die Entscheidung dort in sehr kurzer Zeit erringen mußte: Für den Frühling 1954 war von den Außenministern der westlichen Großmächte auf Drängen der Sowjetunion Genf als der Ort vereinbart worden, an dem eine internationale Konferenz den Indochinakrieg beenden sollte …
Ho Chi Minh
Jahrgang 1890, die herausragende Persönlichkeit der vietnamesischen Revolution, wuchs in einer Familie auf, in der die Gedanken an Freiheit und Unabhängigkeit stets wach gewesen waren. Günstige Umstände erlaubten es ihm, sich Schulbildung zu erwerben, und der wißbegierige Nguyen Van Thanh, wie er eigentlich hieß, übte später sogar den Beruf eines Lehrers in einer Schule aus, die von einer Fabrik in Huê unterhalten wurde.
Bald erkannte der junge Revolutionär jedoch, daß er zuwenig von der Welt wußte, um der Befreiungsbewegung im Vaterland eigene Impulse zu geben, und weil es ihn dazu drängte, heuerte er kurzerhand als Hilfskoch auf einem französischen Dampfer an: ein erster Schritt zur entscheidenden Erweiterung seines Horizontes.
Er wechselte, um die Spur zu verwischen, seinen Namen, und er sah nicht nur Frankreich, sondern auch Spanien, Portugal, England, die afrikanischen Länder am Mittelmeer und Irland.
Während des ersten Weltkrieges arbeitete (als Fotograf) und studierte er in Frankreich, später in den USA. Bei Kriegsende, eng verbunden mit der Sozialistischen Partei Frankreichs, übergab er der Versailler Konferenz eine Denkschrift über sein unterdrücktes Volk.
Seine politische Arbeit wurde immer zielstrebiger. So gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der KP Frankreichs und war der erste vietnamesische Kommunist, der fortan im Kolonialland Frankreich für die Unabhängigkeit kämpfte. Er verfaßte eine Vielzahl politischer Schriften und gab eine in seinem Land viel beachtete Zeitschrift heraus. Sein politischer Weg führte ihn weiter: in die Sowjetunion zur Kommunistischen Internationale, nach China, Deutschland, der Schweiz und wieder zurück nach Asien, wo er 1930 mit anderen Revolutionären die KP Indochinas gründete.
Von da an war er der kluge, welterfahrene, am Internationalismus orientierte Führer der vietnamesischen Befreiungsbewegung, die zuerst gegen die japanische Besatzung bewaffneten Widerstand leistete, die Okkupanten besiegte und die Republik proklamierte.
Damit aber begann ein neuer Kampf gegen den alten Feind, den französischen Kolonialismus. Er führte nach Siegen und Niederlagen schließlich zu der letzten Schlacht, um Dien Bien Phu, die endlich die Unabhängigkeit Vietnams von Frankreich zur Tatsache machte.
Truong Chinh
Der 1907 in der Provinz Nam Dinh geborene Lehrerssohn gehörte seit seinem 18. Lebensjahr zur revolutionären Bewegung in Vietnam. Drei Jahre später verhafteten ihn die Franzosen, und er mußte sechs Jahre im Gefängnis verbringen. Nach Beginn des zweiten Weltkrieges kämpfte er als Partisan zuerst gegen die japanischen Okkupanten und später wieder gegen die Franzosen, die ihn in Abwesenheit zum Tode verurteilten. Truong Chinh leitete das oberste Gremium des Volksaufstandes gegen die zurückgekehrten Franzosen.
Seit 1941 war er Generalsekretär des ZK der Partei. Mit Ho Chi Minh, Pham Van Dong und Vo Nguyen Giap zusammen war er an der Planung und Leitung der Schlacht um Dien Bien Phu beteiligt.
Pham Van Dong
1906 geboren, gehörte er schon als Student zur revolutionären Bewegung in Vietnam. 1929 wurde er von den französischen Kolonialtruppen gefangengenommen und auf die berüchtigte Gefängnisinsel Poulo Condor geschafft.
1936 konnte er freikommen. Von da an arbeitete er mit anderen führenden Revolutionären, vor allem mit Ho Chi Minh, an der Befreiung, lange Zeit im Süden des Landes. Er wurde Außenminister der Volksregierung. 1954 nahm er als Vertreter der DRV an der Genfer Konferenz über die Beendigung des Indochina-Krieges teil.
Vo Nguyen Giap
Er wurde 1912 in Vinh (Zentralvietnam) geboren und reihte sich bereits als junger Mann in den antikolonialistischen Kampf seines Landes ein. Während er später an der Universität Hanoi Geschichte und Geographie lehrte, gehörte er schon zum Zentrum der kommunistischen Bewegung und arbeitete illegal mit Ho Chi Minh zusammen.
1940 entzog er sich der drohenden Verhaftung durch Emigration nach China. Doch bereits zwei Jahre später war er wieder in seiner Heimat, wo er im bewaffneten Widerstand gegen die ins Land eingedrungenen Japaner aus den ersten, verstreut operierenden Partisanengruppen den Kern der späteren Volksarmee formierte.
Ho Chi Minh hatte schon in den Anfängen des antikolonialistischen Aufbegehrens die großen Fähigkeiten des Historikers Giap erkannt und arbeitete eng mit ihm zusammen. In der ersten Provisorischen Regierung der mit der Augustrevolution 1945 ausgerufenen Republik Vietnam bekleidete Giap das Amt des Innenministers. Mit Einsetzen der französischen Intervention und der Verstärkung des Befreiungskrieges widmete er sich mehr und mehr militärischen Aufgaben und entwickelte sich zu einem umsichtigen mutigen Feldherrn. 1953/54 leitete er die Operationen der Volksarmee bei Dien Bien Phu, die das Ende des französischen Kolonialregimes herbeiführten.
Bis ins hohe Alter blieb Giap an der Seite des Präsidenten Ho Chi Minh Verteidigungsminister.
Gaston le Fou
»Alle Huren versammelt?« fragte der Capitaine in streng militärischem Ton, als sich am Eingang der Maison de France, dem Sitz des französischen Hochkommissars von Vietnam, der Wachführer, ein Lieutenant, vor ihm aufbaute.
»Geh nach Hause, Gaston«, riet der Lieutenant dem Capitaine mit gedämpfter Stimme. »Du weißt, es gibt Ärger …«
Der Capitaine ließ sich nicht so einfach abweisen. Für heute, den 21. Mai 1953, hatte Hochkommissar Jean Letourneau, den manche Leute den biblischen Fürsten von Tongking nannten, zu einem großen Abendempfang eingeladen. Hanoi war um diese Zeit schon ein ziemlich heißer Ort, es gab keinen Regen. Wie immer unterschieden sich hier im Delta des Roten Flusses die Tagestemperaturen kaum von denen, die abends und nachts herrschten. Altgediente Kolonialoffiziere allerdings meinten, dieser auslaufende Frühling gliche einem angenehmen europäischen Hochsommer.
»Ich muß die Ärsche aller Huren sehen!« beharrte Capitaine Gaston Janville. »Nur wenn ich die Ärsche kontrolliere, kann ich Dung wiedererkennen. Im Gesicht unterscheidet sie sich kaum von tausend anderen Gelben, besonders wenn sie sich schminkt. Aber ihr Arsch – er ist unvorstellbar. Und unverwechselbar, seit damals nämlich …«
Der Wachführer zog ihn behutsam von der Freitreppe fort, zur Seite, wo er versuchen wollte, ihm das Eindringen in die feine Abendgesellschaft des Hochkommissars auszureden. Jeden anderen hätte der Lieutenant sofort abführen lassen – Gaston war ein Sonderfall. Man nannte ihn nicht umsonst Gaston le Fou, Gaston der Narr. Und so hörte er sich geduldig wieder einmal die alte Geschichte an, die er längst kannte: Dung, eine vietnamesische Prostituierte, war die große Liebe des Capitaine gewesen, bevor man ihn mit einer kleinen Truppe nach dem östlichen Laos geschickt hatte, auf Fernpatrouille. Oberbefehlshaber Salan hatte sich eine nachhaltige Störung der laotischen Befreiungsaktionen von solchen schlagkräftigen Einheiten versprochen. Von versteckten Stützpunkten aus sollten sie das Hinterland des Gegners verunsichern. Gaston Janville war auf dem Hügel 743 gelandet, zwölf Soldaten, mitten im ewig grünen, verfilzten Regenwald des nördlichen Laos, wo es zwischen Hügeln und Flüssen keine Straßen mehr gab, nur noch schwer zu entdeckende Pfade und Wildwechsel.
»Sie ist als Kind von einem Affen gebissen worden. Eine schreckliche Wunde, deren Narbe heute noch zu erkennen ist. Wenn ich nur die Ärsche kontrollieren kann …«
Er wollte wieder zum Eingang, aber der Chef der Wache hielt ihn mit sanfter Gewalt zurück und redete beruhigend auf ihn »Sie ist nicht unter den Weibern hier, Gaston. Ich habe sie selbst in Saigon gesehen; sie lebt jetzt dort!«
Janville schüttelte den Kopf. »Das würde sie nie tun, lieber Freund! Sie ist mir treu. Sie wartet auf mich, sie erkennt mich nur nicht. Es war dunkel, damals. Und ich muß ihren …«
»Ja, ja«, fiel der andere ihm ins Wort. »Wenn du die Narbe siehst, klar. Nur – Dung lebt tatsächlich in Saigon. Findest sie im ›Arc-en-Ciel‹; das Lokal gehört ihr. Ehrlich, Gaston, du kannst mir das glauben, sie hat mich nämlich nach dir gefragt. Und jetzt geh, bevor es Ärger gibt. Saigon, ›Arc-en-Ciel‹. Flieg mit der nächsten Maschine ’runter, mach sie glücklich!«
Es war dem Lieutenant gelungen, den anderen zumindest nachdenklich zu machen. Jedenfalls empfand er es so. Janville versuchte nicht mehr, sich aus dem Griff des Wachführers zu befreien.
Gaston war alles andere als bösartig, obwohl er gut einen Meter neunzig maß, ein Hüne mit kohlschwarzem Haar unter dem hohen Képi der Armee. Dunkle Augen, die hilflos blickten, wenn er nachzudenken versuchte, wie jetzt. Eines der unzähligen tragischen und von den meisten belächelten Schicksale, die es in dieser Kolonialarmee der Franzosen gab. Dort, auf dem obskuren Hügel 743, war er mit seinen Soldaten in einen Hinterhalt geraten. Wie alles verlaufen war, blieb ungeklärt, weil Gaston Janville der einzige war, der es überlebte. Seine Leute fielen unter den Schüssen der Pathet-Lao-Soldaten, die vor und hinter dem gepanzerten Mannschaftswagen, der die Truppe beförderte, je einen Baum so gefällt hatten, daß die Straße blockiert wurde. Janville war, wie er selbst sich nach und nach erinnerte, vor dem Fahrzeug im Schrittempo marschiert, um nach vorn zu sichern. Ihn hatte der vordere Baum voll getroffen, am Kopf. Viel später, als sich weitum nichts mehr regte, war Janville aus seiner Betäubung erwacht. Er hatte Mühe gehabt, sich zurechtzufinden, und war dann, nachdem er sich von jedem seiner toten Männer verabschiedet hatte, zwei Monate lang durch Busch und Savanne getrampt; allein mit seinem Kompaß und dem lächerlichen Dienstrevolver, den die Pathet-Lao-Soldaten übersehen hatten.
Als er beim ersten französischen Außenposten am Schwarzen Fluß ankam, war er nicht nur total erschöpft und halb verhungert gewesen, seine Haut war von Dschungelgeschwüren bedeckt, und widerliche Egel hatten sich an vielen Stellen festgesaugt – Janville konnte sich nur schlecht darauf besinnen, was überhaupt geschehen war. Er gab an, er käme von einer Beerdigung und hätte sich verlaufen.
Einige Wochen vergingen, ehe sich bei ihm Spuren von Erinnerung zeigten, doch auch was Janville dann erzählte, war konfus. Er blieb im Lazarett stationiert, ein Objekt besonderen beruflichen Interesses für die Ärzte dort, die außerdem der Meinung waren, der Mann sei in einem Lazarett der Armee am besten aufgehoben. Im zivilen Leben Frankreichs würde er nur als willkommenes Beispiel für die Verderbnis des Kolonialkrieges benutzt werden. Außerdem hätte er keine Chance, sich durchzubringen. Die nicht gegen den Kolonialkrieg opponierende Hälfte der Franzosen liebte den Helden, nicht den Krüppel.
So galt der ehemals fähige Capitaine als harmloser Idiot, dem jedermann alles verzieh, was er in seinem geistigen Dämmerzustand anstellte. Die Ärzte beobachteten gelegentlich Phasen, in denen er für kurze Zeit ein klares Bewußtsein zu haben schien, aber sie hielten nicht an, wurden auch nicht häufiger.
»Du bist sicher, sie ist in Saigon?« wandte er sich jetzt an den Wachführer. Der atmete erleichtert auf. Es schien, als besänne sich Gaston, als habe sich da just in diesem Augenblick eine Kette klarer Gedanken angekündigt. Am besten, ich schicke ihn schnell weg, solange die Einsicht anhält, dachte er. Deshalb nickte er zustimmend. »Saigon, da mußt du hin, wenn du sie sehen willst. Laß dir von den Kerlen im Lazarett einen Flug besorgen. Wo das ›Arc-en-Ciel‹ ist, sagt dir jedes Kind in Saigon.«
Er schob Janville an der Freitreppe vorbei dem Ausgang des Grundstücks zu. Auf der anderen Straßenseite lag das »Metropole«, Hanois größtes Hotel, bewirtschaftet von Monsieur Louis Blouet, der als vorsichtiger Mann in Paris ebenfalls noch ein Hotel betrieb. Aus dem »Metropole« kamen mehrere hohe Offiziere, vor denen der Wachführer am Fuße der Treppe zu salutieren hatte.
»Geh jetzt!« flüsterte er Gaston zu, der sich auf die Straße zu bewegte. Dann stellte er sich, wie es die Wachordnung vorsah, an der ersten Treppenstufe auf und kommandierte: »Achtung!«
Salan, der elegante Oberbefehlshaber mit den blankgeputzten Generalssternen, dessen Ablösung bevorstand, kam federnd heran, in den Augen das starre Blinken, von dem der Wachführer wußte, daß es vom Opiumgenuß herrührte. Er würde hier auf seinen Nachfolger treffen, den General de Corps d’Armée Henri Navarre, Viersterneretter Indochinas, wie die Witzbolde ihn jetzt schon nannten, obwohl man eigentlich Respekt vor ihm haben mußte. Er war ein Mann mit dem Ruf von Besonnenheit und nüchterner Berechnung. Ob er diese Eigenschaften auch hier unter der sengenden Tropensonne angesichts eines Gegners behielt, der keine der in den französischen Kriegsschulen gelehrten Prinzipien von Strategie und Taktik befolgte?
Brigadier Cogny schob sich leicht hinkend heran, der breitschultrige Zweimetermann, dessen Division die wichtigsten strategischen Punkte im Delta des Roten Flusses besetzt hielt. Dickfellig und jovial, ein Fuchs mit der Gestalt eines Ochsen. Um den neuen Oberkommandierenden gleich an seine Wesensart zu gewöhnen, trug er nicht Gala, sondern den gescheckten Kampfanzug: Dies hier, Hanoi, war ebenso Kriegsgebiet wie jede Straßenkreuzung im Umkreis von hundert Kilometern, also war er, der sich nicht ungern »Chef des Deltas« nennen ließ, im Dienst. Immer, auch auf Empfängen. Er tippte an sein Képi und nickte dem Wachführer zu, als er die Treppe hinaufstieg. Niemand hätte vermutet, daß er den Grad eines Doktors der Rechtswissenschaften besaß.
Im Unterschied zu ihm erschien General Gonzales de Linarès eher zierlich. Er war der militärische Chef aller in Tongking, dem Nordteil Vietnams, operierenden französischen Truppen. Unter der vorgehaltenen Hand wurde er allerdings »Bürgermeister von Gia Lam« genannt, weil er sich jenseits des schlammigen Flusses, am anderen Ende der Daumer-Brücke, das Töchterchen eines chinesischen Beamten zur Geliebten genommen hatte. Deren Vater beteiligte den Galan der Tochter, wie es hieß, an den Einkünften, die er aus schwer zu ermittelnden Quellen kassierte, hauptsächlich aus dem Baugeschäft um den französischen Militärflugplatz, in dem Linarès unauffällig vermittelte. Die kleine, zierliche, stark geschminkte Chinesin brachte den General nur bis zum Eingang des Gouverneurspalastes, weil sie da drinnen nicht erwünscht war. Französische Generale hatten Statusprobleme, wenn es um einheimische Geliebte ging. Das Chinesenmädchen ärgerte sich darüber nicht sonderlich. Für sie war Gonzales de Linarès ein nicht mehr sehr appetitlicher Kolonialfranzose, mit dessen Hilfe die Familie Reichtum erwerben konnte. Sobald sich dieser Reichtum in fünfstelligen Ziffern darstellte, wurde er jeweils umgehend nach Paris transferiert, auf eine sichere Bank. Liebe war hier ein Geschäft, nicht mehr. Der eine gab, der andere zahlte. Freundinnen wußten von der Geliebten des Oberbefehlshabers der Tongking-Truppen, daß er ungeschliffen war, ständig aus dem Mund roch, zu viel soff und während des Geschlechtsverkehrs laut zu furzen pflegte. Nun ja, er würde bald nach Frankreich zurückkehren, aber bis dahin konnte man die mit seiner Bekanntschaft verbundenen Vorteile noch nutzen.
Gerade war Linarès am Wachführer vorbei und in die Halle getreten, da zog Gaston le Fou draußen am eisernen Gittertor, wo die Geliebte des Generals noch neben dem Wagen stand, der sie nach Gia Lam zurückfahren würde, erneut seine Glanznummer ab. Er baute sich vor der Dame auf, die ihm knapp bis zur Brust reichte, und tippte an sein Képi. »Madame, darf ich Sie höflichst bitten, Ihren werten Arsch frei zu machen, damit ich mich überzeugen kann, ob Sie Dung sind?«
Er sagte das in nahezu perfektem Vietnamesisch, und er brachte seinen absurden Wunsch mit einem Ernst vor, der unweigerlich zum Lachen reizte. Auch die Chinesin empfand das so. Sie prustete los, hielt sich dann aber sofort die kleine, manikürte Hand vor den Mund und besann sich.
»Was wollen Sie?«, fragte sie drohend zurück, in leidlichem Französisch, obwohl sie sehr gut verstanden hatte.
Gaston Janville wiederholte sein Anliegen, ernst, in gemessenen Worten, aber so laut, daß es jeder, der sich auf dem Weg zum Palast befand, hörte und sogleich schallend auflachte. Janville schien das nicht zu merken; sein Gesicht blieb unverändert ernst. Die Puppenzüge der Chinesin hingegen verzerrten sich von einer Sekunde auf die andere zu einer haßvollen Maske. Und ihre Stimme kreischte los, daß der Wachführer wie von einer Sumpfschlange gebissen herumfuhr und zum Tor hinaussprintete.
»Aber Madame«, beklagte sich Gaston gerade, »Sie müssen nicht böse mit mir sein. Ich kontrolliere die Ärsche aller Huren in Hanoi, nicht nur den Ihrigen! Es geht um mein Lebensglück! Nur an der Narbe des Affenbisses werde ich Dung wiedererkennen. Sie müssen wissen, wir taten es stets so, daß ich eben diese Narbe die ganze Zeit vor Augen hatte. Sie genoß es am meisten so, Ihr Gesicht – nun, man schminkt es …«
Weiter kam er nicht. Der Lieutenant nahm ihn am Arm und zog ihn resolut beiseite, während er sich zugleich durch eine Handbewegung mit dem Türsteher vor dem »Metropole« verständigte: einen Wagen!
»Gaston!« fuhr er Janville an, »du machst mir Ärger!« Er wußte aus mehrfacher Erfahrung, daß es sinnlos war, dem Capitaine Vorhaltungen zu machen. Nein, lediglich geduldiges Zureden half. Deshalb versicherte er ihm: »Das war sie doch auch nicht, Junge! Die da kenne ich, sie hat einen ganz glatten Hintern, blank wie ein gewienerter Gewehrkolben. Du irrst dich. Und nun mußt du unweigerlich heim, ins Lazarett. Du erregst hier Ärgernis, und du bist doch ein französischer Offizier, oder?«
Die Chinesin schüttelte noch einmal ihre kleine Faust, während sie, zur Erleichterung des Wachführers, in den Wagen ihres Liebhabers stieg, der sofort anfuhr. Und dann erkundigte sich Gaston Janville bei dem Lieutenant plötzlich ganz erstaunt: »Ich habe Ärger erregt? Das wollte ich nicht! Wie kam es? Ich kann mich an gar nichts erinnern …«
»Siehst du all die grinsenden Leute da?«
»Willst du sagen, sie grinsen über mich?« Janville wirkte ernüchtert.
Der Wachführer hatte den Verdacht, daß in diesem Augenblick wieder einmal eine Phase klaren Denkvermögens bei Gaston dem Narren eintrat. Deshalb flüsterte er: »Ja, über dich grinsen die, weil du den Arsch der Matratze von Linarès sehen wolltest! Mensch, reiß dich zusammen, verschwinde!«
»Jesus«, murmelte Janville, »er wird mich in den Arrest werfen lassen!«
»Das wird er nicht. Du bist ein Held, und außerdem blessiert. Da kommt der Wagen, der bringt dich zum Lazarett. Tu mir den Gefallen und bleib dort!«
Es war ein Sanitätsfahrzeug, das der Türsteher des »Metropole« herbeigerufen hatte. Die Besatzung kannte Gaston. Sie nahm ihn ohne weiteres Aufsehen in Empfang, verfrachtete ihn in den Wagen. Dabei redete der Fahrer ihm zu, im Lazarett wartet sein alter Kamerad, der Commandant Prunelle, auf den Partner für das tägliche Vingt-et-un; die Karten seien schon gemischt.
Das half. Gaston drängte zur Eile, als er an den Commandant erinnert wurde. In der Tat schien sein Kopf jetzt ziemlich klar zu sein, und er erinnerte sich im Beisein der Sanitäter weder an Dung noch an die kleine Chinesin, sondern lediglich an Prunelle, den alten, ebenso klugen wie fatalistischen Commandant mit dem amputierten Bein.
Drinnen im Gouverneurspalast, der diesen hochtrabenden Namen gar nicht verdiente, denn das Haus war nicht viel mehr als ein mit geringem Aufwand geschaffenes Verwaltungsgebäude im Kolonialstil, standen die Gäste mit ihren Champagnergläsern in Grüppchen beisammen und tratschten. Niemand hatte bei einer Zusammenkunft dieser Art jemals etwas anderes erlebt: man ließ sich sehen und klatschte mit ebenfalls Gesehenen über jene die nicht zu sehen waren.
General Navarre, der zukünftige Oberkommandierende, bekam von Salan, den er ablöste, die höheren Offiziere vorgestellt, die er noch nicht kannte. Sie würden fast ausnahmslos in einigen Wochen ebenfalls ihre Koffer packen. Navarre wußte das, und er begrüßte sie mit jener höflich-zurückhaltenden Freundlichkeit, die überall auf der Welt benützt wird, um Desinteresse zu verschleiern. Die Mannschaft Salans, die schon zur Zeit von dessen gescheitertem Vorgänger De Lattre de Tassigny nach Indochina gekommen war, hatte ihre dreißig Monate Kolonialdienst abgeleistet, und damit war die wichtigste Voraussetzung für spätere Beförderungen, aber auch für die Pension erfüllt. Außerdem hatte Salan es geschickt verstanden, die Tatsache bekanntzumachen, daß Navarre nie in Übersee gedient hatte. Was konnte ein kolonialerfahrener Offizier schon unter einem so unbedarften Mann an Meriten erwerben?
Cogny, der Brigadegeneral mit der Herkulesfigur, war der einzige höhere Offizier, der bleiben würde. Er tat es nicht wegen Navarre; er kannte ihn kaum. Aber er liebte die Art, in der er hier Dienst machen konnte. Dies war ein Krieg, bei dem zwar nichts weiter herauskam, aber er erhob einen Offizier in die Position eines Paschas, dessen Macht am Stationierungsort so gut wie unbegrenzt war. Alles stand ihm zur Verfügung, von den besten, in Korea erprobten US-amerikanischen Waffen, über reichlichen Sold, bequeme Lebensbedingungen bis zu den Weibern, die man sich hier buchstäblich kaufen konnte: Was man in Paris fürs tägliche Schuheputzen bezahlte, reichte in Vietnam aus, um eine Gespielin einen ganzen Monat zu unterhalten.
Cogny ahnte nicht, daß Navarre sich bereits in Saigon bei Vertrauten sehr genau über die personellen Veränderungen in seinem Kommando informiert hatte, die für die nächste Zeit anstanden. Er hatte nicht nur einen Ersatzmann für Linarès parat, auch die Anwärter auf den Posten des Stabschefs in Saigon und des Chefs der Luftstreitkräfte standen bereits fest.
Für Cogny hatte Navarre den Oberbefehl über die Truppen in Tongking vorgesehen. Er hielt ihn für einen erfahrenen Mann, der ihm zur Hand gehen würde, vorausgesetzt, man ermunterte ihn. Navarre war klug genug, auf einen erfahrenen Mann wie Cogny nicht zu verzichten. Er kannte die Grenzen seiner eigenen Erfahrungen über diesen Kriegsschauplatz, der aus unermeßlichen Dschungeln, rauhen Gebirgen, Sümpfen und schlammigen Reisebenen bestand, aus wenigen Städten und einer Unzahl von winzigen, stets feindlichen Dörfern, aus brütender Hitze und sintflutartigem Monsunregen, aus Moskitos und Schlangen, Handgranaten werfenden Bäuerinnen und exakt schießenden Kindern.
In Paris war er durch Ministerpräsident Mayer von seinem Posten beim Oberkommando der alliierten Streitkräfte in Westeuropa zurückberufen worden. Der Zivilist Mayer war dem General ziemlich ratlos erschienen, als er ihm die Lage in Indochina schilderte: Rote, von den Truppen der Vietminh beherrschte Gebiete, die einen großen Teil Vietnams ausmachten, Unruhe in Kambodscha und die Gefährdung des gesamten nördlichen Laos durch die Pathet-Lao-Truppen, mit denen die des vietnamesischen Kommunistenführers Ho Chi Minh verbündet seien. Sie handelten koordiniert, mit dem Ziel, die von Frankreich erneut angestrebte Herrschaft über die Länder Indochinas zu vereiteln. Beinahe ein Jahrzehnt schlug man sich damit herum. Ein Erfolg Frankreichs wurde nicht einmal mehr von Optimisten für möglich gehalten.
»Es ist ein harter Auftrag, mon Général«, sagte Mayer. »Die Front ist keine Linie, wie man es in St. Cyr lehrt oder auf anderen Kriegsschulen. Jedes Gebüsch ist Front, jede Straße, jede Hotelterrasse. Und jeder zerlumpte Kuli ist ein potentieller Feind. Schweiß und Blut, das ist es, was ich Ihnen biete. Wir werden diese Kerle dort nicht ausrotten können. Es wird nie mehr so werden, wie es einmal war. Aber wir brauchen einen Erfolg. Der muß so aussehen, daß Ho Chi Minh gezwungen wird, unsere Bedingungen für die Bindung Vietnams an Frankreich anzunehmen. Damit wäre eine Integration Vietnams in die Französische Union möglich, und wir hätten wenigstens etwas gewonnen, wenngleich nicht viel. Mehr ist aber nicht möglich, mon Général, deshalb sollen Sie das Wenige erkämpfen. Und – es darf nicht mehr lange dauern. Wir sind am Ende unserer Mittel angelangt. Schon heute stützen wir uns in einer Weise auf die USA, die nicht nur bei mir persönlich Bedenken hervorruft …«
Wie wahr das alles war und wie ernst, hatte General Navarre schnell begriffen, nachdem er sich zunächst in Saigon allgemein orientiert hatte: Zwei Milliarden alter Francs kostete das Abenteuer täglich, das von den meisten Franzosen inzwischen zornig als »schmutziger Krieg« bezeichnet wurde. 125000 Mann regulärer französischer Truppen bestritten ihn, abgesehen von den Legionärseinheiten, zusammen mit etwa 300000 einheimischen Söldnern und Zwangsrekrutierten. 25000 Franzosen und Angehörige der Fremdenlegion waren seit 1945 in Indochina gefallen, weitere 20000 vermißte man. Die Ausfallziffern der einheimischen Hilfstruppen erreichten etwa die gleiche Höhe. Zu Hause gab es Massenproteste gegen die Verlegung von Truppen nach Indochina; Streiks rissen nicht ab; in regelmäßigen Abständen waren die Straßen der Städte angefüllt mit Demonstranten, die ein Ende forderten. Verlaß, so schien es jedenfalls, war vorläufig noch auf die USA. Sie hatten sich von 1950 an immer stärker engagiert, um, wie sie es darstellten, Frankreich zu helfen, seinen antikommunistischen Feldzug in Indochina zu gewinnen.
General Navarre wußte, daß seine Chancen hier hochgradig von amerikanischer Hilfe abhingen. Aber er hatte wie viele andere Franzosen längst erkannt, daß die USA im Grunde versuchten, Frankreich vermittels ihrer »Hilfe« Indochina auf mehr oder weniger sanfte Art abzunehmen und es sich selbst anzueignen. Das war der eigentliche Hintergrund des »Vertrages über die gemeinsame Verteidigung Indochinas«, den sie 1950 mit dem finanzschwachen Frankreich abgeschlossen hatten. Seitdem residierte eine sogenannte US-Beraterkommission in Saigon, die eifrig ihre eigene Politik mit einheimischen Kollaborateuren machte. Immerhin aber trafen monatlich mindestens 6 000 Tonnen amerikanisches Kriegsmaterial in Vietnam ein; bisher waren das mehr als dreihundert Flugzeuge gewesen, über tausend Panzer und andere Fahrzeuge sowie dringend benötigte Munition und Schnellfeuerwaffen. Genaue Zahlen waren nicht zu erfahren, aber hinter vorgehaltener Hand hörte man, daß die USA bislang etwa 2 Milliarden Dollar investiert hatten und bereits zwei Drittel der Gesamtkosten des Krieges trugen. Die Rechnung, so befürchtete Navarre, würde Frankreich zu gegebener Zeit präsentiert werden.
»Verteidigung der freien Welt« war das Schlagwort der Amerikaner. Die weitreichende Spekulation, die sich hinter dieser Phrase verbarg, erwähnte anstandshalber niemand öffentlich, und doch gab es keinen französischen Kommandeur in Indochina, der sie nicht kannte.
Navarre hatte ein gutes Maß Ehrgeiz auf seinen neuen Posten mitgebracht. Schließlich konnte er hier beweisen, daß er an taktischem Geschick seine in der Militärhierarchie Frankreichs nicht gerade unbedeutenden Vorgänger zu übertreffen imstande war.
Er blickte auf, als Hochkommissar Letourneau ihm ein soeben aus Paris eingetroffenes Fernschreiben überreichte. Der Inhalt überraschte den General nicht. Was da bestätigt wurde, hatte er selbst von Saigon aus, wo er noch vor Tagen gewesen war, veranlaßt.
»Rufen Sie Cogny!« trug er einem Adjutanten auf.
Der Brigadier baute sich vor ihm auf, eine eindrucksvolle Figur, sichtlich um militärische Straffheit bemüht. Sein Tarnanzug hob ihn um einiges von den festlich aufgeputzten Gästen ab, deren Hemden durchgeschwitzt waren, unter deren Achseln sich dunkle, feuchte Flecken bildeten. Navarre lächelte. Er besann sich aber sogleich, daß jedes Lächeln sein Gesicht zur Visage eines Fauns werden ließ, und wurde wieder ernst, als er ihn ansprach: »Brigadier Cogny, ich ernenne Sie im Auftrag der Regierung der Republik zum Général de Division!«
Er übergab ihm das Fernschreiben, weil die für den Beförderungsakt fällige Urkunde noch nicht eingetroffen war. Dann nahm er aus der Hand des Adjutanten mehrere Exemplare des dritten Sterns und gab sie dem Beförderten.
Cogny bedauerte es, daß er sein Képi abgenommen hatte und deshalb nicht die Hand zum militärischen Gruß heben konnte. Er liebte Fotos, die ihn bei der Flaggenparade zeigten, mit der Hand am Mützenrand, alle anderen in seiner Größe überragend. Ein Hauch von Bedeutsamkeit! Jetzt mußte er es dabei belassen, das breite Kinn an die Brust zu drücken und Navarre laut und deutlich zu versichern, er werde sich des Vertrauens, das in ihn gesetzt werde, würdig erweisen.
Es fiel nicht auf, daß er sich nicht ausdrücklich bedankte. Das wäre nicht Cognys Stil gewesen. Er hatte lange auf Beförderung gewartet, und wenn ihn etwas daran beeindruckte, dann war es der Umstand, daß seine Ernennung zum Divisionsgeneral eine der ersten Amtshandlungen Navarres war. Dazu kam die nüchterne Rechnung, daß nun, nachdem die Garnitur der »Alten« heimfuhr, er, Cogny, der erfahrenste Kommandeur auf dem Kriegsschauplatz sein würde, mithin zwangsläufig der engste Berater Navarres in allen entscheidenden Fragen. Navarre sollte einen zuverlässigen Vertrauten in ihm haben!
Wie zügig Navarre über berechnete Präliminarien zum Kern der Sache vorzustoßen gedachte, zeigte sich wenige Minuten später. Die Kapelle schweißtriefender Militärmusiker auf der Empore im Hintergrund hatte sich durch eine Serie von Märschen gequält und griff nach den Biergläsern. Navarre machte Cogny ein Zeichen. »Ich habe noch mit Ihnen zu reden.«
Der Adjutant achtete darauf, daß sie sich an einem Tisch, abseits des Gedränges, ungestört unterhalten konnten.
»Übrigens werde ich Sie zum Oberbefehlshaber unserer in Tongking operierenden Truppen ernennen«, begann Navarre. Er winkte ab, als Cogny seine Freude darüber ausdrücken wollte. »Sprechen wir über unsere Aufgabe hier. Etwas unübersichtlich geworden, der Krieg, wie?«
Cogny erklärte, das Delta des Roten Flusses, die am dichtesten besiedelte, an Reis reichste und für den Verkehr wichtigste Gegend, sei einigermaßen gesichert durch die überall errichteten Bunker, aus denen heraus das Umfeld überwacht werden könnte. Er drückte sich vorsichtig aus, sagte »einigermaßen«. Dieser neue Oberkommandierende war kein Narr; er sah selbst, wie die Dinge standen.
»Immer schon habe ich überlegt«, fuhr Navarre fort, »ob wir uns hier nicht auf eine für uns nachteilige Defensivtaktik eingelassen haben. Wir sind eine mobile Armee, beweglich, auf den Angriff trainiert. Warum müssen wir unsere Leute in diese Betonklötze stecken und dort langsam faul und fett werden lassen? Glauben Sie nicht, daß wir zum Angriff zurückfinden müssen, Cogny?«
Der neuernannte Divisionsgeneral machte eine Kopfbewegung, die Zweifel andeutete. »Ich weiß nicht, mon Général, vielleicht sollten wir das. Aber dies ist kein normales Land, und die Vietminh sind keine normale Armee, die sich so einfach zur Schlacht stellt. Wie oft haben wir in der Vergangenheit irgendwo eine Ortschaft, eine Gegend durchkämmt, von Gegnern gesäubert – mit dem Ergebnis, daß nach ein paar Wochen alles wieder beim alten war! Im Delta tun wir alles, damit unsere Übersicht nicht total zusammenbricht …«
»Ich meine nicht tausend kleine Angriffe, Cogny«, unterbrach ihn Navarre. »Für mich geht es um die strategische Offensive, die Umkehr der Lage. Anstatt uns andauernd vor den Vietminh zu verteidigen, müssen wir dafür sorgen, daß sie dort, wo sie sich ungefährdet dünken, wo sie ihre Reserven haben, in ihrem Hinterland, unsere Operationen fürchten lernen.«
»Haben Sie entsprechende Vorschläge?«
»Vorerst nur diesen Vorsatz«, gab Navarre zurück. »Aber ich werde mir in den nächsten Tagen durch Erkundungsflüge einen Überblick verschaffen, wie die Dinge tatsächlich stehen. Hier ist, wie mir scheint, zu lange geschlafen worden.«
»Eins ist jedenfalls sicher«, erklärte ihm Cogny mit Überzeugung, »einen Angriff auf das Delta, auf Hanoi und Haiphong können die Roten nicht wagen. Weder jetzt noch später. Hier kommt uns das Gelände zu Hilfe, hier können wir unsere Materialüberlegenheit voll ausspielen. Das Delta ist sicher!«
Navarre nickte bedächtig. »Ich glaube, die Vietminh sind gar nicht am Delta interessiert, jedenfalls im Augenblick nicht. Sie bevorzugen die gebirgigen Regionen des Nordens, die Urwaldlandschaften, wo sie jeden beliebigen Unterschlupf finden. Dort können sie ihre Streitkräfte in aller Ruhe trainieren, auf Angriffe vorbereiten; dort verlaufen ihre logistischen Linien bis nach China hinein. Müssen wir nicht diese Ruhe stören?«
Cogny mußte zugeben, daß dies der Kern der Sache war. Und Navarre fügte seinen Überlegungen hinzu: »Betrachten Sie, wie sich die Lage in Laos entwickelt. Dort oben, in dem Gebiet, das an das Hinterland der Vietminh grenzt, herrschen in zwei entscheidenden Provinzen ebenfalls bereits Rote. Nennen sich Pathet Lao. Werden von den Vietminh unterstützt. Haben Sie die Landkarte im Kopf? Vergegenwärtigen Sie sich das militärische Potential, das sich da aufbaut! Der ganze Norden – ein massiver roter Block …«
»Nun«, wandte Cogny ein, »wir haben ja auch weiter im Süden, im zentralen Hochland und um Saigon beträchtliche Vietminh Konzentrationen …«
Das bestätigte Navarre. Man war bei der Sache.
»Mir ist davon berichtet worden. Diesen roten Kräften im Süden sollte unser nächster Schlag gelten. Wir müssen uns den Rücken freihalten, wenn wir hier im Norden offensiv werden wollen. Das heißt, den Süden mit Entschlossenheit säubern.«
Cogny vermeinte zu spüren, daß Navarre auf eine Art frontaler Bereinigung hinauswollte, auf ein Aufrollen des Gegners von Süden nach Norden. Das schien ihm so unsinnig, daß er sich vorsichtig erkundigte, wie er die Bemerkung verstehen solle, im Norden offensiv zu werden. Navarre versicherte ihm, es handele sich bei seinen Gedankengängen nicht um eine Aufrolltaktik. Er wisse sehr genau, der Charakter dieses Landes lasse das einfach nicht zu.
»Es wird keine endgültig gesicherten Gebiete geben, Cogny«, sagte er. »Nie werden wir das erreichen. Aber wir sind mobil. Wir können schnell irgendwo Schwerpunkte schaffen und dem Gegner Schlachten aufzwingen. Was Sie da im Delta machen, ist im Ansatz schon richtig, nur muß man es konsequent zu Ende führen: feste Punkte schaffen, ein System von Bunkern, Befestigungen, Forts in strategischer Verbindung miteinander, ja. Aber – dann darf man nicht darauf warten, daß ein paar Vietminh erscheinen, die man abknallt. Nein, man muß aus diesen festen Punkten heraus offensiv werden! In den Gegner hineinstoßen! Seine Linien durcheinanderbringen, seine Logistik zerschlagen. Verwirrung bei ihm erzeugen, ihn letztlich durch ein System bewaffneter Vorstöße in dem von ihm als sicher betrachteten Gebiet in die Defensive treiben. Das wird meine Strategie sein. Wissen Sie, warum?«
Cogny zog es vor, beifällig zu nicken. Diese Strategie war zu schön, um in Vietnam realisiert werden zu können. Ob dieser Neuling aus Mitteleuropa eine Ahnung hat, was es eine Patrouille unserer besten Leute an Toten, Verwundeten, Kranken, Erschöpften sowie an Material aller Art kostet, um zwanzig Kilometer tief ins Gebiet der Vietminh einzudringen? Und ob er sich denken kann, wie schnell die Überlebenden wieder zurück in ihren Stützpunkt möchten?
Als Cogny nichts sagte, klärte Navarre ihn auf: »Der Grund ist: Wenn wir die Vietminh auf ihrem eigenen Territorium schlagen, wenn wir sie so lange durch Vorstöße zermürben, bis sie nicht mehr an ihren Sieg glauben, dann ist der Augenblick da, in dem sie den Kampf zu Bedingungen aufgeben werden, die wir diktieren.«
»Welche?«, wollte Cogny wissen.
»Wir werden großmütig sein«, gab Navarre zurück. »Wir werden sie nicht vernichten, nicht ihre Auflösung fordern. Nur daß sie sich der von uns gesteuerten Zentralregierung in Saigon unterordnen, und diese wird beschließen, daß Vietnam ebenso wie Laos und Kambodscha zwar unabhängig ist, jedoch zur Französischen Union gehört.«
»Aber«, wandte Cogny ein, »Sihanouk, der schlaue Fuchs, versucht doch gerade, sich aus der Union herauszuwinden?«
»Mit Sihanouk werden sich wohl ganz andere Leute als wir beschäftigen.«
»Und der Nachtklubkaiser, wie die Einheimischen ihn nennen, dieser Bao Dai in Saigon hat doch wieder angekündigt, daß Vietnam auch aus der Union herausmöchte, oder?«
Navarre winkte ab. »Er wird zustimmen, sobald wir die Verhältnisse militärisch klären. Sobald wir ihm Sicherheit garantieren können, was jetzt nicht der Fall ist. Er wird dann nur die Wahl haben, zuzustimmen oder abzudanken.«
»Da gibt es immer noch das Problem Laos«, warf Cogny ein. »Sie haben selbst gesagt, daß ist ein schweres Potential, das sich da im Norden aufbaut und im Nordwesten. Wenn ich daran erinnern darf, daß in dieses Aufmarschgebiet zunehmend unkontrollierbar chinesische Waffenlieferungen fließen …«
»Ich weiß! Deshalb wird das Gebiet von Nordvietnam, das an Laos grenzt, meine besondere Aufmerksamkeit erhalten. Was haben wir dort an Kräften?«
»Lai Chau«, antwortete Cogny. »Befestigter Punkt. So gut wie ständig eingeschlossen. Und ein paar verstreut liegende Außenposten. Meist Holzbunker mit geringer Besatzung.«
»Vorstöße?«
»Mon Général, dafür sind alle diese Posten zu schwach. Wir stehen immer vor der Gefahr, daß, während wir einen Vorstoß unternehmen, der Gegner die Chance nutzt, unseren dann noch schwächer besetzten Posten zu überrennen.«
»Dagegen hilft nur die Verstärkung der Posten!«
»Sehr richtig«, stimmte Cogny ihm zu, ohne sich über die Möglichkeiten für eine solche Verstärkung zu äußern.
Navarre überlegte. »Es ist ein untragbarer Zustand, daß wir von Son Tay bis Luang Prabang weiter nichts mehr stehen haben als ein paar gefährdete Außenposten. Lächerlich!«
Cogny bemerkte mit leichter Ironie: »Immerhin sitzt in Luang Prabang nicht bloß der verkalkte laotische König Sisowath, sondern auch der tausendjährige Buddha, und der beschützt das Land!«
Navarre war kein Mann, der Scherze liebte. Er stellte Cogny die sachliche Frage: »Hat jemand im April ernstlich geglaubt, dieser Buddha könnte die Pathet Lao und die Vietminh aufhalten, als sie ein Dutzend Meilen vor der Residenz eine Pause einlegten?«
»Niemand«, mußte Cogny zugeben.
»Wie sind die Kerle eigentlich so schnell bis kurz vor den Mekong gekommen? Immerhin sind das mehr als hundert Kilometer Luftlinie von ihren Basen gewesen!«
Cogny gab gelassen Auskunft: »Sie drangen in drei Gruppen vor, jeweils in einem Flußtal. Keine schlechte Taktik. Sie benutzten den Ou, den Seng und den Khan, alle drei fließen in Richtung Luang Prabang.«
»Und wir? Ich denke, wir haben etwas südlich davon, in dieser sogenannten Ebene der Tonkrüge, eine ganze Division stationiert?«
»Der Oberkommandierende unserer Streitkräfte in Laos setzte sie nicht in Marsch. Sie waren bereits von drei Seiten her umzingelt; es hätte einen verlustreichen Kampf gegeben.«
»Was hätten Sie an seiner Stelle befohlen?«
Mit dieser direkten Frage überraschte Navarre Cogny zwar, aber dieser faßte sich schnell und gab zurück: »Ich hätte angegriffen. Mit allem, was ich hätte mobilisieren können. Wenn die Pathet Lao noch einen Tag weiter vorgedrungen wären, hätten sie nicht nur Luang Prabang erobert, sie wären am Mekong gewesen, mon Général, und damit hätten sie eine ideale Nachschublinie in den Süden in ihren Besitz gebracht. Sie könnten dann heute ihre Kräfte im Süden so versorgen, daß unsere Probleme unübersehbar wären.«
»Warum haben sie aber haltgemacht, einen Steinwurf vor dem Ziel?«
Cogny zuckte die Schultern. »War es das Ziel? Sie plagen sich nur ungern mit größeren Städten ab. Sind schwer zu halten für sie. Die Vietminh, auch die Pathet Lao führen ihren Krieg nicht nach den Regeln, die in St. Cyr gelehrt werden. Vieles erscheint auf Anhieb unerklärlich, dabei ist es von der Gegenseite her gesehen ganz logisch. Ich persönlich glaube, sie wollten die von ihnen beherrschten Gebiete in Nordlaos ausdehnen, auf eine achtbare Größe bringen, aber nicht so weit, daß sie von uns oder den Königstruppen gefährdet werden können. Sie stoßen weit vor und ziehen sich dann auf eine sichere Linie zurück, die sie ohne Schwierigkeiten halten können. Die Vietminh, wahrscheinlich auch die Pathet Lao, sind in der Einschätzung ihrer Mittel äußerst realistisch. Sie vermeiden jedes unnötige Risiko. Der Name einer großen Stadt bedeutet für sie nichts.«
»Können Sie sich vorstellen, was geschehen wäre, wenn wir nur aus zwei oder drei stark besetzten Stützpunkten mit schweren Fernpatrouillen diese drei Marschsäulen der Pathet Lao angegriffen hätten? Sie wären so durcheinandergeraten, daß sie Monate zum Erholen gebraucht hätten!«
»Die Voraussetzung wären eben starke Stützpunkte gewesen«, meinte Cogny. »Aber es gibt noch einen anderen Aspekt. Wir merken, daß Bewaffnung und Ausrüstung der Roten sich schnell verbessern.«
»Rotchina?«
»Ja. Unsere Aufklärung ist der Meinung, Lang Son ist die Drehscheibe dieser Logistik. Dort verläuft die Indochina-Bahn. Straßen gibt es auch. Mancher von uns vergißt, daß die Vietminh inzwischen nicht mehr isoliert sind. Sie haben den Rücken an einem befreundeten Land.«
Eine Weile schwieg Navarre. Es schien, als höre er der Musik zu, die wieder eingesetzt hatte. Salan erschien am Tisch, aufgeräumt, ein bißchen belustigt über die ernsten Gesichter der beiden Generale, die hier Probleme wälzten. Er überbrachte Navarre die Mitteilung, ein paar Damen würden sich glücklich schätzen, ihm vorgestellt zu werden. Frauen von Kolonialbeamten, die den größten Teil ihrer Zeit in Hanoi damit verbrachten, ihr vietnamesisches Dienstpersonal zu schikanieren und in den Gassen um die Markthalle Antiquitäten zu kaufen. Navarre erhob sich. »Ich komme.«
Salan bemerkte spöttisch zu Cogny: »Nun, Coco, ich gratuliere dir. Zum Stern, aber auch zu deinem neuen Aufgabengebiet. Tongking ist der größte Exerzierplatz Frankreichs. Und – der neue Oberkommandierende wird ihn zu einem vorbildlichen Platz machen. Trinken wir einen Pernod darauf!«
Das Lazarett lag am Hoan-Kiem-See, mitten in Hanoi, ein großes weißes Gebäude mit luftigen Balkonen und einem ausgedehnten Park. Gehfähige Verwundete wurden hier endgültig ausgeheilt. Entweder kehrten sie danach wieder zu ihrer Truppe zurück, oder sie wurden – wenn es sich um Ausmusterungsfälle handelte – nach Frankreich verschifft, sobald die Ärzte entschieden hatten, daß der Anblick der betreffenden Verwundeten jetzt den Leuten daheim zuzumuten sei.
Die Ärzte waren mit Ausnahme von zwei Amerikanern, die hier Studien über bestimmte, nicht sehr häufige Verletzungen betrieben, Franzosen, ebenso das mittlere Pflegepersonal. Lediglich niedere Dienste wurden von Einheimischen versehen. Sie stellten auch, außer dem Chefkoch, das Küchenpersonal. Bevorzugt handelte es sich dabei um Frauen von Soldaten, die entweder in den Streitkräften Bao Dais oder direkt unter französischem Kommando dienten.
Gaston Janville kannte jeder im Haus, ob es der Chefarzt war oder der Toilettenklempner. Als er jetzt vom Sanitätswagen zurückgebracht wurde, empfing ihn am Eingang bereits ein dienstfreier Küchengehilfe und teilte ihm mit, Monsieur le Commandant wäre ungehalten, weil Gaston zur vereinbarten Kartenpartie nicht erschienen sei, er warte im Spielzimmer.
Commandant Prunelle, der stämmige, rotgesichtige Bretone, der einen Pyjama trug, saß an einem der kleinen Tische und war dabei, die Prothese abzuschnallen, die man ihm hier für sein linkes Bein verpaßt hatte. Sie saß nicht gut, überdies war der Stumpf noch sehr empfindlich, und so legte der Commandant das hölzerne Ding ab, wann immer er nicht unbedingt gehen mußte. Diesmal allerdings hatte er Schwierigkeiten mit der Befestigungsschiene, und er wurde so ungehalten, daß er die Prothese wütend zur Seite schleuderte, als er sie endlich losbekommen hatte. Gerade in dem Augenblick betrat Gaston Janville forsch und heiter den Raum. Er bekam die Prothese in den Bauch, riß verblüfft die Augen auf und erkundigte sich, nähertretend: »He, Paul, willst du mich entmannen?«
Der Commandant knurrte nur: »Werde ich wohl kaum schaffen! Du wirst noch mit einem halben Hoden der König der Rue Blondel sein. Hast du wieder dein Spiel mit dem Affenbiß abgezogen?«
»Pst!«, machte Gaston Janville erschrocken. Er blickte sich um, aber die Tür war geschlossen, niemand außer ihnen war im Zimmer.
»Ich wundere mich immer wieder, daß sie dir die Vorstellung abnehmen. Selbst die Ärzte! Der Chef hat mir erst vorhin, als der Anruf kam, aufgetragen, dich beim Spiel zu beruhigen.«
»Tu das!« Janville grinste vergnügt. Er griff sich das bereitliegende Kartenpack, hob ab und teilte aus, bis sein Gegenüber bei der zweiten Karte die Hand hob, das vereinbarte Zeichen. Während einer solchen Kartenpartie sprachen die beiden sonst selten. Heute sollte es anders sein. Als der Commandant seine beiden Zehner aufdeckte, überraschte ihn Janville mit zwei Assen. Der Commandant machte den fälligen Strich auf den Zettel, dann meinte er kopfschüttelnd: »Dein Glück möchte ich haben! Aber – wehe, wenn es dich einmal verläßt!«
Er zielte mit dieser Bemerkung weniger auf das Kartenspiel als auf das, was Janville in Hanoi aufführte, seitdem er als Genesender galt, für den es nur geringe Hoffnung auf völlige Wiederherstellung gab.
Die beiden waren sich in Algerien zum ersten Mal begegnet, dann hatte der beginnende Indochinakrieg sie zunächst nach Saigon verschlagen. Zu jener Zeit war Gaston Janville noch dem Commandant unterstellt gewesen, und damals war es auch zu dem Gefecht gekommen, in dessen Verlauf der Commandant erstmals verwundet worden war, durch einen Schuß in die Schulter. Die Wunde hatte sehr stark geblutet. Janville, selbst leicht angekratzt, hatte ihn aus der Feuerzone gebracht und verbunden, hatte aufgepaßt, daß die Sanitäter ihn so schnell wie möglich zum Verbandplatz transportierten. Der Commandant betrachtete ihn seitdem als seinen Lebensretter, und er hatte es sehr bedauert, als Gaston damals auf den Posten in Laos versetzt wurde. Wiedergesehen hatten sich die beiden hier in Hanoi, im Lazarett, als man Gaston Janville neben den Commandant in das noch freie Bett legte und den älteren Offizier bat, er möge etwas aufpassen. Der Mann sei völlig durcheinander, eigentlich müßte man ihn anbinden, aber man wolle das gern vermeiden.
Der Commandant, der den Vorzug genoß, in einem Zweibettzimmer zu liegen, weil der Chefarzt gelegentlich mit ihm Karten zu spielen pflegte, erkannte Gaston sofort, aber der Capitaine war bewußtlos, von einer halbwegs überstandenen Gelbsucht geschwächt, psychisch offenbar angeschlagen. So dauerte es einige Tage, bis die vietnamesische Schwester eines Morgens an sein Bett trat, um ihm den Puls zu fühlen. Da sprach Janville zum ersten Mal. Er forderte das Mädchen auf: »Zeig mir deinen Arsch, du, damit ich erkenne, ob du Dung bist!«
Der Commandant fuhr hoch und sah das ausdruckslose Gesicht Janvilles. War der Bursche übergeschnappt? Die Schwester floh erschrocken. Nach einer Weile sprach der Commandant seinen Bettnachbarn an: »He, Gaston, warum erschreckst du das Mädchen so? Hast du was an der Klingel?«