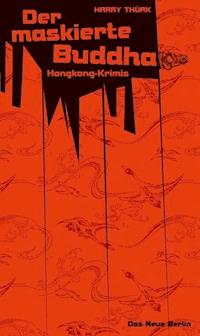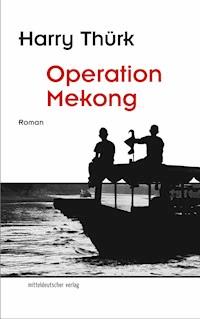Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mdv Mitteldeutscher Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Thürks ebenso packender wie beklemmender Romanklassiker über das Terrorregime der Roten Khmer in Kambodscha April 1975: Seit Jahren tobt in Kambodscha ein Bürgerkrieg; die Roten Khmer, eine maoistisch-nationalistische Guerillabewegung unter Führung Pol Pots, steuern mit ihren Verbündeten auf die Hauptstadt Phnom Penh zu. Die dort Lebenden – unter ihnen der Koch Hang Son und seine Freundin Chanta – erhoffen sich ein Ende der Kämpfe und einen friedlichen Wiederaufbau des Landes. Bald folgt jedoch das böse Erwachen, die Bevölkerung Phnom Penhs wird aufs Land verschleppt und muss Zwangsarbeiten verrichten. Es beginnt die Terrorherrschaft der Roten Khmer, die schließlich im millionenfachen Massenmord mündet. Hang Son kann fliehen und landet in einer geheimen, von den USA geleiteten Truppe. Chanta dagegen wird in eine Edelsteinmine verschleppt und muss täglich um ihr Leben bangen. Son versucht alles, sie wiederzufinden. Auch rund vierzig Jahre nach dem Ende des Pol-Pot-Regimes 1978 sind in Kambodscha noch nicht alle Wunden verheilt. Harry Thürk gelang es mit seinem 1986 erstmals veröffentlichten Roman, die damaligen Geschehnisse durch seine Protagonisten nachvollziehbar zu machen, den unzähligen Opfern ein Gesicht zu geben. Ein packender Roman, der bis heute nichts von seiner Wirkung verloren hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Harry Thürk
Der schwarze Monsun
Roman
mitteldeutscher verlag
Im Mitteldeutschen Verlag erhältlich:
Dien Bien Phu. Die Schlacht, die einen Kolonialkrieg beendete (Tatsachenroman)
Operation Mekong (Roman)
Sommer der toten Träume (Roman)
Die Stunde der toten Augen (Roman)
Harry Thürk (1927–2005), geb. in Zülz (heute Biala/Polen), Besuch der Real- und Handelsschule in Neustadt/Schlesien, 1944/45 Wehrdienst, nach dem Krieg Rückkehr nach Neustadt, Internierung in einem Durchgangsghetto für Deutsche, von dort Flucht nach Ostdeutschland. In der DDR Arbeit als Reporter (u.a. Auslandskorrespondent in Korea, China, Vietnam, Laos, Kambodscha), was sich in seiner literarischen Arbeit niederschlug, seit 1958 freier Autor in Weimar. Seine Bücher wurden in die polnische, tschechische, slowakische, ungarische, rumänische, russische, finnische, litauische, vietnamesische und spanische Sprache übersetzt.
Inhalt
Cover
Titel
Der Autor
1975, April
1977, Mai
1978, Mai
1979, Januar
Weitere Bücher
Impressum
1975, April
Eine Kokosnuß knallte auf das Regendach aus Wellblech, unter dem der Khmer-Soldat Posten stand. Der Mann erschrak tödlich, er warf sich sofort zu Boden, um Deckung bemüht, wobei seine Maschinenpistole aus Versehen losging. Die Geschosse surrten nicht weit von Hang Sons Beinen vorbei in die Nacht. Der Koch aus dem Restaurant des Hotels Mondial in der Monivong hatte dem Posten gerade den Zettel gezeigt, den ihm Keat Sambath vor ein paar Wochen für einen Notfall gegeben hatte. Jetzt war der Notfall eingetreten, früher als Hang Son, der junge Mann mit der verwegen hochgekämmten Haartolle, es für möglich gehalten hatte.
»Warum schießt du Idiot?« schrie er den Posten an, der vorsichtig den Kopf hob und sich nach versteckten Gegnern umsah, er murmelte etwas von den Roten, und daß man bei denen nie wissen könne. Mittlerweile war die Nuß vom Wellblechdach herabgerollt und am Boden liegengeblieben. Der Posten saugte sich mit seinen Augen an ihr fest, es war zu spüren, daß er sie für eine Höllenmaschine hielt, die jede Sekunde explodieren mußte.
Hang Son hatte keine Lust, noch lange vor dem Postenhaus der amerikanischen Botschaft zu stehen. Zwar war es Nacht, es gab keine Straßenbeleuchtung, aber die Armeestreife, die Hang Son zur Sammelstelle für Zwangsrekrutierte hatte mitnehmen wollen und der er entfliehen konnte, war noch hinter ihm her. Die Schüsse würden sie anlocken, es konnte sich nur um Minuten handeln. Erneut hielt Hang Son deshalb dem Posten den Zettel hin, als der kleine Soldat sich vom Boden erhob, nachdem er wohl eingesehen hatte, daß es sich tatsächlich um eine Kokosnuß handelte, nicht um eine Bombe.
»Es eilt!« drängte Hang Son. Er merkte, daß der Posten nicht lesen konnte, und um die Sache zu beschleunigen, forderte er ihn auf: »Ruf im Fahrzeugpool an, der Chef dort ist Keat Sambath. Er soll mich schnell hier abholen!«
»Keat Sambath, he?« fragte der Soldat zurück. Er wartete das Nicken Hang Sons nicht ab, trat in sein Häuschen, griff nach dem Telefonhörer und wählte eine Nummer. Mit erstaunlicher Sicherheit kombinierte er die Zahlen, er mußte sie im Kopf haben. Habe ich mich in ihm getäuscht, fragte sich Hang Son, kann er vielleicht doch lesen? Oder ist das mit dem Telefon nur Dressur? So ein Posten muß wahrscheinlich für jeden Botschaftsangehörigen, der das Gebäude verläßt, ein Auto aus dem Fahrzeugpool herbeordern, die Nummer wird sich ihm eingeprägt haben.
Der Posten sagte ein paar Worte in die Sprechmuschel, legte dann auf und drehte sich wieder zu Hang Son um. »Sambath, he?«
»Keat Sambath, ja. Kommt er?«
»Ist er dein Freund?«
Hang Son bejahte das, ohne zu zögern. Es hatte keinen Sinn, diesem Hohlkopf, der vor der halbverlassenen Botschaft der Amerikaner in Phnom Penh Wache hielt, nachdem die Stadt fast völlig von den Rebellen eingeschlossen war, zu erklären, welcher Art seine Bekanntschaft mit dem Chauffeur des Botschafters Dean war, der jetzt mit seinem Wagen kaum noch herumfuhr, weil die Hauptstadt Kambodschas unter dem Feuer der Rebellen lag und es für Amerikaner auch aus anderen Gründen nicht mehr ratsam war, sich offen in den Straßen zu zeigen. Dabei war es noch nicht einmal ganze sechs Jahre her, daß die Amerikaner nach langem Hin und Her öffentlich zu erklären bereit gewesen waren, sie würden die Existenz des indochinesischen Königreiches respektieren. Es hatte sie Überwindung gekostet, zumal sie im Nachbarland Südvietnam in einen Krieg eingetreten waren, dessen Ende nicht abzusehen war, und der Prinz, damals Kambodschas Staatsoberhaupt, sie deswegen Aggressoren nannte. Sie hatten trotzdem einen Botschafter geschickt. Jetzt gab es den Prinzen Sihanouk von damals nicht mehr an der Spitze des Staates, das Königreich Kambodscha existierte nicht mehr, es gab die Republik Kambodscha und der Prinz lebte nach dem Putsch seines Generals Lon Nol, der diese Veränderungen bewirkt hatte, im Pekinger Exil. Entmachtet war er ein knappes Jahr nach dem Eintreffen des amerikanischen Botschafters worden. Die Republik Kambodscha hatte der General Lon Nol inzwischen unter Kriegsrecht gestellt. Lon Nol hatte sich für den Putsch mit einschlägig bewanderten Amerikanern verbündet, und nach dem Gelingen des Unternehmens hatte er die Amerikaner offiziell als Alliierte ins Land geholt. Aber dadurch hatte er die Gegenkräfte, die schon gegen den Prinzen und sein Regime aktiv gewesen waren, endgültig zur bewaffneten Aktion herausgefordert – heute, nach einem Schlaganfall am Stock gehend und mit Sprechschwierigkeiten kämpfend, befand sich, wie man Zeitungsmeldungen hatte entnehmen können, Lon Nol zur Erholung in Hawaii. Eingeweihte versicherten, der »Oberbürgermeister von Phnom Penh«, wie man ihn hinter der vorgehaltenen Hand nannte, weil seine Macht nie weit über die Grenzen der Hauptstadt hinausgereicht hatte, würde nicht zurückkehren. In der Tat, das Ende war nahe. Jeder spürte es. Die Stadt wimmelte von Flüchtlingen, immer wieder schlugen Raketen in Militärobjekte ein, manchmal krepierten sie auch auf Plätzen oder vor Hotels. Qualm von brennenden Gebäuden schlug sich in die Wohnviertel nieder. Der langsam anschwellende Mekong, der um diese Jahreszeit die Tauwässer der Gebirge im Norden aufnimmt, schwemmte jeden Tag aufgedunsene Leichen deltawärts. Früher waren von Saigon her die Kanonenboote bis in den Tonle Sap gefahren, den Seitenarm des Mekong, der zum Nordwesen hin verläuft und sich unweit der historischen Ruinen von Angkor zum See erweitert, wobei er eben nur zur Regenzeit Wasser führt, ein Naturphänomen, an das sich viele Legenden knüpfen. Heute war selbst der Fährbetrieb über den Tonle Sap zum Ostufer eingestellt, dort drüben, in Chrui Changvar, saßen bereits die Rebellen. Und die elegante Tonle-Sap-Brücke, ein Stück weiter nordwärts, die das Wasser im kühnen Bogen überspannt, war gesperrt. Noch hatten die Rebellen die Brücke nicht besetzt, aber von Lon Nols Truppen traute sich niemand mehr auch nur in ihre Nähe. Selbst in den Nächten war es jetzt nicht mehr still. Um die Stadt herum rollte immer wieder der Donner der Granatwerfereinschläge, und wer weit genug in den Außenbezirken lebte, der konnte das Geknatter der Maschinengewehre hören.
»Ich nehme ihn mit hinein«, sagte der Mann, der plötzlich aus dem Dunkel aufgetaucht war, zu dem Posten. Der griff sich die Zigarettenpackung, die ihm hingehalten wurde, und zog sich wieder unter sein Wellblechdach zurück.
»Komm«, wandte sich der Mann an Hang Son, er winkte ihn auf das Botschaftsgelände. Keat Sambath. Er drückte kurz die Hand seines späten Besuchers und führte ihn dann über den Hof der Botschaft, am protzigen Hauptgebäude vorbei, in die Wirtschaftszone, wo sich Küche und Garagen befanden, ebenso die Unterkünfte der Marineinfanteristen, die zum Schutz der Amerikaner bereitstanden, und die Räume, in denen jene einheimischen Bediensteten untergebracht waren, die Tag und Nacht gebraucht wurden. Keat Sambath hatte sein Quartier in einem Nebenraum der großen Garage, in der außer dem Chevrolet des Botschafters noch verschiedene andere Fahrzeuge standen, darunter mehrere in Tarnfarben gespritzte Lastwagen und ein Jeep.
Erst hier, in der gemütlich eingerichteten, von einem Ventilator einigermaßen gekühlten Kammer, nahm sich Keat Sambath die Zeit für ein Gespräch mit Hang Son. »Hat lange gedauert, bis du gekommen bist! Ich hatte schon nicht mehr mit dir gerechnet!«
Hang Son sagte: »Danke, daß du mich hier hereinnimmst. Ich hätte dich nicht belästigt, aber es ist unsicher geworden draußen für mich …«
»Sind sie hinter dir her?«
Hang Son zuckte die Schultern. »Sie sind hinter jedem her, der noch ein Gewehr tragen kann. Ich hatte mich bei Chanta versteckt. Aber heute kam die Patrouille …«
»Chanta – ist das die Tänzerin? Deine Freundin?«
Hang Son nahm die Zigarette, die der Ältere ihm hinhielt, er brannte sie an. Amerikanisch, wie alles hier, selbst Hemd und Hose Keat Sambaths waren amerikanisch. Ein reicher Mann!
»Sie hat die Tänzerinnen nur geschminkt«, sagte Hang Son.
»Tanzen konnte sie nicht mehr, nachdem sie sich den Fußknöchel gebrochen hatte.«
»Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das Ballett ist aufgeflogen, habe ich gehört. Die meisten Mädchen sind schon in Thailand. Wen soll sie da noch schminken?«
»Sie will da warten, wo sie wohnt. Möglicherweise kommt eine ihrer Freundinnen zurück. Sie war nach Kompong Cham gereist …« Der für einen Khmer recht große, schlanke Keat Sambath lächelte. »Kompong Cham, das ist seit einer Ewigkeit in den Händen der Roten. Da kommt keiner mehr …« Er wollte eigentlich anfügen: es sei denn, er schwimmt als Leiche den Mekong abwärts, aber er unterließ die Bemerkung. Hang Son wußte auch so, daß seine Feststellung logisch war. Phnom Penh befand sich in der undurchdringlichen Umklammerung der Rebellen, es konnte nicht mehr lange dauern, bis die letzten Truppen des Putschgenerals Lon Nol zu den »Geistern im Nebel« verschwanden, wie die Leute die unaufhaltsame Selbstauflösung dieser Armee bezeichneten. Chanta hatte Hang Son versprochen, jeden Mittag in der Nähe der Botschaft zu erscheinen, damit sie sich verständigen konnten.
»Es wird kaum noch einen solchen Mittag geben«, belehrte ihn Keat Sambath. »Was meinst du, weshalb ich mitten in der Nacht hier herumsitze, statt zu schlafen? Drei Stunden nach Sonnenaufgang kommt der erste Hubschrauber.«
»Verstärkung?« Hang Son glaubte zwar nicht, daß mit amerikanischen Verstärkungen auf diesem Kriegsschauplatz noch etwas zu ändern wäre, aber er hielt es immerhin für möglich, daß es zu einer letzten Demonstration amerikanischer Militärmacht kam. Keat Sambath schüttelte den Kopf. »Ab neun läuft die Evakuierung. Da sich der Flugplatz Pochentong bereits in den Händen der Roten befindet, wird es von hier aus gemacht. Ich bin eben mit meinen eigenen Vorbereitungen fertig gewesen, als du am Tor ankamst …«
»Du fliegst mit aus?« Hang Son erschrak. Er hatte sich auf Keat Sambath verlassen, weil dieser ihm vor einiger Zeit gesagt hatte, mit ihm zusammen gäbe es einen Weg, das näherrückende Chaos zu überstehen. Nun winkte Keat Sambath ab, als er sah, wie betroffen Hang Son reagierte. »Ganz ruhig, ich bleibe hier. Und es verläuft alles so, wie ich es geplant hatte. Nur – morgen mittag, wenn deine Freundin kommt, sind wir leider nicht mehr hier!« – »Nicht mehr hier …«, wiederholte Hang Son abwesend, während er den Zigarettenrest ausdrückte. Keat Sambath kämmte sich vor einem Spiegel das ungewohnt kurz geschnittene Haar. Erst jetzt bemerkte Hang Son, daß er sich eine nahezu militärische Frisur zugelegt hatte. An der Tür der Kammer standen ein paar Taschen aus grünem Segeltuch, vollgepackt wohl mit dem, was Keat Sambath auf der Flucht zu brauchen glaubte. Er war ein erfahrener Mann, er würde sorgfältig ausgewählt haben. Ein Transistorradio von Handtellergröße lag auf dem Tisch, Keat Sambath stellte daran herum, bis er Radio Stars and Stripes eingefangen hatte, die amerikanische Militärstation, die jetzt schon nicht mehr von Saigon aus sendete, sondern von einem Schiff auf hoher See.
»Hör zu und rufe mich, wenn etwas Wichtiges kommt«, schärfte er Hang Son ein. »Ich muß noch etwas an den Lastwagen erledigen.« Er schob ihm Zigaretten und ein Pack Cola-Büchsen hin, ebenso eine Rolle amerikanischer Keks, dann ging er nach draußen, in die Halle. Hang Son konnte ihn noch durch die Scheibe beobachten, bis er zwischen den Fahrzeugen verschwand, dann griff er sich das kleine Radio. Musik ertönte, vietnamesisch gesungene Tanzschlager. Die Sprecherin, die sich zwischen den einzelnen Stücken meldete, war heiser. Sie sagte die Zeit an, von Nachrichten war nichts zu hören.
Hang Song, der noch Anfang des Jahres geplant hatte, mit seiner Freundin Chanta zusammen seinen zwanzigsten Geburtstag und zugleich ihre Verlobung im Restaurant des Mondial zu feiern, hatte diesen Plan vor einer Woche aufgeben müssen, wenige Tage, bevor er hatte realisiert werden sollen. Ein Bote war mit der gedruckten Aufforderung erschienen, sich im Olympiastadion zu melden, als Wehrpflichtiger, der bisher freigestellt gewesen war, weil der Besitzer des Mondial hohe Schmiergelder zahlte, um seinen Koch nicht zu verlieren. Der Mann, der die Schmiergelder bisher kassierte, war anscheinend inzwischen geflohen, und so genoß Hang Son plötzlich keinen Vorteil mehr. Aber er war von jeher fest entschlossen gewesen, nicht mit Lon Nols Armee in den Krieg zu ziehen. Das hatte weniger mit Lon Nol zu tun als mit dem Krieg selbst. Schon während der letzten Jahre des Prinzenregimes war Hang Son in einen gewissen Zwiespalt geraten. Einerseits spürte er, daß der vollmundige Propagandafeldzug Sihanouks gegen die einheimischen Kommunisten dem Land Schaden brachte. Abgesehen von vielen Leuten, die über Nacht in Gefängnissen verschwanden, verließen immer mehr Linke die Hauptstadt und versteckten sich in schwer zu kontrollierenden Gegenden im Norden und Nordosten, manche emigrierten sogar nach Nordvietnam.
Andrerseits schlossen sich Gruppen von Widerstandswilligen im Lande zusammen und bewaffneten sich, um gegen Sihanouks Verfolgungen geschützt zu sein. Die Nation spaltete sich zunehmend. Zwar konnte niemand übersehen, daß derselbe Sihanouk öffentlich immer schärfer die Amerikaner kritisierte, die im Nachbarland einen Kolonialkrieg führten, der Kambodschas Grenzen nicht schonte. Aber man hörte auch, Sihanouk weise seine Armee an, schonungslos Kommunisten zu verfolgen. Dieser Umstand verstärkte bei Hang Son die Abneigung, Soldat zu werden – nicht wenige seiner Schulfreunde tendierten zu den Linken, sie bezeichneten den Staatschef als einen Mann mit vielen Gesichtern, der sich mit den Amerikanern nur deshalb nicht arrangieren wollte, weil diese seine Eitelkeit verletzten. Studenten, die aus sozialistischen Ländern in Europa in die Heimat zurückkehrten, erzählten von den Vorteilen eines Gesellschaftssystems, in dem nicht mehr der einzelne mächtige »Monseigneur« alles zu bestimmen hatte, sondern die Bevölkerung sich selbst durch das Gewicht ihrer Organisationen das Leben einrichtete. Dies alles erzeugte bei Hang Son wie bei vielen jungen Leuten seiner Generation Unruhe, aber es gab kaum jemanden, der imstande war, ihre Verwirrung zu klären, und so blieben Mißtrauen, Gleichgültigkeit gegenüber allem, was von der Obrigkeit gesagt wurde.
Hang Son war das einzige Kind einer Tagelöhnerfamilie, die in einem Pfahlhaus am Rande der Wassersiedlung Beng Kak lebte. Der Vater starb am Fieber, die Mutter an einer inneren Krankheit, die zu spät erkannt worden war. Verwandte hatten den Jungen, der schon als Kind in einer Selbsthilfeküche am Beng Kak mitgearbeitet hatte, ins Mondial vermittelt, wo er schnell lernte und der chinesische Besitzer ihm nach verhältnismäßig kurzer Zeit die Stelle eines Kochs gab, als sie frei wurde. Seitdem war Hang Son, was Essen und Unterkunft betraf, ohne Sorgen gewesen. Er hatte sich mit Chanta angefreundet, der Schwester eines Schulfreundes, der in Europa Musik studierte. Dann war der Putsch gekommen, vor fünf Jahren, während Sihanouk sich auf einer Erholungsreise in Frankreich befand. Aber diese Veränderung in der Regierung hatte alle Widersprüche im Lande der Khmer noch verstärkt. Lon Nol, der neue Staatschef, öffnete die Ostgrenzen für die Amerikaner und die Saigoner Truppen, die eigene Armee engagierte sich immer stärker in einem Bürgerkrieg gegen die Rebellen und die Linken. Doch die organisierten Rebellen waren nicht mehr zu besiegen. Sie kontrollierten in wachsendem Maße die ländlichen Gegenden Kambodschas, zuletzt verblieben Lon Nol nur noch die Hauptstadt und – tagsüber – ein Streifen Gelände entlang der Straße nach Battambang sowie ein unsicherer Verbindungsweg bis zum Hafen Sihanoukville, der nun wieder Kompong Som hieß. Es half nichts, daß Lon Nol immer mehr fremde Truppen in sein Reservat holte, immer mehr Munition und Waffen nach Phnom Penh schaffen ließ und daß die B-52 der Amerikaner in seinem Auftrag riesige Gebiete, in denen sich angeblich Rebellen herumtrieben, mit Flächenbombardements verwüsteten – jene Leute, die in der Hauptstadt vereinfachend »Khmer Rouges« genannt wurden, in Anlehnung an die lange gepflegte französische Sprachtradition, hatten den gegen sie gerichteten Bürgerkrieg für sich entschieden.
»Jetzt noch Soldat werden? Wozu? Und für wen?« hatte Hang Son Chanta gefragt, das zierliche, dunkeläugige Mädchen, das in der ehemals königlichen Ballettschule unweit des Tonle-Sap-Ufers im Südteil der Stadt arbeitete und in der Nähe auch eine Unterkunft besaß. Chanta hatte nur den Kopf geschüttelt, sie war Hang Sons Meinung gewesen, man wird nicht Soldat in einer Armee, nur weil andere Leute das wollen, man muß schon für das einzutreten bereit sein, was diese Armee schützt, und das war der junge Mann nicht. Chanta hatte ihn bei sich versteckt, in dem Wohnheim unweit ihrer Arbeitsstelle, aber dort blieb nicht verborgen, wer sich bei dem Mädchen aufhielt, und so war die Patrouille der Militärpolizei gekommen. Nun mußte sich erweisen, ob das Angebot Keat Sambaths etwas wert war. Damals hatte er angedeutet, mit ihm zusammen könne Hang Song die bevorstehenden neuen Umwälzungen überleben. Einzelheiten hatte er nicht verlauten lassen, nur daß Hang Son seinen Beruf als Koch würde ausüben können. Doch was immer er ihm anbot, Hang Son würde es heute akzeptieren, er war ein Gejagter. Griff man ihn auf, als Verweigerer des Militärdienstes, würde man ihn kurzerhand erschießen. Damit verglichen, war selbst eine schlechte Chance immer noch die Rettung!
»Rote Truppen haben den wichtigen Straßenknotenpunkt Xuan Loc, etwa fünfzig Meilen östlich von Saigon eingeschlossen und beschießen die Stadt mit Artillerie und Raketen. Annähernd fünfundzwanzigtausend Soldaten der Republik Vietnam leisten ihnen erbitterten Widerstand, darunter Saigoner Elitetruppen. Wenn Xuan Loc fällt, können die roten Verbände innerhalb weniger Stunden vor Saigon stehen …« Hang Son drehte am Lautstärkeregler, bis er den Sprecher deutlich hören konnte. Aber es kam nur noch einiges über die hoffnungslos werdende Situation der Saigoner Truppen, nichts über Kambodscha. Keat Sambath hatte behauptet, am Morgen werde die Evakuierung der US-Botschaft in Phnom Penh beginnen. Er mußte es wissen. Außerdem klang es wahrscheinlich, gemessen an dem Fiasko, das sich in Saigon anbahnte. Warum nur hatte Keat Sambath immer noch nicht gesagt, auf welche Weise er sich aus dem allgemeinen Zusammenbruch retten wollte? Es hieß, die Rebellen wären erbarmungslos, besonders gegen die Bevölkerung in den Städten. Wer auch nur ein Radio besaß, galt für sie als Kapitalist und würde bestraft werden. Viele Leute glaubten das nicht, sie hofften auf ein Ende der Kämpfe und die damit verbundene Befreiung von den Amerikanern und Saigonern. Und sie behaupteten, die Rebellen seien die einzige Hoffnung, die es für Kambodscha noch gäbe, sie würden endlich Freiheit und Gerechtigkeit bringen, mit der Korruption Schluß machen, jeder würde Arbeit haben, und der Hunger, der die Städter seit Monaten plagte, sollte vergehen …
Draußen kroch Keat Sambath unter die Plane eines Lastwagens. Er hängte eine Handlampe an eine Strebe und vergewisserte sich, daß die Ladung aus Kisten und Blechbehältern noch Platz für ein halbes Dutzend Männer ließ. Alles schien in Ordnung zu sein. Zuletzt erinnerte sich der trotz seiner Khakikleidung und obwohl er verschwitzt war, immer noch geradezu elegant wirkende Mann an den jungen Koch aus dem Mondial, der in der Kammer wartete. Ein Koch! Man würde ihn brauchen. Gut, daß er in letzter Minute noch gekommen war. Dieser Hang Son war aus dem Holz geschnitzt, aus dem sich gute, folgsame Soldaten machen ließen, vorausgesetzt, man konnte ihnen beibringen, daß sie sich auf der richtigen Seite befanden. Aber das würde gelingen. Keat Sambath dachte noch daran, wie er ihn das erste Mal gesehen hatte. Das war damals gewesen, als er nach einem langen und entscheidenden Gespräch mit Mister Barber, der dafür eigens aus Saigon herübergekommen war, gegen Abend im Mondial landete, um mit dem Amerikaner etwas zu essen. Die beiden wollten noch ins Etablissement der Madame Hu, wo man sich garantiert hygienisch einwandfrei mit ungewöhnlich jungen Mädchen vergnügen konnte, die, eben erst aus entlegenen Provinzen kommend, in diesem französisch aufgemachten Bordell in der Nähe der Kais das gefunden hatten, was Madame Hu Arbeit nannte. Keat Sambath hatte das Haus empfohlen, er kannte den Arzt, der dort die Tests vornahm, und der teilte ihm vor solchen Besuchen stets mit, welche der Mädchen er am Vormittag in seinem Labor gehabt hatte, mit negativem Befund des Abstrichs. Nie im Leben wäre Mister Barber, der sein Büro inzwischen nach Thailand verlegt hatte, ausgerechnet nach Phnom Penh gereist, nur um sich mit Mädchen zu vergnügen, selbst unter dem Aspekt garantierter Keimfreiheit – nein, er hatte mit Keat Sambath wichtige Einzelheiten über dessen Tätigkeit in der ferneren Zukunft zu besprechen gehabt, und der Besuch eines Bordells machte sich immer gut als krönender Abschluß solcher Besprechungen.
Keat Sambath war eine der Schlüsselfiguren für manches, was der amerikanische Geheimdienst für die Zukunft in Kambodscha vorhatte. Nach langem Auslandsaufenthalt hatte man ihn unauffällig hierher zurückschleusen können. Ursprünglich war Mister Barber skeptisch gewesen, was diesen Mann betraf. Es war etwas mehr als zehn Jahre her, da war er eines Tages in Saigon aufgetaucht, ein junger Student der Pädagogik, den man von seiner Hochschule in Phnom Penh geworfen hatte, wegen angeblich »imperialistischer Neigungen«. Er hatte Verwandte in Saigon, die standen dort bei einer Exilorganisation von Kambodschanern, die sich »Khmer Serai« nannte. Da diese Exilorganisation ebenso unauffällig wie verläßlich die nach Kambodscha hineinreichenden Interessen der Amerikaner vertrat, pries ein Verbindungsmann eines Tages Mister Barber, der in der US-Botschaft einen Posten als Tarnung für seine operative Tätigkeit bei der CIA bekleidete, die hervorragenden Eigenschaften Keat Sambaths an. Er sei verläßlich, fähig, und man könne so gut wie alles von ihm verlangen, bei angemessener Bezahlung. Das waren Voraussetzungen, um einen CIA-Mitarbeiter zu formen.
»Was ist das für einer?« wollte Mister Barber zunächst wissen. »Jeans-Fan mit Vorliebe für Cola?«
Mister Barber verlor bald sein Mißtrauen gegen einen Mann, den er nicht selbst ausfindig gemacht hatte, sondern der von Bekannten offeriert wurde. Der junge Mann war nämlich der Neffe eines Exilanten, den Son Ngoc Thanh, der Anführer der »Khmer Serai«, angeworben hatte, und zwar zu jener Zeit, als er noch Außenminister einer vom Prinzen Sihanouk geführten Regierung in Phnom Penh war. Diese Regierung hatte von Japans Gnaden gelebt, und das einige Monate vor dem Ende des zweiten Weltkrieges, der Japans Rolle als Gendarm Asiens beendete. Eigentlich war Son Ngoc Thanh damals Rivale des Prinzen Sihanouk gewesen, er hatte in der Mitte der dreißiger Jahre, als Kambodscha noch französische Kolonie war, Rebellen um sich geschart, die von der Kolonialmacht Frankreich die Unabhängigkeit verlangten. Zur Unterstützung seiner Sache gründete er eine Zeitung, die erste, die es in der Sprache der Khmer gab, und die Bewegung breitete sich aus. Mit dem Eintritt Japans in den zweiten Weltkrieg veränderte sich die Lage in Indochina. Japan setzte die französische Kolonialverwaltungen – obwohl diese zum profaschistischen Vichy-Regime tendierten – unter Druck und verschaffte sich damit strategische Vorteile. Den Kolonialfranzosen war daran gelegen, das Verhältnis zu den Japanern möglichst in der Schwebe zu halten, um nicht völlig aus Indochina hinausgeworfen zu werden. So traten sie Teile ihrer Kolonie Kambodscha an das mit Japan befreundete Thailand ab, und sie mußten erleben, daß dies der nationalistischen Bewegung, in der auch Son Ngoc Thanh operierte, Auftrieb gab. Sie dachten sich einen Schachzug aus. Als der alte Khmer-König Monivong, der völlig kaltgestellt war, starb, setzten sie Prinz Sihanouk, der in Saigon ein Gymnasium absolvierte, als Nachfolger ein. Von Sihanouk war bekannt, daß er frankophil war und, was nicht weniger zählte, bereits in jungen Jahren erstaunliche Fähigkeiten zur politischen Intrige offenbarte. Er ließ sich auf den Handel mit den Franzosen ein, aber es zeigte sich bald, daß die Franzosen ihn unterschätzt hatten. Er respektierte die Kolonialherren nach außen, während er über eine Menge geheimer Kanäle den Aufstand gegen sie unterstützte, um sie schließlich wissen zu lassen, er allein, Prinz Sihanouk, dem sein Volk aufs Wort gehorche, könne sich für ihren unbehinderten Abzug verbürgen. Falls sie jedoch blieben, könne auch er den Zorn des Volkes nicht mehr aufhalten.
Die Japaner, auf ungestörte Verbindungslinien zu ihrer Front in Burma bedacht, beobachteten die Vorgänge äußerst mißtrauisch. Einen Monat bevor der zweite Weltkrieg in Europa zu Ende ging, machten sie einen verzweifelten Versuch, sich selbst als Befreier Kambodschas aufzuspielen und ihre Position im Lande dadurch aufzubessern, daß sie in einer Nacht- und Nebelaktion die Reste der französischen Truppen entwaffneten und die Kolonialverwaltung absetzten. Vichy gab es ohnehin nicht mehr. Prinz Sihanouk sah sich plötzlich in der peinlichen Situation, die von ihm angestrebte Unabhängigkeit ausgerechnet aus den Händen der japanischen Eroberer zu erhalten, und das gegen Ende ihrer Herrschaft. Aber er nahm sie und blieb gegenüber den Tenno-Truppen zurückhaltend. Um diese Zeit kehrte der ehemalige Rebellenführer Son Ngoc Thanh von einem zweijährigen Studium in Japan zurück, einer Bildungsexkursion, wie Japan sie für künftig projapanische Politiker organisierte. Sihanouk, der diesem Rebellen nicht traute, machte ihn, weil er damit den Japanern Dankbarkeit demonstrieren konnte, zum Außenminister, später sogar zum Premier, er wollte wohl auch den Einfluß des Rebellenführers für sich nutzen. Die Kapitulation der Japaner aber und die Rückkehr der Franzosen als Protektoratsmacht, mit der sich Sihanouk in der Folge arrangierte und von der er schließlich die Unabhängigkeit erreichte, beendeten die Karriere Son Ngoc Thanhs als Staatsmann. Er wurde für zwei Jahre von den Franzosen als Kollaborateur in Haft gehalten, dann verlor sich seine Spur zunächst in Thailand, bis er nach dem endgültigen Abzug der Franzosen eines Tages in Saigon auftauchte, wo sich inzwischen die Amerikaner etablierten. Sie konnten Son Ngoc Thanh und die von ihm wieder aktivierte Rebellenorganisation »Khmer Serai«, die streng antikommunistisch war, vorzüglich verwenden, allerdings veränderten sie ihre Tätigkeitsmerkmale stark. Es war nun nicht mehr eine politische Vereinigung, die für ihre Ideen demonstrativ eintrat, sondern es handelte sich nach amerikanischer Einflußnahme um eine Geheimorganisation, deren Mitglieder intensiv in den Methoden des verdeckten Kampfes ausgebildet wurden und deren Tätigkeit weit in die Zukunft zielte. Son Ngoc Thanh wurde zum Vertrauten des amerikanischen Geheimdienstes CIA, der fortan die Tätigkeit der »Khmer Serai« leitete und auch finanzierte.
»Neffe eines persönlichen Freundes von Son Ngoc Thanh?« erkundigte sich Mister Barber, dem die Anleitung der »Khmer Serai« in Saigon oblag und dem ein weiteres Kontingent unterstand, das in Thailand untergebracht war. Als ihm bestätigt wurde, daß der junge Pädagogikstudent in der Tat die besten Referenzen besaß, leitete Barber trotzdem noch eine Ermittlung in Phnom Penh ein, von wo er erfuhr, daß Keat Sambath als »offener Freund der amerikanischen Imperialisten und ihrer Lebensweise« von der Hochschule geworfen worden war. Wegen des Tragens verschiedener US-Attribute an seiner Kleidung kritisiert, hatte er dem Dekan zur Antwort gegeben, er solle, wenn er Lust habe, seinen Hintern küssen. Das genügte. Barber beorderte ihn zu sich. Schließlich kannte der Bursche Phnom Penh wie seine Westentasche.
Nach Lon Nols Putsch war der Weg von Saigon nach Kambodscha offen. Nicht nur Waffen, Munition und Ausrüstung für Lon Nol, nicht nur Offizielle, die als Berater in Lon Nols Streitkräften arbeiteten, auch Gruppen bewaffneter, blendend trainierter Khmer-Serai-Leute wurden nach Kambodscha verfrachtet, mehr als tausend Mann. Und Son Ngoc Thanh kehrte zurück. Ohne Ovationen. Es war eine eigenartige Situation entstanden. Ein reichliches halbes Jahr nach seinem geglückten Putsch erlitt General Lon Nol einen Schlaganfall, ein weiteres halbes Jahr danach war er als hinkender, vor sich hin brabbelnder Krüppel zwar wieder einigermaßen vorzeigbar, aber unfähig zu komplizierten Entscheidungen. Zudem steigerte er sich weiter in schon gepflegte abergläubische Vorstellungen und verlor den Sinn für Realitäten. Zuerst veranlaßten die Amerikaner deshalb, daß er zum Marshall ernannt wurde, was ihn von der praktischen Politik distanzierte. Danach wurde er Präsident der Republik. Die Politik machte, als Premier, nun Son Ngoc Thanh.
Keat Sambath hatte den berühmten Fürsprecher nur einmal gesehen. Auf einer Veranstaltung in Saigon war er zu ihm geführt worden. Der nicht mehr junge Khmer-Serai-Begründer hatte ihn empfangen wie ein König einen Bittsteller, mit einer Kopfbewegung hatte er ihn zum Sitzen aufgefordert und ihm einen Augenblick lang die Hand auf den Kopf gelegt. »Ja, du bist vom rechten Blut«, hatte er sodann festgestellt. Er redete vom Kampf, der auf alle Kambodschaner wartete, von der Gefahr, daß die Kommunisten das von Sihanouk hinterlassene Chaos für sich nutzen könnten und man ihnen zuvorkommen müsse. Er sprach über Nordvietnam und Thailand, über die Sowjets und die Frühjahrsüberschwemmungen im Mekong-Delta. Ob Keat Sambath ihm auch etwas zu sagen hatte, war nicht von Interesse gewesen, er entließ ihn nach einer Weile, immerhin lächelte er freundlich dabei.
Von nun an war Mister Barber öfter mit Keat Sambath zusammengekommen. Ihm oblag das, was die Agentur in Langley die operative Arbeit nannte. Barber nahm seine Aufgabe ernst. Asien kannte er seit zwei Jahrzehnten. Als Lehrling des schon fast legendären Colonels Lansdale war er an der philippinischen Operation beteiligt gewesen, und später war er mit Lansdale nach Saigon gekommen, als der Colonel von Direktor Allen Dulles hierher geschickt worden war, um den Einfluß der USA zu etablieren und dafür zu sorgen, daß die auf der Genfer Konferenz von 1954 vereinbarten Wahlen zur Wiedervereinigung Vietnams nicht stattfinden konnten. Barber liebte es, heute noch seinen jüngeren Mitarbeitern zu erzählen, wie er damals ein Team anführte, das in die Treibstofflager um Hanoi herum eindrang und eine bestimmte Substanz in die Tanks schüttete, die den Kraftstoff zersetzte. Heute war man über solche Techniken hinaus. Aber Mister Barber wußte, daß es in einem Geheimdienst keinen einzigen Trick gab, für den nicht einmal wieder Zeit und Umstände kamen. Er hatte eine aus Khmer-Serai-Leuten bestehende Einsatzgruppe sorgfältig ausgebildet, und Keat Sambath, der als Kraftfahrer der Botschaft am längsten hier weilte, war zu einer Erwerbung der Agentur geworden, auf die Mister Barber mit Recht stolz sein durfte. – Als Barber die große Garage der Botschaft betrat, in der die Lastwagen und der Jeep standen, sah er eine Gestalt in Keat Sambaths Kammer. Gleichzeitig entdeckte er Keat Sambath bei den Lastwagen.
»Besuch?« erkundigte er sich. Barber trug einen leichten Tropenanzug aus Drell, der über der etwas korpulenten Figur spannte. Die Stirnglatze wies selbst jetzt, in der Nacht, Schweißtropfen auf.
»Der Koch«, gab Keat Sambath grinsend zurück. »Erinnern Sie sich? Sie selbst haben mich damals im Mondial darauf aufmerksam gemacht, daß wir eines Tages einen brauchen könnten …«
Barber erinnerte sich. Gelehrig war dieser Keat Sambath, man brauchte ihm tatsächlich nur einen Anstoß zu geben, er dachte von selbst weiter.
»Ein Koch, ja«, sagte Barber, »den braucht man. Nur – ich habe mich nie dafür interessiert, was dieser junge Mann, der uns da so freundlich bediente, für politische Ideen hat?«
»Gar keine. Sie wollten ihn zur Armee einziehen, da ist er ausgerückt.« Darüber dachte Barber nicht lange nach, das mit der Armee würde sich von selbst lösen. In einigen Tagen schon, dann nämlich würde es sie nicht mehr geben. Schließlich erinnerte er Keat Sambath daran, daß der junge Mann keine militärische Ausbildung besaß.
Keat Sambath würde das nicht vergessen. Er brauchte Hang Son allerdings nicht zum Schießen, sondern zum Essenkochen, und das hatte er sehr wohl gelernt. Außerdem ließ es sich bestimmt machen, ihm gelegentlich beizubringen, wie man ein Automatgewehr abfeuerte …
»Was Neues?« erkundigte sich Keat Sambath bei Barber. Der schüttelte den Kopf und zitierte die stereotype militärische Wendung: »Alle Systeme laufen!«
Er besah sich noch einmal die Lastwagen, prüfte die Ladung, trat hier gegen einen Reifen und klopfte dort gegen Blech, eigentlich gab es nichts mehr zu tun, man mußte warten, alles war gesagt. Jeder wußte, was er zu tun hatte. Trotzdem beschloß Barber, Keat Sambath nochmals an einige Einzelheiten zu erinnern, die er für wichtig hielt. Er sagte vorsichtig, weil er wußte, daß Keat Sambath derartige Examina nicht gerade schätzte: »Zwanzig waren es, wie?«
»Mit dem Koch und mir dreiundzwanzig.« Der Amerikaner lehnte sich an die Tür eines Lastwagens, aber schon nach ein paar Sekunden drückte ihn die Pistole, die er in der Hüfttasche trug, und er hockte sich auf eine leere Kiste, brannte sich, ohne auf die riesigen Warntafeln zu achten, eine Zigarette an und sagte: »Saigon ist fertig. Werden Sie einkalkulieren müssen, wenn Sie hier weg wollen. Da drüben geht bald nichts mehr. Eine Woche, zwei, viel mehr ist da nicht drin. Ich werde sofort nach Bangkok übersiedeln …«
Keat Sambath lachte. »Vielleicht kann ich ein Flugzeug stehlen! Müßten ja einige stehenbleiben, wenn alles vorbei ist. Und die ›Khmer Rouge‹– ob die fliegen können?«
»Unwahrscheinlich«, meinte Barber. »Es wird sechs bis acht Wochen dauern, dann habe ich die Dossiers von den Spitzenleuten. Wir wissen dann, mit wem wir es zu tun haben. Übrigens gibt es da an der Westgrenze bessere Möglichkeiten als ein Flugzeug …«
Er brauchte Keat Sambath nicht an die vielen Verbindungslinien zu erinnern, die sich die Agentur während der letzten Jahre geschaffen hatte, als sie freizügig in Kambodscha operierte. Vom kleinen Zuträger, der mit Tabak belohnt wurde, bis zu Motorbooten, die an den Küsten der Provinz Koh Kong versteckt lagen, in stillen Mangrovenbuchten, auf Kuriere wartend, die damit in weniger als einer Stunde die nächste thailändische Anlegestelle im Golf von Siam erreichen konnten. Funkgeräte waren deponiert worden und Waffen, Lebensmittel und Kleidung. Keat Sambath hatte den größten Teil dieser Vorarbeiten mit organisiert, deshalb ging der Amerikaner jetzt nicht mehr auf Einzelheiten ein, sondern bemerkte nur beiläufig: »Sie können wahrscheinlich am einfachsten einen der Waldpfade in Battambang benutzen. Soweit man es jetzt absehen kann, wird diese Gegend nicht so schnell durchgekämmt werden können, vielleicht geschieht es gar nicht. Die paar Kilometer von Sisophon bis über die Grenze sind unerheblich …«
Man hatte an Vorbereitungen getan, was irgend möglich war, jetzt mußten sich die operativen Leute selbst helfen. Er zweifelte nicht daran, daß Keat Sambath wissen würde, was zum gegebenen Zeitpunkt nötig war. Dieser Khmer war ein ausgekochter Bursche, der sich vor nichts fürchtete. Ihm würde jederzeit ein Ausweg einfallen, auch wenn andere schon die Hände hoben. »Ziehen Sie die schwarzen Anzüge noch mal durch den Dreck, bevor Sie sie ausgeben«, riet er. »Sie haben alle dieses schwarze Zeug an, und sie tragen die Schweißtücher dazu, wie eine Uniform …«
»Kharma nennen die Bauern die Tücher. Eine Sitte vom Lande. Es ist eine Armee von Bauern, die da anrückt. Manchmal Landlose, aus den Waldsiedlungen, Hungerleider, Benachteiligte, Primitivlinge, Verjagte, Hundefresser …«
»Nach Schweiß müssen die schwarzen Sachen auch riechen«, bemerkte der Amerikaner. »Vielleicht zahlt es sich aus, wenn die Leute sie Tag und Nacht tragen, ab jetzt schon.« Er wußte, daß Keat Sambath mit dem, was er über die Rebellenarmee sagte, ziemlich den Kern der Sache traf. Die Führer dieser Armee, die ihre Raketen auf die letzten Stellungen vor Phnom Penh verschoß, hatten sich geschickt die sozialen Ungerechtigkeiten der Politik Sihanouks zunutze gemacht, sie sammelten alle Unterprivilegierten um sich, in den Landgebieten, in denen es kaum Elektrizität gab oder etwa einen Laden mit Lampenöl und Konserven, wo die Leute eben auf den Regen warteten, damit der Reis wuchs, weil sie sonst hungern mußten. Nicht in jedem Dorf gab es einen, der lesen konnte. Die Rebellenführer hatten diese Leute mobilisiert, indem sie ihnen klarmachten, daß die Städte, in denen das Wasser aus Röhren floß und in denen tausend bunte Lichter am Abend erstrahlten, Musik ertönte und Bilder über graue Scheiben in kleinen Kästen tanzten, daß diese Städte voller Parasiten seien, die auf Kosten der Bauern und Landlosen lebten, von ihren Steuern, von dem Reis, den sie abliefern mußten. Und daß diese Parasiten mit ihren goldenen Uhren, ihren geputzten Weibern, ihren blanken Autos an allem Unglück Kambodschas schuld wären, an Überschwemmung und Dürre ebenso wie an Bombenangriffen und korrupten Polizisten, die in die Siedlungen kamen, um zu stehlen oder die Töchter der Bauern zu vergewaltigen. Polizisten und Soldaten, alles eins. Es war nicht verwunderlich, daß sie eine Armee zusammenbekommen hatten aus primitiven, ungebildeten, hungernden Landleuten, aber auch Städtern, die von der Ungerechtigkeit des Staates betroffen waren, die ihr Leben gerettet hatten, mehr nicht. Sie glaubten das, was die Führer ihnen weismachten. Sie brachen zu einem heiligen Krieg gegen alles auf, was nicht so war wie sie. Und die Führer nannten das Revolution. Auf dem Wege zum Sieg lag nur noch die Hauptstadt.
Barber wischte sich mit einem bunten Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Er war trotz der zwei Jahrzehnte in Südostasien immer noch nicht an das mörderische Klima gewöhnt, das vor allem zur Trockenzeit hier herrschte. Solange er sich tagsüber wenigstens in klimatisierten Büroräumen aufhalten konnte, ließ es sich ertragen. Aber hier, in der verlorenen Stadt, waren die meisten Klimaanlagen längst defekt, außerdem gab es nur noch sporadisch Strom, um sie zu betreiben.
»Es macht mich fertig«, gestand der Amerikaner dem Khmer. Dieser lächelte nur leicht, ihm machte es nichts aus, er war es gewöhnt, daß die Trockenzeit den Körper ausdörrte wie auch die Erde. Er hielt Barber eine Büchse Cola hin, die er aus einem Sack im Laderaum eines Lastwagens zog. Der Amerikaner winkte müde ab. »Zu süß«. Ich werde gekochtes Wasser trinken, mit Salz, sie haben im Korridor einen Ballon voll davon stehen …«
Keat Sambath erinnerte ihn: »Morgen mittag trinken Sie Bier Larue im Majestic, und dabei werden Sie eine kleine Saigonerin auf dem Schoß haben, Sir! Trösten Sie sich mit dieser Aussicht, die meinige ist weniger verlockend!«
Barber unterließ es, ihn an die Summe zu erinnern, die von der Agentur monatlich auf sein Bankkonto in Bangkok überwiesen wurde. Der Mann brauchte alles Glück der Welt, um nur zu überleben, gar nicht zu reden von Erfolgen, die er haben sollte. Eine Weile rauchte Barber schweigend, dann zertrat er den Stummel, und als er sich von der Kiste erhob, sagte er angewidert: »Ich werde Wochen brauchen, bis ich den Gestank der Wasserleichen aus den Nasenlöchern verliere …«
»Waren Sie noch einmal am Fluß?«
Der Amerikaner nickte. »Sie schwimmen immer noch vorbei. Aufgedunsen. Stinkend. Ganz langsam, weil das Wasser noch niedrig ist. Die Leute sagen, sie kommen von Kompong Cham, aber wer weiß das schon …«
»Soldatenleichen?«
Der Amerikaner verneinte das. Er hatte Leichen gesehen, die am Flußufer gestrandet waren. Dort standen Kommandos der Armee, die sie mit langen Stangen wieder ins Tiefwasser zurückstießen. »Weiber«, sagte Barber, »Kinder auch schon mal.« Draußen grollte eine Artilleriesalve. Seit Tagen schossen die Kanoniere Lon Nols, soweit sie noch nicht geflohen waren, ziemlich wahllos in alle Gegenden um die Stadt, wo sie Rebellen vermuteten. Der Amerikaner, der die Menge der in den letzten Monaten von Saigon herübergeflogenen Munition kannte, sagte ironisch: »Sieht so aus, als würden sie den Siegern nicht viel übriglassen.«
Dann blickte er auf die Uhr am Handgelenk und entschloß sich, es noch ein paar Stunden mit Schlafen zu versuchen. Obwohl er voraussah, daß er eine halbe Stunde später in einer Pfütze eigenen Schweißes liegen würde. Mit summendem Schädel, eine Zigarette nach der anderen rauchend, zog er sich zurück. Er schüttelte dem Khmer, auf den er so große Hoffnung setzte, noch einmal kräftig die Hand, weil er wußte, diese Asiaten machten sich etwas aus Händeschütteln, dann verabschiedete er sich. »Für den Fall, daß wir uns vor dem Abflug nicht mehr sehen: Kopf hoch! Wir treffen uns in Bangkok oder irgendwo in der Nähe. Ansonsten – Funkverkehr, bis die Einstellung zwingend notwendig wird. Wir überwachen die Überwacher. Bis dann!«
Er stampfte durch die Garage, ohne sich noch einmal umzublicken, ein gedrungen wirkender Mann mit gerötetem Gesicht, das außerdem etwas aufgeschwemmt war. Er interessierte sich nicht für den jungen Khmer Hang Son, der sich inzwischen hingelegt hatte und eingeschlafen war. Nicht einmal das Radio auf dem Tisch konnte ihn stören, es gab gerade den klirrenden Lärm einer Rock-Nummer von sich. Keat Sambath staunte, daß Hang Son nicht einmal aufwachte, als er den Raum betrat, aber er weckte ihn nicht, stellte nur das Radio ab, ließ sich in einen Sessel fallen und schloß die Augen. In seinem Kopf flimmerten Filmbänder von der Zukunft, so wie er sie sich vorstellte.
Eines der vielen Verstecke. Träge Tage, Nächte mit dem Gesäge der Zikaden und dem Duft wilder Blüten. Gefechte, in denen seine Männer gegnerische Bastionen stürmten. So lange würde das gehen, bis der revolutionäre Spuk totgemacht war. Und dann konnte man neu planen …
Hang Son fuhr von dem Lager hoch, auf dem er sich ausgestreckt hatte. Ein Flugzeug donnerte über das Gebäude hinweg. Sekundenlang überlegte er, ob er, wie bei überraschenden Artilleriesalven, schnell in einer Ecke des Raumes Deckung suchen sollte. Doch dann sah er Keat Sambath, und der schien überhaupt nicht erschrocken zu sein, im Gegenteil, er stand gähnend aus dem Sessel auf, in dem er geschlafen hatte, strich sein Khakizeug glatt, und sagte, als habe jemand soeben einen Gong ertönen lassen: »Auf! Es ist soweit!«
Der Lärm des Flugzeugs war nur geringfügig schwächer geworden. Keat Sambath, der sein Gepäck mitnahm, ließ sich von Hang Son helfen, und sie gingen hinaus, in die Stille der Halle. An den Lastwagen, es waren fünf, standen fünf Kambodschaner, sie machten den Eindruck von gut trainierten Sportlern, waren guter Dinge und begrüßten Keat Sambath militärisch, indem sie die rechte Hand zur Stirn hoben. Keat Sambath erwiderte den Gruß mit dem Ernst eines Offiziers, der seine Truppen inspiziert. Er trat an die jungen Leute heran und machte sich an ihren Hemden zu schaffen. Hang Son sah erstaunt, daß sie unter ziviler Kleidung die schwarzen Kattunkittel trugen, die man aus dem Fernsehen kannte, von den Bildern der Rebellen. Sie griffen nach einer Aufforderung Keat Sambaths in die Taschen und zeigten auch noch die grauschwarz karierten Schweißtücher vor, ebenfalls etwas, das man von den Rebellen kannte. Zu gern hätte Hang Son eine Frage gestellt, aber dazu war jetzt keine Zeit, das begriff er. Keat Sambath beschied die jungen Männer: »Gut!« Dann deutete er auf Hang Son, stellte ihn mit seinem Namen vor und fügte hinzu: »Unser Koch! Kann die schönsten Gerichte zaubern!« Das entlockte den jungen Männern beifälliges Gemurmel. Keat Sambath ließ ihnen keine Zeit zu Fragen, er befahl im Tonfall eines Kommandeurs: »Aufsitzen und Motoren anlassen. Abstand zehn Meter. Keiner hält an. Ich fahre an der Spitze. Folgen!«
Er bedeutete Hang Son, in den Jeep zu steigen, dann setzte er sich hinter das Lenkrad und fuhr auf das verschlossene Tor zu. Aus der Hemdtasche nahm er ein kleines elektronisches Instrument, das er auf die Tür richtete. Sie öffnete sich wie durch Zauberei lautlos. Keat Sambath lenkte den Jeep hinaus, warf das elektronische Gerät achtlos aus dem Wagen, dann waren sie auch schon am Tor der Botschaft, wo der Posten beide Flügel geöffnet hatte. In weniger als einer Minute war der kleine Konvoi auf der Straße. Keat Sambath forderte Hang Son auf, nach hinten Ausschau zu halten und Alarm zu schlagen, sobald einer der fünf Lastwagen stehenblieb.
Es ging ostwärts, in Richtung auf den Tonle Sap zu, an dem eine von Zuckerpalmen gesäumte Uferstraße entlangführt, die Sisowath Terak. Die Kolonne befuhr sie in nördlicher Richtung, bis an die verlassene Tonle-Sap-Brücke. Hier bog Keat Sambath westwärts ab, und nach wenigen Minuten waren sie am kleinen Sportstadion angelangt, einer Wettkampfstätte, die nach dem Ausbau des protzigen Olympiastadions, südwestlich des Stadtzentrums, ein wenig vernachlässigt worden war. Nur selten noch hatte es hier Sportveranstaltungen gegeben, auch die Tennisplätze waren verwaist. Schließlich war die Armee eingezogen, ein Dutzend Panzerspähwagen waren hier stationiert worden und hundert Soldaten, die meist gelangweilt herumlungerten, Steaks über qualmenden Feuern brieten, mit ihren Pistolen nach leeren Bierbüchsen schossen und anderen Unsinn anstellten. Jetzt waren sie ebenfalls verschwunden. Am Tor zu dem Gelände stand ein zivilgekleideter junger Mann, er winkte die Kolonne herein und schob das schwere Tor dann sofort zu, um zu verhindern, daß Flüchtlinge hineinsickerten.
Gegenüber war das Gebäude der japanischen Botschaft zu sehen, die Flagge wehte noch. Ob die Japaner sich von den Rebellen überrollen lassen wollten, oder ob sie nur vergessen hatten, das Sonnenbanner einzuziehen? Vor den Umkleidekabinen des Stadions kam die Kolonne zum Stehen. Aus einer Tür sprang ein weiterer junger Khmer, der baute sich militärisch stramm vor Keat Sambath auf und meldete diesem: »Corporal Ek Sam und fünfzehn Mann, alle gesund, keine besonderen Vorkommnisse.«
»Ab sofort,« teilte ihm Keat Sambath mit, »bist du nicht mehr der Corporal, sondern der Genosse Ek Sam, und die Männer sind rote Kämpfer ohne Dienstgrad, klar?«
»Klar! Umziehen?«
»Noch nicht«, entschied Keat Sambath. »Zu früh.« Man mußte vorsichtig sein. Er deutete auf Hang Son, der aus dem Wagen geklettert war, und erklärte dem Corporal: »Hang Son kämpft mit dem Suppentopf, denn er ist Koch. Wir schützen ihn vor Gefahr, weil er sehr gutes Essen zubereiten kann. Macht euch bekannt und legt einen schwarzen Anzug für ihn bereit!«
Er winkte den Lastwagenfahrern, die Wagen dicht an das Gebäude zu fahren, so waren sie von draußen nicht mehr zu sehen. Schließlich wandte er sich an Hang Son: »Geh hinein, du findest alles, was du brauchst, um für alle einen guten, starken Kaffee zu kochen!«
In diesem Augenblick näherte sich das Geräusch eines Flugzeugs. Es war ein Hubschrauber der Amerikaner, er flog sehr niedrig, nur knapp über den Häuserdächern, es sah aus, als ob er einen Kreis flog, um die Gegend zu sondieren.
Die Kuckucksuhr, die aus dem Schwarzwald stammen sollte, in Wirklichkeit aber in Hongkong hergestellt war, und die irgendeiner der Botschaftsmitarbeiter einmal in der Kantine aufgehängt hatte, zeigte neun Uhr, als der Motorenlärm über der Botschaft so stark anschwoll, daß man den Ruf des Porzellanvogels, der seinen Kopf aus der Klappe steckte, nicht mehr wahrnehmen konnte. Es war der erste riesige Transporthubschrauber, der die Botschaft überflog und sich dann auf dem Fußballplatz nebenan, zwischen den beiden Toren, herabsenkte.
Chanta stand unter der Fächerkrone einer Akazie am Rande des Fahrweges zu dem Fußballfeld, und sie versuchte immer wieder, einen Blick auf das Einfahrtstor der amerikanischen Botschaft zu werfen, die man von hier aus sehen konnte. Doch da vorn, wo der Wachposten unter dem Wellblechdach stand, gab es nichts zu sehen, niemand zeigte sich. Dabei hatte Hang Son, als er zu den Amerikanern flüchtete, ihr versichert, daß er sich am Vormittag in der Nähe des Tores aufhalten würde, so daß sie miteinander sprechen konnten.
Chanta war am frühen Morgen vom Wohnheim der Balletttänzerinnen, in dem es jetzt viele freie Zimmer gab, weit im Südosten der Stadt zwischen dem Königspalast und dem Kloster Botum Vaddey, aufgebrochen. Sie war auf dem mehr als zwei Kilometer langen Weg nicht ein einziges Mal von Soldaten angehalten worden. Dabei war sie auf einer der Hauptverkehrsadern gegangen, der ehemaligen Preah Norodom. Wie sich die Stadt verändert hatte!
Noch vor einigen Jahren war sie schön gewesen, ihr Anblick heute wirkte bedrückend. Nicht nur, daß sie mit Flüchtlingen aus den Provinzen vollgestopft war, die an den Straßenrändern kampierten, deren Exkremente die Luft ebenso verpesteten wie der Qualm ihrer unzähligen Feuer, auf denen sie aus Abfällen Mahlzeiten kochten. Auch das Militär hatte die Stadt verunreinigt mit seinen herumlungernden Soldaten, die von den letzten Huren umschwärmt wurden. Es stellte seine schmutzigen Fahrzeuge vor die Palasttore, türmte Sandsäcke und Stacheldraht um Pagoden auf – wer in dieser Stadt aufgewachsen war, wie Chanta, der konnte sich nur wehmütig an ihren einstigen Glanz erinnern. Das war alles so plötzlich gekommen, als der General putschte und als sich der lange angestaute Unwille über die vielen kleinen Ungerechtigkeiten, die der Prinz zu verantworten hatte, die königliche Korruption und die blutige Verfolgung aller Leute, die sich eines linken Gedankens verdächtig machten, in spontanen Freudendemonstrationen entlud! Man lief ins Olympiastadion, um den neuen Staatschef zu bejubeln, man besah sich dort die ausgestellten Porno-Bilder des Prinzen, man erfuhr von seinen Amouren und geheimen Geschäften, von der Verworfenheit seiner Frau und der gesamten blaublütigen Sippe, man klatschte Beifall, rief im Sprechchor »nieder!«, man tanzte und lachte den neuen Männern zu, die nun alles besser machen wollten.
Zuerst riefen sie die Amerikaner und die Saigoner ins Land. Dabei verschwiegen sie, daß diese den Putsch finanziert hatten. Die »Khmer Rouges«, deren Radiostation man mit einem guten Gerät bisweilen hören konnte, verbreiteten die Nachricht von der unheiligen Allianz Lon Nols mit den Amerikanern, aber die Leute in der Stadt wollten davon gar nichts hören. Sie interessierte vielmehr das Angebot in der großen Markthalle, ein Fernsehgerät, ein Kühlschrank. Gerechtigkeit? Nun, man würde sehen!
Nach einiger Zeit begriffen selbst Leute, die sich gegen politische Erkenntnisse sträubten, daß sie mit dem neuen Regime sozusagen von der Dürre in den Taifun geraten waren. Noch blutiger wurde jeder verfolgt, von dem bekannt wurde, daß er »links« sei. Die Soldaten, die immer jünger wurden, dümmer, gefühllos wie Kinder, die Zikaden die Beine ausrissen, brüsteten sich damit, daß sie den roten Rebellen, die sie erwischten, die Köpfe abhackten. Zeitungen brachten widerliche Bilder solcher Heldentaten. Und es wurde ziemlich offen darüber gesprochen, daß Lon Nols Soldaten im heiligen Kampf gegen den Kommunismus eine Tradition aus der barbarischen Vorzeit neu belebten: sie aßen die Leber von getöteten Gegnern, um deren Kräfte in sich aufzunehmen.
Schon bald gab es das Land Kambodscha, die Republik, deren Geburt man zugejubelt hatte, nur noch auf Landkarten. Das Herrschaftsgebiet des Generals schrumpfte auf einen winzigen Bruchteil des ehemaligen Territoriums zusammen. Damit war der Hunger gekommen. Für Leute, die es sich leisten konnten, flogen die Amerikaner Reis und Mehl, Öl und Konserven ein, aber auch Delikatessen. Bei den Ärmsten begann die Suche nach Weggeworfenem. Kinder und Greise starben. Die Tauben in der Stadt wurden gefangen und verzehrt, bald schon kratzten die Geflohenen, denen niemand zu helfen gewillt war, die Rinde von den Mangobäumen in Phnom Penhs Straßen und kochten einen Sud gegen Skorbut daraus. Heute war aus der Perle Südostasiens, wie die Besucher Phnom Penh so gern genannt hatten, eine graue Siedlung voller unglücklicher Menschen geworden, die sich gegen die vage Ahnung sträubten, ihre Zukunft könne noch düsterer sein als die Gegenwart.
Die Soldaten im Stadtzentrum, denen Chanta begegnete, schienen nicht mehr nach Deserteuren zu suchen, sie waren meist selbst desertiert, hatten sich zu Grüppchen zusammengerottet und versuchten nun, sich das Leben, das ihnen nicht mehr viel Gutes zu verheißen schien, durch Diebereien wenigstens für den Augenblick zu verschönern. An einem der großen Läden, in denen früher Delikatessen verkauft worden waren, war ein Dutzend wild aussehender Gestalten in Tarnanzügen dabei, Säcke voller Dosen mit Gänseleberpastete und Putenfleisch durch das zerschlagene Schaufenster nach draußen zu bugsieren. Wer konnte sagen, ob es Soldaten waren? Jeder konnte Soldatenkleidung am Straßenrand auflesen oder ein Automatgewehr. Ganz sicher wäre Hang Son nichts geschehen, wenn er sich irgendwoanders in der Stadt versteckt hätte. Ich werde ihm zureden, mit mir zu kommen, nahm sich Chanta vor. Sie war sehr schlank, ihr langes schwarzes Haar hing fast bis auf das Gesäß herab. Die Bewegungen des Mädchens, das die Ausbildung einer klassischen Tänzerin genossen hatte, waren anmutig, zuweilen erinnerten sie an Tanzschritt. Sie trug Hosen und eine blaue Bluse, wie sonst auch, wenn sie die Tänzerinnen für den Auftritt schminkte, nur daß sie dann noch einen weißen Umhang überwarf. Die Tänzerinnen waren zum größten Teil ins Ausland geflohen. Das einstige königliche Ballett war vom Regime des Putschgenerals zwar nicht aufgelöst worden, aber es war nach und nach immer schwächer geworden, bis es zu keiner Aufführung mehr taugte. Die Angehörigen der ehemaligen königlichen Familie, soweit sie im Ballett gearbeitet hatten, waren verschwunden, verschleppt oder untergetaucht. Es sah so aus, als ob es in diesem Lande auf lange Zeit kein Ballett mehr geben würde. Einige der Mädchen, die von Bewunderern stets umschwärmt gewesen waren, flohen mit ihren Gönnern, boten sich sogar als deren Konkubinen an. Heute waren sie in Hongkong oder in Bangkok, in Singapore. Die Perle Südostasiens glänzte seit langem nicht mehr.
Chanta spähte zur Botschaft hinüber. Von Hang Son war nichts zu entdecken, nur der Posten stand da, nervös, wie es schien, er musterte den Himmel.
Irgendwo im Osten schlugen Raketen ein, dann explodierte ein Munitionsstapel mit minutenlangem Geknatter. Eine Sirene heulte, offenbar gab es noch eine Feuerwehr. Gewehrschüsse peitschten, bevor wieder für eine Weile Ruhe einzog. Es war eine Ruhe, wie es sie über dieser Stadt voll summenden Lebens nie gegeben hatte.
Dann kam der Hubschrauber …
Es war eine zweimotorige Chinook, und sie setzte genau in der Mitte des Fußballfeldes auf, dort, wo der Anstoßpunkt markiert war. Das Dröhnen der Motoren riß nicht ab, während Scharen von Marineinfanteristen aus der Luke sprangen, schwer bewaffnet, Maschinengewehre tragend und kleine Granatwerfer. Sie gingen sofort rings um das Fußballfeld in Stellung. Durch ein Tor im Zaun, der das Feld umgab, kamen die Leute, die Amerikas Botschaft in Phnom Penh durch den Hinterausgang verließen. Sie hatten nur leichtes Gepäck bei sich, aus irgendeinem Grunde liefen sie geduckt, obgleich nirgends geschossen wurde. Sie bewegten sich schnell auf den Hubschrauber zu. Hang Son, das konnte Chanta sehen, war nicht unter ihnen.
Der erste Hubschrauber war bald besetzt, die Luke wurde geschlossen, er erhob sich und verschwand, eine riesige Staubwolke aufwirbelnd. Wenige Minuten später kurvte die nächste Maschine ein. Die Chinooks kamen von Flugzeugträgern, die nur wenige Flugminuten entfernt im Golf von Thailand kreuzten. Neugierige hatten sich eingefunden, sie beobachteten den Abflug der Amerikaner ohne Gemütsbewegung, es schien fast, als hätten sie erwartet, daß diese Fremden eines Tages vor den Rebellen ausreißen würden. Wenn die nahende Revolution sonst nichts bewirkte, so fegte sie doch die Fremden aus dem Lande, und das war schon etwas!
Ein paar Leute winkten. Kinder bohrten in der Nase und vergaßen über dem Schauspiel der Evakuierung wenigstens für einige Zeit den Hunger. Ihre Blicke folgten den gescheckten Libellen mit bewundernden Blicken.
Zuletzt, als es in der Botschaft niemanden mehr gab, erschien Botschafter Dean am Hinterausgang. Er hatte dafür gesorgt, daß sich unter den Marineinfanteristen ein Kamerateam befand, das einen Filmstreifen davon aufnahm, wie er, im dunklen Anzug, mit Schlips und dezentem Kavalierstaschentuch, gemessenen Schrittes aus dem Botschaftsgelände heraustrat, um zum Hubschrauber zu gehen. Auffällig über den Unterarm drapiert, trug Dean die US-Flagge, sie war so gefaltet, daß man Sterne und Streifen erkennen konnte. Dean hielt das Zeremoniell bis zum Hubschrauber durch, obwohl währenddessen nicht weit entfernt ein paar Raketen der Rebellen niedergingen. Die Marineinfanteristen folgten Dean mit grimmigen Gesichtern.
Die Motoren brüllten jäh auf, dann hob der schwere Vogel ab. Die Show für die abendlichen Nachrichtensendungen im amerikanischen Fernsehen war vorüber.
Chanta sah, daß der Posten noch vor der Botschaft stand, und sie entschloß sich, ihn anzusprechen. Der verängstigte Soldat, der gerade überlegte, wie er am besten verschwinden könne, und ob es sich vielleicht doch lohnen würde, zuvor noch einen Streifzug durch die Bestände der Kantine zu machen, riß seine Maschinenpistole hoch, als das Mädchen auf ihn zukam. Aber er erkannte, daß sie ihn nicht angreifen wollte, und er war nicht unfreundlich zu ihr, zumal sie hübsch war.
»Ein junger Mann?« Er schüttelte den Kopf. Der Helm schaukelte, er war zu groß. »Ich habe keinen hier gesehen. Bin seit dem Morgen da. Wenn du willst, kannst du meinetwegen hineingehen und selbst suchen, ich habe hier nichts mehr zu tun …«
»Aber – er wollte zu Keat Sambath«, fiel Chanta ein. »Das war der Kraftfahrer. Wo ist der?«
»War heute früh schon nicht mehr da, als ich kam. Wurden keine Fahrer mehr gebraucht.«
Dann haben ihn vielleicht doch Soldaten erwischt, durchfuhr es Chanta. Auf dem Weg hierher? Wo soll ich ihn suchen? In welchem Gefängnis könnte er sein? Den Posten zu fragen war sinnlos. Der war froh, wenn man ihn in Ruhe ließ. In einigen Minuten würden ohnehin die ersten Plünderer hier sein, es sprach sich schnell herum, wenn jemand floh und sein Anwesen zurückließ, wie diese Amerikaner.
Der Posten nahm den Helm ab und warf ihn hinter das Häuschen aus Wellblech. Chanta überlegte verzweifelt, was sie tun könnte, während sie ziellos weiterging. Hang Son war verschwunden. Werde ich ihn jemals wiedersehen? Es heißt, sie bringen Leute wie ihn kurzerhand um. Aber vielleicht kommen vorher doch noch die Rebellen! Sie stellte sich vor, daß drüben am Ostufer des Tonle Sap die Leute lagen, die einzig und allein Hang Son befreien konnten, und sie ertappte sich dabei, daß sie sie herbeisehnte, obwohl sie sich vor ihnen fürchtete, weil die Zeitungen sie als brutal und gefühllos beschrieben hatten. Wenn sie ihn aber in Freiheit setzten, dann gab es eine Zukunft, von der einiges zu erhoffen war. Das Mädchen war am Fluß angekommen, während sie vor sich hin träumte. Warum kamen die Rebellen nicht? Sie blickte über das Wasser. Leichen schwammen vorüber, es roch nach Tod. Am diesseitigen Ufer waren die Stellungen der Lon-Nol-Soldaten verlassen. Ausrüstungsgegenstände und Waffen lagen herum, Munition. Im Norden stand die gesperrte Brücke. Niemand bewegte sich am Ufer, weder hüben noch drüben, obgleich nicht geschossen wurde.
Werden sie mit Booten kommen? Oder vielleicht über die verminte Brücke? Es gab außerdem noch mehrere andere Übergänge im Vorgelände der Stadt, es gab die Fähren.
Das Mädchen wanderte zurück. Ohne es eigentlich zu merken, schlug sie die Richtung zum Zentrum ein. Die Stadt war zwar, so schien es ihr, erwacht, wie jeden Morgen, sie lebte, aber es war nicht mehr die gleiche Stadt wie früher. Ganz abgesehen von den Straßensperren, den Trümmerhaufen, dem Unrat, in dem verzweifelte Flüchtlingskinder noch eßbare Bissen suchten, abgesehen auch von dem Gestank, der unter Geröll verwesenden Leichen, dem Qualm seit Tagen schwelender Brände, war das zwar noch Phnom Penh, aber es war eine sterbende Stadt, niemand konnte sich dieses Eindrucks erwehren.
An einer Hilfsstelle, die ein Fähnchen mit dem Roten Kreuz trug, standen Hunderte von schwangeren Frauen. Ein seltsam nobel aussehender Greis kippte jeder eine Suppenkelle voll ungekochtem Reis in die aufgehaltenen Hände.
Ein Auto fuhr vorbei, von dem ein Mädchen durch ein Megaphon verkündete, es werde Milchpulver für die Kinder erst in einigen Tagen wieder geben. In einigen Tagen!
Chanta sah die jungen Frauen stehen, in der langen Reihe, deutlich markierte sich unter ihren schmutzigen, von der Flucht zerfetzten Kleidern ihre Schwangerschaft. Es war wie ein Symbol, daß sie alle Lumpen trugen, keine etwa einen Sampot, sie standen da und hielten die Hände auf, schon lange bevor sie an die Reihe kamen: das ganze Land hielt die Hände auf, es war – einst wohlhabend, wenn auch der Wohlstand ungleich verteilt gewesen war – durch den amerikanischen Krieg endgültig in ein einziges Armenhaus verwandelt worden.
Soldaten zogen in kleinen Grüppchen an den Frauen vorbei, meist noch sehr junge Burschen, halbe Kinder. Gelegentlich legten sie ihre Waffen an und schossen in die Luft, einfach um ihren Mut zu beweisen. Dabei waren sie längst keine Soldaten mehr, die Armee hatte sich aufgelöst, nachdem die Offiziere das Weite gesucht hatten, und diese Kinder hier trugen nur noch Uniformen, weil sie sonst nichts besaßen. Zu einer Gegenwehr wird es nicht mehr kommen, sagte sich Chanta, selbst wenn die Rebellen in der nächsten Stunde angreifen.
Im Kino Asia schien, obwohl es erst Vormittag war, ein Film zu laufen. Durch die weit geöffneten Lüftungsklappen drang Keuchen und Stöhnen, eine Frau trieb einen Mann mit Ausdrücken an, die vor ein paar Jahren noch niemand öffentlich zu benutzen gewagt hätte. Das Plakat, riesengroß über die Vorderfront gezogen, verriet den Titel: »Königin der Sünde«.
Etwas weiter die Monivong abwärts lag das Hotel Mondial, in dessen Restaurant Hang Son gearbeitet hatte. Tür und Fenster waren eingeschlagen, der Gastraum wimmelte von Flüchtlingen, auf der Bar lag eine junge Frau in den Wehen. Eine alte Chinesin wusch sich gerade die Hände in einem Bottich mit heißem Wasser, es schien so, als wolle sie ihr Hebammentalent unter Beweis stellen. Niemand sonst kümmerte sich um den Vorgang, zumal auf der anderen Straßenseite, in der Nähe des Sukhalay, eines anderen Hotels, geschossen wurde. Die Leute duckten sich, schmiegten sich an den Bretterfußboden. Chanta stieg über eine Frau hinweg, die am Boden lag, mit entblößten, schlaffen Brüsten, an denen Zwillinge ihren Hunger zu stillen suchten. Sie konnte in die Küche blicken, den Tisch sehen, an dem Hang Son noch vor Wochen Krabben paniert und Frühlingsrollen gefüllt hatte. Nein, er war nicht mehr hier, natürlich nicht!