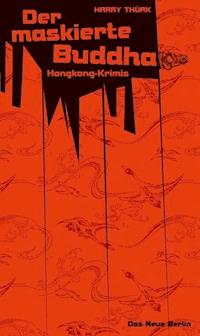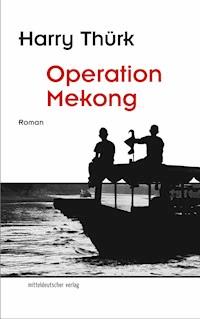Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mdv Mitteldeutscher Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kambodschas bitterste Jahre Mitte der 1970er Jahre befindet sich Kambodscha im Bürgerkrieg. Die Roten Khmer haben unter Pol Pot die Herrschaft übernommen und zwingen die Bevölkerung in Arbeitslager, in denen die Zahl der Todesopfer stetig ansteigt. Drei Augenzeugen berichten aus unterschiedlicher Perspektive von ihren Erlebnissen und den unvorstellbaren Zuständen dieser Zeit: Kim Sar, der durch Zufall in die Führungsriege der Roten Khmer gelangte, Ung Phim, der als Soldat Flüchtende über die vietnamesische Grenze schleuste, und Yong Sok, der die Schrecken der Zwangsarbeit am eigenen Leib erfuhr. Harry Thürks 1990 veröffentlichte ebenso spannende wie erschütternde dokumentarische Rückschau auf eines der brutalsten Regimes der jüngeren Geschichte ist nun endlich wieder lieferbar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Harry Thürk
Der Reis und das Blut
Kambodscha unter Pol Pot
mitteldeutscher verlag
Im Mitteldeutschen Verlag erhältlich:
Die Stunde der toten Augen (Roman)
Sommer der toten Träume (Roman)
Operation Mekong (Roman)
Der schwarze Monsun (Roman)
Dien Bien Phu. Die Schlacht, die einen Kolonialkrieg beendete (Tatsachenroman)
Harry Thürk (1927–2005), geb. in Zülz (heute Biala/Polen), Besuch der Real- und Handelsschule in Neustadt/Schlesien, 1944/45 Wehrdienst, nach dem Krieg Rückkehr nach Neustadt, Internierung in einem Durchgangsghetto für Deutsche, von dort Flucht nach Ostdeutschland. In der DDR Arbeit als Reporter (u.a. Auslandskorrespondent in Korea, China, Vietnam, Laos, Kambodscha), was sich in seiner literarischen Arbeit niederschlug, seit 1958 freier Autor in Weimar. Seine Bücher wurden in polnische, tschechische, slowakische, ungarische, rumänische, russische, finnische, litauische, vietnamesische und spanische Sprache übersetzt.
Editorische Notiz: Im Text taucht häufig der Begriff Angkar auf. Dies ist die Bezeichnung des Führungsgremiums der Pol-Pot-Diktatur in Kambodscha (1975–1979). Sinngemäß übersetzt heißt es etwa Revolutionäre Organisation. Nicht zu verwechseln ist dieses Wort mit dem ähnlich klingenden Angkor, dem Namen der alten Hauptstadt des Khmer-Reiches (12.–
KAMBODSCHA – Was vorher war
Mit dem Beginn der modernen Zeitrechnung entsteht im Herzen Indochinas das Großreich Fu Nan. Gespeist aus den geistigen Quellen des Hinduismus, aber auch aus der buddhistischen Lehre, blüht eine Kultur auf, deren Hauptgegenstand die Verehrung der Götter und der vermeintlich direkt von diesen abstammenden Könige ist.
Doch dem mächtigen Reich erwachsen Feinde. Ein Vasall ist es, der das Rad der Geschichte im 6. Jahrhundert in Bewegung setzt: Hundert Jahre brauchen Generationen von Kriegern aus dem Norden, um Fu Nan zu zerschlagen. Man nennt sie Kambus, nach ihrem ersten König Kambu, dem ehemaligen Oberpriester, der sich, wie die Legende erzählt, mit der himmlischen Schönheit Mera vermählte, der die göttliche Dynastie ihre ersten Herrscher verdankt. Chen La heißt das neue Reich, das später die Kambujas begründen.
Aber auch Chen La wird bald das Ziel neuer Angreifer. Im fernen Java haben sich mächtige Herrscher entschlossen, ihre Heere nordwärts zu schicken, durch die malaiischen Gebiete hindurch, und weiter, bis sie schließlich ihren Zug mit der Eroberung des noch nicht voll konsolidierten Chen La beenden.
Bald jedoch, nachdem gerade das 9. Jahrhundert angebrochen ist, regt sich im Herzen Indochinas Widerstand gegen die Javaner. Ein junger Prinz führt ihn an, Jayavarman. Er sammelt Soldaten, stellt Heere auf, und es gelingt ihm, die fern von ihrem Stammland operierenden Javaner zu vertreiben.
Noch ahnt niemand, daß es von nun an für reichlich vier Jahrhunderte ein friedliches Reich der Kambujas geben wird – Angkor, so genannt nach der märchenhaft schönen und geradezu gigantisch anmutenden Hauptstadt, die an den Ufern des Großen Sees gebaut wird.
Vier Jahrhunderte vergehen, bis die hohen Steintürme, die prachtvoll ausgestatteten Tempel und Pagoden Angkors, in denen Schiwa ebenso verehrt wird wie Wischnu und Buddha, neue Eroberer anlocken. Vom Westen her rücken die Thai an, vom Osten die Cham. Jahrzehntelange Kriege zermürben Angkor, lassen es verarmen, bis die glanzvolle Metropole schließlich aufgegeben werden muß. Sie wird nicht zum Zentrum der Macht neuer Eroberer, sondern sie versinkt buchstäblich im üppig wuchernden tropischen Dschungel, der sich über ihre Mauern hinweg ausbreitet. Ihre Portale werden von den Wurzeln der Kasuarinen gesprengt; die herrlichen Reliefs der Tempel verschwinden hinter Wällen von wildem Buschwerk und Farn. Die Kambujas ziehen sich südwärts zurück. Gründen am Tonlé Sap, dort, wo der mächtige Mekong, Urstrom dieses Erdteils, sich in viele schmale Flüsse zu teilen beginnt, vor seinem Delta, die neue Hauptstadt Phnom Penh.
Man nennt die Kambujas inzwischen die Khmer. Und diese Khmer bekommen keine Ruhe. Immer wieder tränkt das Blut gefallener Angreifer und Verteidiger die satten Reisfelder, den Laubteppich des Waldes. Siamesische und vietnamesische Herrscher wetteifern in der Eroberung des Landes. Ihre Erfolge sind nicht endgültig, denn die Khmer geben nie ganz auf. Doch sie bluten buchstäblich aus. Zudem verschleißt sich die regierende Dynastie der Norodom in Familienzwistigkeiten, und feudale Besitzer kämpfen gegeneinander, auf dem Rücken der Bauern.
Um diese Zeit – es ist die Mitte des 19. Jahrhunderts – etabliert sich Frankreich als Kolonialmacht in diesem unermeßlich reichen Gebiet der Welt. Der Okkupation der ersten vietnamesischen Provinzen folgt 1863 die Unterwerfung des Khmer-Reiches. Es wird zum »Protektorat«. Französische Forscher haben inzwischen die Ruinen von Angkor entdeckt und durchsuchen sie nun eifrig nach verborgenen Schätzen. Die mit primitiven Waffen unternommenen Aufstände patriotischer Khmer, unter ihnen buddhistische Priester ebenso wie feudale Prinzen, können das Blatt nicht mehr wenden: 1887 wird das Reich der Khmer unter dem Namen Kambodscha Teil der sogenannten Indochinesischen Union, einer französischen Kolonie. Die Ausplünderung des Landes, in dem neben den Khmer auch noch einige andere nationale Minderheiten leben, von denen die eingewanderten Chinesen und Vietnamesen die zahlenmäßig stärksten sind, beginnt. –
Es ist die Große Sozialistische Oktoberrevolution in Rußland, die dann ein neues Zeitalter einläutet: Ihre Ideen fassen zuerst Fuß im benachbarten Vietnam: Dort greift sie Nguyen Ai Quoc auf, der große Revolutionär, den man später in Europa als Ho Chi Minh kennenlernt. Er organisiert die ersten Schritte des Befreiungskampfes der Völker von Vietnam, Laos und Kambodscha, unter anderem mit der Gründung der Vorläufer einer ersten marxistischen Bewegung in seinem Land. Da die drei indochinesischen Völker das gleiche Los teilen, ergibt sich, daß sie auch gemeinsam kämpfen, einer für den anderen.
1930 wird folgerichtig in Zusammenarbeit der Kommunisten aller drei Länder die Kommunistische Partei Indochinas gegründet. Das Ziel ist die Befreiung vom Kolonialismus im gemeinsamen Kampf, wonach dann jede Nation für sich in freier Selbstbestimmung ihren eigenen Staat errichten soll. Niemand ahnt, daß es fast ein halbes Jahrhundert dauern wird, bis die nationale Selbständigkeit zur Realität wird. –
Von Beginn an erweist sich die vietnamesische Bewegung als die stärkste und konsequenteste. Aber auch in Kambodscha erstarken nach und nach die revolutionären Kräfte. Dabei entstehen Nebenströmungen, wie die Khmer Isserak, von Son Ngoc Minh angeführt, der stets die Verbindung mit den vietnamesischen Befreiungskräften aufrechterhält. Sein eigener Bruder hingegen, Son Ngoc Thanh, sieht sein Hauptziel in der Bekämpfung der kambodschanischen Monarchie, geht immer mehr eigene Wege und stellt sich mit Teilen der Bewegung sogar während des zweiten Weltkrieges den japanischen Besatzern als »Außenminister« und Chef einer Vasallenregierung zur Verfügung, bis ihn die zurückkehrenden Franzosen wieder in den Untergrund treiben.
Die Unterschiede in der nationalen Entwicklung und der Kräftelage in den einzelnen Ländern nach dem zweiten Weltkrieg machen es schließlich erforderlich, die bisherige KP Indochinas aufzulösen; in jedem Land bilden sich unabhängige Befreiungsbewegungen, an deren Spitze nationale kommunistische Parteien stehen. In Kambodscha gibt es nun die Khanak Pak Pracheachon Pakdevoath Khmer, die bereits 1951 gemeinsam mit der laotischen und der vietnamesischen Bruderpartei die Allianz der vietnamesischen Khmer und laotischen Völker bildet, eine die Grenzen übergreifende Dachorganisation mit dem Ziel der Koordinierung des antikolonialistischen Kampfes. Wenig später werden offiziell die Revolutionären Streitkräfte des Volkes von Kambodscha aufgestellt, die unverzüglich den Kampf gegen die Franzosen aufnahmen.
Diese spürten die Gefahr, die sie nun bedrohte, und sie versuchten auf ihre Art, sie vorerst zu neutralisieren. Sie gestanden dem neunzehnjährigen Prinzen Sihanouk, Abkomme der alten Norodom-Dynastie und in französischen Schulen erzogen, 1953 formell die Unabhängigkeit zu, weil sie wohl glaubten, ein französisch gebildeter Sprößling blauen Geblüts würde einfacher von ihnen zu dirigieren sein als eine revolutionäre Massenbewegung.
Bei den Befreiungskräften Kambodschas verursachte dieser Schachzug der Franzosen eine nicht zu unterschätzende Krise. Nicht wenige Kämpfer sahen das Ziel, die nationale Befreiung, als erreicht an. Sie legten die Waffen nieder und arrangierten sich, während andere dem »neuen Frieden« nicht recht trauten und im Untergrund blieben.
Die unmittelbar auf den Sieg der vietnamesischen Befreiungsarmee bei Dien Bien Phu, 1954, folgende Zeit sah Kambodscha in einem eigenartigen Schwebezustand. Auf der Genfer Konferenz, die den Krieg in Indochina offiziell beendete, wurde Kambodscha von seinem neuen Staatschef Sihanouk vertreten. Zu Hause wob er fleißig an der Legende, der einzige und wahre Befreier Kambodschas vom Kolonialismus zu sein. Er verfolgte eine geschickte Politik, indem er das feudalistische System, in dem sich zunehmend kapitalistische Elemente breitmachten, unangetastet ließ. Zugleich betrieb er international eine antiimperialistische Neutralitätspolitik; er zeigte sich sogar sozialistischen Staaten gegenüber aufgeschlossen, um Anerkennung und Ausgleich bemüht, was ihm in Indochina hohes Ansehen einbrachte, aber auch die Mißbilligung der Vereinigten Staaten, die Indochina als Einflußgebiet betrachteten und in Sihanouk, der sich ihnen nicht unterordnen wollte, einen Störfaktor sahen.
Politiker verschiedener Staaten nannten das, was Sihanouk tat, einen halsbrecherischen Balanceakt. Wie nahe diese Beurteilung der Wirklichkeit kam, sollte sich bald zeigen. Kambodscha erlebte zunächst eine Phase des Aufblühens einer kapitalistischen Wirtschaft. Allerdings spielte sich der Prozeß fast ausschließlich in der Hauptstadt und in einigen wenigen Provinzhauptstädten und Ballungszentren ab. Dort scheffelte eine hauchdünne Unternehmerschicht unerhörte Profite. Die Masse der Landbevölkerung aber, besonders in den Randgebieten, litt unter einer Verschlechterung der Lebenslage, gemessen etwa am Standard der Stadtbewohner, Wirtschaftsangestellten oder Intellektuellen. Mit der Zeit entwickelte sich ein steiles soziales Gefälle im Lande, das gefährlichen Zündstoff anhäufte. Zudem wünschten die USA, daß Kambodscha sich ihnen öffnete.
Das stand im Zusammenhang mit den irrwitzigen Plänen der US-Befehlshaber in Südvietnam, den Krieg gegen die Befreiungsfront militärisch zu gewinnen. In der Einbeziehung Kambodschas in die US-Pläne und der angestrebten Präsenz amerikanischer Truppen dort sahen die US-Generale die Chance, die Befreiungsfront von ihren logistischen Basen abzuschneiden.
Doch Sihanouk ging weder auf Verlockungen noch auf Drohungen ein, wiederholt hingegen äußerte er Sympathie mit der vietnamesischen Befreiungsfront, und sein Verhältnis zu Hanoi verstand er ausgeglichen zu gestalten. So spitzten sich auf außenpolitischem Gebiet die Widersprüche ebenfalls für ihn zu.
Indessen war aus Paris eine Gruppe junger Kambodschaner heimgekehrt, die 1949 die von Frankreich gezielt angebotene Chance wahrgenommen hatte, dort zu studieren. Der Hintergedanke der Franzosen, sie durch den Aufenthalt im »Mutterland« zu intellektuellen Mitläufern des Kolonialregimes zu machen, denen man dann später Schlüsselstellungen in der Kolonie anvertrauen konnte, ging allerdings nicht auf. Im Gegenteil. Die mit wenig Begeisterung studierenden jungen Leute hatten im Hinterzimmer einer kleinen Wohnung in der Rue du Commerce imXV. Arrondissement von Paris eine extrem nationalistische Bewegung gegründet, die Association des Étudiants Khmer. Sie versammelte Studenten, die sich von Anfang an, im Gegensatz zu den in der Heimat arbeitenden Kommunisten, als die »einzig wahren Linken« empfanden. Sie warfen den zu Hause legal lebenden Kommunisten ebenso wie den Illegalen Feigheit vor, weil diese angeblich nicht energisch genug kämpften, ja, sie sagten ihnen sogar Kollaboration mit dem Prinzen nach. Insgesamt, wenngleich mit geringfügigen Unterschieden, waren sie für den Boykott Sihanouks und eine bewaffnete Revolution, die die sozialen Verhältnisse radikal umgestaltete.
Dafür entwickelten sie in langen abendlichen Zusammenkünften, die nicht selten auch in Kneipen des Quartier Latin abgehalten wurden, eine Ideologie, die sie kommunistisch nannten, die das allerdings nicht war. Vielmehr war sie ein morbides Konglomerat utopischer Ideen, die keine Beziehung zu den tatsächlichen Problemen Kambodschas hatten und die sich schon gar nicht an den Erkenntnissen klassischer marxistischer Philosophie orientierten.
Für diese Revoluzzer, die die französische Geheimpolizei als Spinner abtat und ungestört ließ, waren Industrialisierung und moderne Zivilisation Krankheiten, die den Charakter eines Volkes verdürben. Ihrer Ansicht nach waren alle ihre Landsleute, die zivilisiert lebten, bereits unrettbar verloren. Kambodscha, so meinten sie, könnte sich nur auf der Basis eines Kommunismus erneuern, in dem die gegenwärtig unterprivilegierten Schichten der Bevölkerung auf dem Lande, in den Gebirgen und den entlegenen Waldgebieten zu Machthabern erhoben würden. Die Landwirtschaft sollte der Hauptaspekt aller Wirtschaft sein, dazu kämen lediglich einige traditionelle Handwerke. Das Volk sei in großen, militärisch organisierten Produktionseinheiten zusammenzufassen, die den Bedarf an Nahrungsmitteln deckten. Ihnen sollte auch die »Umerziehung« der von der Zivilisation geschädigten Städter obliegen, wobei für jene aus diesem »neuen Volk«, die sich unterwarfen oder anpaßten, Überlebenschancen bestünden. Der Rest sollte als »unwert« so schnell wie möglich beseitigt werden.
Im Grunde lief das auf eine Rückführung der Gesellschaft in mittelalterliche Dorfgemeinschaften hinaus. Alles, was zu den Errungenschaften der Zivilisation gehörte – und hier war man geradezu lächerlich primitiv in der Auswahl –, sollte vernichtet werden, samt seiner Nutznießer. Dazu zählte – vom Geld über das Post- und Fernmeldesystem, die Läden und Transportmittel, die Zeitungen, Rundfunksender, Schulen, Kindergärten, die medizinischen und wissenschaftlichen Einrichtungen, die Kunst, die Technik, die Auslandsbeziehungen und der internationale Handel – so gut wie alles, was nicht im armseligen Leben der Leute in den zurückgebliebensten Winkeln des Landes vorhanden war. Eine Vorstellung, bei deren Analyse erfahrene Politiker eher an die Wunschträume von Anarchisten erinnert wurden denn an vernünftige politische Absichten.
Außenstehende, die durch Zufall Einblick in dieses Programm der gesellschaftlichen Tollheit bekamen, hielten es für Fieberphantasien; doch bereits damals erkannten einige darin die Handschrift menschenverachtender Eiferer. Trotzdem gab ihnen kaum jemand eine Chance. Das sollte sich als Irrtum erweisen.
Zu den Verfertigern jenes »wahrhaft revolutionären« Konzepts gehörten in unterschiedlichen Zeitabschnitten während der frühen fünfziger Jahre solche Studenten wie Saloth Sar (später sollte er sich Pol Pot nennen), Ieng Sary, Khieu Sampan, Son Sen, Hou Yon und Hu Nim sowie die Schwestern Khieu Ponnary und Khieu Thirit, von denen die erstere Saloth Sar (Pol Pot) ehelichte und die letztere Ieng Sary, dessen engsten Vertrauten.
Keiner dieser rabiaten Gesellschaftsveränderer beendete übrigens in Paris sein Studium. 1953, als absehbar wurde, daß Frankreich Kambodscha formell die Unabhängigkeit gewähren würde, kehrten sie nach Phnom Penh zurück, wo sie teils als Französischlehrer an Privatschulen arbeiteten, teils im politischen Untergrund wirkten. Vor allem Saloth Sar (Pol Pot) engagierte sich nun bei den Kommunisten. Noch wurde die Partei allerdings von marxistischen Internationalisten geführt, und Saloth Sar mußte seine tatsächlichen Absichten verschweigen. Er wartete auf seine Chance, sich in die Parteiführung einzuschleichen und diese dann von innen her sprengen zu können.
Prinz Sihanouk, der inzwischen Staatschef geworden war, machte indessen eine geschickte Politik gegen die Kommunisten, in denen er seine gefährlichsten Widersacher sah. Es fiel ihm leicht, jene von ihnen, die ihre Waffen nicht strecken wollten, als Vaterlandsverräter zu diffamieren. Die anderen versuchte er in die Legalität zu locken, selbstverständlich nicht, um sie als gesellschaftliche Kraft zu tolerieren und an Entscheidungen teilhaben zu lassen, sondern um ihre Aktivitäten besser beobachten und kanalisieren zu können. So gestattete er ihnen auch, an den ersten allgemeinen Wahlen nach der Unabhängigkeit teilzunehmen, im September 1955. Seine Partei, die monarchistisch-bürgerliche Sangkum, errang insgesamt 84 Prozent der Stimmen, die kommunistische Gruppierung Pracheachon verzeichnete 4 Prozent. Drei Jahre später, bei den nächsten Wahlen, sank ihr Anteil auf 1,5 Prozent.
Sihanouks Politik galt allgemein als patriotisch und antiimperialistisch. Sie wurde nicht nur von der neuen Bourgeoisie akzeptiert, sondern auch von den vielen königsgläubigen einfachen Menschen, die – in eine lange monarchistische Tradition eingebunden – in Sihanouk den großen Helden sahen, der die Unabhängigkeit erkämpft hatte, Sohn der vergötterten Dynastie der Norodom. Er selbst ließ keine Gelegenheit aus, um seine Position geschickt auszubauen und sich als zwar strenger, aber gütiger Landesvater aufzuspielen. Emsig ließ er dabei die Kommunisten dezimieren, wo immer sie sich zeigten. Von Demokratie war dieses Land weit entfernt.
In jener Phase der widersprüchlichen gesellschaftlichen Entwicklung gelang es dem radikalsten der Pariser Utopisten, Saloth Sar, schließlich, den ersten entscheidenden Schritt auf dem Wege zur Macht innerhalb der KP Kambodschas zu tun. Im Herbst 1960 hielten die Kommunisten einen Kongreß ab, der die künftige Strategie bestimmen sollte. Auf diesem Kongreß konnte Pol Pot fast die gesamte Gruppe, die sich um ihn scharte, in das neue ZK manipulieren. Mehr noch, er konnte durchsetzen, daß im Parteiprogramm »die revolutionäre politische und militärische Gewalt« als Methode des künftigen Vorgehens der KP verankert wurde.
Noch konnten die vernünftigen, marxistischen Kräfte im ZK Touch Samouth als Generalsekretär durchsetzen, der zu einer besonnenen Politik in Abstimmung mit den Parteien der Nachbarländer Laos und Vietnam tendierte. Aber die Signale waren bereits auf ein Vorgehen gestellt, wie Saloth Sar und seine Radikalen es verfochten. Es erwies sich, daß die KP Kambodschas um diese Zeit schon um ihre besten und fähigsten Köpfe dezimiert war. Nicht wenige hatten sich auch vor den Verfolgungen Sihanouks in die Emigration nach Hanoi begeben. Und Sihanouks Polizei schlug wieder zu: 1962 wurde zusammen mit vielen anderen Kommunisten auch der Generalsekretär Touch Samouth verhaftet. Er blieb spurlos verschwunden.
Gerüchte um seinen Tod differierten: Die einen behaupteten, man habe ihn hinrichten lassen, andere wiederum wollten wissen, Saloth Sar habe ihn über Mittelsmänner in der Polizei beseitigt, um freie Hand in der Partei zu haben.
Diese These gewann an Gewicht, als Saloth Sar wenig später mit seinen engsten Mitverschwörern die Schlüsselpositionen im Parteiapparat endgültig besetzte und sich unter dem Tarnnamen Pol Pot zum Generalsekretär machte. Kein Mitglied der Parteibasis wurde darüber informiert, geschweige denn um seine Zustimmung gefragt – es gab nur wenige Mitglieder, die den neuen Generalsekretär überhaupt kannten.
Ein interessanter Aspekt von Sihanouks Innenpolitik war, daß er 1962 zwei Mitglieder der offiziell verbotenen Pol-Pot-Gruppierung, nämlich Khieu Sampan und Hou Yon, in die Wahlliste seiner Sangkum-Partei aufnahm, wohl um die linke Opposition zu verwirren und aufzuspalten. Die beiden wurden prompt als Abgeordnete gewählt, und Sihanouk ernannte Khieu Sampan zum Handelsminister, später sogar zeitweilig zum Premier, Hou Yon erhielt den Posten des Planungsministers.
Bei den nächsten Wahlen, 1966, tauchte in den Listen zum ersten Mal der Name Lon Nol auf, eines konservativreaktionären politisierenden Generals, Verteidigungsminister und stark zu einer Zusammenarbeit mit den USA tendierend. Er gewann die Mehrheit.
In der Folgezeit, für etwa ein Jahr, gab es unter Lon Nol eine Art Militärregierung. Die Armee hatte freie Hand, Land zu beschlagnahmen, Häuser zu besetzen und Steuern zu erheben. Durch diese Verschärfung der Ausbeutung kam es bald zu blutigen Auseinandersetzungen; Hunderte rebellierender Bauern wurden vom Militär zusammengeschossen.
Sihanouk beschuldigte nun nicht etwa Lon Nol, sondern Hou Yon und Khieu Sampan, Aufstände angezettelt zu haben, und kündigte ihre Hinrichtung an. Lon Nol, von den USA klug beraten, schützte Gesundheitsprobleme vor und trat als Regierungschef zurück. Gleichzeitig tauchten Hou Yon und Khieu Sampan unter. Sie schlugen sich zu ihrem alten Kumpan Saloth Sar alias Pol Pot durch, in die Hauptzentren des Widerstandes, die beiden Ostprovinzen Ratanakiri und Mondulkiri. Eine nicht geringe Anzahl ehrlicher, wenngleich theoretisch nicht sehr gebildeter Oppositioneller fand sich ebenfalls nach und nach bei Pol Pots Guerillas ein, die von Sihanouk bald in der von ihm so geliebten französischen Sprache Khmer-Rouges (Rote Khmer) genannt wurden. Immerhin aber machten unzivilisierte, völlig ungebildete und für menschliche Regungen nur selten zugängliche Leute aus den unterentwickelten Gebieten des Landes den Kern von Pol Pots Guerillaarmee aus. Sie besetzten die Führungsposten, und das erste, was sie taten, war, junge Männer und Frauen, die unter ihr Kommando kamen, systematisch auf brutalen Haß gegen alle Städter, überhaupt gegen alle, die außerhalb der Schlupfwinkel legal lebten, zu dressieren.
Indessen hatte Staatschef Sihanouk einen wachsenden Berg von Problemen zu bewältigen. Im Frühjahr 1969 unternahm er nochmals einen Versuch, wenigstens sein Militär für sich und seine Politik einzunehmen, indem er General Lon Nol, inzwischen die bedeutendste Gestalt der legalen Opposition, als »Premierminister der königlichen Regierung« einsetzte.
Ein Jahr später, zu Beginn des Jahres 1970, fand Sihanouk plötzlich, es wäre für ihn gut, sich für längere Zeit nach Frankreich zu begeben, offiziell, um dort einige kleine Leiden auszukurieren.
Beobachter der Szene, die Sihanouks Hof lange Jahre nahestanden, sind sich bis heute nicht ganz einig, was den Staatschef wirklich nach Frankreich trieb: Waren es die kleinen Gebrechen, die er in südfranzösischen Badeorten behandeln lassen wollte? Oder war es vielmehr der listige Versuch, sich aus einer zugespitzten Lage zu lösen, um seinem Stellvertreter Lon Nol die schwierigen Entscheidungen zu überlassen, die er dann später, wie immer sie auch ausfielen, kritisieren könnte?
Lon Nol handelte sofort. Am 18. März 1970 erklärte er Sihanouk für abgesetzt. Er ließ sich zum Staatschef ausrufen, und damit begann der letzte Akt der Entwicklung, die direkt zu der nationalen Tragödie Kambodschas führte …
PHNOM PENH – Juli 1979
Die drei jungen Männer ähnelten einander. Nicht nur, daß sie annähernd gleich alt erschienen, sie sahen auch gleich zerlumpt aus in ihrer geflickten schwarzen Kleidung, ihre Gesichter waren gleich schmal, ausgemergelt, und selbst ihre Haare waren auf die gleiche Weise lieblos gestutzt, glichen Zotteln. Die Augen der drei verrieten eine seltsame Mischung von Abgeklärtheit und Neugier, Tatendrang vielleicht, und Hoffnung.
Der vierte in der Runde, die auf der ramponierten Balustrade eines ehemals prächtigen Pavillons am Ufer des Tonlé Sap saß, in der Nähe des nicht so recht in die Umgebung passenden Wassertanks, war anders. Er war kein Khmer, sondern ein Inder. Älter als seine drei Gesprächspartner, bedächtig fast sah er aus, wenn er sie anblickte, wenn er Fragen stellte, wenn er die Antworten nicht nur in ihren Worten suchte, sondern auch in ihren Blicken. Er war im Gegensatz zu ihnen exakt gekleidet, sein ergrauendes Haar war ordentlich gekämmt, und er trug eine elegante Goldrandbrille. Auch hatte er Schreibzeug bei sich und machte sich immer wieder Notizen. Aus seinem Gesicht war nicht abzulesen, was er dachte. Es wirkte verschlossen, als wolle der Mann eine Art schützenden Wall aufrichten zwischen sich und dem, was er auf seine Fragen erfuhr.
Er kannte die drei jungen Männer seit einigen Tagen. In einem notdürftig instand gesetzten Haus hatte er ein Büro ausfindig gemacht, das sich um die ausländischen Journalisten kümmerte, die den Prozeß der neuen Regierung gegen Pol Pot und seine Helfershelfer verfolgten, der soeben begonnen hatte. Es war dem indischen Reporter erlaubt worden, sich in der Zeit, die er nicht beim Prozeß verbrachte, mit Bürgern zu unterhalten, die das, was da verhandelt wurde, am eigenen Leib gespürt hatten – drei Jahre, acht Monate und zwanzig Tage lang, so oder so.
Im Flußhafen, wo die Hilfsgüter aus Vietnam ankamen, war er auf Kim Sar gestoßen, der Säcke mit Reis aus einem Lastkahn an Land trug. Ung Phim war später hinzugekommen, als Gesprächspartner, auch Yong Sok, der durch besondere Umstände in seinem Leben sogar die Zeitung kannte, die den Inder aus Delhi hierher, nach Phnom Penh, entsandt hatte.
Sie rauchten alle in Hanoi hergestellte »Thang-Long«-Zigaretten, und als der Inder das Aroma lobte, klärte Kim Sar ihn lakonisch auf: »Wir haben sie eingetauscht. Bei einem vietnamesischen Kapitän. Gegen ein chinesisches Fernglas. Das lag auf einem Haufen anderen Gerümpels, von irgendeinem Pol-Pot-Offizier weggeworfen …«
»Gibt es für Sie Anlaß zu Freude?« fragte der Inder. Die drei schwiegen. Dachten nach. Schließlich bemerkte Yong Sok, der bei genauer Betrachtung der Feingliedrigste, Schmalste von ihnen war: »Eine schwierige Frage, Mister. Natürlich freuen wir uns, weil wir überlebt haben. Jeder auf seine Weise. Daß wir nicht zu den drei Millionen Toten gehören, die das Regime Pol Pots hinterlassen hat. Aber – was für eine Art von Freude ist das? Sehen Sie sich unser Land an! Man hat es einmal die Perle Südostasiens genannt. Und heute? Zählen Sie die Ruinen, betrachten Sie die verwüsteten Städte, die Asche der Dörfer, verweilen Sie mit Ihrem Blick auf den herrlichen Zuckerpalmen, die rings um die ehemalige Markthalle von Phnom Penh wachsen – unter jeder von ihnen liegt ein Mensch begraben. Erschlagen und mit einem Palmensamen auf der Brust eingescharrt. Sehen Sie sich unsere Schulen an, die Krankenhäuser, die Pagoden, alles. Wenn Sie das getan haben, werden Sie spüren, daß Freude etwas anderes ist, als was wir heute empfinden. In uns ist das Salz der Bitterkeit. Die Asche der Toten trübt unseren Blick. Die Schreie der Sterbenden hören wir in den Nächten, im Schlaf. Was ist heute in unseren Herzen? Vielleicht erst eine Vorstufe von Freude. Erleichterung …« Der Inder erinnerte sich: »Einer der Ankläger hat gesagt, selbst die steinernen Apsaras, die Gespielinnen der ehrwürdigen Götter, verfluchen die Mörder …«
Ung Phim, der bisher geschwiegen hatte, nur gelegentlich mit den Fingern der rechten Hand über die Stelle an der linken strich, an der ihm zwei Finger fehlten, sprach vor sich hin: »Apsaras fluchen nicht, Mister. Sie klagen. Ich kann es hören, nachts. So wie Kim Sar und Yong Sok die Schreie der Erschlagenen hören.«
Der Inder gestand ihm: »Ich habe die Anklagen gelesen und einige der Zeugen gehört. Man hat mir in einem Gefängnis einen dreizehnjährigen Jungen gezeigt, der einhundertfünfundachtzig Menschen mit einer Rodehacke totgeschlagen hat, wie er selbst erzählte. In der ehemaligen Oberschule hier, die als Gefängnis diente, unter Pol Pot …«
»Tuol Sleng«, ergänzte Yong Sok. »Ich bin dort zur Schule gegangen. Zwölftausend sind es insgesamt gewesen, die man da ermordet hat. Und von jedem wurde vorher ein Foto gemacht.«
»Der Dreizehnjährige antwortete mir auf die Frage, warum er tötete, die Angkar habe es befohlen, das sei die höchste Autorität gewesen, die Organisation. Wer sich hinter dieser Bezeichnung verbarg, wußte er nicht genau, nur daß er bedingungslos ihre Befehle zu befolgen hatte. Die Getöteten seien alle Parasiten gewesen, nicht wertvoller als Kakerlaken. Im übrigen habe er es so gemacht, daß die Leute gleich beim ersten Schlag tot gewesen seien …«
Kim Sar drehte den Kopf zur Seite und tippte auf eine Stelle im Genick. »Hierhin schlugen sie. Man hatte sie belehrt, das sei die beste Stelle.«
»Warum?« Der Inder hob hilflos die Hände. »Was war diese ominöse Angkar? Konnte sie Menschen verzaubern? Aus Anständigen Bestien machen? Und – warum das viele Morden? Wie kam es dazu? Und wieder – warum?«
»Eine weitere schwierige Frage«, bemerkte Yong Sok.
»Können Sie sie nicht beantworten? Oder wollen Sie das nicht?«
»Wir können Ihnen erzählen, wie es begann«, sagte Kim Sar, »und wie es weiterging. Aber es würde Tage dauern, Ihnen alles begreiflich zu machen, Mister.«
»Ich habe viele Tage Zeit!«
»Nun gut«, meinte nach einer Weile Ung Phim. »Wir arbeiten alle drei an den Kais. Hier werden Leute gebraucht, die anpacken können. Aber wir haben stets drei Stunden Mittagsruhe, wenn die Hitze am schlimmsten ist, weil die Sonne am höchsten steht. Seien Sie um diese Zeit hier, unter dem Wassertank. Was wir wissen, werden wir Ihnen erzählen …«
Als der Inder sich am nächsten Mittag dort einfand, hockten die drei bereits im Schatten. Zigaretten glühten. Ung Phim wies auf Kim Sar. »Es wird am besten sein, wenn er beginnt. Seine Erfahrungen reichen am weitesten zurück. Durch besondere Umstände geriet er in den Führungskreis der Angkar. Und er hat da so manches über die Vorgeschichte der Tragödie erfahren …«
Am Kai war Motorengeräusch laut geworden. Eine Barkasse legte ab. Draußen im Strom, der eigentlich der Mekong war, zumindest ein Nebenarm von ihm, der hier den Namen Tonlé Sap trug und sich gute hundert Kilometer nordwestlich in den Großen See ergoß – von jeher ein reiches Fanggebiet für die Fischer –, ertönte der kreischende Schrei einer Bootssirene. Ein leichter Luftzug bewegte an den Resten einer Pagode unweit des Ufers das letzte, nicht zerstörte Glöckchen. Ein heller, einsamer Ton.
Der Inder blickte Kim Sar fragend an. Dieser nickte. Dann begann er zu berichten. Manchmal stockte er, als ob er nachdenken müsse. Dann wieder wurde seine Stimme leiser, als habe er jetzt noch Furcht vor dem, was er beschrieb.
Tage vergingen. Immer wieder saß der Berichterstatter um die Mittagszeit mit den jungen Männern unter dem Wassertank. Schrieb. Brachte schließlich, als auch die anderen erzählten, ein kleines Tonbandgerät mit und nahm auf, was gesprochen wurde. Die drei wechselten einander ab. Es schien ihnen ein Bedürfnis zu werden, dem Fremden alles mitzuteilen, woran sie sich erinnerten. Sie wollten, daß er sie verstand, das Ausmaß der Tragödie begriff, die sie durchlebt hatten und von der die Leute in der übrigen Welt Kunde erhalten sollten, über die spröden Berichte der Zeitungen hinaus. Nachempfinden – würde das möglich sein? Begreifen? Sie wußten es nicht. Und auch der Inder wußte nicht, wie er es anderen würde begreiflich machen können …
KIM SAR, 32 Jahre
Ich bin in Phnom Penh, in der Vithei Samdech Hinn, aufgewachsen, nicht weit von dem Platz, an dem unser Unabhängigkeitsdenkmal steht. Wir nannten es als Kinder die Pagode auf zwei Füßen, weil es so aussieht. Man kann hindurchgehen zwischen den Füßen, erst treppauf, dann treppab. Alles edler Stein. An Feiertagen stets besonders sauber geschrubbt. Sonst allerdings konnte es schon einmal vorkommen, daß ein Rikschafahrer sich dort vor dem Regen unterstellte, in der nassen Jahreszeit, wenn die Schauer plötzlich niederprasselten. Man erzählte sich sogar, Rikschafahrer hätten nicht selten unter dem Denkmal die Nacht hindurch geschlafen.
Wenn Sie unsere Stadt genau durchforschen, entdecken Sie, daß es sechs große, sehr lange Straßen gibt, sie verlaufen nahezu parallel, von Nordwesten nach Südosten. Vom Osten angefangen sind das die Monivong, dann die Trasak, die Pasteur, die Norodom, die Yukanthor und, am Flußufer, die Vithei Sisowath Terak.
Das Unabhängigkeitsdenkmal liegt am Ende der Norodom; eine Krone besonderer Art für die Dynastie. Wenn Sie vom Nordwesten kommen, biegen Sie an der letzten Kreuzung rechts ab, das ist die Vithei Samdech Hinn. Dort betrieben meine Eltern einen Gewürzgroßhandel. Gute Lage. Einen Kilometer von den letzten Kais entfernt, an denen die Lastkähne anlegten, die flußauf kamen, von Saigon.
Eigentlich war der Handel in Phnom Penh ja die Domäne der Chinesen. So wie Handwerke meist von Vietnamesen betrieben wurden. Man war das so gewöhnt, die Khmer waren das Staatsvolk, sie hatten in der Hauptstadt meist die Verwaltungsposten inne.
Aber mein Vater lachte immer, wenn er solche Einteilungen hörte. Er meinte, wie ein Mann sein Geld verdiene, hänge eher von seinem Unternehmungsgeist ab als von seiner Nationalität. Wobei die Nationalität ohnehin keine sehr große Rolle bei uns spielte, jedenfalls um die Zeit, als ich aufwuchs. Wie auch die Religion. Die Götter, so pflegten die Alten zu sagen, haben uns Toleranz gelehrt. Und die alten Könige von Angkor respektierten alle Götter, hinduistische wie buddhistische. Laßt doch die einen zu Buddha beten, die anderen zu Wischnu. Wieder andere verehren den Mann aus Arabien, den mit der Krone aus Dornenranken, der am Kreuz endete. In den Pagoden stehen die Figuren der verschiedensten Gottheiten ohnehin nebeneinander, das ist Tradition bei uns.
Die Cham, die meist in der Provinz Kompong Cham lebten, ein Urvolk, das eine primitive Auslegung des Islam betrieb, unterschieden sich in ihren Riten am meisten von uns anderen. Eigenartigerweise aßen sie kein Schweinefleisch, aber auch sie waren gleichberechtigte Bürger, wenigstens auf dem Papier der Gesetze.
Doch in unserem Lande gab es in der Tat keine Religionsfehden, nicht einmal die Christen, die so gern zu Märtyrern werden wegen ihres Glaubens, konnten darüber klagen, wenige, die sie ohnehin waren. Erst Pol Pots Regime begann Unterschiede zu machen. Neben den Hauptunterschieden, auf die ich noch zu sprechen komme, auch religiöse. In jedem Falle waren sie tödlich. –
Ich wuchs sozusagen mit der Unabhängigkeit auf. Als ich das erste Jahr zur Schule ging, damals ein Privileg der Hauptstädter, weil es in den meisten anderen Orten des Landes noch kaum Schulen gab, bekamen wir eines Tages kleine Fähnchen mit den Türmen von Angkor Wat in die Hand gedrückt und wurden am Straßenrand aufgestellt. Wir hatten Prinz Sihanouk zuzujubeln, der, wie man uns sagte, die Unabhängigkeit im Kampf gegen die französischen Kolonialherren errungen hatte. Monseigneur Papa, wie unsere Lehrer ihn nannten, der gütige Prinz aus der Dynastie der Norodom, der unser Schicksal wenden konnte.
Ich habe keine Erinnerungen an die Kolonialzeit, kann daher auch nicht sagen, daß ich mich sonderlich befreit fühlte. Zumal mein Vater, der eine Buchhalterseele hatte und alles dreimal von allen Seiten besah, bevor er es zur Kenntnis nahm – auch die Rechnungen für seine Gewürze übrigens –, nicht selten im Familienkreis lose Reden führte. So meinte er, der Prinz schmücke sich mit unechten Federn, wenn er sich das Verdienst der Unabhängigkeit so einfach allein zuschriebe. Es habe im Lande seit dem zweiten Weltkrieg, der für mich nur noch eine Legende war, Leute gegeben, die gegen die Franzosen und die Japaner gekämpft hatten. Eigentlich sei dieser Kampf von den Vietnamesen ausgegangen, habe auf uns, das Nachbarland, übergegriffen, ebenso auf Laos, den nördlichen Nachbarn. Im Frühjahr 1954 hätten die Vietnamesen die Franzosen bei Dien Bien Phu so katastrophal geschlagen, daß diese gezwungen waren, nicht nur Vietnam, sondern auch das übrige Indochina aufzugeben.
Sihanouk, der an einer französischen Universität in Saigon studiert hatte, wie das bei den Leuten unserer Oberschicht üblich war, hätten die Franzosen als Statthalter ausgewählt, damit nicht die tatsächlichen Kämpfer, die meist Kommunisten waren, an die Macht gelangten. Die Franzosen, so meinte mein Vater, hätten Sihanouk das Land sozusagen auf dem Silbertablett übergeben, weil er zugesagt habe, daß Frankreichs wirtschaftliche und politische Interessen wenigstens zu einem gewissen Teil weiter respektiert würden.
So gab es bei uns auch weiterhin französische Unternehmen, Kautschukplantagen beispielsweise, aber auch Schulen und Krankenhäuser. Das Militär zog ab, aber die Franzosen waren damit nicht ausgeschaltet, wie etwa im Norden von Vietnam und später im Süden, wo die Amerikaner an ihre Stelle traten – sie waren bei uns lediglich in gewisse Grenzen verwiesen. Aber das kennen Sie ja aus den Geschichtsbüchern …
Als ich zehn Jahre alt war, schickte mich mein Vater in das französische Gymnasium. Bildung, so meinte er, sei wichtig, auch das Erlernen von Sprachen. Das Gymnasium trug den Namen Lycée Kamputh Both. Französisch lehrte dort ein erst kürzlich vom Studium aus Paris heimgekehrter Herr namens Saloth Sar. Er hatte mit einem Stipendium des französischen Staates in Frankreich studieren können wie einige andere Auserwählte auch. Die Franzosen hatten diese Studien finanziert, wohl um sich im eigenen Land eine Art geistiger Elite heranzubilden, die dann später in der ehemaligen Kolonie verantwortungsvolle Posten bekleiden sollte, nicht zuletzt im Interesse jenes Landes, das ihnen so großzügig zu höherer Bildung verholfen hatte.
Herr Saloth Sar war ein untersetzter, etwas bullig wirkender Khmer, der oft lachte und dabei auf eine unnachahmliche Weise sein Pferdegebiß entblößte. Er war nicht ungerecht, und das Lernen bei ihm machte sogar Spaß. Im Gegensatz zu den Erfahrungen, die eine andere Klasse mit ihrem Lehrer hatte, einem gewissen Ieng Sary, der schnell aus der Haut fuhr und dann laut schimpfte. Auch er war übrigens aus Paris zurückgekommen und mit Herrn Saloth Sar ziemlich eng befreundet. Am Gymnasium hatte ich nur einmal mit ihm zu tun, als er mir einen Brief übergab, den ich ins Lycée Norodom bringen sollte, zu einer Madame Khieu Thirit, Englischlehrerin und, wie ich erfuhr, die Frau von Herrn Ieng Sary. –
Unser Französischlehrer, Herr Saloth Sar, war aber bei weitem nicht nur an der Vermittlung von Sprachkenntnissen interessiert. Er war in vielen Fächern bewandert, so auch in der Geschichte und vor allem in der Politik. An unserer Schule gründete er damals den »Zirkel zur Analyse der Geschichte des Khmer-Volkes«. Eine von den Schulbehörden recht gern gesehene Ergänzung unseres Unterrichts, obwohl die Teilnahme freiwillig war. Ich erinnere mich an farbige Landkarten mit den Grenzen des alten Reiches Fu Nan, an Darstellungen der legendären Khmer-Metropole Angkor, in der vom 9. bis zum 15. Jahrhundert unsere Gottkönige herrschten. Wir Schüler bekamen einen Eindruck von der Größe und Bedeutung unserer Vergangenheit.
Wenn wir Herrn Saloth Sar lauschten, wie er von der Pracht und Herrlichkeit des Hofes erzählte, von der Gewalt, die sich dort verkörperte und die angewendet wurde, um das Land immer bedeutsamer zu machen, hatten wir durchaus ein wenig das Gefühl, einem auserwählten Volk anzugehören. Schließlich hatten die Gottkönige von Angkor es nicht nur verstanden, die Energien des einfachen Volkes völlig für die Größe der Dynastie zu mobilisieren, die sich in den gewaltigen Bauwerken von Angkor verkörperte – sie ließen die von Natur aus trägen Bauern, die sich mit dem bißchen Reis, das sie selbst aßen, mit ein paar Fischen und ein wenig Gemüse begnügten, zu riesigen Arbeitskolonnen zusammenfassen, die zwischen Saat und Ernte sogenannte gemeinnützige Vorhaben ausführten. Im ganzen Land legten sie engmaschige Wasserverteilungssysteme an, die der notwendigen Bewässerung der Reisfelder während der Trockenperiode ebenso dienten wie dem Schutz vor Überflutungen während der sintflutartigen Regenfälle.
Mit sichtlichem Stolz präsentierte uns Herr Saloth Sar immer wieder Landkarten, auf denen die einstmals für ganz Südasien beispielhaften Systeme der Stauanlagen und Kanäle im Kambodscha der Angkor-Periode verzeichnet waren. Er bewahrte diese Karten übrigens nicht in der Schule auf, sondern bei sich zu Hause.
Hier muß ich erwähnen, daß ich sozusagen zu seinen Lieblingsschülern gehörte, deshalb wurde ich von ihm oft mit kleinen Nebenarbeiten betraut, wie etwa die Karten von seinem Haus zur Schule und zurück zu tragen. Er hatte mich wohl auserwählt, weil ich eine gute Auffassungsgabe besitze. Französisch bereitete mir keine Schwierigkeiten, ebensowenig die englische Sprache, die ich als Wahlfach nahm.
Allerdings machte der außerschulische Zirkel mir bald mehr Spaß als die Schulfächer. Was Herr Saloth Sar uns über die glorreiche Vergangenheit des Khmer-Reiches erzählte, beflügelte meine Phantasie und gab mir ein wenig das Gefühl, als Khmer etwas Besonderes zu sein. Es schärfte aber auch meinen Blick für die Wirklichkeit, die mich umgab.
Kambodscha erlebte damals eine gewisse Blütezeit. Zwar wurden noch immer beachtliche Teile der Wirtschaft direkt oder indirekt von Franzosen kontrolliert; große Ländereien gehörten französischen Gesellschaften oder Privatpersonen, wie etwa die gesamten Kautschukplantagen des Landes, deren Ertrag nur zu einem geringen Teil Kambodscha zufloß, aber die Verhältnisse stabilisierten sich. Es wurde nicht mehr gehungert. Fisch und Reis waren in den dichter besiedelten Gebieten reichlich vorhanden, der Außenhandel entwickelte sich, die Städte bekamen nach und nach die Errungenschaften der modernen Zivilisation zu spüren – Busse fuhren, Kinos wurden gebaut. Man feierte die alten Feste: das Visak Bauchéa in der ersten Maiwoche, den Geburtstag Buddhas, dann Anfang Mai das Chrot Preah, das sogenannte heilige Pflügen der ersten Furche, oder das Prachum Ben im September, ein Tag, an dem den toten Ahnen Opfergaben dargebracht wurden.
Am schönsten war stets in der Hauptstadt das Fest des umkehrenden Wassers, gegen Ende Oktober, wenn der verringerte Zufluß des Mekong in den Nebenarm Tonlé Sap dazu führt, daß dieser nicht mehr, wie von Juli an, nordwärts in den Großen See fließt, sondern südwärts, zum Meer. Ein Dankfest, das dem Wasser gilt, dessen Fruchtbarkeit den Reis hat reifen lassen.
Tausende Boote schwammen da auf dem Fluß, ruderten um die Wette. Alles war mit Kerzen und Lampions geschmückt. Eine große Barke mit einem Altar setzte sich mit der Flut in Bewegung – es gab wohl keinen Hauptstädter, der nicht an diesem Tag festlich gekleidet am Ufer stand. Nicht einmal der Unabhängigkeitstag am 9. November mit seinen Paraden und Festreden konnte das Wasserfest übertreffen!
Wer Kambodscha um diese Zeit sah, mußte den Eindruck eines prosperierenden Landes haben. Dennoch war das nur die Oberfläche, die schöne Seite. Schon ein paar Dutzend Kilometer von den größeren Städten entfernt sah es wesentlich anders aus.
Den Blick für diese dunklere Seite der Realität schärfte uns Heranwachsenden an der Schule ganz wesentlich Herr Saloth Sar. Von ihm lernten wir, daß sich das System des Prinzen auf klug dosierter Ausbeutung und Unterdrückung aufbaute. So gab es etwa in den ausgedehnten landwirtschaftlich genutzten Gebieten eine schleichende Verschlechterung der Lebenslage unter den Bauern.
Da alles Land der Krone gehörte, dem Staat also, brauchten die Bauern zwar keine direkten Steuern zu entrichten, doch dafür gehörte ihnen das Land nicht, und es häuften sich eine Menge indirekter Abgaben. Die meisten selbständigen Bauern hatten Schwierigkeiten, die steigenden Preise für Saatgut, für Wasser und für den Transport ihrer Erzeugnisse zu zahlen. Sie mußten die Ernten verpfänden, sich bei Geldverleihern verschulden, immer höher, um selbständig bleiben zu können. Gaben sie auf, wurden sie zu Lohnsklaven reicher Landaufkäufer, ihr Lebensstandard sank weiter ab. An die Ausbildung ihrer Kinder war kaum noch zu denken.
Die Sihanouk-Dynastie selbst betätigte sich immer mehr als Wirtschaftsunternehmen und wurde zunehmend reicher. Dazu gründete sie – oft über Mittelsmänner – Industriebetriebe, deren Ertrag ihr allein zufloß. Sie ließ in den landschaftlich schönsten Gegenden, wie etwa bei Angkor, Hotels bauen. So entstand die Socièté Khmere des Auberges Royales, deren Kassen sich mit dem Geld der Touristen füllten; die Gesellschaft besaß so gut wie alle für Ausländer geeigneten Hotels im Lande. Hinter vorgehaltener Hand flüsterte man, selbst die unzähligen Bordelle der Hauptstadt würden von Strohmännern des Königshauses betrieben.
Unser Prinz widmete sich indessen den schönen Künsten. Er komponierte Musik und produzierte Spielfilme – es existierten nur wenige Gebiete des öffentlichen Lebens, an denen nicht die Norodom-Sippe, die Franzosen oder die einheimische Schicht der Zwischenhändler und Exporteure Millionen verdienten. Damit verglichen gab es Gegenden im Lande, die sich buchstäblich noch im Urzustand befanden, ohne die Hoffnung, daß sich das in absehbarer Zeit ändern könnte. Am schlimmsten stand es um die nordöstlichen und östlichen Provinzen, Mondulkiri etwa oder Ratanakiri. Aber auch Battambang war davon betroffen, Siem Reap, Koh Kong oder Svey Rieng, Kompong Speu, Takeo, Kampot.
Ein Studienfreund unseres Herrn Saloth Sar, ein gewisser Khieu Sampan, der an einer Hochschule Ökonomie lehrte, schob sich damals in unser Blickfeld. Herr Saloth Sar eröffnete uns, daß er und einige Mitstudenten sich bereits in ihrer Pariser Schulzeit grundlegende Gedanken über die Misere Kambodschas gemacht und auch eine Theorie für deren Überwindung entwickelt hätten.
Als Herr Khieu Sampan den ersten Vortrag in unserem Zirkel hielt, war das für die meisten von uns eine Art Erleuchtung. Wir begriffen, seine Überlegungen sahen nicht kleine Reparaturen an unserem unzulänglichen Staatssystem vor, sondern dessen gründliche und tiefgreifende Veränderung. Khieu Sampan verkündete, Sihanouk putze Phnom Penh und ein paar andere Vorzeigeplätze im Lande so auf, daß jeder Fremde, der dahin geführt würde, vor Ehrfurcht erstarre und darauf schwöre, der Prinz wäre ein Meister der Staatskunst. Auf diese Weise erschleiche sich die Regierung außenpolitische Meriten, während der größere Teil unseres Volkes dazu verdammt sei, auf unwürdige Weise zu leben. Das müsse man ändern. Er, Khieu Sampan, setzte nicht auf Reformen, sondern auf eine – wie er es nannte – »revolutionäre Umwälzung der Gesellschaft«: Weg mit der korrupten Monarchie, in der ein Geier dem anderen das Futter stehle, weg mit der Schicht der nutznießenden Beamten und Verwalter, der Mittler und Zwischenhändler, die vom Schweiß anderer lebten, weg mit dem Geld, das nur die Reichen besäßen, weg mit allem überhaupt, was das Leben der Oberschicht angenehm mache und das der Armen bedrücke!
Herrn Khieu Sampan schwebte als Lösung eine Art locker organisierte, aber auf strikter Disziplin beruhende Gemeinschaft vor, mit einer nahezu militärischen Kommandostruktur. Hauptanliegen sollte die Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte sein, bei absoluter Gleichheit aller an der Produktion Beteiligten, was den Verdienst betraf, der ohnehin nur in Naturalien bestehen sollte. Verwaltungseinrichtungen höherer Ebene sollte es nicht mehr geben. Eine Art Urgesellschaft, einfach und anspruchslos. Industrie war nur in geringem Umfang vorgesehen, und zwar soweit sie die Landwirtschaft unterstützte. Vorbild war in jeder Beziehung das ehemalige Angkor-Reich. Eine Umkehr also. Zurück zu den Ahnen und ihrer unbestreitbaren Größe. Aber auch zu ihrer Frugalität.
Wir waren, das darf man getrost sagen, fasziniert von diesen ungewöhnlichen Ideen. Herr Khieu Sampan, der uns ausführlich das Elend der Menschen in den entlegenen Provinzen, in den Wald- und Berggebieten beschrieb, sagte damals – ich habe es mir gemerkt: »Die; systematische Nutzung bisher ungenutzter Energien, die in den bäuerlichen Massen schlummern, wird die Landwirtschaftserträge verhundertfachen und dazu beitragen, Neuland zu erschließen, das mit Hilfe gigantischer Gemeinschaftsaktionen bewässert und vor Überschwemmungen geschützt wird – das bedeutet Sattsein und Reichtum für alle, nicht mehr nur für die parasitäre Schicht der Städter, Intelligenzler, Militärs und Händler.«
Es traf den Kern der Sache, meinten wir alle, die wir zuhörten. Wir sahen täglich mit an, wie sich in der Hauptstadt eine neue soziale Schicht bildete, protzend, überheblich, ohne Skrupel. Kaufleute, Zwischenhändler, Spekulanten, hohe Beamte und Militärs, ihre Weiber, Kinder, Mätressen und Huren – das waren die Leute, deren Lebensstil uns provozierte. Sie verbargen ihren neuerworbenen Reichtum nicht etwa, im Gegenteil, sie stellten ihn zur Schau, wo immer es möglich war. Kleideten sich wie die Amerikaner oder Franzosen, aßen nur noch in teuren Restaurants, gaben abends ihre geräuschvollen Partys in Luxusvillen. Wenn sie sich überhaupt in den Straßen der Hauptstadt bewegten, dann geschah das in Buicks oder Cadillacs mit langen Heckflossen, die an Haifische erinnerten.
Haie, das waren sie auch. Sättigten sich ohne Rücksicht auf andere. Ich will damit nicht etwa das rechtfertigen, was später geschah, ich will es nur in den rechten Zusammenhang rücken. Sprechen wir es offen aus: Der Feudalismus auf dem Lande war nicht abgeschafft worden.
Ein Bauer bei uns bewirtschaftete in der Regel etwa fünf Hektar Land. Er besaß vielleicht einen Büffel und einen Pflug. Der Staat, der Land an Bauern verpachtete, verlangte den Bodenzins in Naturalien. Dadurch erwirtschafteten die meisten Bauern fast kein Geld mehr, und es kam auf dem Markt ein Überangebot an Naturalien zustande, das in den Städten Üppigkeit vortäuschte, in Wirklichkeit aber die Preise ruinierte und die Bauern zwang, selbst noch für den Eigenbedarf benötigte Produkte zu verkaufen, um ein wenig Geld für die notwendigsten Ausgaben zu erlangen. Hunger und wachsende Verarmung waren die Folge. Die reichen Städter merkten das vermutlich gar nicht. Sie lebten in Villen, ausgestattet mit dem Luxus französischer oder amerikanischer Zivilisation – wie sollten sie da wissen, was Hunger auf dem Lande war! Sie mästeten sich förmlich. Wenn es etwas gibt, das von dem Regime, das hinter uns liegt, an Wahrheiten verkündet wurde, dann ist es die über das unglaubliche soziale Gefälle bei uns gewesen. Es machte den Leuten, die uns nachher in die Katastrophe stürzten, die Sache leicht.
Auf dem Weltmarkt wurde damals kambodschanischer Reis zu Schleuderpreisen angeboten. Ein gefährliches Phänomen. Der Ertrag der Arbeit kambodschanischer Bauern wanderte nicht mehr in einem großen Kreislauf ins Land zurück – er versickerte in den Kanälen der internationalen Valutaspekulation. Zudem muß man wissen, daß die paar Hektar Land, die ich als Durchschnittsbesitz erwähnte, mit der Zeit schrumpften. Unsere Bauern haben viele Kinder. Unter ihnen mußte das vorhandene Land von Generation zu Generation neu aufgeteilt werden. Das Land nahm nicht zu, aber die Anzahl der Kinder wuchs.
Der Prinz wollte die Misere der Bauern nicht sehen. Herr Khieu Sampan sah sie. Herr Saloth Sar auch. Und wir Jungen erkannten sie. War das verwunderlich? Die theoretischen Überlegungen des Herrn Khieu Sampan enthielten ja durchaus einen Kern, der auf Tatsachen beruhte. Damals hielt auch ich die von ihm vorgeschlagenen Maßnahmen für brauchbar. Heute habe ich Erkenntnisse gewonnen, die ich damals nicht besaß. Und ich habe miterlebt, daß das Land nicht nach den seinerzeit als revolutionär gepriesenen Methoden umgestaltet wurde, sondern etwas ganz anderes geschah. Noch während die große Tragödie lief, habe ich mich von dem getrennt, was ich einst für richtig gehalten hatte.
Aber kehren wir zu den damaligen Realitäten zurück, damit Sie verstehen, weshalb Leute wie ich Khieu Sampan und Saloth Sar zuhörten, ihnen sogar vertrauten.
Die Industrie in Kambodscha erbrachte zu Zeiten Sihanouks lediglich etwa 10 Prozent des Nationaleinkommens. Die erwirtschaftete sie allerdings mit Exporterzeugnissen – für den Bauern produzierte sie so gut wie nichts, wenn man von Seven-Up-Limonade und Bastos-Zigaretten absieht. So machte die Schicht der Exporteure und Industriemanager ihr Geschäft, während die Bauern in der Rückständigkeit versanken.
Daran änderte nichts, daß sich der Prinz gelegentlich vor einer Reihe von Traktoren fotografieren ließ und dazu die internationale Presse, das diplomatische Korps und überhaupt jeden ausländischen Pinsel einlud, den er erreichen konnte!
In den Städten rollten amerikanische Autos, plärrten japanische Fernseher und Recorder, es gab eine wachsende Schicht von Angestellten, die nur noch Dienstleistungen für die Großverdiener versah, vom Kraftfahrer über den Masseur und den Kellner im »Royal« bis zur Hure. Auf dem Lande fehlte hingegen selbst die Pinzette, mit der man eine Zecke hätte aus der Nackenhaut eines Babys entfernen können. In den Städten wuchs die Zahl der sogenannten Verwaltungsangestellten, während in den Dörfern die traditionellen Handwerker ausstarben, etwa der Mann, der eine Karrenachse hätte reparieren können – er wanderte, wie andere auch, in die Stadt ab, um dort Wasserklosetts für Neureiche zu bauen. –
Man muß berücksichtigen, um diese Zeit bezogen wir noch amerikanische »Hilfe« – außer einigen Lastwagen für das Militär oder ein paar Traktoren vor allem Kognak, Whisky, Waschpulver, Zigaretten, Modekleidung, Radios, TV-Geräte, feines Geschirr, Parfüms, Fahrzeuge, Möbel …
Diese Dinge wurden von etwa 10 Prozent der Bevölkerung konsumiert, und zwar in den Städten, weil es anderswo niemanden gab, der sie hätte bezahlen können, selbst wenn er sie gebraucht hätte. Auf dem Lande aber lebten 90 Prozent aller Kambodschaner, und die Importe für sie – Lampenbrennstoff, Haushaltsartikel, Werkzeuge und billiger Baumwollstoff – machten genau 4 Prozent aller Einfuhrgüter aus. Das waren die Zahlenverhältnisse, die Herr Khieu Sampan errechnet hatte. Selbst wenn sie nur annähernd stimmten, ließen sie erkennen, was da vor sich ging: Es war eine Deformation des Lebens, die wir Jungen zwar spürten, auf deren tatsächliches Ausmaß uns aber erst Khieu Sampan und Saloth Sar aufmerksam machten. Und sie boten ein Rezept an, um die Sache vom Kopf wieder auf die Beine zu stellen.
Heute halte ich dieses Rezept für fragwürdig in seiner theoretischen Basis und für barbarisch in der Form, in der es später realisiert wurde, aber man muß verstehen, daß vor allem viele junge Leute nach einem solchen Rezept griffen, nach irgendeinem, begierig, die fatale Wirklichkeit zu verändern, und ohne zunächst zu fragen, worin die Konsequenzen bestehen würden.
Khieu Sampan bot als Lösung an, zunächst die parasitäre Rolle der Städte abzuschaffen. Der Verkauf der Dorf-Produkte – wie Reis, Kautschuk oder Gemüse – sollte nationalisiert werden, um die Preise, die die Bauern erzielten, erträglicher zu gestalten. Importe sollten auf das beschränkt werden, was die Landbevölkerung brauchte, und die Exporteinnahmen sollten gemeinsam mit den Profiten aus den Landwirtschaftsgütern dazu verwendet werden, die Lage der Bauern zu verbessern. Banken, Energiebetriebe, überhaupt alle Industrieunternehmen seien zu verstaatlichen, die Verwaltungsbürokratie, die geradezu unglaublich korrupt geworden war, und die Angestellten aus dem Sektor der Luxusdienstleistungen sollten in der Landwirtschaft arbeiten, um dort die Produktion zu erhöhen. Pachtzinsen seien abzuschaffen, indem große Arbeitsgemeinschaften auf dem Dorfe gegründet würden.
Auf dem Lande, unter den einfachen Leuten, den Ärmsten, sollte der Weg entschieden werden, den Kambodscha zu nehmen hatte – nicht mehr im Königshaus oder in der von den Unternehmern bestochenen Bürokratie.
Unser Herz schlug für diese Ideen. Wir fühlten mit den Armen; das ist wohl das Vorrecht jeder Jugend. Wir waren mit dem, was Herr Khieu Sampan theoretisch ausgearbeitet hatte und was Herr Saloth Sar uns zugänglich machte, total einverstanden. Es traf unseren sozialen Nerv.
Es traf natürlich auch den Nerv des Königshauses; Khieu Sampan ebenso wie Saloth Sar galten als Kommunisten. Obgleich – genaugenommen stimmte das nicht. Sie waren, wie ich sehr viel später erfuhr, erst seit 1960 eingeschriebene Mitglieder der damaligen KP, die sich im Untergrund befand und von den Polizeiorganen erbittert verfolgt wurde. Sihanouk allerdings schmückte sich mit, wie er es nannte, »legalen Kommunisten« als Parlamentsmitgliedern, um seine Toleranz zu beweisen. Er wollte einige Vorzeigekommunisten haben, sogar als Minister, um Kritik von links abzubauen.
Nun bezeichnete sich Herr Khieu Sampan beispielsweise selbst stets als Kommunist. Er ließ durchblicken, er gehöre sogar zum Zentralkomitee der Partei. Ich habe nie, auch später nicht, herausfinden können, ob das eigentlich stimmte. Eine illegale Partei wie die damalige KPK läßt gewiß keine Mitgliederlisten herumliegen; es wären Todesurteile, wenn die Polizei sie aufspürte. Wie dem auch gewesen sein mag, wir Jungen hatten das Gefühl, es tatsächlich mit Kommunisten zu tun zu haben, selbst wenn Sihanouk es vorzog, sie zeitweilig nicht anzutasten. Für uns hatten die Kommunisten aus der Zeit der Kämpfe gegen die Franzosen einen guten Namen. Sie verkörperten soziale Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Unbestechlichkeit.
Khieu Sampan gab damals, neben seiner Lehrtätigkeit, in Phnom Penh eine Wochenzeitung in französischer Sprache heraus, die im wesentlichen der Propagierung seiner Ideen diente, wenngleich er dabei recht vorsichtig vorging und jeden direkten Konflikt vermied. Trotzdem wollte Sihanouk ihn wohl in der Öffentlichkeit als politischen Gegner abwerten. Im Herbst 1960 erschien eine Gruppe Schläger vor Khieu Sampans Haus. Dieser hielt gerade Mittagsruhe. Die Kerle zerrten den nur mit einer Unterhose Bekleideten auf die Straße und ließen ihn von einem Zeitungsreporter fotografieren. Ein Bild der Lächerlichkeit sollte er abgeben. Es hatte nicht den erwarteten Erfolg.
Zwei Jahre später änderte Sihanouk seine Taktik. Neuwahlen standen an. Die KPK war offiziell verboten. Sihanouk nahm Khieu Sampan und zwei seiner Gesinnungsfreunde, Hu Nim und Hou Yon, die beide an der juristischen Fakultät der Universität Phnom Penh lehrten, einfach in seine Sangkum-Partei und deren Wahlliste auf, mit der Begründung, er wolle Linken wie ihnen großmütig eine Chance sichern, weil sie selbst ja keiner Partei angehörten, die Listen aufstellen durfte. Sie wurden prompt gewählt, und so kam es dazu, daß sie alle drei für ein knappes Jahr Ministerposten in Sihanouks Regierung bekleideten, bis er sie wieder hinauswarf.
Herr Khieu Sampan wurde dann, 1966, nochmals auf die gleiche Weise zum Abgeordneten gewählt. Sihanouk wollte ihn wohl neutralisieren. Aber um diese Zeit hatte sich die revolutionäre Stimmung im Lande bereits so stark entwickelt, daß es in Battambang zu Aufständen kam. Da wurde auch Khieu Sampan endgültig von Sihanouk abgesetzt und zum Aufrührer und Staatsfeind erklärt.
Bevor ich über die Aufstände spreche, will ich versuchen, Ihnen ein wenig Aufschluß über das eigenartige Verhältnis Sihanouks zu den Amerikanern zu geben, weil das in unserer ganzen neueren Geschichte eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt hat. Einzelheiten darüber erfuhr ich von Saloth Sar in unserem Zirkel.
Zunächst muß man wissen, daß unser Monseigneur Papa, der Prinz aus der Norodom-Dynastie, ein Mann mit hochentwickeltem Geltungsbedürfnis war. Er rieb sich an Beleidigungen, die von den Amerikanern ausgingen und die ihn zu höchst eigenwilligen Reaktionen trieben.
Die Angelegenheit reicht weit zurück. Ich kenne sie aus den Gesprächen der Älteren, die ich später hörte. 1952, als die Franzosen Kambodscha noch ziemlich umfassend beherrschten, hatte der junge Prinz, zweifellos von nationalem Ehrgeiz getrieben, aber wohl auch von der Absicht bewegt, die Macht zu übernehmen, eine Art Weltreise unternommen, um in vielen Ländern für die Unabhängigkeit Kambodschas zu werben.
Die Reise führte ihn auch nach Washington, wo er nicht gerade wie ein Prinz behandelt wurde, eher wie ein »Eingeborener aus einem wilden Land«. Er wurde vom damaligen Außenminister John Foster Dulles empfangen, und nachdem er seinen Wunsch auf Unabhängigkeit Kambodschas vorgebracht hatte, schüttelte der große weiße Mann nur den Kopf und erklärte dem Prinzen, er solle doch froh sein, daß Kambodscha eine französische Kolonie voller französischer Soldaten wäre, das sei der beste Schutz gegen den aggressiven Kommunismus.
Nun war Sihanouk ja keinesfalls ein Kommunistenfreund, obwohl die kommunistische Widerstandsbewegung zunächst dasselbe Anliegen verfolgte wie er, nämlich die Befreiung vom Kolonialstatus. Aber Sihanouk war in Sachen seines Landes erfahren genug, Herrn Dulles darauf hinzuweisen, daß dessen Denkrichtung nicht stimmte: Die weitere Unterdrückung der Selbständigkeitsbestrebungen in Kambodscha durch die Franzosen würde im Gegenteil die Sympathien für die Kommunisten noch erhöhen. Dulles lachte ihn aus. Das kränkte Sihanouk so sehr, daß er es nie vergessen konnte.
Nach allem, was ich über die Sache erfahren habe, war das so etwas wie ein Anfangskonflikt. Ich hatte später, als ich im Dschungel lebte, worüber ich noch sprechen werde, viel Zeit, und Geschichte wurde ein wenig zu meiner bevorzugten Freizeitbeschäftigung, sofern ich Freizeit hatte. Je irrealer das Leben um mich herum wurde, je mehr Rätsel es mir aufgab, mein Gewissen plagte, mir Fragen stellte, desto mehr war ich interessiert, Wahrheiten herauszufinden, die mir helfen konnten, mich in dem Irrgarten zurechtzufinden, in den ich geraten war.
Die Politik der Amerikaner uns gegenüber war in mancherlei Hinsicht für die Entwicklung Kambodschas mitentscheidend. Es kam nach 1954, als die Franzosen aus Indochina abzogen, zu einer weiteren Kontroverse Sihanouks, des nunmehrigen Staatschefs, mit den USA. Diese bestanden darauf, daß Kambodscha der SEATO beitreten sollte, diesem antikommunistischen Pakt. Sihanouk lehnte das ab. Er stellte zu den asiatischen kommunistischen Staaten bessere Beziehungen her. Aber gleichzeitig bemühte er sich auch um Ausgleich mit den Amerikanern; er erbat bei ihnen sogar Hilfe in Form von Krediten und auf militärischem Gebiet.
Er bekam sie ab 1955. Herr Khieu Sampan errechnete, daß 30 Prozent unseres Militärbudgets von der US-Hilfe gedeckt wurden. Man sah es unserer Armee übrigens an. Uniformen, Helme, Handfeuerwaffen, Geschütze, Panzer, Lastwagen, das alles stammte aus amerikanischen Beständen. Lediglich bei den Luftstreitkräften wurden alte französische Typen benutzt, sonst überwog US-Material.
Sie werden wissen, daß Sihanouk 1963 dann die US-Hilfe