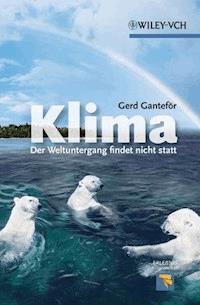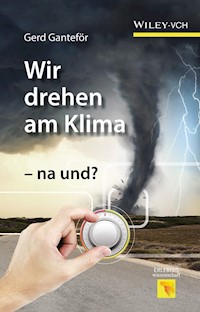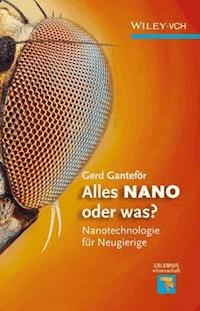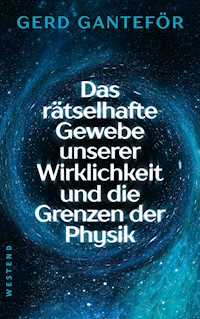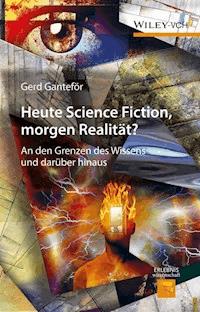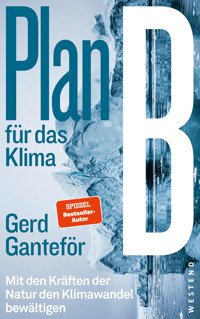
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Zunehmende Wetterextreme verschärfen die Diskussion um den Klimawandel. Politiker beschwören Schreckensszenarien und fordern drastische und unerfüllbare Maßnahmen. Aber es gibt einen Weg jenseits davon: Die Ursache für die globale Erwärmung ist das Kohlendioxid aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. Ihm gegenüber stehen jedoch die beiden großen natürlichen Senken, die Ozeane und die Landpflanzen, die uns den Weg zu einem weniger radikalen Klimaschutz eröffnen. Zur Zeit absorbieren sie jedes Jahr rund die Hälfte der menschlichen Emissionen. Dabei hängt ihre Leistung nicht vom Ausstoß ab, sondern von der Menge an Kohlendioxid in der Atmosphäre. Könnten wir unsere Emissionen also zumindest auf die Hälfte reduzieren, bliebe die CO2-Konzentration konstant, und das Ziel, die Erwärmung des Planeten zu stoppen, würde in greifbare Nähe rücken. Zusätzlich lässt sich die Leistung der Senken mit sanften Maßnahmen erhöhen. Der renommierte Physiker Gerd Ganteför skizziert einen bürgerfreundlichen Weg in die Zukunft, dem auch Länder des globalen Südens folgen können, die ihre Wachstumsphasen noch vor sich haben. Dieses Buch ist eine gute Nachricht inmitten der Kakofonie schlechter Nachrichten, die uns tagtäglich erreichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ebook Edition
Gerd Ganteför
Plan B für das Klima
Mit den Kräften der Natur den Klimawandel bewältigen
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
1. Auflage 2024
ISBN 978-3-98791-071-5
© Westend Verlag GmbH, Waldstr. 12 a, 63263 Neu-Isenburg
Umschlaggestaltung: Buchgut Berlin
Satz: Publikations Atelier, Weiterstadt
Inhalt
Titelblatt
Geleitwort Hermann Hess
Vorwort Wolfgang Eberhardt
1 Einführung
2 Die Folgen der Erwärmung
Hitze
Meeresspiegelanstieg
Stürme
Dürren
Starkregen
Gletscherschmelze
Ergrünen der Erde
Höhere Ernteerträge
3 Plan A: Dekarbonisierung
4 Bevölkerung und Armut
5 Kohle, Öl, Gas und Uran
6 Die erneuerbaren Energien
7 Der Treibhauseffekt
8 Klimageschichte
9 Kohlendioxid
10 Senkenleistung
1. Indiz
2. Indiz
3. Indiz
11 Ozeansenke
Eine Erde ohne Ozeane wäre wie die Venus
Wie Kohlendioxid über Äonen in Kalkstein umgewandelt wurde
Warum die Ozeansenke nicht versagen wird
Die Versauerung der Ozeane und das Auflösen der Muschelschalen
Kohlendioxid und Wasser: Ein wenig Grundwissen
Das Gleichgewichtsmodell für Ozeane und Atmosphäre
Was macht die Erwärmung mit dem gelösten Kohlendioxid?
Argumente gegen das Gleichgewichtsmodell
Wie die Ozeane Kohlendioxid speichern
12 Landsenke
Netto- und Bruttoprimärproduktion
Das Gleichgewicht der Landpflanzen
Der Amazonas-Regenwald: Senke oder Quelle?
Die Erde ergrünt
1. Indiz
2. Indiz
3. Indiz
Ursachen für die hohe Senkenleistung
1. Ursache: Der CO2-Düngeeffekt
2. Ursache: Feuchteres Klima
3. Ursache: Längere Wachstumsperiode
4. Ursache: Verschiebung der Klimazonen
5. Ursache: Schnelleres Wachstum
Die Zukunft der Landsenke
13 Methan
Methanquellen und -senken
Die Gleichschaltung von Methan und Kohlendioxid
Der Faktor 28
Methanstopp zur Jahrtausendwende
Der aktuelle Anstieg der Methankonzentration
Satellitendaten
Strategien, das Methanproblem in den Griff zu bekommen
14 Verstärkung der Senkenleistung
Verstärkung der Ozeansenke
Durchmischung der Wasserschichten
Düngung mit Nährstoffen
Anbau von Seetang
Gesteinsmehl
Verstärkung der Landsenke
Aufforstung
Project Drawdown
Umstellung der Landwirtschaft
LULUCF
15 Budgetmodell versus Senkenmodell
Grundlagen des Budgetmodells
Die Korrelation zwischen den kumulierten Emissionen und dem Temperaturanstieg
16 Gegenargumente
Argument: Die Senken existieren nicht
Argument: Die Senken werden sich bald erschöpfen
Argument: Die Senkenleistung hängt von den jährlichen Emissionen ab
Argument: Die Senken absorbieren immer die Hälfte der Emissionen
Argument: Die Ozeane sind in Wirklichkeit bald eine Quelle statt einer Senke
Argument: Die Erwärmung lässt die Pflanzen sterben
Argument: Die Senken dürfen nicht diskutiert werden, um die Motivation der Bürger zum Klimaschutz nicht zu mindern
Argument: Die Kipppunkte erzwingen eine Reduktion auf null
Argument: Selbst wenn die Emissionen nur um die Hälfte sinken müssen, sollten die Industriestaaten aufgrund ihrer historischen Schuld vollständig dekarbonisieren
Argument: Die ärmeren Länder werden ihre Emissionen nicht reduzieren, also müssen die Industriestaaten dies mit einer vollständigen Dekarbonisierung ausgleichen
Argument: Kohlendioxid ist nicht für die globale Erwärmung verantwortlich, folglich spielen die Senken keine Rolle
Argument: Wasserdampf hat eine stärkere Klimawirkung als Kohlendioxid
17 Die Verweildauer des Kohlendioxids: Ein verblüffendes Argument
18 Plan B
19 Zusammenfassung
Anmerkungen
Navigationspunkte
Titelblatt
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort Hermann Hess
Der Schutz der Erdatmosphäre vor einer zu starken Erwärmung und den damit verbundenen Nachteilen und Schäden ist im Laufe der letzten Jahre zu einem weltweiten Thema geworden. Ganz am Anfang stritt man sich noch, ob die Temperatur tatsächlich ansteigt. Darauf folgte die Diskussion über die Ursachen und den Einfluss der menschlichen Nutzung fossiler Brennstoffe auf den Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre. Nachdem man sich hier weitgehend einig geworden ist, gehen heute die Meinungen über die Möglichkeiten und Grenzen der Dekarbonisierung je nach Weltregion weit auseinander.
Bei der heftig geführten Debatte spielt die globale Dimension und Wirkungsweise des Problems eine Rolle. Einerseits würde selbst der sofortige Verzicht etwa Europas und der USA auf die Nutzung sämtlicher fossiler Energieträger den weiteren Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre nicht verhindern. Andererseits wird ebenfalls meist vernachlässigt, dass das Drehen am »CO2-Rad« weltweit indirekte Auswirkungen auf Energieversorgung, Wirtschaft und Bevölkerungsentwicklung nach sich zieht und damit sogar die Erreichung der Klimaziele unmöglich machen könnte.
Schon heute lässt sich absehen, dass das Wachstum der Erdbevölkerung abflacht, bis etwa 2100 nahezu ganz aufhört und daraufhin langsam ins Negative kippt. Hauptursache dieses Trends, der sich seit Jahrzehnten an zahlreichen nationalen Entwicklungen zeigt, ist das insgesamt steigende Wohlstandsniveau auf der Welt. Würde das Wachstum durch extreme Klimamaßnahmen gestoppt, so wäre in vielen Ländern wieder mit einer Zunahme der Geburtenzahlen zu rechnen.
Wetterphänomene wie beispielsweise »El Niño« oder »La Niña« sowie Vulkanausbrüche führten schon früher und führen auch heute zu instabilen und extremen Wetterlagen. Mittlerweile ist es Usus geworden, diese Extreme auf den Klimawandel zurückzuführen, womit man viele Menschen in Panik versetzt. Dahinter steht der Gedanke, die Tragfähigkeit politischer Maßnahmen gegen die globale Erwärmung zu steigern. Doch das Klima wird durch komplexe und weltweite physikalische Zusammenhänge erzeugt, und von diesen kennen wir sehr vermutlich noch längst nicht alle. So zeichnen sich die Modelle der Klimawissenschaft denn auch durch enorme Bandbreiten aus.
Einer der unterschätzten Einflüsse besteht in den sogenannten CO2-Senken, den Ozeanen und Landpflanzen, um die sich Gerd Ganteförs Buch dreht und die immerhin jedes Jahr rund 20 Milliarden Tonnen Kohlendioxid absorbieren. Das entspricht gegenwärtig ungefähr der Hälfte des weltweiten Ausstoßes. Nun haben Wissenschaftler unter der Führung von Prof. Dr. Wolfgang Eberhardt untersucht, was mit dieser Aufnahmefähigkeit geschieht, wenn die Emissionen in 20 bis 30 Jahren zu sinken beginnen. Ihre Schlussfolgerung überrascht: Weil die Absorption nicht vom jährlichen Ausstoß abhängt, sondern auf die Menge an Kohlendioxid in der Atmosphäre zurückzuführen ist und diese wohl noch Jahrzehnte nach der Trendumkehr hoch bleiben wird, dürfte die Absorptionsleistung nach einigen Jahrzenten die gesamten Emissionen kompensieren. Das heißt mit anderen Worten: Eine Verringerung des heutigen Ausstoßes um 50 Prozent führt zum effektiven Stopp des Anstiegs der Konzentration. Damit wäre der Klimawandel gestoppt – aber noch nicht rückgängig gemacht.
Im Irrgarten der Ideen, Konzepte und politischen Forderungen bewahrt der Physiker Gerd Ganteför einen kühlen Kopf. Frei von Ideologie, aber klar den Menschenrechten, der Demokratie und der Freiheit verpflichtet und stets gestützt auf die Publikationen des Weltklimarats zeigt er die Zusammenhänge auf und präsentiert einen menschenfreundlichen Plan B für das Klima.
Hermann Hess ist Hauptsponsor der 4π-Symposien über Energie, Klima und Bevölkerung, ehemaliger Schweizer Nationalrat, Unternehmer in den Bereichen Immobilien und Tourismus sowie Pianist.
Vorwort Wolfgang Eberhardt
Wir leben in einer Zeit, in der sich das Klima weltweit verändert. Die Bewältigung dieser globalen Erwärmung ist eine der sogenannten »Grand Challenges« der Menschheit, wobei es jedoch auch weitere gibt, wie Bevölkerungswachstum, Hunger, Terrorismus, Kriege sowie den Mangel an medizinischer Versorgung und Bildung, die nicht minder wichtig sind. Der Klimawandel wird dadurch verursacht, dass die Verbrennung fossiler Energieträger, wie Kohle, Öl und Gas, die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre anreichert. Seit dem Beginn des industriellen Zeitalters hat sich diese um etwa 50 Prozent erhöht. Kohlendioxid oder CO2 ist ein Treibhausgas und blockiert einen Teil der Wärmestrahlung, die die Erde in den Weltraum abgibt. Somit verschiebt sich die Bilanz zwischen eingestrahlter und abgestrahlter Energie – mehr bleibt auf der Erde zurück und es wird insgesamt wärmer. Diese Tatsache ist wissenschaftlich erwiesen, und das nicht erst seit Kurzem: Der schwedische Wissenschaftler Svante Arrhenius diskutierte sie schon vor 125 Jahren in einer seiner Veröffentlichungen.
Anlässlich der Pariser UN-Klimakonferenz im Jahre 2015 haben die Länder der Welt vereinbart, den Klimawandel auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen, indem sie die Emissionen bis zur zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts so weit verringern, dass die natürlichen Senken alles weiterhin ausgestoßene Kohlendioxid aufnehmen. So steht es in den Artikeln 2.1a und 4.1 des Übereinkommens geschrieben. In Deutschland wird dies seitens der Klimaaktivisten und einiger Wissenschaftler so interpretiert, dass man die Emissionen bis 2050 auf »netto null« reduzieren muss – wobei »netto« in ihren Augen mit »absolut« oder »nahezu« gleichzusetzen ist. Selbst der Weltklimarat (IPCC) zeigt aber Daten, die eindeutig belegen, dass die beiden großen CO2-Senken der Ozeane und Landpflanzen in den letzten 60 Jahren im Durchschnitt mehr als die Hälfte des emittierten Kohlendioxids aufgenommen haben. Das steht, vom IPCC unerklärt, im krassen Widerspruch zur Forderung, den Ausstoß bis 2050 auf nahezu null zu reduzieren. Dabei macht es natürlich einen gewaltigen Unterschied, ob wir die Emissionen nur halbieren oder fast komplett herunterfahren müssen, um den Klimawandel zu bewältigen.
Diese Beobachtungen bilden die Basis des Senkenmodells, das Gerd Ganteför wunderbar anschaulich mit einer Badewanne beschreibt. Er ist, wie auch ich, Physiker und wir haben viele Jahre erfolgreich in der Grundlagenforschung an Nanostrukturen zusammengearbeitet. In unserer Ausbildung haben wir gelernt, die Natur durch Messungen zu beobachten und zu versuchen, die Gesetzmäßigkeiten, die diesen Beobachtungen zugrunde liegen, zu erkennen und in Gleichungen zu erfassen. Im Mittelalter maßen die Astronomen die Bahnen der inneren, zuerst entdeckten Planeten um die Sonne und schlossen dann aus relativ kleinen Abweichungen auf die Existenz weiterer Himmelskörper. So wurden zum Beispiel die äußeren Planeten des Sonnensystems gesucht und entdeckt. Es ist eine erprobte Praxis, hierbei die einfachste mögliche Beschreibung zu wählen und erst dann, wenn die Werte des simplen Modells nicht mehr mit den Messdaten übereinstimmen, dieses zu erweitern, bis die beiden wieder im Einklang sind. In Bezug auf die Menge an Kohlendioxid in der Atmosphäre ist das Senkenmodell eine einfache Beschreibung, die alle über die letzten 60 Jahre gemessenen Werte genauso gut beschreibt wie die vom Weltklimarat genutzten, deutlich komplexeren, aber auch intransparenten Erdsystemmodelle. Komplexer ist nicht notwendigerweise besser – das müsste man erst beweisen.
Die Herausforderungen an die Umgestaltung unserer Energiewirtschaft ändern sich ganz wesentlich, sobald wir die Emissionen nur um etwa 50 Prozent reduzieren müssen, wie vom Senkenmodell postuliert. Wir können dann zum Beispiel noch ohne Gewissensbisse das Flugzeug für Interkontinentalreisen benutzen, unsere Häuser mit einer modernen Gas-Wasserstoff-Heizung gemütlich warm halten und auch unsere Essgewohnheiten rein nach Gesundheitskriterien gestalten. Zudem bleibt die Industrie unserem Land erhalten und kann sogar wachsen, anstatt wegen hoher Energiekosten alle Produktion ins Ausland zu verlagern. Das erhält Arbeitsplätze, Wohlstand und letztendlich auch den sozialen Frieden.
Deutschland braucht dringend einen Plan B für das Klima. Kein Land in der Welt setzt Maßnahmen zum Klimaschutz so rigoros gegen die eigene Bevölkerung durch wie die derzeitige Regierung. Die für eine CO2-neutrale Stromerzeugung sehr gut geeigneten Kernkraftwerke wurden aus ideologischen Gründen abgeschaltet, während fast alle unsere Nachbarn neue Kernkraftwerke errichten oder die Laufzeiten des Bestands verlängern. Die von der Politik in Deutschland geplanten Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels, beispielsweise das Heizungsgesetz, rufen im Ausland nur Kopfschütteln hervor. Private Haushalte, Geschäfte und Industrie werden durch stetig steigende Kosten für Energie, auch verursacht durch exorbitante Steuern, extrem belastet beziehungsweise ihrer Geschäftsgrundlage und Wettbewerbsfähigkeit beraubt. Selbst das Bundesverfassungsgericht sah sich – beeinflusst durch eine Klage von Klimaaktivisten unter Bezugnahme auf falsch dargestellte Daten – befugt, unsere Regierung zu ermahnen, noch mehr gegen den Klimawandel zu tun. Das war ein einzigartiger Vorgang.
Wir brauchen in Deutschland dringend eine vernunftbasierte Klimapolitik. Ideologie, Hysterie und Angst sind schlechte Ratgeber. Sprechverbote und die Ausgrenzung anderer Vorstellungen müssen aufhören. Wir sollten wissenschafts- und technologieorientiert nach einem stetigen Plan vorgehen und dabei sorgfältig darauf achten, im Gleichklang mit unseren Nachbarn und Wettbewerbern in der Welt zu agieren. Wenn wir unsere wirtschaftliche Grundlage ruinieren, dann gefährdet das auch den Wohlstand und sozialen Frieden sowie die Freiheit unserer Demokratie. Unter Achtung dieser Prinzipien kann die Energiewende gelingen und der Klimawandel erfolgreich beherrscht werden. Gerd Ganteförs Buch vermag dazu einen wesentlichen Beitrag zu leisten.
Professor em. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Eberhardt ist emeritierter Professor für Physik an der Technischen Universität Berlin.
1 Einführung
Es gibt einen bürger- und wirtschaftsfreundlichen Weg, das Klimaproblem zu lösen. Denn die Natur unterstützt uns in unseren Bemühungen, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre auf ein menschen- und umweltverträgliches Niveau zu begrenzen. Gemeint sind die beiden großen natürlichen Senken, die Ozeane und die Landpflanzen. Ozeanwasser speichert große Mengen an Kohlendioxid: Zurzeit nehmen die Weltmeere etwa ein Viertel des von uns ausgestoßenen CO2 auf. Ähnliches gilt für die Landsenke: Bei der Photosynthese wandeln die Wälder und Pflanzen Kohlendioxid aus der Luft zusammen mit Wasser in organische Verbindungen wie Glucose um, die sie für ihren Stoffwechsel benötigen, und geben dabei Sauerstoff von sich. Im Augenblick nehmen uns die Landpflanzen ebenfalls ein Viertel unserer Emissionen ab. Insgesamt kommt also nur rund die Hälfte der menschengemachten Emissionen aus der Verbrennung von Kohle, Gas und Öl tatsächlich in der Atmosphäre an.
Das erste große Ziel des Klimaschutzes besteht darin, die CO2-Konzentration nicht noch weiter anwachsen zu lassen. Sie bliebe konstant, würde man die Emissionen auf die Menge absenken, die die beiden großen Senken jährlich aufnehmen können. Derzeit verschulden wir uns Jahr für Jahr bei der Natur: Unser Ausstoß übersteigt das, was sie aufzunehmen imstande ist, um etwa das Doppelte. Für einen »ausgeglichenen Haushalt« müssten wir die beiden Posten Emissionen und Senken also in ein Gleichgewicht bringen. Das ist die Grundidee des in diesem Buch näher beschriebenen Senkenmodells.
Die Leistung der beiden Senken liegt im Augenblick bei rund 20 Milliarden Tonnen pro Jahr während wir parallel jedes Jahr rund 40 Milliarden Tonnen an Kohlendioxid freisetzen.1 Die Menschheit könnte also weiterhin 20 Milliarden Tonnen CO2 emittieren, jedenfalls solange die Leistung der Senken auf dem derzeitigen Niveau bleibt. Die Halbierung des Ausstoßes von heute 40 Milliarden Tonnen pro Jahr ist noch immer eine gewaltige Herausforderung – sie erscheint aber eher zu bewältigen als die gegenwärtige Forderung der Klimapolitik nach einer vollständigen Dekarbonisierung. Dadurch stünde uns mehr Zeit für die Umstellung auf eine klimafreundliche Gesellschaft zur Verfügung. Das Senkenmodell hat aber noch einen weiteren Vorteil: Durch sanfte Maßnahmen ist es nämlich möglich, die Leistung der Senken zu erhöhen. Wie das funktioniert, wird in diesem Buch näher erläutert.
Die meisten Klimaaktivisten, -journalisten und -politiker lehnen das Senkenmodell ab. Sie sind davon überzeugt, dass jede Abschwächung ihrer Forderungen nach einer vollständigen Dekarbonisierung dazu führen würde, dass die Bevölkerung die Motivation verliert, die harschen Auflagen eines radikalen Klimaschutzes weiterhin mitzutragen. Aus diesem Grund werden die Senken aus der öffentlichen Diskussion weitestgehend herausgehalten.
Stattdessen argumentiert man im Rahmen des sogenannten Budgetmodells, das davon ausgeht, dass die Menschheit über den gesamten Zeitraum seit der Industrialisierung nur eine bestimmte maximale Menge an Kohlendioxid ausstoßen darf. Ist dieses »Budget« einmal aufgebraucht, müssen die Emissionen auf absolut null fallen; die natürlichen Senken kommen dabei praktisch nicht vor. Spricht man die Verfechter des Budgetmodells auf die offensichtliche Diskrepanz an, verweisen sie auf Simulationen und Modellrechnungen, denen zufolge die Leistung der Senken in der unmittelbaren Zukunft sehr rasch abnehmen wird. Solche Prognosen gibt es schon seit vielen Jahrzehnten und seit vielen Jahrzehnten erweisen sie sich als falsch. Zudem fehlt für die Vorhersage jedwede physikalische Begründung: Ein Simulationsergebnis hat wenig Aussagekraft, wenn man nicht erklären kann, welche natürlichen Prozesse dieses herbeiführen.
Das Budgetmodell bildet die Grundlage aller radikalen Forderungen hinsichtlich des Klimaschutzes: Würde sich herausstellen, dass ersteres falsch ist, wären letztere entsprechend hinfällig. Daher verwundert es kaum, dass das Senkenmodell seitens der Klimabewegung massiven Gegenwind erfährt. Möglicherweise hängt dies auch damit zusammen, dass sie sich über Jahrzehnte mit allerhand unwissenschaftlichen Thesen und fadenscheinigen Argumenten herumschlagen musste, sodass die Defensive mittlerweile instinktiv geworden ist. Doch besteht kein Zweifel, dass die Senken existieren und dass ihre Leistung seit vielen Jahrzehnten proportional zur Menge an Kohlendioxid in der Atmosphäre zugenommen hat. Beides sind im Gegensatz zu den Vorhersagen der Computermodelle experimentell überprüfbare Größen.
Dieses Buch zeigt eine Möglichkeit auf, wie das Klimaproblem noch gelöst werden kann, wenn unser Plan A – gemeint ist der konventionelle Klimaschutz, wie ihn die Regierungen vieler westlicher Staaten propagieren – scheitert. Sogar in Deutschland, dem selbsternannten Vorzeigeland der Energiewende, stoßen die radikalen Einschnitte zunehmend auf den Widerstand der Bürger, denn sie drohen den Wohlstand, den sich unsere Gesellschaft über die letzten Jahrzehnte erarbeitet hat, wieder wegzunehmen. Die teuren Maßnahmen können sich viele hierzulande, ganz zu schweigen von ärmeren Regionen der Erde, nicht leisten.
Der in diesem Buch vorgestellte Plan B gibt der Menschheit mehr Zeit und nimmt die Panik aus dem System. Zwar spielen die gängigen Maßnahmen zur Reduktion der Emissionen teilweise noch eine Rolle, aber sie tun dies auf eine weniger radikale und vor allem auf eine sozial verträglichere Art. Hinzu kommt, dass uns die Existenz der Senken ermöglicht, fossile Energien dort, wo sie sich nur schwer ersetzen lassen, in reduziertem Maß weiter zu verwenden. Ein wichtiger neuer Aspekt im Plan B ist schließlich, dass die Leistung der Senken verstärkt werden kann. Damit kommt eine Palette an kostengünstigen und sanften Klimaschutzmaßnahmen hinzu, mit denen sich Kohlendioxid im Gigatonnenmaßstab aus der Atmosphäre extrahieren lässt.
Plan B vertritt einen ganzheitlichen Ansatz, denn der Klimawandel ist nicht unser einziges Problem. Die Vereinten Nationen haben sich auf insgesamt 17 Nachhaltigkeitsziele geeinigt, deren Erfüllung die Menschheit anstreben sollte. Darunter finden sich beispielsweise die Bekämpfung von Armut und Hunger, die Bereitstellung von Bildungsmöglichkeiten und Gesundheitsvorsorge sowie die Schaffung von Frieden und Geschlechtergerechtigkeit. Plan B versucht, das Klimaproblem im Einklang mit diesen 17 UN-Nachhaltigkeitszielen zu bewältigen, und bietet eine bürgerfreundliche Version des globalen Klimaschutzes an. Das Buch beschreibt einen ideologieneutralen und ganzheitlichen Ansatz mit den Menschen und nicht gegen die Menschen. Damit tritt es gegen die Angst und für die Vernunft, gegen die Ideologie und für das kritische Denken ein – und gibt vielleicht Anlass zu ein wenig Optimismus und Lebensfreude.
Für interessierte Leser, die noch tiefer in die Materie eintauchen wollen oder die sich allgemein für die Rätsel der modernen Naturwissenschaft begeistern können, gibt es zahlreiche Inhalte auf der Website gantefoer.ch sowie auf dem YouTube-Kanal Grenzen des Wissens.
2 Die Folgen der Erwärmung
Es besteht kein Zweifel: Unsere Erde wird wärmer. Die meisten Wetterstationen auf der Welt zeigen über die letzten 50 Jahre eine Erwärmung um mehr als 1 Grad Celsius. Aus den einzelnen Messungen lässt sich ein globaler Mittelwert errechnen; reiht man diesen für alle Jahre aneinander, ergibt sich die berühmte Kurve des Anstiegs der globalen Mitteltemperatur, dargestellt in Abbildung 1. Gegenüber dem vorindustriellen Wert beträgt die Erwärmung bisher ungefähr 1,3 Grad.
Abbildung 1: Zunahme der globalen mittleren Temperatur seit 1880.1
Heftige Klimaschwankungen sind in der Erdvergangenheit nicht selten. So ging die letzte Eiszeit vor etwa 10 000 Jahren zu Ende. Darauf folgte eine Zwischeneiszeit, das sogenannte Holozän, in dem wir heute leben. Im Klimaoptimum dieser wärmeren Phase war es fast so warm wie jetzt. Eine Erwärmung um 1 oder 2 Grad ist deshalb erdgeschichtlich gesehen nichts Ungewöhnliches. Den Homo sapiens gibt es seit grob 400 000 Jahren; unsere Vorfahren haben also mehrere Zyklen von Eiszeiten und Zwischeneiszeiten erlebt und überlebt. Mitunter war es auch deutlich wärmer als heute. Unser Fortbestehen wird folglich selbst durch eine Erwärmung um mehr als 2 Grad nicht bedroht.
Im Licht der Erdgeschichte und der Entwicklung des Menschen ist die aktuell befürchtete Klimaerwärmung um rund 1,5 oder 2 Grad eher gering. In den Eiszeiten war es bis zu 8 Grad kälter und in der langen Phase des tropischen Klimas bis vor 35 Millionen Jahren um rund 8 Grad heißer. Trotzdem hat die aktuelle Erwärmung, je nachdem, wie stark sie schließlich ausfallen wird, möglicherweise gravierende Folgen. Der Mensch muss versuchen, sie zum einen zu begrenzen und sich zum anderen mit ihren Konsequenzen, die schon jetzt eintreten und sich noch weiter verstärken werden, auseinanderzusetzen. Zwar hat eine moderate Erwärmung unter Umständen einige positive Effekte, diese sind aber gering an der Zahl und stehen vor allem bedrohlichen Entwicklungen gegenüber, auf die es sich vorzubereiten gilt. In den folgenden Abschnitten besprechen wir kurz die bisher messbaren Auswirkungen des Klimawandels und diskutieren die Prognosen der Wissenschaft für die nächsten 100 Jahre.
Hitze
Der in Klimadebatten häufig fallende Begriff »Hitzetote« suggeriert, dass Menschen in heißen Regionen disproportional sterben. Diese Annahme lässt sich überprüfen. In Deutschland liegt die Jahresmitteltemperatur bei etwa 9 Grad, in Singapur und im Niger bei grob 27 Grad; die mittlere Lebenserwartung beträgt hierzulande 79 Jahre, in Singapur jedoch 81 Jahre und im Niger nur 52 Jahre. Folglich entscheidet nicht die Jahresmitteltemperatur darüber, wie lange die Menschen leben, sondern das Wohlstandsniveau. Im armen Niger sterben sie früh, während sie im reichen Deutschland und Singapur alt werden. Der Begriff »Hitzetote« ist daher falsch. Richtiger wäre, von »Armutstoten« zu sprechen. In vielen Regionen der Welt wird es notwendig werden, sich auf vermehrte und intensivere Hitzeperioden einzustellen. Dazu gehört, die Häuser besser zu isolieren und Klimaanlagen insbesondere für gefährdete Menschen zu installieren. Angesichts der zu erwartenden Hitzeperioden muss zudem Strom bezahlbar bleiben. Teure Energie ist besonders in Zeiten von Hitzewellen unsozial.
Meeresspiegelanstieg
Der Anstieg des Meeresspiegels ist eine der gravierendsten Folgen der Klimaerwärmung. Zurzeit klettert er jedes Jahr um knapp vier Millimeter höher.2 Die Rate ist in den letzten Jahrzehnten schneller geworden und wird sich vermutlich weiterhin beschleunigen. Seriöse Modellrechnungen sagen in Abhängigkeit von der Entwicklung der globalen Treibhausgasemissionen einen Anstieg zwischen 50 und 90 Zentimeter bis ins Jahr 2100 vorher.3 Doch das ist ein Problem, das sich mit entsprechenden technischen Maßnahmen lösen lässt. Selbst Küstenländer wie die Niederlande oder Bangladesch können dem Anstieg zum Beispiel mit Deichen begegnen. Eine Planung über einen Zeitraum von 100 Jahren hinaus ergibt wenig Sinn, denn bis dahin wird sich die Welt weiter verändert haben. Das Öl geht irgendwann zur Neige, ähnlich sieht es beim Erdgas aus. Vielleicht hat die Menschheit bis dahin das Klimaproblem in den Griff bekommen. Für die unmittelbare Zukunft ist der Meeresspiegelanstieg jedenfalls ein überschaubares Problem.
Stürme
Die Zahl der Stürme, Zyklone und Hurrikans hat global weder ab- noch zugenommen, sondern ist innerhalb der Schwankungsbreite ziemlich konstant.4 Das Gleiche gilt für die Gesamtenergie aller Stürme, ein Maß für ihre mittlere Stärke. In einzelnen Regionen wie etwa im Nordatlantik sind Hurrikans messbar häufiger geworden, aber in anderen Regionen der Welt wie beispielsweise im Pazifik dafür konstant geblieben oder sogar weniger geworden. In der Summe hat sich die Zahl und Stärke der Stürme weltweit also bisher nicht messbar verändert. Der Grund dafür liegt in der Natur der Sache: Wind entsteht durch Temperaturunterschiede, nicht durch eine gleichmäßige Temperaturzunahme. Infolge der globalen Erwärmung sinkt die Differenz zwischen den hohen Breiten, die sich relativ stark aufheizen, und den tropischen Regionen. Daher ist es sogar möglich, dass die Zahl und Stärke der Stürme mit weiter fortschreitender Erwärmung abnimmt. Umgekehrt war die Sturmaktivität in der Hochphase der Eiszeiten außergewöhnlich ausgeprägt.5
Neben den großräumigen Stürmen gibt es auch lokale Varianten wie Tornados, die anderen Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Ihre Häufigkeit hat bis 1990 stark zugenommen, scheint sich aber seither auf einem hohen Niveau stabilisiert zu haben.6 Solche Wirbelstürme richten erhebliche Zerstörungen an, insbesondere in Wohngebieten mit vielen Holzbauten. Angesichts der fortschreitenden Erwärmung müssen daher die Bauvorschriften in den Regionen, in denen es öfter zu Tornados kommt, der Notwendigkeit stabilerer Gebäude angepasst werden.
Dürren
Das Leben auf den Kontinenten ist darauf angewiesen, dass der Wind die Feuchtigkeit vom Meer ins Landesinnere transportiert. Tut er das nicht, setzen zunächst Dürren ein und über kurz oder lang wird das Land zur Wüste. So geschah es vor rund 3 000 Jahren in der Sahara. Vorher war die Region eine Feuchtsavanne mit Flüssen, Seen und Wäldern. Aber durch kleine Schwankungen der Erdbahnparameter änderten sich die Strömungsmuster und der Monsun trieb die Regenwolken nicht mehr weit genug in das Innere Nordafrikas hinein.
Aufgrund des menschengemachten Klimawandels kommt es nun in bestimmten Regionen zu vermehrten Dürren, obwohl in einem wärmeren Klima die Erde generell feuchter wird. Denn mehr Hitze bedeutet, dass mehr Wasser in den Ozeanen verdampft. Trotzdem führt eine globale Erwärmung nicht überall zu einem feuchteren Klima; vielmehr verschieben sich die Klimazonen der Erde zu höheren Breiten. Das betrifft auch den Wüstengürtel am nördlichen Wendekreis, zu dem die Sahara gehört. Im Sommer der Nordhalbkugel geraten nun Teile Südeuropas in diese Klimazone, wodurch es möglicherweise lange Monate nicht regnet. In der Folge kommt es zu Waldbränden in Portugal, Spanien, Südfrankreich, Italien und Griechenland. Im Winter regnet es dann zwar wieder ausreichend, aber im Sommer besteht zunehmend die Gefahr von Dürren. Der Südwesten der USA, also Kalifornien und die umliegenden Bundesländer, leidet unter dem gleichen Phänomen wie Südeuropa. Die Menschen in diesen Regionen müssen sich auf die Klimaveränderung einstellen und mit dem Wasser haushalten, auch angesichts der strukturellen Tatsache, dass die Landwirtschaft dort ein wichtiger Wirtschaftszweig ist.