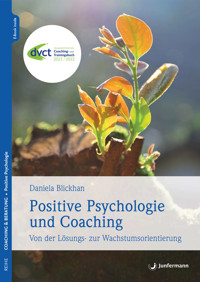44,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Junfermann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Umfassender Überblick über Themen, Konzepte und Interventionen der Positiven Psychologie Der neue wissenschaftliche Ansatz der Positiven Psychologie untersucht Faktoren eines erfüllten und gelingenden Lebens. Er erforscht, wie Menschen ihre Stärken entwickeln und sich selbst, ihr Umfeld und die Gesellschaft als Ganzes voranbringen können. Zentrale Fragen lauten: • Warum ist Glück mehr als die Abwesenheit von Unglück? • Wie lässt sich Zufriedenheit definieren, messen und fördern? • Wie kann man positive Gefühle nutzen, um auch mit widrigen Lebensumständen gut umzugehen? • Was macht nachhaltig leistungsfähig? Die Interventionen der Positiven Psychologie zielen darauf ab, positive Emotionen, Lebenszufriedenheit und Leistungsfähigkeit zu fördern. Daniela Blickhan gibt einen umfassenden Überblick über Themen, Konzepte und Interventionen der Positiven Psychologie und ihre Anwendung in Coaching und Persönlichkeitsentwicklung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Daniela BlickhanPositive Psychologie – ein Handbuch für die Praxis
Über dieses Buch
Das Grundlagenbuch zur Positiven Psychologie
Die Positive Psychologie ist die Wissenschaft des gelingenden Lebens und Arbeitens. Sie untersucht, wie Menschen ihre Stärken einsetzen und sich selbst, ihr Umfeld und die Gesellschaft voranbringen können. Interventionen der Positiven Psychologie zielen darauf ab, persönliches Wachstum, Lebenszufriedenheit und Leistungsfähigkeit zu fördern.
Zentrale Fragen lauten:
Warum ist Glück mehr als die Abwesenheit von Unglück? Wie lässt sich Zufriedenheit definieren, messen und fördern? Wie helfen positive Gefühle dabei, auch mit widrigen Lebensumständen gut umzugehen? Was nützt der Fokus auf Stärken in Beruf und Alltag?Mit diesem Buch gibt Daniela Blickhan einen umfassenden Überblick über das vielfältige Gebiet der Positiven Psychologie. Für die überarbeitete Auflage hat die Autorin neue Forschungsergebnisse einbezogen und zentrale Konzepte wie z. B. Flourishing noch stärker herausgearbeitet.
Dr. Daniela Blickhan, Dipl.-Psych., Coach und Trainerin, leitet seit mehr als 25 Jahren das INNTAL INSTITUT. Sie bietet dort Ausbildungen in Positiver Psychologie, NLP und Systemischem Coaching an. In ihrem Unternehmen Positive Business – Dr. Daniela Blickhan & Partner übersetzt sie die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Positiven Psychologie für die Anwendung in Führung und Zusammenarbeit.
Copyright: © Junfermann Verlag, Paderborn 2015
2., überarbeitete Auflage 2018
Coverfoto: © trixi wolfseher/like.eis.in.the.sunshine – Photocase
Covergestaltung / Reihenentwurf: Junfermann Druck & Service GmbH & Co. KG, Paderborn
Satz, Layout & Digitalisierung: Junfermann Druck & Service GmbH & Co. KG, Paderborn
Alle Rechte vorbehalten.
Erscheinungsdatum dieser eBook-Ausgabe: 2018
ISBN der Printausgabe: 978-3-95571-832-9
ISBN dieses E-Books: 978-3-95571-361-4 (EPUB), 978-3-95571-363-8 (PDF), 978-395571-362-1 (MOBI).
Geleitwort von Prof. Michael Eid
Wer möchte es nicht: Ein langes und glückliches Leben führen, ein Leben, in dem die eigenen Stärken zum Tragen kommen, sich die Erwartungen und Hoffnungen erfüllen; ein Leben, dessen Herausforderungen man angemessen meistern kann; ein Leben, das sinnvoll erscheint und Spaß macht; ein Leben, dessen negative Seiten eine Herausforderung darstellen, an denen man wachsen kann; ein Leben, das trotz Aufs und Abs in einer positiven Lebensbilanz mündet?
Obwohl die Suche nach einem gelingenden Leben Menschen in vielen Epochen und Kulturen begleitet, hat sich die Psychologie erst relativ spät dieser Thematik ange- nommen. Über viele Jahrzehnte hinweg hat sie sich vor allem mit negativen Gefühlen, mit Problemen und psychischen Störungen beschäftigt. Erst in den letzten 30 Jahren ist das subjektive Wohlbefinden zunehmend in den Mittelpunkt der psychologischen Forschung gerückt. Und mit der Begründung des Faches der Positiven Psychologie vor weniger als 20 Jahren hat sich die Psychologie auch zunehmend der Frage geöffnet, wie die Erkenntnisse der Forschung zum subjektiven Wohlbefinden, zu positiven menschlichen Eigenschaften und zu positiven Institutionen für die Anwendungspraxis genutzt werden können und in welcher Weise die Psychologie Methoden an die Hand geben kann, um Menschen auf ihrem Weg zu einem glücklichen Leben zu begleiten.
Im Gegensatz zu anderen Ländern gehört die Positive Psychologie in Deutschland noch nicht zu den etablierten Fächern. Es besteht aber ein großes Interesse an ihren Erkenntnissen, insbesondere in der psychologischen Praxis. Die Forschung der letzten Jahre hat gezeigt, dass Interventionen der Positiven Psychologie das Wohlbefinden steigern können und dass solche Interventionen insbesondere auch in die Psychotherapie integriert werden sollten, um Rückfälle zu vermeiden. Trotz des zunehmenden Interesses an der Positiven Psychologie gibt es im deutschsprachigen Raum kaum Arbeiten, die dieses Gebiet wissenschaftlich fundiert, aber anwendungsbezogen darstellen. Mit dem vorliegenden Buch trägt Daniela Blickhan dazu bei, diese Lücke zu füllen.
Ihr Buch, als Handbuch für die Anwendungspraxis konzipiert, stellt die aktuellen Befunde der Positiven Psychologie klar und verständlich dar. Anschaulich werden etablierte Erkenntnisse der Psychologie vermittelt und verschiedene Möglichkeiten zur Selbstreflexion und zur Anwendung des theoretisch erworbenen Wissens im eigenen Leben beschrieben.
Daniela Blickhan ist es wichtig, ihr Buch in der wissenschaftlichen Psychologie zu verankern und damit mit einigen Vorurteilen gegenüber dem Fach der Positiven Psychologie aufzuräumen. Sie stellt klar, dass es sich bei der Positiven Psychologie um eine Disziplin der Psychologie handelt, die anhand wissenschaftlicher Methoden Interventionen entwickelt und überprüft, um sich somit eine evidenzbasierte Grundlage zu schaffen. Sie hebt hervor, dass Positive Psychologie nicht einfach positives Denken ist, gerade auch nicht das Leugnen von negativen Gefühlen und negativen Aspekten im eigenen Leben. Vielmehr geht es bei der Positiven Psychologie darum, bisherige Erkenntnisse der Psychologie zu ergänzen, und zwar um Aspekte, die sich auf positive menschliche Entwicklung beziehen.
Daniela Blickhan hat die Themen ihres Buches sinnvoll ausgewählt und sie zeigt die große Breite der Positiven Psychologie auf. Ihr gelingt es hierbei, die wesentlichen Erkenntnisse up to date darzustellen, ohne in einen akademischen Duktus zu verfallen. Hierbei kommt ihr ihre langjährige Praxiserfahrung zugute. Ihr gelingt es in hervorragender Weise, die wissenschaftlichen Erkenntnisse den Leserinnen und Lesern anwendungsbezogen zu vermitteln, ohne dass breite psychologische Vorkenntnisse notwendig sind. Das Buch zeigt sehr anschaulich, wie die Erkenntnisse der Positiven Psychologie für die Anwendungspraxis genutzt werden und wie sie Menschen helfen können, auf dem Weg zum Aufblühen wesentliche Schritte voranzugehen. Es sollte daher in jeder psychologischen Praxis stehen.
Prof. Dr. Michael Eid, Freie Universität Berlin
Berlin, im November 2014
Vorwort zur 2., überarbeiteten Auflage
Die Positive Psychologie ist eines der am schnellsten wachsenden Forschungsgebiete der Psychologie und eines mit einem sehr ausgeprägten Anwendungsbezug. Ihre Konzepte und Interventionen sind heute längst nicht mehr nur in psychologischen Fachkreisen bekannt, sondern finden Anwendung in Coaching und Psychotherapie, Führung und Personalentwicklung, Bildung, Erziehung und Familie.
Positive Psychologie – ein Handbuch für die Praxis hat sich in kurzer Zeit (die Erstauflage erschien im April 2015) als deutschsprachiges Übersichtswerk etabliert. Leserinnen und Leser sollen einen Einblick in dieses vielfältige Forschungsgebiet erhalten und gleichzeitig einen Überblick. Deshalb sind in dieser zweiten Auflage zahlreiche, teils wegweisende Neuerungen zu finden, die zeigen, wie lebendig sich das Feld der Positiven Psychologie entwickelt:
Die Gliederung der Themen wurde neu gestaltet. Die Wissenschaft „zerlegt“ subjektive Erfahrung und betrachtet einzelne psychologische Themen isoliert, um diese verstehen und erforschen zu können. Die persönliche Erfahrung ist jedoch immer ganzheitlich und integrativ: Sie verbindet verschiedene Facetten und lässt sie uns als Ganzes erleben. Die neue Reihenfolge der Kapitel orientiert sich mehr an diesen inneren Zusammenhängen der Themen, inspiriert durch Erfahrungsberichte und Feedbacks im Zuge der mittlerweile zahlreichen Ausbildungskurse in Positiver Psychologie. Ich hoffe, dass mit der neuen Gliederung der intuitive Zusammenhang der verschiedenen Themen für Sie als Leserin und Leser noch leichter nachvollziehbar wird.
Die Würdigung von Viktor Frankl als „Großvater der Positiven Psychologie“ bekommt in der Neuauflage mehr Raum. Bereits ein halbes Jahrhundert, bevor Martin Seligman 1998 die Positive Psychologie begründete, forderte Frankl eine sogenannte „Höhenpsychologie“ als Ergänzung zur „Tiefenpsychologie“. Damit nahm er Seligmans Kritik an der Psychologie als „Reparaturbetrieb“ vorweg. Dieser rief die wissenschaftliche Psychologie dazu auf, sich mit den gelingenden Aspekten des menschlichen Lebens zu befassen: „Not getting it wrong does not equal getting it right“ (Seligman 2018, S. 4). Etwas nicht falsch zu machen bedeutet noch nicht, es richtig zu machen.
Sehr viele Veränderungen finden sich im Kapitel 2, in dem es u. a. um das Flourishing geht. Um die Vielschichtigkeit dieses zentralen Konzepts der Postiven Psychologie deutlich zu machen und vor allem seine verschiedenen Facetten leichter verständlich zu erklären, habe ich speziell den Abschnitt zu Florishing komplett überarbeitet. Es wurden neue Flourishing-Ansätze und -Fragebögen integriert und ein tabellarischer Vergleich der vier meistgenutzten Konzepte zum Verständnis von Flourishing integriert. Von mir selbst kann ich sagen, dass ich in den letzten Jahren ein tieferes Verständnis von Flourishing entwickelt habe. Intuitiv und durch persönliche Erfahrung war mir bereits vor meinem Studium der Positiven Psychologie klar, wie wichtig dieses Thema ist. Doch erst die inhaltliche Auseinandersetzung mit den verschiedenen Konzepten im Rahmen meiner Dissertation und die ausführlichen, kritischen und herausfordernden Diskussionen mit meinem Doktorvater Michael Eid haben mich dieses Konzept in seiner vollen Tiefe und Breite verstehen lassen. Entsprechend habe ich für dieses Kapitel auch Abschnitte aus meiner Dissertation adaptiert und möchte so einen Beitrag leisten, um Flourishing als zentrales Konzept der PP und Grundlage und Ergebnis eines gelingenden Lebens zu verstehen. Auf dieser Grundlage habe ich in Kapitel 11 ein neues Modell für Feedback beschrieben: wie sich dieses Verständnis menschlicher Entwicklung ganz praxisnah für die Förderung positiver Entwicklung nutzen lässt.
Aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der Stärkenforschung haben wir (meine Tochter Alexandra Blickhan als Gastautorin und ich) für Sie in Kapitel 4 zusammengefasst. Ich freue mich sehr, dass wir Ihnen hier eine neue und eingängige Klassifikation der 24 Charakterstärken vorstellen können, die 2017 erstmals auf dem PP-Weltkongress in Montreal präsentiert wurde. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in unseren Ausbildungen bestätigen durchweg, wie stimmig und praxistauglich ihnen diese Einteilung der Stärken in die drei Bereiche „Kopf, Herz und Hand“ erscheint. Wir haben neue Studien und Konzepte für Sie aufbereitet, die dieses spannende Thema der Stärken noch leichter für die Praxis anwendbar machen.
Um die Entwicklung auf dem Feld der PP-Interventionsforschung zu zeigen, wurden neuere Metastudien aufgenommen und eine tabellarische Übersicht über Validierungsstudien im Anhang ergänzt. Das Literaturverzeichnis ist noch weiter gewachsen. Wir haben neuere Bücher und Studien integriert, zum Beispiel Ryan Niemiecs hervorragendes Buch der Stärkeninterventionen, Character strengths interventions und Gerald Hüthers Raus aus der Demenzfalle, in der er sich auf die klassische „Nonnenstudie“ bezieht. Zahlreiche redaktionelle Änderungen, Präzisierungen im Ausdruck und Vereinfachungen in der Darstellung tragen hoffentlich dazu bei, dass das Lesen dieses Buches sowohl das Verständnis bereichert als auch Freude macht.
Martin Seligman war zweifelsfrei derjenige, der die Positive Psychologie in den Fokus der wissenschaftlichen Psychologie geholt und ihre beeindruckende Entwicklung maßgeblich gefördert hat. Sein Name wird immer mit der PP verbunden sein, auch wenn er sich nun allmählich von der Forscherbühne zurückzieht. Auf der Weltkonferenz Positive Psychologie in Montreal hielt er 2017 eine beindruckende Keynote, in der er sein Forschungs-Erbe zusammenfasste. In seiner Autobiografie Hope Circuit (2018) führt er diese Gedanken weiter aus, zieht die Bilanz eines sehr produktiven Forscherlebens und verbindet das mit einer Beschreibung von 50 Jahren Psychologiegeschichte. Eine Zusammenfassung von Seligmans Keynote wurde als Nachwort in diese Neuauflage aufgenommen, um diesen Bogen sichtbar zu machen.
In meiner Dissertation bin ich der Frage nachgegangen, wie sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer während ihrer Ausbildung in Angewandter Positiver Psychologie persönlich verändern. Wie wachsen Lebenszufriedenheit, positive Gefühle, Flourishing und wie verringert sich ihr Risiko für Depression und Burnout im Vergleich zu Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer klassischen Coachingausbildung? Die statistischen Ergebnisse unterstützen das, was ich in vielen Kurstagen hören, sehen und erleben durfte: Die Positive Psychologie kann in der Tat ganz praktisch und spürbar dazu beitragen, dass Menschen ein erfülltes, gelingendes Leben führen, in dem sie gut mit sich selbst und mit anderen umgehen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen!
Daniela Blickhan Juli 2018
Anmerkung:In diesem Buch wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit vorwiegend die männliche Form verwendet. Ich bitte alle Leser*innen darum, sich gleichermaßen angesprochen zu fühlen.
1. Psychologie und Positive Psychologie
1.1 Psychologie als Wissenschaft
Die Positive Psychologie ist die Wissenschaft vom gelingenden und erfüllten Leben und damit die erste Disziplin, die sich wissenschaftlich mit der Frage beschäftigt, wie psychisches Wohlbefinden und persönliche Entwicklung für alle Menschen unterstützt und aufrechterhalten werden können. Sie ist eines der jüngsten und neuesten Forschungsgebiete der akademischen Psychologie.
Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit vor Krankheit. Das hat die WHO im Rahmen der International Health Conference bereits 1946 in ihrer Definition betont: Gesundheit ist vollständiges physisches, geistiges und soziales Wohlbefinden.
Dieser Ansatz fordert sowohl die Medizin als auch die klinische Psychologie heraus, denn lange Jahre standen dort die Diagnose und Linderung von Krankheit und Störung im Fokus. Doch genauso wie Gesundheit mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit, umfasst seelische Gesundheit mehr als die Abwesenheit psychischer Probleme oder Störungen. Dennoch fokussiert die Mehrheit der (klinischen) psychologischen Angebote auch heute noch vor allem auf den Abbau negativer Symptomatik, eine bessere Bewältigung des Alltags und damit die Reduzierung des erlebten Leidensdrucks bei klinisch kranken Patienten. Um die Ziele und Ansätze der Positiven Psychologie innerhalb der psychologischen Forschung umfassend einordnen zu können, ist es hilfreich, einen kurzen Ausflug in die Geschichte der Psychologie zu machen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, auf welchen Grundlagen sie aufbaut und wie die Positive Psychologie als eigenes Forschungsfeld die klassische Psychologie sinnvoll ergänzt.
1.1.1 Geschichte und Forschungsgebiete der Psychologie
Psychologische Schulen
Die Psychologie will „verstehen und erkennen, wie Menschen ihr persönliches Leben in ihren sozialen Beziehungen und Gemeinschaften erfahren, verstehen und durch ihr Verhalten organisieren können“ (Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen 2018). Psychologie als Wissenschaft ist seit etwa 1875 als eigenständiges wissenschaftliches Fach an Universitäten etabliert. Die Wurzeln der naturwissenschaftlichen Psychologie liegen in Europa, genauer gesagt in Deutschland. Wilhelm Wundt gründete 1879 in Leipzig das weltweit erste Institut für experimentelle Psychologie, das sich mit Sinneswahrnehmung, Denkprozessen und Erinnerung befasste. Wundts Vorlesungen umfassten ein breites Spektrum von Logik und Methodenlehre, Psychologie der Sprache, Anthropologie, experimenteller Psychologie und Neurophysiologie bis hin zu historischer und moderner Philosophie. Wundt gilt als Begründer der Psychologie im Sinne einer eigenständigen Wissenschaft. Er stellte hohe Ansprüche an wissenschaftliche Forschung und kritisierte die „unkritische Vulgärpsychologie“ (Wundt 1906, S. 15), die sich allein auf persönliche Lebenserfahrung beruft. Wundt ging davon aus, dass sich die innere Erfahrung des Menschen experimentell untersuchen lässt, und führte die Introspektion als psychologische Forschungsmethode ein.
Die Psychologie in Amerika fokussierte sich zunächst eher auf philosophisch verwurzelte Konzepte wie das Bewusstsein und das Selbst. Als Begründer der amerikanischen Psychologie und als einer der wichtigsten Vertreter des philosophischen Pragmatismus gilt William James. Er war von 1876 bis 1907 Professor für Psychologie und Philosophie an der Universität Harvard, und auf ihn geht die Einführung des Fachbereichs Psychologie an US-amerikanischen Universitäten zurück. Seine psychologischen Theorien nahmen Grundideen der Gestaltpsychologie und des Behaviorismus vorweg. James Lehrbuch Principles of Psychology erschien 1890 in zwei Bänden mit 1400 Seiten und bot eine Zusammenfassung der Psychologie des 19. Jahrhunderts in nahezu ihrer ganzen Breite.
Auch James fasste die Psychologie naturwissenschaftlich auf und verband in seiner Theorie Bewusstseinszustände und körperliche Vorgänge. Körper und Geist waren für ihn zusammengehörige Teile eines einheitlichen Organismus. Damit hob er den Gegensatz von Leib und Seele auf und ersetzte ihn durch einen psycho-physischen Funktionalismus. Er arbeitete mit den Methoden der Introspektion, des Experiments und des systematischen Vergleichs (James 1950).
James stellte keine einheitliche Theorie auf, sondern formulierte vielmehr einen offenen Katalog an Forschungsfragen. Die empirische Psychologie betrachtete er als Vorstufe einer einheitlichen Humanwissenschaft (James 1950). Bis heute relevante Erkenntnisse von William James sind etwa die sogenannte James-Lange-Theorie der Emotionen und seine Differenzierung des Selbst in das Ich als den eigenen Bewusstseinsstrom (englisch „I“) und das Selbst als reflektierbare Identität (englisch „Me“).
Um die Jahrhundertwende (ca. 1890) begann die Entwicklung des Behaviorismus, der beobachtbares Verhalten in den Mittelpunkt und mentale Vorgänge in den Hintergrund stellte. Das Verhalten von Menschen und Tieren sollte mit objektiven naturwissenschaftlichen Methoden – also ohne Introspektion – erforscht und erklärt werden. Geistige Prozesse wurden nicht näher untersucht, vielmehr wurde jede Form der Verarbeitung, die zwischen einem (beobachtbaren) Reiz und der (ebenfalls beobachtbaren) Reaktion stand, vernachlässigt. Alle Vorgänge zwischen Reiz und Reaktion spielten sich für die Behavioristen in einem nicht zugänglichen Raum ab, den sie „black box“ nannten.
Reiz→black box→Reaktion
Der Begriff Behaviorismus geht auf John B. Watson zurück, der ihn erstmals 1913 in einem Fachaufsatz verwendete.
Zeitgleich zur Entstehung des Behaviorismus in den USA entwickelte Sigmund Freud in Wien die Psychoanalyse, einen konträren Ansatz, der vor allem auf Introspektion beruhte. In den USA waren die Vertreter des Behaviorismus lange Jahre die einflussreichsten Verhaltensforscher an den Universitäten und entschiedene Gegner der gleichzeitig aufkommenden Psychoanalyse.
Mitte des 20. Jahrhunderts wurden mehrere neue Strömungen in der Psychologie relevant, deren Einflüsse bis heute wirksam sind. Die Methode der Introspektion wurde zum Grundstein für die Kognitionspsychologie bzw. kognitive Psychologie. Die sogenannte Kognitive Wende beruhte auf dem Wunsch nach einem wissenschaftlichen Theorieansatz über das Denken, das die Behavioristen in die sogenannte black box ausgelagert und damit aus ihrer Forschung ausgeklammert hatten.
Die kognitive Psychologie wollte in ihren Anfangsjahren auf der Grundlage der ganzheitlich ausgerichteten Gestaltpsychologie1 in die black box hineinschauen und dabei die inzwischen besser erforschten biologischen Bedingungen berücksichtigen, auf der Grundlage des Menschen als informationsverarbeitendem Organismus. Mit der Entwicklung der Computerwissenschaften, speziell auch im Feld der künstlichen Intelligenz, wurden neue wissenschaftliche Perspektiven formuliert, die den menschlichen Verstand mit einer Computer-Metapher beschreiben. Die Methodik der Kognitionspsychologen beschränkte sich zunächst auf Experimente im Labor, bezog jedoch seit den 1970er-Jahren reale Situationen und Feldstudien ein, um übergreifende Theorien zu entwickeln. Heutzutage werden bildgebende Verfahren genutzt, um komplexe neurophysiologische Funktionen besser zu verstehen, die den Kognitionen zugrunde liegen. Hier hat die Kognitive Psychologie eine Schnittstelle mit der modernen Hirnforschung.
Die Humanistische Psychologie mit ihren Hauptvertretern Abraham Maslow und Carl Rogers betrachtet den Menschen als grundsätzlich gesunde, sich selbst entwickelnde und schöpferische Persönlichkeit. Die Wurzeln der Humanistischen Psychologie liegen im Humanismus und im Existenzialismus (Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger), in der Phänomenologie (Edmund Husserl) sowie in der funktionellen Autonomie (Gordon Allport). Carl Rogers (1961) betrachtete den Menschen als Individuum, das potenziell alle Möglichkeiten besitzt, um sich selbst verstehen und seine Selbstkonzepte, seine Grundeinstellung und sein Verhalten selbstgesteuert verändern zu können. Förderliche psychische Einstellungen können helfen, dieses Potenzial zu entfalten. Psychische Störungen entstehen, wenn Umwelteinflüsse oder hinderliche Einstellungen die Selbstentfaltung blockieren (Rogers 1961). Rogers entwickelte auf dieser Grundlage die klientenzentrierte Psychotherapie.
Grundannahmen der Humanistischen Psychologie sind:
Der Mensch ist mehr als die Summe seiner Teile.
Der Mensch lebt in zwischenmenschlichen Beziehungen.
Der Mensch lebt bewusst und kann seine Wahrnehmungen schärfen.
Der Mensch kann entscheiden.
Der Mensch ist intentional.
(zitiert nach Yalom & Gremmler-Fuhr 1989, S. 30 f.)
Der Humanistischen Psychologie nahe stehen Erich Fromm (humanistische Psychoanalyse), Hans-Werner Gessmann (Psychodrama) und Fritz Perls (Gestalttherapie). Viktor E. Frankl, der Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse, könnte zu Recht als „Großvater der Positiven Psychologie“ bezeichnet werden, da er in Abgrenzung zum tiefenpsychologischen Vorgehen seiner Zeit energisch eine Höhenpsychologie einforderte und damit im Kern das inhaltlich vorwegnahm, was die Positive Psychologie heute empirisch erforscht. Schade, dass Frankl in der englischsprachigen psychologischen Fachliteratur bis heute so wenig rezipiert wird. Eine Ausnahme bilden dabei die existenzialistischen Psychologen, allen voran Paul Wong, der unter Berufung auf Frankls Ideen eine Positive Psychologie 2.02 fordert, die die Gesamtheit des menschlichen Erlebens umfasst und nicht nur die positive Seite3. Im deutschsprachigen Raum wird der Zusammenhang zwischen Frankls überzeugender Beschreibung des Menschen als sinn- und wachstumsorientiert gerade in jüngerer Zeit mehr und mehr betont.
Nach der Beschreibung dieser klassischen psychologischen Schulen sollen nun wesentliche Forschungsgebiete der modernen Psychologie kurz charakterisiert werden.
Forschungsgebiete der Psychologie
Die Sozialpsychologie erforscht, wie Menschen mit ihrer Umwelt und anderen Menschen interagieren. Hier begegnen sich die Forschungsgebiete der Psychologie und Soziologie. Die Sozialpsychologie untersucht Auswirkungen der tatsächlichen oder vorgestellten Gegenwart anderer Menschen auf das Erleben und Verhalten des Individuums. Ebenso wie die Humanistische und die Kognitive Psychologie geht sie davon aus, dass Menschen ihre eigene Realität konstruieren und dass das gesamte Erleben und Verhalten von sozialen Beziehungen beeinflusst wird.
Entwicklungspsychologie ist die Wissenschaft von der psychologischen Reifung und der Entwicklung von der Kindheit bis ins hohe Alter. Die Entwicklungspsychologie beeinflusst die Pädagogik zum Beispiel durch Ergebnisse aus der Lernforschung, Moralentwicklung und Bindungsforschung.
Als weiteres Forschungsgebiet bildete sich gegen Ende des 20. Jahrhunderts die differenzielle Psychologie oder Persönlichkeitspsychologie im engeren Sinn heraus. Sie beschäftigt sich mit der Frage, was die Persönlichkeit eines Menschen ausmacht, wie diese sich messen lässt, und aus welchen Bestandteilen sich zum Beispiel Intelligenz zusammensetzt. Auch die Frage der „Normalität“ gehört in dieses Feld. Die differenzielle Psychologie untersucht Unterschiede zwischen einzelnen Personen, innerhalb einer Person und weiterhin die Frage, wie sich Menschen in ihrer Veränderlichkeit unterscheiden und wie man diese Veränderung beeinflussen kann, z. B. durch Erziehung, Psychotherapie oder andere Maßnahmen.
Neben diesen Grundlagenfächern beinhaltet die wissenschaftliche Psychologie Methodenfächer (empirische Forschungsmethoden, die auch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen genutzt werden, etwa in der Pädagogik, Medizin oder Soziologie) und die Anwendungsfächer der klinischen Psychologie, der Organisations- und Wirtschaftspsychologie sowie der Pädagogischen Psychologie.
Die klinische Psychologie beschäftigt sich mit der Diagnose, Behandlung und Vorbeugung psychischer Störungen und Krankheiten. Deren Grundlagen werden ebenso wissenschaftlich untersucht wie ihre Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten. Die klinische Psychologie berücksichtigt dabei kognitive und emotionale Aspekte und außerdem biologische, soziale, entwicklungs- und verhaltensbezogene Gesichtspunkte. Das relativ neue Feld der Gesundheitspsychologie befasst sich mit der Erhaltung der Gesundheit, der Erforschung und Entwicklung gesundheitsfördernder Maßnahmen und der Prävention4.
Die Pädagogische Psychologie arbeitet im Bereich Schule und Erziehung, um Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Lernprozessen zu unterstützen. In dieses Feld gehören zum Beispiel die Begabungsdiagnostik sowie die Lehr- und Lernforschung.
Die Arbeits- und Organisationspsychologie befasst sich mit psychologischen Fragen im beruflichen Kontext und mit Wechselwirkungen zwischen Berufstätigen und ihren Arbeitsbedingungen. Im Feld der Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie betrifft dies zum Beispiel Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit, Eignungsdiagnostik, Personalbeurteilung und Konfliktmanagement. Weitere Themen sind Ergonomie, Arbeitssicherheit, psychologische Unfallforschung und die Auswirkung moderner Technologien auf den Menschen5. Arbeits- und Organisationspsychologen arbeiten zum Beispiel in der Personalauswahl, Personalentwicklung, in der betrieblichen Weiterbildung, in der Organisationsentwicklung oder im betrieblichen Gesundheitsmanagement.
Es gibt zahlreiche weitere Anwendungsfelder der Psychologie, und diese decken einen breiten Raum ab: z. B. Behavioral Finance, Medien-, Rechts-, Werbepsychologie, Kulturvergleichende-, Geronto-, Sport-, Umwelt-, Verkehrs oder politische Psychologie. Die moderne Psychologie6 überschneidet sich in ihrer Anwendung mit vielen anderen Fachgebieten, zum Beispiel mit der Medizin, den Neurowissenschaften, der Informatik, Pädagogik, Soziologie, Anthropologie, den Wirtschafts- und Rechtswissenschaften.
Psychologie vermittelt Menschen also ein Verstehen, konkrete Anleitungen und Lernhilfen dazu, wie sie z. B.
… sich gegenseitig gut verstehen, fair miteinander reden und ihre Wünsche und Anliegen in Gegenseitigkeit und miteinander regeln können.… lernen, effektiv, motivierend und leistungsfreundlich gestalten können.… Gesundheit und Wohlbefinden fördern und schädlichen Stress vermeiden können.… persönliche Fähigkeiten für ihr privates Leben und ihre Arbeit optimal nutzen können.… Ängste überwinden, Verlusterfahrungen und traumatische Erfahrungen bewältigen können.… Kaufverhalten erkennen und beeinflussen können.… eine Vielzahl von sozialen Prozessen in verschiedenen Lebensbereichen menschenfreundlich gestalten können.Quelle: BDP Berufsverband Deutscher Psychologen (2014)
1.2 Positive Psychologie
1.2.1 Entwicklung der Positiven Psychologie
Neben der breiten Grundlagenforschung der Allgemeinen Psychologie, etwa im Bereich Wahrnehmung, Denken und Lernen, konzentrierte sich die klinische psychologische Forschung nach dem Zweiten Weltkrieg aus praktischen und gesellschaftlichen Gründen vor allem auf das Erkennen und Behandeln von seelischen Störungen. Staatliche Stellen förderten schwerpunktmäßig Forschungsprojekte, die dabei helfen sollten, die psychische Gesundheit der vom Krieg Betroffenen wiederherzustellen. Die Psychologie wurde – vor allem in den USA – mehr und mehr als Teilbereich der Gesundheitsberufe betrachtet und übernahm inhaltlich das medizinische Krankheitsmodell. Martin Seligman charakterisiert dies als victimology („Opfer-Wissenschaft“), die die „Reparatur“ des Patienten in den Mittelpunkt stellt beziehungsweise die seiner „beschädigten Gewohnheiten, der beschädigten Antriebe, beschädigten Kindheit und beschädigten Gehirne“ (2005a, S. 4). Dieser Forschungsansatz, der vor allem auf psychische Krankheit fokussierte, führte zur Entwicklung definierter Konzepte psychischer Störungen und entsprechender evidenzbasierter, wirksamer Behandlungsmethoden.
Weltweit stehen heute Depressionen in Ländern mit mittlerem oder hohem Einkommen an erster Stelle der Krankheitslast7 (WHO 2008). Sowohl individuell als auch gesellschaftlich betrachtet, stehen wir deshalb vor der Aufgabe, wirksame Methoden zu entwickeln und flächendeckend einzusetzen, damit mehr Menschen in einem Zustand psychischen Wohlbefindens leben können. Doch eine bloße Reduktion depressiver Symptome garantiert weder Lebenszufriedenheit noch Wohlbefinden.
Die einflussreichen Psychologieprofessoren Martin Seligman und Ed Diener forderten deshalb bereits vor der Jahrtausendwende eine Neuausrichtung der psychologischen Forschung und Anwendung. Seligman selbst war durch seine Arbeiten zu den Hintergründen der Depression bekannt geworden (erlernte Hilflosigkeit8), die bis heute Grundlage einer wirksamen psychotherapeutischen Behandlung sind. Psychotherapie kann sich jedoch nicht darauf beschränken, negative Symptome zu lindern, denn die bloße Abwesenheit von Depression bedeutet noch längst nicht Gesundheit. Zentrales Ziel jeder Psychotherapie muss nach Seligman deshalb die Unterstützung von Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit und psychischer Leistungsfähigkeit sein.
Martin Seligman wurde 1998 zum Präsidenten der Amerikanischen PsychologenVereinigung (APA) gewählt, was für amerikanische Psychologen eine der höchstmöglichen Ehrungen darstellt. In seiner Antrittsrede forderte er, dass sich die Psychologie auf ihr „Geburtsrecht“ besinnen und sich mit der Erforschung positiver Emotionen, positiver Eigenschaften und positiver Gemeinschaft befassen solle. Statt weiterhin primär auf Defizite und Krankheit zu blicken, sollten Psychologen sich darauf fokussieren herauszufinden, was das Leben lebenswert macht, und die Voraussetzungen für ein solches Leben schaffen (Seligman, 2005a). Seligman prägte damit die Positive Psychologie als neuen Forschungszweig der akademischen Psychologie.
Positive Psychologie als empirische Wissenschaft begann also offiziell mit Seligmans Ansprache vor der Amerikanischen Psychologen-Vereinigung im Jahr 1998, doch ihre Ursprünge lassen sich viel weiter zurückverfolgen, bis zu den philosophischen Schriften von Aristoteles über Glück, Sinn und Tugend9. Abraham Maslow kann zu Recht als „Großvater der Positiven Psychologie“ bezeichnet werden, da er sowohl den Namen Positive Psychologie geprägt als auch wesentliche Grundprinzipien positiver menschlicher Entwicklung postuliert hat. Bereits 1954 überschrieb er das letzte Kapitel seines Buchs „Motivation und Persönlichkeit“ mit den Worten „Towards a Positive Psychology“. Seiner Ansicht nach müsse die Psychologie positiver und weniger negativ werden. Sie sollte „keine Furcht haben vor den höheren Möglichkeiten der menschlichen Existenz“ (Maslow 1965, S. 27). Dem hätte auch Viktor Frankl zugestimmt, dem folgendes Zitat zugeschrieben wird: „Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum liegt unsere Möglichkeit, unsere Reaktion zu wählen. In unserer Reaktion liegen unser Wachstum und unsere Freiheit.“ Auch wenn umstritten ist, ob Frankl diese Worte genauso gesagt hat oder sich dabei sinngemäß auf Nietzsche bezog, so bringt diese Aussage menschliche Eigenverantwortung und Selbstaktualisierung genau auf den Punkt.
Carl Rogers kann neben Abraham Maslow und Viktor Frankl als dritter „Großvater“ betrachtet werden, da er den Menschen als prinzipiell positiv und entwicklungsfähig betrachtete. Sein Konzept der fully functioning person beschreibt ein Kernkonzept der Positiven Psychologie und ist vergleichbar mit dem Begriff des Aufblühens („Flourishing“). Leider lässt sich „fully functioning“ nur schlecht direkt ins Deutsche übertragen, da hier das Wort „funktionieren“ einen eher negativen Beigeschmack hat. Fully functioning beschreibt volle psychische Leistungsfähigkeit – wobei „Leistung“ hier nicht „Arbeitsleistung“ bedeutet, sondern das ganzheitliche und persönlich sinnstiftende Nutzen des eigenen Potenzials.
Niemals sollte der Begriff einer „Positiven Psychologie“ die Existenz einer „Negativen Psychologie“ implizieren oder die bestehende Psychologie als „negativ“ abwerten. Das lag weder in Maslows Absicht noch in der von Seligman oder anderen Begründern der Positiven Psychologie. Martin Seligman und Christopher Peterson, beides namhafte und einflussreiche Forscher, haben die Positive Psychologie von Anfang an als notwendige und sinnvolle Ergänzung der Psychologie verstanden. Seligman nennt sie einen „weiteren Pfeil im Köcher“ und Christopher Peterson äußert in seinem Grundlagenwerk die Hoffnung, dass die Positive Psychologie in einigen Jahren vollständig in die Psychologie integriert sein wird (Peterson 2006).
Leider wird der wegweisende Beitrag von Maslow, Rogers und Frankl für die Positive Psychologie speziell in der amerikanischen Literatur wenig gewürdigt. Seligman grenzt sich sogar ausdrücklich von der „humanistischen positiven Psychologie“ ab und wirft dieser vor, sie sei nicht empirisch begründet und daher nicht wissenschaftlich (z. B. Seligman & Csikszentmihályi 2000). Im Licht der Tatsache, dass speziell Carl Rogers die empirische Forschung in der Psychotherapie maßgeblich gefördert hat10, erscheint Seligmans Einschätzung jedoch nicht ganz zutreffend. Maslows und Rogers Beitrag zur Positiven Psychologie erfährt in Europa, speziell in England11, übrigens wesentlich mehr Wertschätzung.
Neben der griechischen Philosophie und der Humanistischen Psychologie sind als weitere Grundlagen der Positiven Psychologie folgende Konzepte zu nennen:
Lebenslange Entwicklung (Erik Erikson)
Seelische Gesundheit (Marie Jahoda)
Lebensqualität und Wohlbefinden (Ed Diener, Peter Becker, Beate Minsel)
Ressourcenorientierung (Klaus Grawe, Maja Storch)
1.2.2 Ziele der Positiven Psychologie
Positive Psychologie befasst sich in Theorie und Forschung mit der Frage, was das Leben lebenswert macht. Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, Erfüllung und Sinn im Leben zu finden. Die Positive Psychologie möchte dazu beitragen, dass Menschen ihre Stärken erkennen und einsetzen, positive Gefühle erleben und zu einer positiven Gesellschaft beitragen. Interventionen der Positiven Psychologie fördern Wohlbefinden und Glückserleben, erweitern die persönlichen Ressourcen, helfen beim Einsatz eigener Stärken und tragen zu einem gelingenden Leben bei. In Unternehmen beispielsweise können damit neue Handlungs- und Entwicklungsräume eröffnet und Innovation und Kreativität gefördert werden.
Die Positive Psychologie will also Antworten auf Fragen geben, die über die Jahre nicht nur von Psychologen, sondern von Philosophen, Theologen und Politikern gestellt wurden:
Wie kann man Glück definieren und messen?
Wie lässt sich subjektives Wohlbefinden steigern?
Warum sind manche Menschen oder Gruppen glücklicher als andere?
Was sind unterstützende Faktoren für gelingendes Leben und Arbeiten?
Seligman (2003) beschreibt drei Säulen der Positiven Psychologie: positives Erleben, positive Eigenschaften im Sinne von Tugenden und Charakterstärken und positive Gemeinschaften, die Wachstum erlauben, also „gesunde“ Familien, Wohnumfelder, Schulen und Firmen. In seiner 2018 erschienenen Autobiografie formuliert er sein Verständnis der Positiven Psychologie so: „Das heißt nicht, dass Positive Psychologie guten Charakter verschreiben möchte; sie möchte ihn stattdessen beschreiben, erforschen und fragt, wie er zu fördern sei“ (Seligman 2018, S. 243, Übersetzung durch die Autorin).
Die Positive Psychologie geht von der Annahme aus, dass Menschen ein erfülltes Leben führen und ihrem Leben Sinn geben wollen; dass sie daran interessiert sind, ihre guten Seiten zu entwickeln und somit sich selbst, aber auch die Gesellschaft als Ganzes voranzubringen. Damit richtet sich die Positive Psychologie ausdrücklich nicht nur an Patienten mit psychischen Schwierigkeiten oder Störungen, sondern an alle Menschen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Präventionsarbeit. Hier kann die Positive Psychologie zum Beispiel bei der Vorbeugung von Burnout und Depression einen wesentlichen Beitrag leisten.
1.2.3 Was Positive Psychologie nicht ist
Positive Psychologie ist nicht gleichzusetzen mit „Positivem Denken“
Manche Kritiker werfen der Positiven Psychologie vor, in ihrem Ansatz Esoterik mit einem psychologischen Mäntelchen zu versehen. Dieser Vorwurf basiert in der Regel auf einer Gleichsetzung von Positiver Psychologie mit Positivem Denken. Das „Positive Denken“ im Sinne der amerikanischen Ratgeberliteratur verfügt über keine wissenschaftliche Basis und wirkt möglicherweise auch besser, wenn man daran glaubt. Die Positive Psychologie ist dagegen ein Gebiet der akademischen Psychologie; ihre Theorien, Modelle und Interventionen werden mit wissenschaftlichen Methoden untersucht. Positives Denken ist deshalb nicht mit der Positiven Psychologie gleichzusetzen.
Ein weiteres Missverständnis besteht darin, dass Kritiker behaupten, die Positive Psychologie blende das Negative einfach aus und sei deswegen vor allem „Happyologie“. Dies trifft nicht zu, denn bei der Positiven Psychologie geht es in keiner Weise darum, das Negative im Leben zu ignorieren. Es wird vielmehr in einen neuen Rahmen gesetzt, um gelingendes Leben auch unter widrigen Umständen zu ermöglichen bzw. zu unterstützen. Gleichzeitig soll das Gute und Bereichernde, das bereits im Leben vorhanden ist, betrachtet und gefördert werden12.
Positive Psychologie (nach Seligman & Kollegen) ist nicht gleichzusetzen mit Positiver Psychotherapie (nach Peseschkian)
Im deutschsprachigen Raum ist die Methode der Positiven und Transkulturellen Psychotherapie bekannt. Diese wurde um 1970 von Professor Nossrat Peseschkian entwickelt, einem aus dem Iran stammenden Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychosomatische Medizin, der lange Jahre in Wiesbaden lebte. Peseschkian schrieb zahlreiche Bücher, die auch außerhalb von Fachkreisen bekannt sind, wie zum Beispiel „Der Kaufmann und der Papagei“ (Peseschkian 1979).
Die Entwicklung der Positiven Psychologie in Amerika und die der Positiven und Transkulturellen Psychotherapie in Deutschland verlief unabhängig13. Beide Ansätze basieren auf dem Menschenbild der Humanistischen Psychologie und betrachten den Menschen als grundsätzlich lernbereit und entwicklungsfähig. Auch und gerade bei klinischen Patienten sollten nicht nur die Symptome, sondern immer auch Stärken, Fähigkeiten und Ressourcen betrachtet werden.
Die Deutsche Gesellschaft für Positive und Transkulturelle Psychotherapie schreibt dazu auf ihrer Website (2014): „Die Positive Psychotherapie vertritt ein ganzheitliches Menschenbild. Dieser Ansatz berücksichtigt neben den gestörten Bereichen die dem Individuum und der Familie innewohnenden Fähigkeiten.”
Der zentrale Begriff ,positiv‘ ist nicht im Sinne einer Wertung zu verstehen, sondern ,positiv‘ bedeutet hier entsprechend seiner ursprünglichen Bedeutung (Lateinisch: positum) das Tatsächliche, das Vorgegebene.
Tatsächlich vorgegeben sind nicht notwendigerweise nur Konflikte und Störungen, sondern Fähigkeiten, die ein Mensch mitbringt. Positive Psychotherapie richtet also den Blick auf das Ganze und meint damit, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, eine Störung zu entwickeln, und gleichzeitig auch die Fähigkeit zur Gesundung besitzt. Entsprechend diesem Denkansatz berücksichtigt die Positive Psychotherapie nach Peseschkian nicht nur die Vergangenheit – also die regressive Sicht –, sondern sie hat vor allem eine zukunftsorientierte progressive Betrachtungsweise. Oder anders ausgedrückt: Neben der Pathologie wird von Anfang an nach den Ressourcen des Patienten im Sinne seiner Selbstheilungskräfte gefragt.
Jedem Menschen wird die Fähigkeit zur Entwicklung seiner noch schlummernden Potenziale zugebilligt. Demnach sieht der Therapeut den Patienten als den Menschen, der er sein könnte, und ist ihm im Prozess zum „Erkenne dich selbst“ und „Sei, der du bist“ behilflich. Das Therapiekonzept basiert damit auf der Grundannahme, dass der Mensch seinem Wesen nach gut ist.14
Die Positive und Transkulturelle Psychotherapie nach Peseschkian steht auf drei Säulen:
Positiver Ansatz: Jeder Mensch besitzt positive Grundfähigkeiten. Positum (im Sinne dessen, „was da ist“) bezieht nicht nur die Störung, sondern auch die anderen Fähigkeiten des Patienten mit ein.
Transkultureller Ansatz: Lebensqualität durch das Balance-Modell. Nach Peseschkian ist geistige und körperliche Gesundheit nur durch ein Gleichgewicht in den vier Lebensbereichen Körper / Sinne, Leistung / Beruf, Kontakte / Partnerschaft und Sinn / Zukunft zu erreichen.
Methodischer Ansatz: Ein fünfstufiger Weg beschreibt das psychotherapeutische Vorgehen und führt vom Symptom zur Konfliktlösung. Geschichten, Mythen und Lebensweisheiten aus verschiedenen Kulturen helfen dem Klienten ebenso wie Humor, seine Situation zu reflektieren und Veränderungen anzustoßen.
Der Begriff Positive Psychotherapie wird sowohl von der „Peseschkian-“ als auch von der „Seligman-Richtung“ verwendet; die Ansätze sind aber inhaltlich und methodisch nicht deckungsgleich. Beide Schulen betonen ausdrücklich die Wichtigkeit einer lösungs- und wachstumsorientierten Grundhaltung und stehen damit auf der Grundlage der Humanistischen Psychologie. Peseschkians Ansatz ist vorrangig eine Methode der Psychotherapie, Seligman hat in seiner Antrittsrede die Positive Psychologie als neues wissenschaftlich-psychologisches Forschungsfeld begründet.
1.2.4 Das Manifest der Positiven Psychologie
Nachdem die moderne Positive Psychologie formal 1998 mit Martin Seligmans Antrittsrede vor der APA begründet worden war, wurde es notwendig, dieses Forschungsfeld zu definieren und zu fördern. In den folgenden beiden Jahren trafen sich deshalb zentrale Vertreter, um die Ziele der neuen Positiven Psychologie zu präzisieren. Sie nannten ihr Ergebnis nach dem Ort dieser Treffen im mexikanischen Akumal das „Akumal-Manifest“. Wenngleich man geteilter Meinung sein kann, ob eine wissenschaftliche Richtung ein Manifest benötigt, so sind die Inhalte dennoch hilfreich, um das Gebiet der Positiven Psychologie umfassend verstehen und einordnen zu können. Hier sehen Sie einen Auszug aus dem Text15:
1. Definition
Positive Psychologie ist wissenschaftliche Forschung zu optimaler menschlicher Leistungsfähigkeit. Positive Psychologie hat das Ziel, Faktoren zu entdecken und zu unterstützen, die Einzelnen und Gemeinschaften dabei helfen aufzublühen („to thrive“). Die Positive Psychologie beinhaltet eine Verpflichtung für wissenschaftlich arbeitende Psychologen, ihre Aufmerksamkeit auf die Quellen psychischer Gesundheit zu richten und damit über die bisherige Betonung von Krankheit und Störung hinauszugehen.
2. Ziele
Um diese Ziele zu erreichen, müssen wir optimale Leistungsfähigkeit auf verschiedenen Ebenen betrachten: biologische, erfahrungsbezogene, persönliche, beziehungsrelevante, gesellschaftliche, kulturelle und globale.
Forschung ist notwendig, um Folgendes zu verstehen:
die dynamischen Beziehungen zwischen Prozessen auf diesen Ebenen,
die menschliche Fähigkeit, mit Zusammenhang und Sinn auf unvermeidliche Widrigkeiten
(„inevitable adversity“)
zu antworten, und
die Mittel, mit denen „das gute Leben“ in seinen vielen Erscheinungsformen aus diesen Prozessen resultieren kann.
3. Anwendungen
Zu den möglichen Anwendungsfeldern der Positiven Psychologie gehören:
Die Erziehung zu verbessern durch stärkeres Nutzen intrinsischer Motivation, positiver Gefühle und Kreativität in Schulen.
Die Psychotherapie zu verbessern durch Entwicklung von Ansätzen, die Hoffnung, Sinn und Selbstheilung unterstützen.
Das Familienleben zu verbessern durch ein besseres Verständnis der Dynamik von Liebe, Generativität und Einsatz.
Die Arbeitszufriedenheit über die Lebensspanne zu verbessern, indem man Menschen dabei hilft, Teilhabe in ihrer Arbeit zu erfahren, dabei Flow zu erleben und einen echten Beitrag zu leisten.
Organisationen und Gesellschaften zu verbessern, indem entdeckt wird, welches die Voraussetzungen sind, die Vertrauen, Kommunikation und Hilfsbereitschaft zwischen Menschen fördern.
Den moralischen Charakter der Gesellschaft zu verbessern, indem spirituelle menschliche Impulse besser verstanden und gefördert werden.
1 Gestaltpsychologie ist ein Feld der Allgemeinen Wahrnehmungspsychologie und nicht zu verwechseln mit der Gestalttherapie von Fritz Perls.
2 Auch wenn man im Business-Kontext mittlerweile bei „Work 4.0“ angelangt ist, so hat sich der Begriff der Positiven Psychologie 2.0 doch als eigenständiges Konzept fest etabliert, das ein ganzheitliches Verständnis des „Positiven und Negativen“ fordert.
3 Mehr zur Positiven Psychologie 2.0 in Kapitel 14.
4 An deutschen Universtäten werden Erkenntnisse aus der Positiven Psychologie derzeit meist im Fach Gesundheitspsychologie unterrichtet, da es noch keine eigenen Lehrstühle für Positive Psychologie gibt (Stand 2018).
5 Diese Themen werden an manchen Universitäten auch im Feld der Allgemeinen Psychologie erforscht.
6 Einen sehr guten Überblick über die verschiedenen Facetten der Psychologie bietet: Collin (2012) Das Psychologie-Buch: wichtige Theorien einfach erklärt.
7 Die Krankheitslast umfasst sowohl durch Tod verlorene Lebensjahre als auch krankheitsbedingt beeinträchtigte Lebensjahre.
8 Das Konzept der erlernten Hilflosigkeit wird im Kapitel 8.2 beschrieben.
9 Mehr dazu in Kapitel 4.2 über Charakterstärken.
10 Rogers war einer der Ersten, der therapeutische Sitzungen aufzeichnete, um sie systematisch auszuwerten und zur Supervision zu verwenden.
11 Besonders hervorzuheben: Joseph & Linley (2011): Positive Therapie.
12 Mehr dazu in Kapitel 14, Positive Psychologie 2.0.
13 Peseschkian kannte als Facharzt sicher Seligmans Ansatz der Depressionsbehandlung; Seligman und Rashid, die die Positive Psychotherapy entwickelt haben, kannten nach Aussage von Tayyab Rashid (persönl. Mitteilung 2018) Peseschkians Ansatz nicht.
14 http://www.dgpp.positum.org/
15 Sheldon, Frederickson, Rathunde, Csikszentmihályi & Haidt (2000): Akumal manifesto. Übersetzt von Daniela Blickhan.
2. Wohlbefinden und Flourishing
2.1 Was ist Glück? Subjektives Wohlbefinden
„Glück ist die Bedeutung und der Sinn des Lebens, das Ziel der menschlichen Existenz.“
(Aristoteles)
Die moderne empirische Psychologie untersucht weniger „das Glück“, das eher dem Bereich der Philosophie zugeordnet wird, sondern vielmehr das Konstrukt „Wohlbefinden“ bzw. Well-Being (Eid 2014). Einer der ersten Forscher, der sich wissenschaftlich-psychologisch mit diesem Thema auseinandersetzte, war Norman Bradburn (1969) mit seinem Buch The structure of psychological well-being. Sein ursprüngliches Forschungsinteresse galt der Frage, wie sich größere soziale Veränderungen wie zum Beispiel im Bildungsniveau, bei Arbeitsbedingungen oder der politischen Situation auf die Lebenssituation von Individuen und ihr psychologisches Wohlbefinden auswirkten. In der damaligen Zeit basierten die meisten Forschungsarbeiten im Bereich des Wohlbefindens auf Umfragestudien.
Dies änderte sich erst in den 1980er-Jahren durch die Arbeiten des amerikanischen Psychologieprofessors Ed Diener, der sich die Definition und systematische Messung des Konstrukts Well-Being zum Ziel gesetzt hatte. Dieners Artikel Subjective Well-Being (Diener, 1984) gilt als erster Meilenstein für die Beschreibung und empirische Erforschung der Frage, was menschliches Glück16 sei. Diener definiert Glück als subjektives Wohlbefinden (SWB). Es lässt sich entweder global oder lebensbereichs-spezifisch einschätzen. Diener unterscheidet die Lebensbereiche Selbst, Familie / Beziehungen, Arbeit, Gesundheit und Freizeit. Subjektives Wohlbefinden (SWB) besteht aus dem Verhältnis von positiven zu negativen Gefühlen (der sogenannten „Affektbilanz“) und der persönlichen Lebenszufriedenheit. Damit differenziert Diener SWB in zwei Komponenten, einerseits in affektives und andererseits in kognitives Wohlbefinden.
Die emotionale Komponente des subjektiven Wohlbefindens setzt sich aus dem Verhältnis von positiven und negativen Gefühlen zusammen. Ein Überwiegen angenehmer Gefühle genügt jedoch nicht, um das komplexe Konstrukt des Wohlbefindens zu beschreiben; die kognitive Komponente der Lebenszufriedenheit gehört ebenfalls dazu. Sie beinhaltet den Grad der Zufriedenheit mit den eigenen Lebensbedingungen.
Emotionales / affektives subjektives Wohlbefinden
Kognitives subjektives Wohlbefinden
Anwesenheit positiver Emotionen
Abwesenheit negativer Emotionen
Lebenszufriedenheit
Zwischen beiden Aspekten des SWB zeigen sich mittlere bis hohe Korrelationen (Diener, Napa-Scollon, Oishi, Dzokoto & Suh 2000). Das bedeutet, dass positive Stimmung (ein Überwiegen angenehmer Gefühle) im Alltag häufig Hand in Hand geht mit persönlicher Zufriedenheit. Allerdings sind beide voneinander getrennte Dimensionen und dies lässt sich aus dem persönlichen Erleben auch leicht nachvollziehen: Schön ist es, wenn es uns gut geht und wir zufrieden sind mit unserem Leben. Doch wir kennen auch Phasen, in denen wir die angenehmen Gefühle zurückstellen können, weil wir ein Ziel verfolgen, das uns enorm wichtig erscheint. Wir können mit unserem Leben auch zufrieden sein, wenn es gerade kein Wellness-Urlaub ist; wenn wir wissen, warum es sich lohnt, dieses Leben zu leben.
Dieners Forschung zeigte immer wieder, dass subjektives Wohlbefinden über die Zeit hinweg relativ stabil bleibt und auch mit Persönlichkeitsfaktoren zusammenhängt. Personen, die sich eher als extravertiert und optimistisch einschätzen und stabile soziale Beziehungen haben, erleben höheres Wohlbefinden. Äußere günstige Umstände beeinflussen das Glückserleben dagegen weniger stark als zum Beispiel das Erreichen persönlich wichtiger Ziele. Und schließlich tragen kulturelle Einflüsse zum subjektiven Wohlbefinden bei; „Glücklich-Sein“ wird in den USA anders definiert als in Japan oder in den Slums der dritten Welt. Diese Erkenntnisse wurden bereits vor der Jahrtausendwende veröffentlicht (vgl. etwa Diener, Suh, Lucas, & Smith 1999), und so konnte sich die Positive Psychologie in ihrer weiteren Forschung darauf stützen, zum Beispiel bei der Frage, wie sich Glück auf Gesundheit oder Einkommen auswirkt.
Wenn subjektives Wohlbefinden wie beschrieben aus positiven vs. negativen Emotionen und Lebenszufriedenheit besteht, würde folglich das persönliche Glücksniveau steigen, wenn mehr positive Gefühle und / oder eine größere Zufriedenheit mit dem eigenen Leben erlebt werden. Hier setzen die Interventionen der Positiven Psychologie an.
Unterschiede im subjektiven Wohlbefinden lassen sich nicht nur bei Individuen nachweisen, sondern auch bei Nationen. Felicia Huppert und Timothy So von der Universität Cambridge werteten Ergebnisse einer großen europäischen Umfrage aus, in der jeweils 2000 Erwachsene aus 23 EU-Ländern befragt wurden (Huppert & So 2013). Danach zeigten sich die Dänen als glücklichstes Volk, gefolgt von der Schweiz, Österreich und den anderen skandinavischen Ländern, während Russland, Portugal und die anderen osteuropäischen Länder die Schlusslichter in dieser Rangreihe darstellen. Deutschland liegt genau im Mittelfeld. Für das Glück von Nationen spielt eine Rolle, wie wohlhabend, stabil und demokratisch die Gesellschaft ist. Außerdem scheint relevant, wie die Gesellschaft das Streben nach positiven bzw. die Vermeidung negativer Erfahrungen bewertet (Seligman 2012).
Große Armut macht Menschen unglücklicher – doch großer Reichtum macht sie nicht glücklicher. US-Bürger, deren Lebensstandard heute im Durchschnitt deutlich höher ist als vor 100 Jahren, sind im Vergleich jetzt sogar unglücklicher als früher (Diener & Biswas-Diener 2011). Und ein Land auf der Welt hat die Vermehrung des Glücks zum Staatsziel erklärt: Der König von Bhutan hatte bereits 1972 den Begriff Gross National Happiness („Brutto-National-Glück“) als Ziel für sein Land eingeführt; mehr als 20 Jahre bevor Martin Seligman die Positive Psychologie formal als Forschungsfeld begründete. Ziel des Königs von Bhutan war seinerzeit, sein Land in eine positive wirtschaftliche Entwicklung zu führen, die sich im Einklang mit den spezifischen religiösen und kulturellen Werten vollziehen und nicht nur westlichen Wohlstandsidealen nacheifern sollte. Dies führte dazu, dass der Tourismus in Bhutan anders entwickelt wurde als in vergleichbaren Ländern; ausländische Reisende mussten beispielsweise dafür bezahlen, um in Bhutan herumreisen zu können, und diese Einnahmen wurden in Bildung und Straßenbau investiert. Bis heute gilt Bhutan als Land, in dem das Glück der Bürger eine wichtige Rolle spielt.
2.2 Wohlfühlglück und Werteglück
„Das gute Leben ist ein Prozess, kein Zustand.“ (Carl Rogers)
Ein klassisches Gedankenexperiment zeigt, dass Glück nicht einfach nur mit positiven Gefühlen gleichgesetzt werden kann. Darin stellt der Philosoph Robert Nozick Menschen vor die Frage, ob sie – hätten sie die Wahl – sich dafür entscheiden würden, sich an eine Maschine anschließen zu lassen, die ihnen dauerhaftes Wohlfühlglück garantieren könnte (Nozick 1974). Die damit verbundenen positiven Gefühle wären echt, lebenslang garantiert und man bräuchte rein gar nichts dafür tun, um sie zu erleben. Man müsste sich nur darauf einlassen, lebenslang an diese Maschine angeschlossen zu bleiben. Fragt man Menschen, ob sie bereit wären, sich an eine solche Maschine anschließen zu lassen, so antworten bei Weitem nicht alle mit Ja, denn dauerhafte positive Gefühle ohne persönlichen Einsatz erscheinen vielen letztendlich leer und sinnlos. Nozicks Gedankenexperiment führt deutlich vor Augen, wie wichtig es für menschliches Wohlbefinden ist, sich zu engagieren und aktiv zum eigenen Glück beizutragen.
Wohlfühlglück: das angenehme Leben
Hedonisches Glück besteht darin, angenehme Gefühle zu suchen und Schmerz zu vermeiden. Wir erleben Wohlfühlglück, wenn wir Tätigkeiten ausführen, die uns wohltun und gefallen. Ein warmes Bad, das Betrachten eines Sonnenuntergangs, die Nackenmassage durch den Partner, ein entspannter Spaziergang oder Stadtbummel, gutes Essen, vielleicht gefolgt von einem Cappuccino, der an den letzten Urlaub erinnert … All dies beschreibt Momente des Wohlfühlglücks. Oft liegen ihre Quellen in der Umwelt, die als angenehm und wohltuend erlebt wird.
Werteglück: das erfüllte Leben
Eudaimonisches Glück entsteht, wenn Menschen das tun können, was sie für wertvoll erachten. Damit ist immer das Streben nach persönlich wichtigen Werten und Zielen verbunden. Oft, jedoch nicht immer, werden dabei positive Gefühle erlebt. Manchmal ist Werteglück sogar mit dem vorübergehenden Erleben unangenehmer Gefühle verknüpft. Immer ist eudaimonisches Glück aber mit persönlichen Werten und dem eigenen Best Self verbunden, also der bestmöglichen Ausgabe seiner Selbst im Sinne von Goethes Appell „Werde, der du bist“.
Die Unterscheidung zwischen Wohlfühlglück und Werteglück lässt sich bis in die antike griechische Philosophie, speziell zu Aristoteles, zurückverfolgen. In seiner Nikomachischen Ethik weist Aristoteles das Prinzip des Hedonismus zurück, der das angenehme Leben als höchstes Ziel postuliert. Er beschreibt Menschen, die dem angenehmen Leben nachjagen, als Sklaven und vergleicht sie mit grasenden Tieren (Aristoteles 2011). Für Aristoteles besteht Erfüllung darin, moralische Werte zu verwirklichen und ein gutes, das heißt tugendhaftes und wertvolles, Leben zu führen. Glück ist für Aristoteles die natürliche Konsequenz18 eines guten Lebens, das sowohl Charakter als auch Handeln umfasst und menschliche Exzellenz verwirklicht. Eudaimonia, das Ergebnis eines solchen guten Lebens, beschreibt nach Aristoteles den Prozess, wie ein Mensch mit Vernunft und Maß lebt und sich in Richtung des guten Lebens ausrichtet. Psychologisch betrachtet resultiert aus diesem Prozess des guten Lebens persönliche Zufriedenheit im Sinne subjektiven Wohlbefindens. Das eigene Handeln wird als wert- und sinnvoll erlebt.
In der Positiven Psychologie wird die Unterscheidung zwischen hedonischem und eudaimonischem Glücksverständnis bis heute häufig genutzt, etwa um unterschiedliche Motivationsformen oder Ziele zu differenzieren. Hedonisches Glück fokussiert auf spezifische Ergebnisse, nämlich die Anwesenheit angenehmer Gefühle und die Abwesenheit von Schmerz. Eudaimonisches Wohlbefinden umfasst dagegen mehr den Inhalt des eigenen Lebens und der damit verbundenen Prozesse, zum Beispiel Gesundheit, Vitalität, Nähe und Sinnerleben. Eudaimonisches Glück lässt sich mit dem Ausdruck „das Gute Leben“ umschreiben (Blickhan 2014). Einerseits wird das „Gute“, also das Wertvolle und Sinnhafte gelebt, andererseits ist das Leben selbst „gut“. Dies kann mit angenehmen Gefühlen verbunden sein, muss es aber nicht. Es sind durchaus auch Situationen im Leben denkbar, in denen man ein hohes Maß an eudaimonischem Wohlbefinden erlebt und wenig hedonisches Glück, etwa wenn man sich intensiv für eine persönlich wichtige Sache engagiert und dabei auf Komfort, Freizeit und ähnliche „Wohlfühlquellen“ verzichtet.
Die Differenzierung in Wohlfühl- und Werteglück erinnert zu Recht stark an Ed Dieners Definition des Subjektiven Wohlbefindens (SWB). Ein Überwiegen angenehmer Gefühle im Verhältnis zu unangenehmen entspricht dem Wohlfühlglück, und das Werteglück lässt sich leicht mit der Lebenszufriedenheit in Verbindung bringen. Auf diesem Hintergrund erscheint es sonderbar, dass Ed Diener und sein Konzept des SWB in der psychologischen Fachliteratur immer wieder in die „Ecke“ eines hedonistischen Glücksverständnisses gestellt wird. Diener verstand Glück von Anfang an als „mehr als nur Wohlfühlen“ und definierte die persönliche Zufriedenheit mit dem eigenen Leben, also die eudaimonische Wertorientierung als wesentlichen Bestandteil des Glücks. Diener hat damit die empirische Forschung des Wohlbefindens von Beginn an auf eine Verbindung beider Aspekte menschlichen Glückserlebens hin ausgerichtet.
Ein Verständnis der komplementären Aspekte des hedonischen und eudaimonischen Glücksempfindens ist zentral für eine sinnvolle Anwendung der Positiven Psychologie, die inhaltlich weit mehr ist als eine „Happyologie“.
SELBSTREFLEXION
Wohlfühlglück und Werteglück
Welche Aktivitäten, Dinge, Ereignisse etc. sind in Ihrem Leben Quellen für Wohlfühlglück? Welche für Werteglück?
Schreiben Sie jeweils 5 bis 10 Punkte auf und vergleichen Sie die beiden Listen. Welche Begriffe erscheinen in beiden Spalten?
Vergleichen Sie Ihre Glücksquellen nach folgenden Aspekten:
Wie lange hält das Glücksgefühl an?Welche Zeitperspektive ist damit vorranging verbunden? Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft?Wo erleben Sie das Glück für sich allein, wo in Verbindung mit anderen Menschen?Schließlich: Welche Erkenntnisse hat Ihnen diese Reflexion gebracht? Welche Veränderungen möchten Sie in Ihrem Leben anstoßen?
2.3 Psychologisches bzw. psychisches19 Wohlbefinden
Das Modell des psychologischen bzw. psychischen Wohlbefindens (Ryff 1989) stellt eine inhaltliche Erweiterung von Ed Dieners Modell des subjektiven Wohlbefindens dar. Diener hatte den Weg bereitet für ein Verständnis von Glück als Prozess mit emotionalen Facetten (positive Gefühle) und kognitiver Bewertung (Lebenszufriedenheit). Carol Ryff wollte nun die Frage beantworten, warum Menschen mit ihrem Leben zufrieden sind und warum nicht.
Dazu formulierte sie das Konzept des Psychologischen Wohlbefindens (PWB). In ihrem Artikel Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being (1989) gibt sie einen umfassenden Überblick über die bisherige psychologische Forschung zum Thema menschlichen Wohlbefindens, zeigt konzeptuelle Lücken auf und verweist auf die großen Unterschiede, mit denen verschiedene Autoren das Konstrukt des positive psychological functioning beschreiben. Beginnend mit Maslows (1965) Konzept der Selbstaktualisierung und Rogers’ Verständnis der fully functioning person (1961) nennt sie als weitere Vordenker Jung (1933) mit dem Prinzip der Individuation und Allport (1961) mit dem Konzept der Reife. Eriksons Theorie der Psychosozialen Entwicklungsaufgaben über die Lebensspanne (1953) führt sie ebenso an wie Jahodas (1958) Kriterien positiver psychischer Gesundheit. Die „magere empirische Wirkung“ all dieser Ansätze begründet sie mit dem Fehlen passender Erfassungsmethoden, mit der Unterschiedlichkeit der Kriterien für Wohlbefinden und schließlich mit dem Argument, diese Konzepte seien „hoffnungslos mit Werten überladen“.
Ryffs Ziel war es, die vielfältigen Konzepte des positive psychological functioning inhaltlich zu verbinden und daraus empirisch überprüfbare Dimensionen für Wohlbefinden abzuleiten. Sie beschreibt damit nicht mehr Subjektives Wohlbefinden, sondern Psychische Leistungsfähigkeit (positive psychological functioning). Dabei ist es allerdings extrem wichtig, die Bedeutung des englischen Begriffs positive psychological functioning sinnvoll ins Deutsche zu übertragen. Psychological functioning bedeutet nicht etwa „gut funktionieren“, sondern umfasst vielmehr psychische Leistungsfähigkeit im Sinne der Realisierung des eigenen Potenzials. Dies entspricht der selbst aktualisierten fully functioning person nach Rogers (1961) und auch der Beschreibung der WHO im Sinne der Liebes-, Arbeits- und Genussfähigkeit.
Für diese Psychische Leistungsfähigkeit definierte Carol Ryff in ihrem Modell des Psychischen Wohlbefindens sechs Faktoren bzw. Bausteine.
Bausteine für Psychisches Wohlbefinden (Ryff 1989)
Self-acceptance:Sich selbst akzeptieren
eine positive Grundeinstellung sich selbst gegenüberist ein zentrales Kriterium psychischer Gesundheit und psychischer Reifeist ein Charakteristikum der SelbstaktualisierungPositive relations with others:Positive Beziehungen
warme, vertrauensvolle Beziehungen mit anderenEmpathiefähigkeit, Bindungsfähigkeitist ein weiteres zentrales Kriterium psychischer Gesundheit und psychischer ReifeAutonomy:Autonomie, Selbstbestimmtheit
die eigenen Werte als Kompass des eigenen Verhaltens nutzeninterne Bewertung statt Suche nach externer Anerkennungbedeutet nicht: Anarchie, Unabhängigkeit um jeden Preis!Environmental mastery:Selbstwirksamkeit, aktive Gestaltung von Lebensumständen
die Fähigkeit, die eigene Umwelt zu wählen und zu gestalten bzw. mitzugestaltenaktive Teilhabe an der UmweltBewältigung von Alltagsanforderungenist ein zentrales Kriterium psychischer GesundheitPurpose in life:Sinn im Leben, relevante persönliche Ziele
klares Verständnis des eigenen Lebenssinns und -zielsZielorientierung, Ausrichtung an größeren Zielen / Visionenist ein Kriterium psychischer Reife: „erfolgreich alt werden“ und den eigenen Lebensprozess akzeptierenPersonal growth:Persönliches Wachstum
kontinuierliche persönliche Entwicklung im Lauf des LebensOffenheit für neue ErfahrungenSelbstaktualisierungZur Erfassung des PWB liegt der Fragebogen Psychological Well-Being Scales (Ryff 1989) in zwei Fassungen vor: in einer Langform mit 84 Items und in einer mittleren Form mit 54 Items.
Für Carol Ryff bezieht sich Ed Dieners Konzept des SWB auf kurzfristigeres affektives Wohlbefinden im Sinne von happiness; PWB dagegen auf längerfristige Herausforderungen des Lebens wie Sinnfindung, befriedigende Beziehungen und persönliches Wachstum. Bei diesem Argument lässt Ryff allerdings Dieners Konzept der Lebenszufriedenheit außer Acht, das ja auch und gerade die längerfristige kognitive Bewertung des gesamten eigenen Lebens oder seiner einzelnen Bereiche einschließt und einen zentralen Bestandteil des SWB darstellt. Hier zeigt sich wieder einmal, wie weitreichend Dieners Konzept des SWB angelegt ist und wie umfassend es das Verständnis menschlichen Wohlbefindens abbilden kann.
Ryffs Konzept des Psychischen Wohlbefindens erinnert zu Recht stark an den eudaimonischen Glücksbegriff und folglich wird Ryff auch als erste Vertreterin des Feldes der eudaimonic happiness genannt. Wong (2011) beschreibt eudaimonisches Glück sogar als Oberbegriff für psychisches Wohlbefinden im Sinne von Ryffs Konzept, Er definiert Eudaimonia als Lebensstil, bei dem Tugend, Sinn und aktives Beitragen zum Besseren zur persönlichen Erfüllung und zum Flourishing führen. Dieses Glück kommt aus einem Leben, das „aktiv das Beste an Charakter oder Tugend ausdrückt“ (Wong 2011, S. 70, Übersetzung D. Blickhan).
Die Argumente der Forscher aus den Bereichen des subjektiven bzw. hedonischen und des psychologischen bzw. eudaimonischen Wohlbefindens scheinen häufig konträr. Ryan und Deci (2001, S. 146) fassen diese Diskussion um das bessere Konzept zum Verständnis menschlichen Glücks so zusammen:
Vertreter des PWB wie Carol Ryff kritisieren, dass SWB als Modell menschlichen Wohlbefindens zu eingeschränkt und daher nur bedingt aussagekräftig sei, wenn es um
positive functioning
gehe.
Vertreter des SWB in der Tradition von Ed Diener halten dagegen, dass beim PWB Experten über inhaltliche Kriterien definieren, was Wohlbefinden sei. Sie beziehen sich damit auf die sechs Faktoren im PWB. Beim Ansatz des SWB könnte ein Mensch dagegen selbst eine Aussage darüber treffen, was sein Leben „gut“ mache. Wenn es um subjektives Wohlbefinden gehe, sei „der endgültige Richter (…) derjenige, der in der Haut der Person lebe (the final judge (…) whoever lives inside a person’s skin)“ (Myers & Diener 1995, S. 11, Übersetzung Daniela Blickhan).
Ob beide Konzepte tatsächlich unabhängige Dimensionen menschlichen Wohlbefindens abbilden, wird heute auch durchaus kritisch diskutiert (vgl. z. B. Kashdan, Biswas-Diener & King 2008). „Interindividuelle Unterschiede im hedonischen und im eudämonischen Wohlbefinden sind nicht unabhängig voneinander, sondern hängen stark miteinander zusammen“ (Eid 2014, S. 1803).
Die beiden Aspekte des hedonischen und eudaimonischen Wohlbefindens sind bis heute die meistgenannten Unterscheidungen, wenn es um Glück geht. Manche Autoren nennen noch zwei weitere Facetten: prudential happiness und chaironic happiness.
Prudential happiness, auf Deutsch etwa „das kluge Glück“, entsteht aus einem erfüllten und aktiven Leben. Diese Zufriedenheit ist eng verbunden mit Flow und intrinsischer Motivation. Ein Mensch, der das tut, was er gut oder sehr gut kann, und daran Freude hat, wird prudential happiness erleben. Haybron (2000) betont, dass dabei Fragen der Moral oder der Tugend keine große Rolle spielen, sondern die persönliche Erfüllung im Sinne des Flowerlebens im Vordergrund steht. Das Gegenteil von prudential happiness wäre Langeweile und innere Leere (Wong 2011).
Chaironic happiness, auf Deutsch „Glückseligkeit“ oder „gesegnetes Glück“, beschreibt einen inneren Zustand der Ehrfurcht, Dankbarkeit und des Eins-Seins mit der Natur oder dem Göttlichen. Die Bezeichnung geht auf das griechische chairo zurück, das so viel wie Segen, Freude oder Geschenk bedeutet. Für Wong (2011), der diese Facette menschlichen Glücks in seinem Artikel Positive Psychology 2.0 beschrieb, sind Achtsamkeit und Empfänglichkeit die Grundlage dieser Art des Glücks. Sie ist oft mit persönlichen Gipfelerlebnissen oder spirituellen Erfahrungen verbunden, sei es in der Meditation oder in der Natur. Wong (2011) nennt chaironic happiness „den existenziellen, spirituellen Weg zum Glück“ (S. 70, Übersetzung Blickhan) und verweist auf die Notwendigkeit einer weiteren theoretischen und empirischen Fundierung des Konzepts in der Psychologie.20
2.4 Salutogenese
Salutogenese bedeutet übersetzt „Entstehung von Gesundheit“ und geht auf den Medizinsoziologen Aaron Antonovsky zurück, der damit bereits in der 1970er-Jahren das Konzept von Gesundheit und Krankheit grundlegend prägte. Antonovsky beschrieb Gesundheit und Krankheit nicht als Dichotomie, sondern als Kontinuum, auf dem Veränderung leichter abbildbar ist als in einer Gegenüberstellung von zwei separaten Zuständen. Der Ansatz der Salutogenese untersucht die Frage, wie Menschen gesund werden und bleiben, sich also weg vom krankheitsorientierten zum gesunden Pol des Kontinuums „Gesundheit – Krankheit“ entwickeln.
Antonovsky (1979) entwickelte das Konzept der Salutogenese in den 1970er-Jahren auf der Grundlage von Daten zur Gesundheit israelischer Frauen. Selbst in der Gruppe, die in jungen Jahren in Konzentrationslagern gewesen war, zeigte ein Drittel später eine gute psychische Gesundheit. Andererseits lagen Studien aus modernen Industriegesellschaften vor, die bei einem Drittel der Bevölkerung Krankheit feststellten. Diesem Widerspruch wollte Antonovsky in seiner Forschung nachgehen. Er ging dabei von der Annahme aus, dass der Mensch mit einer Vielzahl an Stressoren konfrontiert wird und dadurch in einen Spannungszustand gerät, mit dem er umgehen muss. Das Ergebnis dieses Coping-Prozesses ist individuell verschieden und kann entweder krank machen, neutral sein oder gesund erhalten. In seinem ersten Buch führte Antonovsky (1979) das auf sogenannte generalisierte Widerstandsressourcen zurück, zum Beispiel auf Ich-Stärke, soziale Unterstützung, kulturelle Stabilität oder die finanzielle Situation.
Für die positive Entwicklung im Kindes- und Jugendalter beschreibt Antonowsky (1979, 1997) folgende salutogenetisch wirksamen Widerstandsressourcen:
eine stabile emotionale Beziehung zu mindestens einem Elternteil oder einer anderen Versorgungsperson;
soziale Unterstützung innerhalb und außerhalb der Familie, z. B. durch Verwandte, Nachbarn, Lehrer und Gleichaltrige;
ein emotional warmes, offenes, strukturierendes und normorientiertes Erziehungsklima;
soziale Modelle, die zu konstruktivem Bewältigungsverhalten ermutigen, z. B. Eltern, Geschwister, Lehrer, Pfarrer;
dosierte soziale Verantwortlichkeit und Leistungsanforderungen, z. B. Sorge für andere Verwandte, Pflichten in der Schule;
kognitive Kompetenzen, z. B. ein mindestens durchschnittliches Intelligenzniveau, kommunikative Fertigkeiten, eine realistische Zukunftsplanung;
Temperamentseigenschaften, die eine effektive Bewältigung begünstigen, z. B. Flexibilität, Annäherungsverhalten, Impulskontrolle;
Erfahrungen von Selbstwirksamkeit, internale Kontrollüberzeugungen, Selbstvertrauen und ein positives Selbstkonzept;
die Art und Weise, wie die Person mit Belastungen umgeht, insbesondere die aktive Bemühung um Problembewältigung (aktives Coping).
Da die Anzahl dieser Widerstandsressourcen vielfältig schien, suchte Antonovsky ein Auswahlkriterium, das eine Aussage darüber zuließ, wie etwas individuell als generalisierte Widerstandsressource wirken könnte. Er fand es in der Erfahrung von Sinn, Struktur und Bedeutung in der eigenen Entwicklung, im Kohärenzsinn (sense of coherence). Dieser drückt das Maß aus, in dem man „ein durchdringendes, andauerndes, aber dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass
die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren Umgebung ergeben, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind;
einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen, die diese Stimuli stellen, zu begegnen;
diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und Engagement lohnen“ (Antonovsky & Franke 1997, S. 36).
Der Kohärenzsinn (sense of coherence)
Der Kohärenzsinn entsteht aus drei Komponenten, die ihrerseits wieder miteinander verbunden sind.
Verstehbarkeit
Diese Komponente betrifft die kognitive Einordnung einer belastenden Erfahrung, speziell in ihrer Vorhersehbarkeit. „Warum ist das geschehen?“ Wird eine Erfahrung als chaotisch, willkürlich, zufällig und unerklärlich erlebt oder ist es möglich, eine Ordnung, Struktur und Konsistenz herzustellen? Die Dimension der Verstehbarkeit ist nicht mit der Erwünschtheit eines Ereignisses gleichzusetzen. Es geht hier primär um die Frage, ob sich jemand ein Ereignis subjektiv erklären kann.
Handhabbarkeit
Sie umfasst die konkrete, verhaltensorientierte Bewältigung der Erfahrung: „Wie kann ich damit umgehen?“ Es geht hier um die Frage, inwieweit geeignete Ressourcen verfügbar sind, um den Anforderungen der Situation gewachsen zu sein. Die Erfahrung der Handhabbarkeit ist der sogenannten Opferrolle diametral entgegengesetzt.
Bedeutsamkeit
Diese Dimension zielt auf die Einordnung der Erfahrung in einem größeren Sinnzusammenhang. „Welchen Sinn ergibt das?“ Für Antonovsky stellt diese Komponente das motivationale Element dar. Sie bezieht sich auf das Ausmaß, „indem man das Leben emotional als sinnvoll empfindet: dass wenigstens einige der vom Leben gestellten Probleme und Anforderungen es wert sind, dass man Energie investiert, dass man sich für sie einsetzt und sich ihnen verpflichtet, dass sie eher willkommene Herausforderungen sind als Lasten, die man gerne los wäre“ (Antonovsky & Franke 1997, S. 35 f.). Antonovsky bezieht sich bei der Benennung dieser dritten Komponente explizit auf Viktor Frankls Werk (1985).
Das Konzept der Salutogenese ist in der Medizin weiter verbreitet als in der Psychologie – eigentlich erstaunlich, da die Gemeinsamkeiten so offensichtlich sind. Eine fächerübergreifende Integration wäre wünschenswert.
2.5 Was bringt Glück?
Sonja Lyubomirsky ist neben Martin Seligman und Barbara Fredrickson sicher eine der meistgelesenen Autorinnen im Feld der Positiven Psychologie, gerade auch wenn es um populärwissenschaftliche Veröffentlichungen geht. In ihrem Buch Glücklich sein – The How of Happiness (Lyubomirsky 2008a) zeigt sie zahlreiche wissenschaftlich fundierte und alltagstaugliche Wege auf, um das eigene Wohlbefinden zu erhöhen. Eines ihrer Forschungsergebnisse, das sogenannte „Tortendiagramm“, wird jedoch häufig falsch zitiert. Lyubomirsky konnte mit einer großen Metastudie differenzieren, wie das persönliche Glücksempfinden von verschiedenen Faktoren abhängt, nämlich von äußeren Lebensumständen, anlagebedingten Voraussetzungen und aktivem Handeln (Sin & Lyubomirsky 2009). Das Verhältnis dieser Faktoren wird meist in einem einfachen Tortendiagramm dargestellt.
Abbildung 2.1: Entscheidende Faktoren für Glück
(Quelle: Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M., & Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. Review of General Psychology, 9, S. 111–131)
Die äußeren Lebensumstände (wie zum Beispiel materieller Wohlstand oder die derzeitige Wohnsituation) tragen demnach nur etwa 10 Prozent zum persönlichen Wohlbefinden bei, anlagebedingte Voraussetzungen (wie zum Beispiel die Gene) 50 Prozent und das aktive persönliche Verhalten weitere 40 Prozent. Dieses Modell scheint einleuchtend und plausibel, und das ist sicher auch der Grund, warum es häufig zitiert wird. Leider wird dabei in der Regel eine zentrale Tatsache übersehen:
Das Tortendiagramm zeigt nämlich nicht prozentuale Anteile der drei Faktoren in Bezug auf das Glückserleben einer einzelnen Person, sondern es beschreibt vielmehr, worauf die Unterschiede im Glücksempfinden zwischen Personen zurückzuführen sind. Es würde auch relativ wenig Sinn machen, wenn man das Modell individuell auf eine einzelne Person anwendet, denn welchen Nutzen hätte die Aussage, dass ihr persönliches Wohlbefinden zu 50 Prozent an ihren genetischen Voraussetzungen hängt? Was könnte die Person damit anfangen?