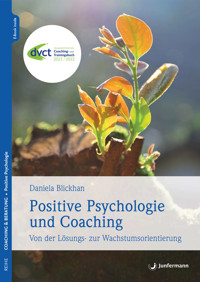
28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Junfermann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Positive Psychologie und Coaching – eine ideale Verbindung Coaching begleitet Veränderungsprozesse und unterstützt Menschen dabei, ihre Ziele zu erreichen. Positive Psychologie untersucht Faktoren des gelingenden Lebens: Was lässt Menschen "aufblühen"? Daniela Blickhan setzt die Positive Psychologie selbst seit mehr als zehn Jahren im Coaching und in der Ausbildung von Coaches ein. Ihr Resümee: Jeder Coach kann Positive Psychologie als Bereicherung in sein Repertoire aufnehmen. Nach einer Zusammenfassung der für das Coaching relevanten Grundlagen der Positiven Psychologie geht es im 1. Teil um Fragen wie: Was bedeutet "Positive Diagnostik"? Was sind "Positive Interventionen"? Was charakterisiert einen "Positiven Coachingprozess"? Im 2. Teil geht es, abgerundet durch Fallbeispiele, darum, wie sich diese Grundlagen in einem Coachingprozess umsetzen lassen: • Emotionen, Aufmerksamkeit und Aufblühen • Stärken, Charakterstärken und das "gute Leben" • Psychische Grundbedürfnisse, Motivation, Ziele und Wohlbefinden • Stress und Bewältigung – und welche Chancen darin liegen • Selbstregulation und Selbstmitgefühl
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Daniela BlickhanPositive Psychologie im CoachingVon der Lösungs- zur Wachstumsorientierung
Über dieses Buch
Positive Psychologie und Coaching – eine ideale Verbindung
Coaching begleitet Veränderungsprozesse und unterstützt Menschen dabei, ihre Ziele zu erreichen. Positive Psychologie untersucht Faktoren des gelingenden Lebens: Was lässt Menschen „aufblühen“? Daniela Blickhan setzt die Positive Psychologie selbst seit mehr als zehn Jahren im Coaching und in der Ausbildung von Coaches ein. Ihr Resümee: Jeder Coach kann Positive Psychologie als Bereicherung in sein Repertoire aufnehmen.
Nach einer Zusammenfassung der für das Coaching relevanten Grundlagen der Positiven Psychologie geht es im 1. Teil um Fragen wie: Was bedeutet „positive Diagnostik“? Was sind „positive Interventionen“? Was charakterisiert einen „positiven Coachingprozess“? Im 2. Teil geht es darum, wie sich diese Grundlagen in einem Coachingprozess umsetzen lassen:
Emotionen, Aufmerksamkeit und Aufblühen Stärken, Charakterstärken und das „gute Leben“ Psychische Grundbedürfnisse, Motivation, Ziele und Wohlbefinden Stress und Bewältigung – und welche Chancen darin liegen Selbstregulation und SelbstmitgefühlDr. Daniela Blickhan, Dipl.-Psych., MSc, Lehrcoach DACH-PP, DVNLP, DCV und Lehrtrainerin DACH-PP, DVNLP, leitet seit 1991 das INNTAL INSTITUT und bildet Coaches, Trainer und Führungskräfte in Positiver Psychologie, NLP und Systemischem Coaching aus.
Copyright: © Junfermann Verlag, Paderborn 2021
Coverfoto: Youngki Son / Pixabay
Covergestaltung / Reihenentwurf: Junfermann Druck & Service GmbH & Co. KG, Paderborn
Satz, Layout & Digitalisierung: Junfermann Druck & Service GmbH & Co. KG, Paderborn
Alle Rechte vorbehalten.
Erscheinungsjahr dieser E-Book-Ausgabe: 2021
ISBN der Printausgabe: 978-3-95571-951-7
ISBN dieses E-Books: 978-3-7495-0121-2 (EPUB), 978-3-7495-0123-6 (PDF), 978-3-7495-0122-9 (Kindle).
Ein persönliches Vorwort
Coaching und Positive Psychologie, das sind zwei Themengebiete – oder besser: Perspektiven –, die mein berufliches Leben und mich selbst sehr stark geprägt haben. Meine erste Coachingausbildung begann ich bereits während meines Psychologiestudiums. Seit knapp 30 Jahren arbeite ich als Coach und bilde seit 25 Jahren Coaches aus. Lösungsorientiertes Denken und die Freude daran, was man mit Sprache, mit Fragen und Zuhören bewirken kann, das ist mir in dieser Zeit in Fleisch und Blut übergegangen. Wann immer ich gefragt wurde, was ich beruflich mache, war meine Antwort: „Ich unterstütze Menschen dabei, sich und anderen das Leben etwas leichter zu machen.“ Das bereitet mir nach wie vor große Freude, und es erfüllt mich immer noch und immer wieder mit Staunen und Begeisterung, wenn ich sehe, wie sich Menschen auf den Weg machen, um ihr Leben selbstbestimmt und aktiv zu gestalten.
Mein Verständnis von Coaching ist geprägt durch meine Ausbildung als Psychologin. Darauf fußt mein Verständnis von menschlicher Entwicklung, von Bedürfnissen, Werten und Gewohnheiten und wie ich Klientinnen und Klienten auf ihrem Weg zu den eigenen Zielen und im konstruktiven Umgang mit Rückschlägen unterstütze. Wesentliche methodische Grundlagen waren für mich dabei die lösungsorientierten Ansätze, klientenzentrierte Gesprächsführung, Gestalttherapie, NLP und systemische Verfahren. Damit konnte ich meine Klientinnen und Klienten unterstützen, häufig in kurzer Zeit wesentliche Veränderungen in ihrem persönlichen oder beruflichen Leben zu verwirklichen. Und so hätte es gut und gerne auch weitergehen können – wäre mir da nicht die Positive Psychologie begegnet.
2008 hatte ich zum ersten Mal etwas von dieser neuen Richtung der Positiven Psychologie gehört, die mich sofort faszinierte. War hier etwa eine Verbindung zwischen den praktischen und wirksamen Coaching-Ansätzen und der Welt der wissenschaftlichen Psychologie möglich? Die meisten meiner Coaching-Ausbilder oder -Kollegen sahen eine solche Schnittstelle nicht, denn „die Coaches“ arbeiten ja schließlich in der „echten Welt“ und „die Wissenschaftler“ in ihrem sprichwörtlichen Elfenbeinturm. Doch je mehr ich von der Positiven Psychologie hörte, las und auf Kongressen erfuhr, umso mehr zeigte sich für mich, dass sich hier wissenschaftliche Forschung auf genau die Themen fokussierte, die im Coaching zentral sind. Das begeisterte mich so, dass ich mich entschied, die Positive Psychologie intensiv und akademisch zu erkunden. Über zwei Jahre flog ich zum Studium regelmäßig nach London (denn damals gab es einen Studiengang zum Master of Applied Positive Psychology nur in den USA oder eben in England) und tauchte nach mehr als 20 Jahren wieder ganz tief in die Welt der wissenschaftlichen Psychologie ein. Meine anfängliche Vermutung fand ich nach jeder Vorlesung, nach jedem Fachartikel bestätigt: Positive Psychologie und Coaching, das ist eine ideale Verbindung.
Ich entwickelte Kurse für verschiedene Zielgruppen, um dieses Wissen im deutschsprachigen Raum bekannt zu machen, zunächst Praxiskurse, um die Positive Psychologie für Teilnehmer/innen zur Burnout-Prophylaxe und zur Steigerung des eigenen Wohlbefindens nutzbar zu machen, und dann Ausbildungen in Positiver Psychologie für Coaches und Trainer/innen. Zusammen mit Fachkollegen gründete ich 2013 den Deutschsprachigen Dachverband für Positive Psychologie (DACH-PP e.V.), denn mir war klar, dass Ausbildungen im angewandten Feld eine fundierte Qualitätssicherung brauchen würden, um dem wissenschaftlichen Anspruch gerecht zu werden, der Positive Psychologie ausmacht und der sie auch von bisherigen Strömungen der angewandten Psychologie unterscheidet. Mit der Entwicklung von Curricula für Ausbildungsgänge und Kriterien für Ausbilder/innen wurde dieses Ziel unterstützt, und die Ausbildungsstandards des DACH-PP sind bis heute die höchsten im deutschsprachigen Raum.
2017 schloss ich meine Promotion ab, in der ich über drei Jahre untersucht hatte, wie sich die Teilnahme an einer Ausbildung in Positiver Psychologie verglichen mit einer Coachingausbildung auf das Wohlbefinden der Teilnehmenden auswirkt (Blickhan 2017). Dazu erfasste ich sowohl Belastungsmaße wie Burnout-Risiko oder Depressionssymptome als auch Variablen gelingenden Lebens wie Zufriedenheit, Wohlbefinden und Flourishing. Die Ergebnisse bestätigten, was wir in unseren Kursen immer wieder von den Teilnehmenden hörten: Beide Ausbildungen wirkten sich positiv auf ihr Wohlbefinden aus, doch in der Positiven Psychologie zeigte sich dieser Anstieg schneller, und er blieb stabil. Sich mit Themen der Positiven Psychologie zu beschäftigen macht also angehende Coaches und andere Professionals anscheinend nicht nur fachlich kompetenter, sondern auch persönlich zufriedener und glücklicher.
Im Handbuch Positive Psychologie (Blickhan 2015) fasste ich Forschungsergebnisse und Erkenntnisse zusammen, um sie im deutschsprachigen Raum zugänglich zu machen. Mit dem Handbuch wollte ich deutschsprachigen Coaches, Trainer/innen und Therapeut/innen den Zugang erleichtern und eine Brücke zwischen Wissenschaft und Anwendung bauen.
Mit dem vorliegenden Coachingbuch wird die Brücke nun noch stabiler, tragfähiger und vor allem breiter. Positive Psychology Coaching ist ein Feld, das jeder Coach als Bereicherung in sein Repertoire aufnehmen kann, sei es, indem Sie nur die eine oder andere Intervention einbeziehen oder aber die Konzepte der Positiven Psychologie in größerem Maß integrieren.
Wer mein Handbuch Positive Psychologie bereits gelesen hat, kann das vorliegende Buch als Ergänzung, Erweiterung und Vertiefung für die Anwendung im Coaching nutzen. Das Handbuch ist aber keine Voraussetzung. Wer das Handbuch bereits gelesen hat, braucht auch nicht zu befürchten, im Coachingbuch nun einfach einen zweiten Aufguss der Themen von 2015 (oder der Neuauflage von 2018) zu bekommen. Die Grundlagen der Positiven Psychologie habe ich in diesem Buch, das Sie nun in Händen halten, neu aufbereitet und auf die Anwendung im Coaching fokussiert.
Im ersten Teil fasse ich wesentliche Grundlagen der Positiven Psychologie zusammen, die für Coaching relevant sind. Dabei beziehe ich mich inhaltlich auf die gleichen Grundlagen und Forschungsergebnisse wie im Handbuch, etwa zu Charakterstärken oder Positiven Emotionen. Doch was diese und andere Konzepte der Positiven Psychologie für Coaching bedeuten können, finden Sie in diesem Buch weit ausführlicher dargestellt als im Handbuch – verknüpft mit mittlerweile zehn Jahren Erfahrung in der Vermittlung der Positiven Psychologie in Coachingausbildungen.
Die wesentlichen Fragen, die im ersten Teil beantwortet werden:
Was ist Coaching? Was ist Positive Psychologie? Und wie bereichert Positive Psychologie das Coaching?
Was unterstützt positive Entwicklung? Wie denken und fühlen wir? Was bedeutet
Flourishin
g
?
Wie geht „Positive Diagnostik“ im Coaching?
Was sind „Positive Interventionen“? Welche Intervention passt zu wem? Wie viel unseres Glücks haben wir selbst in der Hand?
Was charakterisiert einen „Positiven Coachingprozess“?
Wie sich diese Grundlagen in einem Coachingprozess anhand verschiedener Themenfelder umsetzen lassen, dafür bietet Ihnen der zweite Teil dieses Buchs Anregungen, abgerundet durch Coaching-Fallbeispiele:
Emotionen, Aufmerksamkeit und Aufblühen
Stärken, Charakterstärken und das Gute Leben
Psychische Grundbedürfnisse, Motivation, Ziele und menschliches Wohlbefinden
Stress, seine Entstehung, Bewältigung – und Chancen, die darin liegen
Selbstregulation und Selbstmitgefühl
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des Buches und vor allem beim Umsetzen aller Anregungen und Impulse, die Sie für interessant und wertvoll halten.
Daniela Blickhan
März 2020
TEIL I: GRUNDLAGEN DES GELINGENDEN LEBENS
1. Coaching und Positive Psychologie
1.1 Was ist Coaching?
„Je früher der Mensch gewahr wird, dass es ein Handwerk, dass es eine Kunst gibt, die ihm zur geregelten Steigerung seiner natürlichen Anlagen verhelfen kann, desto glücklicher ist er.“
(Johann Wolfgang von Goethe)
Dachte Goethe an Coaching, als er am 17. März 1832 diese Formulierung in einem Brief an Wilhelm von Humboldt wählte? Aus heutiger Sicht beschreibt er nämlich punktgenau und zutreffend, worum es im Coaching geht: das Potenzial, das in einem Menschen bereits angelegt ist, wachsen und sich entfalten zu lassen, um damit zu mehr Zufriedenheit, Wohlbefinden und – in Goethes Worten – Glück beizutragen. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es laut Goethe ein Handwerk, eine Kunst. Ob er sich damals schon vorstellen konnte, dass einmal Menschen diese Kunst in den Mittelpunkt ihrer beruflichen Identität stellen und als Coaches1 ihren Lebensunterhalt damit verdienen würden? Und dass sich mit der Positiven Psychologie ein wissenschaftliches Forschungsgebiet entwickeln würde, das Glück und gelingendes Leben untersucht?
Coaching schien bis vor wenigen Jahren noch bestimmten Zielgruppen vorbehalten, zum Beispiel Leistungssportlern oder Führungskräften, heute ist es dagegen sehr weit verbreitet. „Ich bespreche das mal mit meinem Coach“ ist eine Aussage, die man inzwischen von den verschiedensten Menschen immer häufiger und selbstverständlicher im Alltag hört. Gibt man den Begriff „Coaching“ bei Google ein, so erscheinen sage und schreibe 1.730.000.000 Ergebnisse – weit mehr als eine Billion. Eine Internetsuche mit dem Begriff „Coachingausbildung“ erbrachte 2015 221.000 Ergebnisse und 2019 bereits 276.000. Mit dem Zusatz „Zertifikat“ ergaben sich 28.300 bzw. 38.100 Treffer; auch hier zeigt sich also eine steigende Tendenz. Der Markt für Coachingausbildungen ist groß und scheint weiter im Wachstum begriffen. Die Reglementierung bzw. Qualitätssicherung im deutschsprachigen Raum2 ist allerdings ausgesprochen gering. Seit 1999 wird die Ausbildung von Psychotherapeuten in Deutschland durch das Psychotherapeutengesetz geregelt, doch für den Bereich Coaching existieren bisher noch keine verpflichtenden gesetzlichen Richtlinien. Coach darf sich in Deutschland quasi jeder nennen.
Was ist Coaching also?
Sucht man nach einer Definition für Coaching, so fällt schnell auf, dass es keine einheitliche gibt, was angesichts der fehlenden Regelung des Coaching-Markts aber auch nicht weiter überrascht. Die Coaching-Berufsverbände haben jeweils eigene Definitionen. Einige Beispiele:
Coaching ist die professionelle Beratung, Begleitung und Unterstützung von Personen mit Führungs- / Steuerungsfunktionen und von Experten in Unternehmen / Organisationen. Zielsetzung von Coaching ist die Weiterentwicklung von individuellen oder kollektiven Lern- und Leistungsprozessen bzgl. primär beruflicher Anliegen. Als ergebnis- und lösungsorientierte Beratungsform dient Coaching der Steigerung und dem Erhalt der Leistungsfähigkeit. (…) Der Coach ermöglicht das Erkennen von Problemursachen und dient daher zur Identifikation und Lösung der zum Problem führenden Prozesse. Der Klient lernt so im Idealfall, seine Probleme eigenständig zu lösen, sein Verhalten / seine Einstellungen weiterzuentwickeln und effektive Ergebnisse zu erreichen. Ein grundsätzliches Merkmal des professionellen Coachings ist die Förderung der Selbstreflektion und -wahrnehmung und die selbstgesteuerte Erweiterung bzw. Verbesserung der Möglichkeiten des Klienten bzgl. Wahrnehmung, Erleben und Verhalten. (Deutscher Bundesverband Coaching e.V., 2019)
Klientenzentriertes professionelles Coaching ist lösungs-, potenzial- und zielorientierte, gleichberechtigte und partnerschaftliche Beratung und Begleitung von Menschen, unter Berücksichtigung der persönlich zu entwickelnden Fähigkeiten und Ziele des Klienten. Der gesunde Klient ist Auftragsgeber und vereinbart die Verwirklichung seiner beruflichen und / oder persönlichen Coaching-Ziele. Das Vorgehen hierbei ist immer vertraulich, autonom, partnerschaftlich und klientenorientiert. Professionelles Coaching beinhaltet u. U. auch die Aufarbeitung, Verarbeitung und Überwindung individueller Arbeits- und Lebens-Konflikte, „Missverständnisse und Verwechslungen“ in der Kommunikation, Ambivalenzen im Denken & Verhalten, Störungen in Emotion und Reaktion, Neuorientierung und Zufriedenheit für die Zukunft. Das Erarbeiten eines neuen beruflichen und / oder privaten Lebens und / oder die Entwicklung einer neuen Lebens-Biografie kann Bestandteil einer Neuorientierung im professionellen Coaching sein. Auf Wunsch des Klienten (Auftraggeber) kann nicht nur das berufliche, sondern auch das private soziale Umfeld (Familie, Partner, Bezugspersonen) diskret in das Coaching einbezogen werden. Coaching ist eine Dienstleistung. Es wird keine Heilbehandlung, keine juristische Beratung und keine Steuerberatung angeboten und / oder durchgeführt. (European Coaching Association, 2019)
Professionelles Coaching setzt ganz auf die Entwicklung individueller Lösungskompetenz beim Klienten.
Der Klient bestimmt das Ziel des Coachings. Der Coach verantwortet den Prozess, bei dem der Klient neue Erkenntnisse gewinnt und Handlungsalternativen entwickelt. Dabei wird dem Klienten die Wechselwirkung seines Handelns in und mit seinem Umfeld deutlich.
Coaching ist als strukturierter Dialog zeitlich begrenzt und auf die Ziele und Bedürfnisse des Klienten zugeschnitten.
Der Erfolg von Coaching ist messbar und überprüfbar, da zu Beginn des Prozesses gemeinsam die Kriterien der Zielerreichung festgelegt werden. (Deutscher Verband für Coaching und Training e.V. [dvct], 2019)
Wo arbeiten Coaches eigentlich?
Coaches sind beispielweise im Bereich Karriereberatung, Rhetorik, Politik oder im Leistungssport tätig – oder in der Persönlichkeitsentwicklung, dann nennen sie sich üblicherweise Life Coach. Auch von Führungskräften in der Wirtschaft wird heutzutage Coachingkompetenz erwartet, und eines der englischsprachigen Standardwerke verbindet in seinem Untertitel explizit Coaching mit Führung: Coaching for performance: Growing human potential and purpose: the principles and practice of coaching and leadership (Whitmore 2010). Teilnehmende an Coachingausbildungen kommen also aus ganz verschiedenen Feldern und mit unterschiedlichen Vorkenntnissen, Praxiserfahrung und Erwartungen. Führungskräfte aus der Wirtschaft möchten ihre berufliche Kompetenz erweitern, Berater oder Trainer wollen sich qualifizieren, um Coaching als externe Dienstleistung für Firmen erbringen zu können. Ein weiterer, kleinerer Anteil der Teilnehmenden kommt mit dem primären Interesse an persönlicher Weiterentwicklung und möchte die erworbene Coachingkompetenz zunächst einmal für das eigene Selbstcoaching und Selbstmanagement einsetzen, bevor sie sich entscheiden, ob sie andere Menschen professionell coachen möchten. Auch für Psychotherapeuten und Ärzte wird Coaching zunehmend attraktiv, da Coaching eine Psychotherapie sinnvoll ergänzen kann (vgl. z. B. Joseph & Linley 2011). Ärzte können sich so ein zusätzliches Arbeitsfeld erschließen und müssen sich bei der Abrechnung von Coaching nicht an Vorgaben ihrer Gebührenordnung orientieren.
Auf welcher Grundlage steht Coaching? Wie wissenschaftlich ist Coaching heute?
Bereits 2006 wurde von wissenschaftlich orientierten Psychologen wie Alex Linley, Vorreiter aus England für die Verbindung von Positiver Psychologie und Coaching, die Frage gestellt, ob die empirische Forschung im Bereich Coaching denn ausreichend sei, gerade angesichts seines schnell wachsenden Markts:
Das bemerkenswerte Wachstum im Feld Coaching hat bisher noch keine vergleichbare Entsprechung in der zugrunde liegenden wissenschaftlichen Forschung gefunden. Dafür gibt es mehrere mögliche Erklärungen, darunter die relative Schnelligkeit dieses Wachstums im Vergleich zur Schnelligkeit der Forschung, die Verortung von Coaching an der Schnittstelle zwischen Business-Beratung und angewandter Psychologie, und unterschiedliche Anforderungen, die Coaches selbst vor die Wahl stellen, entweder Coach oder Forscher zu sein (Linley 2006, S. 1, Übersetzung Sasha Blickhan).
Linley charakterisiert diese erste Generation im Coaching dadurch, dass „Coaching-Gurus“ zunächst speziell im Business-Bereich Aufmerksamkeit für Coaching generierten, im Lauf der Zeit jedoch zunehmend in ihren eigenen „geschlossenen Systemen“ stecken blieben. Coaching der zweiten Generation orientiert sich seiner Ansicht nach heute deutlich stärker an psychologischen Modellen und Prinzipien und damit insgesamt mehr und mehr an empirischer Forschung. Dafür sprechen mittlerweile weitere Fakten:
Im Jahr 2015 wurde der Studiengang Positive Psychologie an der
University of East London, der erste europäische Master of Applied Positive Psychology (MAPP MSc),
in einen Hybridstudiengang zum
Master of Applied Positive Psychology & Coaching Psychology (MSc)
umgewandelt.
Der Forschungsbereich der
Coaching Psychology
expandiert seit Jahren, besonders in England und Australien, und verzeichnet eigene Fachzeitschriften (z. B.
Coaching Psychologist
der
British Psychological Society
oder
International Coaching Psychology Review
der
Australian Psychological Society
).
Vor einigen Jahren erschien das
Wiley-Blackwell Handbook of the Psychology of Coaching and Mentoring
(Passmore, Peterson & Freire 2013), das den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung im Bereich Coaching zusammenfasst.
An privaten Hochschulen in Deutschland gibt es bereits Studiengänge für
Life Coaching
mit einem Bachelorabschluss (BSc).
Coaching zeigt sich also inzwischen als ernst zu nehmendes Anwendungsgebiet der Psychologie. Besonders vielversprechend scheint seine Verbindung mit der Positiven Psychologie, die Coaching ideal ergänzen und bereichern kann, sowohl theoretisch als auch praktisch.
1.2 Was ist Positive Psychologie?
Positive Psychologie ist die Wissenschaft des gelingenden Lebens und Arbeitens.
So antworte ich seit Jahren auf dazu gestellte Fragen oder beginne damit Vorträge und Seminare. Meist führt diese Antwort3 zu einem verstehenden Kopfnicken, häufig auch zu interessierten Nachfragen, was denn ein „gelingendes Leben“ sei. Und immer wieder zu der schmunzelnden Frage, ob es denn auch eine „negative Psychologie“ gebe. Gleich vorweggenommen: Nein, die gibt es nicht. Niemals sollte der Begriff einer „positiven Psychologie“ die Existenz einer „negativen Psychologie“ implizieren oder die bestehende Psychologie gar als „negativ“ abwerten. Positive Psychologie (ab jetzt mit PP abgekürzt) wollte von Anfang an als notwendige und sinnvolle Ergänzung der klassischen Psychologie verstanden werden, als eine, die hoffentlich bald vollständig in die Psychologie integriert sein wird (Peterson 2006).
Christopher Peterson, charismatischer Mitbegründer der PP, formuliert es so: „PP ist eine Wissenschaft, keine recycelte Version des positiven Denkens.“ Die PP richtet sich an alle Menschen, denn jeder trägt in sich das Potenzial zu einem erfüllenden, gelingenden Leben. Das umfasst sowohl klinische als auch nicht-klinische Zielgruppen, Patienten und Klienten gleichermaßen. Um auch hier wieder Christopher Peterson zu zitieren: „Was das Leben lebenswert macht, das ist kein psychologischer Prozess. Es ist Arbeit, Liebe und Spiel (work, love and play; Peterson 2013).“4
Warum brauchen wir die Positive Psychologie heute mehr denn je?
Weltweit stehen heute Depressionen in Ländern mit mittlerem oder hohem Einkommen an erster Stelle der sogenannten Krankheitslast (World Health Organisation [WHO] 2013). Psychische Gründe rangierten 2019 an zweiter Stelle bei den Gründen für berufliche Fehlzeiten und sollten laut WHO bald auf Platz eins zu finden sein. Sowohl individuell als auch gesellschaftlich stehen wir deshalb vor der Aufgabe, wirksame Methoden zu entwickeln und flächendeckend einzusetzen, damit mehr Menschen ein gelingendes Leben führen können. Doch eine bloße Reduktion depressiver Symptome reicht dafür nicht aus, und das ist bereits eine der Kernaussagen der Positiven Psychologie: Es genügt nicht, Menschen von „minus 5“ auf „null“ zu verhelfen. Wir müssen Menschen vielmehr dabei unterstützen, in den Bereich von „plus 5“ oder „plus 10“ zu kommen – und zwar unabhängig davon, ob sie eine psychische Diagnose tragen und damit eine klinische Zielgruppe sind oder ob sie einer nicht-klinischen Zielgruppe angehören und damit potenzielle Klient/innen für Coaches sind. Und nachdem auch in hoch entwickelten Ländern wie Deutschland nur ein Bruchteil der Betroffenen auch tatsächlich professionelle Unterstützung durch Therapeuten erhält, wenden sie sich immer öfter auch an Coaches, um Hilfe zu erhalten.
Wo liegen die Wurzeln der Positiven Psychologie?
Der amerikanische Psychologieprofessor Martin Seligman wurde 1998 zum Präsidenten der Amerikanischen Psychologenvereinigung (APA) gewählt, was für amerikanische Psychologen eine der höchstmöglichen Ehrungen darstellt. In seiner Antrittsrede forderte er, dass sich die Psychologie wieder auf ihr „Geburtsrecht“ besinnen und sich mit der Erforschung positiver Emotionen, positiver Eigenschaften und positiver organisationaler bzw. gesellschaftlicher Rahmenbedingungen befassen solle. Statt weiterhin vorwiegend auf Defizite und Krankheit zu blicken, wie das in der klinischen Psychologie seit dem Zweiten Weltkrieg der Fall war, sollten Psychologen sich nun wieder darauf fokussieren, was das Leben lebenswert macht, und die Voraussetzungen für ein solches Leben schaffen. Seligman prägte damit die Positive Psychologie als neuen Forschungszweig der akademischen Psychologie.
Positive Psychologie als empirische Wissenschaft begann also formal mit dieser Ansprache vor der Amerikanischen Psychologen-Vereinigung im Jahr 1998 und Martin Seligman gilt entsprechend bei vielen Menschen, auch Fachleuten, als Begründer bzw. „Vater der Positiven Psychologie“. Die Ursprünge der PP reichen aber viel weiter zurück. Anfänge ihrer Forschungsfragen finden sich bereits bei den antiken Philosophen, zum Beispiel bei Aristoteles mit seinen Werken über Themen wie Glück, Sinnhaftigkeit und Tugend. Den bekannten Psychologen Abraham Maslow bezeichne ich gerne als „Großvater der Positiven Psychologie“, da er bereits im Jahr 1954 den Begriff Positive Psychologie prägte, als er das letzte Kapitel seines Buchs „Motivation und Persönlichkeit“ mit den Worten „Towards a Positive Psychology“ überschrieb. Maslow forderte bereits damals, die Psychologie müsse positiver und weniger negativ werden. Sie solle „keine Furcht haben vor den höheren Möglichkeiten der menschlichen Existenz“ (Maslow 1965, S. 27). Dem hätte auch Viktor Frankl zugestimmt, der zu einer ähnlichen Zeit bereits eine „Höhenpsychologie“ in Ergänzung zur damals vorherrschenden Tiefenpsychologie forderte. Carl Rogers, der Begründer der klientenzentrierten Gesprächsführung und -therapie, wäre neben Abraham Maslow und Viktor Frankl der dritte „Großvater der PP“, da er stets betonte, wie prinzipiell positiv und entwicklungsfähig jeder Mensch sei. Mit seinem Konzept der fully functioning person5 nahm Rogers 50 Jahre vor der Begründung der empirischen Positiven Psychologie durch Seligman und seine Kollegen bereits Aufblühen (Flourishing) als Kernkonzept der Positiven Psychologie vorweg.
1.3 Warum Positive Psychologie für Coaching?
Die Positive Psychologie ist eine Wissenschaft mit weit zurückreichenden Wurzeln und zahlreichen großen Vordenkern. Inzwischen zählt sie zu den am schnellsten wachsenden Forschungsgebieten innerhalb der Psychologie. Kurz gesagt geht es bei der PP um die wissenschaftliche Betrachtung dessen, was das Leben lebenswert macht. Dazu gehören sowohl Stärken, die es zu erkennen und zu fördern gilt, als auch Schwächen bzw. Widrigkeiten, mit denen es konstruktiv umzugehen gilt. Im Englischen lässt sich das sehr prägnant formulieren: Positive Psychologie ist the science of what goes right in life – die Wissenschaft davon, was im Leben gut läuft. PP befasst sich also auf wissenschaftlicher Grundlage mit dem, was uns stärkt und woran wir wachsen können – und damit ist sie eine ideale Grundlage für Coaching, sowohl im Hinblick auf Konzepte und Theorien als auch auf Interventionen und deren Umsetzung in einem Beratungsprozess.
„Coaching ist eine Tätigkeit auf der Suche nach Rückgrat (backbone), genauer gesagt zweifachem Rückgrat: ein wissenschaftliches, evidenzbasiertes Rückgrat und ein theoretisches. Ich glaube, das neue Feld der Positiven Psychologie bietet dieses doppelte Rückgrat. Positive Psychologie kann dem Coaching einen abgesteckten Raum für die Anwendung bieten, mit Interventionen und Messverfahren, die funktionieren, und mit einer Vorstellung von angemessenen Qualifikationen, um Coach zu sein.“ (Seligman 2007, S. 266, Übers. D.B.)6
Mit diesen Worten beschrieb Martin Seligman im Jahr 2007 den Stellenwert der PP für den Bereich des Coaching. Er betrachtete Coaching damals noch als einen relativ neuen Ansatz, der noch nicht auf eigenen Beinen stehen könne, geschweige denn eine empirische Grundlage habe. An anderer Stelle nennt Seligman Coaching in einem Atemzug mit esoterischen Praktiken. Die PP könne seiner Meinung dem Coaching wesentliche Impulse für Theoriebildung und Evidenzbasierung geben. Seitdem hat sich das Feld des Coaching aber ganz wesentlich professionalisiert und auch akademisiert. Weltweit entstehen Coaching-Studiengänge und es arbeiten entsprechende Forschungsgruppen. Zwei der führenden Coaches der Positiven Psychologie, Suzy Green (Australien) und Stephen Palmer (England), betonen in ihrem 2018 erschienenen Buch Positive Psychology Coaching in Practice, dass genau diese Brücke zwischen Wissenschaft und Forschung nun immer stärker werde, weil sich Anwender an der Forschung orientieren und diese in ihre Praxis einbeziehen, und Forscher wiederum mehr die Wirkung ihrer Studien für die Anwendung in den Blick nehmen.
Die Positive Psychologie als wissenschaftlich basierter Ansatz ist deshalb eine ideale Basis für modernes, ganzheitlich verstandenes Coaching.
1 Die gendergerechte sprachliche Darstellung für Coaches und ihre Kund/innen stellt eine Herausforderung dar. Auch wenn mir der Begriff „die Coachin“ inzwischen mehrfach begegnet ist, so halte ich ihn nicht für sinnvoll. Coach ist ein englischer Begriff und als solcher genderneutral. Zwischen maskuliner, femininer und weiterer Genderform zu differenzieren ist im Deutschen sinnvoll, bei einem englischen Wort halte ich das aber für zu umständlich.Ich werde in diesem Buch häufig die männliche Form verwenden und bitte alle Leserinnen, sich davon gleichermaßen angesprochen zu fühlen. Aus Gründen der Prägnanz und Lesbarkeit verzichte ich auf Mehrfachnennungen wie „die Klientinnen und Klienten“.
2 Ich beziehe mich in diesem Buch auf den Coaching-Markt in Deutschland. In anderen deutschsprachigen Ländern sind die Regelungen abweichend. So ist für Coaching in Österreich beispielsweise eine Anerkennung als Lebens- und Sozialberater vorgeschrieben. Diese Ausbildung ist umfangreicher als der deutsche Heilpraktiker für Psychotherapie.
3 Das Forschungsgebiet der Positiven Psychologie wird an anderer Stelle ausführlich beschrieben (Blickhan 2018), sodass die Darstellung hier eher kurz gehalten wird.
4 Damit steht Peterson übrigens in interessanter Gesellschaft, denn bereits Sigmund Freud beschrieb es als Ziel der Psychoanalyse, „arbeitsfähig, liebesfähig und genussfähig“ zu werden.
5 Leider lässt sich fully functioning nur schlecht direkt ins Deutsche übertragen, da hier das Wort „funktionieren“ einen eher negativen Beigeschmack hat. Fully functioning beschreibt dagegen volle psychische Leistungsfähigkeit – wobei „Leistung“ hier nicht „Arbeitsleistung“ bedeutet, sondern das ganzheitliche und persönlich sinnstiftende Nutzen des eigenen Potenzials.
6 Im Original lautet dieser Abschnitt folgendermaßen: „Coaching is a practice in search of a backbone, two backbones actually: a scientific, evidence-based backbone and a theoretical backbone. I believe that the new discipline of positive psychology provides both those backbones. Positive psychology can provide coaching with a delimited scope of practice, with interventions and measurements that work, and with a view of adequate qualifications to be a coach.“
2. Positive menschliche Entwicklung: Denken, Fühlen, Flourishing
2.1 Modelle der Psyche (Sasha Blickhan)
Jeder Coach arbeitet mit der menschlichen Psyche und damit mit emotionalen, kognitiven und motivationalen Prozessen. Dem zugrunde liegt immer auch eine – zumindest implizite – Vorstellung davon, wie diese Prozesse funktionieren und miteinander zusammenhängen. Menschen haben unterschiedliche Auffassungen davon, was unser Denken, Fühlen und Handeln bestimmt, und damit verbunden auch unterschiedliche Menschenbilder, die sich auf den Umgang mit sich selbst und anderen auswirken. Wer hinter allem unterdrückte unbewusste Triebe vermutet, wird das Verhalten und die Aussagen von Menschen (auch von Klienten) anders interpretieren als jemand, der davon ausgeht, dass Menschen prinzipiell reflexionsfähig, ehrlich und wachstums- oder werteorientiert sind.
Sowohl im Coaching als auch für den guten Umgang mit sich selbst lohnt es sich zu wissen, womit man es zu tun hat. Es ist also hilfreich, sich ein Bild von der menschlichen Psyche und den Verarbeitungsprozessen im menschlichen Gehirn zu machen, das einerseits zur empirischen Realität passt und andererseits einen konstruktiven Umgang mit diesen Prozessen ermöglicht. Im Coaching kann das sowohl für das Verstehen und Einordnen von Beobachtungen hilfreich sein als auch für die Psychoedukation: Auch Klienten können davon profitieren, sich eine konstruktive und handhabbare Vorstellung von ihrer Psyche zu machen.
In diesem Kapitel wird im Zusammenhang mit verschiedenen historischen und laienpsychologischen Vorstellungen von der Psyche ein Modell betrachtet, das die Verschiedenartigkeit und das Zusammenspiel von automatischen (automatic) und kontrollierten (controlled) Prozessen im Denken, Fühlen und Handeln auf wissenschaftlich anschlussfähige Weise begreifbar und anschaulich macht (Kahneman 2011a).
2.1.1 Historische Vorstellungen
Viele Menschen differenzieren intuitiv zwischen Denken und Fühlen, also zwischen eher kognitiven, auch sprachlich repräsentierbaren, und eher emotionalen Formen der Verarbeitung. Beide sind Teil des menschlichen Erlebens und der Art und Weise, wie wir mit Informationen, Eindrücken und Erfahrungen umgehen. Die meisten psychologischen und praktischen Modelle der Psyche sind sich einig, dass Denken, Fühlen und Handeln einander beeinflussen und dass sie zwar eng miteinander zusammenhängen, aber voneinander unterscheidbar sind.
Viele Modelle der menschlichen Psyche in der wissenschaftlichen und der angewandten Psychologie, in der Philosophie und auch in der persönlichen Vorstellung Einzelner treffen noch weitere Unterscheidungen innerhalb psychischer Vorgänge (und zum Teil sehr komplexe Vorannahmen, wie sie miteinander in Beziehung stehen):
Denken – Fühlen
kognitiv – emotional
rational – irrational oder non-rational
bewusst – unbewusst
explizit – implizit
freiwillig, absichtlich gesteuert – unwillkürlich, automatisch
ergebnisoffen, frei – festen Mustern folgend, vorbestimmt
erlernt – instinktiv
Verstand, Vernunft – Trieb, Neigung
Kopf – Herz, Bauch
geistig – sinnlich
Die Kategorien in der linken und rechten Spalte überschneiden sich zwar teilweise, sind aber nicht deckungsgleich: Nicht jeder, der zwischen Denken und Fühlen unterscheidet, hält Gefühle für irrational oder für instinktiv vorbestimmt. Verschiedene Menschen (und Coaches) finden manche Unterscheidungen richtiger, hilfreicher oder sinnvoller als andere. Davon könnten einige je nach Kontext auch kontraproduktiv sein, zum Beispiel im Coaching, während andere vielleicht eine hilfreiche Einordnung des eigenen Erlebens ermöglichen.
Gerne wird einer solchen deskriptiven Unterscheidung von Verarbeitungsprozessen auch gleich eine Wertung beigefügt, nach der manche psychischen Vorgänge als höher entwickelt oder komplexer und andere als schlichter oder niedriger eingestuft werden. Philosophen, Psychologieanwender und Laien ergreifen dann oft mehr oder weniger ausdrücklich Partei für eine Spalte: Rationalisten wie Kant und Platon betonen die Bedeutung der Vernunft, die unvernünftige Impulse zügeln und steuern soll, während manche Verfechter der Intuition Menschen dazu raten, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen und sich nicht von gesellschaftlich überformten Denkmustern und Überzeugungen beirren zu lassen. Wer an das sogenannte Unbewusste glaubt, spricht ihm oft eine ungeahnte Macht zu. Wer den Menschen für das einzig vernunftbegabte Lebewesen hält, mahnt ihn, sich seines Verstandes zu bedienen (ein berühmter Leitspruch von Kant) und sich nicht auf das Niveau anderer Tiere hinabzubegeben.
Platon bietet (im vierten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, daher ohne empirische Grundlage) für das Zusammenspiel verschiedener Prozesse in der menschlichen Psyche die Metapher eines Wagenlenkers an, anhand dessen Sokrates im Phaedrus-Dialog das Phänomen der Liebe erläutert. Der Lenker hat die Aufgabe, zwei geflügelte Pferde zu steuern. Ein Pferd versinnbildlicht Emotionen und Verhaltenstendenzen, die den Zielen des Verstandes gut entsprechen oder sich leicht dafür einspannen lassen, wie Ehrgeiz, Bescheidenheit und Tapferkeit. (In Platons aus heutiger Sicht etwas zweifelhafter Metaphorik ist dieses Pferd außerdem weiß, von gutem Wuchs und tadelloser Züchtung.) Das andere Pferd ist störrisch, sprunghaft und nur mit Peitschenhieben und Sporen zu bändigen. Es steht für Impulse wie Stolz und Faulheit (und ist bei Platon krummbeinig, schwerhörig und breitnasig mit dunklem Fell und trüben Augen).
Der Wagenlenker entspricht in der Metapher in etwa dem bewussten, reflektierten Verstand oder dem expliziten Ich, mit dem sich der Mensch typischerweise am leichtesten direkt identifizieren kann, dessen Aufgabe aber in Platons Darstellung in erster Linie im Umgang mit den Pferden besteht. Ohne deren Antrieb kommt der Wagen sprichwörtlich nicht voran. Damit übernimmt der Wagenlenker die Rolle, die auch der schottische Philosoph David Hume (in seiner Abhandlung über die menschliche Natur, 1739) im 18. Jahrhundert dem Verstand zuspricht, als „Diener der Leidenschaften“, auf deren Motivation jede rationale Überlegung angewiesen ist.
In Platons und Humes Betrachtungen der Psyche spiegelt sich die im antiken Griechenland und bei einigen Philosophen des 18. Jahrhunderts verbreitete Auffassung, dass Emotionen, Gefühle und nicht-rationale Impulse allgemein nicht notwendigerweise im Konflikt mit dem Verstand stehen, sondern im Gegenteil gute und harmonische Mitspieler sein können, die für die Handlungsfähigkeit des Menschen sorgen. Seit der Aufklärung hat sich im Gegensatz dazu in Teilen der Philosophie und in populären Vorstellungen ein eher konträres Bild der verschiedenen Teile der Psyche durchgesetzt, in dem die Vernunft eher gegen irrationale Triebe ankämpfen muss.
Immanuel Kant sieht (in der Grundlegung der Metaphysik der Sitten, 1785) das Gute im Menschen rein in seiner rationalen Natur „als vernünftiges Wesen“ begründet. Wir seien aber „mit so vielen Neigungen affiziert“, dass es uns grundsätzlich schwerfalle, den Gesetzen der Vernunft zu gehorchen. Kants moralisches Ideal ist die Herrschaft des rationalen Willens über alle nicht-rationalen Impulse und Triebe. Wer nur aus „Neigung“ Gutes tut, wen also emotionale Motivationen zu altruistischem und moralischem Verhalten bewegen, der ist aus Kants Sicht weniger moralisch lobenswert als jemand, dem dasselbe Verhalten eigentlich widerstrebt und der sich dazu überwinden muss. Das parodierte sein Zeitgenosse Friedrich Schiller in seinen Xenien mit den satirischen Gedichtstrophen Gewissensskrupel und Decisum:
Gerne dien ich den Freunden, doch tu ich es leider mit Neigung,
und so wurmt mir oft, daß ich nicht tugendhaft bin.
Da ist kein anderer Rat, du mußt suchen, sie zu verachten,
und mit Abscheu als dann tun, was die Pflicht dir gebeut.
Ganz abgesehen von der Absurdität, die sich in dieser Überspitzung von Kants Rationalismus zeigt, stellt sich aus psychologischer Sicht die Frage, ob eine Vorstellung vom Verstand als siegreicher Gegner der Gefühle überhaupt realisierbar ist.
2.1.2 System 1 und 2 als Elefant und Reiter
In der Glückshypothese (2006), die historische philosophische Betrachtungen mit modernen psychologischen Erkenntnissen verbindet, bietet auch der Psychologe Jonathan Haidt eine Metapher für die verschiedenen Prozesse an, die in unserer Psyche zusammenspielen. Er knüpft damit an historische Bilder von Pferden oder anderen Tieren und ihren Reitern, Kutschern oder Wagenlenkern an, aber auf eine Weise, die den evolutionär begründeten Größenverhältnissen der verschiedenen metaphorischen Akteure besser entspricht.
Abbildung 2.1: Elefant und Reiter (Sasha Blickhan, nach Haidt 2006 und Kahnemann 2011)
Diese Akteure sind bei Haidt ein Elefant und sein Reiter. Der Elefant hat die Kontrolle über das Vorwärtskommen der beiden, deutlich mehr Kraft, ein gutes Gedächtnis und ein hohes Interesse an Sicherheit und Bequemlichkeit. Er fokussiert eher auf die unmittelbare Umgebung als auf entfernte Gegebenheiten und auf die konkrete Landschaft, nicht auf abstrakte Repräsentationen.
Der Elefant steht für das, was in Daniel Kahnemans Dual-Systems-Modell der Verarbeitung (2011b) schlicht System 1 heißt, nämlich die automatische Verarbeitung. Sie beinhaltet Gefühle, aber auch unwillkürliche kognitive Bewertungen oder (voreilige) Schlüsse und Vorurteile, Wahrnehmung, Gedächtnis, unwillkürliche Aufmerksamkeitssteuerung und alles, was in historisch und populär verbreiteten Vorstellungen dem sogenannten Unbewussten zugeordnet wird.
Diese Art der Verarbeitung geht schnell und effizient, denn für sie ist unser Gehirn seit Jahrmillionen evolutionär optimiert. Die entsprechenden kognitiven, affektiven und motivationalen Prozesse laufen bottom-up, also direkt auf Reiz- und Reaktionsebene ohne Umwege über abstrakte Regeln. Reizmuster sind hier implizit verankert, nicht explizit reflektiert. Der Elefant hat also klare Präferenzen, die er nicht in Worte fasst, sondern die sich direkt im Verhalten ausdrücken.
Der Reiter hat mehr Überblick und größere Freiheit im Planen strategischer Routen. Er steht für Kahnemans System 2, die kontrollierte Verarbeitung. Das heißt bewusstes, reflektiertes Nachdenken, Impulskontrolle, Planen und Belohnungsaufschub – Fähigkeiten, die der Mensch im Lauf seiner kognitiven Entwicklung ausbildet und in denen sich Menschen auch unterscheiden. Außerdem ist der Reiter für die sprachliche Verarbeitung zuständig und damit Sprecher für den Menschen als Ganzes, also sowohl für den Reiter als auch für den Elefanten.
Für die Fortbewegung ist der Reiter allerdings wiederum auf den Elefanten angewiesen, dessen Kooperation sich nicht erzwingen lässt. Hier werden die Größenverhältnisse bedeutsam, die Haidt in seiner Metapher versinnbildlicht: Platons störrisches Pferd lässt sich vielleicht mit Sporen und Peitschenhieben mehr schlecht als recht auf den gewünschten Pfad prügeln, doch es wird darunter leiden und die Beziehung zum Wagenlenker ist gefährdet. Wenn ein widerwilliger Elefant mit Gewalt zu etwas gezwungen wird, das ihm nicht entspricht, können die Konsequenzen umso drastischer sein. Wenn der Elefant sich wehrt, kann der Reiter wenig gegen ihn ausrichten. Es ist also deutlich sinnvoller (und sicherer) für den Reiter, mit dem Elefanten zu arbeiten statt gegen ihn.
Der Reiter mag besondere Fähigkeiten haben, ist dem Elefanten aber zugleich in vielerlei Hinsicht unterlegen: Die Verarbeitung auf Reiterebene ist zwar nicht an feste Reizmuster gekoppelt und dadurch flexibler, dafür aber auch deutlich energieaufwendiger und langsamer. Evolutionär gesehen ist der Reiter viel jünger als der Elefant und unterscheidet den Menschen von Tieren, die keine Fähigkeit zum bewussten und abstrakten Verarbeiten haben. Reiterprozesse sind für uns evolutionär von Vorteil – es lohnt sich, über Dinge nachzudenken, statt einfach dem erstbesten Impuls zu folgen –, aber nicht unmittelbar für das Überleben entscheidend und im Zweifelsfall eher verzichtbar. Werden die Ressourcen im Organismus knapp, etwa durch Stress, Müdigkeit, Hunger, Ablenkung oder Überforderung, wird im Reservemodus in erster Linie der Elefant versorgt und der Reiter tut sich schwerer, überhaupt seine Aufgaben zu erfüllen, geschweige denn den Elefanten von seinen Vorstellungen zu überzeugen. (So lässt sich metaphorisch das Phänomen der ego depletion erklären, auf das im Kapitel 10 näher eingegangen wird.)
Der Elefant bewegt sich am liebsten auf festen Wegen und tut das mit oder ohne das Mitwirken des Reiters, gegebenenfalls auch gegen dessen Willen. Wenn den beiden etwas über den Weg läuft, was dem Elefanten gefährlich vorkommt, weicht dieser ganz von selbst aus, ob der Reiter will oder nicht – oft sogar bevor der Reiter überhaupt etwas von der Gefahr mitbekommen hat, geschweige denn sie benennen kann.
Der Elefant ist für die automatische Steuerung der Aufmerksamkeit und für das Aktivieren von Aktionspotenzialen zuständig. Noch während ein Reiz im sensorischen Zentrum überhaupt für die bewusste Wahrnehmung vorbereitet wird, wird oft anderswo im Gehirn und im gesamten Organismus bereits neuronal und hormonell eine gefühlsmäßige Bewertung oder eine Stressreaktion vorbereitet. Der Elefant steht also bereits in den Startlöchern, noch ehe der Reiter sich und ihm erklären kann, wo es hingeht und warum.
Werte, Grundbedürfnisse, Emotionen und Stärken sind auf der Ebene des Elefanten verankert. Versprachlicht werden sie durch den Reiter und für den konstruktiven Umgang damit sind beide gemeinsam zuständig. Es ist also für einen guten Umgang mit sich selbst sinnvoll, die beiden in eine gute Kommunikation miteinander zu bringen. Der Reiter kann noch so logische Überlegungen anstellen, Ziele formulieren oder vermeintliche Werte benennen – wenn der Elefant nicht damit einverstanden ist, werden die „Flausen“ des Reiters nicht ins Erleben, in die Motivation und damit ins Handeln integriert. Für die metaphorische Fortbewegung ist schließlich der Elefant verantwortlich.
Umgekehrt profitiert der Elefant aber auch vom Weitblick des Reiters und ist außerdem sehr lernfähig. Viele Aufgaben, die zunächst der Reiter bewältigen muss, gehen mit Übung und Training ins Repertoire des Elefanten über. So können die meisten erwachsenen Menschen in abstrakten Zeichen automatisch Bedeutung sehen (Lesen), komplexe Gefährte bedienen (Auto fahren), beim Vibrieren eines flachen metallischen Quaders sofort neugierig werden und in Kommunikationsbereitschaft gehen (Telefonbenachrichtigungen erkennen) und so weiter. All das ist dem Menschen und seinem Elefanten nicht angeboren – der Elefant des Menschen ist aber im Vergleich zu anderen Lebewesen (einschließlich echter Elefanten) einzigartig gelehrig. So können menschliche Elefanten auch lernen, bei einem kleinen Ärgernis nicht sofort in Wutgeschrei auszubrechen und hinter dem Verhalten anderer Menschen prinzipiell positive Absichten und Bedürfnisse zu vermuten, optimistisch zu sein oder schöne und erfreuliche Kleinigkeiten im Alltag zu bemerken.
Kahneman betont in Schnell und langsam denken (2011), dass die Bezeichnungen System 1 und System 2, die in Haidts Metapher dem Elefanten und dem Reiter entsprechen, ihrerseits vereinfachende Personifikationen darstellen und sich nicht etwa direkt auf die Struktur des Gehirns übertragen lassen. Die Neurophysiologie, die der automatischen und der kontrollierten Verarbeitung zugrunde liegt, ist zu komplex, um sie grob auf zwei Netzwerke oder Strukturen zu reduzieren. Zwar gibt es Hinweise auf Aktivierungen in unterschiedlichen Arealen bei unterschiedlichen Aktivitäten – tendenziell spielen sich Reiterprozesse in der äußeren Hirnrinde (insbesondere im präfrontalen Kortex) ab und Elefantenverarbeitung in den tieferen Hirnstrukturen (einschließlich des limbischen Systems) – doch weder Kahneman noch Haidt würden den beiden je einen einzigen festen Wohnort zuweisen. Speziell der Elefant ist schließlich für eine Menge vielfältiger und komplexer Prozesse zuständig, die sehr unterschiedlich und oft unabhängig voneinander (und erst recht vom Reiter) vonstattengehen. Dass all diese Prozesse dem System 1 oder dem Elefanten zugeschrieben werden, ist sprachlich bloß eine Vereinfachung der Aussage, dass sie automatisch und weitgehend unbewusst ablaufen. Umgekehrt bedeutet eine Zuordnung zum System 2 oder Reiter, dass ein Prozess ressourcenintensiv ist und nur mit bewusster Steuerung funktioniert. Die Zuordnung ist also eine Charakterisierung verschiedener Funktionsweisen der Verarbeitung.
2.1.3 Nutzen der Metapher
Die Metapher von Elefant und Reiter macht die Unterschiedlichkeit und das Zusammenspiel automatischer und kontrollierter Prozesse in der kognitiven, affektiven und handlungsorientierten Verarbeitung des Menschen greifbar. Das Bild hilft beim Einordnen, Erklären und Veranschaulichen zahlreicher psychologischer Phänomene und kann damit nicht nur Coaches unterstützen, Prozesse zu verstehen, sondern auch Klienten.
Viele Menschen reflektieren ihre Gedanken und Gefühle anhand mehr oder weniger bewusster und mehr oder weniger empirisch anschlussfähiger Vorstellungen von der Struktur der Psyche. Unliebsame Angewohnheiten oder Widerstand gegen abstrakte Vorsätze werden vielleicht einem sogenannten inneren Schweinehund zugeschrieben – das Bild des Elefanten weckt im Vergleich dazu bei vielen mehr Vertrauen, Respekt und Bereitschaft zum freundlichen Umgang. Hinter spontanen Verhaltensweisen, Wahrnehmungen von Formen in Tintenklecksen oder Träumen wird eine geheime Logik vermutet. Und tatsächlich folgt die automatische Verarbeitung auch ihren eigenen Gesetzen, die aber nicht notwendig logischen Charakter haben, sondern bottom-up gelernt werden. Jemand formuliert ein Ziel und wundert sich dann, warum ihm die Motivation dafür fehlt oder seine Gewohnheiten einer anderen Agenda zu folgen scheinen. Hier ist der Elefant möglicherweise noch nicht überzeugt von einem Vorsatz, den der Reiter verkündet hat. Überzeugungen und Glaubenssätze haben rätselhafte Ursprünge und können einander auch widersprechen – auch für sie ist der Elefant zuständig, und inhaltliche Widersprüche oder Gegenbeweise interessieren eher den Reiter.
Mit der Metapher von Elefant und Reiter werden viele dieser Phänomene und Prozesse auf eine neue, konstruktive Art und Weise beschreibbar. Gewohnheiten und Überzeugungen sind Elefantensache, und nicht immer sind sich Elefant und Reiter einig. Der Elefant ist aber kein mysteriöses Ungeheuer, sondern einfach eine Veranschaulichung von bestimmten Aspekten unserer Verarbeitung. Er ist auch kein Fremdkörper, sondern gehört genauso zu jedem Menschen wie sein Reiter. Dass der sich wiederum schneller und direkter angesprochen fühlt, wenn es um die Identität dieses Menschen geht, lässt sich über seine Nähe zur sprachlichen Verarbeitung erklären. Doch es wäre ein Irrtum, sich deshalb mit dem eigenen Reiter gegen den Elefanten verbünden zu wollen. Das wäre psychisch so kontraproduktiv wie unmöglich.
Einige weitere hilfreiche Erkenntnisse lassen sich aus der Metapher ableiten:
Elefanten sind soziale Lebewesen. Auch der Mensch ist sehr sozial orientiert. Sein Grundbedürfnis nach sozialer Verbundenheit und Zugehörigkeit ist auf Elefantenebene verankert.
Ein Elefant ohne Reiter ist immer noch ein Elefant. Die automatische Verarbeitung funktioniert also auch unter Druck oder mit letzter Kraft, auch wenn dann inhaltliche Fehler oder vorschnelle Reaktionen passieren können. Ein Reiter ohne Elefant hingegen ist gar kein Reiter mehr. Prozesse der gesteuerten Verarbeitung kommen alleine nicht von der Stelle.
Elefanten haben ein sehr gutes Gedächtnis und sind lernfähig. Die automatische Verarbeitung des Menschen ist extrem flexibel und kann auch komplexe Verhaltensweisen, Denk- und emotionale Muster trainieren. Unsere Werte, Stärken, sozialen Beziehungen und hilfreichen Überzeugungen sind nicht angeboren, aber auf Elefantenebene gelernt und dort stabil.
Der Reiter arbeitet oft als Sprachrohr für den Elefanten, ohne zu bemerken, dass er gar nicht selbst zu den Schlüssen gekommen ist, die er aus tiefster Überzeugung stellvertretend für beide formuliert. Haidt nennt das in seiner Arbeit zu moralischen Emotionen das „rationale Schwanzwedeln eines emotionalen Hundes“ – automatische, intuitive Bewertungen auf Gefühlsebene werden sprichwörtlich rationalisiert, also nachträglich mit einer rationalen Erklärung versehen.
Der Elefant reagiert besonders empfindlich auf negative Eindrücke: Unangenehme Emotionen verarbeiten wir schneller und eindeutiger und sie wirken länger nach. Das nennen Baumeister und Kollegen die
Negativity Bias





























