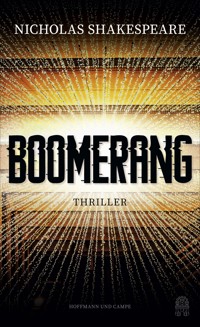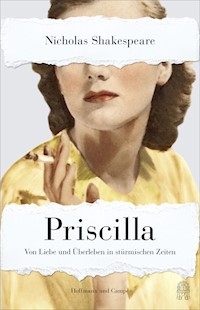
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als Nicholas Shakespeare eine Kiste mit Briefen und Tagebüchern seiner verstorbenen Tante findet, wird er erstmals mit ihrer geheimen Vergangenheit konfrontiert. Die Priscilla, an die er sich erinnert, ist ganz anders als die junge, von Verehrern umschwärmte, zerbrechliche Frau, die in die Wirren des Zweiten Weltkriegs gerät. Nicholas Shakespeare, bekannt durch seinen Erfolgsroman "Sturm", lüftet in diesem Buch ein spannendes Familiengeheimnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Nicholas Shakespeare
Priscilla
Von Liebe und Überleben in stürmischen Zeiten
Aus dem Englischen von Barbara Christ
Hoffmann und Campe
Für Lalage, Imogen, Tracey und Carleton
»Alles ist einfach bei den Männern, alles ist einfach bei den Frauen, wenn man sie von außen betrachtet und sieht, wie sie an der Schwelle der Welt zaudern, in die sie lachend eintreten. Und alles ist einfach an ihnen, wenn man, sehr viel später, ihr Leben deutet, wenn es abgeschlossen ist, nach ihrem Tod, und wenn man nachdenkt über diese Existenzen, die nur noch Geschichte sind. Doch solange das Schicksal sich entwickelt und verknotet, ist es dunkel und oft rätselhaft.«
Jean d’Ormesson, Wie es Gott gefällt
»Ach, es gibt Schlimmeres als Unzucht.«
Allan Massie, A Question of Loyalties
»Schreib alles auf!«
Graham Greene zu Gillian Sutro
Teil 1
Das Verhör: 1943
Am dritten Tag kamen Gestapoleute mit Maschinenpistolen und fuhren Priscilla in die Rue des Saussaies Nr. 11. Dort wurde sie ins Untergeschoss gebracht und musste sich ausziehen. Die Luft war dünn, ein handbetriebener Ventilator saugte sie in die Keller. Eine Frau in grauer Uniform tastete Priscilla unter der wattstarken Glühbirne nach Zyankalikapseln ab, eine ausführliche, erniedrigende Leibesvisitation, und ihre Kleider wurden durchsucht. Dann musste sie sich wieder anziehen und wurde nach oben in einen großen Raum geführt, wo ein Mann sie zwölf Stunden lang verhörte.
Priscilla war es gewohnt, von wildfremden Menschen ausgefragt zu werden. Im Internierungslager in Besançon hatte sie ein Formular ausfüllen müssen: familiäre Abstammung, Blutgruppe, Namen der Eltern, politische Überzeugung, Religion. Das Ganze in doppelter Ausfertigung, und wenn man kein Deutsch sprach, kam man leicht durcheinander. Eine Insassin wurde vom Kommandanten gemaßregelt, weil sie in die Zeile für Religion »Hausangestellte« geschrieben hatte.
Doch dies hier war aggressiver, verwirrender. Persönlicher.
Der Mann sprach französisch, obwohl er offenkundig auch Englisch beherrschte. Schon sein Verhalten gab zu verstehen, dass lügen sinnlos war. Wo sie zur Schule gegangen sei? Welche Bücher sie gern lese? Er fragte nach ihren Eltern und ging dann zu Ehe und Liebhabern über. Die Antworten glich er mit zwei Ausweisen ab, die die Gestapo bei Priscilla gefunden hatte, und mit einem früheren Verhör durch die französische Polizei. Er war gut vorbereitet und schonte sie nicht.
Wann sie erstmals nach Frankreich gekommen sei? Warum sie geblieben sei? Er stellte fest, dass die deutsche Militärverwaltung Priscilla aus Besançon entlassen hatte, weil sie ein Kind erwartete. Was aus dem Baby geworden sei?
Es ist gestorben, sagte sie.
Er richtete den Blick auf sie und dann wieder auf ihre carte d’identité Nr. 40CC92076, ausgestellt auf den Namen Priscilla Doynel de la Sausserie und mit dem Eintrag »sans profession« versehen. Das Dokument war nicht mehr gültig, es war im Oktober des Vorjahres abgelaufen.
Er nahm ihren britischen Pass und blätterte ihn durch. Mais, Priscilla Rosemary, geb. 12. Juli 1916, Sherborne (England). Größe: 175 cm. Augenfarbe: Blau.
Der Pass mit der Nummer 181523 war am 10. März 1937 in London ausgestellt worden, knapp zwei Jahre vor ihrer Heirat. Gegen den Rat aller hatte sie ihn behalten und nicht in der Toilette fortgespült, wie ihre Schwägerin gedrängt hatte. Und als Priscilla Cornet in seinem Hotel besuchte, hatte es sich tatsächlich als Segen erwiesen, dass sie diese alte Identität noch besaß. Sie wäre hingerichtet worden, hätte man sie mit ihren falschen französischen Papieren, ausgestellt auf den Namen »Simone Vernier«, erwischt.
Simone Vernier, Priscilla Mais, Vicomtesse Priscilla Doynel de la Sausserie – ihr Leben verteilte sich auf mehrere Identitäten, und die Deutschen ließen sie in Ruhe, weil sie blond und blauäugig war. Sie erinnerte sich, wie ihre beste Freundin, Gillian, noch vor dem Krieg, die Lippen geschürzt und verkündet hatte: »La beauté, c’est notre première carte d’identité.«[1]
Im besetzten Paris überzeugte vor allem diese letztgenannte Identität. Denn irgendwann am zweiten Tag wurde Priscillas Verhör abgebrochen – jemand, der bei der Gestapo Einfluss besaß, hatte interveniert. Am Abend ließ man sie frei. Sie musste das offizielle Protokoll mit ihren Aussagen unterzeichnen und bestätigen, dass alles der Wahrheit entsprach. Dann fuhr man sie zu dem Sanatorium in Saint-Cloud, das sie als Adresse angegeben hatte.
Church Farm: 1957–66
Tante Priscilla, die Schwester meiner Mutter, war eine besonders glamouröse und geheimnisvolle Erscheinung in meiner Kindheit. Sie lebte an der Küste von Sussex mit ihrem zweiten Ehemann Raymond, der dort einen Pilzzuchtbetrieb führte. Ein eifersüchtiger Mensch, der sie kaum aus den Augen ließ.
Priscilla lud uns manchmal übers Wochenende zu sich nach East Wittering ein, und jedes Mal, wenn auf der Fahrt von London ihr Name fiel, spitzte ich auf dem Rücksitz des Wagens meiner Eltern die Ohren. Ich hatte schon früh begriffen, dass meine Tante zu jenen Frauen gehörte, die den Männern den Kopf verdrehten. Meine Eltern verstanden sich bestens mit ihr, aber wie Priscilla sich mit dem unnahbaren Raymond hatte einlassen können, blieb ihnen zeitlebens ein Rätsel.
Wenn unser Wagen, ein blassblauer Singer Gazelle, in den Feldweg einbog, der nach Church Farm führte, herrschte jedes Mal Aufregung: Waren wir womöglich zu spät? Und würde Raymond – der Pünktlichkeitsfanatiker – uns wohl diesmal Champignons servieren? Dass Pilze etwas Verheißungsvolles waren, lässt sich heute in Zeiten ihrer Massenproduktion nur noch schwer nachvollziehen. Doch für einen Siebenjährigen, der vor allem den Geschmack von Dorschrogen kannte (laut meiner Mutter »das billigste Lebensmittel, das es damals zu kaufen gab«), waren Champignons Anfang der sechziger Jahre ein Traum. Sie waren auf ihre Weise fast so exotisch wie meine Tante.
Priscilla wohnte in einem Haus aus dem achtzehnten Jahrhundert aus rotem Backstein, das neben einer Kirche aus dem zwölften Jahrhundert stand. Es gab einen Hof mit einer verkümmerten Pappel und stapelweise leere Fischkisten für die Pilzzucht. Als »Zuchträume« dienten finster wirkende, lange, niedrige Nissenhütten mit runden Asbestdächern, dreißig Stück nebeneinander. Ich hatte strikte Anweisung, keine davon zu betreten. Sonst würden meine Schuhe mit einem gefährlichen Virus der sogenannten »Absterbekrankheit« infiziert werden, das Raymonds Ernte vernichten konnte, wenn man es verbreitete. Also sah ich nie eine Hütte von innen. Aber ich kann mich gut an Eimer mit Desinfektionsmittel und den feuchten, modrigen Geruch von Kompost erinnern.
Church Farm war kein Haus für ein kleines Kind. Ich erinnere mich an ausländische Haushälterinnen, an kalte Steinböden mit Bleileitungen zwischen den Fliesen, an aggressive Hündchen – mit gelben Pfoten von Raymonds Natriumspray – und an ein Schwimmbecken, in dem dunkelgrüne Algen trieben, sodass ich nie darin baden konnte. Das Wasser aus dem Becken diente zum Kühlen der Nissenhütten. Alles drehte sich um die verbotene kleine weiße Frucht der Spezies Agaricus bisporus, auch bekannt als »Champignon de Paris«. Unter direkter Sonneneinstrahlung verlor der Champignon seine weiße Farbe – noch ein Grund für Raymond, mich nicht in die Schuppen zu lassen. Er machte nur Licht, wenn er die Pilze wässerte oder erntete. Ansonsten wuchsen sie bei einer Temperatur von 18 Grad Celsius in völliger Dunkelheit und wurden mit Pferdemist und Gips ernährt. »Kein Licht reinlassen und mit Scheiße füttern«, das war seine Formel für eine ertragreiche Ernte.
Raymond sah mit seiner Adlernase und der schwarzen Hornbrille ziemlich furchterregend aus. Im Wohnhaus hatte er das gesamte Erdgeschoss als Büro okkupiert. Sitzungen fanden am Esszimmertisch statt, wo Raymond gern in abgeschnittenen Gummistiefeln thronte und seine Angestellten überwachte. Er besaß eine Kuhglocke, die er heftig läutete, wenn Priscilla ans Telefon gehen oder zu den Mahlzeiten kommen sollte. Ein förmliches, von ihm zubereitetes Mittagessen gab es um ein Uhr – um Punkt ein Uhr. Einmal rief seine Tochter Tracy an, um Bescheid zu sagen, dass sie eine Reifenpanne hatte. Er befahl: »Bring das in Ordnung, aber komm nicht zu spät zum Essen!«
Kochen hatte Raymond von seinem »Fuchs« auf der Harrow School gelernt. Er hatte eine Vorliebe für Soßen und war stolz auf sein Kalbsragout – das einzige Gericht, das bei ihm Pilze enthielt. Er empfand es als geschäftsschädigend, sie zu verschenken oder Gästen vorzusetzen, was auch für Verwandte galt. Priscilla hatte uns gewarnt, dass Raymond den vollen Marktpreis von fünf Shilling das Körbchen berechnen würde, falls wir welche ernten wollten. Die schlechten verkaufte er draußen an der Straße.
Raymond übernahm gern die Führung und kümmerte sich um alles. Wenn Priscilla hin und wieder eine Mahlzeit zubereiten durfte, gab es Rindfleisch-Nieren-Pastete, Risotto oder gefüllte Paprika – Gerichte, die ich schon von zu Hause kannte. Nachdem meine Mutter geheiratet hatte, gab Priscilla ihr diese Rezepte, und viel Neues kam später nicht mehr hinzu. Obwohl es mir nie gelang, bei meinen Besuchen auf Church Farm einen Champignon zu kosten, wuchs ich in gewisser Hinsicht also mit Priscillas Kochkünsten auf.
Mein Vater verdiente damals als armer Journalist 500 Pfund im Jahr, und ihn schauderte jedes Mal, wenn er Priscillas Haus betrat mit der Aussicht, dort auf ihre schicken, weltgewandten Freunde wie die Sutros zu treffen. Die Besuche in noblen Restaurants, zu denen Raymond einlud, behagten ihm ebenso wenig.
Raymond war vor dem Krieg auf der Brooklands-Rennstrecke Bugatti gefahren. Er prahlte damit, dass auch Priscilla gut fahren konnte. Ich kann mich zwar nicht erinnern, meine Tante je am Steuer gesehen zu haben, staunte aber, dass Raymond sie jedes Mal in einem anderen Sportwagen chauffierte: in einem schwarzen Aston Martin, einem roten Ferrari aus zweiter Hand, einem grünen Hotchkiss – und einmal in einem Facel Vega, der angeblich rückwärts wie vorwärts hundertsechzig fuhr. Mit uns raste Raymond gern über die Birdham Straight, ein langes, ebenes Stück Landstraße zwischen Wittering und Chichester.
Neben den Autos besaß Raymond mehrere Jachten. Jedes Jahr schipperte er mit Priscilla nach Frankreich, und einmal war mein Vater sogar als Besatzungsmitglied dabei. Pferderennen waren eine weitere Leidenschaft. Raymond verpasste nie das Rennen in Goodwood, und als er gestorben war, begrub seine Tochter Tracy seine Asche unter einem Baum am Veuve-Clicquot-Stand.
Als leidenschaftlicher Spieler trug Raymond sämtliche Wetten in ein Notizbuch ein – was nicht heißt, dass er besonders erfolgreich war. 1957, in dem Jahr, als meine Eltern zum ersten Mal mit mir nach Church Farm fuhren, rechnete sein junger Neffe aus, dass der Onkel 210000 Pfund (mindestens vier Millionen Pfund nach heutigem Maßstab) für Pferdewetten ausgegeben hatte. Gewonnen hatte er 211000 Pfund. Wenn ihm das Glück lachte, konnte es passieren, dass er alle, die gerade um ihn herum waren, zum Essen einlud, oder er kaufte Priscilla einen mit den Namen früherer Derbygewinner bestickten Seidenschal. Wenn er verlor, sah die Sache schon anders aus. Sein Neffe erinnert sich, wie er zitternd hinter dem Sofa kauerte, »weil der Onkel dann immer die alte Küchentür hinter sich zuknallte, wenn er hereinkam, und dann tobte und schimpfte er und warf mit Büchern um sich und griff zur Whiskyflasche«.
Beim Lauschen im Auto schnappte ich auf, dass mein Onkel zwar Anfälle von Verschwendungssucht hatte, seine Frau aber an der kurzen Leine hielt. Nur wenn sie in Frankreich waren, konnte Priscilla hoffen, dass sie das Geld seiner Gewinne bekam – worauf sie einmal sofort zu Hermès geeilt war und für eine astronomische Summe eine Handtasche aus Krokodilleder erworben hatte.
Raymond war stolz darauf, dass er und Priscilla in sechzehn Jahren Ehe keine einzige Nacht getrennt voneinander verbracht hatten. Wenn er geschäftlich unterwegs war, sorgte er dafür, dass er am selben Abend nach Hause kam. Dennoch war selbst für mich offensichtlich, wie sehr Raymond Priscilla kontrollierte, und ich erinnere mich an das Gefühl, dass meine Tante auf Church Farm ein Fremdkörper war, eine Gefangene geradezu – die gleichwohl alles ergeben hinnahm. Wenn man ein Zimmer betritt, in dem sich alle angeregt unterhalten, fühlt man sich wohl automatisch zu der Person hingezogen, die schweigt. Obwohl ich noch ein Kind und Priscilla eine Frau Ende vierzig war, meinte ich sie beschützen zu müssen.
»Sie war extrem zurückhaltend«, sagte mein Vater. »Man spürte, dass sie etwas verbarg.«
Weil das wichtigste Zimmer im Haus als Raymonds Büro diente und alles tadellos aussehen musste, hatte ich zu verschwinden, sobald Geschäftskunden auftauchten. An heißen Tagen ging Priscilla nach draußen und nahm in einer geschützten Ecke des ummauerten Gartens nackt ein Sonnenbad. Ich durfte nicht zu ihr, es sei denn, ich kündigte mich an, damit sie sich rasch bedecken konnte. Ich erinnere mich, wie sie mit gerunzelter Stirn ein Buch las oder Kreuzworträtsel löste, die Zigarette zwischen den Fingern – sie rauchte viel. Und immer stand in Reichweite ein Glas, das ein Getränk mit Zitronenscheibe enthielt. Meistens war sie jedoch im Obergeschoss und blieb unsichtbar.
Das Obergeschoss war Priscillas Reich. Sie verbrachte viel Zeit damit, auf ihrem Bett zu lesen, Karten zu spielen oder zu schlafen. Sie war berühmt für ihren gesegneten Schlaf, und Raymond behauptete, dass sie oft nicht vor Mittag aufstand.
Vom Fenster des über der Küche gelegenen Schlafzimmers aus sah man auf den Hof und die Gasse, die zur Kirche führte. Emaillierte Haarbürsten, Kämme und Spiegel lagen ordentlich nebeneinander auf der Frisierkommode. Dort saß sie dann in einem Nachthemd mit passendem Morgenmantel und bürstete ihr langes blondes Haar. »Für sie galt die alte Regel: Schönes Haar braucht hundert Bürstenstriche am Tag«, sagte Tracey.
Meine Erinnerung an dieses Zimmer ist so lebhaft, weil am Fuß des Betts der erste Fernseher stand, den ich je zu Gesicht bekam. Fernsehgeräte sind heute so banal wie Pilze aus der Dose, doch damals war ein Fernseher im Schlafzimmer der Gipfel des Luxus. Das Gerät mit seinem schweren gewölbten Bildschirm thronte auf einer Holztruhe mit gepolstertem Deckel, und es war etwas ganz Besonderes, wenn ich als kleiner Junge dort sitzen und fernsehen durfte, manchmal zusammen mit Priscilla. Die ersten Filme, von denen ich weiß, habe ich auf dem Bett meiner Tante gesehen, und auch wenn sie nicht neben mir saß, roch es nach ihrem Parfüm, das ich mit jenen Figuren in Verbindung bringe, deren Dramen ich auf dem Bildschirm verfolgte. Ich weiß nicht mehr genau, wie es roch, aber es war ein schweres Parfüm. Ich habe meine Mutter gefragt, die mir sagte, es sei Calèche von Hermès gewesen.
Am besten gefielen mir die Abende, wenn Raymond und Priscilla mit meinen Eltern und den Sutros oder mit anderen Hausgästen zum Essen in den Bosham Sailing Club fuhren. Ich beobachtete, wie sie davonbrausten, dann ging ich zum Fernseher und schaltete ihn ein, ganz leise, um die französische Haushälterin im Parterreflügel nicht zu stören oder Viking, den Schnauzer, der in Priscillas Zimmer schlief und immer so schrecklich roch. Wenn ich hörte, dass das Auto zurückkam, verschwand ich schleunigst in mein Zimmer und lauschte mit klopfendem Herzen, während Priscilla über den Gang torkelte.
Ich erinnere mich an ein Gemälde auf Church Farm: Es war ein unverglaster Peter Scott mit fliegenden Enten, der im Wohnzimmer über dem Kamin hing. Wenn das ungeschützte Gemälde vom Rauch schwarz geworden war, ging Raymond damit nach draußen, nahm einen Eimer Wasser und Seife und schrubbte es gründlich ab.
Mein Lieblingsbild von meiner Tante war ein Porträt von ihr als junge Frau, das am Fuß der Treppe an der Wand hing. Es stammte von dem ungarischen Maler Marcel Vertès und zeigte Priscilla, wie sie im Paris der Vorkriegszeit ausgesehen hatte.
Die Gouache entstand 1939, als Priscilla dreiundzwanzig war. Sie trägt darauf eine goldgesprenkelte Jacke und einen grünen Hut nach dem Entwurf von Elsa Schiaparelli, für die sie damals als Mannequin gearbeitet hatte. »Priscilla hatte nicht viel zum Anziehen«, sagte meine Mutter, die einen schwarzen Cordmantel von ihr erbte, »aber alles war immer schick, immer Haute Couture und sehr teuer.«
Obwohl die Tante Priscilla, die ich kannte, doppelt so alt gewesen sein musste wie die junge Frau auf dem Porträt, sah sie ihr ähnlich: groß, nicht ganz so schlank, aber mit offenem aschblonden Haar und denselben horizontblauen Augen. Der Künstler hatte überdies eine Verletzlichkeit eingefangen, die ich ebenfalls wiedererkannte. So, wie sie die Hände ans Kinn hob, um ihr Hutband zu knoten, hatte ich Leute in der Kirche beten sehen, mit offenen Augen.
Zweierlei wusste ich von Anfang an ganz genau. Erstens, dass Priscilla ungemein attraktiv war. Sie erinnerte mich an Grace Kelly in einem der Filme, die ich in ihrem Schlafzimmer gesehen hatte. Wenn sie lachte, musste ich an meinen Großvater denken, an sein rauchiges Lachen, das sich über die Hügel der South Downs erhob. Ihr Lachen war erfrischend, und mir fiel auf, dass meine Eltern in ihrer Gesellschaft ganz anders waren, dass sie vielleicht wieder zu den jungen Leuten wurden, die sie gewesen waren, als sie noch kinderlos in Frankreich lebten. Priscilla verwandelte ihre Stimmung und meine. In gewisser Weise war sie die Köstlichkeit, die wir jedes Mal zu genießen hofften, wenn wir nach Church Farm fuhren – sie war unser »Champignon de Paris«.
Zweitens wusste ich, dass sie traurig war. Irgendetwas schien auf ihr zu lasten, doch ich ahnte lange nicht, was es war. Mein Vater vermutete, dass sie irgendetwas Außergewöhnliches in der Vergangenheit erlebt hatte, »aber sie sprach nie davon, und man fragte nicht«. Diese scheue, unbestimmbare Traurigkeit war Teil ihres Wesens.
Die Kroko-Handtasche: 1950
Von meinen Eltern erfuhr ich das eine oder andere aus ihrer Biographie.
Priscilla war in Paris aufgewachsen und hatte dort eine Ballettausbildung gemacht.
Sie hatte vor dem Krieg in Paris als Mannequin gearbeitet.
Während der Besatzungszeit hatte sie in Frankreich gelebt und war in einem Konzentrationslager gewesen, vielleicht auch in zweien. Meine Mutter sagte: »Das hat sie mir jedenfalls erzählt, als ich siebzehn war, auf Church Farm. Die Deutschen haben sie inhaftiert und gefoltert. Ich nehme an, sie konnte keine Kinder kriegen, weil sie vergewaltigt wurde und eine Infektion bekam.«
Ihr erster Mann war ein französischer Aristokrat, ein Vicomte, und er hatte nie aufgehört, sie zu lieben.
Absolut unglaublich fand ich, dass Priscilla jedes Jahr mit Raymond nach Paris fuhr, wo sich das Paar dann mit dem Ex-Mann traf – obwohl doch Raymond so ein besitzergreifendes Wesen hatte. Der Vicomte war katholisch und betrachtete Priscilla noch immer als seine Ehefrau. (Um ihn zu heiraten, musste Priscilla zum Katholizismus übertreten, wie meine Mutter sagte.) Mir gefiel ihr Spitzname: »Mein kleiner Korken« nannte sie der Vicomte – auch wenn mir nie jemand erklären konnte, warum.
Meine Mutter erzählte mir außerdem, dass Priscilla einmal mit dem Schauspieler Robert Donat verlobt gewesen war, den ich in Die 39 Stufen gesehen hatte, aber das fand ich nicht so interessant wie ihr Leben in Frankreich, auch wenn ich mich fragte, warum sie sich schließlich für Raymond entschieden hatte statt für Donat.
Als Priscilla 1982 starb, dachte ich weiter über ihr Schicksal nach. Was war in Frankreich vorgefallen? Was hatte sie während des Kriegs gemacht? Wieso war sie nicht nach England zurückgekehrt, als sie dem Konzentrationslager entkommen war? Warum hatte ihr Vater als damals bereits bekannter Autor und Rundfunkmann nie im Radio oder auch nur meiner Mutter gegenüber erwähnt, dass seine älteste Tochter den ganzen Krieg über im besetzten Frankreich allein gewesen war? Ich stellte mir vor, wie Priscilla in einem Pariser Atelier vor einem illegalen Radiogerät hockte und auf BBC der Stimme meines Großvaters lauschte, wenn er zu den Streitkräften sprach. Hatte er Priscilla jemals eine persönliche Botschaft übermittelt, die nur sie deuten konnte, so etwas wie diese rätselhaften verschlüsselten Botschaften an die Résistance, zum Beispiel: Venus hat einen hübschen Nabel oder Das Nilpferd ist kein Fleischfresser? Konnte es sein, dass Priscilla in der Résistance gewesen war?
Und was verband sie mit ihrem ersten Ehemann, was veranlasste sie, sich immer wieder mit ihm zu treffen, obwohl sie ein zweites Mal verheiratet war?
Auch Raymond war schon einmal verheiratet gewesen. Doch seine erste Frau war ein Tabuthema. Sie war gegen Ende des Zweiten Weltkriegs mit seinem Trauzeugen durchgebrannt. Ihre beiden kleinen Kinder ließ sie zurück. Raymond vergab ihr nie und sah sie niemals wieder.
Priscilla war einunddreißig, als sie Raymond heiratete, und gab eine nervöse Stiefmutter für Tracey und Carleton ab, die damals sechs und vier Jahre alt waren. Ich wusste von meiner Mutter, wie sehr Priscilla sich eigene Kinder gewünscht hatte und wie enttäuschend es für sie war, keine bekommen zu haben. Als ich Mitte vierzig war, selbst Kinder hatte und mehr über meine Tante erfahren wollte, überließ Tracey mir ein Sammelalbum, in das Priscilla in unregelmäßigen Zeitabständen Bilder, Zeitungsausschnitte und Ähnliches eingeklebt hatte. Ich ahnte nicht, dass dieses Sammelalbum nur die erste von vielen überraschenden Entdeckungen darstellte, durch die ich Einblicke in Priscillas Gedanken und Gefühle gewinnen würde.
Auf der ersten Seite des Sammelalbums klebte ein aus der Nursing Times ausgeschnittenes Porträt von mir mit achtzehn Monaten. Ich hatte mich immer mit Priscilla verbunden gefühlt, doch erst jetzt, als ich dieses Foto sah, wurde mir klar, wie sehr sie sich von Anfang an für mich interessiert haben musste. Während ich die steifen grauen Seiten durchblätterte, roch ich wieder ihr Parfüm.
Das Sammelalbum enthielt Artikel, die Priscilla noch geheimnisvoller machten. Sie hatte »für Anna Pavlova getanzt«, las ich in einem Nachruf. Ein anderer Ausschnitt aus einer Modezeitschrift der Vorkriegszeit zeigte Priscilla, wie sie als Mannequin in grünen Mainbocher-Knickerbockern aus feinem Kammgarn auf Kunstschnee stand. Die aufregendste Entdeckung war ein Bericht aus dem Chichester Observer, der auf der Rückseite des Blatts mit der Studioaufnahme von mir klebte und sich auf ein Ereignis bezog, das sich 1950 zugetragen hatte, sieben Jahre vor meiner Geburt.
Eine Frau, die mit ihrer Wette auf einen 50:1-Außenseiter bei einer französischen Rennveranstaltung 50000 Franc (etwa 50 Pfund) gewonnen und mit dem Gewinn eine Handtasche aus Krokodilleder erworben hatte, ist heute in Lewes wegen Zollvergehens zu einer Strafe von 35 Pfund zuzüglich 2 Pfund Verfahrenskosten verurteilt worden.
Mrs. Priscilla Rosemary Thompson, Church Farm, East Wittering, räumte ein, sie habe die Tasche in Newhaven durch den Zoll schmuggeln wollen und gegenüber den Zollbeamten falsch deklariert. Es hieß, sie sei früher mit einem Franzosen verheiratet gewesen und mit Hilfe von Papieren, die sie von der Résistance-Bewegung erhalten habe, aus einem deutschen Konzentrationslager entkommen.
Und schließlich: Vor der Befreiung Frankreichs lebte sie wie ein gehetztes Tier.
Die Handtasche erinnerte Priscilla an Paris vor dem Krieg. Sie war schwarz gefüttert und roch weniger nach Krokodil als nach Zigarettenqualm. In der Handtasche waren ihre Chesterfields, ihre Lesebrille und der grüne Hermès-Kalender samt Bleistift. (»Ein Bleistift ist praktischer«, hatte die Verkäuferin gesagt, »der lässt sich ausradieren.«) Sie hatte die Tasche immer bei sich. Ein Zeitungsausschnitt zeigte Priscilla auf der Goodwood Fashion Parade im grauen Flanellkostüm mit weißer Mütze und der Tasche über der Schulter.
Priscilla hatte sie von dem Geld gekauft, das Raymond in Deauville gewonnen hatte. Damals herrschten starke Beschränkungen. Die Devisenkontrollen waren streng wie nie. Als sie und Raymond am 1. September 1950 wieder in Newhaven ankamen, trat ein Zollinspektor auf sie zu.
Priscilla spürte, dass sie ins Schwitzen geriet. Er sah aus wie ein Eisenbahnpolizist, einer von denen, die sie vor der Métro angehalten hatten, um ihre Ausweispapiere zu kontrollieren.
Raymond ahnte nichts davon, dass Priscilla bei ihren Besuchen in Paris immer noch die Stiefel hörte, wie sie im Gleichschritt marschierten, die Champs-Elysées entlang, am Travellers Club vorbei.
Schritte auf dem Bürgersteig oder ein Hund, der ihren Pelzmantel ankläffte – und schon fügte sich alles wieder zu jenem Innenhof in Besançon zusammen, Schnee auf der Erde, ihre zur Inspektion geöffnete Handtasche. Damals hatte sie den Inhalt einer Deutschen zeigen müssen und nur ihren Kamm behalten dürfen.
Jetzt war es ein Mr. Druitt, der ihre Handtasche sehen wollte.
Elf Tage später erhob sich Priscilla vor dem Amtsgericht in der County Hall in Lewes und bekannte sich der Verletzung zollrechtlicher Offenlegungs- und Wahrheitspflichten für schuldig. Doch sie wollte eine Erklärung abgeben.
»Ich habe einen beträchtlichen Teil meines Lebens in Frankreich verbracht, denn dort habe ich von 1925 bis 1932 und dann wieder ab 1937 gelebt. Ich habe 1938 einen französischen Staatsbürger geheiratet und lebte in Frankreich, als das Land von den Deutschen besetzt wurde. Aufgrund meiner britischen Herkunft wurde ich im Dezember 1940 verhaftet und in ein Konzentrationslager gebracht, konnte aber 1941 meine Freilassung aufgrund gesundheitlicher Probleme erwirken und lebte von da an bis 1944 mit falschen Papieren in Frankreich. Infolgedessen wurde ich mehrfach von der Gestapo verhaftet und verhört, einmal für mehr als vierundzwanzig Stunden. Seither leide ich an einer nervlich bedingten panischen Angst vor jeder Art von Verhör durch jede Art von Beamten.«
Nach der Repatriierung 1944 habe sie 1948 in England ihren derzeitigen Ehemann geheiratet. Sie reise im Schnitt zweimal jährlich nach Frankreich. Sie sei also mit den Zollformalitäten einigermaßen vertraut.
»Bei dieser besagten Gelegenheit wurde ich nun gebeten, meine Handtasche vorzuzeigen und zu sagen, wo ich sie erworben hatte. Dummerweise erklärte ich daraufhin, sie sei ein Geschenk meines ersten Ehemannes und ich wisse nicht, was sie wert sei, gab aber den korrekten Namen und die Adresse meines ersten Ehemannes an. Da meine Erklärung nicht akzeptiert wurde, überkam mich wieder die Erinnerung an frühere Verhöre in Frankreich, worauf ich in einer Art Panik bei meiner Geschichte blieb.«
Abschließend betonte sie, wie leid es ihr tue, und nannte als Grund für die beharrlich falsche Erklärung eine »aus früheren Erfahrungen herrührende Vorstellung, man müsse bei der ursprünglichen Geschichte bleiben, um ein langwieriges Verhör zu vermeiden«.
Infolge dieses Appells wurde ihr eine ermäßigte Geldstrafe auferlegt. Doch der Auftritt vor Gericht hatte Priscilla erschüttert. Als sie dem Friedensrichter gegenübersaß, war ihr, als hätte er über ihre Jahre im besetzten Frankreich zu befinden.
Lastwagenfahrerin
Wenn mein Vater auch nicht verstand, was genau Priscilla bewegte – ihre verschlossene Art war ihm nur zu vertraut. Sein eigener Vater hatte als Militärarzt am Ersten Weltkrieg teilgenommen und sich niemals näher über seine drei Jahre in Frankreich geäußert. »Irgendwann wurde mir klar, dass sich das, was er in Ypern gesehen hatte, nicht mitteilen ließ. Die Kluft zwischen ihm und den Zuhörern war so groß, dass er meinte, sie nicht überbrücken zu können.«
Priscilla verhielt sich wie viele Leute, mit denen mein Vater in Paris während der fünfziger Jahre Freundschaft schloss, die den Krieg überlebt hatten und ihre Erinnerungen daran für sich behielten. Ihre Jahre in Frankreich gehörten in eine Kategorie, die die Franzosen »les non-dits« nannten.
Ich war zu jung, um Priscillas Vater zu befragen – er starb, als ich achtzehn war –, aber ich habe in seiner Autobiographie Buffets and Rewards gelesen, was er über sie geschrieben hat.
»Priscilla ist reizend. Sie zog sich während ihrer Ausbildung zur Tänzerin beim russischen Ballett in Paris eine Erkrankung am Bein zu. Kurz vor dem Krieg heiratete sie einen Franzosen, von dem ich kaum etwas weiß, nur, dass er ein Graf war und vormittags Portwein trank. Am 12. Mai 1940 war sie in Amiens. Genau wie die Deutschen. Die haben sie offenbar vernünftig behandelt, als sie zum ersten Mal im Konzentrationslager war. Den sentimentalen deutschen Lagerarzt hat sie tatsächlich dazu gebracht, sie zu entlassen, weil sie ein Kind erwartete. Natürlich erwartete sie keins. Doch offenbar wurde sie leichtsinnig. Sie wurde wieder verhaftet und kam in ein Konzentrationslager in den Vogesen, wo es sich weit weniger angenehm lebte. Als ich sie das nächste Mal sah, hatte sie sich von ihrem Mann scheiden lassen. Sie heiratete wieder, diesmal einen Engländer, der an der Küste von Sussex Erdbeeren und Tomaten anbaute. Auch er war schon einmal verheiratet gewesen und hatte zwei kleine Kinder.« Das war alles.
Ich fragte mich, was Raymond hinzugefügt hätte, der 1988 starb. Bevor er Priscilla kennenlernte, hatte er beim Nachrichtendienst der Air Force gearbeitet und war während des Krieges jeden Tag mit dem Fahrrad von Bosham nach Hayling Island gefahren, sodass er nur wenige Stunden zu Hause war. Unterdessen konnte seine erste Frau seinen Trauzeugen pflegen, der bei ihnen wohnte, seit er verwundet aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war, um sich schließlich in ihn zu verlieben. Doch nicht einmal Raymond hatte Priscilla in den vierunddreißig Jahren ihrer Ehe weitere Informationen entlocken können. Das weiß ich, weil er seiner Schwiegertochter nach Priscillas Tod erzählte, sie habe nie mit ihm darüber sprechen können, was in ihrem früheren Leben geschehen war.
Wie Carleton und Tracey einräumten, waren sie in ihrer Kindheit »überhaupt nicht neugierig« auf Priscillas Vergangenheit gewesen, denn sie selbst habe »nie ein großes Wesen darum gemacht«. So kam es, dass wir alle – Schwestern, Ehemänner, Schwäger, Stiefkinder, Neffen – nichts Ungewöhnliches daran fanden, wenn Priscilla nicht über den Krieg reden wollte. Ihre Entscheidung, sich in Schweigen zu hüllen, entsprach einer Art omertà, wie sie damals weit verbreitet war.
Annette Howard, deren hochdekorierter Vater in japanischer Kriegsgefangenschaft an der Brücke am Kwai hatte arbeiten müssen, war Priscillas Patentochter. »Ich kannte das schon, dass man über bestimmte Dinge nicht sprach, also wunderte es mich nicht, dass Pris nicht reden wollte.«
Annette wuchs als Kind in dem Glauben auf, Priscilla sei während des Krieges in Nordfrankreich Lastwagenfahrerin gewesen und habe als solche »wahre Heldentaten« vollbracht.
Priscillas Nachbarin Vicky, die ein Kleid für sie entworfen hatte, erzählte mir: »Ich weiß, dass sie sehr tapfer in der Résistance gekämpft hat.«
Eine Frau namens Phyllis, die auf Church Farm als Champignonpflückerin gearbeitet hatte, ging davon aus, dass Priscilla hinter feindliche Linien geraten war. »Sie musste als Übersetzerin arbeiten, das habe ich jedenfalls gehört.« Und sie erinnerte sich an eine Verletzung am Bein. Priscilla verwundet? Das war nicht unwahrscheinlich. Und es erklärte vielleicht, warum sie ihre Beine später versteckte und nie mehr einen Badeanzug trug.
Es war aufregend, sich vorzustellen, dass Priscilla vielleicht in der Résistance gewesen war und deswegen nicht über ihre Vergangenheit sprach, dass aus diesem Grund niemand ein Sterbenswörtchen darüber verlor. Helden sind schweigsam. Die Agentin Agnès Humbert hatte sich zur Regel gemacht: »Nie etwas zugeben!« Frauen wie Humbert oder Odette Hallowes verwendeten Decknamen, die schwer nachzuverfolgen waren und auf keiner offiziellen Liste erschienen. Die meisten führten nach dem Krieg wieder ein ganz normales Leben und gerieten in Vergessenheit. Konnte das im Fall meiner Tante, der Lastwagenfahrerin, auch so gewesen sein?
Ich sprach mit Annettes Schwester Judy, die sicher war, dass Priscilla als Agentin gearbeitet hatte. »Sie gehörte in Frankreich der SOE, der Special Operations Executive, an und wurde von den Deutschen gefoltert. Und als sie aus Frankreich zurückkam, hatte sie keine Haare mehr. Meine Mutter erzählte mir: ›Priscilla hat ihre Haare gebürstet, und da sind sie wieder nachgewachsen.‹ Seither bürste ich meine Haare sehr gewissenhaft.«
Die gepolsterte Truhe
Eines Tages, etwa ein Jahr nach Priscillas Tod, eröffnete mir meine Mutter, man habe sie während ihrer gesamten Kindheit über Priscillas Existenz im Dunkeln gelassen, sie habe ihre Schwester erst in den letzten Monaten des Krieges kennengelernt. Sie besuchte noch nicht lange das Cheltenham Ladies’ College, als sie einen Brief von ihrem Vater erhielt. Priscilla sollte aus dem besetzten Frankreich zurückkehren, mein Großvater musste also etwas unternehmen. Daher teilte er meiner Mutter mit, dass sie und ihre jüngere Schwester Imogen eine ältere Halbschwester hätten, beziehungsweise nicht nur eine Halbschwester, sondern gleich zwei. Von der Kindheit der beiden Mädchen Priscilla und Vivien und von ihren Lebensumständen bis 1944 hatte meine Mutter, wie sie mir sagte, bis in die Gegenwart hinein nur äußerst unklare Vorstellungen.
Der Gedanke, dass meine Mutter erst mit dreizehn von der anderen Familie ihres Vaters erfahren hatte, war einfach zu verrückt. Ich musste dem nachgehen. Also nahm ich Kontakt mit Priscillas Schwester Vivien auf.
Vivien war vier Jahre jünger als Priscilla und so vollkommen anders als sie, dass man die beiden kaum für Schwestern halten konnte. Schon äußerlich: Vivien war ein dunkler Typ wie Sophia Loren, Priscilla eher der Grace-Kelly-Typ. Entsprechend unterschiedlich waren sie auch im Wesen.
Als Kind hatte ich Vivien kaum je gesehen – der Tod ihres ältesten Sohns hatte sie in eine schwere Krise gestürzt, und sie entwickelte in der Folge eigentümliche Vorstellungen vom Leben nach dem Tod.
Als ich Vivien zu Hause in Henley besuchte, schien sie froh zu sein, endlich ihr Herz ausschütten zu können. Langsam und bedächtig, wie es ihre Art war, erzählte sie Einzelheiten aus der gemeinsamen Kindheit an der Küste von Sussex und anschließend in Paris.
»Angst vor dem Leben« habe ihre verstorbene Schwester gehabt, mit der sie, wie ich glaubte, eine liebevolle, aber nicht immer einfache Beziehung verband, in der Vivien diejenige Schwester war, die sich stets um Harmonie bemühte. »Als Kind hat sie sich immer vor allem gefürchtet, hatte ständig Albträume.« Priscillas schlafwandelte sogar. »Dann stand sie oben an der Treppe und schrie – schlief dabei aber fest.« Alle waren erleichtert gewesen, als sie schließlich den Vicomte heiratete.
Vivien war auf Priscillas Hochzeit in Paris im Dezember 1938 gewesen, musste aber vor dem Einmarsch der Deutschen nach England zurückkehren. Über Priscillas Ehe oder ihr Leben während der Besatzungszeit konnte sie daher nichts sagen. Sie wusste auch nichts Genaues über Priscillas Zeit im Konzentrationslager, nicht einmal dessen Namen.
Vivien starb 2004. Fünf weitere Jahre vergingen, bis ich beschloss, meiner Neugier nachzugeben und gezielt Nachforschungen zu Priscillas französischer Vergangenheit anzustellen.
Im Sommer 2009 nahm ich Kontakt mit ihrer Stieftochter Tracey auf, die ich zuletzt gesehen hatte, als ich vier Jahre alt war und in Paris lebte – Tracey war dort für kurze Zeit mein Kindermädchen gewesen. Ich erklärte, ich würde mich sehr für Priscillas Geschichte interessieren, und fragte, ob meine Tante irgendwelche persönlichen Papiere hinterlassen habe.
»Komisch, dass du gerade jetzt anrufst«, sagte Tracey.
Sie hatte in der Tat einen ganzen Karton voller Fotos, Briefe, Tagebücher und Manuskripte – sogar ein Romanfragment befand sich darunter. All das hatte sie nach Priscillas Tod an sich genommen. Die Papiere hatten sich in der gepolsterten Truhe am Fußende des Betts befunden, auf der immer der Fernseher stand.
Ein oberflächlicher Blick auf diesen Nachlass hatte Tracey davon überzeugt, dass es sich hier um sehr persönliche Dinge handelte, die man Raymond besser nicht zeigte, also hatte sie ihrem Vater gar nichts von diesem Fund erzählt, sondern alles in den Karton gelegt und weggepackt. Erst kürzlich war sie wieder darauf gestoßen. Sie hatte sich nie eingehend mit dem Inhalt beschäftigt, weil er sich, wie sie sagte, auf Priscillas Leben bezog, bevor sie Raymond kennenlernte.
Tracey hatte sich gerade in diesen Tagen gefragt, was sie mit dem Karton anfangen sollte.
In Frankreich nennt man die Zeit der deutschen Besatzung auch »les années noires« – die finsteren Jahre –, und Priscilla war nicht allein mit dem Wunsch, sie in irgendeiner dunklen Truhe verschwinden zu lassen.
Beim Lesen und in Gesprächen über diese Zeit hatte ich bereits erfahren, dass gewisse Abteilungen des französischen Nationalarchivs in Paris noch immer nicht öffentlich zugänglich sind, und zwar ab dem Jahr 1940. Ähnlich sieht es mit den Polizeiarchiven aus – oder was von ihnen übrig ist, denn die Wehrmacht hatte bei ihrem Rückzug die meisten Akten mitgenommen, viele davon wurden 1945 nach Russland gebracht. Noch heute kann niemand prüfen, welchen Denunziationen die eigene Familie vor siebzig Jahren in Frankreich ausgesetzt war. Weite Teile des Pariser Gestapo-Archivs wurden im Herbst 1944 vernichtet, hauptsächlich Unterlagen, die die als »französische Gestapo« bekannte Organisation der »Carlingue« betreffen. Die Archive in London sind kaum hilfreicher. Der britische Geheimdienst MI6 hält weite Teile seiner Unterlagen unter Verschluss, und beim Bureau Central de Renseignement et d’Action (BCRA), für das Priscillas beste Freundin Gillian Sutro tätig war, hatte man so große Angst vor einer Infiltration durch das Vichy-Regime, dass man kaum Akten aufbewahrte. Papiere wurden regelmäßig auf Scheiterhaufen im Hof verbrannt, in die Seine geworfen oder bei alliierten Bombenangriffen vernichtet, wie zum Beispiel die Archive von Caen, wo jene Region verwaltet wurde, in der Priscillas Vicomte lebte.
Es war eine Zeit großer Beschränkungen. Heute, im Internet-Zeitalter, ist es kaum vorstellbar, dass jemand gerade einmal dreißig Kilometer entfernt auf der anderen Seite des Kanals lebte und doch keinen Kontakt mit seiner Familie in Sussex aufnehmen konnte, sei es brieflich oder telefonisch. Aber genau dies war die Folge der hermetischen Nachrichtensperre, die zwischen 1940 und 1944 bestand.
Die besetzte Zone war vollkommen abgeriegelt. Brieftauben waren verboten, man durfte nicht aus Türen heraus fotografieren, und wer Briefe irgendwo am Körper versteckte, riskierte drakonische Strafen. Es war strengsten untersagt, Paketen Briefe beizulegen, die Rückseiten von Fotos zu beschriften oder in Büchern einzelne Sätze zu unterstreichen. Priscilla konnte daher nicht ins Ausland schreiben – selbst wenn sie die nötigen Utensilien besessen hätte. Jacques Audiberti musste seinen Roman Monorail auf Tapetenstreifen schreiben, weil Papiermangel herrschte.
So kam es, dass damals kaum jemand überhaupt etwas aufschrieb (und wie sich herausstellte, wurden viele Tagebücher, auf die sich Historiker stützten, erst viel später nachträglich verfasst). Und wenn man im besetzten Frankreich tatsächlich korrespondierte, blieb davon erstaunlich wenig erhalten. Man glaubt es kaum, aber die Zeiten waren nicht danach, Briefe aufzuheben. Und nun sagte Tracey mir, sie habe einen ganzen Karton davon.
Meine Cousine Tracey wohnte in der Nähe von Goodwood in einem Haus aus den sechziger Jahren. Eine Wand war komplett verglast, mit Blick über ein langes Rasenstück. An einer anderen erkannte ich das Vertès-Porträt von Priscilla. Tracey hatte Priscillas blaues Sammelalbum und zwei ihrer Kroko-Handtaschen auf dem Esszimmertisch bereitgelegt. Daneben stand ein Karton, wie ihn Gemüsehändler verwenden, mit den Papieren, die sie aus der gepolsterten Truhe genommen hatte.
Was würden mir diese Fotos, Briefe und Manuskripte erzählen, die Priscilla unter dem Fernseher verborgen hatte, also direkt vor Raymonds Nase? (»Ich kann mich an die Truhe erinnern«, sagte meine Mutter. »Ich dachte, da wären Decken drin.«) Ich hatte bereits für eine Biographie recherchiert und wusste, wie vielversprechend alte Dokumente aussehen sein konnten und wie enttäuschend sie oft waren.
Den Vormittag über las ich in Priscillas Sammelalbum. Nach dem Mittagessen fing ich an, den Karton durchzusehen. Ich nahm ein Schwarz-Weiß-Foto heraus und sah eine atemberaubend schöne Frau, die genüsslich hingegossen auf einem Haufen Heu lag. In ihr war unschwer eine von der Taille aufwärts nackte Priscilla zu erkennen.
Andere Fotos waren nicht weniger sensationell. Ein Château. Ein Strand. Und Männerporträts. Ein Mann in knapper Badehose, dessen jugendliches Gesicht eine Taucherbrille aus Messing verbarg, hielt lächelnd einen Aal in die Höhe. Auf die Rückseite hatte jemand geschrieben: »Sainte-Maxime, Oktober 1940« – zwei Monate bevor Priscilla beziehungsweise die Vicomtesse Doynel de la Sausserie von den Deutschen verhaftet und interniert wurde. Aber wer war der Taucher?
Und dieser andere junge Mann, der auf einem Skihang im Schnee lag und Priscilla im Arm hielt – diesmal in einen Pelzmantel gehüllt? Und der lederbehelmte Rennfahrer am Lenkrad eines Delahaye – »Pour toi, Pris, en souvenir de la Coupe de Paris«?[2] Und was hatte es mit diesem nicht mehr ganz jungen, kultiviert wirkenden Mann mit dem rundlichen Gesicht auf sich, der da im edlen Zweireiher und mit Halbgamaschen in einem Zimmer unter einem impressionistischen Gemälde saß? Hinten stand mit blauem Kugelschreiber auf Englisch: »Da ist er also – dein geliebter offener Kamin.« Doch in welchem Haus befand sich dieser Kamin, in welcher Stadt? Zu keinem der Gesichter gehörte ein Name oder eine Adresse. Ich hatte den Eindruck, dass diese Anonymität Absicht war. Identifizierbar war nur das Gesicht von Robert Donat auf einem signierten Foto als »Richard Hannay« in Die 39 Stufen.
Ich klappte eine Mappe mit Briefen auf. Es waren ungefähr hundertfünfzig. Die frühesten waren von 1938, die letzten von 1947 – ein Jahr später heiratete Priscilla dann Raymond. Die auf Englisch verfassten Briefe stammten meist von Donat, der Priscilla im letzten Kriegswinter mit grüner Tinte geschrieben hatte. »Ich wünschte, ich könnte Dich ganz langsam ausziehen, ganz, ganz langsam, und dann sehr, sehr lieb und gut zu den Wunden auf Deinem Bäuchlein sein und Dir wieder etwas anziehen, exquisite Schwarzmarktwäsche und Strümpfe aus reiner Seide, und Dich dann mit einem Exemplar mit den neuesten Ergüssen von Peter Quennell unversehrt wieder nach Hause zu Mami und Omi schicken – nur um Dir zu zeigen, wie platonisch meine Liebe zu Dir ist.« Ich las weiter. »Liebling, wo wurdest Du geboren, wann und vor allem: warum? Bist Du das wirklich, und bist Du wirklich wirklich? Kann so ein hinreißendes Gesicht durch Zufall entstanden sein, oder steckt ein göttlicher Plan dahinter? Was hat das alles zu bedeuten?«
Die meisten Briefe waren allerdings auf Französisch geschrieben und stammten von einem halben Dutzend verschiedener Verfasser. Priscilla hatte sie während des Krieges erhalten, als sie in Frankreich auf freiem Fuß war. Sie klangen ähnlich wie Donats Briefe: überraschend leidenschaftlich und zärtlich – obwohl sie aus einer Zeit stammten, in der es immer gefährlich war, offen zu sprechen. Erstaunlich, dass es sie überhaupt noch gab.
Als Flüchtling braucht man leichtes Gepäck, und doch hatte Priscilla all die Fotos und Briefe offensichtlich quer durch Frankreich mit sich herumgeschleppt. Die Mappe enthielt Umschläge mit den Poststempeln »Bretagne«, »Paris«, »Annemasse«.
Viele hatte Priscillas Ehemann verfasst, der Vicomte Robert Doynel de la Sausserie. Darüber hinaus gab es Liebesbriefe von einem gewissen Emile, der auch in den Scheidungspapieren genannt wurde. Die lagen in einer separaten Mappe und stammten aus den Jahren 1943 und 1944 sowie 1946 – dem Jahr, in dem Priscillas erste Ehe schließlich aufgelöst wurde.
Weitere Briefe waren von Liebhabern namens Daniel, Pierre und Otto unterschrieben. Ausnahmslos alle wiesen Priscilla die Rolle einer Emma Bovary oder Anna Karenina zu – die der verletzlichen, intelligenten, kultivierten Frau, die man beschützen oder retten musste. Doch ohne Nachnamen oder Adressen gab es keine Möglichkeit, die Liebhaber zu identifizieren oder den Gesichtern aus der Fotosammlung zuzuordnen. Eines aber wurde deutlich: Meine Tante Priscilla hatte im besetzten Frankreich offenbar wilde Jahre verlebt.
Nur wenige Briefe stammten aus der Nachkriegszeit. Ich zog einen vom Januar 1946 hervor, von einem amerikanischen Marineoffizier, der Priscilla unbedingt heiraten wollte und die vielsagende Bemerkung machte: »Du hast mir alles über Deine Vergangenheit erzählt, Liebling, und ich liebe Dich dennoch, obwohl konservative Leute in Boston ehrlich gesagt schockiert wären, wenn sie davon hörten. Auch aus diesem Grund dachte ich, wir sollten eine Weile im Ausland leben, das wäre besser.«
In Traceys Karton fand sich außerdem eine dicke Mappe mit einem Stapel vergilbter Typoskripte. Während ich sie durchblätterte, fiel es mir schwer, mich auf das zu konzentrieren, was ich da las. Der gesamte »Nachlass« war ein Fund erster Güte, etwas Besseres konnte man sich nicht wünschen, wenn man das Rätsel Priscilla lösen wollte. Tagebuchaufzeichnungen, Krankenakten, ihre Aussage vor dem Amtsgericht in Lewes, Briefe (darunter ein nicht abgeschickter an Tracey), ungefähr zwanzig Kurzgeschichten sowie Kapitelentwürfe zu einem längeren Buch, das Priscilla zu schreiben begonnen hatte.
Als ich das erste Kapitel zu lesen begann, begriff ich, dass diese Fiktion gar keine war und dass Priscilla nicht nur in diesem Roman, sondern auch in ihren Kurzgeschichten in erster Linie erzählen wollte, was sie, Priscilla, in Frankreich erlebt hatte.
Ich bat Tracey um die Erlaubnis, den Karton mitzunehmen.
Teil 2
Sonderbares Zusammenleben
Ohne Traceys Karton hätte ich dieses Buch niemals schreiben können. Für Informationen über Priscillas Kinderzeit stand mir zum Glück eine weitere Quelle zur Verfügung: die Papiere meines Großvaters. Sie wurden in Chichester archiviert, im West Sussex Records Office. Mit Hilfe seiner Tagebücher, Briefe und Manuskripte machte ich mir ein Bild von Priscillas frühen Jahren.
Sie wurde im Sommer 1916 geboren – gut neun Monate nachdem ein Arzt ihren Eltern das Wunder der menschlichen Fortpflanzung erläutert hatte.
Ihr Vater war damals einunddreißig und unterrichtete in Sherborne. Sein Name war Stuart Petre Brodie Mais. Der Nachname war angeblich sächsisch und bedeutete »Maien-Söhne«. Allgemein kannte man ihn jedoch nur unter seinen Initialen: SPB. Priscillas Mutter Doris, damals vierundzwanzig, war die verhätschelte Tochter eines Majors im Ruhestand aus Bath und einer eins fünfzig großen Schottin, die alles und jeden mit dem lobenden Adjektiv »bonny« versah, mit Ausnahme ihres Schwiegersohns. Die Ehe war von Anfang an eine Katastrophe.
SPB hatte Doris vier Jahre zuvor bei einem Tanztee kennengelernt. Das Mädchen, das in dem Salon vor ihm stand, war schlank, hatte blasse Wangen unter einer glatten dunkelbraunen Ponyfrisur, ein schmales, ovales Gesicht mit spitzem Kinn – und wurde von den jungen Männern umschwärmt. In Oxford und Tansley, wo sein Vater sein Brot verdiente, hatte SPB bis dahin nur Mädchen vom Typ »Verkäuferin« gekannt. Bei den Schwestern seiner Kommilitonen brachte er keinen Ton heraus. Als Doris ihn mit katzengrauen Augen und Schmollmund ansah, marschierte er auf sie zu und verlangte einen Tanz nach dem anderen. Sie gewährte ihm elf.
Zu Silvester tanzten sie wieder miteinander, diesmal auf dem Ball des Lansdown Cricket Club. Doris trug ein erdbeerrotes Kleid und verriet ihre Vorlieben für Zwergschnauzer, Kekse und Gin. Irgendwann zog sie ihn in eine dunkle Ecke und gab ihm ohne Vorwarnung einen langen Kuss. Der Kuss überwältigte ihn. SPB vergaß alles um sich herum, wie er später schrieb. Er sah Doris in die Augen, nahm ihre langen, schmalen Hände, in denen seiner Meinung nach »die ganze Fülle ihres Wesens zum Ausdruck kam«, und äußerte jene sechs Worte, die sich als größter Fehler seines Lebens erweisen sollten.
»Heißt das, du willst mich heiraten?«
Doris nickte. »Wenn du mich willst?«
Sie heirateten in der St. Anne’s Church in Oldland, Gloucestershire, am 6. August 1913. Die beiden jungen Leute wussten kaum etwas voneinander, und noch weniger wussten sie von Sex. Mit achtundzwanzig hatte SPB zum ersten Mal ein Mädchen seiner gesellschaftlichen Klasse geküsst und gleich geheiratet. Die Unschuld war sein Fluch. Er ging mit großer Arglosigkeit durchs Leben und wurde nie so recht schlau aus dem sonderbaren Verhalten der Menschen.
SPB verdiente als Schulmeister 150 Pfund im Jahr und hatte bei seiner Heirat bereits Schulden. Er konnte Doris nicht mit nach Rossall an der Küste von Lancashire nehmen, weil die Schule keine verheirateten Lehrer beschäftigte. Major Snow, Doris’ Vater, hatte der Heirat unter der Bedingung zugestimmt, dass SPB sein Leben mit 1000 Pfund versicherte und Doris zur Begünstigten machte.
Seine Mutter hatte ihn angefleht, die Hochzeit abzusagen. »Das wirst du dein Leben lang bereuen.« Sie hatte bereits eine »tiefverwurzelte Abneigung« gegen ihre zukünftige Schwiegertochter entwickelt (und verweigerte nach der Hochzeit jeden Umgang mit ihr). Sie hielt Doris für ein flatterhaftes Ding, das ihr das einzige Kind entreißen wollte, und spürte sehr richtig, dass das Paar keinerlei gemeinsame Interessen besaß. In der Familie Snow galt Lesen als Zeitverschwendung. (»Bücher in einem Haus verderben die ganze Einrichtung. Das ist meine Meinung«, sagte Mrs. Snow oft.) Doris hasste Spaziergänge und konnte mit der Natur nichts anfangen. Sie spielte gern Pianola, Billard und Bridge und sonnte sich ansonsten im Glanz männlicher Aufmerksamkeit. Kricket mochte sie auch nicht.
Es war daher auch Doris, die schließlich einen Versuch unternahm, die Verlobung zu lösen. Eine Woche vor der Hochzeit führte SPB seine eigensinnige Verlobte zu einem Kricketspiel, bei dem sie Reißaus nahm. Sie sagte, sie fahre nach Hause, könne ihn nicht mehr sehen und wolle nichts mehr mit ihm zu tun haben. Es war seine letzte Chance, die er besser ergriffen hätte. Doch SPB war inzwischen besessen von dem Gedanken an ein baldiges gemeinsames Leben und drohte bei Zurückweisung mit Selbstmord.
Das Ausmaß seines Fehlers zeigte sich während der Flitterwochen in Porlock Bay. Er schleppte seine neue Ehefrau durch dichtes Farnkraut, um die Jagdhunde in Cloutsham, Dunkery und Exford zu beobachten. Sie paddelten auf dem Badgworthy-Fluss bis zum Doone Valley, gingen in Porlock Weir baden, erklommen den Selworthy Beacon, fuhren mit einem Ausflugsdampfer nach Ilfracombe, um seine Tante zu besuchen, und sahen im Park von Dunster Castle beim Polo zu. Was sie nicht taten, war miteinander schlafen, wie mir Vivien neben anderen bemerkenswerten Details erzählte.
Dafür gab es zwei Erklärungen. Zunächst hatte Doris ihre Periode, was bei ihr, laut Vivien, mit großen Schmerzen verbunden war. »Ma lag in diesen kritischen Tagen für gewöhnlich auf dem Sofa und wollte mit Tee und Keksen verwöhnt werden. Sie brauchte dann viel Liebe und Mitgefühl. SPB wusste aber nichts von solchen Sachen, weil er nie mit jungen Frauen und ihrem monatlichen Leiden zu tun gehabt hatte. Also wurde die Hochzeitsreise zur Katastrophe. Ma bekam nämlich nach einer Woche tatsächlich ihre Periode und erwartete Tee und Mitleid, während ihr ergebener Ehemann aufs Land verschwand, um zu wandern und die Gegend zu erkunden.«
Der zweite Grund war, dass keiner der beiden wusste, wie man die Ehe vollzog. SPB schrieb, sein Vater habe sich zu den drei Themen Geld, Gott und Geschlecht konsequent in Schweigen gehüllt. Und Major Snow war seiner Tochter gegenüber offenbar auch nicht mitteilsamer gewesen. Vivien erzählte mir: »Ma hatte angeblich keine Ahnung, woher die kleinen Kinder kamen, und SPB wusste offenbar auch nicht viel mehr über das ›Wie‹. Es dauerte drei Jahre, bis sie endlich Rat bei einem Arzt suchten, und am 12. Juli 1916 kam meine Schwester Priscilla Rosemary Mais in Sherborne zur Welt.«
SPB schrieb später zahllose Bücher, vor allem Reiseberichte, aber auch autobiographische Romane. Letztere hielten sich so sehr an die Realität, dass ich ihnen Informationen entnehmen konnte, die ich von Vivien nicht bekam. Demnach verbrachte er am Tag von Priscillas Geburt den Vormittag in der Schule, um nicht ins Grübeln zu verfallen. »Ich unterrichtete von neun bis eins, redete unentwegt und versuchte, mich auf quadratische Gleichungen und englische Grammatik zu konzentrieren. Gegen Mittag ging ich heim, wo man mir sagte, ich solle mich fortscheren und nicht vor vier Uhr wiederkommen. Ich fuhr kilometerweit Fahrrad, ohne etwas zu sehen, und mein Kopf war ganz leer, bis auf den immer wiederkehrenden Satz: ›Lieber Gott, mach, dass alles gutgeht!‹«
Als er zurückkam, zeigte man ihm Priscilla in ihrem Bettchen. Sie war um halb zwei zur Welt gekommen. »Sie ist kräftig und munter, hat große blaue Augen und ebenmäßige Züge.«
Trotzdem machte ihm das kleine Wesen Angst. Als er es zum ersten Mal auf den Arm nahm, konnte er einfach nicht glauben, dass dieses neue Leben Teil seiner selbst war, »etwas, das zukünftig in ihm einen Vater sehen würde«. Anscheinend hat er Priscilla mit seiner Angst angesteckt, denn schon wenige Wochen später heißt es: »Sie zeigt ein außergewöhnliches Maß an Individualität. Leider macht ihr jedes plötzliche Geräusch furchtbare Angst. Das hat sie wohl geerbt …« Er stand stundenlang bei Priscilla und versuchte, »der Zukunft abzulauschen, was sie wohl für sie bereithielt«.
Es gab zwei Prophezeiungen, was Priscilla und ihre Zukunft betraf. Die eine stammte von einer offiziellen Wahrsagerin, die in Sherborne ansässig war. Ich fand ihr »Gutachten« unter Priscillas Papieren, mit Bleistift in einer geraden Schrift notiert: »Ebenso gewitzt wie tiefsinnig, kritisch und lebhaft – das sind die wichtigsten Charakterzüge. Sehr verschwiegen, gibt eine Freundin ab, bei der Geheimnisse sicher sind. Doch neben diesen Eigenschaften besteht auch ein zu glühendes Temperament in der Liebe … Kurze Reisen sind gut, besonders wenn sie unerwartet und kurzfristig unternommen werden müssen … Ihre glücklichste Zeit wird nach der Heirat sein, zu der es früh im Leben kommt, wahrscheinlich mit einem Mann, der älter ist als sie und ihr treu ergeben, der sie gut und großzügig behandeln wird … Mit dem Tod des Vaters endet große Uneinigkeit.«
Die zweite Prophezeiung wurde in Versform abgefasst.
Priscilla war drei Monate alt, als sich ein früherer Schüler von SPB aus Sherborne in sein Zimmer in Sandhurst setzte und anlässlich ihrer Geburt ein Gedicht niederschrieb. Der Autor war damals achtzehn und noch unbekannt. Als Alec Waugh zwei Jahre später seinen ersten (und einzigen) Gedichtband, Resentment, veröffentlichte, fand sich darin auch »To Your Daughter«. Waugh, der für Priscilla später eine Art Mentor darstellen sollte, war inzwischen bereits zu Ruhm gekommen.
Ich bestellte Resentment in der Bodleian Library in Oxford. Es handelte sich um eine einfache Broschur-Ausgabe vom Juli 1918, die ganz offensichtlich nie gelesen worden war – die Seiten waren nicht aufgeschnitten. Eine junge Bibliothekarin nahm ein Messer aus einer Schublade und schlitzte das Gedicht für mich auf.
»To Your Daughter« ist demnach Priscillas Eltern gewidmet. Es ist lang und sehr ernst. Einige Zeilen geben vielleicht einen Eindruck:
And dust’s the end of every song …
Yet happiness is not life’s aim.
Unflinching you will face the truth,
And others not so nobly wise
Will lay before your feet their youth,
Their hopes, and their heart’s treasuries.
So though you deem the gift of life
Better not had, those others torn
And bleeding in the throes of strife
Will thank their God that you were born.[3]
Priscillas erstes Zuhause war eine Doppelhaushälfte aus rotem Backstein mit Blick auf Sherborne Castle. SPB mietete sie für 35 Pfund im Jahr. Er hatte eine Stelle als Lehrer in Sherborne angenommen und vor allem auf Druck seiner Schwiegermutter das Angebot eines Schulinspektorenpostens auf Ceylon ausgeschlagen. Das Haus war eine ziemliche Bruchbude, ausgestattet mit hässlichen Eichenmöbeln und einem Perserteppich, den Mrs. Snow ihnen als Hochzeitsgeschenk gestiftet hatte. SPB dachte später immer nur mit Schaudern an dieses Haus zurück.
Als einziges Kind eines zerstreuten Pfarrers und einer unwilligen Mutter, die ihn zur Pflege an ältere Verwandte weitergereicht hatte, wusste SPB sehr wenig darüber, wie man sich als Ehemann und Vater verhielt. Er machte nun erstmals Erfahrungen mit dem Familienleben und war völlig verstört. Nachdem Alec Waugh ein Wochenende mit SPB, Doris und der vier Monate alten Priscilla verbracht hatte, berichtete er seinem Vater in einem Brief von den erstaunlichen Gepflogenheiten im Hause Mais: »Beim Frühstück kommt Mais fluchend und zeternd angewalzt. ›Dein Schuh ist offen‹, sagt Doris. ›Dann mach ihn zu!‹, sagt Petre und stellt seinen Fuß auf ihr Knie …«
Dass Mrs. Snow häufig zu Besuch kam, trug nicht gerade zur Entspannung der Lage bei. Ein Sohn war jung gestorben, und sie empfand die Trennung von ihrer einzigen Tochter als bedrückend. Nach der Geburt von »bonny« Priscilla kam sie öfter denn je. Ein Foto in Priscillas Album zeigt eine kleine Frau mit runder Drahtbrille und Apfelbäckchen. Das angedeutete Lächeln in ihrem Gesicht hat wahrlich nichts Humorvolles. Ihr Schwiegersohn konnte es jedenfalls nie erwarten, bis sie endlich wieder abreiste, aber wenn sie einmal da war, neigte sie dazu, Wurzeln zu schlagen.
SPB bewunderte Thomas Hardy und berichtete eines Tages stolz, dass er den Vormittag mit der Witwe des Romanciers verbracht hatte. Mrs. Snows bemerkte nur säuerlich: »Ein unangenehmer Schriftsteller, der ganz offensichtlich nicht ganz richtig im Kopf war.« Sie warf SPB Egoismus vor, weil er ein Fahrrad angeschafft hatte – schließlich sei er kein sorgloser Junggeselle mehr. »Du musst lernen, zu sparen und an den Haushalt zu denken.« Sie äußerte sich zu seinem übermäßigen Appetit, seinen schlechten Manieren und seiner Unreinlichkeit und reizte ihn derart, dass er Doris gegenüber ausfallend wurde, was ihm hinterher leidtat.
Die ewigen Vorwürfe waren Priscillas Gutenachtgeschichten: Dass SPB lieber in den South Downs wandern ging, als sich um Doris zu kümmern. Dass Doris sich mit einem seiner Schüler herumtrieb, statt sich um ihre Tochter zu kümmern. Meist zog SPB den Kürzeren. Das Urteil lautete, er sei egoistisch, zwanghaft, verschwendungssüchtig.
»Im Allgemeinen sind Schriftsteller besser in ihren Büchern als im wirklichen Leben«, schrieb SPB in Rebellion – einem Roman, den er 1917 innerhalb von zwei Wochen verfasste, als er mit Priscilla bei Alec Waugh im Norden Londons wohnte. Dieser Ansicht war Doris auch.
Doris war allerdings zu naiv oder zu unerfahren, um zu erkennen, dass ihr Mann manisch-depressiv veranlagt war. Er floh keineswegs vor ihr in die Downs – er brauchte die Landschaft, um wieder zu sich zu finden.
Manche Menschen kommen in einen Raum und füllen ihn sofort mit ihrer Präsenz. SPB war – wenigstens zuweilen – ein solcher Mensch. In Oxford hatte SPB die Universität erfolgreich beim Querfeldeinrennen vertreten. Alec Waugh erinnerte sich, dass SPB in Sherborne mit einem Stapel Bücher unter dem Arm über das Gelände marschierte, als würde er sich für einen Marathon warm machen. Andere Schriftsteller, die seine Schüler gewesen waren, erklärten ihn im Rückblick zu ihrem wichtigsten Lehrer: Er weckte in ihnen die Leidenschaft fürs Theater, für Gedichte und Romane und machte ihnen Mut, selbst zu schreiben. Hinter seiner zuweilen überschäumenden Energie steckte jedoch eine bipolare Störung, die erst 1964 diagnostiziert wurde. »Er segelte mit großem Enthusiasmus, hatte aber sehr wenig Ballast an Bord«, schrieb der Rektor in Sherborne, nachdem er ihn 1917 gefeuert hatte.
Wenn es ihm gutging, war er eine Bereicherung für seine Mitmenschen. »Dann wollte jeder in seiner Nähe sein«, sagte meine Mutter. Doch wenn er niedergeschlagen war, kam kaum jemand mit ihm aus. Berufliche und auch private Beziehungen drohten zu zerbrechen.
Priscilla wuchs damit auf, dass SPB ihrer Mutter Vorhaltungen machte: »Du hast mich doch einmal geliebt!« Worauf Doris zurückgab: »Hör auf mit den alten Geschichten! Kapernsoße habe ich auch irgendwann einmal gemocht.« Die Kämpfe wurden erbittert geführt. Oft sank Doris irgendwann zu Boden und ließ ihren Tränen freien Lauf.
Als Priscilla drei war, begann Doris eine Affäre mit einem ehemaligen Schüler ihres Mannes. Neville Brownrigg war im Ersten Weltkrieg Leutnant im 20. Husarenregiment gewesen, »ein vierschrötiger Ire, der keinerlei Intelligenz, aber dafür umso mehr Charme besaß«. Als SPB Brownrigg einmal in sein Elternhaus nach Tansley einlud, fiel das Urteil seiner Mutter vernichtend aus. »Das ist ein geborener Parasit. Der plündert heimlich deine Vorräte und verschwindet dann wieder. Du wirst schon sehen.« Doch SPB bewunderte Brownrigg als geschickten Kricketspieler und vergnüglichen Lebemann. »Er hatte nichts im Hirn, war aber sehr lustig und machte, was er wollte.«
1919 hatten sie sich wiedergetroffen, auf einem Bahnsteig in Tonbridge, wo SPB nun im Anschluss an Sherborne unterrichtete. Brownrigg wohnte in der Nähe bei seinem Onkel und hatte nach fünf Jahren Kampfeinsatz in Ägypten und Frankreich keine Anstellung. Aus einem Impuls heraus lud SPB Brownrigg ein, mit in das große Haus zu ziehen, das ihm die Tonbridge School zur Verfügung gestellt hatte. Er suchte einen Sekretär und meinte, dass Frau und Tochter ein wenig Gesellschaft brauchen konnten.
Siebzehn Jahre später betrachtete der Vorsitzende Richter des Scheidungsgerichts, Sir Alfred Bucknill, das Ergebnis mit Erstaunen: »Bedauerlicherweise hatte Mr. Mais’ Güte zur Folge, dass seine Frau und Mr. Brownrigg sich ineinander verliebten und es zwischen ihnen zu Verfehlungen kam.« Doris war damals siebenundzwanzig. Mit ihrer Beziehung zu einem vier Jahre Jüngeren begann, was das Gericht später als »dieses sonderbare Zusammenleben von Mr. und Mrs. Mais« bezeichnen sollte.
Ein brauner Umschlag in SPBs Archiv enthielt Ausschnitte aus der Times, den News of the World und dem Daily Mirror. Letzterer titelte auf der Umschlagseite: »Antrag im Interesse der Allgemeinheit abgelehnt«.
Am 16. Juli 1936 hatte Doris Mais ihren Mann in einem aufsehenerregenden Fall auf Scheidung verklagt. Sie wollte die zerbrochene Ehe mit einem Gatten auflösen, der schon seit 1925 nicht mehr ihr eigentlicher Lebenspartner war.
Da Doris in jenen Tagen kaum Chancen hatte, den Prozess zu gewinnen, riet ihr der Anwalt, SPB in die Rolle des sexuell Perversen zu drängen. Doris ließ sogar ihre Tochter vorladen, damit sie gegen den Vater aussagte – was heutzutage wohl kein Gericht mehr dulden würde.
In Priscillas Erinnerung herrschte in ihrem Elternhaus ständig Krisenstimmung. Die angespannte Atmosphäre hatte dazu beigetragen, dass sie ein schwieriges und neurotisches Kind wurde. Doris’ Mutter bewachte Priscilla »wie ein Drache den Goldschatz«. Der Vater bekam sie oft den ganzen Tag nicht zu sehen und musste sich mit dem dreimal wiederholten »Nacht, Daddy« begnügen, wenn er zum Abendessen nach unten ging.
Nachts hörte er sie in ihren Albträumen manchmal schreien. Diese Schreie verfolgten SPB nach Tonbridge, nach Lincolnshire, nach Hove. Und sogar bis nach Wengen, wohin er mit Priscilla zum Skilaufen fuhr – ihre erste Auslandsreise. Der darauffolgende Sommer führte die beiden ins nördliche Devon. SPB bemerkte in seiner Autobiographie: »Die Ferien, die ich in Woolacombe mit meiner damals ungefähr sechsjährigen Tochter Pris verbrachte, waren mit die schönsten, die ich je hatte. Wir verbrachten einen goldenen, unvergesslichen Monat miteinander, der wie ein Traum verging und von dem ich nicht mehr viel weiß, nur, dass wir ständig steile Sanddünen hinunterrollten und den heißen Sand schließlich im kühlen Meer aus Haaren und Kleidern wuschen. Ich glaube nicht, dass ich ihr vorher oder nachher im Leben jemals so nah gewesen bin, und es macht mir nichts aus, dass Pris das alles garantiert vergessen hat.«
Das letzte Zuhause der Maises als Familie war eine Wohnung direkt am Meer in Hove. Man zog zu fünft dort ein: Priscilla, ihre Eltern, Brownrigg sowie Priscillas kleine Schwester Sheila Vivien, die 1920 zur Welt gekommen war. Ihr Vater arbeitete inzwischen nicht mehr als Lehrer, sondern als Journalist. Beim Daily Express war er als Film- und Theaterkritiker tätig. Wenn er Priscilla auf dem Weg zum Bahnhof zur Schule brachte, fiel ihm auf, dass sie es vermied, an Leuten vorüberzugehen, an denen sie schon einmal vorbeigekommen war. Er schrieb in sein Tagebuch, sie habe eine heftige Abneigung gegen »geschlossene Türen und das Geräusch ablaufenden Badewassers«. Er hörte zu, wie seine Tochter mit den Fingern an die Wand klopfte. Er notierte: »Nächtliche Schreie nach Kinobesuch und Träume von Verfolgung durch Wölfe.«
Bis Vivien vier Jahre alt war, ahnte SPB offenbar nichts von der Affäre, die seine Frau mit Brownrigg begonnen hatte. Im Mai 1924 gestand Doris endlich – und teilte dem fassungslosen SPB mit, sein Sekretär und Chauffeur sei seit geraumer Zeit ihr Liebhaber und außerdem Sheila Viviens Vater, und sie habe noch niemanden auf der Welt so geliebt. Richter Bucknill kommentierte: »Es ist wohl kaum ein beschämenderes Verhalten denkbar als das einer Ehefrau, die über Jahre hinweg im Haus ihres Ehemannes Verfehlungen mit einem jungen Mann begeht, den der Ehemann ins Haus gebracht und sich zum Freund gemacht hat.«
Über Nacht brach für SPB