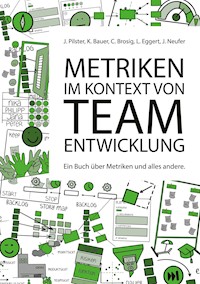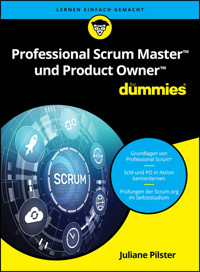
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Für Dummies
- Sprache: Deutsch
Facilitator oder Wert-Maximierer? Wo sehen Sie Ihre Stärke?
Dieses Buch ist Ihr idealer Begleiter, wenn Sie sich auf die Scrum-Master- oder die Product-Owner-Zertifizierungsprüfung der Scrum.org im Selbststudium vorbereiten möchten. Es deckt die Scrum-Grundlagen, Methoden und bewährten Praktiken, die für die Prüfung relevant sind, umfassend ab. Mit Beispielen und Tipps aus der Praxis ist es schnell zugänglich und hilft Ihnen, Ihr Verständnis von Scrum zu festigen. Das Buch enthält 84 beispielhafte Übungsfragen und kommentierte Lösungen, um sicherzustellen, dass Sie optimal vorbereitet sind.
Sie erfahren
- Welche Bedeutung Transparenz, Inspektion und Adaption in Scrum haben
- Was die Aufgabe des Scrum Teams ist und wie Scrum Events vor sich gehen
- Welche »Good Practices« Ihnen den Alltag erleichtern
- Wie die Zertifizierungsprüfungen ablaufen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Professional Scrum Master™ und Product Owner™ für Dummies
Schummelseite
SCRUM
Scrum ist ein leichtgewichtiges Rahmenwerk (Framework), keine Methode. Es …
ist bewusst unvollständig.dient der Schaffung von Wert.dreht sich um adaptive Lösungen für komplexe Probleme.setzt auf ein iteratives, inkrementelles Vorgehen.EMPIRIE
Scrum basiert auf Empirie und Lean Thinking. Die drei Säulen der Empirie heißen:
TransparenzInspektionAdaptionTransparenz, Inspektion und Adaption sind nur im Dreiklang wirksam.
SCRUM-WERTE
Die Scrum-Werte lauten:
CommitmentFokusOffenheitRespektMutDurch die fünf Scrum-Werte funktionieren die drei Säulen Transparenz, Inspektion und Adaption, und Vertrauen kann entstehen.
SCRUM TEAM
Ein Scrum Team ist ein kleines Team, das eng zusammenarbeitet. Es zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
hierarchielosinterdisziplinär (cross-functional)managt sich selbst (self-managing)üblicherweise ≤ 10 Personenschafft signifikante Arbeit je Sprintliefert je Sprint ein wertvolles, nützliches IncrementEin Scrum Team besteht aus einem Product Owner, einem Scrum Master und Entwicklern. Es gibt keine »Sub-Teams« in einem Scrum Team.
3-5-3
Kern des Scrum-Rahmenwerks sind 3-5-3 Elemente und die Regeln, die diese Elemente miteinander verknüpfen. Nur dann, wenn das Rahmenwerk vollständig eingehalten wird, ist es Scrum.
3 Verantwortlichkeiten:
Product OwnerScrum MasterEntwickler5 Scrum Events:
SprintSprint PlanningDaily ScrumSprint ReviewSprint Retrospective3 Artefakte:
Produkt BacklogSprint BacklogIncrementArtefakte dienen der Transparenz.
ERGEBNISVERANTWORTUNG
Scrum unterscheidet zwischen Ergebnisverantwortung (Accountability) und Umsetzungsverantwortung (Responsibility). Die folgenden Ergebnisverantwortungen sind im Scrum Guide festgehalten:
Scrum Team: Schaffung eines wertvollen, nützlichen Increments je SprintProduct Owner: Wert-Maximierung des Produkts, Product-Backlog-Management, Stakeholder-ManagementScrum Master: Einführung von Scrum gemäß Scrum Guide, Effektivität des Scrum TeamsEntwickler: Sprint Backlog, Qualität durch die Einhaltung der »Definition of Done«, tägliche Adaption des Plans zur Erreichung des Sprint-Ziels, gegenseitig als Experten in Verantwortung nehmenPRODUCT OWNER
Der Product Owner wird auch Wert-Maximierer genannt. Er …
ist eine Person, kein Gremium.verfügt über die Entscheidungshoheit für die Sortierung des Product Backlogs.kann Umsetzungsverantwortung delegieren.kann den Sprint abbrechen, wenn das Sprint-Ziel hinfällig geworden ist.SCRUM MASTER
Der Scrum Master ist eine echte Führungspersönlichkeit. Er …
dient dem Scrum Team, dem Product Owner und der Organisation.agiert als Lehrer, Facilitator und Coach.kümmert sich um die Einführung von Scrum.kümmert sich um die Beseitigung von Hindernissen.ENTWICKLER
Die Entwickler erzeugen während des Sprints ein Increment, indem sie Product-Backlog-Einträge umsetzen. Sie …
verfügen über alle notwendigen Fähigkeiten.organisieren ihre Arbeit selbst.schätzen die Umfänge der Arbeit.SCRUM EVENTS
Alle Scrum Events bieten die Gelegenheit für Inspektion und Adaption. Sie sind auf folgende Zwecke ausgerichtet:
Sprint: Erstellung eines wertvollen, nützlichen IncrementsSprint Planning: Erstellung einer Prognose, eines Plans und eines Ziels für den SprintDaily Scrum: Überprüfung des Fortschritts hinsichtlich des Sprint-Ziels und Erstellung eines Plans für die nächsten 24 StundenSprint Review: Überprüfung des Sprint-Ergebnisses und Ableitung der nächsten SchritteSprint Retrospective: Identifikation von Maßnahmen zur Verbesserung von Qualität und EffektivitätTIMEBOXEN
Die Timebox ist die maximale Dauer eines Events.
Sprint: ein Monat oder kürzerSprint Planning: acht Stunden für einen einmonatigen SprintDaily Scrum: 15 MinutenSprint Review: vier Stunden für einen einmonatigen SprintSprint Retrospective: drei Stunden für einen einmonatigen SprintSPRINT BACKLOG
Das Sprint Backlog besteht aus ausgewählten Product-Backlog-Einträgen (Was), einem Plan für die Lieferung des Increments (Wie) sowie dem Sprint-Ziel (Warum). Es …
»gehört« den Entwicklern.dient als Plan für den Sprint.COMMITMENTS
Die drei Artefakte in Scrum sind jeweils mit einem Commitment versehen, die der Überprüfung des Fortschritts dienen:
Product Backlog: Produkt-ZielSprint Backlog: Sprint-ZielIncrement: Definition of DonePRODUCT BACKLOG
Das Product Backlog ist eine geordnete (nicht nur priorisierte!) Liste. Es …
ist unvollständig und dynamisch.wird bei neuen Erkenntnissen sofort angepasst.»gehört« dem Product Owner.ist die einzige Quelle von Arbeit für das Scrum Team.Die Einträge des Product Backlogs werden im Rahmen von kontinuierlichen Refinement-Aktivitäten weiter detailliert. Dadurch sind die Entwickler im Sprint Planning in der Lage, Einträge auszuwählen.
INCREMENT
Das Increment entspricht einem Schritt in Richtung Produkt-Ziel. Es …
besteht aus vorherigen Increments ergänzt um neue Funktionalitäten.muss benutzbar sein, um Wert zu stiften.sorgt im Sprint Review für Transparenz.entspricht der Definition of Done.
Professional Scrum MasterTM und Product OwnerTM für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2025
© 2025 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This book is published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Dieses Buch wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: WrightStudio - stock.adobe.comKorrektur: Claudia Lötschert
Print ISBN: 978-3-527-72226-6ePub ISBN: 978-3-527-84841-6
Über die Autorin
Juliane Pilster ist agile Führungskraft und Organisationsentwicklerin und fühlt sich im Kontext von Transformationen zu Hause. Sie lässt nicht locker, bis es den Menschen um sie herum besser geht, und setzt dabei auf agile Prinzipien, Selbstmanagement, Netzwerke und regenerative Führung. Scrum zählt zu ihren langjährigen Begleitern. Unter anderem bildet sie Scrum Master aus und coacht und unterstützt sie in ihrer täglichen Arbeit. Die Wirtschaftsingenieurin der Fachrichtung Elektrotechnik war bereits in verschiedenen Fach- und Führungspositionen in unterschiedlichen Unternehmen und Branchen tätig. Unabhängig von der Rolle sind ihr drei Dinge wichtig: Authentizität, Abenteuerlust und Fortschritt.
Ihr Kumpel Marcel erzählte ihr im Jahr 2008 zum ersten Mal von diesem »Scrum«, einem iterativen Vorgehen, um Projekte besser abzuwickeln als bisher. Sie war jedoch noch im Studium und so sehr mit elektrotechnischen Sachverhalten beschäftigt, dass sie damit zunächst einmal nichts anzufangen wusste. Trotzdem hatte Scrum sie irgendwie fasziniert und sich eine kleine Ecke in ihrem Hinterkopf gesucht, wo es verharrte und – kaum war sie in den Beruf eingestiegen – wieder hervorkam. Obwohl sie sich intensiv mit klassischem Projekt- und Prozessmanagement auseinandersetzte, machten vor allem ein paar Eigenschaften, die sie Scrum entliehen hatte, bereits ihre frühen Projekte erfolgreich: Kundenzentrierung, kurzzyklische Planung, iteratives und inkrementelles Vorgehen, frühzeitiges Feedback.
Ziemlich schnell begann sie dann, Scrum einzusetzen – in Softwareentwicklungsprojekten übrigens erst nach Jahren. Zuvor war sie immer in anderen Branchen tätig und erlebte begeistert die vielfältige Anwendbarkeit von Scrum. Die Magie entfaltete sich immer mehr, und sie ist davon überzeugt, dass wir irgendwann in der Zukunft komplexe Projekte nur noch so umsetzen werden, wie die Erfinder von Scrum es einst ersonnen haben. Ob wir es dann (noch) Scrum nennen, sei einmal dahingestellt.
Widmung
Ich widme dieses Buch stellvertretend für die vielen Scrum Master, die täglich hart daran arbeiten, ihr Umfeld ein bisschen agiler zu gestalten, einigen tollen Scrum Mastern, die ich in den letzten 15 Jahren kennenlernen durfte (in der Reihenfolge ihres Auftretens in meinem Leben): Dave, ST, Mike, Laura, Carina, Christian, Lisa, Deborah, Ilka, Elea, Nico, Kim – lasst Euch bitte niemals unterkriegen. Die Welt braucht Menschen wie euch!
Danksagung
Ich bin froh und dankbar, dass ich mit diesem Buch noch einmal mein gesammeltes Wissen zum Thema Professional Scrum™ niederschreiben durfte. Ich möchte Sie ermutigen, sich – über die Prüfungen hinaus – intensiv mit den Zusammenhängen und Haltungsfragen zu beschäftigen, auf denen Scrum basiert. Nur dann – so meine feste Überzeugung – wird es Ihnen gelingen, die Magie von Scrum voll zu entfalten. Das reine Bestehen der Prüfung wird nicht dazu führen.
Es gibt ein paar Menschen, ohne die dieses Buchprojekt nicht möglich gewesen wäre und die ich daher an dieser Stelle kurz würdigen möchte. Ihr seid die Besten!
Danke an Marcel, dass du die Idee von »Scrum« in mein Leben gebracht hast. Wer weiß, ob es ohne unseren Austausch vor so vielen Jahren jemals so weit gekommen wäre.
Danke an meinen (agilen) Wegbegleiter Dominik Maximini: Du hast dieses Buch fachlich begleitet und aufgepasst, dass alles gemäß Scrum Guide formuliert ist.
Danke an meinen Mann, meine Eltern und meine Schwiegermutter: Ihr habt mir den Rücken freigehalten, sodass dieses Buch überhaupt entstehen konnte.
Danke an meinen Sohn: Du musstest immer wieder auf mich verzichten, wenn ich am Schreibtisch saß. Auch du hast dieses Buch Wirklichkeit werden lassen.
Danke an meine wunderbare Lektorin Andrea Baulig: Ihre schnellen Rückmeldungen, klugen Hinweise und immerwährende Unterstützung haben mir sehr geholfen.
Danke an die ValueRise Academy, Anbieter deutschsprachiger Zertifizierungen, dass ich unter anderem auf euren Fragenpool zurückgreifen durfte.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autorin
Widmung
Danksagung
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Über dieses Buch
Törichte Annahmen über die Leser
Was Sie nicht lesen müssen
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Konventionen in diesem Buch
Wie es weitergeht
Teil I: Grundlegende Konzepte
Kapitel 1: Einführung in die Welt der Scrum Master und Product Owner
Bedeutung von Scrum in der VUCA-Welt
Framework vs. Methode
Scrum Master ≠ Projektmanager ≠ Product Owner
Wichtige Learnings für die Prüfung
Kapitel 2: Werte und Prinzipien als Basis
Agiles Manifest und Agile Prinzipien
Scrum-Werte im Überblick
Wichtige Learnings für die Prüfung
Kapitel 3: Transparenz, Inspektion, Adaption
Empirie als Vorgehensmodell
Förderung von Selbstmanagement
3-5-3-Aufbau des Scrum-Rahmenwerks
Wichtige Learnings für die Prüfung
Teil II: Scrum-Theorie
Kapitel 4: Scrum Team im Überblick
Entwickler
Product Owner
Scrum Master
Gründung und Veränderung von Scrum Teams
Wichtige Learnings für die Prüfung
Kapitel 5: Scrum Events im Überblick
Sprint
Sprint Planning
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
Wichtige Learnings für die Prüfung
Kapitel 6: Product Owner in Aktion
Product Owner als Wert-Maximierer
Product Owner als Mitglied des Scrum Teams
Produkt-Vision
»Done«
Product Backlog
Sprint Backlog
Stakeholder-Management
Wichtige Learnings für die Prüfung
Kapitel 7: Scrum Master in Aktion
Scrum Master als Impediment-Beseitiger
Scrum Master als Mitglied des Scrum Teams
Scrum Master als Change Agent in der Organisation
Scrum Master als Facilitator
Scrum Master als Coach
Wichtige Learnings für die Prüfung
Teil III: Scrum im Unternehmensalltag
Kapitel 8: Scrum im Unternehmensalltag
Einführung von Scrum in Unternehmen
Skalierung von Scrum
Wichtige Learnings für die Prüfung
Kapitel 9: Good Practices im Scrum-Umfeld
User Stories
Story Points
Velocity
Burndown-Chart
Agile Cone of Uncertainty
Teil IV: Die Zertifizierung
Kapitel 10: Zertifizierung
Prüfungsvorbereitung
Ablauf der Prüfungen
Kapitel 11: Informationsquellen
Scrum Guide
Scrum.org
Weitere Anbieter
Literatur
Internet
Kapitel 12: Prüfungsfragen
Empirie
Scrum-Werte
Scrum Team
Scrum Events
Artefakte
»Done«
Self-Managing Teams
Facilitation und Coaching
Forecasting und Release-Planung
Produkt-Vision und -Wert
Product-Backlog-Management
Stakeholder und Kunden
Lösungen und Erläuterungen
Teil V: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 13: Die zehn wichtigsten Fakten aus dem Scrum Guide zum Merken
Leichtgewichtigkeit vs. Komplexität
Empirie und ihre Säulen
Scrum basiert auf fünf Scrum-Werten
Ein Scrum Team besteht aus Verantwortlichkeiten
Scrum Team – klein und groß genug zugleich
Fünf Scrum Events
Events sind zweckgerichtet
Drei Artefakte
Qualität ist nicht verhandelbar
Keine Auslieferung ohne »Done«
Kapitel 14: Zehn grundlegende Fragen der Haltung zum Beherzigen
Scrum ist keine Methode
Pull statt Push
Kontinuierliche Verbesserung
Interdisziplinarität
Selbstmanagement
Increments sind Durchstiche
Scrum Master sind nicht allwissend
… aber Product Owner (fast) allmächtig
Stakeholder sind Interessenvertreter, keine Befehlsgeber
Facilitation und Coaching
Kapitel 15: Die zehn gefährlichsten Stolperfallen in der Prüfung
My English is not the Yellow from the Egg
So machen wir es in der Praxis
Antwort passt nicht zur Frage
Zu wenige Antworten
Zwingend oder nicht?
Das steht nicht im Scrum Guide
Da ist von mehreren Teams die Rede
Änderungen im Scrum Guide
Ohne Vorbereitung die Prüfung absolvieren
Google liegt falsch
Kapitel 16: Zehn wichtige Änderungen im Scrum Guide 2020
Ein Scrum Team ist ein Team
Aus Rollen werden Verantwortlichkeiten
Selbstmanagement statt Selbstorganisation
Keine Größenvorgabe mehr
Jedes Artefakt enthält ein Commitment
Produkt-Ziel als Orientierung
Wer erstellt die Definition of Done?
Legende von den drei Fragen
Refinement < 10 % der Kapazität
Verbesserungsmaßnahmen sind nicht mehr Pflicht
Wichtige englische Begriffe
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 1
Tabelle 1.1: Fähigkeiten von Scrum Mastern und Product Ownern
Kapitel 5
Tabelle 5.1: Überblick über die Scrum Events während des Sprints
Tabelle 5.2: Input- und Output-Faktoren des Sprint Plannings
Tabelle 5.3: Input- und Output-Faktoren des Daily Scrums
Tabelle 5.4: Input- und Output-Faktoren des Sprint Reviews
Tabelle 5.5: Input- und Output-Faktoren der Sprint Retrospective
Kapitel 10
Tabelle 10.1: Fokusgebiete, die für die PSM-I- und die PSPO-I-Prüfungen relevant ...
Kapitel 13
Tabelle 13.1: Übersicht über die drei Artefakte und die dazugehörigen Commitments
Illustrationsverzeichnis
Einführung
Abbildung E1.1: Peters agile Reise: Weil Scrum draufsteht, ist noch lange kein Sc...
Kapitel 2
Abbildung 2.1: Scrum-Werte im Überblick
Kapitel 3
Abbildung 3.1: Drei Säulen der Empirie
Abbildung 3.2: Empirie und Vertrauen bauen aufeinander auf.
Abbildung 3.3: Elemente des Scrum-Prozesses
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Im Scrum Team vertretene Verantwortlichkeiten (Accountabilities): ...
Abbildung 4.2: Eigenschaften von Scrum Teams
Abbildung 4.3: Ergebnisverantwortung vs. Umsetzungsverantwortung
Kapitel 5
Abbildung 5.1: Scrum Events innerhalb des Scrum-Rahmenwerks
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Darstellung des Zusammenhangs zwischen Increments
Abbildung 6.2: Golden Circle von Simon Sinek (2009) in Bezug auf das Sprint-Ziel
Abbildung 6.3: Übersicht über die Stakeholder
Kapitel 7
Abbildung 7.1: Pyramide der Impediments (Maximini & Pilster 2023)
Abbildung 7.2: Facilitation-Prinzipien im Überblick
Kapitel 8
Abbildung 8.1: Exemplarische Darstellung einer traditionellen Matrixstruktur zur ...
Kapitel 9
Abbildung 9.1: Exemplarische Darstellung des Burndown-Charts zur Sprint-Mitte
Abbildung 9.2: Exemplarische Darstellung des »Agile Cone of Uncertainty«
Abbildung 9.3: Exemplarische Darstellung des »Agile Cone of Uncertainty«, nachdem...
Kapitel 10
Abbildung 10.1: Screenshot der Internetseite der
Scrum.org
zur PSM-I-Zertifizieru...
Abbildung 10.2: Screenshot meiner PSPO-I-Ergebnisse als Beispiel
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autorin
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Fangen Sie an zu lesen
Wichtige englische Begriffe
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
3
4
7
8
9
10
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
139
140
141
142
143
144
145
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
217
218
219
220
221
222
223
225
226
227
229
230
231
232
233
237
238
239
240
Einführung
Scrum ist wohl der bekannteste Ansatz für das agile Arbeiten und wenn es darum geht, komplexe Produktentwicklung zu betreiben. In den letzten Jahren wurden im Zuge der Einführung von Scrum nicht nur Meetings durch Events ersetzt, sondern es kamen auch neue Rollen in die Unternehmen: Product Owner und Scrum Master.
Professional Scrum Master™ und Product Owner™ für Dummies ist ein Buch für jeden, der in eine dieser Rollen schlüpfen darf oder bereits durfte und diese besonders gut machen möchte: professionell eben. Die Scrum.org hat rund um Scrum ein umfangreiches Angebot geschaffen, um etwas über Professional Scrum™ zu lernen und sich darin zertifizieren zu lassen.
Über dieses Buch
Dieses Buch sollte jeder lesen, der sich zu Professional Scrum™ weiterbilden möchte, um am Ende eine oder beide Grundlagenzertifizierungen Professional Scrum Master™ I oder Product Owner™ I der Scrum.org zu erreichen.
An dieser Stelle sei bereits erwähnt, dass die beste Methode, sich auf eine Prüfung vorzubereiten, vermutlich immer ist, ein Verständnis für das Gelernte zu entwickeln. Nichtsdestotrotz gibt es für die Zertifizierungsprüfungen einiges an reinem Wissen, das Sie sich aneignen können, um gute Chancen zu haben, die Prüfungen auch wirklich zu bestehen.
Dabei ist es am Ende ein bisschen wie mit dem Kfz-Führerschein: Autofahren lernen die meisten erst nach der Prüfung.
Die wichtigste Quelle ist der Scrum Guide in seiner Fassung aus dem Jahr 2020. Wer Professional Scrum Master™ oder Professional Scrum Product Owner™ sein möchte, sollte dieses Dokument wirklich sehr gut kennen. Der Scrum Guide ist frei zugänglich im Internet verfügbar: https://scrumguides.org/.
Törichte Annahmen über die Leser
Sie halten dieses Buch vermutlich in der Hand, weil
Sie entweder ein Scrum Master oder ein Product Owner werden wollen,
sich jeweils in die Welt des anderen reindenken möchten oder
weil Sie ganz neu mit Scrum in Berührung gekommen sind.
In jedem Fall liebäugeln Sie mit der Zertifizierung zum Professional Scrum Master™ oder zum Professional Scrum Product Owner™ der Scrum.org. Und dabei möchte Ihnen dieses Buch helfen.
Während ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich mir immer wieder Gedanken über Sie gemacht. Ich fragte mich, wer Sie sind und was Sie von mir brauchen, und traf folgende Annahmen:
Sie arbeiten schon eine Weile mit Scrum und wollen die Zertifizierung jetzt »nachziehen«: Erste praktische Erfahrungen machen es nicht immer leicht, im Sinne des offiziellen Scrum Guides zu denken. Die Realität überlagert die Theorie – ich spreche aus Erfahrung! Aber das kriegen wir schon hin. Falls Sie absoluter Anfänger sind und gar keine Vorkenntnisse haben, dann freuen Sie sich. Das macht die Sache leichter.
Sie haben nicht besonders viel Zeit, um sich auf die Zertifizierung vorzubereiten: Ich vermute, Sie haben neben der Zertifizierung zum Professional Scrum Master™ I oder Professional Scrum Product Owner™ I noch andere Dinge zu tun und suchen nach schnellen, praktischen Tipps, um sich die Theorie von Professional Scrum™ anzueignen und um mit diesem Wissen die Zertifizierungsprüfung der
Scrum.org
zu bestehen.
Sie arbeiten nicht in einem perfekten Scrum-Prozess: Vermutlich arbeiten Sie in einem realen Umfeld, in dem es vorher kein Scrum, sondern Projektmanagementmethoden gab, um Vorhaben aller Art erfolgreich über die Bühne zu kriegen. Herausforderungen können also auftreten, wenn Sie versuchen, Ihr neu erworbenes Scrum-Wissen anzubringen. Ich werde versuchen, Sie mindestens auf potenzielle Konflikte aufmerksam zu machen.
Sie finden
denglische
Fachliteratur schrecklich: Es tut mir leid. Begriffe spielen in Scrum eine so wesentliche Rolle, dass ich nicht umhinkomme, sie Ihnen näherzubringen. Das geht am einfachsten, indem ich die englischen Begriffe im Buch einfach benutze. Auch auf die Gefahr hin, dass sie Ihnen am Ende zum Halse raushängen werden, verfolge ich damit das Ziel, dass Sie die Begriffe in der
Scrum.org
-Prüfung schnell wiedererkennen.
Was Sie nicht lesen müssen
In den Kapiteln finden Sie Beispiele, die dazu dienen sollen, die theoretischen Ausführungen in dem Buch ein wenig anschlussfähiger zu gestalten. Es handelt sich dabei um Erfahrungen, die ich insbesondere im letzten Jahrzehnt und teilweise auch schon davor sammeln durfte. Für die Beispiele, die ich Ihnen zur Untermalung mitliefere, habe ich bereits vor ein paar Jahren einen fiktiven Charakter ersonnen: Peter (vgl. Abbildung E1.1). Peter war ursprünglich Projektleiter und übernimmt später die Rolle des Scrum Masters. Auf seiner persönlichen Entwicklungsreise erlebt er dabei allerlei, was mit Scrum nicht viel zu tun hat, aber auch zahlreiche positive Beispiele für die Anwendung von Scrum.
Für Ihre Zertifizierungsprüfung reicht es, den regulären Text des Buchs zu lesen und zu verstehen. Die Beispiele helfen hoffentlich dabei, alles leichter zu verinnerlichen.
Abbildung E1.1: Peters agile Reise: Weil Scrum draufsteht, ist noch lange kein Scrum drin.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Dieses Buch hat fünf Teile. Hier erfahren Sie, welche Inhalte Sie in welchem Teil finden und was Sie aus den einzelnen Teilen mitnehmen sollten.
Teil I: Grundlegende Konzepte
Im ersten Teil lernen Sie Scrum als ein empirisches Vorgehen kennen, das auf Experimenten basiert und kontinuierlich wertvolle Arbeitsergebnisse liefert. Es hilft, mit der Komplexität der VUCA-Welt umzugehen, und erfordert die vollständige Anwendung des Rahmenwerks. Die Rollen Scrum Master und Product Owner werden eingeführt, und Sie erhalten einen Einblick in wichtige Grundlagen:
das Agile Manifest aus vier Wertepaaren und zwölf Prinzipien
die fünf Scrum-Werte sind Commitment, Fokus, Offenheit, Respekt und Mut
Transparenz, Inspektion und Adaption als Säulen der empirischen Prozesskontrolle
Selbstmanagement als Aspekt von Scrum: Was wird wie, wann und von wem erledigt?
Teil II: Scrum-Theorie
In Teil II erhalten Sie zunächst einen Überblick über das Scrum Team, das aus Entwicklern, einem Product Owner und einem Scrum Master besteht, die gemeinsam an der Erstellung eines wertvollen Increments arbeiten. Auch die fünf Scrum Events Sprint Planning, Sprint, Daily Scrum, Sprint Review und Sprint Retrospective als formale Gelegenheiten zur Inspektion und Adaption sind in diesem Teil beschrieben. In der zweiten Hälfte dieses Teils lernen Sie dann die Arbeit des Product Owners und des Scrum Masters näher kennen. Dabei kommen Sie auch an den Scrum-Artefakten Product Backlog, Sprint Backlog und Increment vorbei und werden erfahren, welche Kompetenzen Sie für erste Schritte in den Rollen und damit auch für die Zertifizierung theoretisch mitbringen müssen.
Teil III: Scrum in der Praxis
In Teil III gehen wir über die reine Scrum-Theorie hinaus, und Sie werden sehen, wie Scrum ins Unternehmensumfeld eingebettet werden kann. Dabei kommen Sie auch an sogenannten »Good Practices« vorbei, die hier und da in der Zertifizierungsprüfung zumindest ihrer Begrifflichkeit nach auftauchen, und Sie beschäftigen sich mit dem Thema Skalierung.
Teil IV: Wie werde ich ein zertifizierter Product Owner oder Scrum Master?
Der vorletzte Teil widmet sich den Zertifizierungsprüfungen zum Professional Scrum Master™ I (PSM I) und zum Professional Scrum Product Owner™ (PSPO I). Sie erhalten einen Überblick über Informationsquellen, die ich für hilfreich halte. Außerdem bekommen Sie Informationen zur Prüfungsvorbereitung. Insbesondere finden Sie in diesem Teil eine lange Liste von beispielhaften Prüfungsfragen, mit deren Hilfe Sie üben können.
Teil V: Der Top-Ten-Teil
Der Top-Ten-Teil am Schluss fasst für Sie noch einmal die wichtigsten Hinweise im Hinblick auf Ihre Zertifizierung zusammen. Dazu gehören:
Die zehn wichtigsten Fakten aus dem Scrum Guide, die Sie sich merken sollten.
Zehn grundlegende Fragen der Haltung, die Sie beherzigen sollten.
Die zehn gefährlichsten Stolperfallen der Prüfung, denen Sie entgehen sollten.
Zehn wichtige Änderungen im Scrum Guide 2020, die Sie kennen sollten.
Sicherlich hilft es Ihnen für Ihre Zertifizierungsprüfung, einen Blick auf diese abschließende Zusammenfassung zu werfen. Die Lektüre des restlichen Buchs ersetzen diese wenigen Seiten natürlich nicht.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wichtige oder zusätzliche Informationen werden in diesem Buch mithilfe von Symbolen hervorgehoben. Hier ist ein Überblick über das, was Sie erwartet.
Für die Zertifizierung ist es hilfreich, sich den Scrum Guide genau anzuschauen. Manche Wortlaute aus dem Scrum Guide (in der männlichen deutschen Übersetzung aus dem Jahr 2020) werden auf diese Weise hervorgehoben.
Nützliche Hinweise zur Vorbereitung auf Ihre Zertifizierungsprüfung sollen Ihnen helfen, an den richtigen Stellen auf Details zu achten oder vielleicht noch einmal nachzulesen, damit Sie am Ende problemlos bestehen.
Für die Zertifizierung sollten Sie sich immer klarmachen, wie die Antwort gemäß Scrum Guide lauten würde. In der Realität läuft es häufig anders; das möchte ich Ihnen zumindest hier und da zeigen.
Im Umfeld von Scrum und den Zertifizierungen der Scrum.org gibt es viele interessante Modelle und Werkzeuge, die Anwendung finden. Hier finden Sie Anregungen, um sich abseits der Zertifizierungen zu informieren.
Es gibt einige Themen, die sich in der neusten Version des Scrum Guides gegenüber den Vorgängerversionen deutlich geändert haben. Sie können zu Stolperfallen werden, auf die ich Sie hinweisen möchte.
Die Dinge lassen sich oft besser verstehen und merken, wenn man ein Beispiel zu ihnen hat. Auch wenn die Beispiele nicht direkt prüfungsrelevant sind, habe ich die theoretischen Ausführungen daher mit einigen Beispielen aus der Praxis untermalt.
Konventionen in diesem Buch
In diesem Buch gibt es ein paar Konventionen, die ich Ihnen vorab mitgeben möchte. Sie dienen alle entweder der guten Lesbarkeit und dem einfachen Verständnis oder der flüssigen Übertragbarkeit zur Sprache der Scrum.org, die Sie für die Prüfung benötigen.
Obwohl ich auch sonst auf das Gendern verzichte, wünsche ich mir, dass sich alle Menschen angesprochen fühlen, die etwas Hilfreiches in diesem Buch finden könnten. Der Verzicht hat einzig und allein etwas mit der Lesbarkeit zu tun. Überall da, wo es sich anbietet und auch schon eingebürgert hat, greife ich auf das Partizip I zurück (Beispiel: Mitarbeitende). Allerdings möchte ich diese grammatische Form nicht unnötig zweckentfremden, zumal sie holprig klingt und obendrein auch noch ungenau ist. Daher gehe ich eher sparsam mit ihr um.
Ich referenziere der Einfachheit halber auch auf die deutsche Version des Scrum Guides in der männlichen Fassung, damit sich insbesondere wörtliche Zitate leicht in den Text einfügen lassen. Der Scrum Guide ist in drei deutschsprachigen Versionen (männlich, weiblich, neutral) und in zahlreichen anderen Sprachen verfügbar.
Im Buch werden Sie auf zahlreiche englische Begriffe stoßen. Das liegt daran, dass der Scrum Guide selbst zwar in viele Sprachen übersetzt wurde, die Prüfungen zu den Zertifizierungen der Scrum.org jedoch ausschließlich auf Englisch angeboten werden und es häufig auf die genauen Begrifflichkeiten ankommt. Eine Liste der wichtigsten Begriffe finden Sie im Anhang des Buchs.
Es gibt einige Fachbegriffe, die von Anfang an verwendet, aber erst im späteren Verlauf erklärt werden. Sollte Sie das beim Verständnis behindern, empfehle ich Ihnen ebenfalls einen Blick auf die genannte Liste der englischen Begriffe oder ins Stichwortverzeichnis am Ende des Buchs.
Es gibt ein paar englische Begriffe, bei denen es etwas seltsam wäre, sie »einzudeutschen«. Gleichzeitig sind sie so relevant für die Prüfung, dass ich trotzdem auf sie aufmerksam machen möchte. Beispiele dafür sind unter anderem »self-managing« und »Developers«. Im Text finden Sie daher die Übersetzungen, in diesen Fällen »selbstgemanagt« und »Entwickler«. Das englische Wort, das Ihnen dann auch in der Prüfung begegnen wird, finden Sie jeweils in Klammern (self-managing).
Wie ich bereits erwähnt habe, sind meine wichtigsten Quellen die Website der Scrum.org und der Scrum Guide in seiner Version aus dem Jahr 2020. Dennoch gibt es darüber ein paar Literaturhinweise, die Sie in der Form »Autor Jahr« in Klammern im Text finden. Die Übersicht der Quellen finden Sie am Ende des Buchs in alphabetischer Reihenfolge.
Wie es weitergeht
An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass die Scrum.org ein sehr umfangreiches Potpourri an Trainings, Blogbeiträgen, Videoclips, offenen Tests und weiteren Lernmöglichkeiten anbietet, um Sie auf die Prüfungen für die Zertifizierungen zum Professional Scrum Master™ I (PSM I) oder zum Professional Scrum Product Owner™ (PSPO I) und darüber hinaus vorzubereiten. Diese vielfältige Sammlung kann dieses Buch nicht einmal ansatzweise ersetzen. Vielmehr dient dieses Buch dazu, Akzente zu setzen und Ihre Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Aspekte zu lenken, um die beiden Basis-Zertifizierungen zu bestehen.
Und jetzt ist vermutlich der Zeitpunkt gekommen, wo Sie mit der Lektüre beginnen, und ich wünsche Ihnen schon jetzt viel Erfolg für Ihre Zertifizierungsprüfung(en). Im Nachgang würde ich mich sehr über Ihr Feedback freuen. Was fanden Sie besonders hilfreich? Was hat Ihnen gefehlt? Kontaktieren Sie mich dafür gerne jederzeit – am einfachsten via LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/julianepilster/).
Teil I
Grundlegende Konzepte
IN DIESEM TEIL …
In diesem Teil erhalten Sie einen Einblick in die Welt der Product Owner und Scrum Master und ihre Herausforderungen. Sie lernen Scrum als empirisches Vorgehen und als eine Art des Umgangs mit Komplexität in der VUCA-Welt kennen. Das Agile Manifest aus vier Wertepaaren und zwölf Prinzipien sowie die fünf Scrum-Werte Commitment, Fokus, Offenheit, Respekt und Mut liegen Scrum zugrunde. Sie werden außerdem lesen, welche Bedeutung Transparenz, Inspektion und Adaption sowie das Konzept des Selbstmanagements haben.
Kapitel 1
Einführung in die Welt der Scrum Master und Product Owner
IN DIESEM KAPITEL
Herausforderungen der VUCA-Welt verstehenFrameworks und Methoden voneinander unterscheidenScrum Master und Product Owner einordnenWenn Sie in der IT arbeiten, ist Ihnen Scrum vermutlich schon vor längerer Zeit begegnet. Doch auch in Unternehmen, die Hardware entwickeln, oder in Human-Resources- oder Controlling-Abteilungen setzt sich Scrum immer mehr durch. Scrum ist ein empirisches Vorgehen, das es ermöglicht, auf der Basis von Experimenten zu lernen und auf diese Weise wertvolle Arbeitsergebnisse zu erzeugen.
Die Ursprünge von Scrum gehen auf einen Artikel der japanischen Autoren Hirotaka Takeuchi and Ikujiro Nonaka im Harvard Business Review aus dem Jahr 1986 zurück, in dem selbstorganisierte Teams bereits in den Mittelpunkt der Produktentwicklung gestellt wurden. Die Erfinder von Scrum, die beiden US-amerikanischen Softwareentwickler Jeff Sutherland (*1941) und Ken Schwaber (*1945), griffen diese Ideen in den 1990er-Jahren auf und übertrugen sie auf die Softwareentwicklung. In der Folge entstanden zahlreiche Bücher – und der Scrum Guide.
Entgegen einer häufigen Vermutung handelt es sich bei dem Wort Scrum nicht um ein Akronym. Der Begriff stammt aus dem Englischen, bedeutet so viel wie »Gedränge« und stellt eine Standardsituation im Rugby dar. Bereits Takeuchi und Nonaka referenzierten in ihrem Artikel auf dieses Spiel. »Scrum« dient ähnlich wie der Einwurf im Fußball dazu, das Spiel nach einer Unterbrechung neu zu starten, und ist dadurch gekennzeichnet, dass beide Teams sich jeweils im Verbund gegeneinander bewegen und dabei versuchen, den Ball für die eigene Mannschaft zu erobern.
Der Scrum Guide wurde inzwischen in über 50 Sprachen übersetzt und ist im Internet unter https://scrumguides.org/ abrufbar. Die letzte Version des Scrum Guides stammt aus dem Jahr 2020. Wenn Sie vorhaben, sich zertifizieren zu lassen, sollten Sie die neuste Version kennen, da sich Änderungen des Scrum Guides immer auch auf die Prüfungsfragen auswirken.
Als Leitfaden beschreibt der Scrum Guide die Spielregeln von Scrum, also die Mindestanforderungen, die beim Einsatz von Scrum zu erfüllen sind. Das heißt, Scrum ist kein Methodenbaukasten, aus dem man sich bedienen kann. Einzelne Elemente wegzulassen, ist keine Option. Zusätzliche Elemente zu ergänzen, ist hingegen möglich und gewünscht.
Lesen Sie in der Vorbereitung Ihrer Zertifizierungsprüfung auf jeden Fall die aktuelle Version des Scrum Guides aus dem Jahr 2020.
Bedeutung von Scrum in der VUCA-Welt
Die Welt ist nicht (mehr) planbar. Globalisierung und Digitalisierung sorgen für mehr Vernetzung und Abhängigkeiten. Damit wächst auch die Komplexität, wenn es darum geht, in der Geschäftswelt von heute erfolgreich zu sein. Häufig wird dieses Phänomen als »VUCA-Welt« bezeichnet. VUCA ist ein Akronym, das für Volatility (Volatilität), Uncertainty (Unsicherheit), Complexity (Komplexität) und Ambiguity (Mehrdeutigkeit) steht.
In der VUCA-Welt passen Kunden ihre Anforderungen ständig an, wechselnde Mitbewerber bringen neue Produkte an den Start, Technologien entwickeln sich weiter, Mitarbeitende verändern ihre Ansprüche an ihre Arbeitsplätze und haben andere Kenntnisse und Fähigkeiten. Diese komplexe Gemengelage aus verschiedenen Einflussgrößen führt dazu, dass Probleme nicht mehr so einfach zu durchschauen sind und dass die Lösungen nicht auf der Hand liegen. Aus diesem Grund haben prädiktive (= absehbar, berechenbar, vorhersagbar) Methoden an vielen Stellen ausgedient und Unternehmen suchen andere Vorgehensmodelle, um mit Komplexität erfolgreich umzugehen.
Überall dort, wo in Unternehmen die Rahmenbedingungen aber stabil und die Ergebnisse bei ausreichender Planung vorhersagbar sind, haben prädiktive Ansätze wie Wasserfall immer noch ihre Berechtigung. Für solche einfachen oder komplizierten Aufgabenstellungen würde Scrum völlig unnötigen Aufwand verursachen.
Fragen Sie sich selbst: Wie oft liefert Ihr bisheriges Vorgehen genau das, was Sie ursprünglich geplant hatten, zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie es geplant hatten? Wenn Ihre Antwort unter 50 Prozent liegt, dann deutet dies auf ein komplexes Szenario hin, bei dem Scrum seine Stärken ausspielen kann.
Peter kommt neu in den technischen Bereich des Unternehmens Abenteuer GmbH. Gleich am ersten Tag wird ihm die Leitung für ein Projekt übertragen, in dem es darum geht, ein tagesaktuelles Kennzahlen-Dashboard für das Management zu implementieren. Das Projekt hat zwar schon einige Hunderttausend Euro verschlungen. Bisher gibt es für das Management aber leider noch nichts zu sehen.
Peter analysiert das Projekt und findet heraus, dass es vor allem zwei Schwierigkeiten gibt: Das Projektteam hat bisher versucht, alles gleichzeitig zu erledigen. Die Umsetzung aller möglichen Kennzahlen ist zwar begonnen worden, bisher ist jedoch noch nichts fertiggestellt. Gleichzeitig bemerkt Peter, dass sich die Anforderungen, welche Kennzahlen überhaupt implementiert werden sollen, über die Zeit geändert haben. So sind viele Arbeiten sogar völlig umsonst gewesen, weil Kennzahlen, zu denen bereits Fortschritt erzielt worden ist, einfach ersetzt worden sind. Im Ergebnis gibt es also viele Dokumente und einigen Quellcode, allerdings kein Produkt, das einen Mehrwert für das Management liefert.
Peter entscheidet sich für ein inkrementelles und iteratives Vorgehen. Montags wird geplant, welche Kennzahl die Woche über umgesetzt werden soll, und in den folgenden Tagen wird fokussiert daran gearbeitet. Die Reihenfolge der Umsetzung stimmt er mit dem Management ab, das froh ist, dass es schon bald die erste Kennzahl im Dashboard sehen kann und dass stetig weitere dazukommen. Das Management nutzt die umgesetzten Kennzahlen sofort und kann so wertvolles Feedback dazu liefern, was wirklich benötigt wird.
Wo früher in Stellenanzeigen noch die Anforderung nach einer Zertifizierung im klassischen Projektmanagement (z. B. GPM, PMI oder PRINCE2) zu finden war, wünschen sich die Unternehmen heutzutage häufig Kenntnisse im agilen Arbeiten – bestenfalls bewiesen durch eine entsprechende Zertifizierung.
Agile Ansätze wie Scrum zeichnen sich dadurch aus, dass während der Entwicklung eines komplexen Produkts kontinuierlich Wert geschaffen wird. Sie leben außerdem von einem empirischen Vorgehen, das verschiedene Feedbackschleifen vorsieht, um anhand gemachter Erfahrungen und Beobachtungen die nächsten Entscheidungen zu treffen. Basierend auf einer schrittweisen Planung werden wertvolle Inkremente erzeugt, die dann wiederum inspiziert und adaptiert werden.
Doch die Lieferung eines Produkts, das »Was«, ist nicht die einzige Herausforderung, um in der VUCA-Welt zu bestehen. Auch das »Warum« und das »Wie« werden immer wieder überprüft und gegebenenfalls justiert. Scrum sieht dafür Mechanismen vor, die in den folgenden Kapiteln genauer betrachtet werden.
Wenn Sie sich tiefer mit dem Thema Komplexität auseinandersetzen möchten, lohnt sich ein Blick auf die Stacey-Matrix des Mathematik-Professors Ralph Douglas Stacey oder auf das Cynefin-Modell des Wissenschaftlers David John Snowden.
Framework vs. Methode
Es gibt viele Missverständnisse rund um das Rahmenwerk (Framework) Scrum. Eins sei direkt an dieser Stelle erwähnt: Häufig existiert die Erwartungshaltung, dass Scrum Komplexität eliminiere; das ist jedoch kaum möglich. Stattdessen hilft das Rahmenwerk dabei, mit Komplexität umzugehen und sie zu bewältigen.
Außerdem wird Scrum fälschlicherweise häufig als Methode bezeichnet. Dadurch ist in vielen Organisationen eine Erwartungshaltung entstanden, die meistens gleich beim ersten Einsatz enttäuscht wird: Scrum sage Schritt für Schritt, was zu tun sei. Das ist jedoch nicht der Fall. Scrum ist keine Methode und enthält keine Ablaufpläne. Es ist bewusst unvollständig und dadurch sehr leichtgewichtig. Umso wichtiger sind daher gute Scrum Master mit einem umfangreichen Verständnis des Rahmenwerks. Sie müssen in der Lage sein, die Lücken mit Leben (sprich: mit Methoden, Werkzeugen und Techniken) zu füllen.
Peter arbeitet nun schon eine Weile für die Abenteuer GmbH. In der IT-Abteilung des Unternehmens wird »Scrum« eingesetzt und vom Management als erfolgreich angesehen. Daher wird er als Projektleiter nun angehalten, sein nächstes Projekt ebenfalls mit Scrum abzuwickeln. Er hält dies für passend, weil seine Projekte ein hohes Maß an Komplexität aufweisen.
Er besucht ein zweitägiges Training, in dem ihm die Grundlagen zu Scrum mit seinen sogenannten Events nähergebracht werden, und er lernt etwas über das Product Backlog und andere Artefakte. Über Prinzipien und Werte verliert der Trainer nicht viele Worte. Leider hat Peter am Ende der zwei Tage nicht verstanden, dass Scrum keine Methode ist, sondern nur ein Rahmenwerk mit ein paar Eckpunkten und Regeln, die es mit Leben zu füllen gilt.
In der Folge benennt er sich selbst zum Product Owner und ein Teammitglied zum Scrum Master für sein neues Projekt. Sie führen fleißig Sprint Plannings, Sprint Reviews, Sprint Retrospectiven und sogar Daily Scrums durch. Das Vorgehen kommt Peter trotzdem irgendwie unvollständig vor, und er entscheidet sich in alter Manier des Projektmanagers dafür, ein Gantt-Chart für das kommende Jahr zu erstellen und ein paar Statusberichte einzuführen, um einen guten Überblick zu haben. Änderungen am Projektumfang lässt er lieber nicht zu. Wichtige Entscheidungen werden durch einen Lenkungsausschuss getroffen, der auch die Berichte erhält.
Er fragt sich, was nun anders ist als vorher, und kann es nicht so richtig beschreiben. Obwohl er zu Beginn seiner Karriere schon einmal gute Erfahrungen mit der inkrementellen und iterativen Arbeitsweise gemacht hat, entfalten sich die Vorzüge von Scrum im aktuellen Fall nicht. Das liegt vor allem daran, dass er gemeinsam mit dem Scrum Master nicht in der Lage ist, Scrum als Rahmenwerk auszugestalten. Ihnen fehlen die Erfahrung und ein passender Methodenbaukasten mit sinnvollen Ergänzungen.
Während Methoden vorschreiben, wie Sie von einem Problem zu einer Lösung kommen, gibt es in Scrum nur ein paar Leitplanken, die einerseits dazu dienen, das Produkt kontinuierlich zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Andererseits helfen die Leitplanken Teams dabei, die eigenen Arbeitsprozesse im Hinblick auf Effizienz (Efficiency), Reaktionsfähigkeit (Responsiveness) und Qualität (Quality) zu verbessern. Ein Team, das mit Scrum arbeitet, entwickelt auf dieser Basis seinen eigenen Arbeitsmodus.
»Scrum ist ein leichtgewichtiges Rahmenwerk, welches Menschen, Teams und Organisationen hilft, Wert durch adaptive Lösungen für komplexe Probleme zu generieren.« (Scrum Guide 2020)
Scrum Master ≠ Projektmanager ≠ Product Owner
Mit Scrum haben sich in den Unternehmen auch neue Rollen etabliert – allen voran Scrum Master und Product Owner. Doch nicht immer schaffen Unternehmen es, alte Rollen auch wirklich zu ersetzen, sodass es sie teilweise immer noch gibt. So kommt es nicht selten vor, dass trotz aller Bemühungen rund um die Einführung von Scrum auch noch Projektmanager (oder Projektleiter oder ähnliche Funktionen) anzutreffen sind. Aber: Es gibt keine Projektmanager in Scrum!
Im Scrum Guide werden drei Rollen (bzw. Verantwortlichkeiten – doch dazu später mehr) explizit erwähnt: Entwickler (Developer), Product Owner und Scrum Master. Sie bilden gemeinsam das Scrum Team.
Während die Entwickler selten mit Projektmanagern verwechselt werden, kommt dies beim Product Owner und beim Scrum Master schon häufiger vor. Dies liegt vor allem an der Art der Verantwortlichkeiten, die der Scrum Guide für diese beiden vorsieht. Da geht es um Ergebnisverantwortung im Zusammenhang mit Wert-Maximierung und Product-Backlog-Management für den Product Owner. Der Scrum Master hingegen trägt die Verantwortung für die Effektivität des Teams und die Verbesserung der Organisation.
»Der Product Owner ist ergebnisverantwortlich für die Maximierung des Wertes des Produkts, der sich aus der Arbeit des Scrum Teams ergibt. Wie dies geschieht, kann je nach Organisation, Scrum Team und Individuum sehr unterschiedlich sein. Der Product Owner ist auch für ein effektives Product-Backlog-Management ergebnisverantwortlich.« (Scrum Guide 2020)
»Der Scrum Master ist ergebnisverantwortlich für die Einführung von Scrum, wie es im Scrum Guide definiert ist. Er tut dies, indem er allen dabei hilft, die Scrum-Theorie und -Praxis zu verstehen, sowohl innerhalb des Scrum Teams als auch in der Organisation.
Der Scrum Master ist ergebnisverantwortlich für die Effektivität des Scrum Teams. Er tut dies, indem er das Scrum Team in die Lage versetzt, seine Praktiken innerhalb des Scrum-Rahmenwerks zu verbessern.
Scrum Master sind echte Führungspersönlichkeiten, die dem Scrum Team und der Gesamtorganisation dienen.« (Scrum Guide 2020)
Die beiden Definitionen zeigen schon, dass die Aufgaben des ehemaligen Projektmanagers in Scrum unter anderen Rolleninhabern aufgeteilt wurden: Aufgaben des Anforderungs- und Stakeholder-Managements liegen beim Product Owner, während der Scrum Master sich um die Prozess-, Team- und Verbesserungsaufgaben kümmert. Der dritte Bestandteil der ehemaligen Projektmanagerrolle, die operativen Organisations- und Umsetzungsaufgaben, gehen zu den weiteren Teammitgliedern des Scrum Teams, den »Entwicklern« (Developer genannt) (vgl. Kapitel 3Transparenz, Inspektion, Adaption).
Peter ist mittlerweile einige Jahre als Projektmanager bei der Abenteuer GmbH tätig und hat in dieser Zeit einige Projekte erfolgreich umgesetzt. Sein Alltag ist trotz abwechslungsreicher Projekte mehr oder weniger zur Routine geworden.