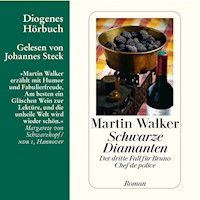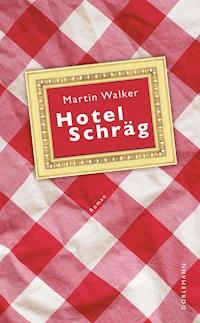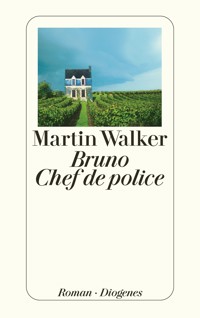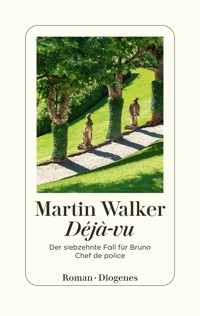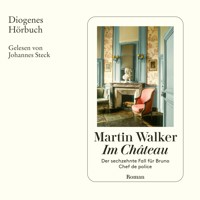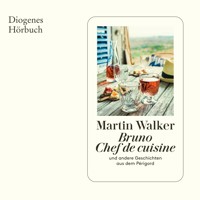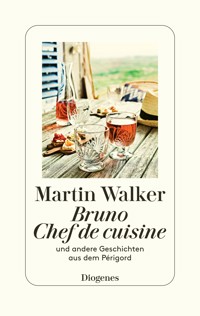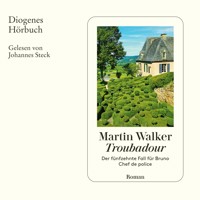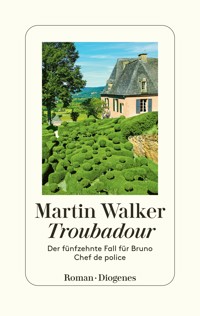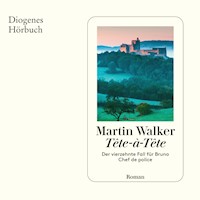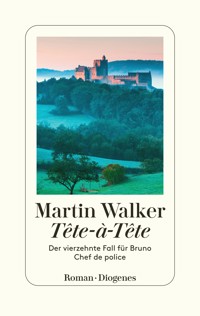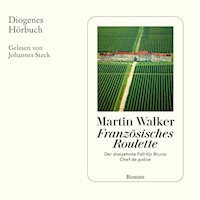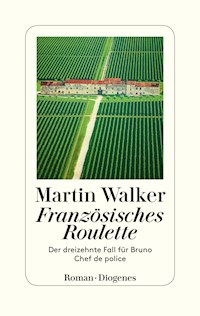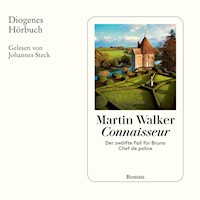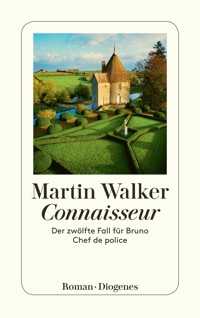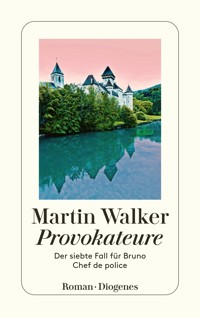
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Bruno, Chef de police
- Sprache: Deutsch
Saint-Denis im Périgord ist ein Sehnsuchtsort für viele. Auch für einige, die hier aufgewachsen sind. Doch als ein autistischer Junge aus Saint-Denis auf einer französischen Armeebasis in Afghanistan auftaucht und nach Hause möchte, ist unklar, ob als Freund oder Feind. Dies herauszufinden ist die dringende Aufgabe für Bruno, ›Chef de police‹, ehe sich verschiedene Provokateure einmischen und alle in tödliche Gefahr bringen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Martin Walker
Provokateure
Der siebte Fall für Bruno,Chef de police
Roman
Aus dem Englischen vonMichael Windgassen
Titel der 2014
bei Quercus, London,
erschienenen Originalausgabe:
›Children of War‹
Copyright ©2014 Walker & Watson, Ltd.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2015 im Diogenes Verlag
Coverfoto: Copyright ©plainpicture/BY
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright ©2016
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24359 8 (1. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60462 7
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
Meinen Jurykollegen in der traditionsreichen und ehrenwerten Confrérie du Pâté de Périgueux
[7]1
Benoît Courrèges, Chef de police des kleinen französischen Ortes Saint-Denis und dort allen bekannt als Bruno, hatte in seinem Leben schon allzu viel Gewalt und Tod gesehen. Nach zwölf Jahren bei der französischen Armee und elf als Polizist im Périgord kannte er die verheerenden Verletzungen, die Artilleriegeschütze und Maschinengewehre hervorriefen, ebenso wie die Folgen schwerer Verkehrsunfälle. Und auch seine eigene Schussverletzung, die er sich einst in den verschneiten Bergen oberhalb Sarajevos zugezogen hatte, brachte sich an feuchtkalten Wintertagen regelmäßig durch einen pochenden Schmerz in der Hüfte in Erinnerung. Nie würde er das Bleu-Blanc-Rouge am Ärmel des Sanitäters vergessen, der sich bis zum Eintreffen des Rettungshubschraubers um ihn gekümmert hatte. Und immer wenn er seither die leuchtende Trikolore seines Landes sah, musste er an sein rotes Blut im weißen Schnee zurückdenken und an den Blauhelm, den er damals als Mitglied der UN-Friedenstruppe getragen hatte.
Nie aber war Bruno etwas so Makabres zu Gesicht gekommen wie der tote Mann, der gefesselt und halbnackt vor ihm lag. Regentropfen perlten von Brust und Bauch und glänzten auf den frischen Wunden der verbrannten Brustwarzen. Die Scheinwerfer von Brunos Landrover und des [8]großen Einsatzwagens der Feuerwehr von Saint-Denis waren auf die Leiche gerichtet, während im Hintergrund trotz des Regens und trotz der dicken Schicht Löschschaum, mit der das Auto des Opfers überzogen war, noch immer hohe Flammen aus den Wagenreifen schlugen. Bruno atmete durch den Mund, um den Gestank von verkohltem Fleisch und brennendem Gummi nach Möglichkeit nicht riechen zu müssen. Er schaute auf die Uhr. Noch eine Stunde bis Tagesanbruch.
Es waren nicht nur die Gerüche, die ihm auf den Magen schlugen. Ihm war übel vor Wut darüber, dass ein solches Verbrechen in seinem Revier hatte stattfinden können, fast in Sichtweite der Stadt, die er mit seinem Diensteid zu schützen gelobt hatte. Obwohl der Tote ein Fremder war, empfand Bruno den Mord als eine Art Besudelung der Wälder, die er so gut kannte. Nie mehr würde er unbeschwert diesen Weg zu Pferd oder mit seinem Hund einschlagen können, ohne daran erinnert zu werden. Zumal diese Scheußlichkeit offenbar von Profis begangen worden war, von abgefeimten Spezialisten, die zu stellen er schon jetzt wild entschlossen war.
»Er ist definitiv tot, und zwar infolge Fremdeinwirkung«, konstatierte Fabiola, die als Ärztin hinzugerufen worden war, um den vom Gesetz geforderten Totenschein auszustellen. »Hast du die Wunde unter seinem Kinn gesehen?«
Bruno nickte. Allem Anschein nach war ein Messer mit langer Klinge unterhalb des Kinns durch den Rachen ins Gehirn gestoßen worden, was einen raschen Tod ohne starken Blutverlust zur Folge gehabt hatte. Solche Tricks lernte man in Spezialeinheiten des Militärs.
[9]»Der Todeszeitpunkt lässt sich nicht genau bestimmen«, fuhr sie fort. Fabiola war die beste Ärztin der Klinik von Saint-Denis und eine gute Freundin, mit der er sich inzwischen auch duzte. Die regennassen Haare klebten ihr im Gesicht und verdeckten die Narbe auf ihrer Wange. Ohne Make-up schien sie im Scheinwerferlicht sehr blass, und die Augen wirkten enorm groß. Wie schön Fabiola sein könnte, dachte er.
»Normalerweise würde ich rektal die Körpertemperatur messen, aber er ist so übel missbraucht worden, und das Feuer–« Sie schluckte.
»Der Boden unter ihm ist trocken«, bemerkte Bruno. »Weil es kurz nach zwei zu regnen angefangen hat, ist anzunehmen, dass er bereits lebend an diesen Baum gefesselt wurde.«
»Warst du wach, als das Unwetter losgebrochen ist?«, fragte sie.
Er nickte. Doch nicht die Blitze hatten ihn aufgeweckt, sondern Balzac, der beim ersten fernen Donnergrollen zu ihm unter die Decke gekrochen war. Eigentlich war Brunos Bett für ihn tabu, aber der junge Basset stand noch unter Welpenschutz und genoss Dispens, wenn schwere Gewitter heraufzogen und dem Tal der Vézère vorübergehend fast indische Monsunverhältnisse bescherten. Bruno war aufgestanden und ans Fenster gegangen, nachdem es so heftig zu regnen angefangen hatte, dass um die bevorstehende Weinernte zu fürchten war.
Nach einer kurzen Wetterbesserung frischte der Wind nun wieder auf und trieb die letzten Regenwolken der Atlantikfront über das Tal. Fabiola hatte ihre Untersuchung [10]abgeschlossen, worauf Bruno eine Plastikfolie über den Leichnam legte, die zwar die verkohlten Fußknochen und Unterschenkel bedeckte, wenn auch nicht die Hände, die immer noch an den Stamm der jungen Kastanie gefesselt waren. Wie ein Folteropfer des Mittelalters – mit verrenkten Armen und durchgebogenem Rücken – musste der arme Teufel hier liegen bleiben, bis die Kriminaltechniker aus Périgueux mit ihren Kameras und Checklisten anrückten.
»Glaubst du, er war schon tot, als sie ihm die Füße verbrannt haben?«, fragte Fabiola, die deutlich Mühe hatte, ihre Stimme unter Kontrolle zu halten.
Bruno zuckte mit den Achseln, doch als er genauer darüber nachdachte, lief ihm ein Schauder über den Rücken. »Das wirst du besser beurteilen können als ich. Ich weiß nicht, ob oder wie man so etwas feststellen kann.«
»Man kann. Warten wir den Bericht der Rechtsmedizin ab.«
Bruno vermutete, dass die Füße absichtlich verkohlt worden waren, und zwar noch bevor die Täter das Fahrzeug in Brand gesetzt hatten – eine Explosion hätte sie allenfalls versengt, nicht aber bis auf die Knochen zerfetzt. Allem Anschein nach waren die Füße mit Benzin übergossen worden.
Von ähnlichen Greueltaten hatte Bruno im Zusammenhang mit dem Algerienkrieg gehört. Die weißen Kolonialherren waren von den Rebellen dort pieds-noirs genannt worden, Schwarzfüße, wegen der dunklen Stiefel der französischen Soldaten, die das Land 1830 erobert hatten. »Wir geben euch schwarze Füße«, hatten die Rebellen bei [11]Algeriens Unabhängigkeit den Kriegsgefangenen versprochen und deren Füße mit Benzin übergossen. Bruno wusste das von Hercule, einem alten, inzwischen verstorbenen Freund, der als Soldat an dem schrecklichen Krieg beteiligt gewesen war, mit dem Frankreich vergeblich versucht hatte, das Land und dessen reiche Erdölvorkommen unter Kontrolle zu halten.
»Keine Ausweispapiere?«, fragte Fabiola. »Den dunklen Haaren und der Hautfarbe nach zu urteilen, würde ich auf eine nordafrikanische Herkunft schließen.«
»Papiere sind nicht zu finden, und vom Auto wurden die Kennzeichen entfernt.« Bruno hatte sich die Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Motorblock notiert, rechnete aber mit einer Auskunft der Zulassungsstelle erst im Laufe des Nachmittags. Fabiola starrte ihn an und erwartete offenbar weitere Ausführungen. »Wir wissen nur, dass Serge aufgestanden ist, um nach den Kühen zu sehen, als er die Explosion im Wald hörte. Das war kurz nach vier. Er hat sofort die pompiers alarmiert. Du kannst jetzt ruhig nach Hause fahren und wieder ins Bett gehen. Ich muss bleiben, bis die Spurensicherung kommt.«
Bruno gähnte und reckte sich. In dieser Nacht war er gleich mehrmals aus dem Schlaf gerissen worden, das erste Mal kurz vor Mitternacht vom Klingelton seines Spezialhandys. Danach war er wieder eingenickt, gefasst auf einen weiteren Anruf. Dann hatte ihn zwischenzeitlich sein Hund geweckt und nach knapp zweistündigem Schlaf dann Albert, um ihm das Feuer im Wald zu melden. Immerhin hatte der Wind bis dahin nachgelassen, und es war nicht mehr zu befürchten, dass die Flammen um sich griffen. [12]Nach dem trockenen Sommer galt in fast allen südlichen Départements erhöhte Waldbrandgefahr.
»Ins Bett zurückzugehen hat jetzt keinen Zweck mehr. Ich könnte ohnehin nicht schlafen, nicht nach dem hier.« Fabiola deutete mit dem Kinn auf die zugedeckte Leiche. »Ich werde duschen und einen Kaffee aufsetzen. Komm doch vorbei, und trink eine Tasse mit, sobald du hier fertig bist.«
»Danke, aber es wird wohl noch eine Weile dauern. Wahrscheinlich musst du dich heute ohne mich um die Pferde kümmern.«
»Armer Bruno. Schrecklich, was hier passiert ist. Wenn du ein Schlafmittel brauchst, dann…«
Er lächelte dankbar, schüttelte aber den Kopf. Es waren nicht so sehr Erinnerungen an Krieg und Tod, die ihn manchmal um den Schlaf brachten, sondern Gedanken an Frauen und sein verworrenes Liebesleben. Fabiola drückte ihm einen Kuss auf die Wange und rannte dann zum Einsatzwagen der pompiers hinüber, um in der trockenen Fahrerkabine den Totenschein auszufüllen.
Das ausgebrannte Auto stand auf einem Schotterweg, in der Zufahrt zur alten Müllkippe rund hundert Meter abseits der Landstraße. Sie war nach dem Bau der modernen déchetterie, wo nun alle Abfälle getrennt entsorgt wurden, geschlossen worden. Der Tote lag nur wenige Meter von seinem Fahrzeug entfernt. Dieses war neben einem Holzstoß zum Stehen gekommen. Bruno hob eins der Scheite an, um sein Gewicht zu schätzen. Rund fünfzig Kilo, weit hätte er es nicht schleppen können.
Vier angekohlte Scheite lagen vor und hinter dem aus[13]gebrannten Auto auf dem Schotterweg. Vermutlich war der Fahrer von der Straße weg in die Falle gelockt worden und konnte nicht mehr zurücksetzen, weil ihm jemand die schweren Scheite hinter die Räder gewuchtet hatte. Aber warum war er dann nicht einfach weitergefahren? Bruno ging den ansteigenden Weg hinauf bis zu einer scharfen Rechtskurve, wo der Lichtstrahl seiner Taschenlampe auf geknickte Zweige und plattgefahrenes Gras fiel. Reifenspuren deuteten darauf hin, dass hier ein zweites Auto geparkt und die Durchfahrt versperrt hatte. Wahrscheinlich hatte es dort gewartet und das kommende Fahrzeug mit aufgeblendeten Scheinwerfern zum Anhalten gezwungen, worauf ein Komplize die Holzscheite auf den Weg geschleppt hatte, um ein Zurücksetzen zu verhindern. Es waren demnach mindestens zwei Täter, die Bruno suchen musste. Von der Spurensicherung durfte er sich weitere Aufschlüsse erhoffen, ermittelte aber bis zu deren Eintreffen schon mal auf eigene Faust, holte sein metallenes Maßband aus seinem Landrover und legte es zwischen den Reifenspuren des zweiten Fahrzeugs an. Hundertdreißig Zentimeter! Zurück in seinem Büro, würde er nach entsprechenden Fahrzeugtypen suchen.
Er löste seine Anorakkapuze, um sich den Ohrstöpsel seines Handys ins Ohr zu klemmen, und drückte die Schnellwahltaste für die Nummer des Brigadiers, jenes schattenhaften Offiziers aus dem Innenministerium, der ihm anlässlich eines früheren Falls dieses Spezialhandy hatte zukommen lassen. Angeblich war es abhörsicher, und es hatte einen speziellen Klingelton, wenn der Brigadier oder einer seiner Mitarbeiter anrief. Von diesem Klingelton [14]war Bruno in der vergangenen Nacht das erste Mal geweckt worden.
Der Anrufer hatte sich nur mit dem Namen Rafiq gemeldet und gesagt, dass er in der Gegend sei und möglicherweise Hilfe brauche. Er wollte später noch einmal anrufen, war aber nicht mehr dazu gekommen.
»Mit wem spreche ich?«, fragte ihn nun jemand durch den Kopfhörer. Bruno gab sich zu erkennen, erwähnte Rafiqs Anruf und berichtete von dem Mord und den Spuren, die auf Hinterhalt und Folter schließen ließen. »Das Opfer könnte dieser Rafiq sein.« Bruno beugte sich über seinen Notizblock, um ihn vor dem Regen zu schützen, und las die Identifikationsnummer des Fahrzeugs vor. »Vielleicht lässt sich klären, auf wen der Wagen zugelassen ist. Ein Handy haben wir nicht finden können.«
»Wir überprüfen das und rufen zurück.«
Als Bruno erklärte, wo er sich gerade befand, wurde er unterbrochen.
»Wir wissen, wo Sie sind. Ihr Handy funkt uns Ihre GPS-Koordinaten auf den Schirm. Wurden noch andere Polizeidienststellen alarmiert?«
»Commissaire Jalipeau, der Chefermittler des Départements«, antwortete Bruno. Er hatte auch überlegt, die Gendarmerie zu informieren, sich aber anders entschieden. Rafiqs Anruf über das Spezialhandy hatte ihn vorsichtig gemacht. Als Angestellter von Saint-Denis pflegte Bruno zwar ein durchaus gutes Verhältnis zu den städtischen gendarmes, doch wie die meisten Kollegen der Police Nationale betrachtete Jean-Jacques Jalipeau sie vor allem als Verkehrspolizisten.
[15]»Sonst niemand? Gut, belassen Sie es dabei.« Der diensthabende Beamte brach die Verbindung ab, und Bruno ging durch das aufgeweichte Laub zum Feuerwehrwagen zurück. Fabiolas Wagen war verschwunden. Die pompiers aber schienen keine Eile zu haben. Sie hatten es sich in der Fahrerkabine gemütlich gemacht und tranken Kaffee aus einer Thermosflasche. Bruno ließ sich einen Becher einschenken. Er hatte gerade einen ersten Schluck genommen, als das Handy wieder klingelte.
»Ich bin’s«, meldete sich Jean-Jacques. »Wir sind gerade in Saint-Denis eingetroffen. Würden Sie uns bitte lotsen? Ich kann dieses verdammte Navi nicht bedienen und möchte die Gendarmen nicht bitten müssen.«
Bruno riet ihm, nach den Scheinwerfern des Feuerwehrwagens Ausschau zu halten, und erklärte dann den pompiers, sie könnten jetzt abrücken, die Police Nationale würde gleich kommen. Im Stillen fragte er sich, ob die französische Polizei wohl effizienter wäre, wenn alle Dienste zusammengefasst wären, statt sich gegenseitig zu behindern, doch da hörte er schon wieder diesen besonderen Handyklingelton, und diesmal war der Brigadier selbst dran.
»Der Wagen mit der Nummer, die Sie durchgegeben haben, ist der von Rafiq. Ist der Tote noch am Tatort?«
Bruno bejahte.
»Dann werfen Sie einmal einen Blick auf den linken Oberarm; da müsste eine Tätowierung sein.«
Bruno beugte sich über die Leiche, hob die Plastikplane an und streifte die Lederjacke samt Oberhemd von der linken Schulter. Und tatsächlich sah er auf dem Oberarm ein Tattoo, das Erinnerungen in ihm wachrief.
[16]»Ja, da ist eine. Ziemlich alt, wie es aussieht. Zwei Ziffern: eins und drei.«
»Rafiq, kein Zweifel«, erwiderte der Brigadier. »War ein guter Mann. Ich komme zu Ihnen, um bei der Autopsie dabei sein zu können.«
»Jean-Jacques wird gleich hier sein«, sagte Bruno. »Soll ich ihn über die Identität des Toten aufklären?«
Rafiq hatte offenbar zum 13. Regiment der Fallschirmjäger gehört, einer Eliteeinheit, die dem französischen Oberkommando für Sondereinsätze, COS, unterstellt war. Bruno hatte an der Seite von Mitgliedern des 13. Regiments in Bosnien gedient. Sie waren Spezialisten für Aufklärung auf feindlichem Boden, ähnlich der britischen SAS. Rafiq würde nicht leicht zu überwinden gewesen sein, auch nicht von zwei oder drei Männern.
»Ich rufe Jean-Jacques gleich an und setze ihn ins Bild«, versprach der Brigadier. »Wahrscheinlich werde ich am frühen Nachmittag selbst zur Stelle sein. Vorher wird Ihrem Bürgermeister ein Fax von mir vorliegen, in dem ich ihn bitte, Sie für mein Team freizustellen. Und halten Sie inzwischen Ausschau nach Arabern. Rafiq war undercover auf Dschihadisten angesetzt.«
»Rufen Sie Jean-Jacques lieber sofort an«, sagte Bruno. »Da kommt ein Wagen, und ich glaube, es ist seiner.« Er steckte das Handy weg und stellte sich vor die Scheinwerfer des Feuerwehrwagens, damit Jean-Jacques ihn sehen konnte.
»Wir fahren dann, oder?«, rief Albert aus dem Fenster der Kabine. »Auf der Wache warten Kaffee und frische Croissants. Wenn du Lust hast, komm vorbei.«
[17]
[18]2
Als Bruno den Tatort endlich verließ, war die Sonne auf gegangen. Eine kräftige warme Brise vertrieb die letzten Regenwolken. Vor Pamelas Haus bogen sich die Bäume, und als er aus seinem Landrover stieg, hörte Bruno die Stalltür schlagen. Er ging hin, um sie zu verriegeln, und fand die Boxen leer vor. Pamelas Wagen konnte er nirgends sehen. Wahrscheinlich war sie einkaufen gefahren. Nach dem schweren Reitunfall, bei dem sie sich das Schlüsselbein gebrochen hatte, durfte sie sich zwar wieder ans Steuer setzen, doch auf Fabiolas Rat hin verzichtete sie darauf, schon wieder in den Sattel zu steigen. Allem Anschein nach war Fabiola also allein mit den Pferden unterwegs. Auf dem Küchentisch standen Kaffee, Orangensaft und ein Joghurt von Stéphane samt einem Topf Honig für ihn bereit. Er trank den Saft und den Kaffee, duschte kurz und rasierte sich dann mit der Klinge, die er in Pamelas Badezimmer aufbewahrte für den Fall, dass sie ihn einlud, über Nacht zu bleiben, was zu seinem Leidwesen immer seltener vorkam.
Schließlich aß er auch noch den Joghurt, um Pamela nicht zu brüskieren, und bedankte sich bei ihr mit einer kurzen Notiz. Dann machte er sich auf den Weg zur Domaine, weil er Julien fragen wollte, ob die Reben unter dem Unwetter gelitten hatten. Er selbst hatte einen Großteil [19]seiner Ersparnisse in das städtische Weingut investiert. Als er jetzt in seinem Landrover in die Straße einbog, die zu dem kleinen Château führte, strahlte ihm die Sonne durch die Windschutzscheibe direkt ins Gesicht. Er klappte die Sonnenblende herunter und sah zwischen den Rebstöcken, die dem Fluss am nächsten standen, etliche Männer und Frauen bei der Weinlese. Er hielt an und genoss die vertraute ruhige Szene, die die Gedanken an Rafiqs Leiche für eine Weile verdrängte und ihm wieder einmal vor Augen führte, wie sehr er dieses Land liebte. Sofort fühlte er sich erfrischt, fast schon wiederhergestellt, und er fuhr weiter. Julien traf er im chai an, dem Weinlager, wo er die Trauben begutachtete, bevor sie in die Kelter kamen.
»Du bist bereits der dritte besorgte Investor heute Morgen«, grüßte Julien heiter. »Zuerst war der Bürgermeister da, dann der Direktor der Bank. Die Trauben sind prima. Wir schneiden immer die, die weiter oben am Stock wachsen, ab, damit die unteren vom Laub geschützt werden.«
Bruno nickte beruhigt, war aber immer noch ein wenig irritiert. Er hatte sich in die Literatur zum Thema Weinanbau eingelesen. In einem Buch war davon die Rede, dass der größte Feind der Winzer der Mehltau sei; der Autor eines anderen schwärmte von Botrytis, der Grauschimmel- oder Edelfäule, der die Sauternes- und Monbazillac-Weine der Region ihre intensive Süße verdankten.
»Keine Probleme mit Mehltau?«, fragte er und hoffte, so zu klingen, als wüsste er, wovon er sprach.
»Jetzt nicht mehr, denn die Ernte ist fast geschafft. Außerdem trocknet der Wind die Trauben. Nicht der Regen macht mir Sorgen, sondern möglicher Hagelschlag. Mir [20]sind schon Weinberge zu Gesicht gekommen, die völlig verwüstet waren.«
Bruno nickte. Um die Tagundnachtgleiche herum, im März und September, konnten Stürme mit Hagelkörnern so groß wie Golfbälle aufziehen. Sie zerschlugen Dachziegel und Gewächshäuser und hatten in Minutenschnelle die Straßen mit einer knöcheltiefen weißen Schicht überzogen. Dankend lehnte er Juliens Angebot ab, ein Glas Wein zu trinken, akzeptierte aber frischgepressten Traubensaft, der warm und klebrig war. Nachdem er sich die Hände abgespült hatte, fuhr er weiter in Richtung Mairie.
Nach den Sommerferien war der Schulbetrieb wiederaufgenommen worden, und die Touristenmengen hatten sich aufgelöst. Nur noch wenige britische Familien und ältere Ehepaare aus den Niederlanden und Deutschland erfreuten sich an der Septembersonne. Sie frühstückten auf Fauquets Terrasse und betrachteten den Fluss, der unter der alten Steinbrücke hindurchströmte. Joghurt mit Honig war lecker, aber keineswegs das, was Bruno unter einem richtigen Frühstück verstand, und so kehrte auch er bei Fauquet ein und ließ sich ein Croissant schmecken.
»Albert war gerade hier und hat von dem Mord erzählt«, sagte Fauquet über den Tresen gelehnt und mit der verschwörerischen Miene, die er immer aufsetzte, wenn er sich von Bruno aufregende Informationen versprach. »Muss ja ein scheußlicher Anblick gewesen sein. Total verbrannte Beine. Weißt du, wer es war?«
»Die Police Nationale aus Périgueux wird irgendwann im Laufe des Tages eine Stellungnahme abgeben«, antwortete Bruno. »Sie ermittelt in diesem Fall. Ich bin nur [21]gerufen worden, um den Tatort abzusichern, bis die Kollegen zur Stelle waren.«
»Philippe war da, als Albert kam. Er ist gleich losgefahren, um Fotos von der Polizeiarbeit zu machen, wie er sagte«, fuhr Fauquet fort und reichte Bruno einen Espresso. »Er wollte wissen, ob du am Tatort bist.«
Bruno biss in sein Croissant, nippte am Kaffee und ließ sich beides, das wie füreinander geschaffen schien, auf der Zunge zergehen. Die Aussicht darauf, wieder einmal von Philippe Delaron belagert zu werden, konnte seinen Genuss nicht schmälern. Der junge Mann, der ein Fotogeschäft in der Stadt unterhielt, hatte einen lukrativen Nebenerwerb als Fotoreporter für die regionale Tageszeitung Sud Ouest. Dank seiner vielen Geschwister und Cousins war er bestens vernetzt und über das, was in der Stadt passierte, ebenso gut informiert wie Bruno. Allerdings neigte er dazu, selbst eher Belangloses zur Sensation aufzubauschen. Bruno half Philippe, wo er konnte, gab ihm aber auch immer wieder klar zu verstehen, dass seine Hilfsbereitschaft Grenzen hatte. Beide hatten nur wenig Skrupel, den jeweils anderen für sich einzuspannen, und so unterhielten sie eine freundliche, wenngleich öfter etwas angespannte Beziehung zueinander.
»Übrigens, Pater Sentout will wissen, ob der Tote eventuell hier bei uns beigesetzt werden soll«, fügte Fauquet hinzu. Bruno zuckte mit den Achseln, sagte aber nichts, denn wenn er erwähnt hätte, dass das Mordopfer möglicherweise ein Muslim war, wüsste dies spätestens am Mittag die ganze Stadt, und Radio Périgord würde mit einem Übertragungswagen anrollen.
[22]Bruno legte eine Zwei-Euro-Münze auf den Tresen und nahm das Exemplar der Sud Ouest zur Hand, das den Gästen des Cafés zur Verfügung stand. An seinem Croissant knabbernd, überflog er die Schlagzeilen und gab damit zu verstehen, dass er nicht weiter gestört werden wollte. Fauquet sah offenbar ein, dass er von Bruno nicht mehr würde erfahren können, und wandte sich anderen Gästen zu. Wie Kaffee und Croissants gehörten auch Klatsch und Tratsch zum Ausschank.
Auf der Titelseite waren jüngste Meldungen über deprimierende Entwicklungen auf dem französischen Arbeitsmarkt und Gewaltakte im Nahen Osten zu lesen. Im krassen Kontrast dazu fanden sich weiter hinten in der Zeitung bebilderte Berichte über die aktuelle Weinernte, die Vorstellung neuer Schullehrer und Glückwünsche zu goldenen Hochzeiten. Auf den Sportseiten wurde ausführlich über den städtischen Rugby-, den Tennis- und den Jagdverein informiert. Deshalb kaufte man die Sud Ouest, dachte Bruno, nämlich der lokalen Nachrichten wegen und weil es auf den Fotos meist Leute zu sehen gab, die man kannte. Er faltete die Zeitung zusammen, verabschiedete sich und ging dann über die Straße, die Treppe zur Mairie hinauf und in sein Büro.
Auf seinem Schreibtisch erwartete ihn wie üblich ein Stapel Post, den er durchging, während er seinen Computer hochfuhr. Ein Ping aus dem Lautsprecher des Computers meldete ihm den Eingang einer neuen E-Mail. Zigi-Para. Das letzte Mal, als er diesen Namen gelesen hatte, war vor über zehn Jahren gewesen. Zigi stand für Tzigane, wie in der Armee die Angehörigen der Roma und Sinti [23]genannt wurden. Sein eigentlicher Name war Jacques Sadna. Er stammte aus der Camargue, den weiten Niederungen im Mündungsgebiet der Rhone, wo seit Jahrhunderten Sinti und Roma siedelten und ihre berühmten Pferde züchteten. Wie Bruno war Zigi Hauptgefreiter gewesen, als sie sich im Einsatz an der Elfenbeinküste kennengelernt hatten. Später waren beide während verdeckter Operationen im Grenzgebiet zwischen Tschad und Libyen in den Rang von Sergeanten befördert worden. Zigi war bei den Fallschirmjägern, Bruno bei den Pionieren gewesen. Er erinnerte sich, gehört zu haben, dass Zigi beim Militär weiter Karriere gemacht hatte.
»Hi Bruno, Kopf hoch wünscht Dir, Pékin, ein alter Kamerad«, las er vom Bildschirm ab. »Ich bin inzwischen Stabsfeldwebel, zurzeit stationiert in Nijrab. Gestern kreuzte bei uns ein muj auf, der behauptet, aus Saint-Denis zu stammen. Nennt sich Sami Belloumi und sagt, er kennt Dich. Sein Vater sei Momu. Macht einen etwas beschränkten Eindruck. Sein Rücken ist voller Peitschenspuren. Der toubib meint, er sei schwer traumatisiert. Will nach Hause zurück, hat aber keine Papiere. Foto im Anhang. Kennst Du ihn? Gib mir Bescheid, bevor ich den Amtsweg einschlagen muss. Gruß, Zigi.«
Bruno grinste über Zigis Soldatenjargon. Pékin bedeutete Zivilist. Nijrab war der französische Stützpunkt in der afghanischen Region Kapisa, einst Basis für Kampfeinsätze, aber nunmehr nur noch Ausbildungszentrum für afghanische Soldaten. Als muj wurden Mudschaheddin bezeichnet, und toubib war der Spitzname für einen Arzt. Doch nun verfinsterte sich Brunos Miene, als er weiterlas. Er [24]kannte Sami Belloumi – den jungen Mann, der Saint-Denis vor drei, vielleicht vier Jahren verlassen hatte, um eine Sonderschule für autistische Jugendliche zu besuchen, die einer Moschee in Toulouse angegliedert war. Sami war der Neffe und Adoptivsohn von Momu, dem Mathematiklehrer am hiesigen collège, und der Cousin dessen Sohnes Karim, der das Café des Sports führte und ein Star des städtischen Rugbyteams war.
Bruno öffnete das Foto und sah bestätigt, dass es sich um ebendiesen Sami handelte, der laut Zigi in Nijrab aufgekreuzt war. Er hatte ihn als hoch aufgeschossenen Jungen in Erinnerung, fast ebenso groß wie Karim, sah aber nun einen fast bis auf die Knochen abgemagerten Burschen mit hervorstehenden Wangenknochen, die die Augen umso eingesunkener erscheinen ließen. Er trug einen langen Bart, und der Kopf war kahlrasiert. Bruno dachte zurück an Samis Versuche, Tennis zu spielen. Er hatte es geschafft, ein Ass nach dem anderen zu servieren, immer präzise und unerreichbar ins äußere Eck, aber keinerlei Interesse daran gezeigt, selbst einmal einen Ball zu retournieren, sei es mit der Vor- oder Rückhand. Oft stand er stundenlang allein auf dem Platz neben einem Korb voller Tennisbälle und übte seine Aufschläge. Ähnlich verhielt er sich beim Basketball. Egal wo er stand, er versenkte beinahe jeden Ball, weigerte sich aber, Mitspieler zu bedienen oder mit dem Ball zu dribbeln. Und wie seine Aufschläge trainierte er stundenlang Korbwürfe.
Momu meinte, Samis Gehirn funktioniere eben etwas anders. Der Junge schien sich besonders gut auf die Reparatur elektrischer oder mechanischer Geräte zu verstehen, [25]egal, ob Toaster oder Computer. Er löste die schwierigsten mathematischen Rätsel, doch zu lesen oder zu schreiben versuchte er erst gar nicht. Obwohl er immer höflich und freundlich war, redete er mit anderen kaum ein Wort. Dr.Gelletreau, der ehemalige Oberarzt des medizinischen Zentrums, hatte Autismus diagnostiziert und gesagt, daran sei nichts zu machen. Momu hatte ihn in einer öffentlichen Sonderschule unterbringen wollen, aber keinen Platz für ihn finden können. Dass es viel zu wenige solcher Einrichtungen gab, war einer der Skandale des französischen Schulwesens. Schade, dachte Bruno, dass Fabiola nicht schon früher nach Saint-Denis gekommen war. Vielleicht hätte sie Sami helfen können. Nicht dass die anderen Ärzte der Stadt schlecht gewesen wären, Fabiola war einfach nur besonders gut, nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil sie zu ihren Patienten einen intuitiven Zugang fand und großes Vertrauen genoss. Immerhin würde sie jetzt vielleicht etwas für den Jungen tun können – sofern man ihn denn wieder nach Hause zurückkehren ließ.
Bruno rief die Meldestelle an, um in Erfahrung zu bringen, ob Sami einen Reisepass beantragt hatte. Er fragte sich, was er wohl in Afghanistan getrieben haben mochte. Zigi bezeichnete ihn als muj, und in dem graubraunen Kittelhemd, das er auf dem angehängten Foto trug, sah er tatsächlich aus wie ein Taliban. Aber wahrscheinlich kleideten sich die meisten Afghanen so, zumindest diejenigen, die auf dem Land lebten.
Eine Antwort auf die Frage, was einen französischen Staatsbürger, zumal einen Muslim arabischer Herkunft, nach Afghanistan verschlagen könnte, lag auf der Hand. [26]Hatte sich Sami radikalisieren lassen? Bruno bezweifelte, dass der Junge, den er kannte, überhaupt Sinn für Politik oder Glaubensfragen hatte, zumal er in einer eher weltlich orientierten Familie aufgewachsen war. Momu hatte für Religion nicht viel übrig, und Bruno konnte sich nicht erinnern, dass er überhaupt jemals eine Moschee besucht hatte außer jenes eine Mal, als er nach Toulouse gefahren war, um Sami in die Sonderschule zu bringen. Dennoch ließ sich nicht ausschließen, dass Sami ein frommer Muslim geworden war und sich als solcher hatte drängen lassen, nach Afghanistan zu gehen. Oder war er womöglich freiwillig in den Dschihad gezogen? Die Peitschenstriemen auf Samis Rücken sprachen allerdings eher nicht dafür. Was zählte, war, dass Sami ein Sohn der Stadt war und zu seiner Familie zurückkehren wollte.
Der Sachbearbeiter der Meldestelle rief endlich zurück und erklärte, dass für Sami Belloumi nie ein Reisepass ausgestellt worden sei.
»Hi Zigi«, tippte Bruno als Antwort auf die Mail seines alten Kameraden. »Wenn sie Dich zum Stabsfeldwebel gemacht haben, ist die Armee schlimmer dran, als ich dachte. Schön, von Dir zu hören, und danke für die Nachricht. Der junge Mann auf dem Foto ist tatsächlich unser Sami, französischer Staatsbürger und Mitglied einer sehr geachteten Familie unserer Stadt, die ihn in einer muslimischen Sonderschule für autistische Jugendliche in Toulouse wähnt. Können wir ihn nach Hause zurückholen? Gruß, Bruno.«
[27]Der Bürgermeister wirkte um Jahre gealtert und sah sehr müde aus, als er von einer Sitzung des Conseil Général zurückkehrte. Das höchste politische Gremium des Départements tat sich in Zeiten der Austerität offenbar besonders schwer, zu einer Einigung in Haushaltsfragen zu gelangen. Für gewöhnlich sprang Gérard Mangin die Treppen im Bürgermeisteramt mit fast jugendlichem Elan hinauf, doch heute trat er mit hängenden Schultern aus dem Fahrstuhl. Bruno schenkte sich gerade eine Tasse Kaffee aus der Gemeinschaftskanne ein, als der Bürgermeister ihn mit einem Wink in sein Büro bat. Dort nahm er auf dem unbequemen Holzstuhl mit der geraden Rückenlehne Platz, der für gewöhnlich Besuchern vorbehalten war, die der Bürgermeister möglichst schnell wieder abwimmeln wollte.
»Sie müssen noch schlimmer dran sein, als Sie aussehen, wenn Sie sich mit dieser Brühe zufriedengeben«, meinte Mangin und deutete mit einer Kopfbewegung auf den Becher in Brunos Hand. Er drückte zweimal auf seine Gegensprechanlage, womit er seiner Sekretärin Claire signalisierte, dass er einen Kaffee aus seinem Privatvorrat wünschte.
»Nach der Sitzung heute Morgen habe ich eine gute Tasse bitter nötig«, fuhr er fort. »Man versucht, meine Rücklagen für die Sanierung unseres Abwassersystems zu plündern, um Straßen von Kommunen zu reparieren, die für deren Wartung nichts getan haben. Aber das lasse ich nicht zu, sosehr sie mich auch unter Druck setzen.«
»Ich dachte, man würde Sie inzwischen gut genug kennen«, entgegnete Bruno mit verhaltenem Lächeln. »Als jemanden, der den Stadtsäckel hütet, als wäre er sein eigener.«
»Besser als meinen eigenen, Bruno. Ich weiß von [28]Amtskollegen, die ins Gefängnis mussten, weil sie mit den Geldern, die ihnen anvertraut waren, allzu fahrlässig umgegangen sind.«
»Womit setzt man Sie unter Druck?«
»Sie wollen, dass ich die collège-Appartements abstoße, in den nächsten drei Jahren keine weitere Arbeitskraft mehr im Bürgermeisteramt einstelle und einen Teil unseres Stadtparks zur Bebauung durch Investoren freigebe.«
Bruno schnaubte. Im vergangenen Winter hatte er viel freie Zeit darauf verwendet, eines der Appartements, von denen die Rede war, zu renovieren. Sie wurden für eine bezuschusste Miete angeboten, um Lehrer anzulocken, die einen solchen Anreiz brauchten, um in der ländlichen Provinz zu arbeiten. Florence, die neue Technik- und Naturkundelehrerin, wohnte dort mit ihren kleinen Zwillingen. Und der Stadtpark ist sakrosankt, dachte Bruno, oder sollte es zumindest sein.
»Und was wurde entschieden?«
»Nichts – wie üblich. Ich habe gesagt, dass wir die Aufgabe der Appartements nicht einmal in Erwägung ziehen können, bevor nicht der rechtliche Status der bestehenden Mietverhältnisse geklärt ist. Und für ein solches Gutachten müsste der Rat aufkommen. Gegen einen Einstellungsstopp habe ich nichts, vorausgesetzt, die anderen Kommunen ziehen mit. Ich habe dazu vorgeschlagen, dass wir eine Zählung aller öffentlichen Angestellten in sämtlichen Mairies organisieren und durchführen. Davon war man nicht gerade angetan.«
»Und der Park?«
»Der geht die anderen überhaupt nichts an. Ich habe [29]darauf hingewiesen, dass er den Bürgern von Saint-Denis gehört und dass sich ohne deren Einverständnis am Status quo nichts ändern wird. Und dann habe ich es mir nicht verkneifen können, die Ratsherren nach Saint-Denis einzuladen und sie dazu aufzufordern, an Ort und Stelle für einen Verkauf zu werben; nur würde ich dann nicht für ihre Sicherheit garantieren können. Wie auch immer, sie bekommen unser Geld nicht, und damit ist die Sache erledigt.«
Bruno nickte. Er war froh, dass der Bürgermeister offenbar wieder zu seinem alten Selbst zurückgefunden hatte, streitlustig, engagiert und entschlossen, sich von seinen Amtskollegen nicht unterkriegen zu lassen.
»Jetzt erzählen Sie mir mal von diesem mysteriösen Mord, von dem ich unterwegs im Autoradio gehört habe.«
Während Bruno berichtete, was er über Rafiqs Tod wusste, schaute der Bürgermeister in seinen Posteingangskorb und fischte das Fax des Innenministeriums heraus, mit dem dieses Brunos Freistellung für seinen Einsatz im Dienst des Brigadiers beantragte. Er hatte gerade seinen Füllfederhalter aus der Schreibtischschublade geholt und das Fax gegengezeichnet, als die Tür aufging und Claire zwei Espressi hereinbrachte, gebraut mit der Maschine, die der Stadtrat dem Bürgermeister zu dessen zwanzigstem Amtsjubiläum geschenkt hatte.
Sobald Claire den Raum wieder verlassen hatte, räusperte sich Bruno. »Da ist noch etwas, von dem ich Ihnen berichten wollte. Es geht um Afghanistan – ausgerechnet.«
Zu seinem Erstaunen nahm Bürgermeister Mangin die Nachricht vom Wiederauftauchen von Momus Neffen am [30]Hindukusch ausgesprochen gleichmütig auf und stand sogar mitten in Brunos Ausführungen auf, um aus einem der Regale einen braunen Halbhefter zu holen, der mit einem weißen Klebestreifen markiert war. Zurück an seinem Schreibtisch, entnahm er ihm mehrere Dokumente, die er Bruno zuschob. Es handelte sich um Kopien eines von Momu für seinen Neffen gestellten Antrags auf Einbürgerung, der Einbürgerungsurkunde und Samis carte d’identité.
»An den Vorgang erinnere ich mich gut, denn ich habe mich persönlich darum gekümmert. Wusste hier bei uns jemand, dass der junge Mann nicht mehr in dieser Sonderschule in Toulouse war?«
»Nein«, antwortete Bruno. »In der Meldestelle wusste man noch nicht einmal, dass er je einen Reisepass beantragt hat. Weiß der Himmel, wie Sami nach Afghanistan gelangt ist. Sobald die Schule Mittagspause hat, werde ich Momu aufsuchen und hören, was er dazu zu sagen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er von Samis Auslandsaufenthalt wusste.«
»Mag sein, aber wenn Sami beschlossen hat, ein Dschihadkämpfer zu werden, würde es mich nicht wundern, wenn Momu kein Wort darüber verliert«, entgegnete der Bürgermeister. »Eins ist jedenfalls sicher: Je früher er erfährt, dass Sami lebt, desto besser.«
Bruno berichtete, dass Samis Auftauchen am französischen Militärstützpunkt noch nicht in offizielle Kanäle gelangt sei. Er habe nur einen Tipp von einem alten Freund beim Militär erhalten, der zu einer informellen Regelung der Angelegenheit bereit sei. Es gebe reguläre Flüge der französischen Armee von und nach Afghanistan, und wenn [31]alles gutgehe, könne Sami ohne größeres Aufsehen nach Hause zurückkehren. Nach seiner, Brunos, Erfahrung sei das Militär durchaus dafür bekannt, dass seine Offiziere mit heiklen Problemen mitunter auf recht unkonventionelle Weise umgingen, diskret und unbürokratisch.
»Ich schätze, diese Kopie des Personalausweises wird Ihrem alten Armeefreund ausreichen«, sagte der Bürgermeister. »Wenn nicht, könnte ich in Paris intervenieren. Ich erinnere mich an eine Regelung zur Rückführung in Not geratener französischer Staatsbürger aus Gefahrengebieten. Falls die Flugkosten übernommen werden müssen, lässt sich bestimmt irgendwo Geld auftreiben. Sami ist einer von uns, also sollten wir uns dafür einsetzen, dass er zurückkehrt. Aber jetzt zu der anderen Sache. Wie kommt es, dass sich ein Geheimagent mit arabischem Namen hier in Saint-Denis umbringen lässt?«
»Er wurde nicht nur umgebracht, sondern auch brutal gefoltert«, erwiderte Bruno. »Man hat also wahrscheinlich Informationen aus ihm herausgepresst oder herauszupressen versucht und ihn dann getötet, und zwar sehr professionell mit einem Messerstich durch den Unterkiefer bis ins Gehirn. Mehr als das, was der Brigadier dazu zu sagen hatte, weiß ich auch nicht. Der Name Rafiq klingt arabisch, und Fabiola findet, dass der Tote dem Aussehen nach nordafrikanischer Herkunft sein könnte. Ein seltsamer Zufall, dass er ausgerechnet zeitgleich mit Samis Wiederauftauchen getötet wurde.«
»Allerdings«, bestätigte der Bürgermeister mit nachdenklicher Miene. »Und äußerst verdächtig, zumal unser ominöser Brigadier involviert ist. Wenn der sich einschaltet, steht [32]meist Ärger ins Haus, und zwar Ärger im Dreierpack aus Politik, Intrige und Diplomatie.«
[33]3
Wieder in seinem Büro, scannte Bruno die Dokumente ein, die der Bürgermeister ihm gegeben hatte, und schickte sie per E-Mail an Zigi mit dem Vermerk, dass sie ausreichen müssten, um Samis Identität zu bestätigen. Sowohl der Personalausweis als auch die Einbürgerungsurkunde trugen einen Fingerabdruck. Anschließend rief er das Sekretariat des collège an und erfuhr, dass Momu noch unterrichtete, aber vor der Mittagspause eine Freistunde hatte und wahrscheinlich im Lehrerzimmer anzutreffen sein würde.
Bruno setzte seine Schirmmütze auf und ging zu Fuß den kurzen Weg über die Brücke zur Schule, die von Teenagern aus Saint-Denis und der näheren Umgebung besucht wurde. Das Gebäude war in den 1960er Jahren errichtet worden, ein phantasieloses Hufeisen aus Beton und Glas mit Schulhof und kleinem Sportplatz in der Mitte. Die Schüler nannten es »den Schuhkarton«. Im Sommer war es in den Klassenzimmern drückend heiß, im Winter nicht warm genug, und die unzuverlässige Heizung stand weit oben auf der Dringlichkeitsliste des Bürgermeisters für anstehende Sanierungsmaßnahmen, um deren Finanzierung noch gestritten werden musste.
Bruno zwängte sich an einem ihm unbekannten weißen [34]Lieferwagen vorbei, der den Eingang blockierte. Irgendein Handwerker, dachte er, obwohl der Wagen keine Aufschrift trug. Dennoch steckte er den Kopf durch die Tür zum Sekretariat, um hallo zu sagen und zu fragen, wem der Lieferwagen gehörte. Da niemand Bescheid wusste, kehrte er zum Eingang zurück und notierte sich das Kennzeichen. Der Wagen war, wie die Endziffern 31 verrieten, in Toulouse zugelassen.
Nun doch misstrauisch geworden, warf er einen Blick durch eines der Seitenfenster und sah auf dem Beifahrersitz einen Ausdruck liegen: die Vergrößerung eines Passfotos, wie es schien. Zu seiner Überraschung erkannte er darauf Sami Belloumi wieder, den jungen Mann, der sich angeblich in Afghanistan aufhielt.
Bruno versuchte die Wagentüren zu öffnen, doch sie waren verriegelt und die hinteren Fenster mit Papier zugeklebt. Er musterte die Reifenprofile, schätzte die Spurbreite und verglich sie auf gut Glück mit den Aufzeichnungen zu den mutmaßlichen Täterfahrzeugen am Tatort in seinem Notizbuch. Als er sah, dass die Maße übereinstimmten, öffnete er kurzerhand die Motorhaube, montierte die Verteilerkappe ab und löste die Kabel von der Batterie. Dann rief er bei der Gendarmerie an. Sergeant Jules war am Apparat. Bruno bat ihn dringend um Unterstützung, gab das Kennzeichen des Fahrzeugs aus Toulouse durch und betrat eilig das Schulgebäude.
Im ersten Stock, wo sich außer dem Lehrerzimmer auch die Räume für den Technik- und Naturkundeunterricht und Momus Klassenzimmer befanden, hatte die letzte Vormittagsstunde noch nicht begonnen, doch statt des [35]üblichen Pausenlärms drangen nur vereinzelte gedämpfte Lehrerstimmen aus den Zimmern auf den Flur heraus.
Dieser war leer bis auf zwei Männer in Jeans und Lederjacken, die hastig von Tür zu Tür gingen und durch die Guckfenster in die dahinterliegenden Räume spähten. Als er Brunos quietschende Gummisohlen auf dem Linoleumbelag hörte, drehte sich der Kleinere der beiden um und stieß seinen Partner an.
»Bonjour, messieurs«, grüßte Bruno höflich, dessen Polizeiuniform die Männer merklich irritierte. »Kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie jemanden?«
Sie sahen aus wie Nordafrikaner. Der eine war groß und kräftig wie ein Rugbyspieler, glattrasiert, mit krausem, schwarzem Haar und ließ die Arme seitlich herabhängen, als machte er sich auf etwas gefasst. Der andere, kleinere Mann trug einen kurzen, gepflegten Bart und hatte einen Gegenstand am Schenkel befestigt, der wie ein Schlagstock aussah. An einem Gurt, der über die Schulter geschlungen war, hing eine Box in der Größe eines dicken Wörterbuchs. Die beiden Männer wirkten wie ein eingespieltes Team. Ohne eine Miene zu verziehen, ging der Große direkt auf Bruno zu, während sein bärtiger Partner lächelnd einen Schritt zur Seite trat und etwas von einem Freund sagte, nach dem sie suchten.
Doch Bruno ließ sich nicht ablenken, sondern wandte sich vom Bärtigen ab und stellte sich dessen weitereilendem Kollegen in den Weg. Überrascht blieb der große Mann kurz stehen, ging dann aber kurz entschlossen zum Angriff über. Bruno parierte, indem er dem Angreifer seitlich vors Knie trat. Als dieser daraufhin zu Boden ging, dachte [36]Bruno schon, er habe nun Zeit, sich dem kleineren Mann zu widmen, doch er irrte sich.
In seiner linken Seite spürte er plötzlich einen so stechenden heftigen Schmerz, dass er in Schockstarre geriet. Sein Hals war wie zugeschnürt, und unmittelbar darauf fand er sich mit zuckenden Gliedern am Boden wieder. Sein Herz raste. Er konnte sich nicht erklären, was geschehen war, und sah Sterne vor seinem Gesichtsfeld flirren, als ihn erneut der schreckliche Schmerz traf, diesmal in der Magengrube. Arme und Beine schlugen wie ferngesteuert aus, während er mit dem Hinterkopf auf den Boden hämmerte.
Zwar ließ der Schmerz nach, aber es blieb eine Empfindung, als feuerten seine Nerven irrwitzige Impulse durch den ganzen Körper. Bruno, der die Kontrolle über seine Muskeln verloren hatte, spürte, wie sich seine Blase entleerte, feucht und warm. Als er wieder halbwegs bei Sinnen war, fragte er sich, ob er vielleicht einen epileptischen Anfall gehabt hatte. Doch da wurde er von einem plötzlichen Krampf im Magen gebeutelt, wälzte sich auf die Seite und übergab sich. Er roch etwas Verbranntes, blickte an sich herab und sah Rauchschlieren von einem Brandfleck an seiner Uniformjacke aufsteigen. War auf ihn geschossen worden? Blut war nirgends zu sehen. Wie durch Watte hörte er Schritte auf sich zukommen und sah die beiden Männer an ihm vorbei- und durch den Korridor davonhasten; der größere hatte offenbar Schwierigkeiten, denn er musste sich von seinem Partner stützen lassen.
Türen gingen auf. Schüler spähten neugierig auf den Flur hinaus. Doch als Bruno ihnen zuzurufen versuchte, sie [37]sollten um Himmels willen in ihren Klassenzimmern bleiben, kam nur ein Krächzen heraus, das von einer in der Ferne anschwellenden Sirene sofort übertönt wurde. Als Nächstes merkte er, dass sich jemand neben ihm niederkniete, ihm den Puls fühlte und mit heller Stimme nach Wasser und einem Putzlappen verlangte. Es war Florence, die ihm alsbald mit einem feuchten Tuch über das Gesicht fuhr, während ein anderer Lehrer das Erbrochene vom Boden aufwischte. Bruno mühte sich auf, doch seine Nerven schienen noch immer zu zucken, und da realisierte er, dass ihm offenbar zwei Stöße aus einem elektrischen Viehtreiber versetzt worden waren – mit voll aufgedrehter Spannung.
Er versuchte, an sein Handy zu kommen, um die Gendarmen zu alarmieren, bekam aber keine koordinierte Bewegung zustande. Florence gab ihm aus einem Glas Wasser zu trinken, und als er aufstehen wollte, hielt sie ihn zurück. Da sah er die vielen Schüler, die ihn umringten und anstarrten. »Der ist ja sturzbetrunken«, sagte einer von ihnen abfällig.
Da erst gelang es ihm, ein paar Worte hervorzustoßen: »Zurück in die Klassen. Gefahr! Zwei Männer, Araber, einer mit Bart. Weißer Lieferwagen. Draußen.« Und dann noch: »Versteckt Momu! Sie sind hinter ihm her.«
Die Sirene heulte jetzt unmittelbar vor der Schule. Rufe wurden laut, Motoren drehten auf, und die Sirene entfernte sich wieder. Brunos Handy klingelte. Florence zog es ihm aus der Tasche.
»Hier Florence an Brunos Handy. Er ist verletzt und kann nicht reden. Mit wem spreche ich, bitte?«
Eine Pause. Dann wandte sie sich Bruno zu und erklärte: [38]»Es ist Sergeant Jules. Sie jagen zwei Männer, die auf offener Straße einen Wagen angehalten, den Fahrer rausgezerrt haben und abgehauen sind.«
Ins Handy sagte sie: »Bruno ist hier im collège von zwei Männern überfallen worden. Wir haben die urgences alarmiert. Er muss ärztlich versorgt werden. Sonst ist niemand verletzt.«
Langsam erholte sich Bruno etwas. Er ahnte jetzt, dass er von Profis überwältigt worden war, nahm Florence das Handy aus der Hand und sagte: »Jules? Ich bin’s, Bruno. Es geht schon wieder. Sie haben mich mit einem Viehtreiber niedergestreckt. Ich weiß nicht, ob sie noch andere Waffen mit sich führen. Es kann gut sein, dass sie etwas mit dem Mord von letzter Nacht zu tun haben. Wir müssen sie unbedingt vernehmen. Kann ich etwas tun? Ich schlage vor, ich bleibe hier und passe auf ihren Lieferwagen auf. Ich habe ihn fahruntüchtig gemacht.«
Jules berichtete noch, dass er hinter den beiden her auf der Straße nach Belvès sei und Verstärkung angefordert habe. Dann beendete er das Gespräch.
»Was zum Teufel ist denn hier los?« Rollo, der Direktor, dessen Büro im Erdgeschoss lag und der eben erst von den Ereignissen in Kenntnis gesetzt worden war, erschien schwer atmend oben an der Treppe.
Bruno, der inzwischen halbwegs sitzen konnte und gerade Jean-Jacques Nummer in sein Handy tippte, zählte auf Rollos schnelle Auffassungsgabe. »Schick die Kinder zurück in die Klassen. Und dann müssen wir Momu in Sicherheit bringen.«
Jean-Jacques, den er unterwegs in seinem Wagen [39]erreichte, meldete, dass er gleich da sein werde: »Ich war schon fast bei der Mairie, als ich plötzlich die Sirene hörte und die Gendarmen vorbeirasen sah. Über Funk kam die Meldung, dass nach einem silbergrauen Renault Laguna gefahndet wird.«
Bruno erklärte kurz, was geschehen war. Jean-Jacques versprach, in wenigen Minuten im collège zu sein, worauf Bruno sein Handy einsteckte und vorsichtig aufstand. Die Schüler ließen sich widerwillig von ihren Lehrern in ihre Klassenzimmer zurückscheuchen, während Rollo, Momu und Florence, die aufgrund seines kurzen Lageberichts an den commissaire aus Périgueux den Hergang und den Ernst der Ereignisse erahnten, verstört und besorgt bei Bruno blieben.
Bruno jedoch verlor keine Zeit. »Ich muss hier auf Jean-Jacques warten und mit ihm den weißen Lieferwagen durchsuchen. Rollo, bring bitte Momu und seine Frau in die Mairie. Da sind sie fürs Erste in Sicherheit. Florence, vielen Dank, mir geht es schon wieder besser. Und du, Momu – also ich wollte eigentlich eine bessere Gelegenheit abpassen, um dir zu sagen, dass Sami in Afghanistan aufgetaucht ist und nach Hause kommen möchte. Die beiden Männer, die mich angegriffen haben, scheinen ihn zu suchen, und ich fürchte, sie sind auch hinter dir her. Solange sie auf freiem Fuß sind, bist du in Gefahr. Das Gleiche gilt für alle, die in deinem Haus wohnen.«
In der Ferne erklang eine Sirene, die rasch lauter wurde. Alle wandten den Kopf zum Fenster bis auf Momu, der stammelte: »Was sagst du da, Bruno? Sami lebt? Er kommt zurück? Hast du mit ihm gesprochen?«
[40]»Das wird Jean-Jacques sein. Ich muss zu ihm und mit ihm reden. Momu, ja, Sami lebt und will nach Hause zurück. Mehr weiß ich auch nicht. Rollo, Momu, tut jetzt bitte, was ich gesagt habe. Wir haben keine Zeit für ausführliche Erklärungen.«
Damit ließ Bruno die beiden stehen und humpelte durch den Korridor zu den Toiletten, um sich notdürftig zu säubern. Seine Beine fühlten sich an wie nach einem besonders erschöpfenden Rugbyspiel. Seitlich und auf dem Bauch entdeckte er Brandwunden, wo er von dem Viehtreiber getroffen worden war. Er spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht und beschloss, lieber nicht in den Spiegel zu blicken. Als Bruno das Gebäude verließ und den Schulhof überquerte, sah er Jean-Jacques vor dem weißen Lieferwagen stehen. Das Blaulicht auf seinem Fahrzeug blinkte noch.
»Die Flüchtigen sind uns durch die Lappen gegangen. Kam über Funk«, sagte Jean-Jacques. »Jules hat sie aus den Augen verloren, und bevor Straßensperren organisiert werden konnten, waren sie über alle Berge.«
»Tja«, erwiderte Bruno. »Das hier ist ihr Lieferwagen. Ich schätze, es ist derselbe, der am Tatort im Wald gestanden hat.«
In diesem Moment bog ein ihm vertrauter Renault Twingo auf den Parkplatz der Schule ein, gefolgt von dem roten Transporter der pompiers, der für Krankentransporte genutzt wurde. Fabiola stieg aus dem Twingo und eilte, ohne die Tür hinter sich zu schließen, auf Bruno zu. Sie ergriff sein Handgelenk, um den Puls zu fühlen, und schaute ihm prüfend in die Augen.
»Warst du bewusstlos?«, fragte sie.
[41]»Nein. Ich bin von zwei Stromstößen aus einem Viehtreiber außer Gefecht gesetzt worden. Und habe mir in die Hose gemacht. Dann musste ich mich übergeben. Aber jetzt geht’s schon wieder. Es tut einfach nur noch weh.«
»Kein Wunder. Wo hat es dich erwischt?«
Er zeigte ihr die Stellen, worauf sie sein Handgelenk losließ, seine Jacke aufknöpfte, das Hemd aus der Hose zog und die Wunden inspizierte.
»Ein ähnliches Brandmal habe ich am Anus des Toten von letzter Nacht gesehen«, sagte sie. »Du hast Glück gehabt. Die Verletzungen stammen nicht von einem gewöhnlichen Viehtreiber.«
Sie legte ihre Hände an seinen Hals und tastete die Lymphknoten ab. »Und jetzt folge meinem Finger mit den Augen.« Sie bewegte den Zeigefinger von links nach rechts durch sein Gesichtsfeld, von oben nach unten und auf die Nase zu.
»Du lebst noch«, stellte sie befriedigt fest. »Aber sobald du mit Jean-Jacques fertig bist, kommst du sofort zu mir in die Klinik.« Damit drehte sie sich auf dem Absatz um, ging auf den Transporter zu, um den Feuerwehrleuten mitzuteilen, dass sie nicht gebraucht würden, und stieg zurück in ihren Wagen.
»Eine sehr resolute junge Frau«, meinte Jean-Jacques. »Sind Sie wirklich in der Lage, sich mit mir zu unterhalten? Sie sehen schlimm aus.«
»Sie haben doch gehört, ich lebe noch«, erwiderte Bruno. »Geben Sie mir ein paar Latexhandschuhe. Wir sollten einen Blick in den Wagen werfen.«
Sowohl Fahrer- als auch Beifahrertür waren jetzt [42]unverriegelt, und der Schlüssel steckte nach dem gescheiterten Startversuch noch im Zündschloss. Die Vergrößerung des Fotos von Sami war verschwunden. Ein Ladegerät für Mobiltelefone hing in der Buchse für den Zigarettenanzünder. In einer Halterung zwischen den Sitzen steckten zwei Kaffeebecher aus Pappe, und auf dem Boden lag zusammengeknülltes Butterbrotpapier.
»Sehr schön«, sagte Jean-Jacques. »Jede Menge Fingerabdrücke und DNA-Spuren an den Bechern. Die Kollegen vom Geheimdienst werden glauben, es sei Weihnachten.«
Bruno holte den Verteilerkopf aus dem Papierkorb neben dem Eingang zur Schule, in dem er ihn versteckt hatte, und reichte ihn Jean-Jacques. Dann öffnete er die Hecktüren und sah eine Matratze mit zwei Schlafsäcken auf der Ladefläche, daneben ein Ladegerät. Wahrscheinlich für den Viehtreiber, dachte er. Hinter den beiden Sitzen lag eine lange Holzkiste, über die eine Wolldecke geworfen war. Bruno zog die Decke herunter und öffnete die Kiste.
Sie war leer bis auf eine Auskleidung aus Schaumgummi, die in den Umrissen eines Repetiergewehrs sowie eines Zielfernrohrs ausgeschnitten war. Auf der Innenseite des Deckels waren die Zeichen FR-F2 eingestanzt. Bruno erkannte darin die Modellvariante jener Waffe, die zu seiner Militärzeit von französischen Scharfschützen eingesetzt worden war. Zwischen der Schaumgummiauskleidung und der Seitenwand steckten zwei in Tücher eingewickelte Magazine für je zehn Patronen. Sie waren beide mit der Nato-Standardmunition Kaliber 7,63 gefüllt.
Unter dem Fahrersitz entdeckte er ein kleines Notizbuch mit Einträgen in arabischer Schrift. Zwischen den [43]Seiten steckte ein passbildgroßes Foto von Sami, offenbar das Original der Vergrößerung, die auf dem Beifahrersitz gelegen hatte. Er fand noch weitere Papierabzüge, auf denen ein Mann zu sehen war, der offenbar nicht ahnte, dass er fotografiert wurde. Sie zeigten ihn beim Besteigen und Verlassen eines Wagens, an einem Cafétisch und inmitten muslimischer Männer beim Gebet. Bruno war sich nicht sicher, glaubte aber, Rafiq zu erkennen, der noch vor wenigen Stunden an einen Baum gefesselt tot im Wald gelegen hatte. Er durchblätterte die unbeschriebenen Seiten, kehrte wieder an den Anfang zurück und entzifferte auf einer Seite in lateinischen Buchstaben den Namen Saint-Denis. Als er Rollo mit Momu das Schulgebäude verlassen sah, reichte er Jean-Jacques das Notizbuch und winkte die beiden zu sich.
»Kannst du das lesen?«, fragte er Momu und hielt ihm das Notizbuch unter die Nase. »Augenblick.« Er half ihm, ein Paar Latexhandschuhe überzustreifen, ehe er ihm das Notizbuch reichte.
»Nanu, hier steht ja mein Name und der meiner Frau, unsere Adresse und die Adresse der Schule«, wunderte sich Momu.
»Es war kein Scherz vorhin, als ich sagte, du seist in Gefahr«, erwiderte Bruno. »Hol deine Frau, und geh mit ihr in die Mairie. Sobald die Gendarmen zurück sind, sollen sie euch an einen sicheren Ort bringen.«
Momu nickte. »Okay. Aber was ist mit Karim, Rashida und den Kindern?«
»Stehen ihre Namen auch da drin?«
Momu blätterte die Seiten durch und schüttelte den Kopf.
[44]»Dann musst du dir wohl keine Sorgen um sie machen. Ich werde Karim anrufen und ihm sagen, was passiert ist. Du und ich, wir müssen uns noch über Sami unterhalten, aber geh jetzt erst einmal mit Rollo. Ich komme später nach.«
Jean-Jacques, der immer noch neben dem Lieferwagen stand, telefonierte. Den Blick auf Bruno gerichtet, formte er mit den Lippen: »Der Brigadier.« Er lauschte noch eine Weile in sein Handy und reichte es dann an Bruno weiter. »Er will mit Ihnen sprechen.«
»Ich höre, Sie hatten einen ziemlichen Schock«, meldete sich die vertraute Stimme.
»Zwei Schocks, um genau zu sein.«
»Der Hubschrauber hat mich eben in Bergerac abgesetzt, und jetzt sitze ich im Auto auf dem Weg nach Saint-Denis. Am besten treffen wir uns in der Gendarmerie, sobald Sie sich in der Klinik haben untersuchen lassen. Jean-Jacques sagt, Ihre Ärztin bestehe auf einem Check, und ich will, dass Sie voll einsatzfähig sind. Das ist ein Befehl.«
Bruno wollte Jean-Jacques gerade bitten, ihn zu seinem Landrover zu fahren, als er das vertraute Ruckeln und Stottern eines alten 2 CV hörte, der viel zu schnell um die Kurve geschossen kam. Pamela. Sie bremste hart und sprang buchstäblich aus dem Wagen und auf Bruno zu. Offenbar hatte sie in aller Eile ihr Haus verlassen, denn sie steckte noch in ihren Gartenkleidern, und ihr rotbraunes Haar flog in alle Richtungen.
»Was hast du denn jetzt wieder angestellt?«, fragte sie keuchend vor Wut, aber mit besorgtem Blick. »Fabiola [45]sagt, du seist überfallen worden! Mehr habe ich nicht aus ihr herausbekommen!«
»Oh, Pamela!« Bruno strahlte trotz der verbalen Ohrfeige, die er sich soeben eingefangen hatte. »Fabiola hat mich untersucht, und sicher hat sie dir auch gesagt, dass mit mir alles in Ordnung ist, oder?« Er erklärte kurz, was geschehen war, wobei er den Vorfall herunterspielte. Doch Florence, die in Hörweite war, mischte sich ein.
»Nichts da. Er hat sich am Boden gewälzt vor Schmerzen. Und übergeben musste er sich auch. Es dauerte Minuten, bis er wieder auf den Beinen stehen konnte. Ich habe mir schreckliche Sorgen gemacht.«
»Aber jetzt ist alles wieder gut«, meinte Bruno begütigend, doch Pamela reagierte wie eine Furie.
»Ich halte das nicht mehr aus! Ständig gerätst du in Schwierigkeiten, als würdest du den Ärger magnetisch anziehen. Wie soll man das ertragen?« Ihre Augen funkelten, und sie fuchtelte mit ihren Händen, mit denen sie kurz zuvor noch in der Erde gegraben hatte, wütend vor seinem Gesicht herum.
Florence, die ihren Schnitzer von eben wiedergutmachen wollte, hakte sich bei ihrer Freundin unter. »Ach, Pamela, seien wir doch einfach froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Bruno lässt sich jetzt in die Klinik chauffieren und dort gründlich untersuchen.« Bruno verstand den Wink und stieg zu Jean-Jacques ins Auto, der nur fragte: »Wohin? Zur Klinik?«
»Nein. Zur Mairie. Da steht mein Wagen, und ich will erst einmal nach Hause, mich umziehen.« Er schaute Jean-Jacques an. »Rastet Ihre Frau auch jedes Mal so aus?«
[46]»O ja, und nicht nur meine«, antwortete Jean-Jacques. »Das ist wohl einer der Gründe, warum nur wenige flics lange verheiratet bleiben. Meine Frau hat mich auch deswegen verlassen, ist dann aber zurückgekommen. Komischerweise macht sie sich, seitdem auf mich geschossen worden ist, weniger Sorgen. Angeblich, weil sie das Schlimmste schon hinter sich hat.«
»Klingt auch nicht unbedingt nach einer empfehlenswerten Therapie«, meinte Bruno trocken.
»Die Ehepartner von Polizisten können nachgerade zwischen allen möglichen Angeboten wählen, von Gesprächstherapien über den Zugang zu Selbsthilfegruppen bis… Wollen Sie, dass ich mich für Pamela erkundige?«
»Das hat wohl keinen Zweck. Sie ist Britin und schwört auf die Therapie einer guten Tasse heißen Tee. Außerdem ist sie nicht meine Frau, nicht einmal meine Partnerin.«
»Das sagen
[47]4
Nachdem er geduscht, frische Sachen angezogen und die Hühner gefüttert hatte, sprach Bruno gehorsam in der Klinik vor, wo er sich wieder ausziehen und von Fabiola untersuchen lassen musste. Sie musterte eingehend die von dem Viehtreiber verursachten Brandwunden, horchte mit dem Stethoskop Herz und Lungen ab und prüfte seine Reflexe. Schließlich nahm sie ihm auch noch Blut ab.
»Du hast einen Schock erlitten«, sagte sie. »Dein Herz schlägt immer noch viel zu schnell. Du gehst jetzt nach Hause, legst dich ins Bett und deckst dich warm zu. Kein Essen, kein Alkohol, keine Aktivitäten. Dafür jede Menge Wasser. Ich komme später mit einer Bouillon vorbei und will dich morgen wieder hier in der Klinik sehen.«
Bruno hatte großes Vertrauen in Fabiolas medizinisches Können und versprach, ihrem Rat zu folgen, im großen Ganzen zumindest. Vorher müsse er allerdings unbedingt noch in der Gendarmerie vorbeischauen.
»Musstest du Pamela eigentlich unbedingt erzählen, was passiert ist?«, fragte er. »Sie hat mir vor dem collège die Hölle heißgemacht und so getan, als wäre alles meine Schuld.«
»Du bist ihr Liebhaber, also hat sie ein Recht dazu«, entgegnete Fabiola mit strengem Blick. »Ihr lebt doch so gut [48]wie zusammen, auch wenn du das nicht zugeben willst. Wenn Pamela wütend ist, dann nur, weil sie sich Sorgen um dich macht. Mensch, Bruno, selbst mir stehen die Haare zu Berge, wenn ich sehe, in welche Probleme du dich immer wieder reinreitest. Gehirnerschütterungen, Verbrennungen, Prellungen. Einmal wärst du beinahe in einem Weinfass ertrunken und ein andermal in dieser prähistorischen Höhle fast an Unterkühlung gestorben. Macht dir die Schussverletzung aus Sarajevo immer noch zu schaffen?«
»Ich spür’s in der Hüfte, wenn das Wetter umschlägt. So weiß ich immer im Voraus, wann mit Regen zu rechnen ist.«
»Mir wäre es lieber, du würdest alle Termine absagen. Aber wenn du an diesem Gespräch unbedingt teilnehmen musst, solltest du anschließend sofort nach Hause fahren. Und wenn du plötzlich schlappmachst, sag ja nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Wir sehen uns später, wenn ich die Pferde ausgeführt habe und dir die Bouillon bringe.«
Bruno fuhr noch kurz bei der Mairie vorbei, um nach Post und E-Mails zu sehen, und stellte fest, dass Zigi schon geantwortet hatte. »Papiere reichen voll und ganz. Aber wenn wir ihn über Bagram ausreisen lassen, werden Amerikaner und Afghanen Fragen stellen. Deshalb schlage ich vor, wir setzen ihn in Duschanbe in eine französische Militärmaschine. Ich melde mich, wenn es so weit ist.«
Bagram Air Base war, wie Bruno wusste, das Hauptquartier der US-Streitkräfte in Afghanistan, während die Franzosen, die von den amerikanischen Verbündeten weitestgehend unabhängig zu bleiben versuchten, ihren eigenen Militärflugplatz nahe der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe unweit der afghanischen Grenze unterhielten. Ein [49]wahrer Segen, dachte Bruno, der sich die bürokratischen Hürden nicht auszumalen wagte, die zu nehmen gewesen wären, um einen mysteriösen französischen Zivilisten durch amerikanische Sicherheitskontrollen zu schleusen.
Er hatte gerade eine kurze Antwort abgeschickt, als der Bürgermeister in sein Büro kam und die Tür hinter sich zuzog. »Was hör ich da? Sie sind im collège überfallen worden? Philippe Delaron hat gerade angerufen.«
Bruno stöhnte innerlich. Nur gut, dass Philippe kein Foto von ihm gemacht hatte, wie er in seinem eigenen Erbrochenen am Boden lag.