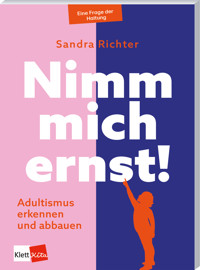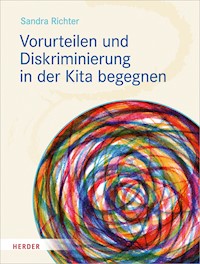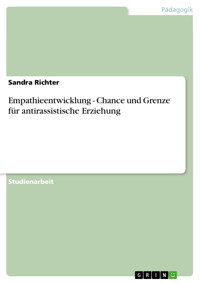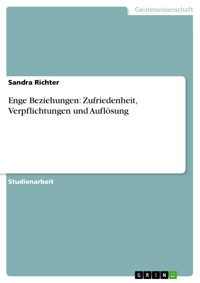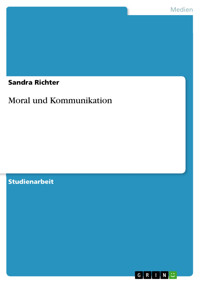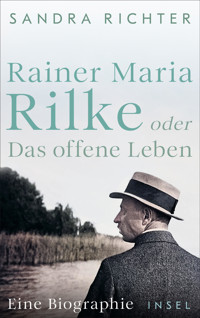
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Offen sein und schreiben, mehr wollte Rilke nicht: ein bescheidener und zugleich anspruchsvoller Wunsch. Als Autor erfuhr er »das ganze Leben [...], als ob es mit allen seinen Möglichkeiten mitten durch ihn durchginge«. Allerdings auch mit all seinen Widersprüchen: Rilke floh vor seinen Musen und konnte ohne sie nicht sein, beklagte die Folgen des menschengemachten Fortschritts und begeisterte sich für die Technik, er liebte das einfache Leben und hatte eine ausgeprägte Vorliebe für schöne Dinge und Wohnsitze. Er schuf mit den Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge einen der ersten modernen Romane und epochemachende Gedichtzyklen, deren Ausdruckskraft bis heute nachwirkt.
Sandra Richter, Literaturwissenschaftlerin und Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, arbeitet mit neuen Quellen, die mit Ankauf des großen Rilke-Archivs 2022 nach Marbach gelangt sind. In ihrer Biographie erscheint der Autor in neuem Licht: Nicht der weltabgewandte Einsiedler, zu dem er sich gern stilisierte, sondern robust, durchsetzungsfähig, alert in Gesellschaft, heiter und selbstironisch und in Finanzdingen beschlagener, als man gemeinhin annimmt. Diese Biographie macht deutlich, warum es sich heute in besonderer Weise lohnt, Rilke wieder zu lesen: Er lebte in schwierigen Zeiten, und er verarbeitete sie mit einer Wucht, die vielleicht nur im Angesicht existenzieller Bedrohung glaubhaft wirkt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 720
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
Sandra Richter
Rainer Maria Rilke oderDas offene Leben
Eine Biographie
Mit zahlreichen Abbildungen
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Insel Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der 4. Auflage der Erstausgabe, 2025.
Originalausgabe© Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagabbildung: Foto von Rainer Maria Rilke, Greifensee, 1924, Schweizerisches Literaturarchiv, Bern
eISBN 978-3-458-78299-5
www.insel-verlag.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
In Rilkes Kosmos. Vorwort
Das Mädchen René. Behütete Jahre
1875
-
1882
Müttersöhnchen. Erziehung zur Vorfreude
1875
-
1926
Der Vater und
sein verlorener Sohn. Aufstiegsphantasien
1887
-
1891
Slawophiler Debütant
im deutsch-böhmischen Prag. Wilde Jahre
1893
-
1896
René wird Rainer. Blumenkinder in Wolfratshausen
1897
Sehen lernen
mit Clara Westhoff. In der Künstlerkolonie Worpswede
1900
Der Weiße Hirsch. Flitterwochen im Sanatorium
1901
Babylon Paris. Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge
1902
-
1910
Die kleine Mücke
im nordischen Utopia. Unter schwedischen Bildungsreformern
1904
Kein Postbüro
im Walfischbauch. Ruth und der »verlorene Vater«
1901
-
1926
Durchbruch
mit blutender Nase. Auftrittsangst und Sprechmaschine
»Voll Erwartung und froh«. Unerwarteter Abschied von Auguste Rodin
1906
Im selben Käfig. Nähe und Distanz zum »Prager Kreis« (Max Brod, Franz Werfel und Franz Kafka)
Schreiben als Selbsttherapie. Der Hysteriker als Seelenarzt
1911
/
12
»Will ich dich besser lieben
nach dem Tod«. Griechische Landschaften auf Anacapri
1906
/
7
Ich ist eine »Übertreibung«. Orientalische Wende in Ägypten?
1910
/
11
Zwei Künstler
auf dem Scheiterhaufen. Mit Eleonora Duse in Venedig
1912
»Dottore Serafico«. Séance mit der Planchette und die Geisterfahrt nach Spanien
1912
»Sparen, sparen, sparen!«. Das Werk des verlegerischen »Hausvaters«
Das Erfolgsbuch. Ein geschäftstüchtiger Cornet
1912
-
1926
»Offene Hand« oder
»offenes Leben«? Georg Simmel und Alfred Schuler als Lehrer
»Pegasus im Joch«. Kampf um die Freistellung vom Kriegsdienst. München, Wien
1915
/
16
»Neue Zeit, Zukunft, endlich!«. Räterepublik München
1918
/
19
»Bücher, Bücher, Bücher«. Rückkehr in die Zivilisation aus der Bibliothek von Soglio
1919
Schreibstoff
durch Liebesentzug. Baladine Klossowska als Muse
1919
-
1926
Das Spukschloss im Wallis. Wie das große Werk in Muzot entstand
1921
/
22
Fünfzig Rosen für den Garten. Selbstsorge und ökologisches Bewusstsein
1922
-
1926
Hat Rilke sich selbst vergiftet? Odyssee in den Tod
Gegen den »deutschen Typus«
des weltabgewandten Dichters. Nachwort
Chronologie
Anmerkungen
Bibliographie
Dank
Abbildungsverzeichnis
Personenverzeichnis
Informationen zum Buch
In Rilkes Kosmos
Vorwort
Rilke: Selbstporträt, 9.1.1887[1]
Offen sein und schreiben, mehr wollte Rilke nicht: ein bescheidener und zugleich anspruchsvoller Wunsch. Seine Literatur sollte aus innerer Dringlichkeit erwachsen, alle Wesen, Lebensformen und Weltanschauungen wahrnehmen und in seinem literarischen Kosmos aufheben. Zivilisation und Natur, Tod und Leben, Körper und Geist, die einander angeblich durch das Christentum feind geworden waren, wollte Rilke miteinander versöhnen, in einem rhythmisierten hohen Ton, der alles poetisieren sollte. Auf diese Weise empfahl er seine Literatur für die vorderen Plätze im literarischen Kanon Europas und der Welt. Tatsächlich schrieb Rilke einen der ersten modernen Romane in deutscher Sprache, das wichtigste Prosastück des Ersten Weltkriegs und epochemachende Gedichtzyklen, deren Ausdruckskraft bis heute nachwirkt.
Aber obwohl Rilke sich auf dem Altar der Literatur opfern und alles Widerstreitende vereinen, ohne Unterlass an seinem eigenen Kosmos arbeiten wollte, polarisierte er, und zwar aus ästhetischen wie aus moralischen Gründen. Martin Heidegger, einer der einflussreichsten und aufgrund seiner Nähe zum Nationalsozialismus umstrittensten Philosophen des 20. Jahrhunderts, betrachtete Rilke nach dem Zweiten Weltkrieg als Bundesgenossen, der seinsphilosophische Fragen stellte und mit den Mitteln der Lyrik beantwortete. Rilke erschien Heidegger als sehender Dichter, er löste aus dessen Versen große, bildhafte Begriffe heraus, um sie in den Ideenhimmel seiner Fundamentalontologie einzuordnen: Rilke künde von einem »Weltinnenraum«, meinte Heidegger, der alle Wesen wie in eine »heile Kugel« aufnehme, Dingen, Tieren und Menschen einen »reinen Bezug« aufeinander ermögliche.1 In diesem Raum gibt es weder wahr noch falsch, weder gut noch schlecht, denn hier ist alles durch sein bloßes Dasein gerechtfertigt.
Theodor W. Adorno hingegen, in den 1960er- und 1970er-Jahren die Autorität in ästhetischen und literaturkritischen Fragen, stempelte Rilkes Gedichte als protofaschistisch ab, auch um sich von Heidegger abzugrenzen. Schon das Selbstverständnis Rilkes ist aus Adornos Sicht falsch: Der Autor begreife sich als Sänger eines dunklen Gottes, propagiere eine amoralische Kunstreligion und schreibe in einem »Jargon der Eigentlichkeit«, der »auf dem Grat« zum Faschismus schlafwandele.2 Noch das Schrecklichste, etwa die Armut, romantisiere Rilke in weltfremden Versen: »Bettler können dir Bruder sagen, / und du kannst doch ein König sein«3, heißt es in seinem frühen Königslied aus dem Jahr 1896. Rilke dichte bräunlichen Kitsch für eine kulturell ignorante »Konsumgesellschaft«, verfertige Trostsprüche als »Massenartikel«4, schimpft Adorno.
Die Rilke-Interpretationen von Heidegger und Adorno wirken bis heute nach; sie bilden Extrempole der Wahrnehmung Rilkes. Erst nach und nach, durch die sorgsame Arbeit der Rilke-Forschung, zeigt sich, dass die beiden großen Philosophen Rilke gezielt missverstanden haben. Heidegger und Adorno erfassen einzelne Merkmale von Rilkes Werk, scheitern mit ihren Auslegungen seiner Verse aber jeweils an der selbstgewählten Zuspitzung: Rilkes Kosmos war nicht in einem philosophischen Sinne harmonisch; er veredelte nicht einfach die Wirklichkeit und bejahte alles Irdische, auch wenn er das behauptete,5 sondern schlug auch kritische Töne an, sah Schönes im Hässlichen und umgekehrt, Hässliches im Schönen. Sich selbst empfand Rilke als Mängelwesen, krank, überempfindlich, unterprivilegiert. Sein Gott, der ihn angeblich zum Schreiben inspirierte, war ein selbsterschaffenes, imperfektes Perpetuum mobile, das ihm mit Vorliebe den Dienst versagte. Und obwohl Rilke behauptete, die Einsamkeit zu suchen und apolitisch zu sein, war er bei wichtigen historischen Ereignissen mittendrin, und sein Werk weist Spuren von politischen Ideologien auf.
Gerade aufgrund dieser Vielschichtigkeit lohnt es sich heute in besonderer Weise, Rilke wieder zu lesen: Er lebte in schwierigen Zeiten, und er verarbeitete sie mit einer Wucht, die vielleicht nur im Angesicht existenzieller Bedrohung glaubhaft wirkt. Diese Wucht entfaltet sich durch Rilkes Gestus, auch das Kleinste, Nebensächlichste radikal mit Bedeutsamkeit aufzuladen. Ein solcher Anspruch kann leicht in sein Gegenteil umschlagen. Rilke riskierte den »Balanceakt zwischen Gedankenkitsch und hoher Kunst«6. Er stilisierte sich zum Pilger, Propheten und dichtenden Seher,7 zum esoterischen Einzelgänger. Bislang kaum bekannte und neue Quellen zeigen jedoch,8 dass er einer der mit dem Literatur- und Kunstbetrieb seiner Zeit eng verbundenen Autoren der europäischen Moderne war, der die Geselligkeit ebenso schätzte wie die Einsamkeit, die ihn zum Lebensende hin sogar belastete.
In diesem Buch, dem es um den Menschen Rilke geht, liegt mir daran, mich dem Autor nicht in Ehrfurcht zu nähern, sondern Leben und Werk mit der nötigen, gelegentlich ironisch gebrochenen Distanz zu begegnen. Ziel ist es, das vom Autor und von seinem Verleger errichtete Dichtermonument Rilke9 in ein neues Licht zu rücken und zugleich das Eigensinnige wie das Fragwürdige an Rilkes Werk zu erörtern.
Als Autor erfuhr Rilke, so wollte er es, »das ganze Leben […], als ob es mit allen seinen Möglichkeiten mitten durch ihn durchginge«.10 Auch sein Werk begriff Rilke – in romantischer Tradition – als unabschließbar: Er erklärte alles zum Werk, auch seine Briefe,11 sodass die Grenzen von Werk und Lebenszeugnissen verschwimmen. Rilkes Leben lässt sich schon aufgrund dieser selbsterklärten Durchlässigkeit nicht einfach von der Wiege bis zur Bahre erzählen, auf sein Werk abbilden, bewerten und kanonisieren. Zudem waren Rilkes Sichtweisen auf sich selbst und die äußere Wirklichkeit in stetigem Fluss. Er veränderte seine Identität, spielte unterschiedliche Rollen, leugnete reale Zusammenhänge und schrieb sie um.
Vor dem Hintergrund dieser stetigen und rasanten Wandlungen teilt man Rilkes Entwicklung in verschiedene Phasen ein: Am Anfang steht das früheste Werk des jungen Mannes von den ersten, noch in Prag verfassten Texten bis zu seiner Begegnung mit Lou Andreas-Salomé. Das frühe Werk umschließt die Folgejahre, Worpswede und Westerwede vor allem, bis zur Abreise nach Paris. Es folgt das mittlere Werk des Dreißigjährigen, das in die Kriegserfahrung des Anfang Vierzigjährigen hineinreicht, aber auch schon ins späte Werk übergeht, das von den beiden großen Gedichtzyklen Duineser Elegien und Sonette an Orpheus, publiziert im Jahr 1923, bestimmt wird. Das späteste Werk beginnt danach und reicht bis zu Rilkes Tod, wobei die Zugehörigkeit der Sonette an Orpheus umstritten ist.12 Die fünf Werkphasen sind tatsächlich nicht trennscharf voneinander zu unterscheiden, und im Detail ist hier noch vieles zu vergleichen und zu diskutieren.
Zahlreiche Biographien haben dazu beigetragen, Verschiebungen und Entwicklungen im Werk Rilkes zu beschreiben und »die exklusive Existenzform« Rilkes darzustellen;13 sie sind unverzichtbare Grundlagen, auch für dieses Buch. Indem ich Begebenheiten aus Rilkes Leben näher beleuchte, die bislang nur in groben Zügen dargestellt wurden, möchte ich den von Rilke selbst verwischten Spuren nachgehen, Wirklichkeitskerne aus Rilkes Texten herausschälen und das Literarische an ihnen beschreiben. Die Auswahl der Begebenheiten orientiert sich an Biographemen, also prägenden Ereignissen, die Rilke dauerhaft beschäftigten und über die er sich immer wieder äußerte,14 darunter das schwierige Verhältnis zur Mutter, die Erzählung von der vermeintlich adligen Vaterfamilie, der körperliche Zwang in der Militärschule der k.u.k. Monarchie. Biographeme wie diese sind Dreh- und Angelpunkte von Rilkes Handeln, Schreiben, Sich-Verweigern und zugleich Gegenstand der Selbstdeutung in seinen Briefen, Gedichten, Dramen, Erzählungen.
Rilke suchte seine Anregungen dort, wo kaum jemand sie sonst finden wollte: bei »gefallenen Mädchen« in der tschechischen Provinz, in den Krankenhäusern von Paris, im Kampf mit einer schwedischen Mücke und, nachts, am Fuß der Sphinx. Als Kind der Moderne, das die Großstadt ebenso intensiv erfuhr wie die eigenen Schwierigkeiten damit, machte er sich tradierte und neue Schreibweisen zunutze, entwickelte sie weiter, dichtete in kritischer Auseinandersetzung mit seiner Zeit und lobte sie in den höchsten Tönen. Rilke floh vor seinen Musen und konnte ohne sie nicht sein. Er entwarf Kinderlyrik und studierte die Geschichte der Frauen, beklagte die Folgen des Anthropozän und begeisterte sich für neue Techniken, er hoffte auf große Leistungen und nahm vom eigenen Erfolg erst Notiz, als er sich ums Geld keine Sorgen mehr machen musste und einen abgelegenen Wohnturm in der Schweiz bezog. Wahlmütter, Psychologen, Mäzene und ein umsichtiger Verleger schufen dafür den Freiraum und lenkten seinen Willen zu höchster Kunst. In diesem Buch geht es auch um sie und ihren Anteil am Werk Rilkes – und der ist größer als bislang gedacht. Durch diese Einsicht wird die Literatur Rilkes jedoch nicht relativiert, im Gegenteil: Der Beitrag der Zeitgenossen zu Rilkes Werk und ihr Glaube an dieses Werk zeigen, dass seine Literatur in besonderer Weise begeisterte. Woher aber bezieht sie ihren Geltungsanspruch, und was nahmen Rilke und sein Umfeld dafür in Kauf?
Das Mädchen René
Behütete Jahre 1875-1882
Rilke, 1879[2]
»Die Ismene bleibt bei der lieben Mama, der René ist ein Nichtsnutz«1, sagte der siebenjährige René zu seiner Mutter, als er etwas Unerlaubtes getan hatte und seine Strafe erwartete, so jedenfalls will es eine Legende der Familie. Den androgynen frankophonen Vornamen hatte die Mutter bewusst ausgesucht. René stand im Kleid vor seiner Mutter, die Ärmel aufgerollt, um die zarten Arme zu entblößen, sie musste sein langes Haar zum Zopf flechten. Als Mädchen unter dem Alias Ismene mochte sie ihn besonders, und er wusste das.
Ismene spielte das Unschuldslamm und solidarisierte sich mit der Mutter gegen das ›böse Knaben-Ich‹ Renés. Der Geschlechtertausch galt ihm, wenn die Familienanekdote zutrifft, als selbstverständliches Mittel zum Zweck; aus der frühen Erfahrung, dass Täuschung ihr Ziel zu erreichen vermochte, entstand sein manipulatives Talent: Schon früh war Rilke ein Menschenfänger – ein Umstand, den man bislang aufgrund fehlender Quellen kaum beachtet hat.
Eine tragische Begebenheit war dem Rollenspiel des jungen René vorausgegangen: Ein Jahr vor seiner Geburt am 4. Dezember 1875 hatten die Eltern ein Mädchen verloren, »Zesa«, kaum eine Woche alt, das Wunschkind der Mutter. René kam als Zweiter und aus ihrer Sicht mit dem falschen Geschlecht zur Welt. Obwohl der Vater protestierte, machte die Mutter ihn zum Mädchen, ließ ihm Locken wachsen und ihn mit Puppen spielen, steckte ihn in Kleider – ein Schicksal, das wenige Knaben seiner Generation teilten, denn damals galten die Stammhalter mehr als Mädchen. Aber Frauen wie Rilkes Mutter begehrten gegen die Hierarchie der Geschlechter auf. Sie machten sich Gepflogenheiten wie diejenige zunutze, dass auch Jungen bis zum sechsten Lebensjahr praktische kleidartige Kittel tragen konnten; außerdem sparten lange Haare den Friseur. Auf diese Weise konnte Rilkes Mutter sich ein Kind mit dem Wunschgeschlecht gestalten. René Rilke nahm seine Mädchenrolle angeblich bereitwillig an, kämmte Puppenhaare, wünschte sich ein Puppenbett und eine Puppenküche.
In seinen teilweise autofiktionalen Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge von 1910 beschreibt Rilke die frühkindliche Doppelgeschlechtlichkeit als Persönlichkeitsspaltung in Mädchen und Junge. Hier verschmilzt Malte beinahe mit der Figur der »Maman«; er erkennt ihre Wünsche, nennt sich nun nicht Ismene, sondern nach Rilkes Mutter »Sophie«. Wenn er in seinem Hauskleid mit aufgerollten Ärmeln an der Tür klopft, spricht er mit hoher Stimme und beklagt sich über die Schlechtigkeit der Jungen im Allgemeinen, über Malte im Besonderen.2 Die Mädchenrolle wird ihm so sehr zur zweiten Haut, zum Alter Ego, dass er Sophie auch als Heranwachsender nicht sterben lassen will; sie erlaubt ihm die unmittelbare Teilnahme an der mütterlichen Welt, schützt ihn nicht nur vor Strafen, sondern erweitert auch seine Handlungsmöglichkeiten.
Wenn ihm die Mädchenrolle jedoch aufoktroyiert wurde, die Mutter mit ihm »wie mit einer großen Puppe« spielte und er mechanisch ihr Programm abspulen sollte, stemmte Rilke sich gegen den Geschlechtertausch.31914, nachdem er in München die filigranen Wachspuppen der Künstlerin Lotte Pritzel gesehen hatte, brachte er seine Weigerung auf den Punkt. Anders als die schönen Pritzelpuppen starrten die schlichten Kinderpuppen blass bemalt wie tot ins Leere, wenn sie ihre klimpernden Augen öffneten. In einer Schimpfrede klagt Rilke diese Puppen an, stellvertretend für seine Mutter, die den Sohn zur Puppe gemacht hatte; sie werden ihm zu Symbolen seelenlosen Lebens, oder: der »Herzpause«4, die den Einzelnen haltlos zurücklässt. Pritzels Puppen hingegen, Puppen für Erwachsene, zarte Figuren, die scheinbar sehen und fühlen konnten, nannte Rilke »Engelspuppe[n]«5 – und fand ihre Produzentin so engelsgleich, dass er sie für einen Nachmittag in sein kleines Hotelzimmer einlud.6 Seine Mutter hingegen erschien ihm im Traum als Puppe, er hielt sie am seidenen Faden und wusste sie mit ihren Phrasen und ihren hysterischen Ausbrüchen in seinem Sinn zu dirigieren.7
In Malte Laurids Brigge steigert Rilke sich in die Auseinandersetzung mit dem Puppenhaften hinein und malt sie in bunten Farben aus. Eine eindrückliche Verkleidungsszene veranschaulicht die Empfindungen und das Rollenspiel des Jungen René: Begeistert von den alten Trachten des dänischen Elefantenordens, von Frauenröcken, Pierrots, türkischen Hosen, persischen Mützen, Schals und Schleiern, probiert Malte vor einem schmalen, trüben Pfeilerspiegel ein Kleidungsstück nach dem anderen an. Er bewegt sich wie ein Schauspieler, redet wie mit fremden Zungen, gestikuliert, überzeugt von sich selbst, immer kühner, taucht – berauscht durch außergewöhnliche Formen, Farben und Stoffe – in fremde Welten ein. Doch unter energischen Bewegungen und Pirouetten – seine Hand hat sich selbstständig gemacht – geht ein Flakon zu Bruch, der Zauber verfliegt im Nu. Er begreift seinen Zustand nicht mehr, verfängt sich in Schnüren, fühlt sich durch den Spiegel, der ihn verführte, verlacht. Die viel zu vielen möglichen Welten überwältigen Malte: »[I]ch verlor allen Sinn, ich fiel einfach aus.«8 Die Diener müssen ihn aus dem Mantel befreien, er liegt »wie ein Stück in all den Tüchern«9, als sei alles Leben aus ihm gewichen. Malte will sich der verordneten Masken entledigen; von Angst gewürgt, liegt er sterbebereit am Boden.
»[D]ie Wege, auf denen sie mich erwartet, sind wie in einem Spiegel«10, nicht begehbar, unwirklich, beschwerte Rilke sich über seine Mutter. »[S]ie sieht mit ihrer Vorstellung von mir ein solches Loch in mich hinein, eine solche Leere, daß ihr gegenüber nichts seine Gültigkeit behält«11. Der flirrenden Geschlechteridentität von Ismene, Sophie oder René entspricht eine Mutterwelt, die sich dem jungen René als buntes Kaleidoskop von Möglichkeiten darstellt. Ich ist immer schon eine Andere, und der Knabe kann auswählen, wie in einem Süßigkeitenladen. Für den jungen René war das eine inspirierende Urerfahrung, aber im Nachhinein stellte er fest, dass ein Zuviel der Maskerade das Selbstgefühl verdarb.
Lou Andreas-Salomé fasste die Spiegelszene deshalb im Sinne einer Missbrauchsgeschichte auf und klagte an: Die Mutter und die Prager Verhältnisse der Familie hätten Rilke zu einer gefährdeten Persönlichkeit, »zu einer kleinen Renée« gemacht.12 Aber so einfach war es nicht. Das Verhältnis von Rilke zu seiner Mutter und zu seiner Geschlechtlichkeit war vielschichtiger, ambivalenter und liebevoller, und er selbst entwickelte sich trotz der Gefährdungen zu einer starken, durchsetzungsfähigen Persönlichkeit.
Rilkes Mädchenleben fand im Alter von etwa fünf Jahren ein sichtbares Ende, die langen Haare kamen ab, für die Schule, die bald beginnen sollte. Diese Erfahrung teilte Rilke mit der zentralen Figur eines anderen bekannten österreichischen Autors: In seinen Verwirrungen des Zöglings Törleß von 1906 schilderte Robert Musil (noch vor Erscheinen von Rilkes Malte), wie Törleß mit der binären Geschlechterordnung hadert. »[A]ls er noch Kleidchen trug und noch nicht in die Schule ging, hatte er Zeiten, da in ihm eine ganz unaussprechliche Sehnsucht war, ein Mäderl zu sein.«13 Diese Sehnsucht »kitzelte im ganzen Körper«14. Wie Rilke wird Törleß vor Schuleintritt mit den Normen und Erwartungen der Knabenwelt konfrontiert. Angeblich rückte der junge Rilke im Alter von zehn Jahren mit rüschenverzierter Wäsche in die Militärschule ein, zum Spott der Vorgesetzten und Kameraden, und ein Unteroffizier riss ihm die Kette mit dem Medaillon ab, die er um den Hals trug.15 Musils Figur – Törleß ist älter als Rilke – will sich nicht in die soziobiologischen Zeitläufte fügen. Rilke nahm es leichter, sein Malte übrigens auch. Beide akzeptierten ihr Knabendasein, es war eben eine Möglichkeit für sie und körperlich gesehen die naheliegende.
Rilke erlebte keine schwere, aber eine belastete Kindheit; er war kein Wunderknabe, vielmehr »ein verwöhntes Kind und ein sentimentaler Jüngling«16, urteilte sein Schwiegersohn Carl Sieber streng. Dieses Urteil ist wahrscheinlich ebenso halb wahr wie die Klage, die Andreas-Salomé gegen Rilkes Mutter führte.
Liest man Rilkes Gedichte, dann fällt auf, dass sie im Vergleich mit dem Prosatext Malte Laurids Brigge eine andere Sprache sprechen und das Wahrgenommene verklären, während Malte Laurids Brigge es in die düstere, mitunter groteske Welt der Persönlichkeitsspaltung und der Ängste rückt. Melancholisch dichtet Rilke auf die »langen Kindheits-Nachmittage«17, die nicht wiederkommen; die Kindheit gilt im Gedicht als »grenzenlos und ohne / Verzicht und Ziel«18. Mit der Schule erst beginnt die Umkehr, in Rilkes Worten: »Absturz in Versuchung und Verlust«19. »Der Umgebogene wird selber Bieger«20, diagnostiziert Rilke nüchtern und beschreibt damit die Anpassungsleistung derer, die in der Gesellschaft weiterkommen: Sie nehmen die existierenden Rollen- und Handlungsmuster auf, fügen sich ein, geben weiter, unterdrücken und formen andere nach diesem Bild. »Da stürzt ein Gott aus seinem Hinterhalt«21, lautet der Schlussvers des Gedichts, und er signalisiert, dass es etwas Unkontrollierbares – für Rilke: Höheres – geben kann, das den Lauf der Dinge verändert, zumindest für einen Menschen. In seiner Prosa fehlt diese Aussicht auf Rettung.
Die Erziehung zum Mädchen eröffnete Rilke den Weg zu etwas Ungewöhnlichem: einer Gefühls- und Geschmackskultur, die vielen Zeitgenossen verschlossen blieb. Er pflegte und bewahrte seine Begeisterung für das ästhetisch Feine, Weibliche: Der Heranwachsende wünschte sich duftende Seife und spezielles Briefpapier. Als junger Autor befasste er sich intensiv mit den Trachten des Elefantenordens, die Malte sich im Text überwirft.221911, auf Schloss Duino, kramte Rilke in Schubladen, Kästen und Kartons, in denen sich »Spitzen, Schleier und Schärpen«, Batist- und Spitzentücher befanden.23 Er erarbeitete sogar ein Inventar des Tuchbestands auf Zetteln mit feiner Schrift, begeisterte sich für Schminktiegel aus feinem Porzellan mit geflügelten Amoretten, Parfumfläschchen, Dosen und Arbeitstäschchen. 1921, im Historischen Museum Bern, faszinierten ihn die schweizerischen Shawls, die weich um die Schultern ihrer Trägerin fielen.24 Der modebegeisterte Rilke schenkte der Kleidung seiner Musen besondere Aufmerksamkeit, und für sich selbst wollte er vom Einfachen das Beste: graue Anzüge und Hüte, die damals modischen Manfield-Schuhe, Gamaschen – aber nur mit vier bis fünf Knöpfen.
Knaben, die sich in ihrem Geschlecht unwohl fühlten, behandelte Rilke so, als besäßen sie ihr feminines Wahlgeschlecht. Der Sohn der Freundin und Mäzenin Eva Cassirer etwa wollte, nachdem er Kriegsversehrte gesehen hatte, eine Frau werden, um nicht dienen zu müssen.25 Rilke betrachtete den Knaben entsprechend als Mädchen. Gegenüber der eigenen Tochter war er weniger tolerant: »Mutter hat mir geschrieben, dass du ein paar Tage ein Junge warst, ich freue mich, dass das wieder vorüber ist, ich kann mit Jungen nicht gut umgehen, sie sind mir zu wild, es ist bei weitem schöner, an ein kleines Mädchen zu schreiben.«26
Bei aller Akzeptanz der Knaben- und Männerrolle haftete Rilke etwas Mädchenhaftes an, bis zu einem gewissen Grad jedenfalls. Der schwedische Nervenarzt und Psychotherapeut Poul Bjerre, ein enger Freund von Lou, meinte sogar, dass Rilke durch die Erziehung zum Mädchen in seinem Geschlecht »heimatlos« geworden sei: Von hinten habe er wie ein dreizehnjähriges Mädchen ausgesehen und er habe sich nie damit versöhnt, ein Mann zu sein.27 Andreas-Salomé und Rilke hingegen glaubten an die Produktivität des »Doppelgeschlechtlichen«28: Aus der Reibung beider Geschlechter in einem Menschen entstünde erst jene besondere Spannung, die Kunst hervorzubringen erlaube. In diesem Sinne bekannte Rilke: »Es ist so natürlich für mich, Mädchen und Frauen zu verstehen; das tiefste Erlebnis des Schaffenden ist weiblich.«29 Männer wie Frauen mussten sich für ihn schaffend verändern, Merkmale des jeweils anderen Geschlechts in sich aufnehmen.30 In Rilke sei die Doppelgeschlechtlichkeit so groß gewesen, meinte Andreas-Salomé, dass sie ihn im Geschlechtsverkehr mit Frauen »um seinen letzten Genuß bringen« konnte.31 Ganz gleich, wie es sich genau mit der Geschlechtlichkeit Rilkes verhielt, die heterosexuelle literarische Männergesellschaft spottete über ihn: Karl Kraus wollte Rilke nach einem Streit nur beim weiblichen Vornamen »Maria« nennen32. Gottfried Benn sagte zu ihm, auf den häufigen Gebrauch des Diminutivs bei Rilke anspielend: »Männchen«33, und Bertolt Brecht hielt Rilkes Verhältnis zu seinem Gott für »absolut schwul«34.
Männern gegenüber lebte Rilke seine Doppelgeschlechtlichkeit jedoch nicht aus, deutete aber eine mögliche Ausnahme an: Rudolf Kassner. Der konservative Essayist und Kulturphilosoph war »vielleicht der einzige Mann«, mit dem Rilke nach eigener Aussage »etwas anzufangen« wusste, und umgekehrt sei Kassner »der Einzige, dem es einfällt, aus dem Weiblichen in mir ein klein wenig Nutzen zu ziehen.«35 Neben Kassner, der laut und heftig werden konnte, wenn die Welt ihn – wie üblich – ärgerte, wirkte Rilke leise und zart.36 Kassner seinerseits liebte Rilkes Lachen, und er beschrieb es etwas despektierlich, mit überlegener Geste, als »das Lachen eines Knaben, das treuherzigste, darin auch etwas vom Lachen oder dem Maulverziehen eines überaus guten, unendlich dem Herren ergebenen Hundes war, ich sage, dieses wundervollste Lachen, das ich bei Männern getroffen habe«37. Manchmal wollte Rilke außer Kassner, der ihn bis zum Lebensende begleitete, niemanden treffen. Er widmete ihm die achte Duineser Elegie: »Mit allen Augen sieht die Kreatur / das Offene«38, beginnt sie. Die Kreatur, das Tier blickt ins Entgrenzte, in den Bereich, nach dem er sich ebenfalls sehnt. Nur durch Kassners Vertrauen in ihn und seine Leistungen hänge er »recht wesentlich mit den Menschen zusammen«39, so empfand es Rilke, als sei er selbst eine Kreatur, wie ein Tier geöffnet für Wahrnehmungen, vor denen Menschen üblicherweise die Augen verschließen.
Die Faszination des Autors für Mädchen oder junge Frauen aber, seine Identifikation mit ihnen und seine Verehrung der scheinbar reinen Geschöpfe, sind mit dem Odium des Unanständigen behaftet. Immer wieder fühlte Rilke sich zu Mädchen hingezogen, zu dem, was er als ihr Geheimnis begriff. Der Begriff des Mädchens war damals schillernd, er konnte jedwedes weibliche Wesen meinen. Was das Lebensalter betrifft, war er nicht klar begrenzt. Um 1900 galten 17-jährige Mädchen in Frankreich bereits als heiratsfähig, und Rilke nannte sie ebenso Mädchen wie die 22-jährige Clara Westhoff und die 24-jährige Paula Becker, beide damals nicht gebunden, als er sie im Alter von 25Jahren, sich selbst erwachsen fühlend, in Worpswede kennenlernte.
Doch wurde die Altersspanne, die zwischen Rilke und seinen Mädchen lag, mit den Jahren größer, und damit wächst der Verdacht unangemessener, missbräuchlicher, vielleicht sogar – nach heutigen Maßstäben – pädophiler Beziehungen. Rilke selbst berichtet von einer Verbindung, die ihn selbst besonders fasziniert, gefordert und verstört hat. Im Alter von 35Jahren begegnete er in einem Pariser Elendsviertel, das er aus ungeklärten Gründen aufgesucht hatte, der gerade 17Jahre alt gewordenen Marthe Hennebert. Die vom Hunger abgemagerte, hübsche Marthe lebte, so Rilke, im Atelier eines russischen Bauern, trug »ein goldenes Stirnband um die Schläfe, in einem wunderlichen tanagrahaften Gewand«40. Sie züchtete Hyazinthen zwischen ihren Füßen im Bett, suchte Schönes in ihrer bedrohlichen Umgebung, verdiente ihr Geld nur mühsam, als Näherin. Mit Rilke wollte sie in das Pariser Zentrum fahren, auf einem Ball tanzen; sie hatte sich den ganzen Tag dafür gewaschen und gekämmt. Rilke erfüllte ihr diesen Wunsch, brachte sie in das Tanzlokal Bullier – er verhielt sich wie ein unbeholfener, älterer Liebhaber, auf den die Kindsbraut sich sorgsam vorbereitet hatte. Sie verpassten den letzten Zug, trieben sich bis zum Morgen in den Straßen der Stadt herum. Hennebert ging barfuß »in ihren Sandalen, um recht griechisch zu sein: das gab ihr etwas Unwahrscheinliches, Rührendes (etwas wie von einer Bettlerin im Himmel)«41.
In seine Wohnung nahm Rilke Hennebert angeblich nicht mit – anders als andere Mädchen, die, wie er Clara Rilke-Westhoff gestand, mitunter »zu lange« blieben42. Rilke begriff sich als Henneberts Retter, las ihr vor, machte sie mit dem literarischen Sujet der Schmerzensfrau vertraut, indem er ihr die Gedichte der bedeutenden, von Schicksalsschlägen heimgesuchten Lyrikerin Marceline Desbordes-Valmore und Paul Claudels eben erschienene L’annonce faite à Marie (Mariae Verkündigung) zur Lektüre gab. Er genoss das Beisammensein mit Marthe, die ihm als »das phantastische ungehemmte Kind« erschien,43 naturhaft, selbstverständlich, sublim. Seine Vertrauten sollten ihr Geschenke besorgen: Von der gebildeten, vermögenden und großherzigen Fürstin Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe erhoffte er sich ein Medaillon für Marthe,44 von der emsigen Verlegerin Katharina Kippenberg ein altes, feinziseliertes goldenes Kettchen.45 Gegenüber der Malerin Hedwig Jaenichen-Woermann, die sich zeitweise um Marthe kümmerte, formulierte Rilke nur nebulös: Er könne kaum von ihr erzählen, sein Verhältnis zu Marthe sei »nah am Unsäglichen«46.
Der Wiener Kaffeehausliterat Peter Altenberg, dessen perverse Vorlieben schon sein Schriftsteller-Kollege Felix Salten kritisierte,47 schilderte Mädchen im Alter von sieben und fünfzehn Jahren als junge Diven, sammelte Aktaufnahmen von ihnen. In seinen kurzen Prosatexten schilderte er unverhohlen, wie er sie anhimmelte und küsste,48 sie – wie Egon Schiele und andere Zeitgenossen – zu Kindfrauen stilisierend. So weit ging Rilke nicht, doch war die Mädchenliebe des Autors schon damals erklärungsbedürftig: Wie leicht hätte auch Rilke Mädchen wie Marthe verführen, die Kunst als Mittel zum erotischen Zweck missbrauchen können, meinte Katharina Kippenberg, Rilke gegen mögliche Kritiker in Schutz nehmend. Sie betonte, er habe sich diesen Schritt versagt.49 Aus ihrer Sicht konnten Mädchen wie Hennebert, die sich altersmäßig auf der Schwelle zu jungen Frauen befanden, als Rilkes Wahltöchter gelten. Er habe seine Verehrung und sein Begehren durch Dichtung sublimiert. Nach dem Urteil der Zeitgenossinnen war die Begeisterung für Mädchen offenbar eine lässliche Sünde – sofern es nicht zu körperlichen Übergriffen kam.
Rilke selbst legte die Grundlage zu dieser Einschätzung, der viele bis heute folgen: »Einflüsse von jungen Mädchen, welche nachts ihre Fenster öffnen«, zählte er zu den Hauptquellen seiner Verse, neben »Einflüsse[n] von Einsamen«, »Einflüsse[n] von Fernen, die einsam sind«, »Einflüsse[n] von Dingen, Thieren, Steinen, Sternen«50. In seinen Briefen an Hennebert verwendete er aber eine formelhafte und mehrdeutige Sprache, wie er sie vor allem in Briefen an seine Frau Clara Rilke-Westhoff gebrauchte: »Sein verlassenes Herz« habe sie »in ihren beiden Händen« getragen, und er wolle dorthin, »in die Innenflächen ihrer Hände«, zurückkehren.51 Das Bild ist doppeldeutig und könnte auch erotisch gemeint sein.
In seinen Versen begibt Rilke sich in eine voyeuristische Rolle, aus ihnen tönt eine schwülstige, paternalistische Erotik. Seine Mädchen haben kein Selbst, erscheinen als bloße Symbole für eine höhere Ordnung, wie Dekor in harmonischen Umgebungen, typisch für die Bildwelten des Jugendstils und der Lebensreform. Sappho ist die Schutzgöttin dieser Mädchen,52 der Tanz erscheint als ihr Element. Sie tragen Blumen im Haar, lächeln zart, aus Furcht vor dem Frausein, sind nie nackt, immer unberührt, jungfräulich, aber bereit, sich erwecken zu lassen. »Mädchen, ihr warmen, Mädchen, ihr stummen«53, heißt es in den Sonetten an Orpheus über die schweigenden Kreaturen, die vor allem körperlich ausstrahlen: durch Wärme. Das Wärmeempfinden aber setzt körperliche Nähe voraus, die sie nicht gewähren: eine merkwürdige Mischung aus Versprechen und Frustration.54 Ein anderes Sonett verlegt das Mädchenhafte in den eigenen Körper:
Und fast ein Mädchen wars und ging hervor
aus diesem einigen Glück von Sang und Leier
und glänzte klar durch ihre Frühlingsschleier
und machte sich ein Bett in meinem Ohr.55
Das imaginäre Wesen, das noch nicht ganz Mädchen ist, siedelt im Ohr und strahlt von dort aus, durch Schlaf: als eigene Lebensform zwischen Mensch und Tier. Rilkes Mädchen kommt offenbar eine eigene Existenzform zu, die ihnen das Eindringen in jeden Körper, auch den männlichen, ermöglicht.
»Der letzte legendäre Maler«56, Balthasar Kłossowski de Rola, kurz: Balthus, zugleich der Patensohn und »Kooperationspartner« Rilkes57, dem der Autor als »geistiger Vater«58, Lehrer und Spielgefährte zugleich galt, gestaltete die Existenzform des Mädchens auf seine Weise. Balthus fiel schon früh durch sein gestalterisches Talent auf, und als er im Alter von zwölf Jahren eine Bildergeschichte über den Verlust seiner Katze in Tusche malte, war Rilke so begeistert, dass er mit dem jungen Künstler einen Buchvertrag abschloss, ein Vorwort verfasste, das Ergebnis drucken ließ und vielfach verschenkte. Die Katze steht in der Bildgeschichte für unkontrollierbares Begehren: für ein Wesen, das sich nur gibt, wenn es will. Ohne formale Ausbildung, gefördert durch Rilke und den impressionistischen Maler Pierre Bonnard, erlebte Balthus einen kometenhaften Aufstieg. Der erwachsene Balthus malte immer wieder Katzen und Mädchen, Rilkes Begeisterung für die Mädchen weitertreibend. Heute gelten die Mädchenbilder von Balthus als anstößig und einige von ihnen – vor allem das Bild Die Gitarrenstunde von 1934, das die Entjungferung eines Mädchens durch seine Gitarrenlehrerin zeigt – stehen im Verdacht, pädophiles Begehren zu illustrieren oder gar zu wecken.59
Balthus verteidigte seine Mädchen-Bilder mit Rilkes Argument: Hier gehe es nicht um Erotik, sondern um das Göttliche im sexuell erwachenden Kind. Es werde als irdischer Engel gezeigt. Die Gestalt der Mädchen von Balthus changiert vom schemenhaften Dasein der Renaissancemalerei bis ins Puppen- oder Marionettenhafte und Androgyne, Unwirkliche. Seine Mädchen wirken oft unwillig, störrisch, gefangen in ihrer eigenen Welt. Eines der ersten dieser eigensinnigen Mädchen, das Balthus nach einem Foto malte, ordentlich mit Hut bekleidet, war ein Junge: René Rilke alias Ismene oder Sophie.60
Die Verschiebungen von Geschlechtlichkeit durch Rollenspiel und die Umarbeitung des Erotischen in Literatur wurden Rilkes poetische Lebensthemen.61 Seine »Doppelgeschlechtlichkeit« war ihm Voraussetzung und Allegorie des Dichtens, und sie hat eine bislang wenig beachtete, zeittypische dunkle Seite. Mädchen oder junge Frauen faszinierten Rilke; er begehrte sie und identifizierte sich zugleich mit ihnen, ein mitunter perfides Rollenspiel: Die Mädchen, die mit Rilke zu tun hatten, suchten in ihm den großen Autor, den Mentor, vielleicht auch den Geliebten. Er verehrte und benutzte sie als Musen, auf seinem Weg ins ›Offene‹. Wenn das Feuer zu glühend wurde oder abnahm, entzog er sich, wandte sich neuen Wärmequellen zu und überließ die vormals Begehrte den eigenen Flammen. Rilke konnte die Mädchen, die jungen Frauen zu seinen Objekten machen, sodass sie von seiner Aufmerksamkeit abhingen – und er wiederholte dieses Spiel auf der Schwelle zum Missbrauch ein Leben lang mit immer neuen Personen. Zu solchen Grenzüberschreitungen fühlte er sich berechtigt, denn schon die Mutter hatte ihm vermittelt, dass er etwas Besonderes sei, und aus diesem Bewusstsein heraus begeisterte er nicht nur, sondern verführte und manipulierte andere auch.
Müttersöhnchen
Erziehung zur Vorfreude 1875-1926
Phia und René Rilke, ca. 1887-1888[3]
Als junge Frau soll Sophie Entz, wie Rilkes Mutter mit Taufnamen hieß, eine Flasche Sekt ganz allein ausgetrunken haben – in der Prager Gesellschaft ein Skandal, und die künftige Frau Rilke sollte für weitere Skandale gut sein. Sophie Entz war die Lieblingstochter des hochdekorierten Sparkassendirektors und Chemiefabrikanten Carl Entz und seiner Frau Caroline Entz (geborene Kinzelberger). Im Mittelpunkt des familiären Lebens standen das Geld, das opulente Leben in einem Prager Barockpalais und der Wunsch nach sozialem Aufstieg, nämlich in den Adelsstand. Von einer frankophonen Familiengeschichte ist die Rede, aber sämtliche Papiere der Familie waren vernichtet, sodass sich nichts belegen und Unliebsames verbergen ließ.
In die Ausbildung von Sophie Entz hatte die Familie viel investiert, sie sollte eine gute Partie machen. Die junge Frau war gebildet und musisch begabt, tanzte, spielte ausgezeichnet Klavier, las viel und wollte »etwas unbestimmtes vom Leben«1: Außergewöhnliches, Hochgefühl. Wie ihre Mutter war sie von sozialem Ehrgeiz beseelt, gab vor, adlig zu sein, studierte den Gotha aufs Genaueste – allesamt Motive, die sich bei ihrem Sohn wiederfanden.
Ende Mai 1873 heiratete sie erstaunlicherweise den bloß vermeintlich adligen Josef Rilke. Den gewohnten Lebensstandard konnte der Bräutigam seiner Braut nicht bieten, die Ehe bedeutete für die prätentiös »Phia« gerufene Sophie Rilke sozialen Abstieg. Doch Josef Rilke war ein gutaussehender Mann, und offenbar galten ihr das aparte Äußere und die vage Aussicht auf einen Adelstitel mehr als ein gefülltes Bankkonto.
Das Paar zog in ein unansehnliches Mietshaus in der Heinrichsgasse, hielt auf Äußerlichkeiten, versuchte Glanz zu erzeugen, wo Mattigkeit vorherrschte: Der »kleine Hausstand, der in Wirklichkeit kleinbürgerlich war, sollte den Schein von Fülle haben, unsere Kleider sollten die Menschen täuschen und gewisse Lügen galten als selbstverständlich.«2 Gab das Ehepaar Rilke Gesellschaften, musste das Bett des Sohnes hinter einem Paravent verschwinden. Die Etiketten des schlichten Tischweins wurden mit Etiketten edler Weinflaschen überklebt. Phia Rilke, alterslos, beseelt vom »Wille[n] zum Schein«3, scheute keine Mühe, um als Dame von Welt zu gelten.
Nach wenigen Ehejahren war Phia Rilkes Mitgift aufgebraucht, ihre Liebe zu Josef Rilke auch. Dass es im katholischen Prag zur Trennung kam, lässt darauf schließen, dass etwas vorgefallen sein muss: Misshandlungen, Trunksucht oder Ehebruch. Der Grund für den Zerfall der Ehe ist nicht überliefert.4
Rilke kannte seine Mutter nur als schmalgliedrige, schattenhafte und enttäuschte Frau mit tiefer Stimme; seit dem frühen Tod ihrer Tochter Zesa hüllte sie sich in unzeitgemäße lange, schwarze Kleider. Sie ließ sich »Fräulein« nennen, wollte als jung, leidend und unglücklich gelten,5 betrieb einen Kult um sich selbst, der anderen nur wenig Raum ließ und für eine Frau ihrer Generation als unanständig galt.
Manche schreiben Phia Rilke einen narzisstischen Charakter zu, unter dem der Sohn gelitten habe; er schien dazu verurteilt, ihr zu schmeicheln, gefallen zu müssen.6 Tatsächlich wirkte sie stark auf Äußeres gerichtet und mit Hilfe ihres religiösen Kultes verschloss sie sich vor anderen, aber eine abschließende Diagnose fällt nachträglich schwer. Möglicherweise wurde Rilkes Mutter von den Rilke-Biographen und der Forschung zu Unrecht abgestraft, weil sie sich nicht in das gängige Frauenbild fügte.7 Die bislang unbekannten Kinder- und Jugendbriefe Rilkes bestätigen diese Vermutung; sie geben Aufschluss über das Verhältnis von Mutter und Sohn, und dieses Verhältnis wirkt inniger als gedacht.
Phia Rilke war das Urbild der enttäuschten, vergeblich liebenden Frau, das Rilke in immer neuer Form schildern sollte. Sie lehrte ihren Sohn, neben dem Deutschen Französisch zu sprechen. Das Tschechische lehnte sie ab, es galt ihr als Sprache der Diener und der Unterschichten. Der junge René sollte, so wollte es die ehrgeizige Mutter, malen und zeichnen,8 Literatur lesen, Gedichte memorieren und vortragen, Schillers Balladen zum Beispiel. Sie versuchte, ihn wie einen Künstler zu erziehen, aus ihm sollte etwas Besonderes werden. Wie sehr ihr daran lag, zeigt der Umstand, dass sie in weiser Voraussicht die bildkünstlerischen Dokumente des Knaben und des Jugendlichen aufbewahrte und nach seinem Tod an den Verlag weitergab, in »tiefinnige[r] Mutterliebe«9.
1882 wurde René in die Volksschule der Piaristen in der Herrengasse eingeschult: eine teure katholische Privatschule, die das Ehepaar Rilke finanziell beanspruchte. Wenige Jahre später besuchten die Autoren Max Brod, Leo Perutz und Franz Werfel dieselbe Schule – anders als Franz Kafka, den der Vater in die günstigere deutsche Knabenvolksschule am Fleischmarkt schickte, wo er auf Schüler aus mittelständischen, oft auch jüdischen Familien traf. Rilke erhielt gute Noten, in der dritten Klasse sogar lauter Einsen, ausgenommen in Zeichnen und Gesang, wo er jeweils mit einer Zwei nach Hause ging. Das Rechnen fiel ihm in den beiden ersten Jahren schwer, aber er besserte sich. Doch versäumte er fast die Hälfte des dritten Schuljahres, offenbar wegen wiederkehrender Krankheiten.
Begehrte der junge René gegen elterliche Erziehungsmaßnahmen auf, schlug der Vater ihn auf den Po. Die Mutter hingegen gab ihm Eau de Cologne auf das geschlagene Hinterteil,10 fürsorglich, könnte man sagen. Rilke beschrieb seine Prager Kindheit zweigeteilt: als Gehen in »dumpfkalten Gassen« einerseits,11 in die kaum je die Sonne drang, als Zeit der »ärgsten Verzärtelung« andererseits.12
1886 wurde Rilke in die Militär-Unterrealschule St.Pölten geschickt: einen langgestreckten Kasernenbau, in dem amtierende Unteroffiziere und Offiziere den Nachwuchs zu Höchstleistungen anspornten. Ab vier Uhr früh standen Turnen, Fechten, lange Märsche und Baden im Freien auf dem Stundenplan. Rilke galt als strebsamer, guter und gutmütiger Schüler, aber »das raue Treiben« der Militäranstalt, »wo über das kaum bewußt gewordene Sehnen nach Liebe eine eisige, wilde Pflicht wie ein Wintersturm hinwütet[e]«13, setzte ihm zu. Die Militärschulzeit griff ihn existenziell an.
René Rilke vermisste seine Mutter. Diese aber reiste selbstbestimmt durch Europa, manche sagten: allein, andere meinten, sie sei an der Seite eines »geistreichen Freundes« unterwegs gewesen.14 Ihr Sohn suchte Halt in der Lektüre und zitierte aus der Deutschen Zeitung, die ihm ein Lehrer gegeben hatte: »Ein Kind kennt außer seiner Mutter keinen Schutz auf Erden und keine Macht«, Verse aus Friedrich Rückerts Poem Der Erwachsene von 1837.15 Gerade 14Jahre geworden, klagte Rilke erstaunlich vehement: »Ich fühle in meinem Innern, dass ich zum Soldat nicht tauge.«16 Die Mutter, seine Trösterin, sollte den Abtrünnigen unterstützen. Mit gewaltigen Bildern, dem Verweis auf die Naturmacht des emotionalen Vulkans in seinem Inneren, der »fix wie der unterirdische Feuerherd des Ätna einmal seine Lavamassen der Außenwelt nachwirft«17, malte er sein Leiden aus und diagnostizierte Zeitverschwendung. Die Überforderung durch den militärischen Drill verfolgte ihn Tag und Nacht: »Beim Turnen, kurz bei allem fühle ich ich bin zu solchen Sachen nicht geboren, und Stunden die ich bei einem Turngeräth stehend, nichts thuend, verbringen musste, hätte ich können für Wissenschaft verwenden.«18
In seiner Erzählung Die Turnstunde von 1902, die oft als rein biographisches Dokument missverstanden wurde, steigert Rilke die eigenen Fluchtreflexe angesichts des Drills ins Groteske, Surreale: Militärschüler Karl Gruber klettert bis zur Decke des Turnsaals, immer weiter, als wolle er in den Himmel fliehen – und stirbt auf der Flucht, der Suche nach Höherem und Anderem. Wie Rilke, aber in literarisch gesteigerter Form.
Offiziere der Anstalt rieten ihm, aus der Schule auszutreten, behauptete Rilke, er fühlte sich »verspottet und verhöhnt«19, stilisierte sich zur Reinkarnation von Jesus Christus. In einer schlaflosen Nacht träumte er, dass ein Engel vom Himmel stieg und den Jungen »durch golden blühende Auen« führte, bis er an einer Tafel ankam, auf der »in goldenen Initialen« wegweisende Verse standen: »Verlass die Anstalt wo du jetzt verweilst / Dir blüht kein Glück auf diesem Lebenspfad / Zum rauhen Kriegshandwerk bist du nicht gebohren – / Ein andres Los ist noch für dich bestimmt!«20 Rilke wollte die Militärschule verlassen, und zu diesem Zweck zog der sprachlich gewiefte Knabe rhetorisch alle Register, etwa, indem er diese Traumallegorie entwarf. Beamter könne er werden, in der Rechnungsbranche, schlug er vor, stellte der Mutter also eine plausible und einträgliche Alternative zum Militärdienst vor; er hoffte auf eine schnelle Entscheidung in seinem Sinne. »Die Brust ist wieder frei, der Geist ist hell, Nacht muß es sein, wo Friedlands Sterne strahlen«21, verkündete Rilke pathetisch mit SchillersWallenstein. Doch die Mutter verständigte sich mit dem Vater, und die Eltern reagierten anders als erhofft: Ihr Sohn blieb in St.Pölten.
Angesichts der elterlichen Härte versuchte Rilke, sich an Schillers Balladen aufzurichten, am Ring des Polykrates und dem wenig später entstandenen Lied von der Glocke, die der Deutschlehrer Oberleutnant Cäsar von Sedlakowitz mit den Eleven durchnahm. Den Schulstoff ergänzte Rilke um eigene Verse, die er dem Deutschlehrer zu Beginn der Stunde mit der Bitte überreichte, sie vortragen zu dürfen.22 Der Lehrer folgte dem Wunsch des Schülers, und der durfte sich vor der Klasse selbst rezitieren – ein ungewöhnlicher Akt, bedenkt man das strenge Regime der Militärschule. St.Pölten war literarisch überraschend förderlich.
Die körperlichen Exerzitien aber überforderten Rilke, und sein Körper versagte – oder Rilke simulierte. Wiederholt musste er ins Spital, litt unter Kopfschmerzen und Husten. Im April 1890 brach Rilke aus ungeklärtem Anlass regelrecht zusammen. Er schrieb der Mutter wie in Trance, ohne Interpunktion: »Ich will nicht mehr sagen: ich bin unglücklich habe Augenschmerzen nachdem ich so viel geweint. Kann mich nicht fassen.«23 Vater und Mutter sollen sich schnell auf den Weg machen: »Ich muss jetzt reden jetzt, sonst macht mich das fortwährend Weinen wieder elend.«24
Der 14-Jährige machte sich Vorwürfe, wollte sein Versagen wiedergutmachen. Nacheinander kamen sie zu Besuch: Papa zu Ostern, Mama Anfang Mai, anlässlich ihres Geburtstages, zu dem Rilke ihr einen heiteren Brief auf Französisch und ein Geburtstagsgedicht schrieb. Aufgrund schlechter Noten in Turnen und Fechten fürchtete Rilke, nicht auf die Militär-Oberrealschule nach Mährisch Weißkirchen zu Hranice versetzt zu werden, also beim nächsten, dem wichtigsten Schritt auf dem Weg zur Offizierslaufbahn zu versagen. Er sollte und wollte es nun doch schaffen, stand im Juni täglich um 3.00 Uhr auf, gönnte sich keine Erholung, hoffte, dass Papa »etwas« für ihn tue.25 Im Juli wurde Rilke für die Tortur belohnt, auch ohne Papas Fürsprache, und er kam nach Mährisch Weißkirchen. »Ich werde das Anstaltsleben geduldig ertragen und trachten Euch Freude zu machen«26, versprach der erfolgreiche Schüler seinen Eltern.
Ein anderer schreibender Insasse, Robert Musil, wusste es besser. Er schilderte die Militär-Oberschule nicht ohne Grund als »A-Loch des Teufels«27, unhygienisch, brutal. In Musils Verwirrungen des Zöglings Törleß von 1906 verschließen die Lehrer die Augen vor den sadistischen, oft homoerotisch gefärbten Beziehungen der Jungen; sein Törleß kommt in der Anstalt nicht zurecht, flüchtet ins Mystische, wird mit einer »Anlage zum Hysteriker« diagnostiziert und zum Privatunterricht nach Hause geschickt.28 Rilke ging es ähnlich: »Eine große Anlage zu übermäßiger Frömmigkeit wuchs unter dem Einflusse des Seeleneinsamseins und dem Zwange einer verhaßten, kismetschweren Pflicht zu einer Art Wahn.«29 Er entwickelte masochistische Neigungen, sprach von »ekstatische[r] Qualfreude«: »Ich empfand die Schläge, die ich oft von meinen mutwilligen Kameraden oder groben Vorgesetzten ertrug, als Glück und lebte mich in den Gedanken eines falschen Martyriums ein.«30 Bei sich diagnostiziert der junge Rilke einen Zustand stetiger Aufgeregtheit; Erholung und Ruhe brachten nur die Stunden in der Anstaltskapelle, während er schlaflose, zugleich »traumtolle[] Nächte[]« verbrachte.31
Alle Briefe würden geöffnet, warnte Rilke seine Mutter und bat sie, nichts zu schreiben, was ihn angesichts der strikten sozialen Kontrolle der Militärschule in Schwierigkeiten bringen könnte.32 Wiederholt litt er unter starkem Fieber, Kopf- und Rückenschmerzen.33 Am 3. Juni 1891 wurde Rilke wegen »dauernder Kränklichkeit« ohne Abschlusszeugnis aus der Militär-Oberrealschule entlassen.34 Der Vater hatte seinen Austritt zuletzt doch genehmigt.
Für den 21-jährigen Rilke stellten sich die Ereignisse so dar: »Im fünften Jahr meiner Militärerziehung (dem 15. meines Lebens) erzwang ich endlich meinen Austritt [aus der Militärschule].«35 Die Eltern seien ihm seitdem »[g]anz fern« gewesen.36 Rilke inszenierte seine Entlassung später als Bruch mit den Eltern, und die Rilke-Biographik übernimmt diese Selbstaussage meistens. Doch Rilkes Emanzipationsgeschichte stimmt so nicht; vor allem die Mutter stand ihm einige Jahre noch sehr nahe.
Der entlaufene Militärschüler verhielt sich wie ausgewechselt. Er schrieb der Mutter heitere Briefe über die Prager Gesellschaft, für die sie sich besonders interessierte, und entdeckte sein Talent als Schriftsteller: »Bin ganz Literat«37, jubelte der 15-Jährige, übte die Autorenrolle ein, gewann ein Preisausschreiben der Wiener Zeitschrift Das interessante Blatt, die sein Gedicht Schleppe oder keine Schleppe abdruckte; es war sein erstes publiziertes Gedicht. Sein Literatendasein speiste sich allerdings vornehmlich aus dem Sehen und Gesehenwerden der Prager Hautevolee, deren Wohlleben er von der Villa Excelsior im industriereichen Prager Vorort Smichow aus beobachten konnte. Die Familie des Onkels wohnte dort, und sie nahm den jungen Mann über den Sommer auf. Im Familienkreis debütierte er nicht nur mit Geburtstagslyrik, sondern auch mit Boulevardjournalismus. »Montagsblatt« nannte er seine Klatschgazette, die er exklusiv für seine Mutter schrieb.38 Es handelte sich um großformatige Briefe im Stil der Regenbogenpresse, Publikationsdatum: Montag.
Das »Montagsblatt« berichtet über Prager Vergnügen wie die Operette und die Landpartien. Lokalkrimis standen im Mittelpunkt: »Mord auf dem Rossmarkt. Unheimliche Zeiten. Ohne Revolver sollte man eigentlich gar nicht ausgehen. Denn es wimmelt von Betrunkenen, Attentätern etc. etc.«39 Alles sei jetzt ein tolstoischer Roman, meinte Rilke hochtrabend. Die ganze Stadt erschien ihm – mit Hermann Sudermanns Künstlerdrama Sodoms Ende, im Sommer 1891 in Prag aufgeführt – als heiteres Sodom, das einander seine »Laren« verkauft,40 eine Vorausdeutung auf den späteren Titel Larenopfer, den Rilke seinem zweiten Gedichtband gibt. Die Prager galten ihm als skrupellos im Umgang mit der eigenen Vergangenheit, sie machten ihre Erinnerung zum Geschäft. Rilke tauschte seine Schillerlektüre gegen Die Gartenlaube, Land und Meer, An der Schönen Blauen Donau und die Illustrirte Zeitung und zeitgenössische Unterhaltungsromane ein, die er Engelhorns allgemeiner Romanbibliothek, einer populären Sammlung für unterhaltsame Literatur mit Anspruch, entnahm. Er begeisterte sich für die humoristischen Romane Alphonse Daudets, Lederstrumpf-Geschichten und Léon de Tinseaus neuen Feuilleton-Roman Versiegelte Lippen, den der leicht entflammbare Rilke als »eine Schilderung von ergreifender Wahrheit« auffasste.41 Aus der Cotta’schen Bibliothek wählte er Friedrich Rückerts1828 erschienene indische Geschichte Nal und Damajanti aus, wünschte sich Lenaus Werke, Shakespeare und Schopenhauer.
Doch die Aufsteigerfamilie Rilke wollte, dass der Sprössling praktische Kenntnisse erwarb, und schickte ihn auf die Linzer Handelsakademie, wo er – neben dem kaufmännischen Geschäft – Kalligraphie, Englisch und Französisch lernte. Trotzdem überlagerte der literarische den ökonomischen Ehrgeiz Rilkes: Zum Namensfest des Klassenvorstands hielt er eine vielbewunderte Ansprache in drei Oktav-Strophen.42 Zum sechzigsten Geburtstag überreichte Rilke dem Schuldirektor im Auftrag der Mitschüler ein Likörservice, mit Selbstgedichtetem. In der Freizeit ging er ins Theater oder zu Lesungen: Peter Rosegger, der die Bauern »in Sprache, Tonfall und Ausdrucksweise« großartig imitierte,43 sagte ihm ebenso zu wie Goethe – Hauptsache, die Literatur beschäftigte den Geist auf angenehme Weise. Bald ergänzte der junge Dichter, den das Kommerzienwesen zusehends langweilte, sein Unterhaltungsprogramm durch Ballbesuche und Liebschaften.
Wegen einer Affäre mit dem Kindermädchen Olga Blumauer, die Rilke für den Liebesurlaub in ein tristes Wiener Vorstadthotel entführte, flog er von der Handelsschule. Seiner Mutter, die in Wien lebte und deren Nähe er offenbar suchte, gestand er: »Ich habe den großen Fehler, den ich von augenblicklichen Gefühlen bewogen, begangen, bereut!«44 Seine Gefühle verteidigte Rilke aber trotzdem: »heute finde ich den damaligen Zustand meiner Empfindungen ganz natürlich«45. Dieses Feuer kann die »heiligste Flamme« sein, wie dasjenige, das die ›Priesterinnen der Vesta‹ unterhalten,46 oder es kann Unheil bringen, durch entfesselte Leidenschaften alles zerstören. Er schickte der Mutter elegische romantische Strophen nach Wien.47
Erst danach begann Rilkes Emanzipationserzählung zu greifen: »Es kam eine Zeit, da ich meine Eltern hasste, besonders meine Mutter«48. Rilke attackierte, noch nicht 18-jährig, seine »Ex-Mutter« mit harten Worten.49 Sie sollte in ein Irrenhaus geschafft werden, weil sie nur dort »ihre tollhäuslerischen Ansichten« verbreiten könne,50 ohne anderen und ihm selbst zu schaden. Valerie von David-Rhonfeld, die neue Geliebte des Sohnes,51 verdrängte die Mutter von ihrem Platz als wichtigste Vertraute und zugleich übernahm er das negative Urteil über die Mutter von der väterlichen Familie.52
»Jede Begegnung mit ihr ist eine Art Rückfall«53, diagnostizierte Rilke in einem Brief an Lou Andreas-Salomé aus dem Jahr 1904. Angeblich wirkte er noch mit Anfang dreißig beklommen, wenn er seiner Mutter begegnete;54 in dieser Zeit verfasste er Gedichte, die seine emotionale Abhängigkeit von der Mutter ausdrücken:
Ach, wehe, meine Mutter reisst mich ein.
Da hab ich Stein um Stein zu mir gelegt
und stand schon wie ein kleines Haus,
um das sich groß der Tag bewegt,
sogar allein – da kommt die Mutter,
kommt und reisst mich ein.55
Rilke stellt die Figur der Mutter als gefühllos und kalt dar: Sie gibt sich der »kalten Messe[]« hin,56 nimmt dem Kind die Blume kindlicher Liebe, während das liebesbedürftige und liebeswillige Kind hilflos zurückbleibt.57 In der dritten Duineser Elegie erscheinen die Mütter überhaupt als unfruchtbar: Die Elegie beklagt »das trockene Flußbett / einstiger Mütter«58. Im Malte Laurids Brigge stirbt die Mutter beizeiten, zurückgezogen, allein in kalten Zimmern mit ihrer Vertrauten, während der Prediger, die Ärzte, der Geheimrat und seine Assistenten Zigarre rauchen und Portwein trinken.59
Offenbar wollte Rilke sich von der übermächtigen Mutter lösen und der Geliebten gefallen, aber zugleich schrieb er Phia Rilke weiterhin so zärtlich, dass von einem Verstoßen keine Rede sein konnte. Mit den Jahren legte Rilke sein hartes Urteil über die Mütter im Allgemeinen, die eigene Mutter im Besonderen wieder ab. Er schickte ihr mindestens einmal die Woche einen Brief, kümmerte sich um ihr Wohlergehen, als sei sie sein Kind, sein Mädchen: unfertig, unglücklich, hilflos. Phia RilkesEphemeriden, Kalendersprüche, Tageblätter und Sprüche, die Rilke im Jahr 1900 mit Hilfe des Prager k.u.k. Hofbuchhändlers Gustav Neugebauer publizierte, bestätigen Rilkes Sicht. Wenn es bei Phia Rilke heißt: »Egoismus ist die Basis moderner Liebe«60 oder »Der Wert des Kusses liegt allein in seiner Glut«61, dann entstammen diese Sätze offenbar dem unmittelbaren Erleben und den Enttäuschungen, die Phia Rilke zu verarbeiten suchte. Der Sohn wollte ihr etwas Geltung in der literarischen Welt verschaffen, die sie bewunderte.
Umgekehrt steckte sie ihrem Sohn immer wieder Geld zu, wie übrigens auch die Großmutter, die ihm noch 1924 etwas schickte.62 Phia Rilke kaufte ihm Kleidung, »schöne elegante, hellrothe, oder rothgelbe Handschuhe« beispielsweise.63 Rilke trug mit Vorliebe hauchdünne Handschuhe und Taschentücher, in die seine Mutter sein Monogramm hineingestickt hatte, und beides schickte er ihr regelmäßig zum Waschen: ein Ritual der körperlichen Verbundenheit und Schutzsuche.64 In Muzot stiftete sie der kleinen Kapelle in der Nähe des ›Schlosses‹ eine Lampe und ein Bild der Muttergottes, obwohl sich ihr Sohn bereits in der Militärschule »nach bangen, langen Kämpfen« von seiner »heftige[n] katholische[n] Kinder-Frömmigkeit« abgewandt hatte;65 er bevorzugte eine eigene Kunstreligion aus buddhistischen Glaubensfragmenten, dem ägyptischen Totenkult, dem Islam und dem Christentum.66
Im Dezember 1923, drei Jahre vor seinem Tod, machte Rilke seiner Mutter ein Kompliment: Sie habe ihn – gemeinsam mit dem Vater – nicht zum Materiellen, sondern »zu so großer Vorfreude erzogen«, dass er ein »Rühmer« geworden sei.67 Wie es in den Sonetten an Orpheus wohl nahezu autobiographisch heißt: »Rühmen, das ists! Ein zum Rühmen Bestellter, / ging er hervor wie das Erz aus des Steins / Schweigen.«68 Mit Rühmen meint Rilke das Lob des Daseins, der Welt, das Preisen ihrer schönen Seiten, ohne die schwierigen zu verschweigen; anders als Adorno später meinte, ging es nicht bloß ums Verklären einer an sich verstörenden Wirklichkeit. Vielmehr hatte Rilke sich das Rühmen ertrotzt, als eigene Ausdrucksform gegen die Widrigkeiten der Außenwelt. Sprachkritik, wie sie die Zeitgenossen entwickelten, war nur bedingt Rilkes Sache,69 seine Impulse, zu schreiben, speisten sich zwar aus dem Düsteren und Unverarbeiteten, aber dieses transzendierte er, sodass es schien, als hafte selbst dem Abscheulichsten Schönes an: als spreche sogar der stumme Stein.
Von der Mutter übernahm Rilke auch das Interesse an der ›weiten Welt‹, die Bewunderung der Kunst, den Glauben daran, dass er etwas Besonderes sei, die Willensstärke und Hoffnung auf Großes. Selbst die Rücksichtslosigkeit der Mutter, dass sie beispielsweise einfach fortging, schien Rilke nachzuahmen. Er rechtfertigte sein Verhalten jedoch, indem er höhere Wesen für sein Verschwinden verantwortlich machte. Die Fluchten aus seinen Beziehungen, sein Ablehnen von Verantwortung hätten ihre Ursache allein darin, dass er zu Besonderem – und das heißt: für die Kunst – auserwählt sei und sich ihr ganz verpflichten müsse. Er litt unter seiner Mutter, und seine Texte, in denen die Mutter als belastete und belastende Figur erscheint, spiegeln dieses Leiden, aber er hatte sich zugleich viel von ihr angeeignet und sehnte sich nach mütterlicher Liebe.
In seiner bemerkenswert modernen Erzählung Ewald Tragy von 1898, der Blaupause für die berühmteren Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, beschreibt Rilke eine »alte Schuld«70, die nicht nur seitens der eigenen Mutter abzutragen sei: »Es ist ein Schrei nach Mütterlichkeit, der weit über ein Weib hinausreicht«71. Als Kind flüchtete sich Rilke in Phantasiewelten, auch vor der Mutter. Als Erwachsener suchte er sich Ersatzmütter, bis zum Lebensende. Er begeisterte sich für Künstlerinnen, Intellektuelle, Mäzeninnen, für die Schlichtheit alter Bauersfrauen, wünschte sie sich nachträglich als Mütter, »mühefroh und mühefromm«72. Rilke konnte gar nicht genug Mütter haben, die eigene genügte ihm nicht.
Zu Rilkes »Wahlmüttern« zählten vor allem die schwedische Reformpädagogin Ellen Key, die Mäzeninnen Fürstin Marie von Thurn und Taxis und Nanny Wunderly-Volkart; auch die Verlegergattin Katharina Kippenberg, die »Herrin der Insel«73, gehörte dazu. Diese erfahrenen Frauen unterstützten Rilke, materiell, intellektuell und emotional. Key gegenüber arbeitete Rilke sein Verständnis von der Wahlverwandtschaft erstmals aus und bezeichnete sich als ihr »Sohn«: »[W]ie oft habe ich mich nach einer solchen Frau gesehnt; nach einer Mutter, die Größe, Stille und Wohlthun ist«74. Über Fürstin von Thurn und Taxis sagte er wenige Jahre später, wiederum mit der Zuneigung des Wahlsohnes: »[I]ch liebe sie sehr, sie ist viel Schutz, klug, lebensfreudig alternd, voller Erfahrung in der Freundschaft.«75
Manche Wahlmütter waren – wie Rilkes erste Liebesbeziehung, die Essayistin Lou Andreas-Salomé, und seine Frau, die Bildhauerin Clara Rilke-Westhoff – zugleich Geliebte und Musen. Einige von ihnen, darunter Andreas-Salomé und Key, waren miteinander befreundet; sie sorgten sich gemeinsam um den Ziehsohn und bildeten seine Müttergemeinde, sein persönliches und künstlerisches Schutz- und Trutzbündnis. Rilke war ein Müttersöhnchen, und die Aufgabe seiner Beschützerinnen war es, für ihn und sein Fortkommen zu sorgen, ihm neue Welten zu öffnen, lebenslang. Es scheint, als habe Rilke die Beziehung zu seiner Mutter nur unter jeweils veränderten Umständen und mit immer neuen Frauen fortgesetzt. Der Vater hingegen zeichnete ihm bereits durch seine pure Existenz ein besonderes Dasein vor.
Der Vater und sein verlorener Sohn
Aufstiegsphantasien 1887-1891
Joseph und René Rilke, 1884[4]
Rilke fühlte sich als Spross aus »dem Kärntner Ur-Adel«1. Gestützt auf die genealogischen Recherchen seines wohlhabenden Onkels Jaroslav, Rechtsanwalt, Präsident der Notariatskammer, zugleich Landesadvokat, Landtagsabgeordneter und Familienoberhaupt der Rilkes, erzählte der junge Autor vom Aufstieg und Fall der Ahnen:2 Die Familie Rilke (auch: Rylke, Rülko, Ryleke, Rulike) habe 1351 das sächsische Gut Langenau besessen, mit einem in der Kirche zu Niederlangenau dokumentierten Wappen; einer dieser Rilkes sei nach Böhmen verzogen, habe dabei sein Vermögen verloren und den Familienzweig der Prager Rilkes begründet. Der Urgroßvater sei Herr auf Kamenitz an der Linde gewesen, er habe »die alten Traditionen, […] des Geschlechtes uralten Namen« wiederbelebt, jedoch ohne bleibenden Erfolg: Der Großvater brachte es bloß zum Gutsverwalter, und Rilkes eigener Vater schaffte nicht einmal das.
Josef Rilke fügte sich scheinbar perfekt in die Knaben- und Männerwelt der k.u.k. Monarchie; wie seine Brüder sollte er Offizier werden, zeichnete sich im Fechten, Reiten, Schwimmen aus, und tatsächlich wurde er 1856 Kadettkorporal, bald danach Kadettführer, 1858 Kadettfeuerwerker, stand kurz vor dem Offiziersrang. 1859 nahm er am Feldzug gegen Italien teil, erkrankte aber an einem ungeklärten Halsleiden, das die Offizierslaufbahn verhinderte.
Durch Vermittlung des Bruders Jaroslav stellte die Turnau-Kralup-Prager Eisenbahn Josef Rilke an; bald wurde er dann Stationschef in Barkow, in der Folge Magazinvorstand und schließlich Revisor der böhmischen Nordbahn. Vergeblich bewarb er sich um den Posten des Verwalters eines Gutes der gräflich sporkschen Herrschaft Kukus (Böhmen). Erfolgreich war Vater Rilke nicht, wohl aber ein angesehener und anziehender Mann, ein Kleinbürger, der mit seinem vollen weißen Bart und gut angezogen wie ein alter österreichischer Kavalier als stadtbekannte Persönlichkeit durch Prag promenierte.
Bei Rilke klingt es hochtrabend so: »Mein Vater beginnt die Offizierslaufbahn (einer Familientradition folgend), geht aber dann zur Bahn-Carrière über. Er ist Bahn-Beamter, bekleidet bei einer Privat-Bahn einen ziemlich hohen Posten, zu dem er sich mit unendlicher Gewissenhaftigkeit hinaufgedient hat.«3 Rilke erzählt eine Aufstiegsgeschichte, so als habe der Vater die »Bahn-Carrière« aus freien Stücken gewählt. Ähnlich phantastisch ist der Adelsnachweis des Onkels, der die Nobilitierung der Familie befördern wollte; er überzeugte die Ämter aber nicht. Rilke begeisterte sich trotzdem für die Adelsfiktion der väterlichen Familie. In Paris führte er das silberne Petschaft des Großvaters wie einen alten Siegelstock mit sich; »Gut Naktendorflosser Amtsinsiegel« stand darauf, mit einem in Elfenbein geschnitzten Wappenbild.4 Auf Muzot zeichnete Rilke seinen Stammbaum, und für das Kreuz auf seinem Grab sah er das Wappen der Familie in der vom Urgroßvater geführten Form vor. Ursprünglich war es silbern und schwarz gefärbt gewesen; es zeigte zwei aufeinander zuspringende Windhunde sowie zwei gekrönte Helme mit schwarz-weißen Decken. Die Grenzen zwischen genealogischer Recherchearbeit und Hochstapelei waren bei Rilke fließend.
Brecht spottete über Rilkes »feinheit des emporkömmlings«5; Brecht wollte das Proletariat auf die Bühnen der Welt bringen, schlicht, bescheiden, zufrieden mit der eigenen sozialen Rolle, so stellte er es sich vor. Aus Brechts Sicht waren Adelsphantasien Symptome eines künstlerischen Spießbürgertums, das eigentlich anderes wollte als wahre, und das meinte aus seiner Sicht: mehr oder minder realistische Kunst. Im Fall Rilkes aber wurde aus der aristokratischen Familienphantasie ein Bestseller, der den Nerv des Publikums traf: Die Weise von Liebe und Tod des Cornet Christoph Rilke von 1906, deren erste Fassung er 1899 in Schmargendorf schrieb und für die Rilke das Kämpferleben eines Familienmitglieds aus dem 17. Jahrhundert erfand. Wohl schon in St.Pölten hatte Rilke eine Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs begonnen, von der 81 Seiten überliefert sind, ergänzt um eine Kartenskizze der Schlachtorte und eine Zeichnung: ein geborstener Turm mit der Unterschrift »Ringsum schmachten die Gefilde«6. Rilke faszinierte die Kriegserzählung; er beschrieb das elende Land, pries die Kraft und den Willen der großen Männer: Rudolf von Habsburg, Erzherzog Matthias, Maximilian von Bayern, Tilly und Wallenstein. Später stellte er seinen Cornet in dieses Schlachtfeld hinein und präsentierte die väterliche Familie als Teil der kriegerischen Soldateska.
Rilkes Beziehung zu seinem Vater war nicht ungebrochen, so zeigt der Blick in die Quellen. Er liebte seinen Vater, den er auch »Papatschi« nannte, schilderte ihn als herzlich, gütig und sorgend, obwohl dieser den Lebenswandel seines Sohnes nicht nachvollziehen konnte. Rilke begegnete ihm gleichfalls mit Sorge: »meinem Vater möchte ich viel, viel Liebe thun«7. Andreas-Salomé hingegen schätzte Rilkes Vaterbeziehung ähnlich kritisch ein wie sein Verhältnis zur Mutter: Laut ihr erschien der Vater als »der verständnislos Störende«8, der immer wieder in die innige Beziehung von Mutter und Sohn einbrach. Die Ehe sei bei seiner Geburt schon »welk«9 gewesen, notierte Rilke, die Eltern konkurrierten um ihn.
Der Vater