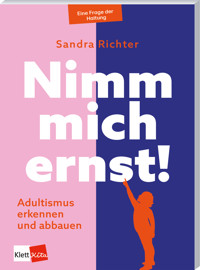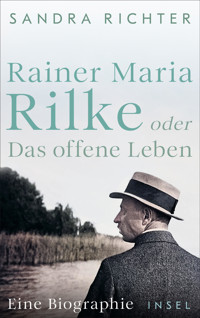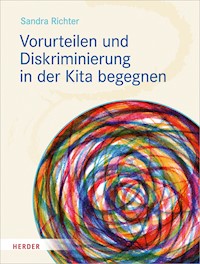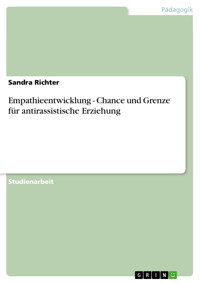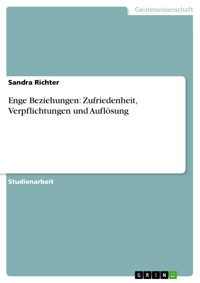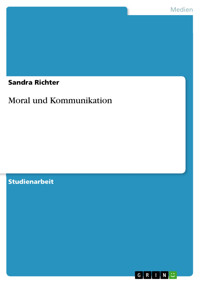Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Murmann Publishers
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Wie alt ist der Wettbewerb? Begann er mit Kain und Abel? Mit den Olympischen Spielen in der Antike? Vermutlich ist er dem Menschen seit Urzeiten innewohnend. Man denke nur an Thomas Hobbes, Spruch - Der"Mensch ist dem Mensch ein Wolf." Sandra Richter, Germanistik-Professorin in Stuttgart, beleuchtet die ganze Bedeutungsbreite des Begriffs Wettbewerb. Den perfekten Wettbewerb gibt es nicht. Richter bezieht die Werke der Weltliteratur von Grimmelshausen bis Zola, von Goethe bis Upton Sinclair und von Thomas Mann bis Wolfgang Herrndorf in ihre Überlegungen ein und verbindet die großen Denker der Ökonomie wie Locke, Marx und Schumpeter mit den Schildbürgern, Nathan dem Weisen und den Buddenbrooks. "Wir befinden uns in einem Wettbewerbsdilemma. Ganz ohne Wettbewerb geht es nicht – und nur mit ihm auch nicht." Die Grenzen des Wettbewerbs verlaufen entlang der Menschlichkeit: der Gefühle, Werte und Kulturen. Sandra Richter gelingt Einzigartiges – sie entdeckt die legendäre "unsichtbare Hand" von Adam Smith mit Hilfe der Weltliteratur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sandra Richter
Mensch und Markt
Warum wir den Wettbewerb fürchten und ihn trotzdem brauchen
Für Wolfgang
Inhalt
I. Wettbewerb: Allheilmittel und Fluch
Verteilungskämpfe und Interessenkonflikte · Konkurrenz und Kooperation · Wettbewerb literarisch
II. Wettbewerb vor der Erfindung des Wettbewerbs
Eine kurze Geschichte der ökonomischen Konkurrenz · Wettbewerb in der Literatur · Eskapismus und Durchtriebenheit · Marktdynamik und Vollkommenheitsstreben
III. Metaphorischer Wettbewerb
Naturrecht, Physiokratie und Kameralistik · Adam Smith · Goethe und Schiller · Tieck und Achim von Arnim
IV. Perfekter Wettbewerb
Eugène Sue · Freytag und Keller · Hertzkas Freiland-Utopie
V. Wettbewerbskritik und emanzipatorischer Wettbewerb
Balzac · Marx · Aston und Weerth, Raimund und Fontane · Gaskell und Dickens · Hauptmann und Kretzer · Zola
VI. Ästhetischer Wettbewerb
Schumpeter · Thomas Mann · Heinrich Mann · Von Franklin bis Dreiser · H. G. Wells · Brecht · Ludwig van Mises versus Ayn Rand
VII. Kooperativer Wettbewerb
Knight und Hayek · Arthur Miller · Martin Walser · Michael E. Porter · Adam M. Brandenburger und Barry J. Nalebuff
VIII. Komplexer Wettbewerb
Fernando Pessoa · Burkhard Spinnen und Bernd Cailloux · Adam Haslett·William Gaddis, Ernst-Wilhelm Händler und Marlene Streeruwitz · F. C. Delius, Urs Widmer und Burkhard Spinnen · »Homo sensitivus« · Ingo Niermann, Juli Zeh und die Zentrale Intelligenz Agentur
IX. Nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb. Schlusswort
Anmerkungen
Nachwort
Literaturverzeichnis
Über die Autorin
Impressum
I. Wettbewerb: Allheilmittel und Fluch
»Je mehr Wettbewerb, desto größer der Wohlstand.« Kaum eine andere Idee erlebte in der jüngsten Zeit eine so steile Karriere wie diejenige des Wettbewerbs. Sie geriet von einer ursprünglich rein ökonomischen Idee zum politischen Heilsversprechen. Begründet war die Idee des Wettbewerbs zunächst aus der anthropologischen Fiktion des »homo oeconomicus«, des rational handelnden, die eigenen Interessen frei, aus eigenem Antrieb und besonders in Konkurrenz mit anderen befördernden Wirtschaftswesens. Aus dem Heilsversprechen, das sich an den Wettbewerb knüpfte, folgte eine politische Strategie. Alle Bereiche der Gesellschaft, vom Finanzmarkt bis hin zu Schulen und Universitäten, wurden so weit als möglich dereguliert und aus der staatlichen Fürsorge entlassen. Die Bürokratie galt als ineffizient, langsam, unflexibel. Der effizienten, schnellen, flexiblen wettbewerblichen Selbstorganisation, »Markt« genannt, gehörte die Zukunft.
Diese Euphorie für den Wettbewerb ist mittlerweile verflogen, nicht nur durch die lang anhaltenden Wirtschaftskrisen der vergangenen Jahre, sondern auch durch ökonomische, ökologische, soziale und kulturelle Schreckensszenarien, die den Ruf nach mehr Regulierungen und Codices, nach Werten und staatlich vorgegebenen Regeln laut werden lassen. Die Effizienz des Wettbewerbs erscheint nur mehr als »Kaputtsparen«, die schnelle und flexible Selbstorganisation als Fehlinvestition in kurzfristig billige Lösungen. Viele Menschen sehen im Vertrauen auf die Regelungskräfte des Marktes die Ideologie der »Ellenbogengesellschaft«.1 Das Heilsversprechen ist zum Fluch geworden. Mit ihm steht auch sein zentraler Akteur, der »homo oeconomicus«, am Pranger. Zwischen der anthropologischen Fiktion und der Wirklichkeit klafft, so bemerkt man jetzt, der Abgrund des Menschlichen und allzu Menschlichen, der Gefühle, Leidenschaften und Interessen.
Bei der derzeit oft geübten Wettbewerbskritik handelt es sich aber um eine ebenso riskante mentale Spekulation wie bei der Wettbewerbseuphorie.2 Wettbewerbskritik vertraut häufig auf den Staat, der es richten soll. Sie hegt Skepsis, was das freiheitliche Spiel der Kräfte auf dem Meinungsmarkt betrifft, und hofft auf staatlich administrierte Gerechtigkeit.3 Diese aber wird im politischen Interessengeflecht nur selten zufriedenstellend eingelöst. Andere Kritiker des Wettbewerbs setzen deshalb auf die partizipatorische Demokratie. Sie fordert den Wettbewerb der Meinungen, führt aber ebenfalls nicht notwendigerweise zu mehr ökonomischer Gerechtigkeit – wobei die Frage, was das eigentlich genau ist, noch zu erörtern wäre.
Wir richten uns zwischen Wettbewerbseuphorie und -kritik so »gemütlich« ein wie zwischen Skylla und Charybdis – die allzu große Nähe zu einer der beiden Sirenen bringt den Tod. Es gilt, den Zustand des gesellschaftlichen Gleichgewichts immer wieder neu zu definieren. Denn beide Denkschemata stoßen an ihre Grenzen, wenn Freiheits- und Gerechtigkeitsbedürfnisse gleichermaßen erfüllt werden sollen. Wir befinden uns in einem Wettbewerbsdilemma, das durch ideologische, affektiv belastete Neigungen zu der einen oder anderen Seite bestimmt wird. Doch: Ganz ohne Wettbewerb geht es nicht – und mit ständigem Wettbewerb auch nicht. Wettbewerb ermöglicht sozialen Aufstieg, zugleich aber führt er häufig zum Abstieg derer, denen es – bedingt durch gesellschaftliche Vorkehrungen, Privilegien, über lange Zeit erwirtschaftetes Vermögen und erreichte Positionen – gut ging.
In diesem Buch werden die Geltungsgründe von Wettbewerbseuphorie und -kritik historisch ausgelotet, um das Wettbewerbsdilemma zu beschreiben, zu analysieren und ein neues, anspruchsvolles, komplexes Verständnis von Wettbewerb vorzulegen. Für den Wettbewerb sprechen nämlich erstens sozioökonomische Erkenntnisse: Wettbewerb gilt als effizienteste Form der Motivation und der Ressourcenallokation. Zweitens kennzeichnet Wettbewerb eine Verlaufsform, die nichtteleologisch und nichtmetaphysisch angelegt ist. Damit bietet er drittens eine Fülle von Projektionsmöglichkeiten: Im Grunde lässt sich jede Entwicklung mit dem Begriff des Wettbewerbs beschreiben. Wettbewerb wäre danach in einem idealen Sinne Wettbewerb, wenn er sich selbst genügt, kein Ziel außerhalb seiner selbst verfolgt, im freien Spiel Kräfte weckt, diese aber nicht durch dirigistische Vorhaben lenkt. In Anbetracht einer multipolaren Welt, die kaum gemeinsame Werte und Ziele kennt, erweisen sich diese Projektionsoffenheit und Selbstbezüglichkeit des Begriffs viertens als pragmatisch. Aufgrund seiner pragmatischen Anlage stellt Wettbewerb gegenwärtig möglicherweise die einzig akzeptierte Form globaler Interaktion und Kommunikation dar: Das Plädoyer für universelle Werte wird als Zumutung, als westlicher Kulturimperialismus empfunden. Aber darauf, dass die Staaten, Regionen, politische, kulturelle oder gesellschaftliche Systeme weltweit miteinander wetteifern, kann man sich verständigen. Gegenwärtig scheint es, als lebten wir unter Bedingungen sich verschärfenden globalen Wettbewerbs, als rückten die Erdteile näher zusammen, als sei die Welt plötzlich »flach« geworden – jedem zugänglich, für alle verfügbar, offen für die Konkurrenz eines jeden Menschen mit allen anderen.4 Wettbewerbseuphoriker knüpfen an dieses Szenario die Hoffnung, dass jeder Erdenbürger einmal im Wettbewerb die Chance haben wird, ihn für sich zu entscheiden. Wettbewerbskritiker hingegen klagen darüber, dass Wohlstand durch Wettbewerb bloß in der Form kommunizierender Röhren von bestimmten Akteuren auf andere verteilt wird.
Der Global Competitiveness Report dokumentiert Aufstieg und Fall im globalen Wettbewerb. Er untersucht Länder im Blick auf Kriterien wie Infrastruktur, funktionierenden ökonomischen Wettbewerb, Wettbewerbspolitik und makroökonomisches Umfeld (Lohnstückkosten usf.). In den Jahren 2011/12 fiel Deutschland auf Platz fünf in der Rangfolge der wettbewerbsfähigsten Länder hinter die Schweiz, Singapur, Schweden, Finnland und die USA zurück.5 Danach ist Deutschland derzeit noch eines der bestbewerteten Länder der Europäischen Union, aber vor allem der als starr wahrgenommene Arbeitsmarkt gefährdet diese Position. Kündigungsschutz und komplexe Prozesse der Lohnfindung entsprechen nicht den Vorstellungen der Juroren. Der Wettbewerbsbegriff des Report ist auf eine stetige Flexibilisierung und Beschleunigung der Marktordnung angelegt und bemisst diese unter Gesichtspunkten wie Effizienz und Wettbewerbsfreiheit.
Der so verstandene Wettbewerb verschweigt seine Bedingungen und Folgekosten. Hier greift die Kritik an ihm: Wettbewerb kann seine eigenen Voraussetzungen nicht garantieren und seine Folgen nicht abschätzen. Zu konkurrieren vermag erstens nur, wer sich das Eintrittsticket für den jeweiligen Wettbewerb leisten kann – wer etwas von den Gütern oder Eigenschaften mitbringt, um die es im Wettbewerb geht. Wettbewerb ist also kein bloß neutrales, sondern auch ein normatives Konzept. Wer Wettbewerb fordert, setzt voraus, dass es eine Bringschuld seiner Teilnehmer gibt und dass Wettbewerb solche Schuld in bester Weise einzufordern und zu verteilen weiß. Zweitens aber greift der Wettbewerb die Grundlagen an, auf denen jene Güter oder Eigenschaften entstehen, die ihn selbst erst ermöglichen. Denn im Wettbewerb geht es um gesteigerte Dynamik – zuungunsten der etablierten Werte, Handlungsformen und Gesellschaftsordnungen. Dies kann – wiederum normativ – gewollt oder ungewollt sein, etwa um Effizienz zu steigern oder verkrustete Strukturen zu sprengen, Handlungsfreiheit zu ermöglichen und Wettbewerbsvorteile zu erwirtschaften. Drittens erweist sich Wettbewerb damit auch in seiner Verlaufsform und seinem Ergebnis als strukturell parteilich: Er schlägt zugunsten des Stärkeren, Effizienteren, besser Verkäuflichen aus. Diese Janusköpfigkeit des Wettbewerbs hat viertens Verteilungskämpfe und Interessenkonflikte hervorgerufen: Eine Partei fordert mehr, eine andere weniger Wettbewerb – abhängig davon, wo sie sich auf der Skala der Wettbewerbsfähigkeit positioniert.
Dieser Konflikt ist bezeichnend für etwas, wovon man nur vage Begriffe hat. Wettbewerb aber ist nicht gleich Wettbewerb. Er fällt nicht vom Himmel, ist nicht oder jedenfalls nicht nur etwas Naturgegebenes, sondern mindestens in der Art und Weise seines Erscheinens und seiner kulturellen Akzeptanz ein vielschichtiges Konstrukt. Seine Geschichte reicht vom griechischen »ἀgón« (Kampf, Wettstreit, besonders der sportliche Wettstreit der Olympiaden) über den Sängerwettstreit des Mittelalters bis hin zu ökonomischen Wettbewerbskonzepten, wie sie systematisch seit dem 19. Jahrhundert entstehen.6 In seiner Bedeutungsbreite wird der Begriff des Wettbewerbs positiv und kritisch, normativ und analytisch, enthusiastisch und parodistisch gebraucht. Häufig denkt man auch einen Gegenbegriff für Wettbewerb oder zumindest einen korrigierenden Begriff mit. So lehrt die hohe Schule des Wettbewerbsdenkens, die Ökonomietheorie, verblüffenderweise: Reinen Wettbewerb gibt es nicht. Wettbewerb ruft sein Gegenteil hervor – Zielabsprachen, Wertorientierungen, Kartelle, Monopole. Aus dieser Problemdiagnose lässt sich eine wichtige Sichtweise auf das Wettbewerbsdilemma entwickeln: Es handelt sich um ein Interaktionsmuster, in dem nicht beabsichtigte Folgen von Handlungen und Regulierungen eine große Rolle spielen. Wettbewerb erscheint als eine eigentümlich abstrakte Verbindung von Konkurrenz und Kooperation, von Wertfreiheit und Wertorientierung, Regellosigkeit und Regelhaftigkeit, Freiheit und Ordnung, autonomer Tätigkeit und Steuerung, Unsicherheit und Sicherheit. Der ideologische Grabenkampf zwischen diesen Extremen ist zwar nicht überflüssig, aber wenig erhellend, sofern er ausschließlich polemisch ausgetragen wird.
Wer einen anspruchsvollen Begriff vom Wettbewerb entwickeln will, über den zu streiten lohnt, muss nach den historischen und kulturellen Kontexten eines auch in sein Gegenteil schillernden Wettbewerbs fahnden. Dieser Suchauftrag lenkt die Aufmerksamkeit auf die Semantiken, Geschichten und Rhetoriken, die unsere Bilder vom Wettbewerb prägen. Im Folgenden wird dieser Suchauftrag in essayistischer Form und ohne Anspruch auf Vollständigkeit umgesetzt. Aktuelle wissenschaftliche Überlegungen helfen dabei – wie die Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte, die sich mit ökonomischen Semantiken befasst,7 die Verhaltensökonomie, die in Storys, Mentalitäten und Affekten wichtige Antriebskräfte der Ökonomie erblickt,8 oder auch der »New Economic Criticism«, der sich den Darstellungsformen des Ökonomischen widmet.9
Verteilungskämpfe und Interessenkonflikte
»Der Markt ist die hohe Schule der Selbstverantwortlichkeit«, notierte der Philosoph Wolfgang Kersting.10 Damit ist gesagt, was es bislang so schwierig machte, einen solchen komplexen und analytischen Begriff vom Wettbewerb zu entwickeln und zu vertreten. Ökonomische Selbstverantwortlichkeit setzt mündige, risikobereite, ausdrucksfähige, vernünftige, moralische Bürger voraus, die im Zweifel gegen die eigenen Interessen denken und handeln müssen – keine »homines oeconomici«, sondern couragierte Wirtschaftsbürger, die »economic citizens«. Ein solch couragiertes Denken und Handeln ist so anspruchsvoll wie die ideale Kommunikationssituation, die Jürgen Habermas beschwor, um Bedingungen für einen »herrschaftsfreien Diskurs« aufzuzeigen.11
Eine derart anthropologisch umfassend anzulegende Kommunikation über Wettbewerb lässt sich nur schwer in ein ökonomisches oder philosophisches Schema pressen. Dieses Buch will deshalb einen anderen Weg einschlagen. Es will Stärken und Schwächen wettbewerblicher Konstellationen vor allem am Beispiel literarischer Texte ausloten und von dort mit systematisierendem Anspruch auf Ökonomie und Ethik blicken. Damit nimmt es Gedanken der bekannten Ökonomen George A. Akerlof und Robert J. Shiller auf. Sie meinen, dass Geschichten wichtige Informationen für die Wirtschaft enthalten:12 Informationen über die Motivationen, Aktionen und Reaktionen von Menschen in bestimmten ökonomischen Situationen. Gute Geschichten können für Vertrauen in eine Marke, eine Firma, ja ein ganzes ökonomisches System sorgen; schlechte Geschichten können Misstrauen hervorrufen und das Ende für ein Unternehmen, vielleicht sogar für ein ökonomisches System bedeuten.
Literarische Texte enthalten besondere Arten von Geschichten. Sie zeigen, wie Menschen als literarische Figuren in Markt und Wettbewerb hineingeraten und sich darin verhalten. Autoren haben Figuren geschaffen, um ihre Auffassung von Wirklichkeitssystemen durch sie zu thematisieren. Literarische Texte veranschaulichen Verhalten, Koalitionen und Handlungsmuster, Zu- und Abneigungen, individuelle Fähigkeiten und Unfähigkeiten, Scherz und Ernst im Verteilungskampf. Sie bringen drängende Fragen der jeweiligen Gegenwart auf den Punkt – mit einem Geltungsanspruch, der über das jeweils Aktuelle hinausgeht, indem sie nach den typischen Merkmalen von Wettbewerbssituationen fragen und in ein Gespräch mit Texten eintreten, die sich ähnlichen Herausforderungen stellen. Solche Texte zeigen, dass Wettbewerb überall sein kann: am Beginn von Menschheit und Kultur, im Überlebenskampf eines mittelständischen Unternehmens und im Alltag von Arbeitnehmern wie Arbeitsuchenden. Zugleich aber versuchen sie, über den alltäglichen Konkurrenzkampf hinauszugehen, indem sie nach den Grenzen von Wettbewerb, nach Alternativen oder zumindest nach einem Gebiet fahnden, das durch Wettbewerb nicht ohne weiteres erschließbar ist.
Die literarische Einsicht in die Allgegenwärtigkeit des Wettbewerbs hilft auch, die Gefahr der Klientelessayistik zu umgehen, wie sie in der »Sloterdijk-Debatte« aus dem Jahr 2009 auffiel.13 Peter Sloterdijk hatte auf eine Verschiebung von Semantiken und Praktiken des Gebens und Nehmens hingewiesen, das Steuersystem der Bundesrepublik harsch als »Staats-Kleptokratie« kritisiert und sich als Anwalt der Leistungsträger vorgestellt.14 Der kritische Theoretiker Axel Honneth hingegen trat als Anwalt der Schwachen auf und bezeichnete den »Kampf gegen soziale Diskriminierung und ökonomische Benachteiligung« unter Bezug auf das umstrittene Sozialstaatspostulat des Grundgesetzes als rechtsstaatlich notwendig.15 Dieser Schlagabtausch zeigt, wie ideologisch besetzt ökonomische Fragen sind. Eine intellektuelle Arena, auf der sie fair ausgetragen werden könnten, fehlt. Aus der Wahrnehmung dieses Mangels entstehen zunehmend neue Beiträge, um ihn zu beheben: Wie Sloterdijk probt der Medien- und Kommunikationswissenschaftler Norbert Bolz die antiegalitaristische Polemik und kritisiert die sozialromantische Kapitalismuskritik.16 Erklärte Linke wie der psychoanalytisch orientierte Pop-Philosoph Slavoj Žižek, der ehemalige Rote-Brigaden-Sympathisant Antonio Negri und der Marxist Alain Badiou hingegen unterhalten ihr Publikum mit Thesen über den Verfall des Spätkapitalismus. Dieses Buch sucht Gesprächspartner in diesen unterschiedlichen Fraktionen, um die bekannten Frontstellungen abzubauen.
Konkurrenz und Kooperation: Seiten derselben Medaille
Einen wesentlichen Grund für solche Frontstellungen erblickt dieses Buch in einem unterbestimmten Wettbewerbsbegriff. Philosophie, Ethik, Ideen- und Kulturgeschichte nämlich haben sich dem Phänomen des ökonomischen Wettbewerbs kaum gewidmet. In philosophischen Enzyklopädien wie Routledge’sPhilosophical Dictionary sucht man vergeblich nach einem Lemma »Wettbewerb« oder »Competition«. Der Begriff scheint dem Reich des Bösen und Unphilosophischen zuzugehören. Gleiches gilt für die historische Semantik: Die Geschichtlichen Grundbegriffe und die daran anknüpfenden begriffshistorischen Publikationen von Mark Bevir, Rolf Reichardt, Hans-Jürgen Lüsebrink, Terence Ball und Richard Dagger ignorieren den Begriff.17
Das Historische Wörterbuch der Philosophie und die Encyclopédie philosophique universelle identifizieren »Wettbewerb« mit »Konkurrenz«.18 Dies ist zwar nicht falsch, aber undifferenziert. Etymologische Wörterbücher lehren, dass sich unter dem Lemma »Wettbewerb« nicht nur Begriffs-, sondern auch Metapherngeschichten, also komplexe Semantiken, verbergen. Ein ahistorischer Vergleich des Oxford English Dictionary und des Deutschen Wörterbuchs der Brüder Grimm lenkt die Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Traditionen, was die Wörter »Competition« respektive »Wettbewerb« betrifft: Das Oxford English Dictionary hebt den Ursprung von »Competition« aus dem lateinischen Verb »competere« (»gemeinsam nach etwas streben«) hervor. Infolgedessen bedeutet »Competition« relativ neutral: »die Handlung, um zu erreichen, was ein anderer auch gewinnen will; das Streben von zweien oder mehreren nach demselben Objekt«.19 Diese Definition erklärt Wettbewerb als Rivalität. Es handelt sich um eine zweifache Beziehung: Erstens konkurrieren mindestens zwei Parteien und zweitens um dasselbe Objekt.
Grimms Wörterbuch hingegen betrachtet »Wettbewerb« als Schlüsselbegriff des ausgehenden 18. ebenso wie des 19. Jahrhunderts: als Schlüsselbegriff des Liberalismus, der Ökonomie (»freier Wettbewerb«), Politik (»Rivalität der Nationen«), Kultur, Kunst (»Dichterwettstreit«, »Wettstreit der Künste«) und Biologie (»survival of the fittest«).20 Diese liberale Ideologie ruht zwar auf einem humanistischen, genauer: neuhumanistischen Wertekanon, aber dieser Wertekanon gerät im Zuge der Betonung von »mehr Wettbewerb« immer weiter ins Hintertreffen. Wettbewerb wird zum Kernbestand einer nicht-, vielleicht sogar antihumanistischen Ideologie. Möglicherweise liegt im Auseinanderdriften von Wettbewerb und Werten der tiefere Grund für die ideengeschichtliche Blindheit, was den Wettbewerb betrifft: Für den begrifflichen Kanon, den Ideengeschichte, historische Semantik und ihre Nachfolger vorstellen wollen, kommt der Wettbewerb nicht in Frage. Er entzieht sich der humanistischen Wertprämisse, wie sie die Ideengeschichte noch heute häufig anleitet.
Doch knüpften sich, angeleitet durch Jakob Burckhardts Antike-Deutungen, große Hoffnungen an den Begriff des »ἀgón«: Burckhardt nämlich betrachtete die hellenistische Antike prinzipiell als kompetitiv. Ihre Ethik des Wettbewerbs, der individuelle Versuch, sich dem Ideal der »Schöngutheit« (»kalokagathía«) anzunähern, erschien ihm als Wiege moderner Individualität.21 Friedrich Nietzsche hingegen konzentrierte sich auf die Epoche vor Homer und sprach vom göttlichen Neid der Griechen, der sie zum Wettbewerb antrieb. Aktuelle Rückgriffe auf diese Sichtweisen sind unterschiedlicher Art: Vermittelt über Norbert Elias etablierte sich »Konkurrenz« als kontroverses Interpretament der Geschichtswissenschaft.22 Anknüpfend an Hannah Arendt untersuchten Theoretiker wie Seyla Benhabib, Jean-François Lyotard, Bonnie Honig und William E. Connolly die demokratietheoretischen Dimensionen von »Agonalität«, verstanden als Austragungsform kultureller Differenz.23
Geht man konsequent auf den lateinischen Ursprung zurück, so lässt sich das Metaphern- und Begriffsfeld von »Wettbewerb« weiter entfalten und schärfer konturieren: Das Nomen »competitio« zum Verb »competere« entstammt der gerichtlichen Sphäre. Gemeint sind eine gerichtliche Forderung, ein Anspruch und auch eine Mitbewerbung, eine in irgendeiner Form geregelte Interaktion, die einen strittigen Gegenstand zum Ziel hat. Das Verb »concurrere« hingegen zielt auf Kampf und Verteidigung, auf konfliktreiche Konstellationen. Es meint »zusammenlaufen« (etwa um, wie bei Cäsar, nach den Waffen zu greifen und vereint zu streiten), aber auch »feindlich zusammenstoßen«, einander anzugreifen – ohne bestimmtes Objekt, sondern vielmehr mit dem Ziel, den jeweils anderen zu besiegen. Das Substantiv »concursus« (Zusammenlaufen vs. Zusammentreffen, Angriff) spiegelt diese doppelt gelagerte Bestimmung. Wettbewerb meint danach also regelgeleitetes, Konkurrenz aber bloß regelloses Streben. Ein so verstandener Begriff des Wettbewerbs erweist sich, gleich wo er auftaucht, als juristisches Erbe; die Frage nach seiner Regelung trägt der Wettbewerb damit gewissermaßen in sich.
Die Etymologie des Wettbewerbs belegt also ein vergleichsweise klares Verständnis von Wettbewerb: Er beschreibt das regelgeleitete Streben von mindestens zwei Parteien um dasselbe Objekt. Zugespitzt formuliert: »Fairer Wettbewerb« steht gegen »erbitterte Konkurrenz«.24 Eine Kulturgeschichte des Wettbewerbs könnte dem engen Wettbewerbsbegriff des Oxford English Dictionary nachspüren oder – wie die Brüder Grimm – versuchen, möglichst diverse wettbewerbliche Interaktionsformen sowie Varianten des Begriffs und seiner Metaphern zu ermitteln. Angeregt durch den grimmschen Ansatz, geht es hier um den ökonomischen Wettbewerb in seinen kulturellen Kontexten, um sein Verständnis in Literatur, Essayistik und Ökonomie. Ökonomische Spezialprobleme werden nicht diskutiert; vielmehr stehen Wettbewerbsgeschichten im Vordergrund: Geschichten über den Menschen im Wettbewerb, über Gefühl und Verstand, Milieus, Stile und Darstellungsformen, mitunter auch über Institutionen und Lernprozesse – Facetten des Wettbewerbs, die eine ausschließlich zahlen- und faktenorientierte Wirtschaftswissenschaft nicht ausreichend berücksichtigt.25
Wettbewerb literarisch
Die Erzählung setzt mit dem Wettbewerb vor seiner eigentlichen Erfindung ein. Denn Verhaltensmuster und Mentalitäten, die heute mit dem Begriff des Wettbewerbs erfasst werden, haben sich über Jahrhunderte eingespielt, verfestigt und weiterentwickelt. Noch im 17. Jahrhundert scheint es, als lasse das Fehlen von Institutionen und Regeln Wettbewerb nicht zu: Im Dreißigjährigen Krieg kämpfte man ums Überleben. Aus der Notlage heraus bemühten sich lokale Obrigkeiten um Regularien, die den Überlebenskampf, das wechselseitige Belügen und Betrügen, Kampf und Krieg, ja Konkurrenz überhaupt stillstellen und die alte ständische Ordnung stabilisieren sollten. Die Durchsetzung solcher Regularien ist zwar umstritten; allein ihre Verfertigung und öffentliche Inszenierung sorgten im Geflecht der Normgeber, Normvermittler und Normadressaten aber für Aufmerksamkeit.26 Diese Aufmerksamkeit konnte in mehrere Richtungen ausschlagen: Regulierungen konnten Wettbewerb abschaffen, indem sie etwa Preise festsetzten; sie konnten aber Wettbewerb auch überhaupt erst ermöglichen, indem sie ihm einen Rahmen gaben, etwa unterschiedliche Preise für bestimmte Regionen vorsahen und damit einen Standortwettbewerb in Gang setzten. So betrachtet, war die Erfindung des Wettbewerbs aus seiner vordergründigen Ablehnung heraus eine wichtige zivilisatorische Leistung. Mit allzu schlichten Erwägungen vom Ursprung der Neuzeit, des Individuums, des Staates und Marktes aus der Konkurrenz lässt sie sich nur unzureichend verstehen.
Im 18. Jahrhundert wurde deutlich, wie aus den Wechselbeziehungen von alter und neuer Zeit, von christlichem, neostoischem und idealisierendem Weltbild nach und nach die Überzeugung entstand, es könne und dürfe auf Märkten auch wenig regulierte Interaktion geben. Erst im 19. Jahrhundert aber wurde der Begriff des Wettbewerbs so recht theoretisiert. Zugleich kritisierten Pamphletistik und Sozialtheorie den real existierenden Wettbewerb. Denk- und Darstellungsmuster wie diese hallten im 20. Jahrhundert nach, wurden verfeinert, zugespitzt – und doch blieb und bleibt es bei einem stark ideologisch besetzten Begriff des Wettbewerbs.
In der Literatur sah Wettbewerb über die Jahrhunderte vergleichsweise vielgestaltig aus. Sie entwickelte Parallelgeschichten, mitunter auch wechselseitige Bezüge zum real existierenden, theoretisch, empirisch oder essayistisch bedachten Begriff des Wettbewerbs. Auf der einen Seite des Wettbewerbs kennt die Literatur eine dualistische Ästhetik der glatten Oberfläche, der schwarz-weißen Storys, der Gewinner und Verlierer, der linearen Erfolgsgeschichten aus Bestsellern und Hollywood-Filmen. Auf der anderen Seite stehen mehr oder minder kritische Darstellungen von Wettbewerb. Sie brechen mit allzu schematischen Darstellungen von Gut und Böse. Häufig folgen sie dem Erzählschema des Glücksrades: »Was aufsteigt, muss absteigen«.
Darüber hinaus erlaubt Literatur, wettbewerbliche Situationen zu personalisieren: Siegertypen zeichnet sie ebenso wie Verlierer, Helden ebenso wie Antihelden. Über die Jahrhunderte hinweg verband die Literatur diese wettbewerblichen Positionen mit unterschiedlichen Berufen, schilderte ihren Aufstieg und Fall: Der Handwerker beispielsweise zählte zu den Hauptfiguren der europäischen Romantik. Doch schon bald darauf (im Realismus) gab er seine privilegierte Position an den Kaufmann ab. Er wurde zum neuen Marktgewinner.
Vergleichbare Entwicklungen gelten für die unterschiedlichen literarischen Gattungen: Märchen schließen den ökonomischen Wettbewerb zumeist aus. Andere literarische Texte, Kaufmannsromane, »from-rags-to-riches-novels«, Angestellten- und Industrieromane konzentrieren sich auf den Wettbewerb und sein Umfeld; in der Regel zeigen sie, dass Wettbewerbserfolg zu erheblichen sozialen und ethischen Kosten geht. Anders als diese Genres preisen kapitalistische Utopien (etwa von Ayn Rand) Wettbewerb als beste ökonomische, soziale und ethische Ordnung, und wieder andere – Unternehmergeschichten und die populären Finanzkrimis (Joseph Finder, Stephen Frey, Michael Ridpath) – zeichnen wettbewerbliche Umwelten, stellen den Wettbewerb selbst aber nicht in Frage. Romane, Novellen und Kurzgeschichten legen prototypische Wettbewerbserzählungen über die Protagonisten, Mentalitäten, typischen Abläufe und Umgebungen des Wettbewerbs vor. Das Drama entwirft Konstellationen von Betrug und Gegenbetrug27; auch in der Lyrik findet sich das Motiv vom Wettbewerb auf dem Markt.
Das scheinbar so globale Wettbewerbsthema polarisiert die Literatur. Die jeweiligen Nationalliteraturen gebrauchen typischerweise bestimmte Genres, um über Wettbewerb zu handeln. Doch folgen die Positionen nicht der üblichen Logik, die besagt, dass Amerika mehr oder minder pro und Europa kontra Wettbewerb eingestellt sei – wie es etwa Schulbücher dies- und jenseits des Atlantiks dokumentieren.28 Vielmehr finden sich gerade in der amerikanischen Literatur, möglicherweise geleitet durch unmittelbare Anschauungen im Wirtschaftsleben vor Ort, äußerst kritische Darstellungen des Wettbewerbs. In der europäischen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts hingegen geht man nicht nur kritisch, sondern auch spielerisch mit dem Thema um: Wettbewerb ist überall, fasziniert, verstört, erscheint als kreatives Moment, als Anlass zu Reflexion und Korrektur der eigenen Position.
Gegenwärtig aber sind die Dinge aus dem Gleichgewicht geraten, und das merken Politik und Wirtschaft ebenso wie die Literatur: Eine Staatsschuldenkrise bislang unbekannten Ausmaßes bedroht die öffentlichen Haushalte. Sie kennt viele Schuldige, zum Teil Schuldige wider Willen. Politiker suchten, ihren Wählern ein Häuschen auf Pump zu ermöglichen, um wiedergewählt zu werden. Banker folgten dem politischen Willen und nahmen hochriskante Papiere in ihre Portfolien, um Profit zu erzielen. Dazu zählten in jüngster Zeit verbriefte amerikanische Immobilienkredite und griechische Staatsanleihen, also solche Schuldtitel, bei denen der Schuldner auszufallen drohte. Anleger kauften diese Produkte, weil sie hohe Rendite versprachen, und ignorierten das damit verbundene Risiko. Wenn alle Beteiligten fehl gehen, dann muss etwas im System schieflaufen, doch was?
Wir scheinen uns in einer Konkurrenzbeschleunigungsfalle zu befinden: Politiker konkurrieren um Wählergunst, Banker um ihre Boni und ihren Ruf im Markt; Anleger wollen ihr Geld so schnell wie möglich gemehrt sehen, um sich mehr leisten zu können und für schlechte Zeiten vorzusorgen. Das System, das bislang leidlich rundlief, ist überhitzt. Gemeinwesen geraten in tiefgreifende ökonomische und kulturelle Konflikte. Existenzen sind zerstört. Künftige Generationen erwartet ein kaum zu tilgender Schuldenberg. Dieses Buch will die Dynamiken untersuchen, die den Wettbewerb negativ verstärkt haben, und fragen, wie sie sich entschleunigen lassen. Im Mittelpunkt steht das Sondieren dessen, was zu unseren gegenwärtigen Problemen geführt hat. Niemand soll sagen, er habe davon nichts gewusst. In der Literatur kann man alles nachlesen. Und mehr noch: Die Literatur vermittelt sogar Ideen über eine Zukunft, in der die Konkurrenzbeschleunigungsfalle nicht mehr zuschnappt.
II. Wettbewerb vor der Erfindung des Wettbewerbs
Schon als Säugling stahl und log Hermes, der Gott der Kaufleute. Dem Apollon raubte er eine ganze Kuhherde – und leugnete aus seiner Wiege heraus, überhaupt zu wissen, was eine Kuh sei. Zugleich versuchte er, den Musengott durch sein Spiel auf einer Leier gnädig zu stimmen, die er selbst am Morgen aus einer Schildkröte gefertigt hatte. Hermes war einerseits ein skrupelloser Dieb, andererseits aber ein Schöpfer und Musiker.29 Im Wettbewerb um Wohlstand, Macht und Genuss ließ er keine Grenzen gelten und tastete selbst göttliches Eigentum an. Ihm war jedes Mittel recht, um die Sache für sich zu entscheiden. Er bewegte sich in einer produktiven Weise am Rande des Moralischen – in einer Weise, die schockieren wollte und musste.
Bezeichnenderweise nahmen die griechischen Philosophen vom Hermes-Mythos Abstand. Handel, Markt und Wettbewerb schlossen sie aus ihren Überlegungen aus. Nur die Chrematistik, die »Krämerkunst«, widmete sich dem Themenfeld. Sie ging sogar davon aus, dass sich Geld geschickt vermehren ließ – für Philosophen wie Aristoteles ein unmoralischer Gedanke. Ihm galt nur als guter Bürger, wer nicht handelte. Handel, Markt, Wettbewerb waren der Bürger unwürdig, die in der Polis Mitsprache begehrten. Sie sollten, so notiert es Artistoteles in seinen ökonomischen Lehren, ihren »oikos«, Haus und Land, pflegen, nach Freiheit, Unabhängigkeit (»aủtárkeia«) und Tugend (»ἀreté«) streben.30 Im Denken der Römer änderte sich an diesen Maßgaben nicht viel. Händler waren nicht selten entlassene Sklaven, denen man wenig Moral und Ehre zubilligte. Gleichwohl akzeptierten die Römer Handel, Markt und Wettbewerb, weil sie auf eine mobile Gesellschaft reagieren mussten und es sich nicht mehr leisten konnten, die Handeltreibenden zu ignorieren. Denn ihren großen Reichtum verdankten sie neben ihren Eroberungen dem Erfolg im Handel – spätestens als sie ihren Mittelmeer-Konkurrenten Karthago niedergerungen hatten.
Aus der Konkurrenz mit den römischen Besatzern heraus revitalisierten die Christen die griechische Abneigung gegen die Händler. Mit dem Christentum verbreitete sich – wie schon im Judentum und Jahrhunderte später durch den Islam – die Fiktion von einer Welt ohne Wettbewerb: Die drei großen Religionen berichteten gleichermaßen von einem Paradies, in dem Gott für die Menschen sorgte und Freundschaft unter allen Lebewesen herrschte. Solches Ausblenden von Wettbewerb belegt die Sehnsucht der Menschen nach einer Welt ohne Konkurrenz, Neid und Anstrengung. Davon hatten sie im wirklichen Leben offenbar genug. Sie fragten sich, weshalb sie sich in einer harten wettbewerblichen Wirklichkeit befanden, obwohl sie sich doch ins Paradies wünschten. Die Antwort der Paradieserzählungen auf dieses Dilemma lautete: Es war Verführung durch äußere Mächte, durch die Schlange. Sie versprach Eva, gottgleich Gut und Böse unterscheiden zu können, wenn sie nur Äpfel vom Baum der Erkenntnis äße. Ursprünglich böse war der Mensch danach nicht, sondern nur schwach, anfällig für Versprechungen, für Konkurrenz und Neid. Die Generation der Kinder Adams und Evas verdeutlicht es: Kain war neidisch auf seinen Bruder Abel, da Gott dessen Opfer vorzuziehen schien – und ermordete seine Konkurrenz mit dem Ziel, als treuester Gläubiger anerkannt zu werden.
Die religiösen Vorstellungen von der paradiesischen Gutheit des Menschen, seinem Sündenfall und seinen Neigungen zu erbitterter Konkurrenz bargen Motivationspotenzial: Sie wurden zum Glauben gerade auch der unvermögenden Bevölkerungsgruppen. Denn ihre materielle Lage ließ sich religiös rechtfertigen: Wer arm war, lebte scheinbar gottgefällig und widerstand den irdischen Verlockungen. Bezeichnenderweise vertrieb Jesus die Händler und Geldwechsler aus dem Tempel.
In der Tradition Xenophons und Aristoteles’ entwickelten die Christen Ökonomiken oder Hausväterlehren, die helfen sollten, Gottes Reich auf Erden umzusetzen,31 Handel, Markt und Wettbewerb zurückzudrängen. Doch kämpften sie gegen Windmühlen: Die ökonomische Konkurrenz nahm zu. Mit ihr verschärfte sich das Dilemma, Wettbewerb nicht zu wollen und sich doch mitten darin zu befinden.
Eine kurze Geschichte der ökonomischen Konkurrenz vom Mittelalter bis ins 17. Jahrhundert
Im Ausgang aus der antiken Welt entwickelte sich ein weitläufiges Handelssystem. Dabei ging »der Fall des Ostens« dem »Aufstieg des Westens« voraus.32 Während der Tang-Dynastie (7. bis 9. Jahrhundert n. Chr.) blühte der Handel entlang der Seidenstraße, minderte sich aber schon während der Song-Dynastie (9. bis 12. Jahrhundert). Seit dem 8. Jahrhundert ließen agrarische Reformen, neue Technologien, speziell Bewässerungstechniken, den arabischen Raum erstarken; parallel entwickelten sich zunächst Bagdad und seit der Jahrtausendwende Kairo zu Handelszentren.33 Die jüdische Diaspora bildete eine wichtige Mittlerkultur. Sie gewährte Sicherheit für Gütertransporte und Finanztransaktionen. Seit dem 12. Jahrhundert ergaben sich Verschiebungen der Weltordnung: Venedig dehnte sich in Konkurrenz mit Byzanz immer mehr aus. Ägypten wurde durch Portugals Seefahrertätigkeit geschwächt. Europa, eine zunächst rückständige Region, profitierte von der Fragmentierung der östlichen Handelswege, von kriegerischen Auseinandersetzungen der Chinesen mit den Mongolen und von der Pest, die Chinas Bevölkerung dezimierte.
Über den exakten Zeitpunkt des europäischen Erstarkens aber streiten die Gelehrten: Fernand Braudel geht vom 13. Jahrhundert aus; sein Augenmerk liegt auf der Erschließung des Nordatlantiks durch italienische Galeeren und der »kommerziellen Revolution«.34 Immanuel Wallerstein hingegen sieht den Aufstieg Europas erst im 16. Jahrhundert gekommen.35 Wieder andere betonen die Bedeutung innereuropäischer Institutionen für den Transformationsprozess seit etwa 1000 n. Chr.36 Danach galt es, die hohen Kosten für den Handel durch schnelle und sichere Verwaltungsformen zu senken. Hinzu kam der regionale Wettbewerb: der Wettbewerb der Herrscher, Höfe und Klöster. Letztere bildeten im Mittelalter Handelszentren aus, verwalteten Ländereien, pflegten Weinanbau und Braukunst, stellten Luxusgüter wie Codices und Teppiche her und wollten ihre Güter verkaufen. Die Konkurrenz der weltlichen und geistlichen Institutionen konnte Stände und Städte, ethische und religiöse Ordnungen destabilisieren; zugleich aber förderte solche Konkurrenz auch eine Kultur der Produktivität und Innovation, des Geschmacks und Konsums.37 Selbst die Zünfte ließen im Mittelalter Mobilität (Zunftwechsel, Doppelzünftigkeit) zu und gewährten individuelle Freiheiten bei der Ausgestaltung zünftiger Prinzipien.38
Wettbewerb, Markt und Innovation waren gleichwohl nicht gewollt und wurden allenfalls als notwendiges Übel akzeptiert. So tauchen in den großen Romanen des Mittelalters zwar fahrende Kaufleute auf, aber ihre Erscheinung ist selten positiv besetzt. Sie gelten als Randfiguren der höfischen Gesellschaft. Wirkt einmal einer von ihnen schön und tugendhaft, so erweist er sich – wie in den Tristan-Romanen Eilhart von Obergs (um 1170) und Gottfried von Straßburgs (1200–1210) oder wie Gawan in Wolfram von Eschenbachs Parzival (ca. 1200–1210) – als verkappter Ritter.
In der bildenden Kunst hingegen sprach man, auch um sich von den Zünften und dem Handwerk abzugrenzen, bereits frühzeitig und positiv von Wettbewerb.39 Spätestens seit dem Jahr 1401 geschah er tatsächlich. Für diesen Zeitpunkt ist ein Wettbewerb um die Gestaltung einer Bronzetür am Florentiner Baptisterium belegt. Lorenzo Ghiberti, Bildhauer, Goldschmied und Kunsttheoretiker, und Filippo Brunelleschi, Bildhauer und Architekt, konkurrierten miteinander, und ein Gremium entschied über den besten Entwurf.40 Zwar verschafften sich spätere Auftraggeber nicht immer mit denselben Methoden Transparenz über das künstlerische Angebot, aber es finden sich zunehmend Belege für einen konkurrenzgetriebenen Kunstmarkt. Wettbewerb regte die Produktion an und führte zu neuen Kollaborationen.41 In England beispielsweise konkurrierten Maler um Aufträge des Hofes. Zu diesem Zweck kooperierten sie miteinander, gründeten Schulen, um Kosten zu sparen, Raum für die eigene Arbeit zu finden, große Projekte wie die Ausgestaltung der Kapelle im King’s College (Cambridge) zu bewerkstelligen. Auch der Wettbewerb auf dem niederländischen Bildermarkt des frühen 17. Jahrhunderts lässt sich positiv beschreiben: Aus Belgien, besonders aus Antwerpen, gelangten viele kostengünstige Bilder in die Niederlande. Immigranten aus dem Süden begeisterten sich dafür und dekorierten ihre Häuser, wie sie es in ihrer Heimat gewohnt waren. Zugleich aber stimulierte die Bilderflut die Produktion von Bildern ähnlichen Stils;42 es entstanden regelrechte Bilderwerkstätten, wo in Arbeitsteilung jeder an seiner Aufgabe malte.
In der Musik sah es kaum anders aus, doch sind die Erkenntnisse darüber strittig: Der Ökonom Roland Vaubel beispielsweise schließt aus der kurzen Aufenthaltsdauer von Musikern an Höfen des Reiches auf die kreativitätsfördernde Wirkung von Mobilität und Fürstenkonkurrenz.43 Doch gründet sein Schluss auf einem ästhetischen Vorurteil, und so wird seine gesamte Studie problematisch. Er meint nämlich, die deutsche Musik des 17. und 18. Jahrhunderts sei besser als die französische, die am Pariser Hof, also zentral und außer Konkurrenz gespielt wurde. Unabhängig davon, ob man Vaubels Urteil folgt – die Konkurrenz nahm auch auf musikalischem Gebiet zu. Waren es zunächst die Mäzene oder die Kirchen, die Musiker nach ihren mehr oder minder einsichtigen Kriterien auswählten und finanzierten, führte die Gründung der privatwirtschaftlichen Opernhäuser in Venedig, Hamburg und England bald zu einer Orientierung an der sich wandelnden Gunst des Publikums und damit zu gesteigertem Wettbewerb.44 Berühmt wurde das Duell zwischen Georg Friedrich Händel und Johann Christoph Pepusch sowie John Gay. Händel lebte seit 1717 in London, hatte sich der höfischen Oper verschrieben und dort mit der »Royal Academy of Music« ein erfolgreiches Operunternehmen gegründet. Pepusch, der Komponist, und Gay, der Texter der sozialkritischen und volksnahen Beggar’s Opera (1728, aktualisiert durch Bertolt Brechts Dreigroschenoper, 1928), machten Händels Erfolg beinahe über Nacht zunichte. Das Publikum zeigte sich fasziniert von der Beggar’s Opera; sie trug erheblich zum Niedergang von Händels »Royal Academy of Music« bei.
Die Künste übernahmen also eine Vorreiterrolle bei der Umsetzung und Entwicklung von Vorstellungen des Wettbewerbs. Sie reagierten damit auch auf einen tiefgreifenden Wandel der ökonomischen Semantik. Die scholastische Wirtschaftsethik nämlich, die bis zum 14. Jahrhundert bedeutsam blieb, änderte die negative Einstellung zu Handel, Markt und Wettbewerb, wie sie seit der Patristik tradiert wurde.45 Scholastische Denker entwickelten eine ausgeklügelte Methodik, um zu beweisen, dass Handel nicht per se, sondern nur unter bestimmten Umständen (gegliedert nach Ort, Zeit, Verfahren und Person) schlecht war: An bestimmten Orten, etwa in Kirchen, durfte nicht gehandelt werden; auch war Handel an Feiertagen verboten. Täuschung und Nötigung waren strafbar; der Kaufmann sollte sich am Ideal des »ehrbaren Handwerkers« orientieren, der nur sich selbst und seine Angehörigen durch seine Arbeit (im Rahmen der Zunftordnung) zu erhalten suchte. Wenn ein solcher Kaufmann seine – riskante und kostspielige – Tätigkeit für das Wohl der Gesellschaft und des eigenen Hausstandes betrieb, durfte er einen maßvollen Gewinn erwirtschaften, so meinte Thomas von Aquin (Summa theologica, 1266–1273, Frage 77). Albert der Große und seine Nachfolger trieben diese Überlegungen weiter: Aus ihrer Sicht garantierte der Wettbewerb maßvolles Wirtschaften. Er schützte Händler und Käufer durch die Kontrolle der Konkurrenz vor Täuschung und Nötigung. Wettbewerb galt erstaunlicherweise bereits hier als Instrument, soziale und ökonomische Gerechtigkeit herzustellen.
Martin Luther hingegen äußerte sich kritischer; er reagierte auf einen internationalen Wettbewerb, der aus dem Ruder zu laufen drohte.46 Die Bergpredigt mit ihren Seligpreisungen der Armen, Barmherzigen und derer, die nach Gerechtigkeit suchen, rechtfertigte seine Argumentation. Vor dem Hintergrund der Bergpredigt griff Luther eine auf Gewinnmaximierung angelegte Wirtschaftsordnung an. Sie gebäre die Sünde und das Ketzertum. Dabei gehörte die Polemik gegen den Wucher (Kleiner Sermon vom Wucher, 1519) noch zum tradierten Bestand ökonomischen Denkens. Bedeutsamer war Luthers Schrift Kaufshandel und Wucher (1524), eine Attacke gegen die großen Handelsgesellschaften. Er hält ihnen einen Sündenkatalog vor, beklagt Preisabsprachen und zeichnet auch im Blick auf die Dynastie der Fugger ein analytisch scharfes Bild von harter Konkurrenz. Im Umkehrschluss fordert Luther dabei aber einen funktionierenden Wettbewerb im Markt: ein Marktgeschehen, das regional orientiert und durch Händler und Käufer kontrolliert ist.
Calvin hingegen erlaubte auch wenig regulierte Formen von Wettbewerb; er sah in ihnen ein zivilisatorisches Moment. Armut betrachtete er als Strafe Gottes: Sie bezeuge die Sündhaftigkeit des Besitzlosen. Bettelei wollte Calvin verbieten. Reichtum aber galt nicht als Schande, sofern seine Träger fleißig arbeiteten und asketisch lebten. Ein geringer Zinssatz von etwa 5 Prozent war – wie auch bei Luther – gestattet. Calvin scheint das Matthäus-Evangelium in praktische ökonomische Regeln umgemünzt zu haben: »Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, dass er Fülle habe; wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, was er hat« (Matthäus 25,29) lautet das sogenannte Matthäus-Prinzip.
Es wird durch zwei weitere Gleichnisse konturiert. Das erste Gleichnis berichtet von Arbeitern im Weinberg: Ein Herr wirbt Tagelöhner für unterschiedliche Arbeitszeiten an (12 und 6 Stunden sowie 1 Stunde). Sie alle erhalten denselben Lohn, was zu Klagen derer führt, die 12 und 6 Stunden arbeiten, also mehr für ihr Geld leisten müssen. Doch verweist sie der Herr auf die einmal getroffene Vereinbarung: Sie dürfen mit ihrem Gut tun, was sie wollen. Der Weinberg steht, folgt man der Bibelexegese, für das künftige Reich Gottes. Wer an ihm mitarbeitet, gehört zur Gemeinde der Gläubigen, gleich, wann er sich zum Glauben bekehrte. Als »Arbeiter im Weinberg des Herrn« erhält er den gleichen Lohn wie derjenige, der sich schon länger in Gottes Hand begeben hatte. Das zweite Gleichnis (das »Gleichnis von den anvertrauten Talenten«; Matthäus 25,14–30; Lukas 19,21–27) ist ähnlich gelagert. Es beschreibt einen Herrn, der seinen Dienern Silber anvertraut, um es gewinnbringend anzulegen. Derjenige, der fünf Zentner Silber erhält, macht daraus zehn. Ein anderer erhält zwei Zentner und verdoppelt die Summe. Derjenige aber, der nur einen Zentner erhält, erzielt keinen Gewinn. Die Gewinnchancen im Wettbewerb sind offenkundig unterschiedlich verteilt, und diese Verteilung führt im Verhältnis von eins zu eins zu unterschiedlich hohen Erträgen. Doch steht das Edelmetall wiederum stellvertretend für den Glauben: Wer viel davon hat, vertraut, legt seine Gaben günstig an und gewinnt. Derjenige aber, der nicht glaubt, verliert, auch materiell. Matthäus (19,30) bringt diese Auffassungen auf den Punkt. Er predigt vom Lohn der Nachfolge: »Aber viele, die da sind die Ersten, werden die Letzten, und die Letzten werden die Ersten sein«, so heißt es dort. Wer nicht glaubt, sich aber scheinbar im Leben gut schlägt, wird am Jüngsten Tag das Nachsehen haben. Mit den Gläubigen verhält es sich anders: Ihnen wird am Jüngsten Tag der größte Lohn zuteil.
Solcher Wettbewerb zu ungleichen Bedingungen ist im Christentum offenkundig akzeptiert, weil es von einer prinzipiellen Gleichheit der Menschen vor Gott ausgeht und den Glauben als einzig fruchtbaren Weg zu immateriellem und materiellem Glück betrachtet. Doch darf man vermuten, dass Glaube und Wohlstand in der Realität auch auseinandertraten (und treten). Calvin traf wohl auch deshalb ethische und rechtliche Vorkehrungen, um die Gemeinschaft der Gläubigen zu stabilisieren: Die Früchte eines erfolgreichen Konkurrenzkampfs durften nicht zur Schau gestellt werden. Auf diese Weise versuchte Calvin, die sozialen Probleme und Instabilitäten auszugleichen, die durch Wettbewerb ausgelöst wurden: Wer sich durchsetzte und von anderen oder auch nur von der eigenen Klugheit profitierte, musste sich zugleich mäßigen und auf die menschlichen Voraussetzungen besinnen, die ihm das Konkurrieren erst ermöglichten. Das Wettbewerbsdilemma war religiös, ethisch und juristisch eingehegt.
In den lutherischen Territorien hingegen nahm die Obrigkeit Luthers wettbewerbskritischen und regulatorischen Ansatz auf: Ideen, Begriffe, Sprachbilder und ganze Textgattungen wie die Hausväter- und Policeyliteratur, besonders die Taxordnungen, wurden während der gesamten frühen Neuzeit, vor allem aber während des Dreißigjährigen Krieges in Stellung gebracht, um einen als zerstörerisch wahrgenommenen Wettbewerb zu regulieren.47 Texte wie diese zeigen ex negativo, dass Konkurrenz ein zentrales Problem der Zeit war. Die Taxordnungen folgten, gleich aus welchem Territorium sie stammten, allesamt einem Generalbass: Aktuell gibt es bedauerlich wenig und überhaupt nur korrumpierten Handel.48 Beispielsweise behaupten von fern kommende Kaufleute, dass die Landeswährung andernorts weniger wert ist und ihre Güter infolgedessen teurer verkauft werden müssen.49 Einige Taxordnungen sprechen angesichts solcher Forderungen von der Gefährdung der »Leibes Nothdurfft«, also davon, dass die Bürger auf dem Markt nicht mehr ausreichend Nahrungsmittel erhalten, um sich zu ernähren.50 Entsprechend wenden sich solche Ordnungen gegen die um sich greifende Teuerung. Sie legen Preise für einzelne Güter und Dienste fest, um die »gute Ordnung« wiederherzustellen – ein typisch vormodernes Argumentations- und Verhaltensmuster: Man leistet nichts Neues, sondern renoviert, was durch menschliche Verfehlung zerstört wurde. Diese Verfehlung wird moralisch als »Eigennutz« oder »Wucher« etikettiert.51 Das Moralisieren ist obligat; nur wenige Ordnungen sparen es aus.52 Einige Taxordnungen schreiben Sanktionen für Fehlverhalten vor, um die »gute Ordnung«, die ständische Ordnung der Zeit, wiederherzustellen oder zu stabilisieren. Nur wenige Taxordnungen werden dabei so konkret wie die württembergische: Sie erweist sich als Herrschaftsinstrument, indem sie die Amtsleute und Schultheiße anhält, widerständige Bauern zu bestrafen.53 Üblicherweise aber appelliert man stereotyp an die »christliche Liebe« der Fehlgehenden, und diese scheint unmittelbar deckungsgleich mit dem »alten Preis« zu sein, den es wieder einzusetzen gilt.54 De facto handelt es sich dabei zum einen um Regulierungsbemühungen durch die Reduktion von Münzen, die Festlegung von Gewichten, Längen, Löhnen (vor allem von Böttichern und Kleinbindern, Tischlern und Schreinern, Wagnern und Radmachern, Barbieren, Seilern, Töpfern und Bürstenbindern) und Preisen. Dabei meint Preisregulierung zumeist Preissenkung, etwa bei Süßweinen.55 Der Preis richtet sich nach dem je regional spezifischen Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Beispielsweise soll ein Kalbskopf mit Kalbsfüßen im Kreis Leipzig drei bis vier Groschen, im Kreis Erzgebirge aber nur zwei Groschen und sechs Pfennig kosten; für einen Kapaun muss man im Kreis Meißen je nach Alter und Größe sechs bis acht Groschen, im Erzgebirge jedoch nur fünf Groschen anlegen.56 Taxordnungen erweisen sich damit als Wettbewerbsordnungen: In einem korrumpierten Markt wollen sie Wettbewerb erst ermöglichen, indem sie zwar Preise festlegen, aber regionale Abweichungen ebenso wie Qualitätsunterschiede der Waren tolerieren. Für den Fall, dass ihren Regulierungen nicht Folge geleistet wird, kündigen sie Sanktionen an, wollen Zensoren und Inspektoren einsetzen.57 Ob dies tatsächlich geschah und in welchem Ausmaß solche Sanktionierung stattfand, ist noch nicht hinlänglich bekannt. Unstrittig aber ist, dass die Taxordnungen Sichtbarkeit für die Anliegen erzeugten, die sie vertraten. Im komplexen Geflecht der kleinen Staaten des Alten Reichs und gestützt durch unterschiedliche Trägergruppen übten diese Regelungen auf die zeitgenössische Semantik und die Umgangsformen auf den Märkten vermutlich einigen Einfluss aus.
Doch auch in lutherischen Territorien fand man Mittel und Wege, Marktwettbewerb und Glauben zu harmonisieren. Anders als Wittenberg und Halle atmete etwa die Hansestadt Hamburg ein ökonomisch freies Klima, das durch den logistischen Wettbewerbsvorteil des Hafens und die Nähe zu anderen handeltreibenden Ländern bedingt war: Viele Ratsherren waren Fernkaufleute, England-, Flandern- und Schonenfahrer; im Jahr 1558 wurde die erste deutsche Börse, eine Warenbörse für Wein, Edelmetalle und Stoffe, gegründet. Doch es gab auch gravierende Probleme: Mit dem Zusammenbruch des Tulpenmarktes im Jahr 1637 erwuchsen ausgehend von der Amsterdamer Börse weiten Teilen der zeitgenössischen Gesellschaft ernste Schwierigkeiten. Sogar Dienstmädchen hatten auf Tulpen, das Statussymbol der Oberschicht, spekuliert und durch die Krise ihr Geld verloren.58 Portugiesische Juden, die in Hamburg lebten, begründeten derweil neue Wirtschaftszweige unter anderem im Banken-, Makler- und Seeversicherungswesen. Auch andere Glaubensflüchtlinge, die in der Stadt sowie im dänischen Altona Aufnahme fanden, sorgten mit ihren guten Kontakten in andere Länder für Wirtschaftswachstum. Als im 18. Jahrhundert Engländer und Niederländer den Welthandel von den Spaniern und Portugiesen übernahmen, profitierte Hamburg von seinen guten Verbindungen dorthin und den eigenen Erfahrungen im Seehandel. Der Niedergang des Hafens von Antwerpen, gute Verbindungen nach Skandinavien und ein niedriges Lohnniveau durch das große Umland förderten die Prosperität der Stadt weiter.59
Vor dem Hintergrund dieser Fallbeispiele aus der langen Geschichte des Wettbewerbs vor dem Wettbewerb lassen sich einige wesentliche Merkmale der Entwicklung desselben ermitteln: In Antike, Mittelalter und früher Neuzeit konkurrierten Weltreiche, Regionen, Höfe, Klöster, Künstler, Autoren, Wissenschaftler und wohl auch Manufakturen miteinander, so sie konnten (und durften). Semantisch aber tauchte Wettbewerb zunächst vor allem unter den Vorzeichen von Kampf, Betrug, Korruption und Verstoß gegen die etablierte Wertordnung auf. Die Scholastik sorgte für Akzeptanz des Wettbewerbs und sogar für ein positives Bild desselben, sofern er wechselseitige Kontrolle auf dem Markt begünstigte. Im 16. Jahrhundert hingegen wandelte sich das Bild vor dem Hintergrund der globalen Konkurrenz der großen Handelshäuser; zu Beginn des 17. Jahrhunderts tat der Dreißigjährige Krieg das Übrige: Unter dem Deckmantel christlicher Semantiken wurde Wettbewerb reguliert – wohl auch, um überhaupt erst wieder Grundlagen für mehr als bloß zerstörerische Konkurrenz zu schaffen. Allerdings ist wenig deutlich, wie wirksam solche Regulierungen tatsächlich waren und ob es sich nicht in erster Linie um Verordnungen handelte, die keine Sanktionen zur Folge hatten. Die Normen und Werte, in deren Namen man Wettbewerb einschränkte oder ablehnte, waren gleichwohl beeindruckend stabil, jedenfalls im lutherisch bestimmten Alten Reich. Hier dominierte eine Argumentationslinie: Marktwettbewerb und Konkurrenz gefährdeten die persönliche Aufrichtigkeit, das Christentum, die Moral und die ständische Ordnung. Calvinistische Territorien oder Hafenstädte wie Hamburg hingegen ließen eine größere Breite von Vorstellungen und Handlungsweisen zu. Entsprechend entwickelte sich die Marktwirtschaft dort schneller als andernorts. Merkmale wie Lage (Anbindung an Verkehrs- und Handelsnetze, Möglichkeiten zur Mobilität), Kaufkraft und Mentalität (Akzeptanz von Konkurrenz) bestimmten die jeweilige Wettbewerbswilligkeit und -fähigkeit mit. Hinzu kamen infrastrukturelle Bedingungen wie die Schnelligkeit und Zuverlässigkeit der Verwaltung sowie der Grad der Befriedung eines Gemeinwesens, auch im Verhältnis zu den Nachbarn.
Die Literatur dokumentiert diese Prozesse der Vertiefung und Erweiterung, aber auch der Ablehnung von Konkurrenz,60 greift ihnen vor, bewertet sie moralisch. Schon frühzeitig schafft sie prototypische Wettbewerbserzählungen. Ihnen kommt mehr als bloß anekdotische Evidenz zu. Sie erzählen vom Menschen in spezifischen Marktsituationen. Literatur legt Tiefenbohrungen vor, welche die lange Geschichte des Wettbewerbs vor dem Wettbewerb ausschnitthaft vorstellbar machen. Das Für und Wider des Wettbewerbs bedenkt Literatur mutig und einfallsreich – wie kaum ein anderes Textzeugnis in einer Zeit der Zensur und der Autorenverfolgung.
Wettbewerb in der Literatur: Fortunatus als Rollenmodell
Das berühmteste Buch, das im Ausgang aus dem Mittelalter mit einer bislang nicht gekannten Offenheit auf Wirtschaft und Wettbewerb reagiert, heißt bezeichnenderweise Fortunatus