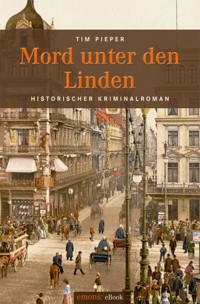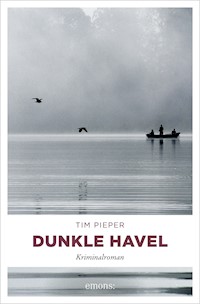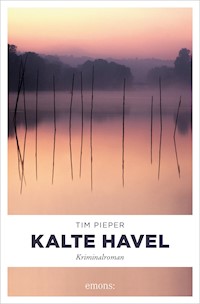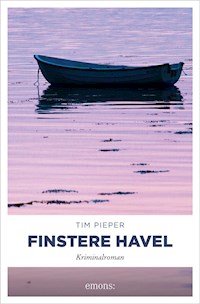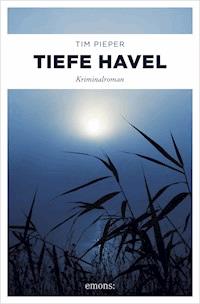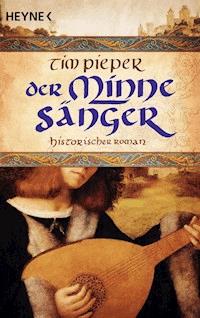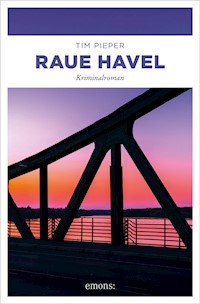
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Toni Sanftleben
- Sprache: Deutsch
Ein Spionagefall nach wahren Begebenheiten. In einem alten Bootshaus an der Havel werden drei jahrzehntealte Skelette gefunden. Kurz darauf wird eine Journalistin ermordet. Sie recherchierte in einem Spionagefall aus dem Jahr 1949 um eine junge Frau, deren Identität bis heute unbekannt ist. Hängen die Todesfälle von damals und heute zusammen? Als Hauptkommissar Toni Sanftleben klar wird, dass er selbst familiär in den Fall verstrickt ist, ist es schon fast zu spät: Er bekommt es mit einem Gegenspieler zu tun, für den ein Menschenleben nicht viel zählt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Tim Pieper, geboren 1970 in Stade, studierte nach einer Weltreise Neuere und Ältere deutsche Literatur und Recht. Mit seiner Familie lebt er im Havelland, nur wenige Kilometer vor den Toren Potsdams, und liebt es, die idyllische Landschaft Brandenburgs mit dem Fahrrad zu erkunden.
www.timpieper.net
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2022 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: shutterstock.com/Patrick Daxenbichler
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept
von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Carlos Westerkamp
E-Book-Produktion: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-894-8
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für Steffi, Moritz und Theo
Da draußen lauert ein Wolf, er will mein Blut.Wir müssen alle Wölfe töten!
Josef Stalin, 1878–1953, sowjetischer Diktator
Das Hauptquartier der »Kontr-Razvedka« oder des Spionageabwehrdienstes der sowjetischen Besatzungsarmee befindet sich in Potsdam. Es ist der militärische »Arm« der N.K.W.D., dessen Tätigkeit sich durchaus nicht auf die Bekämpfung der feindlichen (…) Spionage beschränkt. Er befasst sich vielmehr mit der Bekämpfung jeglicher als feindlich angesehener Gesinnung sowohl in den eigenen Reihen als auch in der deutschen Bevölkerung der sowjetischen Besatzungszone.
Waldemar Hoeffding, 1886–1979, ehem. Häftling im Militärstädtchen Nr. 7
Prolog
Untersuchungsgefängnis des sowjetischen Geheimdienstes, Potsdam, März 1946
Vor zwei Monaten waren die Schüler der Potsdamer Einstein-Oberschule zum Tod verurteilt worden. Im Anschluss hatte man ihnen die Gelegenheit gegeben, ein Gnadengesuch zu stellen. Seitdem vegetierten sie in der Gefängniszelle vor sich hin und warteten auf die Antwort vom Vorsitzenden des Präsidiums des Obersten Sowjets.
Christoph war während der Haft siebzehn geworden und damit der älteste. Er hatte den Russischunterricht geschwänzt, weil es ihn geärgert hatte, dass die Sprache neuerdings ein Pflichtfach war. Außerdem hatte er keinen Hehl daraus gemacht, dass er lieber Englisch gelernt hätte. Die Amerikaner mit ihren schicken Autos und der Swingmusik gefielen ihm besser als die Sowjets, die in der Region Schlimmes angerichtet hatten und immer so primitiv wirkten.
Die anderen Jungs hatten ihn für seine Haltung bewundert und sich ihm angeschlossen. Gemeinsam hatten sie Fußball gespielt, anstatt Russischvokabeln zu pauken. Dabei hatten sie den Ernst der Lage unterschätzt.
Mehrfach waren sie zu Befragungen abgeholt und schließlich eingesperrt worden. Endlose Verhöre folgten. Keiner von ihnen hätte je für möglich gehalten, dass man ihnen für das Fernbleiben vom Unterricht die »Mitgliedschaft in einer konterrevolutionären Organisation« und die Vorbereitung von »Terror« und »Diversion« andichten würde.
Christoph kauerte auf dem harten Boden und drehte den Oberkörper zur Seite, um an der Inschrift zu arbeiten, die er mit Fingernägeln in die Wand kratzte. Überall standen Namen und Nachrichten von Gefangenen, die vor ihm eingesessen hatten. Die meisten Verfasser waren längst hingerichtet worden. Andere Verurteilte hatte man in sibirische Lager verschleppt, wo sie Zwangsarbeit verrichteten, bis sie in der Schneewüste erfroren oder an der Ruhr verreckten.
Schon die kleinste Armbewegung schmerzte Christoph, und er ließ die Hand sinken, um das Pochen abklingen zu lassen. Ihn quälten nicht nur die Rippenbrüche und Fleischwunden, die ihm von seinen Vernehmern zugefügt worden waren, sondern auch die Wanzen- und Flohbisse, die sich entzündet hatten. Die fehlende Hygiene setzte ihm zu. Seit seiner Inhaftierung vor drei Monaten hatte er sich nicht waschen dürfen. Sein ganzer Körper war von Beulen und Ekzemen übersät, die aufplatzten, sobald sich seine Haut spannte. Die Ernährung aus Kohlbrühe und schimmeligem Brot tat ihr Übriges. Er brauchte keinen Spiegel, um zu erkennen, wie es um ihn stand. Ein Blick in die fiebrigen und hohlwangigen Gesichter seiner Freunde reichte aus, um zu verstehen, dass er nichts Menschliches mehr an sich hatte. Das Herz in seiner Brust schlug noch, aber ihm war, als würde sich sein Leib bereits zersetzen. Seine Kerkermeister ließen ihn spüren, dass er nicht den Dreck unter ihren Fingernägeln wert war.
Als der Schlüssel von außen ins Schloss gesteckt und unter rostigem Knarzen gedreht wurde, zuckte er zusammen. Die Freunde erschraken ebenfalls. Schnell rückten sie an ihn heran, um sich an seinen Armen und Beinen festzuhalten. Christoph hätte am liebsten aufgeschrien, aber er verbiss sich den Schmerz, den die Berührungen verursachten. Kein Laut kam über seine Lippen. Er wollte stark sein und seinen Freunden Halt bieten. Das war alles, was er noch tun konnte, um seine Schuld abzutragen.
Tausendmal hatte er sich verflucht, weil er einen so kindischen Aufstand angezettelt hatte. Seit dem Einmarsch der Russen wusste doch jeder, dass sie vor nichts zurückschreckten, um Rache zu nehmen und ihre Ideologie durchzusetzen. Er hätte einfach über die Zonengrenze türmen können, so wie es Zehntausende andere Deutsche jeden Monat taten. Dann wären seine Freunde nicht verhaftet worden. Dann würden sie jetzt auf dem Schulhof stehen, ihre Pausenbrote auswickeln und Pläne fürs Wochenende schmieden.
»Was haben sie vor?«, fragte Frieder, der noch eine helle Jungenstimme hatte. Kurz vor Weihnachten war er fünfzehn geworden.
Christoph zog ihn näher zu sich und hielt ihn im Arm, so als könnte er dem Freund Schutz bieten. Früher wäre ihm eine solche Geste unmännlich erschienen. Heute war sie eine der letzten Möglichkeiten, um sich gegenseitig zu stärken und Trost zu spenden.
Auch Christoph wusste nicht, was sie erwartete. Vielleicht kam das Ende, vielleicht eine neue Schikane. Wenigstens darin waren die Sowjets Könner. Die seelischen und körperlichen Grausamkeiten wirkten so ausgeklügelt, als würden sie einer Choreografie folgen.
Die Zellentür schwang auf. Nacheinander zwängten sich ein Ermittlungsoffizier, zwei mongolische Wachsoldaten und eine flachsblonde Dolmetscherin in die Zelle, die auch selbstständig Verhöre durchführte und die alle »die Möwe« nannten, weil sich ihr Gelächter wie das Geschrei der Wasservögel anhörte.
Sie hieß Jelena Kowalewskaja und war – abgesehen von ihrer schneidenden Stimme – von einer seltenen Schönheit. Sie hatte faszinierende Augen, von denen eines dunkelbraun war und das andere smaragdgrün glitzerte. Auch mit den hohen Wangenknochen und der atemberaubenden Figur dürfte sie die Phantasie vieler Männer beschäftigen.
Allerdings täuschte das attraktive Äußere über ihr Wesen hinweg. Vom Gefängnispersonal wurde sie am meisten gefürchtet. Ihre Misshandlungen beschränkten sich nicht auf die Anwendung von Gewalt. Vielmehr nutzte sie ihre Position aus, um die unerfahrenen Jungen so zu erniedrigen, dass sie jedes Mal völlig verstört zurück in die Zelle gebracht wurden.
»Die Möwe« rümpfte die Nase wegen des Gestanks, der von dem Notdurfteimer aufstieg und der so drückend in der Luft hing, dass jeder Atemzug Überwindung kostete. Sie bedachte Christoph und seine Freunde mit einem feindseligen Blick, so als träfe sie die alleinige Schuld an Hitlers Einmarsch in die Sowjetunion.
Dann rollte sie ein Stück Papier aus. »Der Vorsitzende des Präsidiums des Obersten Sowjets, Michail I. Kalinin«, sagte sie kalt, »hat Frieder Hellmann zu zwanzig Jahren Zwangsarbeit begnadigt. Die Gnadengesuche von Christoph Buch, Dieter Hellweg, Benjamin Brandt, Fritz Lapierre, Sander Bohn und Werner Lieberknecht wurden abschlägig beschieden. Die zum Tod Verurteilten werden noch heute erschossen. Ihnen wird fünf Minuten Zeit gewährt, um Lebewohl zu sagen.«
Sie rollte das Papier zusammen, und die Delegation verließ die Zelle.
Frieder kam schwankend auf die Füße. »Zwanzig Jahre?«, schrie er. »Soll das ein Witz sein? Wieso krieg ich Lager und die anderen nicht? Ich will bei ihnen bleiben. Meinetwegen könnt ihr mich auch abknallen.«
Auch Christoph stemmte sich hoch. Dabei spürte er, wie seine Haut zwischen den Schulterblättern aufplatzte und das austretende Sekret sein Rückgrat hinuntersickerte. Also Hinrichtung, dachte er. Die Bestätigung des Todesurteils beendete die Wartezeit. Es wunderte ihn, dass er so ruhig blieb. Die ganze Situation fühlte sich unwirklich an. Die Russen hatten ihn nicht nur verwahrlosen lassen, sondern auch abgestumpft.
»Sie lassen dich am Leben, weil du der Jüngste bist«, sagte er. »Sie wollen beweisen, dass sie nicht nur Parteimaschinen, sondern auch Menschen sind.«
»Aber Dieter, Benjamin und Werner sind kaum älter als ich.«
Christoph zuckte mit den Achseln. »Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir sollten sie nutzen. Wenn du das Arbeitslager überlebst, möchte ich, dass du Vera aufsuchst und ihr etwas ausrichtest.«
»Vera?«
»Ja. Bitte sag ihr, dass ich in der Haft viel an sie gedacht habe und dass die Erinnerung an sie mir geholfen hat, alles zu überstehen. Sie kann nichts dafür, was ihr passiert ist, und sie ist tausendmal besser, als sie glaubt. Leider werde ich nicht mehr da sein, um sie daran zu erinnern. Sie soll dir versprechen, dass sie sich von niemandem kleinmachen lässt. Außerdem soll sie unbedingt ihren Traum verwirklichen und Physik studieren. Sag ihr, dass mein letzter Gedanke ihr gelten wird.«
Frieder wischte sich den Rotz von der Nase. Etwas ging in ihm vor, er wirkte plötzlich gefasst und konzentriert. Offenbar hatte er begriffen, dass dies der letzte Dienst war, den er dem Freund erweisen konnte. »Sie soll sich nicht kleinermachen, als sie ist. Sie soll Physik studieren. Und dein letzter Gedanke wird ihr gelten«, sagte er. »So richtig? War’s das?«
»Ja, ich glaube schon.«
Jetzt traten auch die anderen an Frieder heran und sagten ihm kurze Botschaften, die er ihren Familienangehörigen ausrichten sollte. Der Fünfzehnjährige wiederholte die Nachrichten gewissenhaft und prägte sie sich ein.
Danach sahen sich die Jungen in die Augen. Darin erkannten sie nicht die gedemütigten, kranken und schmutzstarrenden Kreaturen, zu denen die Sowjets sie gemacht hatten, sondern die Kindheitsfreunde, mit denen sie Schlittschuh auf dem Griebnitzsee gelaufen waren, mit denen sie Zigarettenbilder getauscht hatten und mit denen sie das Gartenhaus von Sanders Vater bei einem verunglückten chemischen Experiment in Brand gesteckt hatten.
Die mongolischen Wachsoldaten zwängten sich in die Zelle, prügelten die Jungen auseinander und packten Frieder am Arm, um ihn nach draußen zu zerren. Die Zellentür fiel mit einem dumpfen Laut zu, der Schlüssel wurde knarzend gedreht und herausgezogen.
Christoph verharrte still, bis nichts mehr vom Gang zu hören war. Seine erste Reaktion auf die Bestätigung des Todesurteils verwunderte ihn noch immer, aber die Verkündung hatte auch etwas angestoßen. Etwas, das ihn früher ausgemacht hatte und das offenbar nicht zerstört war. Es war sein Mut, der ihn auf dem Fußballplatz, in der Schule und bei Auseinandersetzungen ausgezeichnet hatte. Auf keinen Fall wollte er sich wie ein tumbes Stück Vieh abschlachten lassen. Das würde nur bedeuten, dass die Sowjets gewonnen hätten.
»Sie haben einen Fehler begangen«, sagte er.
»Was auch immer du meinst: Das macht für uns keinen Unterschied mehr«, erwiderte Benjamin.
»So darfst du nicht denken.«
»Und wie soll ich denken?«
»Verstehst du denn nicht? Sie lassen Frieder am Leben. Er kann den Menschen erzählen, was sie uns angetan haben. Ihre Verbrechen werden bekannt werden und sie in den Augen der Welt als die Monster zeigen, die sie sind. Eine Ideologie, in der Kinder hingerichtet werden, kann nicht überdauern. Unser Tod ist nicht umsonst. Er ist der Beweis, dass sie falschliegen.«
»Das ist wenig.«
»Nein«, sagte Christoph entschieden. »Das ist, was wir noch haben. Und deshalb möchte ich, dass ihr mir eins versprecht.«
»Was?«, fragte Sander.
»Wenn sie uns holen, werden wir nicht nach unseren Müttern schreien. Wir werden ihnen zeigen, dass sie uns nicht gebrochen haben. Und bevor sie die Gewehre anlegen und abdrücken, werden wir jedem Einzelnen von ihnen in die Augen blicken. So werden sie niemals vergessen, was sie getan haben. Habt ihr verstanden?«
Dieter kämpfte mit den Tränen, aber er wusste genau, was er seinen Freunden schuldig war. Irgendwie schaffte er es, die Fassung zu bewahren. »Ich bin dabei«, sagte er.
»Ich auch«, schloss sich Sander an.
Auch Benjamin, Fritz und Werner nickten.
»Gut«, sagte Christoph. »Dann sind wir bereit.«
1
Hinter dem Horizont zersprang der Morgen. Die ersten Lichtstrahlen splitterten durch den grauen Himmel und ließen ihn goldrot schimmern. Ein kleiner Vogel flatterte aufgeregt umher, so als könnte er den Tagesanbruch nicht länger erwarten.
Hauptkommissar Toni Sanftleben stand auf dem Oberdeck seines Hausboots und verfolgte das Naturschauspiel. Er liebte die frühe Stunde, wenn die Neustädter Havelbucht ihm gehörte. Zu dieser Uhrzeit war er frei genug, um all die Schönheit zu sehen.
Er kostete die Stimmung aus, dann trat er zur Klimmzugstange. Mit Mitte vierzig musste er härter trainieren als die jungen Heißsporne, mit denen er es manchmal zu tun bekam. Er spuckte in die Hände, packte das kalte Metall und zog sich hoch. »Eins … zwei … drei …«, zählte er die Wiederholungen mit und beobachtete, wie Caren aufs Oberdeck trat. Die Staatsanwältin trug einen engen Laufdress, der ihre schlanke Figur betonte. Grazil strich sie sich eine blonde Haarsträhne hinters Ohr, lächelte ihm zu und dehnte ihre Waden.
Manchmal konnte er kaum glauben, dass sie ausgerechnet mit ihm zusammen sein wollte. Sie war nicht nur klug, sondern mit Abstand die schönste Frau, die er kannte. Bei ihrem Anblick musste er an die gestrige Nacht denken und an all das, was sie miteinander angestellt hatten.
Natürlich vergaß er, die Klimmzüge mitzuzählen. Er maßregelte sich damit, dass er von vorn anfangen musste. »Eins … zwei … drei …«
Glücklicherweise beschränkte sich ihre Anziehungskraft nicht auf das Körperliche. Im vergangenen Jahr hatten sie eine Reise mit dem Hausboot unternommen, die sie über die Havel, die Elbe und die deutsche Nordseeküste bis nach Norwegen geführt hatte. Dabei hatten sie erfahren, dass sie ein starkes Gefühl füreinander hatten. Die gemeinsame Zeit hatte sie enger zusammenrücken lassen.
»… achtzehn … neunzehn … zwanzig …« Toni ließ die Stange los, fiel auf seine Füße und schüttelte die Arme aus.
Für ihn hätte ihr Törn länger dauern können. Die Weite des Meeres hatte bewirkt, dass er zu sich gekommen war und sich wieder gespürt hatte, aber Caren fehlte irgendwann die intellektuelle Herausforderung ihres Amtes. Halb im Spaß, halb im Ernst warf sie ihm vor, dass es ihm an Ehrgeiz mangele, weil er kein Interesse habe, in der Behördenhierarchie aufzusteigen. In diesem Punkt gab er ihr uneingeschränkt recht. Er war kein Mann, der für Verwaltungsaufgaben geschaffen war.
Ihr zuliebe kehrte er nach Potsdam zurück, und dort brauchte es nur wenige Wochen, bis sie wieder in den alten Verhaltensmustern feststeckten. Der Job zehrte sie auf. Sie fanden nur selten Zeit füreinander. Im Justizzentrum trafen sie sich auf den Gängen. Zuweilen bearbeiteten sie Fälle zusammen, aber gemeinsame Unternehmungen gab es kaum noch.
Auch der heutige Morgen stand unter schlechten Vorzeichen. Im Kommissariat waren sie chronisch unterbesetzt. Toni hatte Bereitschaft, die schon fast zu einem Dauerzustand geworden war. Jederzeit konnte er zu einem Tatort gerufen werden. So passte es zu der allgemeinen Situation, als sein Smartphone vibrierte.
Mit einem Seufzen zog er das Gerät aus seiner Trainingsjacke und wischte über das Display. Er checkte den Posteingang und stieß auf eine Nachricht seiner Mutter.
Von seiner Mutter?
Das war ungewöhnlich!
Er war bei ihr aufgewachsen. Seinen Vater lernte er erst im Alter von sechs Jahren kennen und unterhielt bis zu dessen überraschendem Tod ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm. Seine Eltern waren nie ein Paar gewesen und hatten den sporadischen Kontakt noch vor Tonis Geburt eingestellt. Insofern schätzte er seine Zeugung als ungewollt ein.
Seit 2001 lebte Vera Sanftleben in Portugal. Jetzt schrieb sie, dass sie gestern Abend von Lissabon nach München geflogen sei und derzeit in einem Zug nach Berlin sitze. Gegen neun Uhr früh werde sie in Potsdam eintreffen. Sie wolle ihm keine Umstände machen, deshalb habe sie sich ein Hotelzimmer in Bahnhofsnähe genommen, aber es sei wichtig, dass sie sich träfen. Ob er heute mit ihr zu Mittag essen könne?
»Joggen wir, oder musst du los?«, fragte Caren. Sie war näher getreten und schaute ihn erwartungsvoll an.
»Das ist kein neuer Fall«, erwiderte Toni und klärte sie über den Inhalt der Mitteilung auf.
»Deine Mutter kommt? Und das sagst du erst jetzt?«
»Ich habe es gerade erst erfahren.«
»Ich möchte sie kennenlernen. Wie lange bleibt sie in Potsdam?«
»Keine Ahnung. Das hat sie nicht geschrieben. Ein paar Tage vielleicht.«
»Ich nehme mir ab sofort frei. Und ich muss gleich nach Hause, um die Wohnung aufzuräumen. Das Laufen verschieben wir auf ein anderes Mal.«
»Warte!« Toni war verwundert. Normalerweise hetzte Caren von einem Termin zum anderen. Jetzt wollte sie alle Besprechungen sausen lassen, um Zeit mit seiner Mutter zu verbringen. »Mach dir bitte keine Umstände. Sie steht nicht gerne im Mittelpunkt, es ist ihr unangenehm.«
Caren neigte den Kopf zur Seite. »Ich weiß, dass du ein schwieriges Verhältnis zu ihr hast, und ich will mich bestimmt nicht aufdrängen, aber ich möchte so gerne mehr über dich erfahren.«
»Ich würde mich schon freuen, wenn du dabei wärst.«
»Also ist es abgemacht. Nun muss ich los. Sag mir Bescheid, wo wir uns treffen. Bis später.«
»Aber erwarte nicht zu viel«, rief Toni ihr nach und beobachtete, wie Caren unter Deck verschwand, wie sie mit ihrer Tasche wiederauftauchte und winkend über den Steg zum Parkplatz lief, wo sie ihren Wagen abgestellt hatte. Sie verschwand aus seinem Blickfeld. Kurz darauf startete in der Ferne ein Motor.
Dann muss ich wohl allein joggen, dachte Toni und schrieb seiner Mutter, dass er sich über ihren Besuch freue, dass er sich gern Zeit nehme und dass er sie über den Treffpunkt noch informiere. Er schickte die Nachricht ab und begann mit den Aufwärmübungen für die Beine.
Als sein Smartphone erneut vibrierte, vermutete er, dass seine Mutter geantwortet hatte, aber es war die Einsatzleitstelle. Ihm wurde mitgeteilt, dass man in einem Bootshaus in Werder drei menschliche Skelette gefunden hatte, die möglicherweise Opfer eines Tötungsdelikts geworden waren.
Zerknirscht steckte Toni das Handy weg. Nun konnte er seine Trainingspläne endgültig begraben.
2
Auf der Autofahrt nach Werder merkte Toni, dass er beunruhigt war. Zunächst konnte er das Gefühl nicht richtig einordnen. Erst als er genauer in sich hineinhorchte, begriff er die Zusammenhänge.
Seine Mutter war nicht der Typ, der überraschend handelte. Alles Spontane und Unvorhergesehene versetzte sie in Panik. In den letzten zwanzig Jahren hatten sie selten miteinander telefoniert, gesehen hatten sie sich nur ein paarmal. Die Begegnungen waren Monate im Voraus geplant worden. Ihr jetziges Verhalten war nicht nur untypisch, sondern alarmierend.
Toni schaltete einen Gang runter und nahm im Kreisel bei Geltow die erste Ausfahrt. Seine Mutter war mittlerweile in einem Alter, in dem jeder Tag ihr letzter sein konnte. Er hoffte, dass sie nicht erkrankt war oder dass etwas Schlimmes geschehen war.
Wenig später passierte er das Ortsschild von Werder, bog von der Potsdamer Straße ab und rollte eine Sackgasse hinunter, bis ihm die Weiterfahrt durch verschiedene Einsatzfahrzeuge versperrt wurde. Um keinen der Wagen zu blockieren, wendete er den Peugeot, parkte ihn ein Stück abseits und stieg aus.
Die Bebauung ringsum war uneinheitlich. Alte Einfamilienhäuser standen zwischen modernen Architektenentwürfen und Schuppen, die gewerblich genutzt wurden. Die glitzernde Havel floss in wenigen Metern Entfernung vorüber. Eine leichte Junibrise wehte landeinwärts und trug Blütenduft mit sich.
Toni zwängte sich zwischen den Transportern der Gerichtsmedizin und der KTU hindurch und erblickte ein zweieinhalbgeschossiges Gebäude, das sich an der Zieladresse erhob. Es befand sich in einem maroden Zustand, aber es beschwor augenblicklich Bilder herauf, wie nobel das Anwesen aussehen könnte, wenn man es fachgerecht restaurieren würde.
Der Eigentümer hatte vermutlich ähnliche Überlegungen angestellt, als er sein Geld in die Hand nahm, um Baugerüste errichten zu lassen. Die Fassade würde schon bald einen neuen Außenputz erhalten. Das Dach wurde bereits mit roten Biberschwanz-Ziegeln eingedeckt.
Toni begab sich über platt getretene Beete zur Rückseite. Der Garten war mit Büschen und Obstbäumen zugewuchert und mutete märchenhaft an. Das Ufergrundstück zog sich wie ein langer Schlauch zur Wasserkante hin, wo sich eine Steganlage und ein abgerissenes Bootshaus befanden, von dem nur noch eine halbe Wand aufragte. Überall rannten Einsatzkräfte umher.
Endlich entdeckte Toni Kriminalkommissar Nguyen Duc Phong. Seine Eltern waren als Boatpeople aus Vietnam nach Deutschland gekommen. Von der Statur her ähnelte er einem klein geratenen Sumoringer, der nach Beendigung seiner Karriere an Pfunden zugelegt hatte. Bei den Ermittlungen war er lange für Arbeiten zuständig gewesen, die vom Büro aus erledigt werden konnten. Nach einer fehlgeschlagenen Diät und einer unerwiderten Liebe hatte er das Computerdasein beendet und sich ins Leben gestürzt, was sich in vielerlei Hinsicht auswirkte. Die Kassenbrille hatte er gegen ein Goldrandgestell mit bläulich getönten Gläsern getauscht. Statt T-Shirts mit Rockstars darauf trug er weiße Hemden, deren oberste Knöpfe er offen stehen ließ. An seinem Handgelenk glitzerte das massive Gliederarmband einer Uhr. In seiner Freizeit nahm er an Karaokewettbewerben teil und hatte mit einer Weihnachtsschnulze einen ersten Preis gewonnen.
»Morgen«, sagte Toni und stutzte plötzlich. »Was hast du da am Hals? Ist das ein Knutschfleck?«
»Ach, nichts«, erwiderte Phong. »Ich kann dir schon einen Überblick geben. Heute Morgen haben die Bauarbeiter mit dem Abriss des Bootshauses begonnen. Im Inneren befand sich ein Behältnis aus Ziegelsteinen, das ungefähr zwei Meter zwanzig lang, einen Meter breit und neunzig Zentimeter tief war. Oben war es zugemauert.«
»Ungewöhnlich!«
»Wieso?«
»Na, es sieht so aus, als wäre das Bootshaus klein gewesen. Bei so beengten Verhältnissen wird jeder Quadratzentimeter genutzt. Und wenn das Behältnis zugemauert war, konnte es bestenfalls als Bank oder Ablegeort dienen. Wahrscheinlich wurde es mal zur Aufbewahrung von Schiffsleinen, Netzen und Fendern verwendet. Dann wurde der Deckel entfernt, und es wurde zu einem Sarg umfunktioniert.«
»Oder es wurde extra zur Aufnahme der Leichname gebaut.«
»Auch möglich, ja.«
»Nach der Größe der Knochen zu urteilen, handelt es sich um Erwachsene. Das Geschlecht lässt sich erst nach der Analyse zweifelsfrei bestimmen, aber es sind mindestens zwei Männer. Eins könnte auch von einer Frau stammen. Da ist sich die Gerichtsmedizinerin nicht sicher.«
»Hat sie sich schon zum Todeszeitraum oder der Todesursache geäußert?«
»Du weißt doch, wie sie ist. Am liebsten würde sie gar nichts sagen, solange sie nicht ihren Stempel draufdrücken kann. Fest steht, dass die drei schon vor Jahren, vielleicht vor Jahrzehnten gestorben sind. Einer trug Kleidung, die uns vielleicht Hinweise gibt.«
»Was für Sachen?«
»Es sieht so aus, als hätte er eine Uniform angehabt. Die Knöpfe und der Mützenschirm sind halbwegs erhalten und könnten bei der Identifizierung helfen.«
Toni war skeptisch. Deutschland war ein Land mit einer langen Militärtradition. Millionen Söhne hatten Drillichmonturen getragen. Hinzu kamen die Besatzungsmächte. »Warten wir es ab. Und die Todesursache?«
»Alle Skelette weisen Spuren von Schussverletzungen auf. Wenn die Wunden nicht post mortem zugefügt wurden, dürften sie tödlich gewesen sein.«
»Das klingt fast nach einer Exekution.«
»Oder sie haben sich gegenseitig abgeknallt. Ein Vierter überlebt und lässt die Leichen verschwinden.«
»Sind Geschosse oder Hülsen sichergestellt worden?«
»Ziemlich verrottet, aber ja. Wir haben verschiedene Durchmesser. Es wurden Schüsse aus mindestens zwei Handfeuerwaffen abgegeben. Über das Kaliber können wir vielleicht die Pistolen bestimmen.«
»Was wissen wir über den Eigentümer?«
»Ein junger Mann aus Potsdam. Er macht was mit IT oder Werbung und hat das Anwesen vor einem halben Jahr gekauft. Die Bauarbeiter haben mir Namen, Telefonnummer und Anschrift notiert«, sagte Phong und wedelte mit einem zerknitterten Zettel.
Toni schnappte sich das Papier. »Das übernehme ich. Du fährst ins Kommissariat und stimmst dich mit dem Staatsanwalt ab. Hinterher erforschst du die Geschichte des Hauses. Die Unterlagen aus Grundbuchamt und Bauamt sind vielleicht hilfreich. Ansonsten telefonierst du die Nachbarn ab.«
»Toni, ich bin kein Anfänger!«
»So war das auch nicht gemeint. Hinterher komme ich ins Kommissariat, und wir nehmen eine Standortbestimmung vor. Also, bis später.«
Toni machte sich auf den Weg zum Auto. Unterwegs zückte er sein Smartphone und rief den Eigentümer an. Glücklicherweise ging er gleich ran. Obwohl Toni sich vage ausdrückte, erklärte sich der IT-Mann zu einem Treffen bereit. Fragen stellte er keine. Fast schien es so, als wolle er nicht erfahren, was auf seinem Grundstück passiert war.
Oder wusste er es bereits?
3
Sowjetische Besatzungszone, Juni 1949
Vera Sanftleben trug einen vollen Kartoffelsack mit sich, den sie im Tausch gegen drei Kaninchen erhalten hatte. Seit die Neunzehnjährige vor einer Woche erfahren hatte, dass das Geschäft zustande kommen würde, konnte sie nur noch an goldbraune Erdäpfelscheiben denken, die so knusprig gebraten waren, dass sie beim Kauen knackten. Sie konnte sich keinen größeren Genuss vorstellen und hatte letzte Nacht von einem Teller geträumt, der sich wie durch Zauberhand immer wieder füllte.
Der Hunger war zu ihrem ständigen Begleiter geworden. Er hatte unter den Nazis begonnen und sich unter den Sowjets fortgesetzt. In Westdeutschland und in den Berliner Westsektoren füllten sich die Regale wieder. Grundnahrungsmittel und Luxusgüter wie Spirituosen waren verfügbar. Dagegen war im Ostsektor und in der Ostzone von einer Entspannung der Lage nichts zu spüren. Die Versorgung war miserabel, die Rationen fielen so knapp aus, dass sie kaum zum Überleben reichten.
Besonders in den kalten Monaten litten die Menschen, aber Not machte erfinderisch, und Vera hatte schon im ersten Hungerwinter begonnen, Kaninchen zu züchten. Selbst konnte sie den Tieren kein Leid zufügen, aber die meisten Bekannten hatten da weniger Skrupel. Sie gierten nach dem Fleisch und waren für einen Braten bereit, Eingemachtes, Haferflocken oder Speiseöl zu opfern. Manchmal zahlten sie auch mit einem Haarschnitt, einer Klempnerarbeit oder einer Arztbehandlung.
Bei ihren Geschäften ging Vera äußerst diskret vor. Die Hauptumschlagsplätze des Schwarzmarktes hatte sie von Anfang an gemieden und verhandelte nur mit Personen, die ihr empfohlen wurden. Wenn sie – wie heute – eine wertvolle Fracht transportierte, mied sie die Hauptverkehrsstraßen und benutzte Trampelpfade, die größere Umwege bedeuteten. Das war ihr jedoch egal. Die Sicherheit ging vor, und bislang hatten diese Maßnahmen verhindert, dass sie erwischt worden war.
Als sie sich im grünen frühsommerlichen Wald bei Potsdam einer Weggabelung näherte, hörte sie ein metallisches Quietschen. Sie war sofort alarmiert. Mit einer Hand hielt sie den groben Sack fester, mit der anderen tastete sie nach dem Küchenmesser, das in der Tasche ihres Kittels steckte. Sie trug es nicht nur bei sich, um sich bei einem Überfall zu wehren, sondern auch aus einem anderen Grund. Zwar waren die Vergewaltigungen im letzten Winter zurückgegangen, aber in der Nähe der russischen Kasernen gab es noch unzählige Übergriffe auf Frauen und Mädchen.
Bei Kriegsende waren auch Vera schlimme Dinge passiert. Deshalb wusste sie, was sie erwartete, wenn sie einer Horde betrunkener Soldaten ausgeliefert war. Eine solche Gewalt würde sie nicht noch einmal verkraften. Deshalb würde sie sich verteidigen – auch wenn das hieß, dass sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden würde. Keine Strafe konnte so schlimm sein wie das, was ihr als fünfzehnjähriges Mädchen widerfahren war.
Ihre Augenlider flatterten. Die Kiefermuskulatur verspannte sich. Diese körperlichen Reaktionen waren mittlerweile normal. Manchmal reichte der Anblick einer russischen Uniform aus, um sie in Panik zu versetzen.
Heute musste sie jedoch wegen der Kartoffeln die Nerven bewahren. Auf keinen Fall durfte sie kopflos davonrennen. Es würde sowieso nichts bringen. Im Unterholz hätte sie keine Chance. Mit wenigen Sätzen hätten die Soldaten sie eingeholt.
Dann sah Vera sie.
Sie bogen um die Ecke und kamen ihr entgegen.
Glücklicherweise waren es keine Sowjets.
Es waren eine Greisin mit wirrem weißen Haar und ein Junge mit dreckverschmiertem Gesicht, der elf oder zwölf Jahre alt sein mochte. Vielleicht handelte es sich um den Enkel. Beide waren in fadenscheinige Lumpen gekleidet, die nur von wenigen Nähten zusammengehalten wurden. Sie schoben einen alten Kinderwagen vor sich her, der mit irgendetwas so schwer beladen war, dass die Reifen bei jeder Umdrehung schrille Töne von sich gaben.
Vor lauter Erleichterung öffnete Vera den Mund und schnappte nach Luft. Sie hatte gar nicht gemerkt, dass sie den Atem angehalten hatte. Knapp nickte sie den beiden Gestalten zu, die sie aus leeren Augen betrachteten und vorüberzogen.
Obwohl der Krieg schon vier Jahre beendet war, begegnete man solchen Gespenstern öfters. Es handelte sich um Vertriebene, Flüchtlinge, ausländische Kollaborateure, Ausgebombte, Kriegsversehrte, KZ-Häftlinge und ehemalige Zwangsarbeiter. Ganz Deutschland war voll von diesem menschlichen Treibgut, das keine Heimat hatte und bestenfalls geduldet wurde.
An manchen Tagen fühlte sie sich mit den Entwurzelten verbunden, dann spülten dunkle Erinnerungen hoch. Ihr Blickwinkel verengte sich, und die Schatten wurden länger. Wenn sie in solchen Momenten nicht aufpasste, öffnete sich ein Schlund, in den sie ins Bodenlose stürzte. Düstere Grübeleien übernahmen das Kommando und entwickelten eine beängstigende Kraft, der sie kaum etwas entgegenzusetzen hatte. Sie sprach sich selbst die Existenzberechtigung ab, und ihre Argumente klangen so einleuchtend, dass sie keinen Ausweg mehr sah. Einmal hatte sie auf der zugefrorenen Havel gestanden, wo sie in das verlassene Loch eines Eisanglers gestarrt hatte. Sie hatte sich auch schon auf dem Geländer einer Eisenbahnbrücke sitzend wiedergefunden.
Aber nicht heute!
Heute war sie nur noch fünf Minuten vom Garten entfernt. Alle kritischen Streckenpunkte hatte sie passiert, und sie war zuversichtlich, dass sie den restlichen Weg unbehelligt zurücklegen konnte.
Später würde noch ihr guter Freund Thomas vorbeikommen, der versprochen hatte, Schinkenspeck und Rahmbutter mitzubringen. Solche Delikatessen hatte sie schon seit Monaten nicht mehr auf dem Tisch gehabt. Ja, ein voller Magen war das höchste der Gefühle. Er genügte in diesen Zeiten vollkommen, um so etwas wie Glück zu empfinden.
***
Drei Stunden später saß Vera vor der Gartenhütte und konnte sich kaum noch rühren. Sie hatte gegessen, bis sie keinen Gabelbissen mehr hinunterbekommen hatte. Gerade kostete sie es aus, einfach satt zu sein. Mit geschlossenen Augen spürte sie der wunderbaren Trägheit nach, die sich ihrer bemächtigt hatte.
»Hast du es schon gehört?«, fragte Thomas, der neben ihr Platz genommen hatte. »Auf der Berliner Museumsinsel öffnet die Nationalgalerie. Lass uns am Wochenende hinfahren.«
Vera blinzelte. Die nachmittägliche Sonne stand hoch am Himmel, aber im Schatten des Mirabellenbaums ließ es sich gut aushalten. »Hier sprießt alles so schön«, sagte sie. »Außerdem muss ich mich um die Beete kümmern. Die Schnecken fressen sonst alles weg.«
»Ich könnte dir helfen. Dann wärst du schneller fertig.«
»Danke für das Angebot, aber ehrlich gesagt habe ich keine Lust auf die Trümmer.«
»Du warst schon länger nicht mehr in der Stadt. Du würdest sie nicht wiedererkennen. Da weht ein völlig neuer Geist. Alles ist im Aufbruch. In den Straßen kann man die Kraft spüren. Auch der kleinste Arbeiter kann eine wichtige Rolle übernehmen.«
»Lass uns nicht über Politik reden.«
»Jedenfalls kann ich am Sonntag den Wagen meines Vaters haben. Wir hätten so viel Sprit zur Verfügung, wie wir brauchen.«
»Ich wusste gar nicht, dass du Auto fahren kannst.«
»Es gibt so einiges, was du nicht über mich weißt.«
Vera schmunzelte. »Aha.«
»Wir könnten uns auch die Humboldt-Uni anschauen und uns unter die Studenten mischen. Ich helfe höchstens noch zwei Jahre beim Aufbau der Verwaltung, dann fange ich mit dem Studium an. Meinst du, dass die Gesellschaftswissenschaften zu mir passen würden?«
Vera spürte einen Stich in der Brust und setzte sich auf, um Thomas besser zu betrachten. Er blickte vollkommen arglos drein. Im Grunde hatte sie auch nicht erwartet, dass er in böser Absicht gesprochen hatte. Er war einer ihrer ältesten Freunde und hatte zur selben Clique gehört wie Christoph und sie, bevor die Sowjets viele Jungen verhaftet hatten. Thomas war verschont geblieben, weil er alles in sich aufgesogen hatte, was die neue Führung angeboten hatte.
Normalerweise war er mit seinem dunkelblonden Haar, dem blassen Gesicht und der schmalen Statur eher jemand, der schnell übersehen wurde, aber in ihrer Gegenwart kam er aus sich heraus und konnte zeigen, was für ein feiner Mensch in ihm steckte. In den letzten Jahren war er ein mitfühlender und loyaler Gefährte gewesen.
Vera konnte ihm unmöglich übel nehmen, dass er sich an den Möglichkeiten erfreute, die ihm die Machthaber in Aussicht stellten. Wegen seiner familiären Herkunft lag eine glänzende Zukunft vor ihm. Sein Vater war unter den Nazis Dreher bei Siemens gewesen und hatte im Untergrund für die Widerstandsgruppe um Anton Saefkow gearbeitet. 1944 erließ der Volksgerichtshof »wegen Feindbegünstigung und Vorbereitung zum Hochverrat« ein Todesurteil gegen ihn. Glücklicherweise wurde es nicht mehr vollstreckt. 1946 wurde er Mitglied der SED und legte eine steile Karriere hin. Fahrdienstleiter im Bezirksamt Pankow, Bürgermeister und KPD-Instrukteur von Luckenwalde und Erster Sekretär der SED-Kreisleitung dort hießen die Stationen. Derzeit wurde er für ein noch höheres Amt vorbereitet. Er unterhielt persönliche Verbindungen zu vielen Funktionären und hatte seinem Sohn eine gute Stellung verschafft.
Thomas merkte, dass etwas nicht stimmte. »Was ist mit deinen Studienplänen?«, fragte er behutsam. »Hast du dich beworben?«
Vera hatte vergangenes Jahr als Jüngste ihrer Jahrgangsstufe das Abitur bestanden und Einsen in den Naturwissenschaften und in Mathematik erhalten. Trotzdem hatte sie keine Chance auf die Zulassung. »Das bringt nichts«, erwiderte sie.
»Ich finde, dass du es zumindest versuchen solltest.«
»Ach ja? Unter den Nazis durfte niemand studieren, der keine arische Großmutter hatte, und unter den neuen Herren darf niemand studieren, der nicht aus einer Arbeiter- oder Bauernfamilie stammt. Ich …«, sagte sie und unterbrach sich lieber.
Vera wollte ihre Fluchtpläne nicht verraten. Zwar vertraute sie Thomas, und irgendwann würde sie ihn einweihen, aber sie wollte nicht voreilig sein. Zuerst musste sie noch etwas erledigen.
Christoph war vor dreieinhalb Jahren verhaftet worden. Niemand hatte seitdem von ihm oder den anderen Jungen gehört. Selbst Thomas’ Vater mit seinen Verbindungen hatte nichts in Erfahrung bringen können und war für seine Nachforschungen gerügt worden.
Trotzdem wollte Vera nicht aufgeben. Irgendwie musste sie herausfinden, was mit Christoph geschehen war und wo er jetzt steckte. Sie musste Kontakt zu ihm aufnehmen und ihn wissen lassen, dass sie beabsichtigte, in den Berliner Westsektor zu gehen, wo es im letzten Dezember eine Reaktion auf die Instrumentalisierung der Humboldt-Universität im Ostsektor gegeben hatte.
Im US-amerikanischen Stadtteil Zehlendorf war die Freie Universität gegründet worden, in der allein das Leistungsprinzip zählte. Jeder konnte sich unabhängig von seiner familiären Herkunft einschreiben. Für sie war es genau der richtige Ort, um ein Physikstudium aufzunehmen.
»Die Sowjets sind nicht so schlecht, wie du glaubst«, sagte Thomas. »Sie bewirken auch gute Dinge und haben alle Nazis aus den Ämtern entfernt. In Westdeutschland werden sie kaum behelligt. Schau dir nur mal die Richter und Staatsanwälte an, die weiter Recht und Gerechtigkeit repräsentieren und sich ins Fäustchen lachen. Es sind dieselben Männer, die meinen Vater hinrichten wollten, weil er Flugblätter gegen Hitler gedruckt hat.«
Im Hinblick auf die Verfolgung der Nazis hatte er recht, aber seine Sichtweise war zu einseitig, denn die Sowjets setzten ihre Ideen mit größter Brutalität durch. Politisch Andersdenkende wurden beseitigt. Äcker und Produktionsstätten hatte man enteignet. Hoch qualifizierte Arbeiter, Techniker und Konstrukteure waren entführt worden, um deren Fähigkeiten in der Sowjetunion zu nutzen. Zurzeit wurden überall Studenten verhaftet, die sich für die Freiheit der Wissenschaft einsetzten.
In der ganzen Ostzone gab es viele rechtschaffene und gebildete Leute, die einen Beitrag zum Aufbau leisten könnten, die aber nicht in das neue Menschenbild passten und die aus purer Angst das Weite suchten.
Aber von all diesen Dingen wollte sie nicht anfangen. Sie fand es überflüssig, darüber zu diskutieren, ob bei einem revolutionären Umbruch Fehler gemacht werden durften. Für sie war der humanitäre Maßstab entscheidend. Er allein entschied über Schuld und Unschuld. »Hast du vergessen, was sie unseren Freunden angetan haben?«
Thomas schaute sie mit großen Augen an, dann senkte er betreten den Blick.
Diese Reaktion war einer der Gründe, weshalb sie ihn so mochte. Denn bei all seiner ideologischen Begeisterung blieb er ein Mensch. Und sie hoffte, dass er sich diese Qualität erhalten würde, auch wenn er den Parteiapparat erklimmen sollte. Es tat ihr leid, dass sie ihn so grob ausgebremst hatte.
»Ich habe dir doch gesagt, dass wir besser nicht über Politik sprechen«, sagte sie. »Die Tage sind selten so unbeschwert wie heute, und ich möchte die Stimmung nicht kaputt machen.«
»Schon gut. Mir tut es leid, dass ich so dahergeredet habe. Wenn ich bei dir bin, fühle ich mich frei, und dann achte ich nicht auf meine Worte. Natürlich habe ich Christoph und die anderen nicht vergessen. Die Verhaftungen liegen bloß so lange zurück, und die Erinnerungen verblassen. Mir kommt es vor, als hätte das in einem früheren Leben stattgefunden.«
»Ich weiß«, sagte sie.
Eine Weile saßen sie schweigend zusammen. Jeder hing seinen Gedanken nach.
»Was möchtest du denn sonst machen?«, fragte Thomas.
»Wie wäre es mit einer Partie Schach?«, erwiderte Vera.
»Du willst mich nur an die Wand spielen.«
»Hast du Angst?«
»Ich hätte eindeutig weniger Angst, wenn du ohne Dame antreten würdest.«
»Abgemacht. Ich bin gleich wieder da«, sagte Vera und begab sich in die Holzhütte, um das Brett und die Figuren zu holen. In diesem Augenblick glaubte sie, dass sie den frühsommerlichen Juninachmittag gegen die lauernde Dunkelheit verteidigt hatte.
Sie sollte sich täuschen.
4
Der Eigentümer der Villa wohnte in der Nedlitzer Straße in Potsdam-Bornstedt. Toni parkte auf der Rückseite des lang gestreckten Komplexes zwischen zwei Kleinwagen.
Auf der Herfahrt war ihm eingefallen, wo er sich mit seiner Mutter treffen könnte, und er schrieb ihr eine Nachricht. Er könne gegen zwölf Uhr bei »Mövenpick« sein, tippte er ins Smartphone. Das Restaurant liege in Nachbarschaft zum Schloss Sanssouci und der alten Mühle und sei leicht zu finden.
Toni steckte das Handy zufrieden weg. Seine Mutter war mittlerweile am Potsdamer Hauptbahnhof eingetroffen und hatte ihr Hotelzimmer bezogen. Jetzt blieb ihr genügend Zeit, um sich auszuruhen und sich frisch zu machen. Sie war eher der vergeistigte Typ und konnte kulinarischen Dingen nicht viel abgewinnen. Wahrscheinlich würde sie die leckere Küche kaum beachten, aber das tolle Ambiente würde sie ganz sicher beeindrucken.
Guten Mutes stieg er aus und sah sich um. Das Mietshaus wirkte gepflegt und beherbergte auch WGs von Studenten, die wegen der vernünftigen Preise, der guten Verkehrsanbindung und der Nähe zu den Uni-Standorten herzogen.
Am Eingang befand sich ein Fahrradständer, der um diese Uhrzeit freie Plätze aufwies. Während Toni auf den Klingelknopf drückte, donnerte hinter ihm der Verkehr auf der B 2 vorüber. Zur Rushhour war hier noch mehr los, und es kam zu Staus.
Toni hatte sich die Wohnadresse eines wohlhabenden IT- oder Werbemannes nicht so bodenständig, sondern glamouröser vorgestellt. Vielleicht war er auch in die Klischeefalle getappt. Als der Summer ertönte, drückte er die Tür auf und sprang die Stufen im Treppenhaus hoch.
Im zweiten Geschoss traf er auf einen Mann, der ihn in der offenen Wohnungstür erwartete. Er mochte Mitte zwanzig sein und schaute desillusioniert drein. Die dunkelblonden Haare lichteten sich bereits und standen strohig vom Kopf ab. Er trug einen kurzen Vollbart; möglicherweise war er auch unrasiert. Kaffeeflecken zierten Sweatshirt und Jogginghose. Von den apfelgrünen Stricksocken standen kleine Wollbällchen ab.
»Nils Jockel?«, fragte Toni und zeigte seinen Dienstausweis.
Der Mann besah das Dokument so gründlich, als würde er die Angaben auswendig lernen, und reichte es zurück. Dann schlurfte er in seine Wohnung und ließ die Tür offen stehen.
Toni verstand das als Einladung und folgte Jockel in ein Arbeitszimmer, das von einem Schreibtisch mit vier riesigen Monitoren dominiert wurde und zum Parkplatz rausging. Auf der Fensterbank waberte eine Lavalampe. Die in der Ecke stehende Wasserpfeife hatte den Umfang eines Truthahns.
Bei dem Telefonat hatte Toni nur Andeutungen gemacht, weil er die Reaktion auf die Mitteilung sehen wollte, dass auf dem Grundstück drei Skelette gefunden worden waren. Jetzt war er unsicher, ob er überhaupt richtig war. »Sie sind der Eigentümer der Havelvilla?«
Jockel setzte sich nickend auf den Bürostuhl, schlug ein Bein über das andere und drehte sich eine Zigarette. Dabei rieselten Tabakkrümel auf den Laminatfußboden, was ihn nicht zu stören schien.
Toni wusste immer noch nicht, was er von der Sache halten sollte. »Bei den derzeitigen Preisen dürfte das Anwesen bestimmt zwei Millionen wert sein. Dazu kommt die kostspielige Instandsetzung. Was machen Sie beruflich? Ich meine: genau.«
»Ich bin Informatikstudent und programmiere eine App für Trödelhändler. Bin aber noch nicht fertig. Und eigentlich zweifle ich auch, dass irgendjemand sie runterlädt. Ist wohl eine dumme Idee.«
»Dann haben Sie das Haus geerbt?«
»Nee, nee. Gekauft«, sagte Jockel und steckte sich die Kippe in den Mund. Sie sah so krumm aus, als könnte sie auseinanderbröseln. Vergeblich klopfte er seine Taschen nach einem Feuerzeug ab. »Haben Sie Streichhölzer?«
Toni schüttelte den Kopf. »Woher haben Sie so viel Geld?«
Jockel seufzte und klemmte sich die Selbstgedrehte hinters Ohr. »Die Frage musste ja kommen. Als Vierzehnjähriger habe ich ein Spiel programmiert. Bei Klositzungen sollte es mir die Zeit vertreiben. Wirklich nichts Besonderes.«
»Und damit haben Sie genug verdient, um sich eine solche Villa zu leisten?«
»Total abgedreht, oder? Mit meinem aktuellen Wissen könnte ich so was Kindisches nicht mehr schreiben, aber damals habe ich mir keinen Kopf gemacht. Die App steht seit elf Jahren in den Charts. Heutzutage wäre ein solcher Erfolg nicht mehr möglich; heutzutage sind die Entwickler froh, wenn sie ihre Unkosten reinkriegen. Die Goldgräberstimmung ist längst vorbei.«
»Dann können Sie ja von Glück reden, dass Sie noch einen Treffer gelandet haben.«
»Könnte man denken.«
»Aber?«
»Aber damals war ich plötzlich der Erfinder vom Scheißhaus-Bingo. Das Spiel heißt anders, aber meine Freunde haben es so genannt.«
»Klingt ziemlich verächtlich. Wahrscheinlich waren die Jungs nur neidisch.«
Jockel betrachtete ihn aufmerksam. »Kann sein, aber das ändert nichts. Die Leute wurden komisch. Ich hatte plötzlich Kumpel, die mich früher nicht mit dem Hintern angeguckt haben. Mein Onkel wollte sich eine größere Summe leihen, um eine Cocktailbar aufzumachen. Als ich ihm das Geld nicht geben wollte, hat er mich jahrelang bei den Leuten schlechtgemacht. Meine Schwestern bettelten, dass ich ihnen Reisen, Pferde und Auslandssemester spendiere. Es wurde alles zu viel. Vorher war ich Nils und hinterher der neureiche Programmierer vom Scheißhaus-Bingo.« Jockel zuckte deprimiert mit den Schultern.
Toni ersparte sich die Bemerkung, dass es Schlimmeres auf der Welt gab, als ein volles Bankkonto zu haben. »Wenn Sie so vermögend sind, warum leben Sie dann hier und nicht in einem Loft in der Innenstadt?«
»Ich komme aus Cottbus und bin extra nach Potsdam gezogen, damit mich niemand kennt. Hier wollte ich nur ein Student sein.«
»Aber ein normaler Student kauft sich keine Villa in Werder.«
Jockel seufzte. »Ich habe verrücktgespielt. So was passiert mir eigentlich nie.«
»Was war los?«
»Ach, ich hatte eine chinesische Freundin, Shuilian. Die war echt super! Nicht nur schlau, sondern eine richtig tolle Powerfrau. Mit der Zeit wurde ich so eine Art Projekt für sie.«
»Das müssen Sie mir erklären.«
»Na, ich habe mich ihr anvertraut und alles erzählt. Von dem Geld, von meiner Familie und von Cottbus. Sie sagte sofort, dass ich ein Glückspilz sei und dass ich aus der Chance was machen müsse. Konkret meinte sie, dass ich aus viel Geld noch mehr Geld machen solle. Also beschäftigte ich mich mit der Börse. Ich setzte mich total unter Druck, um die Sache richtig anzugehen, aber der ganze Finanzkram stresste mich so, dass ich gar nichts mehr auf die Reihe bekam und nur noch abhing. In dieser Zeit ließ sich Shuilian mit meinem Sparkassenberater ein. Der war immer gut drauf und trug einen Anzug. Da habe ich rotgesehen und diese Villa gekauft, nur um den beiden zu zeigen, dass ich es kann. Das war natürlich hirnrissig. Mein Mitbewohner und meine Kommilitonen wundern sich schon, warum ich ständig mit dem Bus nach Werder fahre. Wenn ich auffliege, geht alles von vorne los.«
Toni ließ diese Geschichte sacken. »Interessiert es sie gar nicht, weshalb ich hier bin?«
»Ich weiß nicht, ob ich noch eine Schreckensnachricht vertrage.«
»Da, schauen Sie mal«, sagte Toni und zeigte auf ein Feuerzeug, das unter einem Comic hervorlugte.
»Oh, danke!«
»In Ihrem Bootshaus wurden drei Skelette gefunden, die in einem Behältnis eingemauert waren und schon viele Jahre tot sein dürften.«
Jockel nickte grimmig. Er zündete sich die Selbstgedrehte an und zog so heftig an ihr, als wäre diese Zigarette das letzte Reale in einer Welt, die immer mehr aus den Fugen geriet.
»Fällt Ihnen etwas dazu ein?«, fragte Toni. »Hat der Vorbesitzer irgendeine Bemerkung fallen gelassen, die Ihnen in diesem Zusammenhang komisch erscheint? Wie lief der Verkauf ab?«
»Ganz normal. Ich habe die Villa über eine Anzeige im Internet entdeckt. Ein Maklerbüro meldete sich. Die waren voll nett und hatten zufällig einen Architekten und eine Baufirma zur Hand. Deshalb habe ich auch nicht gefeilscht und den All-inclusive-Service gebucht. Mit dem Vorbesitzer hatte ich nie Kontakt. Ich kenne seinen Namen nur aus dem Kaufvertrag.«
Toni bat um den Namen des Maklerbüros, des Vorbesitzers und fotografierte die notariell beglaubigten Papiere ab. In ihm hatte sich die Überzeugung verfestigt, dass der Eigentümer nichts Weiteres zur Aufklärung beitragen konnte. Toni verabschiedete sich und wollte gehen.
Da sagte Jockel: »Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber vor acht oder neun Tagen hat sich eine Journalistin gemeldet und gefragt, ob sie sich im Haus und auf dem Grundstück umschauen könnte.«
»Eine Journalistin? Wieso?«
»Sie hat irgendwas von alten Zeiten und vom Havelland erzählt. Klang ziemlich schwammig. Ich hatte den Eindruck, dass sie was verheimlicht. Letztendlich habe ich ihr die Besichtigung unter der Bedingung erlaubt, dass ich den Artikel absegnen möchte und dass sie mich nicht namentlich nennen darf.«
»Und? Hat sie sich umgesehen?«
»Nee. Sie hat sich weder auf der Baustelle gemeldet, noch hat sie mich wieder angerufen.«
»Wie hieß sie?«
»Katharina. Den Nachnamen weiß ich nicht mehr. Sie schreibt für die Märkische Allgemeine und ist wohl für Falkensee zuständig.«
Wenig später verließ Toni das Mietshaus, rief Phong an und bat ihn, die Kontaktdaten der Redakteurin zu ermitteln und ihm aufs Smartphone zu schicken. Er wollte herausfinden, welcher Story die Journalistin auf der Spur war und ob sie von den Skeletten wusste.
Doch zunächst setzte er sich in den Peugeot und fuhr Richtung Park Sanssouci, um seine Mutter zu treffen. Er fragte sich, was sie zu diesem Überraschungsbesuch veranlasst hatte.
5
Im Biergarten des »Mövenpick«-Restaurants boten die hohen Kastanienbäume und die aufgespannten Schirme Schutz vor der Sonne, die – sobald sie zwischen den Wolken auftauchte – vom Himmel niederbrannte und Toni den Schweiß aus den Poren trieb.
Auf der Terrasse hatte er einen Tisch ergattert, von dem seine Mutter einen Blick auf das Schloss und die alte Mühle haben würde. Er war schon früher gern hergekommen. Nicht nur, weil sein Sohn Aroon, der mittlerweile erwachsen war und als Mathematiker in den Vereinigten Staaten lebte, nach den Eisbechern verlangt hatte, sondern auch, weil hier eine besondere Atmosphäre herrschte.
Neben den Einheimischen kehrten Touristen ein, die sich nach der Besichtigung der prachtvollen Bauten und Parkanlagen stärkten. Auch heute war das Publikum international. Hungrige Asiaten vertilgten Spezialitäten des Hauses. Am Nebentisch saß ein Backpacker-Pärchen aus Südamerika, das die Köpfe über einem Reiseführer zusammensteckte.
In Toni erwachte das Fernweh. Warum packten sie nicht einfach ihre Rucksäcke, um den nächsten Flieger zu besteigen? Er bedachte Caren mit einem abenteuerlustigen Blick, den sie vollkommen missverstand.
»Ich bin nicht nervös«, sagte sie. »Du brauchst auch keine Angst zu haben, dass ich so eine Schwiegermutter-Schwiegertochter-Geschichte anzettele. Ich will sie nur mal kennenlernen, und du kannst dir sicher sein, dass ich merke, wann ich mich zurücknehmen muss.«
»Das weiß ich doch«, erwiderte Toni. Allein ihre Aufmachung war schon ein diplomatisches Meisterwerk. In der Vergangenheit musste sie herausgehört haben, dass seine Mutter ein zurückhaltender Mensch war. Und so hatte Caren auf allen Schnickschnack verzichtet. Mit dem schlichten Pulli, dem Silberring und der dezenten Chinohose wirkte sie wie eine Unidozentin. Wieder einmal hatte sie ihre Wandelbarkeit bewiesen.
»Ich glaube, da ist sie!«, rief er und sprang von seinem Stuhl auf.
Am Biergarteneingang hielt ein Taxi. Der Fahrer stieg aus, eilte um die Kühlerhaube herum und öffnete die Tür. Er half einer betagten weißhaarigen Dame heraus, bei der es sich eindeutig um Vera Sanftleben handelte.
Natürlich kannte Toni ihr hohes Alter, aber in seiner Erinnerung war sie eine Frau, die allein zurechtkam und Wert auf ihre Selbstständigkeit legte. Obwohl sie sich bemühte, den Rücken durchzustrecken und sich gerade zu halten, wirkte sie sehr zerbrechlich. Sie so schwach zu sehen, erschütterte ihn.
Toni eilte ihr entgegen und bremste sein Tempo abrupt ab, als sie den Kopf hob und ihn aus steingrauen Augen anschaute. Seine freudige Unruhe erhielt einen Dämpfer. Er wusste, dass sie von zu viel Nähe und spontanen Gefühlsäußerungen schnell überfordert war.
»Mama«, sagte er und hielt ihr seinen Unterarm hin, den sie glücklicherweise ergriff. »Ich hoffe, dass du gut hergefunden hast.«
»Du vergisst, dass ich früher hier gelebt habe. Einige Häuser und Straßen mögen neu sein, aber im Großen und Ganzen hat sich der Stadtplan nicht geändert.«