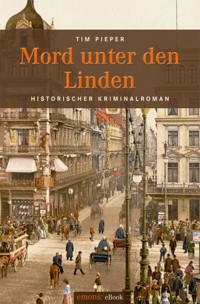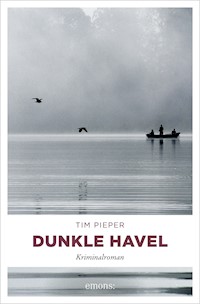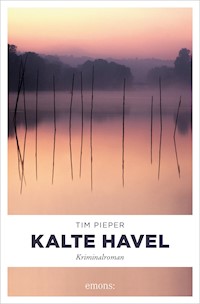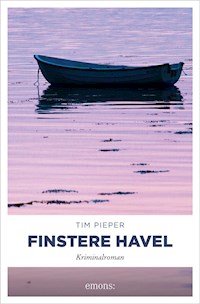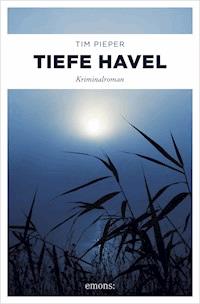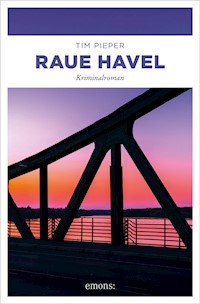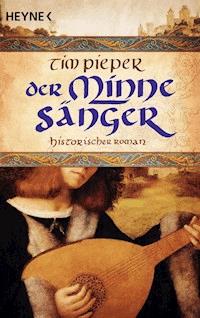Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Toni Sanftleben
- Sprache: Deutsch
Klug konstruiert, authentisch und fesselnd – Toni Sanftlebens neuester Fall führt tief in die dunkle Vergangenheit der Havelregion. Potsdam. Im Park Sanssouci wird ein Kunstsachverständiger erschlagen aufgefunden. Der Tote zeigte zuletzt auffälliges Interesse an einem wertvollen Gemälde im Museum Barberini, auf dem eine schwarz gekleidete Frau zu sehen ist. Doch sie trägt einen Schleier, der ihr Gesicht verhüllt, und ihre Identität ist nicht geklärt. Wer ist die Unbekannte? Seine Nachforschungen führen Hauptkommissar Toni Sanftleben zum Filmunternehmen Ufa und zu einer alten Havelvilla, hinter deren Mauern sich etwas Ungeheuerliches verbirgt.hreckliches Geheimnis verbirgt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tim Pieper, geboren 1970 in Stade, studierte nach einer Weltreise Neuere und Ältere deutsche Literatur und Recht. Mit seiner Familie lebt er nur wenige Kilometer vor den Toren Potsdams. Er nutzt jede Gelegenheit, um die Geschichte und die reizvolle Landschaft der Region mit dem Fahrrad zu erkunden.
www.timpieper.net
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Das Zitat »Ich glaube an die Wiedergeburt. Wir alle sterben ja nicht. Wir gehen durch ein nur scheinbar dunkles Tor ins nächste Leben«1 ist eine Äußerung von Magda Goebbels gegenüber ihrer Freundin Ello Quandt (vgl. Anja Klabunde, »Magda Goebbels«, München 1999, S. 315). Das Zitat »Lass Dich nicht vom Lärm der Welt, der nun einsetzen wird, verwirren. Die Lügen werden eines Tages in sich zusammenbrechen und über ihnen wird wieder die Wahrheit triumphieren. Es wird die Stunde sein, da wir über allem stehen, rein und makellos, so wie unser Glaube und Streben immer gewesen ist«2 stammt aus dem Abschiedsbrief von Joseph Goebbels an seinen Stiefsohn Harald Quandt.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2019 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Helgi/photocase.de
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Carlos Westerkamp
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-554-1
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Glaube denen, die die Wahrheit suchen,und zweifle an denen, die sie gefunden haben.
Prolog
Montauk auf Long Island, Vereinigte Staaten, 1969
Die Fenster des Ateliers standen weit offen. Lydia konnte den Atlantischen Ozean hören, der nur einen Steinwurf entfernt lag. Ununterbrochen brandeten die Wellen an und verbreiteten einen intensiven Salzgeruch. Draußen war ein sonniger Tag, und es flutete so viel Licht herein, dass auch die hintersten Ecken ausgeleuchtet waren.
Seit einer Stunde posierte Lydia auf dem harten Schemel. Über ihrem Gesicht lag ein Schleier aus Kunstfaser, der ihre Haut jucken ließ. Unter dem schwarzen Kostüm rann der Schweiß hinunter. Trotzdem hielt sie still; sie rührte sich keinen Zentimeter. Zu groß war die Angst vor ihrem Ehemann Arvid, der ungeduldig auf und ab lief und hektisch an seiner Zigarette zog.
»Stellen Sie endlich das Gedudel ab!«, sagte Arvid. Er hasste diese Songs, die sich mit seinem Verständnis von Musik nicht vertrugen.
»Zeigen Sie mal Respekt, junger Mann«, erwiderte Jackson Tannebaum und führte den Pinsel über die Leinwand. Der rüstige Maler mit deutschen Wurzeln hatte schlohweißes Haar und ein wettergegerbtes Gesicht, das von seinen langen Küstenwanderungen herrührte. Obwohl er bald seinen achtzigsten Geburtstag feiern würde, hing in seinem Mundwinkel eine Kippe, die einen dünnen Rauchfaden absonderte. »Wenn Sie Bob Dylan nicht mögen, sollten Sie einen Strandspaziergang unternehmen. Das fegt den Kopf klar. Sie bringen hier sowieso nur Unruhe rein.«
»Wissen Sie eigentlich, wie viel ich Ihnen zahle?«, sagte Arvid. Es fiel ihm sichtlich schwer, sich zusammenzureißen. Er wirkte, als könnte er jeden Moment explodieren. Auch sonst war er mit seinem akkuraten Seitenscheitel fehl am Platz.
»Guten Service bekommen Sie im Ritz-Carlton«, antwortete Tannebaum. »Ich bin für die Kunst zuständig, und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass ich nur Schund produziere, wenn Sie mir ständig über die Schulter schauen.«
»Sie …«, setzte Arvid an und unterbrach sich lieber. Er war es nicht gewohnt, dass ihm jemand Paroli bot. Seine Angestellten lasen ihm jeden Wunsch von den Lippen ab. Sie wussten genau, dass Widerworte nicht gut für die Karriere waren. Doch den berühmten Maler wollte er nicht vor den Kopf stoßen. Zu viel stand auf dem Spiel.
Der Radiosender unterbrach das Musikprogramm für die Nachrichten. Lydias Englisch war nicht gut genug, um jedes Wort zu verstehen, aber sie begriff, dass John Lennon und Yoko Ono ein Bed-in veranstalteten. Dabei saßen sie in Nachtzeug auf einem Hotelbett, gaben Interviews und demonstrierten gegen den Vietnamkrieg. Manchmal konnte Lydia kaum fassen, wie sich die Sitten verändert hatten. Schon plärrte ein neuer Song aus den Boxen. Der Interpret hieß Otis Redding.
Ihr Mann Arvid schnipste mit den Fingern, um ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Lautlos formte er mit den Lippen die Worte: In einer halben Stunde bin ich zurück. Er warf ihr einen warnenden Blick zu, riss den Sommermantel von der Garderobe und stapfte durch die Terrassentür nach draußen, wo er in den gleißenden Sonnenschein eintauchte. Mit seinen langen Beinen stürmte er am Pool vorbei, kletterte die Düne hoch und verschwand zwischen den wogenden Gräsern.
»Ist der immer so?«, fragte Tannebaum.
Lydia zuckte müde mit den Achseln.
»Geht es noch, oder sollen wir eine Pause einlegen?«, erkundigte sich der Maler.
»Wir machen weiter«, entschied Lydia und straffte sich. »Er kann böse werden, wenn er nicht bekommt, was er will.«
»Sie sind sehr diszipliniert«, sagte Tannebaum anerkennend und mischte neue Farbe an.
Eine missbilligende Falte grub sich zwischen ihre Augenbrauen. Der Maler redete beinahe so, als wäre ihre Selbstbeherrschung eine Überraschung. Wenn sie nicht schon früh auf sich geachtet hätte, wäre sie als Animierdame in einem schäbigen Tanzlokal geendet. Alles, was sie konnte, hatte sie sich hart erarbeitet. Sie war achtundvierzig Jahre alt und ein Profi. Lydia hielt das verschleierte Gesicht so, wie es für das Porträt notwendig war.
Mittlerweile wusste sie, warum dieses Bild Arvid so viel bedeutete. Die vergangenen Jahre waren nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Dieses Gemälde war seine Wiederauferstehung. Es erinnerte ihn an alles, was ihm wichtig war. Wenigstens dieses Kunstwerk sollte perfekt sein und seiner Idealvorstellung entsprechen.
Um es zu realisieren, war ihm nichts zu teuer gewesen. Die Kleidung hatte er nach Fotovorgaben von einem deutschen Modeschöpfer schneidern lassen, der in Paris gerade Furore machte. Für eine phantastische Summe hatte er Jackson Tannebaum engagiert, der schon zu Lebzeiten eine Legende war und in den großen europäischen Museen ausgestellt wurde. Im Nebenraum wartete eine Maskenbildnerin, die mit zahlreichen Hollywoodstars gearbeitet hatte und die beginnenden Alterserscheinungen an Lydias Hals und ihren Händen retuschierte.
Arvid überließ nichts dem Zufall und verfolgte sein Ziel mit einer Leidenschaft, die an Besessenheit grenzte. So war er schon vor vielen Jahren gewesen, als sie sich kennengelernt hatten. Damals waren sie gut füreinander gewesen. Mittlerweile war ihre Ehe nur noch ein Kartenhaus, das jederzeit einstürzen konnte. Der Schmerz saß zu tief, um zur Tagesordnung zurückzukehren.
Lydia wusste, dass die Geschehnisse auch sie verändert hatten. Meistens konnte sie sich zusammenreißen, aber an manchen Tagen fürchtete sie sich sogar vor ihrem eigenen Schatten. Aus heiterem Himmel konnte sie eine so heftige Wehmut erfassen, dass sie tagelang nur weinte. Sie spürte, dass sie endlich loslassen musste. Alles in ihr verlangte nach Aufbruch, nach Neuanfang. Mit jeder Faser ihres Leibes sehnte sie sich zurück ans Licht.
Sie musste sich nur trauen.
1
Am Büfett lud sich Toni Sanftleben Garnelen, spanische Würstchen und Balsamicozwiebeln auf den Teller. Längst bereute er, dass er die Einladung zum Brunch angenommen hatte. Schon sein Äußeres machte ihn zum Außenseiter. Seine dunklen Locken waren zu lang. Die Muschelkette hatte ihm ein französischer Althippie am Strand von Goa geschenkt. Und die Beatstiefel mussten dringend besohlt werden. Die anderen Gäste hatten sich herausgeputzt und waren schick gekleidet. Normalerweise mied er solche Gesellschaften. Er hatte nur der Gastgeberin zuliebe eine Ausnahme gemacht.
Toni ging durch die helle Dachgeschosswohnung zu dem langen Esstisch und rückte den Stuhl heran. Er griff nach dem Besteck und widmete sich den Tapas. Links und rechts von ihm schwatzten Männer und Frauen in den mittleren Jahren durcheinander. Sie waren solche Situationen gewohnt und feuerten im Minutentakt witzige Bemerkungen ab, die alle zum Lachen brachten. Am Anfang hatte er versucht, sich in das Gespräch zu integrieren, aber seine Beiträge waren zu ernst gewesen. Er hatte nicht den richtigen Ton getroffen. Irgendwann hatte er es aufgegeben.
Glücklicherweise hatten die meisten Gäste ein Einsehen mit ihm und ließen ihn in Ruhe. Nur Lars nicht, der eine Rechtsanwaltskanzlei leitete und eigentlich ganz nett war. Leider hatte er es sich in den Kopf gesetzt, ihn aufzulockern. Er verfolgte sein Ziel mit solcher Beharrlichkeit, dass er Toni allmählich auf die Nerven ging. Schon wieder stand Lars auf, griff nach einer Flasche Crémant und trat viel zu dicht an ihn heran.
»Einen … einen zum Anstoßen«, sagte Lars schwer. Obwohl es noch nicht Mittag war, hatte er ordentlich einen sitzen. Schon senkte er den Arm, um ihm einzuschenken.
Toni gelang es gerade noch, seine Hand über das Glas zu schieben. »Danke«, sagte er. »Für mich nicht. Ich hab dir ja schon erzählt, dass ich Kriminalkommissar bin und Bereitschaft habe.«
Lars blickte ihn mit einem Hundeblick an. Mit seinen sorgfältig geschnittenen Haaren, dem Bauchansatz und den hellbraunen Cordhosen gewann er bestimmt schnell das Vertrauen seiner Klienten. »Gegen … gegen ein Schlückchen wird doch niemand was haben.«
»Ich bleib bei Zitronenlimonade«, sagte Toni und nahm demonstrativ einen Schluck.
Lars schwankte und schaute ratlos drein, bis er seine Chance erkannte. Das Glas war frei. Sofort senkte er den Flaschenhals.
»Nein, hab ich gesagt«, zischte Toni und fuhr blitzschnell den Arm aus.
Die Bewegung kam zu überraschend.
Lars kippte den Crémant auf Tonis Pulliärmel. »Oh!«, sagte der Rechtsanwalt.
Der Geruch war jetzt überall und stieg Toni aufreizend in die Nase. »Verdammt. Fünf Mal hab ich Nein gesagt. Kapierst du es nicht? Ich bin trockener Alkoholiker und darf nichts trinken.«
Schlagartig war es still an der Tafel. Die Gäste starrten ihn an, als hätte er soeben einen Mord gestanden. Nur die Gastgeberin betrachtete ihn gelassen. Staatsanwältin Caren Winter wusste Bescheid und akzeptierte, dass er auf bestimmte Getränke und Schmerzmittel verzichten musste.
In den vergangenen Jahren hatten sie eng zusammengearbeitet und dabei erfahren, dass sie sich auch in schwierigen Situationen aufeinander verlassen konnten. Ihr Umgang war durch Vertrauen und Loyalität geprägt. Toni hatte nie viele Freunde besessen. Wenn sich jemand diese Bezeichnung verdient hatte, dann war es Caren.
Sie nickte ihm aufmunternd zu und begann beiläufig ein Gespräch mit ihrem Nebenmann, als wäre nichts geschehen. Bald war die ganze Runde wieder damit beschäftigt, zu essen, zu trinken und lustige Bemerkungen abzufeuern. Lars trottete mit hängenden Schultern zu seinem Platz.
Warum hast du auch nicht zugehört?, dachte Toni.
Er erhob sich von seinem Stuhl und ging ins Badezimmer, wo er als Erstes den Pulli auszog und den klebrigen Arm abspülte. Zwar besuchte er regelmäßig die Gruppenabende und war seit dem letzten Rückfall stabil, aber mit dem Alkoholgeruch in der Nase konnte er sich nicht konzentrieren. Glücklicherweise trug er ein T-Shirt drunter, mit dem er sich sehen lassen konnte. Den Pulli stopfte er in einen Hygienebeutel und verknotete ihn.
Leider war es zu früh, um sich zu verabschieden. Wenn er Caren nicht enttäuschen wollte, musste er noch durchhalten. Toni wollte sich gerade zurück an die Tafel begeben, als sein Smartphone vibrierte. Er zog es aus der Hosentasche und überflog die Nachricht. Im Park Sanssouci war ein männlicher Leichnam entdeckt worden. Auf der Karte im Mailanhang war der Fundort markiert. Der Einsatz kam wie gerufen.
Toni öffnete die Badezimmertür und stieß im Flur mit Caren zusammen, die wohl auf ihn gewartet hatte.
»Bitte entschuldige«, sagte sie. »Lars meint es nicht so. Er ist ein lieber Kerl. Manchmal weiß er nur nicht, wann Schluss ist.«
»Schon gut«, erwiderte Toni. »Er konnte ja nicht ahnen, dass ich ein Alkoholproblem habe. Leider muss ich jetzt los.«
Caren nickte. »Ich hab die Nachricht auch bekommen. Du weißt ja, dass ich zwei Wochen Urlaub habe. Dieses Mal wirst du mit meinem Stellvertreter vorliebnehmen müssen. Schön, dass du da warst«, sagte sie, stellte sich auf die Zehenspitzen und umarmte ihn so fest, dass er ihre Brüste spürte. Ihr Parfüm war betörend.
»Du hast dir so viel Mühe gegeben«, sagte er und machte sich leicht benebelt los. »Ich hab schon lange nicht mehr so gut gegessen.«
»Schmeichler«, erwiderte sie und lächelte erwartungsvoll. Die halblangen blonden Haare umrahmten ihr attraktives Gesicht. Ihre Augen funkelten türkis, die Zähne waren weiß und ebenmäßig. »Ich will mir in Potsdam ein paar schöne Tage machen. Sollen wir kommende Woche zusammen essen gehen?«
»Gerne, meld dich einfach.«
Er strich ihr freundschaftlich über die Schulter und verließ die Dachgeschosswohnung. Als er die Stufen hinuntersprang, war er erleichtert, dass er sich nun einem Gebiet zuwenden konnte, auf dem er sich sicher fühlte.
Draußen war es spätsommerlich warm. Zügig ging er zum Auto und entdeckte den Kratzer sofort. Es sah so aus, als hätte jemand einen Schraubenzieher über den Lack gezogen. Die Vordertür, die Hintertür und der Kotflügel waren betroffen. Das war ärgerlich, weil der Wagen vor nicht allzu langer Zeit einen Schaden an beinahe derselben Stelle abbekommen hatte.
Toni atmete tief durch, machte mit seinem Smartphone Fotos und stieg ein. Nachdem er den Motor gestartet hatte, fuhr er los. Auf jeden Fall musste er den Kratzer aktenkundig machen. Das war bestimmt kein Zufall. In seinem Beruf hatte er viele Feinde.
2
Von der Großen Weinmeisterstraße lenkte Toni das Auto auf den Voltaireweg, der auf den Park Sanssouci zuführte. Er passierte das prachtvolle Schloss, den Ruinenberg und die historische Mühle, wo sich zahlreiche Touristen tummelten.
Die historischen Bauten lenkten ihn ab. Immer wenn er die Sehenswürdigkeiten erblickte, befiel ihn der Wunsch, die Zeit des Preußenkönigs näher zu studieren. Zu Hause fehlte ihm jedoch die Muße, um sich auf einen Geschichtswälzer einzulassen. So verschob er die Lektüre auf einen späteren Zeitpunkt.
Toni umkurvte den alten Weinberg und fuhr die Eichenallee hoch, bis er bei einigen Einsatzfahrzeugen parkte. Der Fundort der Leiche befand sich zwischen dem Belvedere auf dem Klausberg und dem Restaurant »Drachenhaus« und war weiträumig abgesperrt.
An dem Flatterband stand eine asiatische Reisegruppe. Die Teilnehmer fotografierten alles, was sie vor die Linse bekamen. Ein junger Polizist wollte sie zum Weitergehen animieren, aber er erntete nur lächelnde Gesichter. Es gab wohl Verständigungsprobleme.
Toni wandte sich an einen älteren Kollegen, der ihn erkannte und passieren ließ. Schon von Weitem hatte er Oberkommissarin Gesa Müsebeck entdeckt, die schneller vor Ort gewesen war.
Gesa hatte einen dunklen Kurzhaarschnitt und verzichtete auf die Betonung ihrer Weiblichkeit. Mit ihrem kurzärmeligen Outdoorhemd, den Cargohosen und Schnürschuhen war sie zweckmäßig gekleidet. Ihre kompakte Figur rundete den Eindruck vom praktischen Typ ab, den sie auch in dem dreiköpfigen Ermittlungsteam verkörperte. Sie verlor nie den Überblick und vertrat meistens bodenständige Ansichten.
»Wo haben sie dich denn hergeholt?«, fragte sie. »Du siehst irgendwie zerknittert aus.«
Toni winkte ab. Er wollte nicht über sein gesellschaftliches Versagen und den Lackschaden nachdenken. »Erzähl mir lieber, was wir hier haben.«
»Das Opfer wurde zwischen den Büschen gefunden. Wir können davon ausgehen, dass es kein Raubüberfall war. Er hatte alle Wertsachen am Körper. Portemonnaie, Schlüsselbund, Goldkette und Armbanduhr. Nur ein Handy haben die Kollegen vergeblich gesucht.«
»Das muss nichts heißen. Das kann er auch zu Hause vergessen haben.«
»Auf seinem Personalausweis steht, dass er Helmut Lothroh heißt, sechzig Jahre alt ist und in Potsdam wohnt.«
Toni sah sich um. Sie befanden sich auf einem Spazierweg, der links und rechts von hohen Bäumen gesäumt wurde. Er wusste, dass dieser Teil des Parks eher als Geheimtipp galt. Trotzdem war es Sonntagmittag. »Hier waren doch bestimmt schon Spaziergänger unterwegs. Warum haben sie den Leichnam nicht früher entdeckt?«
»Der Täter hatte ihn mit Malervlies, blauen Plastiksäcken und Bauschutt verhüllt. Es sah so aus, als hätte jemand seinen Renovierungsmüll abgeladen. Die Leute sind vorbeigelaufen, ohne etwas zu ahnen. Erst ein Parkangestellter hat sich den Haufen näher angesehen. Dabei ist er dem Opfer auf die Hand getreten.«
»Gut so.«
»Wie bitte?«
»Na, du weißt schon. Der Täter hat uns eine Menge Zeug dagelassen, auf dem wir DNA, Fasern und Fingerabdrücke sichern können.«
»Nicht nur das. Ich hab gerade mit den Kollegen von der KTU gesprochen. Die Spurenlage bietet viele Ansatzpunkte. Es gibt Reifen- und Schuhabdrücke sowie Schleifspuren, die folgenden Hergang nahelegen: Der Täter ist mit einem Wagen vorgefahren, hat den Leichnam unter den Achseln gegriffen und ihn zum Ablegeort gezogen. Danach ist er hin- und hergelaufen, um das Material zu holen, mit dem er den Toten abgedeckt hat.«
»Dann ist das Opfer an einem anderen Ort getötet worden?«
»Sieht so aus. Der Täter hätte ihn natürlich auch transportieren und hier erschlagen können, aber der Todeszeitpunkt war deutlich früher.«
»Konkreter bitte.«
Gesa holte tief Luft. »Unter Vorbehalt hat die Gerichtsmedizinerin sich auf gestern Abend festgelegt.«
»Geht es nicht genauer?«
»Du weißt doch, dass eine Bestimmung kompliziert ist, wenn man die Temperatur der Umgebungsluft am Tatort nicht kennt. Totenflecken und Leichenstarre sind nur ungenaue Parameter, die individuell ausfallen. Ganz grob zwischen achtzehn und vierundzwanzig Uhr, hat sie gesagt. Wir werden die Obduktion abwarten müssen.«
Toni schnaufte unzufrieden.
»Allerdings konnte sie bestimmen, wie lange die Leiche hier gelegen hat«, fuhr Gesa fort. »Das Opfer wurde wahrscheinlich nach drei Uhr morgens abgeladen. Dazu passen auch die Wetteraufzeichnungen. Davor hat es nämlich geregnet. Wenn der Täter früher hier gewesen wäre, wären die Abdrücke und Schleifspuren stärker verwässert. Außerdem sind die Malerutensilien und der Leichnam nahezu trocken. Die paar Tropfen, die sie abbekommen haben, dürften von den Bäumen gefallen sein.«
»Die Uhrzeit liefert uns einen wichtigen Ermittlungsansatz. Hast du schon was veranlasst?«
»An der Zufahrtsstraße gibt es einige Einfamilienhäuser. Ich hab einen Kollegen losgeschickt, um die Anwohner zu befragen.«
»Sehr gut«, sagte Toni und schaute nach oben. Am Himmel schoben sich Wolken zu einer dunklen, dräuenden Masse zusammen. Bald würde der nächste Regenschauer niedergehen. Einigen KTU-Mitarbeitern war der Wetterwechsel ebenfalls aufgefallen. Sie rannten zum Einsatzwagen und holten weiße Zelte, mit denen sie die ungesicherten Spuren abdecken würden.
Am Fundort wies die Gerichtsmedizinerin ihre Gehilfen an, den Leichnam anzuheben und in einen Plastiksack zu legen. Das Opfer war von zierlicher Gestalt und kaum größer als ein Dreizehnjähriger. Sein Nasenrücken ragte empor, und die Augen waren geschlossen. Alle Farbe war aus dem Gesicht gewichen; es war so weiß wie eine Totenmaske aus Gips. Der beinahe friedliche Ausdruck stand im krassen Gegensatz zu dem blutigen Haar am Hinterkopf. Zweifellos war gegen den Schädel massive Gewalt ausgeübt worden.
»Willst du ihn dir näher ansehen?«, fragte Gesa.
»Vielleicht später«, erwiderte Toni. »Vorerst reicht mir die Info, dass er erschlagen wurde. Jetzt lassen wir die Kollegen ihre Arbeit tun und schauen uns die Wohnung des Opfers an. Vielleicht machen wir eine interessante Entdeckung.«
3
Varieté Wintergarten, Berlin, 1938
Lydia saß vor dem Spiegel und schmierte sich Leichner-Theaterschminke ins Gesicht. Im Umkleideraum herrschte ein nervöses Treiben. Sie und die anderen Hiller-Girls bereiteten ihren Auftritt vor. Lore bepinselte ihre Steppschuhe mit Goldbronze. Fiffi bleichte ihren Haaransatz. Hanne dehnte ihre Beinmuskulatur. Frieda trank gegen das Lampenfieber Kirschlikör. Und Traute, ihr Käpt’n-Girl, raste von einer zur anderen und betete die Reihenfolge der Tanznummern vor, damit sich keine Aufstellungsfehler einschlichen.
Endlich wurde die Tür aufgerissen, und Vreni stürmte herein. Sie war die Größte und Strahlendste von ihnen und hatte wunderschöne lange Beine, die schon zahlreiche Titelseiten geziert hatten. Seit einigen Wochen teilten sie sich ein Zimmer. Dabei waren sie zu Freundinnen geworden.
Vreni ging neben ihr in die Knie und plapperte drauflos: »Einer der Beleuchter hat gesagt, dass die gesamte Prominenz anwesend ist. Aus Politik und Gesellschaft, aus Industrie und Wissenschaft, aus Kunst- und Zirkuswelt fehlt niemand, der Rang und Namen hat. In der ersten Reihe soll sogar Dr. Lippert sitzen.«
»Wer?«, fragte Lydia.
»Na, Dr. Lippert. Sag bloß, den kennst du nicht. Das ist der Oberbürgermeister von Berlin.«
Politiker interessierten Lydia nur, wenn sie sich für das Filmwesen einsetzten. »Ist Reichsminister Dr. Goebbels auch da?«
Vreni lachte wild. »Der? Der soll doch so klein sein, dass man ihn mit der Lupe suchen muss.«
Lydia warf der Freundin einen bösen Blick zu. Eigentlich war Vreni ein feiner Kumpel und hatte Talent, aber wenn sie nicht bald ihr loses Mundwerk zähmte und kapierte, worauf es im Leben ankam, würde es ein schlimmes Ende mit ihr nehmen.
Lydia griff nach der Wimperntusche und schaute prüfend in den Spiegel. Mit ihrem schwarzen Haar und der olivfarbenen Haut entsprach sie nicht dem Schönheitsideal der neuen Zeit, aber sie wusste um ihre Ausstrahlung. Ein tiefer Blick von ihr reichte aus, um aus einem gestandenen Mann einen verliebten Trottel zu machen. Ihr Aussehen und ihr Körper waren ihr Kapital, das sie gewinnbringend einsetzen musste, um nicht so zu enden wie ihr jüngster Bruder. Er war im Alter von acht Jahren an der Schwindsucht gestorben, ohne dass er etwas von der Welt gesehen hatte.
Obwohl sie aus einfachen Verhältnissen stammte, hatte sie es mit ihren siebzehn Lenzen schon weit gebracht. Sie war das älteste von fünf Kindern und hatte von klein auf mit anpacken müssen. Nachdem sie die Volksschule beendet hatte, arbeitete sie in der Leipziger Eckkneipe ihres Vaters. Sie begriff schnell, dass sie es war, die den überraschenden Aufschwung bewirkte. Die Trunkenbolde kamen in Scharen, um sie zu begrapschen und ihr schmutzige Worte ins Ohr zu flüstern. Als sie sich bei ihrem Vater beschwerte, bekam sie eine solche Tracht Prügel, dass sie tagelang nicht laufen konnte. In Zukunft ließ sie alle Widerwärtigkeiten über sich ergehen, damit die neu gewonnene Kundschaft nicht vergrault wurde.
Ein sentimentaler Kulissenmaler, der lieber Regisseur geworden wäre, schwärmte ihr bei seinen allabendlichen Besäufnissen von einer glamourösen Filmwelt vor, die so gar keine Ähnlichkeit mit der harten Wirklichkeit hatte, die sie kennengelernt hatte. Sie studierte mehrere Ausgaben einer Illustrierten, in der Interviews mit Stars abgedruckt wurden. So erfuhr sie, dass eine Tanzausbildung als gute Vorbereitung auf den Schauspielerberuf galt.
Sie hatte längst kapiert, dass ein Mädchen ihrer Herkunft jede Gelegenheit nutzen musste. Also schlug Lydia dem Kulissenmaler einen Handel vor. Sie bot ihm ihre Unschuld gegen einen Vorstellungstermin an der Opernballettschule am Neuen Theater an. Der Kulissenmaler stimmte sofort zu. Lydia wusste nicht genau, worauf sie sich eingelassen hatte, aber der Abstecher auf den Hinterhof war so schnell vorüber, dass sie sich hinterher nur an einen kurzen Schmerz, ein paar feuchte Küsse und etwas Geschiebe und Gestöhne erinnern sollte.
Die folgenden Tage waren schwieriger. Sie hatte Angst, dass sie schwanger war. Mit niemandem konnte sie reden. Erst als die Regelblutung einsetzte und der Kulissenmaler ein Treffen arrangierte, überwog die Freude. Bei der Meisterin machte sie einen guten Eindruck und bekam eine Woche später eine vorläufige Zusage per Post.
Als ihr Vater davon erfuhr, verdrosch er sie mit einem Schürhaken. Dann verbot er ihr die Probezeit. Dieses Mal gab sie nicht klein bei. Zum ersten Mal hatte sie ein Ziel. Mit blutiger Nase drohte sie ihm, ein Riesengeschrei zu machen, wenn sich einer der Suffbrüder das nächste Mal an ihr rieb. Außerdem gab sie zu bedenken, dass kein Gast kommen würde, um sie in diesem Zustand zu sehen. Als sie versprach, an den freien Abenden zu kellnern, stimmte er widerstrebend zu.
Die Ballettausbildung ging sie mit einem unbändigen Willen an und überwand alle körperlichen Schmerzen und Blessuren. Sie war bei jeder Gelegenheit an der Stange und übte stundenlang weiter, wenn alle anderen Mädchen längst gegangen waren. Tagtäglich machte sie sich bewusst, welches triste Leben sie erwartete, wenn sie versagen sollte.
An einem sonnigen Maitag wurde sie als ordentliche Schülerin aufgenommen. Obwohl sie nicht zu Gefühlsaubrüchen neigte, weinte sie vor Glück und konnte gar nicht mehr aufhören. Sie durchlief die Anfänger- und Abschlussklasse mit Bravour und bekam kurz vor den Prüfungen Besuch von Manfred Cocu. Der Operettendirektor am Centraltheater Dresden hatte mehrere Ausfälle zu beklagen und unterbreitete ihr einen lukrativen Saisonvertrag.
Sie erkannte die Chance, ihr Elternhaus für immer zu verlassen, und unterschrieb sofort. Alle wussten, dass sie wegen ihres Alters gelogen hatte, aber niemand hakte nach. Als sie ihren Vater informierte, bekam er einen Tobsuchtsanfall, spuckte ihr ins Gesicht und schleuderte ihre Habseligkeiten auf die Straße. Wenigstens versuchte er nicht, sie an der Abreise zu hindern.
Nur der Abschied von den Geschwistern fiel ihr schwer. Die Mutter war früh verstorben, und Lydia hatte die Zwillingsbrüder und die Schwester großgezogen und alle Höhen und Tiefen miterlebt. Zwar waren sie aus dem Gröbsten raus, aber sie würden es in diesem Milieu nicht leicht haben. Beim tränenreichen Abschied versprach sie, Briefe zu schreiben und für sie da zu sein, wenn sie in Not geraten sollten.
In Dresden fand sie sich schnell zurecht und zählte in dem Ballettensemble zu den Fleißigsten. Von ihrer Gage konnte sie sich ein winziges Zimmer leisten. Sie lebte bescheiden, aber glücklich.
Ab Juni ging sie mit dem Höler-Programm »Wer zuletzt lacht, lacht am besten« auf Städtereise. Ein anderes Mädel aus der Truppe war mit Rolf Hiller, dem Impresario der Hiller-Girls, befreundet, der von ihr so beeindruckt war, dass er sie abwerben wollte und ihr ein verlockendes Gehalt von hundertachtzig Mark bot. Freie Kost und Logis inbegriffen.
Sie musste nicht lange überlegen. Die Mädchentruppe war nicht nur in Deutschland bekannt, sondern hatte in ganz Europa einen Namen. Die Tänzerinnen waren für ihre Schönheit und ihre Disziplin berühmt. Aufgrund ihres Könnens waren sie für das Jubiläumsprogramm zum fünfzigjährigen Bestehen des Berliner Wintergartens engagiert worden.
Und jetzt war sie hier.
Im Weltstadtvarieté!
Im vielleicht bedeutendsten, schönsten und fortschrittlichsten Schauspielhaus des Abendlandes!
Man konnte nie wissen, was das Schicksal als Nächstes bereithielt, aber sie war sich sicher, dass ihr Aufstieg noch nicht beendet war. Möglicherweise saß ihr nächster Entdecker schon im Publikum, möglicherweise war diese Aufführung der Beginn einer Filmkarriere.
Als das Startkommando in den Umkleideraum gezischt wurde, schmiss Lydia die Schminkutensilien auf das Tischchen und stürmte mit den anderen Mädchen nach draußen. Auf der Bühne reihte sie sich nach ihrer Größe ein. Hinter ihnen erhob sich das Brandenburger Tor, das detailgetreu nachgebaut worden war. Ein typischer Geruch hing in der Luft. Es duftete nach Kulissenleim, nach Sägemehl und nach Rupfen, einem derben Stoff, der zur Bespannung von Dekorationen benutzt wurde.
Lydia schulterte das Spielzeuggewehr, nahm Aufstellung und machte ein ernstes Soldatengesicht. Durch den Spalt zwischen den Vorhängen beobachtete sie, wie im Zuschauerraum das Licht erlosch. Das vielstimmige Murmeln wurde leiser, bis es ganz verstummte. Sie spürte ein Ziehen in der Magengegend und ein Kribbeln auf der Haut.
Endlich teilte sich der schwere Samtstoff, und die Scheinwerfer flammten auf. »Ahs« und »Ohs« erklangen. Hinter dem Orchestergraben stiegen die Sitzreihen bis zu den Terrassen an, wo die Gäste an Tischen saßen. Von der Decke hingen zahllose Glühbirnen, die den berühmten Sternenhimmel illuminierten und eine traumhafte Atmosphäre erzeugten. Das Haus war restlos ausverkauft, fast dreitausend Zuschauer hatten sich eingefunden.
Die Kapelle W. Voigt spielte schwungvoll auf, und schon bald warfen Lydia und die anderen Hiller-Girls die Beine beim »Exerziermarsch« so gekonnt hoch, dass spontaner Applaus losbrandete. Auch die folgenden Nummern klappten fehlerlos. Das Publikum schwelgte bei einem Walzer und sprang von den Sitzen auf, als sie in hauchdünnen Kostümen den heißesten Stepp auf die Bretter legten, den die Spreemetropole je gesehen hatte.
Die Aufführung lief perfekt, und als Lydia sich zum Abschluss verbeugte, hatte sie das herrliche Gefühl, dass all diese applaudierenden und johlenden Menschen nur ihretwegen gekommen waren. Sie würde alles tun, damit sie niemals nach Leipzig zurückmusste.
4
Eigentlich fuhr Toni lieber allein zu den Einsatzorten. In Begleitung fühlte er sich nur genötigt, über Belangloses zu reden. Mit Gesa arbeitete er jedoch schon so lange zusammen, dass er ihre Eigenheiten kannte und sich mit ihnen arrangieren konnte.
Wenn es nichts Fallrelevantes zu klären gab, stellte er ihr eine Frage zu ihrer Familie. Meistens hatte sie Lust, von ihren sechs Brüdern und den ganzen Nichten und Neffen zu erzählen, die im Havelland verstreut wohnten. In seltenen Fällen, so wie heute, beschränkte sie sich auf einsilbige Antworten, um ihm zu signalisieren, dass sie lieber aus dem Fenster schaute.
Toni war es recht. Der Regenschauer war vorüber, und er schaltete die Scheibenwischer aus. Ihm kam es nur darauf an, nicht von sich selbst berichten zu müssen. Die Tage vergingen, ohne dass er sie unterscheiden konnte. Meistens arbeitete er bis zum späten Abend und spazierte nachts durch die Straßen, um sich die Beine zu vertreten. Der einzige Höhepunkt waren die Schachpartien mit seinem Sohn, der in den Vereinigten Staaten lebte und nur ungern telefonierte. Die Züge schickten sie sich über Kurzmitteilungen.
Toni war sich darüber im Klaren, dass er in diesem engen Rahmen gut funktionierte. Nicht mehr und nicht weniger. Vielleicht waren ihm gesellschaftliche Ereignisse so unangenehm, weil er glaubte, dass er nichts Interessantes erzählen konnte. Allerdings konnte es genauso gut sein, dass ihn das Gerede von Fremden nicht interessierte und er die Zeit lieber allein verbrachte.
Er setzte den Blinker und bog ab. Die Nabelbeschau führte zu nichts. Er sollte sich lieber auf die kriminalistische Arbeit konzentrieren. Darin konnte er Ergebnisse erzielen.
Das Opfer Helmut Lothroh wohnte in Bornstedt in der Nähe der Biosphäre. Er musste vor Kurzem hergezogen sein, denn Toni erinnerte sich, dass die Mietshäuser noch nicht lange fertiggestellt waren. Direkt vor dem modernen Gebäude fand er einen Parkplatz. Mit den großen Glasflächen, den Stahlträgern und den geräumigen Balkonen wirkte die Wohnanlage attraktiv. Auch die öffentliche Verkehrsanbindung war gut.
Nach dem Klingelschild zu urteilen, wohnte Lothroh im Hochparterre. Gesa zog sich Handschuhe an, holte den Bund aus einer Klarsichttüte und probierte die Schlüssel durch, bis sie die Haustür öffnen und eintreten konnten. Vorbei an dem gläsernen Fahrstuhl und einem angeketteten Kinderwagen stiegen sie einige Stufen hoch. Zwei Wohnungstüren lagen vis-à-vis.
»Hier«, sagte Gesa und zeigte auf ein Metallplättchen mit Namensgravur, das unter den Spion geschraubt war. Sie suchte schon den passenden Schlüssel, als in ihrem Rücken ein langer, hagerer Mann auf den Flur trat. Er hatte einen neongrünen Plastikhelm auf dem Kopf und trug eine regenfeste Fahrradtasche über der Schulter. Mit offenem Mund starrte er sie an.
»Was machen Sie da?«, fragte er. »Herr Lothroh ist nicht zu Hause.«
Toni zückte seinen Dienstausweis. »Hauptkommissar Sanftleben. Und das ist meine Kollegin Oberkommissarin Müsebeck. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie der Nachbar sind?«
»Genau. Trochien. Ralph Trochien. Was ist mit Helmut? Ihm wird doch nichts passiert sein?«
»Herr Lothroh wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Über die näheren Umstände dürfen wir keine Auskünfte geben. Wie gut kannten Sie ihn?«
»Du meine Güte«, sagte Trochien. »Ist es hier passiert? Ich meine, wir haben Kinder. Wenn irgendeine Gefahr droht, dann müssen wir es wissen.«
»In dieser Hinsicht können Sie vollkommen beruhigt sein. Wenn Sie jetzt bitte auf meine Frage antworten würden.«
»Was? Welche Frage?« Trochien schob den Fahrradhelm aus der Stirn.
»Wie gut kannten Sie Herrn Lothroh?«
»Ach so. Nicht so gut. Wir sind zeitgleich eingezogen, aber privat hatten wir nichts miteinander zu tun. Ich bin in der IT-Branche, und Helmut hat was mit Kunst gemacht. Ich glaube, er war Sachverständiger oder so. Meistens hat er in höheren Sphären geschwebt, er war auch ein bisschen eigen. Wir haben uns im Treppenhaus gegrüßt, Pakete für den anderen angenommen und über Mieterangelegenheiten gequatscht. Wir waren beide an einem freundlichen Umgang interessiert. Man muss ja miteinander auskommen, aber das war’s dann schon. Ist er wirklich tot?«
Toni nickte. »Sie nannten Herrn Lothroh eigen? Was meinen Sie damit?«
»Ich kann das nicht genau benennen. Außerdem soll man über Tote nicht schlecht reden.«
»Alles, was Sie uns sagen, behandeln wir vertraulich. Versuchen Sie es mal.«
Trochien runzelte die Stirn. »Es ist nichts vorgefallen oder so. Helmut war immer korrekt, aber … Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, er war mir einfach unsympathisch. Er hatte etwas an sich, das ich nicht mochte. Meiner Frau ging es genauso. Konkreter kann ich nicht werden.«
»Ist Ihnen in den vergangenen Wochen etwas Ungewöhnliches aufgefallen?«
»Nee. Nicht dass ich wüsste.«
»Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?«
»Gestern Abend, als ich heimgekommen bin. Er machte einen ganz normalen Eindruck und wollte gerade los.«
Toni tauschte mit Gesa einen vielsagenden Blick aus und sagte: »Herr Trochien, das ist jetzt wichtig. Erinnern Sie sich, wie spät es war, als Herr Lothroh das Haus verlassen hat?«
»Das war um fünf nach sieben.«
»Sind Sie sicher?«
»Hundertprozentig. Wegen der Kinder versuche ich spätestens um neunzehn Uhr zu Hause zu sein. Meine Frau schafft es sonst nicht. Ich meine: Abendbrot, Zubettbringen, Gutenachtgeschichte und so.«
»Wissen Sie, was er plante?«
»Das hat er nicht gesagt, aber er wollte mit dem Auto los. Der Wagen ist immer noch weg.«
»Was für einen Pkw fährt er?«
»Einen weißen Volvo V60. Schickes Teil. In Potsdam zugelassen. Auf dem Kennzeichen standen seine Initialen, HL.«
»Fällt Ihnen sonst noch etwas ein, das für uns wichtig sein könnte?«
Trochien runzelte wieder die Stirn und schüttelte den Kopf.
»Ihre Aussage hat Relevanz«, sagte Toni. »Es kann sein, dass wir in den nächsten Tagen einen Kollegen vorbeischicken, um ein Protokoll anzufertigen. In diesem Fall wird er sich vorher telefonisch ankündigen, damit Ihnen sein Besuch auch passt. Dann wollen wir Sie nicht länger aufhalten. Danke für Ihre Mithilfe und Ihnen einen schönen Sonntag.«
»Ja, wenn das noch möglich ist«, sagte Trochien und stand unentschlossen im Treppenhaus. Wahrscheinlich überlegte er, ob der Tod des Nachbarn etwas an seinen Plänen änderte. Schließlich sprang er die Stufen hinunter und verließ das Gebäude.
Toni wandte sich an Gesa und sagte: »Denkst du auch, was ich denke?«
»Kann sein«, murmelte Gesa. Sie hatte sich wieder hinabgebeugt, um den passenden Schlüssel für die Wohnungstür zu suchen.
»Lothroh ist in dem vermuteten Todeszeitraum von hier aufgebrochen«, sagte Toni. »Es ist gut möglich, dass er direkt zum Tatort gefahren ist. Wenn wir seinen Wagen haben, finden wir vielleicht die Stelle, an der er umgebracht wurde. Ich werde den Volvo gleich zur Fahndung ausschreiben lassen.«
Kurz nachdem er den Anruf getätigt hatte, öffnete Gesa die Wohnungstür und sagte: »Na endlich!«
Toni streifte Handschuhe über und folgte ihr in das Apartment, das geschmackvoll eingerichtet war. Die wenigen Bauhausmöbel waren sorgfältig ausgewählt worden und harmonierten miteinander. Auf den Fensterbänken standen kleine Holzfiguren. An den Wänden hingen gerahmte Zeichnungen, die mit wenigen Strichen viel ausdrückten. Sie gefielen Toni außerordentlich gut, und neugierig schaute er auf die Signatur, die nur aus den Initialen des Künstlers bestand. Wer sich dahinter verbarg, war eigentlich egal. Mit seinem Beamtengehalt konnte er sich solche Werke sowieso nicht leisten.
Nach der Aussage des Nachbarn konnten sie davon ausgehen, dass der Mord nicht hier geschehen war. Der Zustand der Räume bestätigte diese Vermutung. Alles war sehr aufgeräumt, nirgends waren Kampfspuren oder Blutflecke zu entdecken. Auf dem Küchentisch befanden sich eine leere Teetasse und ein Holzbrettchen. Lothroh hatte eine Mahlzeit zu sich genommen und sie auch beendet. Nichts sprach für einen überstürzten Aufbruch.
Die Nahrungsaufnahme war kriminalistisch interessant. Toni machte mit dem Smartphone Fotos von dem Messer, auf dem sich Rückstände von einer roten Marmelade und einem Streichfett befanden, außerdem von einem Salbeiteebeutel, der in der Spüle lag. Im Kühlschrank stieß er auf ein Glas mit Himbeergelee und auf eine Packung Butter, die er ebenfalls ablichtete. Die Krümel auf dem Brettchen stammten von einem Vollkornbackerzeugnis. In einem Brotkorb fand er einen Laib, von dem einige Scheiben abgeschnitten waren.
Er öffnete sein E-Mail-Postfach und schrieb der Gerichtsmedizinerin, dass das Opfer vor neunzehn Uhr fünf Nahrung zu sich genommen hatte. Die Fotos hängte er an. Der Zustand des Mageninhalts konnte eine große Hilfe sein. Der Verdauungsprozess variierte zwar individuell und ließ keine exakten Rückschlüsse zu, aber er lieferte bei der Bestimmung des Todeszeitpunkts einen weiteren wichtigen Anhaltspunkt.
»Kommst du mal?«, rief Gesa.
Toni setzte sich in Bewegung. Er betrat das Arbeitszimmer und sah als Erstes ein Handy und einen Fotoapparat, die auf einem zugeklappten Laptop lagen. Ansonsten bildete dieser Raum eine Ausnahme. So stilvoll und ruhig die übrige Wohnung wirkte, so vollgestellt und betriebsam sah es in diesem Bereich aus. Die Bücherregale bedeckten die Wände bis zur Decke und quollen über vor Aktenordnern, Bildbänden und Enzyklopädien. Auf dem Boden stapelten sich Mappen, Auktionskataloge und Fachzeitschriften, in denen bunte Post-its steckten.
»Vergessen hat er sein Handy jedenfalls nicht«, sagte Toni. »Ansonsten hätte er es nicht so gut sichtbar hingelegt. Entweder hat er auf die Reise ein anderes Mobiltelefon mitgenommen, oder er wollte unterwegs nicht gestört werden.«
»Eine Smartphone-Pause täte mir auch mal ganz gut«, sagte Gesa und deutete auf eine Flipchart, die mitten im Raum stand. »Komisch ist, dass sich bestimmt tausend Bücher um Gemälde, Skulpturen, Ikonen, Geschirr und Nippes drehen. Nur die Fotos auf der Schautafel zeigen Gebäude.«
Toni trat näher. Soweit er auf den ersten Blick erkennen konnte, handelte es sich um Aufnahmen von einer löwengelben Villa, die wohl im neobarocken Stil errichtet worden war, und von einem mehrstöckigen Bürogebäude, das er spontan auf die fünfziger Jahre datierte und das vermutlich auf einem Firmengelände stand. »Zumindest das Wohnhaus könnte sein kunsthistorisches Interesse geweckt haben.«
»Und der Betonklotz?«
Toni zuckte die Achseln. »Am besten nehmen wir den Laptop, das Handy, den Fotoapparat und die Bilder mit. Vielleicht können wir irgendeinen Zusammenhang mit dem Mord herstellen.«
5
Im Kommissariat betraten Toni und Gesa den Besprechungsraum. Nguyen Duc Phong, das dritte Teammitglied, saß bereits am Tisch.
Früher war der Kriminalkommissar mit vietnamesischen Wurzeln ein pummeliger Fastfoodjunkie gewesen. Seit einem Jahr ernährte er sich nach einer Lowcarbdiät, die Kohlehydrate mied und auf Eiweiß und Fetten basierte. Parallel überwachte er seinen Körper mit einer App. Vierzig Kilogramm hatte er mit dieser Methode abgenommen, was bei einem Menschen seiner eher geringen Körpergröße einen immensen Gewichtsverlust darstellte.
Phong hatte das sogenannte Idealgewicht erreicht und müsste gesund wirken. Das Gegenteil war der Fall. Unter seinen Augen hatten sich weiße Ringe gebildet, die ihm ein gespenstisches Aussehen verliehen. Seine Wangen hingen wie erschlaffte Geburtstagsluftballons herab. Regelmäßig bohrte er neue Löcher in den Gürtel, damit die Hose nicht rutschte. Sobald er redete, verbreitete er einen fauligen Mundgeruch. Insgesamt machte er den Eindruck, als würde er an einer schlimmen Krankheit leiden.
In ihrem Ermittlungsteam war Phong für alle Aufgaben zuständig, die vom Büro aus erledigt werden konnten. Er hielt den Kontakt zur Gerichtsmedizin und zur KTU. In beiden Disziplinen hatte er sich ein umfangreiches Wissen angeeignet, das den Ermittlungen häufig diente. Sein Steckenpferd war die Recherche. Im Internet fühlte er sich zu Hause und förderte erstaunliche Erkenntnisse ans Tageslicht. Früher hatte er manchmal Motivationsprobleme gehabt. Momentan kannte sein Arbeitseifer keine Grenzen.
Phong schob seine getönte Brille den Nasenrücken hoch. »Ich hab euch früher erwartet«, sagte er und zog einen schmalen Streifen Roastbeef aus einer Tupperdose. Damit das Blut nicht auf die Tischfläche kleckerte, sperrte er Ober- und Unterkiefer weit auf und ließ den Lappen in den Schlund fallen. Er kaute konzentriert, schluckte geräuschvoll und sagte: »Eure Mappen enthalten alle wichtigen Fakten. Am besten fangen wir gleich an.«
»Phong, weißt du eigentlich, wie viel Antibiotika in deutschem Rindfleisch steckt?«, fragte Gesa. »Damit ruinierst du dir die Darmflora. Und wenn die erst hin ist, fährt dein Immunsystem runter. Dann hast du nicht mehr die Power, um dich zu bewegen. Verstehst du? Es ist ein Teufelskreis. Durch das rote Fleisch nimmst du kurzfristig ab, aber auf lange Sicht wirst du wieder fett.«
»Was?« Phong starrte sie entsetzt an. Schließlich senkte er den Kopf und schaute auf den Bildschirm seines Laptops. Wahrscheinlich überprüfte er ihre Argumentation.
Gesa zwinkerte Toni zu. Sie machte sich einen Spaß daraus, Phong auf den Arm zu nehmen. Auch Toni fand, dass der Kollege mit seiner Ernährungsumstellung übertrieb. Gleichzeitig war es erstaunlich, dass Phong so konsequent blieb. Einerseits musste man ihn wohl bestärken, damit er weiterhin auf sein Essen achtete, andererseits musste man ihn ermahnen, mehr Abwechslung in den Speiseplan zu bringen. Ein solches Gespräch wäre eindeutig die Aufgabe für einen einfühlsamen Ernährungsberater.
Phong hob plötzlich den Kopf, warf Gesa einen trotzigen Blick zu und stopfte sich einen extrablutigen Streifen Roastbeef in den Mund. »Helmut Lothroh ist nicht vorbestraft«, begann er kauend. »Er war als Kunstgutachter für Versicherungen und Privatleute tätig und spürte auch Raubkunst auf. Er hat erst kürzlich ein Madonnenbild zurück nach Potsdam gebracht, das in Stalins Auftrag entwendet wurde und sich lange im Kreml befand. In seinem Beruf war Lothroh gefragt und genoss hohes Ansehen. Auch sonst konnte ich nichts Auffälliges feststellen.«
»Raubkunst ist ein schwieriges Thema und birgt Konfliktpotenzial«, sagte Toni. »Da müssen wir dranbleiben. Parallel sehen wir uns sein Privatleben an. Prüf am besten die Korrespondenz auf dem Smartphone und dem Laptop. Mit irgendjemandem wird er näheren Kontakt gepflegt haben. Hatte er Verwandte, die wir informieren müssen?«
»Eine Schwester.«
»Wer übernimmt das? Am besten gleich nach der Besprechung!«
»Na, unser Stubenhocker bestimmt nicht!«, sagte Gesa und zog einen Flunsch. Angehörigen eine solche Nachricht zu überbringen, war eine schwierige Aufgabe. Niemand erledigte diesen Job gerne.
»Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort.« Phong grinste schadenfroh. Er hatte jetzt wieder Oberwasser. »Ihre Adresse findest du in der Mappe. Sie wohnt in Caputh. Aber jetzt sollten wir uns dem Fundort zuwenden.«
»Natürlich«, sagte Toni. »Dazu wäre ich als Nächstes gekommen.«
»Ich meine«, fuhr Phong hibbelig fort, »mir kommt es komisch vor, dass der Täter den Leichnam abdeckt. Wieso hat er das getan? Es bringt nur Nachteile. Er braucht länger und läuft Gefahr, entdeckt zu werden. Den Toten einfach abzulegen, hätte nur ein paar Sekunden gedauert. Ihn so zu verhüllen, hat bestimmt mehrere Minuten in Anspruch genommen. Ein paar betrunkene Studenten hätten vorbeikommen können. Außerdem hinterlässt er überall Spuren.«
Toni ließ Phong gewähren. Oft sprangen brauchbare Ideen heraus, wenn er sich so ereiferte. »Welche Schlussfolgerung ziehst du daraus?«
»Na, dass er uns auf eine falsche Fährte locken will. Vielleicht war er mit dem Renovierungsmüll unterwegs, aber er gehörte nicht ihm. Oder er hat ihn ganz bewusst mitgenommen und platziert.«
»Du meinst also, dass er den Verdacht auf jemand anders, vielleicht einen Maler- oder Renovierungsbetrieb, lenken wollte?«
»Wäre doch möglich. Außerdem frage ich mich, wieso er den Hang hochgefahren ist. Es gibt nur eine Zufahrtsstraße. Jemand hätte ihm entgegenkommen können.«
»Das sehe ich genauso. Die Aktion war ziemlich riskant.«
Gesas Smartphone meldete sich. Es war die aufgezeichnete Stimme ihrer Lieblingsnichte, die kichernd »Nachricht, Nachricht, Nachricht« plapperte. Nach einem Blick auf das Display sagte die Oberkommissarin: »Die Befragung der Anwohner hat nichts ergeben. Niemand hat etwas bemerkt. Wäre zu dieser Uhrzeit auch ein Wunder gewesen, aber mir fällt noch etwas anderes ein. Das ganze Zeug muss viel Platz eingenommen haben. Außerdem lassen die Reifenabdrücke am Fundort auf einen größeren Wagen, möglicherweise einen Lieferwagen, schließen. Wir sollten die Videos der Verkehrsüberwachung auswerten. Vielleicht landen wir einen Treffer.«
»Gute Idee«, sagte Toni. »Das übernimmst du gleich morgen früh. Konzentrier dich auf die Kameras in der Nähe des Fundorts. Jetzt noch mal zu Phongs Theorie. Ein Punkt kommt mir komisch vor. Wenn uns der Täter tatsächlich behindern wollte, warum lässt er seinem Opfer die Geldbörse, sodass wir ihn sofort identifizieren können? Der Tote befand sich vermutlich über einen längeren Zeitraum in seiner Gewalt. Er hatte genug Zeit, um alle persönlichen Gegenstände verschwinden zu lassen.«
»Gehört alles zum Plan«, sagte Phong geheimnisvoll.
»Wissen wir schon, wie viel Schläge Lothroh auf den Kopf erhalten hat?«, fragte Toni.
»Laut der Gerichtsmedizinerin war es nur einer«, antwortete Gesa. »Der wurde mit großer Wucht ausgeführt. Zur Tatwaffe wollte sie sich noch nicht äußern.«
Toni überlegte, ob sich die Ausführung in das Gesamtbild einfügte. Hatte der Täter aus Wut zugeschlagen? Hatte er erschrocken von seinem Opfer abgelassen? Was war in den Stunden danach geschehen? Hatte er bei dem Toten gesessen, um zu verstehen, was passiert war? Schließlich hatte er unter Entdeckungsgefahr die Leiche abgeladen und abgedeckt. Er hatte Schuhabdrücke hinterlassen, die zu seiner Identifizierung führen könnten. Das alles sah nicht nach Kalkül aus, das alles wirkte eher spontan.
»Vielleicht folgt er tatsächlich einem Plan, der sich uns noch nicht erschließt«, sagte Toni, »aber wir sollten vor allem erwägen, dass seine Handlungen rational nicht nachvollziehbar sind. Möglicherweise befand er sich in einem emotionalen Ausnahmezustand. Wann können wir mit den Berichten aus der KTU rechnen?«
»Morgen im Laufe des Vormittags dürften die ersten Ergebnisse vorliegen«, erwiderte Phong.
»Du hast noch Blut an der Unterlippe«, sagte Toni. »Was ist mit Lothrohs Wagen?«
Phong wischte sich den Mund ab. »Nach dem wird noch gefahndet.«
»Mit der Verkehrsüberwachung und der Spurenlage am Tatort haben wir zwei vielversprechende Ermittlungsansätze«, sagte Toni, »aber wir sollten uns auch intensiv um die Rekonstruktion des Tatabends kümmern. Um neunzehn Uhr fünf hat Lothroh seine Wohnung verlassen. Nur wenig später wurde er getötet. Wenn wir seine letzten Wege rekonstruieren können, haben wir den Tatort, und wenn wir den lokalisiert haben, führt er uns zum Täter.«
6
Potsdam, 1942
An der Station Babelsberg-Ufastadt sprang Lydia aus dem S-Bahn-Waggon. Auf sandigen Wegen hastete sie zwischen Kiefern zu dem berühmten Eingangstor, an dem sich schon zahlreiche Schicksale entschieden hatten. Ihr Herz schlug bis zum Hals, als sie sich mit ihrem Namen vorstellte. Glücklicherweise war der Pförtner informiert worden und führte sie zu einer Holzbank. Hier sollte sie warten, bis jemand sie abholen würde.
Nach und nach trafen die Stars in ihren schicken Cabriolets ein, um sich zu den Dreharbeiten in die Ateliers zu begeben. Produktionsassistenten schleppten Manuskriptstapel, ein Techniker stürmte mit einem Scheinwerfer unter dem Arm vorbei und verschwand in einem Gebäude. Ein beleibter Maskenbildner stieß wütend einen kleinen Rollwagen mit Schminkdöschen vor sich her.
Lydia verfolgte das Treiben fasziniert und saugte alle Eindrücke in sich auf. Dabei hielt sie den Brief, den sie von Dr. Rudolf Langen-Albrecht, dem Ufa-Nachwuchschef, zugeschickt bekommen hatte, wie einen Berechtigungsschein in der Hand. Mit diesem Schreiben konnte sie nachweisen, dass sie einen Grund hatte, sich hier aufzuhalten. Sie kannte den Wortlaut auswendig:
Sehr geehrte Frau Bugalle,
Herr Dr. Unstrut von der Nachwuchsabteilung der Bavaria-Filmkunst München hat mir die Stummtestaufnahmen geschickt, die dieses Jahr von Ihnen gemacht wurden. Bei einem Telefonat berichtete er mir, dass Sie demnächst die Aufnahmeprüfung an der Staatlichen Schauspielschule absolvieren möchten. Vorher würde ich Sie gerne zu Probeaufnahmen hier haben und Ihre Fotogenität prüfen.
Sollte es uns gelingen, Ihre Leinwandeignung nachzuweisen, würde ich mich freuen, Sie in unsere Filmakademie aufnehmen zu dürfen. Unsere Schüler werden von den besten Lehrern des Reiches unterrichtet und erhalten ein Stipendium in Höhe von 400 RM monatlich.
Bitte teilen Sie mir auf telegrafischem Wege mit, ob ich Ihr Interesse wecken konnte. Fahrtkosten in der zweiten Klasse werden Ihnen ersetzt, wenn Sie die Belege mitbringen.
Heil Hitler!
Dr. Rudolf Langen-Albrecht
Ufa Filmkunst G.m.b.H.
Nachwuchsabteilung
Mittlerweile war Lydia einundzwanzig Jahre alt, und sie wusste, dass diese Probeaufnahmen ihre vielleicht letzte Chance waren, im Filmgeschäft Fuß zu fassen. Schon früher hatte es Interessenten gegeben. Während sie mit den Hiller-Girls in verschiedenen Städten gastiert hatte, war sie von Intendanten, Regisseuren, Agenten und Talentsuchern angesprochen worden. Sie alle zeigten sich von ihrem blendenden Aussehen und ihrer Bühnenpräsenz beeindruckt. Trotzdem verloren sie nach einem ersten Treffen das Interesse und meldeten sich nicht mehr.
Lydias Enttäuschung war riesengroß, doch sie stellte Fragen und ließ nicht locker, bis sie eine Erklärung gefunden hatte. Die Wahrheit war niederschmetternd.
Wenn ihr jemand von Shakespeare vorschwärmte, dachte sie allen Ernstes, er rede von einem Leinwandhelden. Wenn jemand Goethe zitierte, hielt sie die Weisheit für einen Kalenderblattspruch. Und wenn sie selbst länger sprach, wurde in jedem Satz deutlich, dass sie aus einfachsten Verhältnissen stammte.
In der Kneipe ihres Vaters und als Tänzerin hatte ihre Erscheinung genügt, aber anspruchsvolle und feingeistige Gesprächspartner konnte sie nicht fesseln. Sie war eine dumme Gans.
Nachdem sie zu dieser Einsicht gelangt war, erwachte ihr Kampfgeist. Lange überlegte sie, wie sie Abhilfe schaffen konnte. Eine Frau sollte nicht klüger als ein Mann erscheinen. Einen höheren Schulabschluss musste sie daher nicht nachholen, aber einfältig durfte sie auch nicht bleiben.
So studierte Lydia Tageszeitungen, den Völkischen Beobachter und Zeitschriften wie »Die junge Dame«, um sich bei Gesprächen interessant zu machen. In Antiquariaten kaufte sie sich Klassiker, von denen alle redeten und die man kennen musste. Zum Lesen hatte sie nie Zeit gehabt, und am Anfang fiel es ihr schwer, einen Wälzer mit mehreren hundert Seiten zu beenden, aber die Fortschritte stellten sich schnell ein. Ihr Wortschatz vergrößerte sich, und sie drückte sich bald gewählter aus.
Regelmäßig unterhielt sie sich mit Traute, die aus dem Raum Hannover stammte und Hochdeutsch sprach. Lydia imitierte die Betonung, und mit der Zeit gelang es ihr, den starken sächsischen Dialekt abzumildern.
Ihre Gage sparte sie eisern, um Unterricht im Benimm, im Gesang und in Sprechtechnik zu nehmen. Die Anleitung durch eine Lehrerin war nur im Urlaub oder an freien Tagen möglich. Wenn sie auf Tournee war, musste sie allein zurechtkommen.
Dann stand sie im Hotelzimmer vor dem Spiegel und absolvierte ihre Stimmübungen: »ha-he-hi-ho-hu« und »ma-me-mi-mo-mu«. Sie rezitierte Verse mit dem Explosivlaut »k«. Ihre Freundin Vreni lachte sie jedes Mal aus. Aber Lydia ließ sich nicht beirren und sang noch die Dur-Tonleiter »do-re-mi-fa-so-la-ti« in verschiedenen Tempi hinterher.
Da rief Vreni vom Bett herüber: »Du solltest lieber mal was Richtiges singen. Hör mal, das habe ich gestern auf einem Zettelchen gelesen, den ich in der Straßenbahn gefunden habe: ›Zehn kleine Meckerlein, die saßen einst beim Wein, der eine machte Goebbels nach, da waren’s nur noch neun. Neun kleine Meckerlein, die haben nachgedacht, dem einen hat man’s angemerkt, da waren’s nur noch acht. Acht kleine Meckerlein, die haben was geschrieben, der eine hat’s veröffentlicht, da waren’s nur noch sieben. Sieben kleine Meckerlein –‹«
Lydia stand der Mund sperrangelweit offen. Sie brauchte ein paar Sekunden, um die Schockstarre zu überwinden. »Hör sofort auf damit«, zischte sie, sprang auf die Füße und öffnete die Zimmertür. Sie schaute nach links und rechts. Glücklicherweise war der Hotelgang leer. »Hast du den Verstand verloren? Wenn du so weitermachst, landen wir noch unterm Fallbeil.«
Vreni zuckte mit den Achseln und griff nach einer Packung JUNO. Sie klopfte eine Zigarette heraus, zündete sie mit einem Streichholz an und inhalierte den Rauch tief.
Lydia musterte sie wütend. Eigentlich nutzte es nichts, ihr ins Gewissen zu reden. Eine Stunde später würde sie alle Mahnungen in den Wind schlagen und den nächsten lebensgefährlichen Unsinn plappern. Sie war unbelehrbar, ein hoffnungsloser Fall. Trotzdem startete Lydia einen weiteren Anlauf: »Wenn du noch einmal so einen Quatsch redest, suche ich mir eine neue Zimmergefährtin. Nur, damit du es weißt. Lore und Hanne würden sich freuen, wenn ich sie frage.«
»Die beiden sind so transusig. Du würdest dich zu Tode langweilen.«
»Aber sie sind unpolitisch.«
»Das bin ich auch«, sagte Vreni verschmitzt. Sie sog an ihrer Zigarette und blies einen schönen Rauchring. »Du bist eine treue Seele. Das hab ich schon bei unserer ersten Begegnung gemerkt. Du würdest mich niemals auf die Straße setzen.«
Das stimmte vielleicht, aber Vreni übersah, dass Lydia auch eine Verantwortung gegenüber ihren Geschwistern trug. Sie schickte regelmäßig Geld nach Leipzig, damit sie etwas aus sich machten. Außerdem hatte sie noch Großes vor; sie wollte ein Star werden und nicht wegen irgendwelcher Blödeleien in einem Lager landen.
»Reiß dich gefälligst zusammen«, sagte sie und beendete das Gespräch, indem sie sich von Vreni abwandte und ihre Gesangs- und Sprechübungen fortsetzte.
Zu ihrer großen Erleichterung zeigte sich, dass sie Takt und Melodie halten konnte. Ihre Stimme hatte eine raue Färbung, die sich dem Zuhörer einprägte. Auch Herrn Hiller blieb ihr Talent nicht verborgen, und er überlegte, ein Lied für sie in das Programm einzubauen, wozu es allerdings nicht mehr kommen sollte.
1941 verließ Lydia die Hiller-Girls, weil nach Ausbruch des Krieges die militärisch anmutenden Tanznummern beim Publikum nicht mehr so viel Beifall fanden. Sie erhielt ein Engagement am Gärtnerplatztheater in München, wo sie eine Rolle in der ›Fledermaus‹-Inszenierung übernahm. So blieb ihr endlich genügend Zeit für regelmäßigen Schauspielunterricht.
Nachdem sie über drei Jahre lang hart an ihrer Allgemeinbildung, ihrem gesellschaftlichen Auftreten und ihren künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten gearbeitet hatte, wurde sie von einem Regisseur der Bavaria Filmkunst gesichtet, der sie zu Stummtestaufnahmen einlud. Diese fielen so erfolgversprechend aus, dass er sie unverzüglich an seine Kollegen in Potsdam schickte, die ständig auf der Suche nach unverbrauchten Gesichtern waren. Wenige Tage später saß Lydia hier, auf dem Ufa-Gelände, am Ziel ihrer Träume.
Mittlerweile hatte sie mit genügend Filmleuten gesprochen, um die Bedeutung von Probeaufnahmen einschätzen zu können. Mit ihnen prüfte man die Eignung und Ausstrahlung eines Kandidaten. Ihr finanzieller und zeitlicher Aufwand war erheblich. Deshalb wurden sie mit außerordentlicher Achtsamkeit durchgeführt. Sie konnten der erste Schritt zu Rollenangeboten sein oder alle Träume zerplatzen lassen. Heute würde sich entscheiden, ob Lydia eine Zukunft als Darstellerin hatte oder Tänzerin bleiben würde.
»Komm mal mit, Mädchen!«, sagte ein Mann, der sich breitbeinig vor ihr aufbaute. Er hatte weit auseinanderstehende Augen, die ihren Körper abtasteten. Auf seinem Hemd klebten Reste der letzten Mahlzeit.
»Sind Sie Herr Langen-Albrecht?«, fragte Lydia erstaunt. Am Telefon hatte sich der Ufa-Nachwuchschef viel kultivierter angehört. Sie erhob sich und wollte ihm das Schreiben reichen.
»Lass mal stecken«, sagte der Mann und grinste. Dabei zeigte er gesunde, kräftige Zähne. »Ich bin der Kostümschneider. Müller zwei.«
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, ging er voraus. Offenbar erwartete er, dass sie ihm folgte. Sein rechtes Bein zog er nach. Möglicherweise trug er eine Prothese. In letzter Zeit sah man häufiger kriegsversehrte Männer.
Schließlich zog Müller zwei einen Schlüsselbund aus der Tasche und öffnete eine schwere Tür. Er gab ihr den Vortritt, und sie betraten den stockdusteren Kleiderfundus, in dem es nach Lavendel roch. Über ihr flammte eine Glühbirne auf, und zahllose Anzüge, Dirndln, Uniformen und Pelzmäntel wurden sichtbar. Sogar eine Ritterrüstung schimmerte matt.
»Der Gewandmeister ist krank, aber er hat was rausgesucht«, sagte Müller zwei. »Wenn es nicht passt, müssen wir noch mal schauen.«
Sie hatte ihre Konfektionsgröße, ihre Maße und die Schuhgröße am Fernsprecher durchgegeben. Jetzt hing an einer Puppe ein schlichtes dunkelblaues Sommerkleid, das ein dezentes Blümchenmuster aufwies. Eine weiße Stickerei zierte den Kragen. Die Ärmel reichten bis zu den Ellbogen. Sie würde darin bieder und ernst aussehen. Der bereitliegende Schmuck, ein einfacher Ehering und ein Kettchen mit Medaillon, würde diesen Eindruck noch verstärken.
Lydia bezweifelte, dass diese Aufmachung geeignet war, um ihren Typ zur Geltung zu bringen, aber sie musste darauf vertrauen, dass die Filmleute etwas in ihr entdeckt hatten, das sie nun in Szene setzen wollten. Halbherzig sah sie sich nach einem Umkleideraum um.
»Nun mach schon«, sagte Müller zwei. Er hatte ein geiles Funkeln in den Augen. »Das ist so beim Film. Manchmal muss es schnell gehen. Wenn du dich anstellst, kannst du die Chose gleich vergessen.«