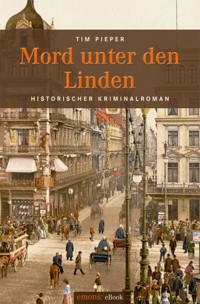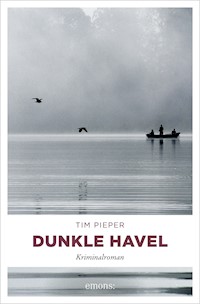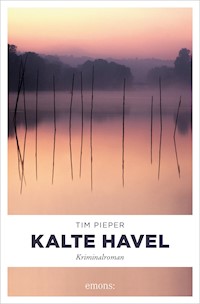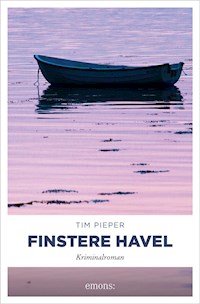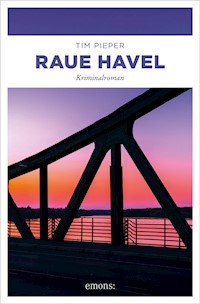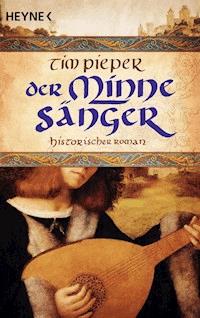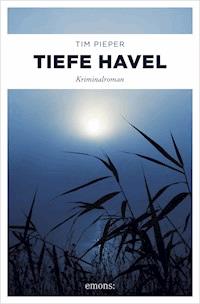
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Toni Sanftleben
- Sprache: Deutsch
Der dritte Fall für Toni Sanftleben. Ein Binnenfrachtschiff treibt im Havelkanal. An Bord liegt der Kapitän, hingerichtet in Profimanier. Erste Hinweise führen den Potsdamer Hauptkommissar Toni Sanftleben ins Berufsschiffermilieu. Doch der Täter hat bereits weiteres Blut an den Händen. Zu spät begreift Toni, dass es um alles geht, auch um seine eigene Zukunft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tim Pieper, geboren 1970 in Stade, studierte nach einer Weltreise Neuere und Ältere deutsche Literatur und Recht. Mit seiner Familie lebt er nur wenige Kilometer vor den Toren Potsdams. Er nutzt jede Gelegenheit, um die Geschichte und die reizvolle Landschaft der Region mit dem Fahrrad zu erkunden. www.timpieper.net
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2018 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: DavidQ/photocase.de Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer Umsetzung: Tobias Doetsch Lektorat: Carlos Westerkamp eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-330-1 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für Steffi, Moritz und Theo
Wir sind, wozu wir uns selbst machen,und nicht, wozu unser Schicksal uns macht.
Émile Coué (1857–1926), französischer Autor
I’m the king of my own land.Facing tempests of dust,I’ll fight until the end.
Prolog
Schiffsführer Jürgen Seitz stand im Ruderhaus der MS»Beate« und hielt beide Hände auf dem Steuerrad. Der Bug des fünfundsiebzig Meter langen Frachtschiffes zerteilte das Wasser und schickte kleine Wellen an die Uferböschungen. Der Dieselmotor stampfte gleichmäßig. Es war ein wolkenloser Spätsommertag, und der Havelkanal reflektierte so viel Sonnenlicht, dass Seitz die Augen zusammenkneifen musste.
So lange hatte er sein Gewissen strapaziert und die Argumente abgewogen. So lange hatte er keinen Schlaf gefunden und mit sich gehadert. Jetzt war er erleichtert, dass er es endlich hinter sich gebracht hatte. Ja, er hatte seinen Teil der Abmachung erfüllt und den Lohn kassiert. Bis zum Schluss war er misstrauisch gewesen, ob sie ihr Versprechen halten würden, aber es hatte keine Schwierigkeiten gegeben. Das rechnete er ihnen hoch an.
Unter normalen Umständen hätte er sich niemals auf einen solchen Handel eingelassen, aber er hatte keine Alternative gesehen. Mehrere Banken hatten ihn abgewiesen. Er sei zu alt, er habe ein schwaches Herz und das Haus sei nicht abbezahlt, hatte ihm der letzte Sachbearbeiter vorgehalten. Der junge Schnösel hatte nicht mal gefragt, warum er den Kredit so dringend brauchte.
Dass Seitz mit seinen sechzig Jahren noch zum Kriminellen wurde, hätte er nicht für möglich gehalten. Sein ganzes Leben hatte er auf ein solides Fundament gestellt, aber das Schicksal war nicht planbar und schlug unbarmherzig zu. Das war eine Erfahrung, die er in den vergangenen Jahren gleich zwei Mal gemacht hatte.
Über den offenen Funkkanal kamen nautische Nachrichten und eine Gefahrenmeldung herein, die ihn nicht betrafen. Prüfend ließ er seinen Blick über die Instrumente streichen. Auf dem Monitor des Inland ECDIS war weit und breit kein anderes Schiff zu sehen. Alles war in bester Ordnung, bis er durch die Frontscheibe beobachtete, wie ein Mann auf das Geländer der Stabbogenbrücke bei Paretz kletterte.
Was hat der Kerl vor?, fragte sich Seitz. Die Höhe war eindeutig zu gering, um sich umzubringen. Wahrscheinlich war er einer dieser Freeclimber, die immer neue Herausforderungen suchten und dabei Kopf und Kragen riskierten. Wie konnte man sich nur freiwillig solchen Gefahren aussetzen?
Das Vorschiff der MS»Beate« erreichte die Brücke, und in diesem Moment ließ der Mann sich fallen. Mit einem lauten Scheppern landete er auf den Platten, die über dem Frachtraum lagen. Er federte den Aufprall ab und richtete sich auf. Aus einer Scheide zog er ein Messer. In seinem Gürtel steckte ein schwarzes Netz. Dann sprang er in den Gang, der zwischen Reling und Frachtraum verlief.
Seitz hatte dem Geschehen wie einem spannenden Fernsehfilm zugeschaut. Jetzt begriff er, dass er ein Teil dieses Schauspiels war. Der Mann hatte es auf ihn abgesehen. Also waren sie aufgeflogen. Sie hatten Mächte herausgefordert, die sie nicht kontrollieren konnten, und die Bluthunde hatten die Jagd eröffnet.
Der Mann näherte sich schnell, und Seitz kapierte, dass er handeln musste. Über Bord zu springen würde nichts bringen. Der Mann würde ihn verfolgen, bis er es zu Ende gebracht hatte. Seitz musste hier und jetzt eine Entscheidung herbeiführen.
Aus der Schublade riss er die Signalpistole und steckte die Patrone hinein. Er stieß die Tür auf, trat aus dem Ruderhaus und visierte den Mann an, der überrascht stehen blieb.
Seitz hatte noch nie auf einen Menschen geschossen, aber er musste es tun.
Für sie!
Für seinen kleinen Engel!
Er allein glaubte noch an sie. Ohne ihn wäre sie verloren.
Der Mann grinste plötzlich und setzte sich wieder in Bewegung.
Seitz wusste, dass er nur einen Schuss hatte. Wenn er den Mann verfehlte, wäre alles umsonst gewesen. In einem Handgemenge hätte er keine Chance.
1
Toni Sanftleben parkte den Peugeot auf dem Kopfsteinpflaster des Resthofs und zog die Handbremse an. Von dem Scheunentor flatterten bunte Bänder. Einige moderne Stahlskulpturen standen neben Kübelpflanzen. Im Rückspiegel tauchte eine Gänsefamilie auf, die in Reih und Glied zum Teich marschierte.
Toni kam gerne her. Der ehemalige Obsthof lag in der Gemeinde Groß Kreutz bei Deetz. Das Landschaftsschutzgebiet Osthavelniederung und die Natur boten einen erholsamen Kontrast zu seiner Arbeit als Hauptkommissar in der Potsdamer Mordkommission. Aus dem Kofferraum holte er einen Karton mit Malzubehör. Die Pinsel, Farben und Blöcke waren für seine Frau bestimmt.
Sofie hatte vor knapp zwei Jahren das gemeinsame Hausboot verlassen, um in der neunköpfigen Wohngemeinschaft ein Zimmer zu beziehen und sich selbst zu finden. Was sich zunächst wie ein Egotrip anhörte, rührte von einer Identitätskrise her, die Toni mittlerweile nachvollziehen konnte.
Sofie war 1998 beim Baumblütenfest in Werder spurlos verschwunden. Nachts sprang sie von einem Bootsanleger in die Havel und kehrte nicht mehr zurück. Sechzehn Jahre blieb sie verschollen. Obwohl ihre Eltern, Freunde und Bekannte sie für tot hielten, gab Toni die Hoffnung nie auf und suchte nach ihr. Er wurde sogar Kriminalpolizist, um mehr Handlungsspielraum zu haben. Dann geschah endlich, womit niemand mehr gerechnet hatte: Er spürte sie auf. Sie befand sich in einem schlechten gesundheitlichen Zustand, aber mit einer intensiven Rehabilitation schaffte sie den Weg zurück ins Leben.
In Sofies sechzehnjähriger Abwesenheit hatten sich die Menschen verändert. Die Welt war nicht mehr so, wie sie sie gekannt hatte. Sie fühlte sich fremd und kam sich bevormundet vor. Außerdem litt sie unter Gedächtnislücken, die auch durch Hypnosetherapiesitzungen nicht gefüllt werden konnten. Sie erinnerte sich nicht, was damals passiert war. Bei einer solchen Vorgeschichte war es verständlich, dass sie sich neu erfinden wollte.
Toni war über ihren Auszug dennoch sehr enttäuscht. Er hatte sein ganzes Leben auf die Suche nach ihr ausgerichtet und viele Opfer gebracht. Und als es ihr endlich besser ging, verließ sie ihn, um ihr eigenes Ding durchzuziehen.
So hatte er am Anfang gedacht.
Mittlerweile hatte er sich mit der Situation arrangiert und sie als Chance begriffen. Jetzt konnten sie sich neu kennenlernen und ihre Beziehung behutsam aufbauen. Sie konnten eine stabile Grundlage schaffen, um einen zweiten Anlauf zu wagen, der hoffentlich bis an ihr Lebensende reichen würde.
In den vergangenen Monaten hatte er jede Gelegenheit genutzt, um in ihrer Nähe zu sein und ihr mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Er hatte sperrige Haushaltsgeräte transportiert, er hatte ihr Zimmer gestrichen, und er hatte sie zu Arztterminen gefahren, wann immer es sein Dienst zuließ. Oft hatten sie zusammengesessen, Tee getrunken und gequatscht. Ihr Verhältnis war innig und vertraut, aber bei aller Präsenz hatte Toni stets darauf geachtet, ihre Grenzen zu respektieren, damit sie sich nicht bedrängt fühlte. Es war ihm schwergefallen, denn er begehrte sie stärker denn je, aber er war zuversichtlich, dass sich seine Geduld bald auszahlen würde.
Schon jetzt waren sie seiner Meinung nach an einen Punkt gelangt, an dem er das Tempo erhöhen konnte. Heute kam er zum ersten Mal ohne Vorankündigung vorbei. Und er fragte sich, wie sie auf seinen Überraschungsbesuch reagieren würde.
***
Toni schloss den Kofferraum und stapfte mit beladenen Armen los. Der Hof war bis 2010 von einem Obst- und Spargelbauern bewirtschaftet worden und bestand aus zwei Scheunen und einem großen Wohnhaus, in dem jeder der neun Bewohner ein eigenes Zimmer bezogen hatte. Auch wenn er von ihnen nur »Sheriff« genannt wurde, wurde er akzeptiert. Vermutlich hing es mit seiner Erscheinung zusammen, die für einen Beamten eher unkonventionell ausfiel.
Seine dunklen Locken waren schwer zu bändigen. Um seinen Hals trug er eine Muschelkette, die ihm einst ein französischer Althippie am Strand von Goa geschenkt hatte. Er hatte meist legere T-Shirts, ausgewaschene Jeans und dunkelbraune Beatstiefel an. Rein äußerlich unterschied sich der Zweiundvierzigjährige kaum von den anderen.
Auch Gesprächsstoff gab es genügend. Gerne berichtete er von der zweieinhalbjährigen Weltreise, die Sofie und er zwischen Juli 1995 und Januar 1998 mit einem alten, klapprigen VW-Bus unternommen hatten. Mit dem Performancekünstler Claude Malheur unterhielt er sich auf Französisch und tauschte sich über die Kultur und die Küche des Nachbarlandes aus. Wenn er nicht Polizist geworden wäre, hätte er Romanistik studiert. Hier konnte er seine frankophilen Neigungen ausleben. Ja, er fühlte sich wohl.
Abgesehen von einigen Grundregeln des Zusammenlebens und festen Aufgaben wie der Tierfütterung bot die Gemeinschaft jedem Mitglied die größtmögliche Freiheit. Das Prinzip der Offenheit, des Respekts und des gegenseitigen Vertrauens äußerte sich auch darin, dass es im ganzen Wohnhaus keine Schlüssel gab. Das war ein Alptraum für jeden sicherheitsbewussten Menschen, aber Toni musste hier ja nicht leben.
Er ging um das Wohnhaus herum und begab sich über die Wiese zur Terrassentür, die direkt in Sofies Zimmer führte. Er wollte gerade an die Scheibe klopfen, als er innehielt.
Was er dort sah, kam ihm komisch vor.
Er kniff die Augen zusammen, um das Geschehen besser zu erkennen. Als es ihm gelungen war, konnte er es nicht glauben. Es konnte einfach nicht sein, und trotzdem trug es sich direkt vor ihm zu.
Er schluckte hart und packte den Karton fester, um ihn nicht fallen zu lassen.
Hanna stand hinter Sofie, die an ihrem Zeichentisch saß und den Kopf nach hinten gedreht hatte. Die beiden Frauen küssten sich, und in dieser Berührung lag so viel Zärtlichkeit und Intimität, dass Toni ohne jeden Zweifel daraus schloss, dass sie eine Liebesbeziehung führten.
Er drehte sich abrupt weg und stapfte zurück zum Auto. Hanna war von Anfang an Sofies Physiotherapeutin gewesen. Auch ihretwegen war seine Frau auf den Resthof gezogen. Doch er hätte niemals für möglich gehalten, dass zwischen ihnen eine Anziehungskraft bestehen könnte, die über freundschaftliche Gefühle hinausging. Dafür hatte es in seiner Gegenwart keine Anzeichen gegeben.
Toni war geschockt. Er hatte geglaubt, dass er seine Frau kennen würde. Seit der gemeinsamen Schulzeit waren sie ein Paar! Wie hatte er sich so täuschen können? Wie hatte sie ihn so täuschen können? So ging es hier also zu, wenn er nicht da war. Deshalb hatte sie darauf bestanden, dass er jeden Besuch ankündigte.
Er pfefferte die Malutensilien in den Kofferraum und setzte sich hinters Lenkrad. Dumpf starrte er vor sich hin. Er konnte keinen klaren Gedanken fassen. Der Druck hinter seinen Augen nahm stetig zu.
Claude Malheur ging auf dem Kopfsteinpflaster vorüber. Er rief »Salut«, griff sich an die Hüfte und tat so, als würde er eine Pistole abfeuern.
Automatisch hob Toni seine Hand und grüßte zurück. Claude war ein Freund geworden. Wusste er Bescheid? Natürlich! Alle Mitbewohner mussten eingeweiht sein. Nicht nur Sofie hatte ihn betrogen; sie alle hatten ihn hinters Licht geführt! Hatten sie ihn »Sheriff« genannt, weil ein solcher Spitzname Distanz schaffte?
Seine Finger zitterten. Mehrmals ballte er die Hand zur Faust und blickte auf sein Smartphone, das auf dem Beifahrersitz lag und vibrierte. Er hob es auf und sah, dass vier Anrufe eingegangen waren. Sie alle stammten von Phong, seinem Kollegen im Kommissariat. Warum hatte er nichts gehört?
Toni drückte auf die grüne Taste, hielt sich das Mobiltelefon ans Ohr und sagte: »Ja?«
In den folgenden Minuten berichtete Phong, dass ein Mann auf einem Binnenfrachtschiff getötet worden war, das nun im Havelport in Wustermark am Kai lag.
»Wir sollen den Fall übernehmen«, schloss er seine Ausführungen.
»Bin unterwegs«, erwiderte Toni und unterbrach die Verbindung. Er startete den Motor, gab Gas und fuhr mit durchdrehenden Reifen los.
Er musste hier weg, und zwar schnell.
2
Auf der Fahrt stellte Toni die Musik so laut, dass sie fast alles übertönte. Nur die Bierwerbung an einer Bushaltestelle drang zu ihm durch. Ein markanter unrasierter Mann stand in einer Dünenlandschaft. In seiner Hand hielt er eine grüne Flasche. Das endlose Wattenmeer versprach Weite und Freiheit. Nur ein Schluck aus der Pulle, dachte Toni, und alle Probleme sind gelöst. Leider wusste er viel zu gut, dass es nicht so einfach war.
Nach einer halben Stunde erreichte er den Havelport, einen Binnenhafen in Wustermark. Im Schritttempo rollte er durch das offene Tor. Vorbei an den Containerbüros, einem Kipplader und einem Lkw mit Schüttgut fuhr er bis zum Schiffsanleger vor und parkte neben einem Kran.
Als er seine Beine aus dem Peugeot hievte, entdeckte er Oberkommissarin Gesa Müsebeck, die mit einem uniformierten Beamten zusammenstand und Anweisungen erteilte. Mit ihrer dunklen Kurzhaarfrisur, den schmalen Hüften und den festen schwarzen Schnürschuhen sah sie von hinten aus wie ein Mann. Im Kommissariat kursierte das Gerücht, dass sie lesbisch war. Toni war immer für Toleranz und Gleichberechtigung gewesen, aber in diesem Moment brandete ein solcher Hass auf alle Homosexuellen in ihm an, dass er aus dem Auto sprang und die Tür zuknallte.
Es war ihm scheißegal, ob er Aufsehen erregte. Mit geballten Fäusten stapfte er an die Kaikante. Eine kräftige Böe blies ihm ins Gesicht und brachte ihn zum Schwanken. Er hörte das Blut in seinen Ohren rauschen und schaute nach unten, wo der Havelkanal gegen die rostige Mauer schwappte– Welle auf Welle.
Wasser war schon immer sein Element gewesen und hatte eine starke Wirkung auf ihn ausgeübt. Er erinnerte sich, wie er es als Kind liebte, unter die Oberfläche zu sinken und sich mit ausgebreiteten Armen treiben zu lassen. Es fühlte sich an wie Schweben. Keine störenden Geräusche drangen zu ihm durch; es war absolut still.
»Du siehst blass aus«, sagte Gesa, die neben ihn getreten war.
Erneut wurde Toni von seiner Wut überrollt. »Das geht dich überhaupt nichts an«, platzte er heraus und durchbohrte sie mit seinem Blick.
»Oh, da hat wohl jemand einen schlechten Tag erwischt«, sagte Gesa. »Dann gehen wir wohl besser gleich an Bord. Da kannst du dir selbst ein Bild machen.«
Die Kriminaloberkommissarin reichte ihm einen weißen Plastikanzug und Überzieher. Nachdem Toni sich hineingezwängt hatte, folgte er Gesa. Sie machte ein paar Schritte, stützte sich mit einer Hand an der Kaikante ab und sprang hinab auf das Frachtschiff, das längsseits festgemacht hatte. Über die Schulter schaute sie zurück und berichtete: »Wir haben einen männlichen Leichnam. Nach Auskunft des Bootsmanns handelt es sich um den sechzigjährigen Jürgen Seitz. Er ist Berufsschiffer und Partikulier.«
»Partikulier?«, fragte Toni. Hinter seinen Schläfen ließ das Pochen nach. Auf dem schmalen Gang zwischen Frachtraum und Reling hallten seine Schritte wider. Von Zeit zu Zeit musste er über einen weißen Kreidekreis treten, wo die KTU rötlich braune Fußspuren markiert hatte. Links neben ihm, im offenen Laderaum, tauchten sperrige Maschinenteile auf, die in eine Folie gewickelt waren. Ganz hinten stand ein alter Opel Corsa, der mit einem Kran an Land gehievt werden konnte.
»Das sind selbstständige Schiffseigner, die für eine Reederei oder einen sonstigen Befrachter fahren«, erwiderte Gesa. »Die MS›Beate‹ gehörte ihm.«
»Und der Bootsmann?«
»Angeblich hat er während des tödlichen Angriffs geschlafen«, antwortete Gesa und passierte das Ruderhaus. »Er hat gestern Nacht gezecht und war wohl ziemlich fertig. Nach dem Losmachen hat er sich hingelegt und ist nur aufgewacht, weil er pinkeln musste. Er wollte nach dem Rechten sehen und hat seinen toten Chef gefunden. Das Schiff trieb im Havelkanal. Er hat einen Notruf abgesetzt und die ›Beate‹ zum Havelport gefahren.«
»Ist er glaubwürdig?«
»An seinen Händen und der Kleidung haben wir Blutspuren gefunden, aber er hat sich neben den Leichnam gekniet und nach Lebenszeichen gesucht. Ansonsten roch er bei der Befragung nach Alkohol und machte einen verzweifelten Eindruck. Auch hat er mich mehrmals gefragt, wer ihn in seinem Alter noch einstellen soll.«
»Wir dürfen ihn nicht ausschließen. Selbst wenn er harmlos wirkt, kann er mit drinstecken«, sagte Toni und blieb im Heck des Schiffes stehen.
Einige Spurensicherer untersuchten den toten Kapitän. Fotos wurden geknipst und Proben genommen. Mittlerweile hatte Toni sich wieder unter Kontrolle und konnte klar denken. Seine Eheprobleme waren kein Grund, um seine liberalen Überzeugungen über den Haufen zu werfen. Ob und mit wem Gesa Sex hatte, war ihre Privatsache und mit Sicherheit kein Anlass, um ihr distanziert, zornig oder mit Vorurteilen zu begegnen. Ganz im Gegenteil. Auf die Kollegin war immer Verlass gewesen. In ihrem dreiköpfigen Ermittlerteam war sie die Pragmatikerin, die nie den Überblick verlor. Im zwischenmenschlichen Umgang war sie korrekt und verbindlich. Zu ihrer Bodenständigkeit passte, dass sie in der Region aufgewachsen war und durch ihre sechs Brüder und deren Familien in beinahe jedes Dorf des Havellandes verwandtschaftlich vernetzt war. Davon hatten die Ermittlungen schon häufig profitiert. Eine solche Behandlung hatte sie nicht verdient.
»Es tut mir leid, dass ich dich so angeblafft habe«, sagte Toni. »Bitte entschuldige.«
»Was ist denn los?«, erwiderte Gesa. »So kenne ich dich gar nicht.«
Toni presste nur die Lippen aufeinander und schüttelte den Kopf. Das Verhältnis zu seinen Teammitgliedern war so gut, dass er es nicht durch seine privaten Probleme belasten wollte. »Wie ist Seitz ums Leben gekommen?«, fragte er.
»Du willst nicht darüber reden«, sagte Gesa. »Das ist dein gutes Recht. Solltest du es dir anders überlegen, hab ich ein offenes Ohr.«
»Danke.« Toni wusste bereits, dass er nicht auf ihr Angebot zurückkommen würde, aber ein solches zu erhalten, war auch schon was wert. »Lass uns weitermachen.«
Gesa sah ihn prüfend an und nickte. »Als wir Seitz fanden, hielt er in seiner rechten Hand eine Signalpistole, die er kurz zuvor abgefeuert hatte. Den Leuchtsatz haben wir im Bug des Schiffes gefunden. Er ist gegen eine Metallwand geprallt und auf das Deck gefallen. Seitz weist auf der Rückseite des rechten Beins eine tiefe Stichverletzung auf, die auch den Blutverlust erklärt. Außerdem ist ihm das Genick gebrochen worden.«
»Wie bitte?«
»Ja. Anhand der Spurenlage gehen wir von folgendem Tathergang aus: Seitz wird angegriffen. Er feuert die Signalpistole auf den Täter ab und verfehlt ihn. Seitz will fliehen und rennt Richtung Heck davon. Ein Stichwerkzeug, vermutlich ein Wurfmesser, trifft ihn hinten am Bein, und er fällt nach vorne. Der Täter holt ihn ein, kniet sich auf seinen Rücken und bricht ihm das Genick.«
»Er hat ihn also in seine Gewalt gebracht und dann kurzen Prozess gemacht«, sagte Toni. »Das war eine Hinrichtung.«
»Sieht so aus«, erwiderte Gesa.
»Der Täter kann mit einem Wurfmesser umgehen und mit bloßen Händen töten. Über solche Fähigkeiten verfügen nicht viele Menschen. Das schränkt den Kreis der Verdächtigen deutlich ein.«
»Wir suchen jemanden, der möglicherweise im Nahkampf ausgebildet ist«, sagte Gesa. »Der Bootsmann macht keinen sehr fitten Eindruck. Auch der Modus Operandi passt nicht zu ihm. Zwar fuhr er erst seit zwei Jahren mit Seitz, aber sie kennen sich schon länger. 1974 haben beide in der Binnenschifffahrtsschule der DDR eine Lehre zum Matrosen begonnen. Seitdem waren sie befreundet und hatten auch beruflich miteinander zu tun.«
»Ich stimme dir zu. Unser Täter ist eher ein Killer als ein langjähriger Freund, aber er kann trotzdem beteiligt sein. Sonst noch was?«
»Der Mörder ist nach der Tat auf dem Schiff herumgerannt, wie die blutigen Schuhspuren belegen. Er hatte es wohl eilig.«
»Sind Profil und Größe mit dem Schuhwerk des Bootsmannes abgeglichen worden?«
»Keine Übereinstimmung. Der Bootsmann hat Schuhgröße einundvierzig, der Täter trug Nike-Sneakers, die vier Nummern größer ausfallen. Er war zuerst im Ruderhaus, um die Maschine mit dem Notausschalter zu stoppen, dann im Büro, in den Wohnräumen und in der Kombüse. Überall hat er Schränke aufgerissen und Schubladen herausgezogen.«
»Dann hat er etwas gesucht! Mal angenommen, der Bootsmann hat nichts mit der Sache zu tun: Warum hat der Täter ihn nicht geweckt und unter Druck gesetzt? Warum hat er ihn verschont?«
»Seine Kajüte liegt auf dem Vorschiff. Wenn man sie nicht kennt, findet man sie nicht so leicht. Er kann Glück gehabt haben. Wenn du willst, zeige ich dir die Unterkunft.«
»Vielleicht später«, sagte Toni und schaute auf die andere Seite des Kanals. Gegen die Sonneneinstrahlung beschirmte er seine Augen mit der Hand. Auf dem Uferweg beobachteten ein Jogger, ein Spaziergänger mit einem Hund und ein Mann mit einer Kapuzenjacke das Geschehen. In ihrem Rücken erstreckten sich Wiesen und Felder, auf denen Windräder und Hochspannungsmasten standen. Vereinzelte Wolken zogen über die Landschaft. »Werden Fotos von den Schaulustigen gemacht?«
»Ja, ich hab vorhin einem Kollegen eine Kamera in die Hand gedrückt. Er steht vorne im Bug.«
»Gut. Wir sollten uns später…« Toni unterbrach sich. Er schaute erneut zur gegenüberliegenden Kanalseite, wo jetzt nur noch der Spaziergänger mit Hund und der Jogger standen. Wo war der dritte Mann?
»Ja?«, fragte Gesa.
»Ach, ich wollte nur sagen, dass wir uns später die Fotos genauer ansehen sollten.«
»Das machen wir doch sowieso.«
»Also gut. Den Bootsmann will ich morgen Nachmittag zur Befragung im Kommissariat haben. Regle das bitte. Wenn wir davon ausgehen, dass der Schiffsführer von einem Profi getötet wurde, ist er möglicherweise in eine größere Sache verwickelt. Was hatte er geladen? Wo war er überall unterwegs?«
»Steht alles hier drin«, sagte Gesa, griff in eine Plastikkiste und zog eine transparente Tüte hervor, in der Papiere steckten. »Das sind das Fahrtenbuch, die Frachtunterlagen, diverse Zertifikate, Eichbescheinigungen und die Zulassung.«
»Das übernimmst du. Ich will wissen, ob es Unregelmäßigkeiten gibt. Hatte er persönliche Gegenstände bei sich?«
»Wir konnten weder ein Mobiltelefon noch eine Brieftasche sicherstellen.«
»Die hat der Täter vermutlich mitgenommen. Beschaff dir die Mobilnummer und veranlasse eine Handyortung. Vielleicht ist es noch angeschaltet. Hatte Seitz Familie? Verwandtschaft? Jemanden, den wir benachrichtigen müssen?«
»Ja, eine Schwiegertochter und eine Enkelin. Beide leben in Ketzin«, antwortete Gesa und nannte die Adresse.
»Okay. Du weißt, was zu tun ist. Das Schiff muss auf den Kopf gestellt werden. Irgendetwas hat der Mörder gesucht, und vielleicht hat er es nicht gefunden. Außerdem möchte ich, dass du Phong instruierst. Er soll das Opfer durchleuchten. Vorstrafen, Schulden, Auffälligkeiten.«
»Er arbeitet gerade zwei Altfälle auf.«
3
Sandro Ehmke trabte auf der Fuchsstute Bonita an den Deetzer Erdelöchern vorbei, wo er gestern Nacht die Hälfte der Beute vergraben hatte. Die Tongruben waren in den achtziger Jahren mit Havelwasser geflutet worden und hatten sich zu einem Anglerparadies entwickelt. Auf einundfünfzig Hektar befanden sich Teiche mit Seerosen, wacklige Holzbrücken, Badestellen, Schilfgürtel, Laubbäume und verwunschene Trampelpfade. Sandro hatte sich den ganzen Tag ausgemalt, wie die Polizei Suchmannschaften über das Gelände schickte, aber selbst wenn jemand den Bullen einen Tipp gegeben hätte, würden sie sich in diesem Labyrinth nur verlaufen. Das Versteck war gut gewählt und hundertprozentig sicher.
Beruhigt lenkte der fünfundzwanzigjährige Stallgehilfe die Fuchsstute zum Flussufer, um ihre Beine zu kühlen. Eigentlich sollte er nicht mehr auf ihr reiten, weil er es nie richtig gelernt hatte und sie mit seinem »Rumgehopse« nicht verwirren sollte, aber er kümmerte sich nicht um die Anweisungen der Trainerin. Bonita war sein Geschöpf. Es gab niemanden, der sie besser kannte. Deshalb entschied er auch, was gut für sie war und was nicht. Sein sonst so kleinlicher Chef ließ ihm die Ausritte durchgehen.
Sandros Lieblingsstelle befand sich an einem winzigen Strand, der versteckt zwischen alten Weiden und Sträuchern lag. Manchmal traf er hier auf verschwitzte Radfahrer, die sich auf dem nahen Havelradweg verausgabt hatten und eine Rast einlegten. Heute war er glücklicherweise allein und brauchte keine Rücksicht zu nehmen.
Er stieg ab und befreite das Pferd von Sattel, Decke und Zaumzeug. Schnell streifte er seine Kleidung ab und führte Bonita ins Wasser, das schon recht frisch war. Das lange Flussgras kitzelte zwischen seinen Zehen, unter seinen Fußsohlen drückten flache Kiesel. Zwei Libellen jagten über die funkelnde Oberfläche dahin, und ein Mückenschwarm wogte auf und ab.
Sandro bemerkte nicht, dass er beobachtet wurde. Er war voll und ganz auf die Fuchsstute konzentriert, die Angst vor dem Fluss hatte. Auch jetzt blieb sie erschrocken stehen und warf den Kopf zurück, was sie immer tat, wenn sie sich fürchtete.
»Ach, Süße«, sagte er sanft. »Trau dich. Das ist gut für die Durchblutung. Wir sind so weit gekommen, das schaffen wir jetzt auch noch.«
Als Sandro nach seiner Haftentlassung als Stallgehilfe angefangen hatte, war Bonita ein Problempferd gewesen. Mit RöntgenklasseIV und Hufrollenbefunden an beiden Vorderhufen galt sie als unverkäuflich. Seltsamerweise fasste das lahmende Tier sofort Zutrauen zu ihm. An seinem ersten Tag trat es vor ihn hin, senkte den Kopf und schnaubte ab. Es ließ sich sogar streicheln, so als hätte es instinktiv gespürt, dass sie eine Gemeinsamkeit hatten.
Sie waren beide kaputt.
Damals war er in einer schlimmen Verfassung gewesen. Die Knasterlebnisse verfolgten ihn bis in die Nächte. Niemand zeigte ihm einen Weg, um die Übergriffe zu verarbeiten. Er fühlte sich beschmutzt und weggeschmissen. Wenn er kurz einnickte, schreckte er schweißgebadet auf. Schlaftabletten bewirkten nur, dass er sich am nächsten Tag benebelt fühlte. Der Druck in seiner Brust nahm stetig zu, und er fand kein Ventil, um sich Erleichterung zu verschaffen.
An einem eisigen Dezembermorgen stand er an den Gleisen. Sein Atem warf weiße Wolken, die Eiskristalle auf den Gräsern glitzerten. In allen Einzelheiten malte er sich aus, wie er sich vor die Regionalbahn warf, wie ihn die Stahlräder erfassten und wie sie ihn zu einem Brei aus Gewebe, Knochen und Haaren zermalmten. Die Vorstellung hatte etwas Befreiendes. Er begriff, dass es einen Ausweg gab. Nur ein einziger Schritt genügte, um Ruhe zu finden.
An jenem Morgen machte er nicht Schluss, weil er an Bonita denken musste, die ohne ihn beim Abdecker landen würde. Die Zutraulichkeit des Tieres rührte ihn. Auf der Welt gab es ein Wesen, das mehr in ihm sah als ein hübsches Ding, das man benutzen konnte. Obwohl er keine Ahnung von Pferden hatte, holte er sich nach seiner Rückkehr auf den Hof die Erlaubnis, mit der Fuchsstute arbeiten zu dürfen.
Nächtelang las er sich im Internet ein und kapierte, dass Bonita viel zu steil in der Beinachse stand, dass die Hufe katastrophal aussahen und die Trachten untergeschoben waren. Horn drückte auf die Hufrolle. Bonita musste fürchterliche Schmerzen haben, in etwa wie ein Mensch, der seit Jahren einen spitzen Stein im Schuh trug und unter einer chronischen Entzündung litt.
Er schaute mehreren Huforthopäden bei der Arbeit zu und löcherte sie mit Fragen, bis sie nicht mehr weiterwussten. Es vergingen weitere drei Monate, in denen er sich intensiv vorbereitete, bis er sich an die erste Behandlung traute. Er wusste, dass die Prognose schlecht war und dass er viel Geduld aufbringen musste, um irgendwann eine kleine Besserung zu erzielen.
So wässerte er die Hufe stets, damit sie schön weich waren. Mit dem Messer verschaffte er sich einen Überblick, er bearbeitete die Eckstreben und bildete ein Gewölbe. Er kürzte die Zehe und brachte eine Mustangrolle an den Huf, sodass ein gesunder Bewegungsablauf möglich wurde. In kurzen Abständen korrigierte er den Wuchs behutsam mit der Feile und legte besonderen Wert darauf, dass Bonita gerade stand.
Er merkte ihr an, wie die Schmerzen nachließen. Ihr Schrittbild besserte sich, sie wurde lebhafter und konnte sich in der Herde behaupten. Bisse und Tritte der anderen Tiere wurden seltener, bis sie gar keine Blessuren mehr davontrug. Bald zeigte sie ihren wahren Charakter und nahm eine führende Rolle ein. Nach sieben Monaten intensiver Behandlung ging Bonita zum ersten Mal klar und konnte zeigen, wie viel Grazie und Temperament in ihr steckten. Ein unbeschreibliches Hochgefühl erfasste ihn. Er konnte sich nicht erinnern, wann er jemals so glücklich gewesen war.
Parallel zu ihrer Genesung erholte auch er sich. Er hatte bewiesen, dass er etwas konnte und einen Wert besaß. Seinen neuen Lebensmut verdankte er der Fuchsstute. Sie hatte ihn gerettet, sie hatte ihn erstarken lassen. Die Panikattacken blieben aus, die Alpträume wurden seltener. Er spürte, dass er nicht mehr allein war und dass ihre Lebensläufe miteinander verbunden waren. Ohne Bonita konnte er sich ein Dasein nicht mehr vorstellen.
Sein Chef war über die Erfolge begeistert und erkannte das Potenzial der Fuchsstute. Er bezahlte Bereiter, die sie in einem atemberaubenden Tempo auf ein hohes Dressur-Niveau hievten. Bei Turnieren konnte sie sich platzieren und gewann Pokale. Ihr Talent und ihre Lernfähigkeit sprachen sich über die Grenzen des Havellandes hinaus herum.
Sandro war stolz auf ihre Erfolge und gönnte sich nun auch etwas Zerstreuung. Er meldete sich telefonisch bei Herm Neudorf, der sich als einziger Häftling im Jugendknast anständig verhalten und ihn vor Übergriffen beschützt hatte. Ihm verdankte er, dass er nicht schon im Gefängnis draufgegangen war. Herm war kurz nach ihm entlassen worden und arbeitete auf einem Schrottplatz in Brandenburg an der Havel, das nur ein paar Autominuten entfernt lag.
Herm freute sich tatsächlich über seinen Anruf, betonte aber sofort, dass er tausend heiße Girls an der Angel hätte und dass ihr Kontakt rein platonisch bleiben müsse. Was in der Zelle geschehen sei, hinge nur mit den besonderen Umständen zusammen, und überhaupt sei er ein hundertprozentiger Hetero und nur auf Pussis scharf.
Sandro nahm das Gerede nicht persönlich. Der Freund war eben ein richtiger Kerl, der überall seine Männlichkeit zeigte und Respekt verlangte. Er hatte eine raue Schale, aber Sandro erinnerte sich noch genau, was zwischen ihnen passiert war, und er erinnerte sich auch, wie fassungslos Herm über seine Ekstase gewesen war. Es war schon erstaunlich, wie wenig die meisten Männer über ihre Körper wussten, aber wenn ihm sein Wissensvorsprung helfen konnte, musste er ihn nutzen. Er brauchte jedes Argument, um Herm von sich zu überzeugen. Außerdem benötigte der Freund Zeit, um sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass es in der Liebe nicht auf das Geschlecht eines Menschen ankam.
Sandro schwamm im Fluss um Bonita herum, bespritzte sie lachend mit Wasser und träumte von der Zukunft. Wenn sie es geschickt anstellten und ihren Plan verwirklichten, würden sie so etwas wie eine Familie gründen können. Herm wäre der Versorger, und er würde alles zusammenhalten und sich um Bonita kümmern. Sie würden irgendwo im Süden neu anfangen– vielleicht in Marokko– und viele Orangenbäume haben. Vor dem Sex würden sie Haschisch rauchen und hinterher in einer Hängematte chillen. Sie würden ein offenes Haus haben, in dem Freunde ein und aus gingen. Sie würden die Vergangenheit auslöschen und nie mehr zurückkehren. Ja, sie würden den ganzen Schmutz hinter sich lassen.
Nachdem er Bonita zurück ans Ufer geführt hatte, rubbelte er sie mit einem Handtuch trocken, damit sie sich nicht erkältete. Als er ein Knacken in seinem Rücken hörte, drehte er sich um und begriff sofort, dass er nicht allein war.
Zwischen den Büschen erhob sich eine brünette Frau von ungefähr fünfzig Jahren, die mit hektischen Handbewegungen einige Mücken vertrieb. Sie hatte sich sorgfältig geschminkt und trug Schmuck, eine Seidenbluse und einen hellen Sommerrock.
»Entschuldigen Sie bitte«, sagte sie nervös. »Ich wollte Sie nicht erschrecken, aber Regina hat mir erzählt, dass Sie heute Abend zum Fluss reiten würden, und da bin ich… da hab ich gedacht, dass ich…«
»Ich heiße Sandro«, sagte er und unternahm keine Anstalten, seine Blöße zu bedecken. Er wusste längst, warum die Frau gekommen war. Regina hatte ihn empfohlen. Das sagte alles. Er hatte früh in diesem Gewerbe angefangen und stets davon profitiert, dass er die Wünsche seiner Kundinnen und Kunden einschätzen konnte. Diese Frau war ein Geschenk. Sie war nicht nur gepflegt, sondern auch bedürftig. Sandro hätte wetten können, dass sie zu Hause einen mundfaulen, frustrierten Partner sitzen hatte, der sie nicht mehr wahrnahm und sich nicht vorstellen konnte, dass sie noch Interesse an Intimitäten hatte. Sie würde jede Zuwendung mit Dankbarkeit erwidern.
Auch wenn er irgendwann in Geld schwimmen würde, konnte er die Kohle gut gebrauchen. Von dem Verdienst könnte er Bonita eine neue Trense oder Herm ein kleines Geschenk kaufen. Vielleicht das Taschenmesser, von dem er neulich so geschwärmt hatte.
»Es ist gut, dass du gekommen bist«, sagte er. »Ich kümmere mich nur schnell um das Pferd, dann hab ich Zeit für dich.«
Er band Bonita an einen Baum, sodass sie etwas grasen konnte. Dann trat er auf Armeslänge an die Frau heran. »Verrätst du mir deinen Namen?«, fragte er und spürte die wachsende Erregung.
»Sonja«, erwiderte sie und nestelte an ihrer Handtasche herum, bis sie zwei Fünfziger aus dem Portemonnaie zog. Als sie den Kopf hob, blieb ihr Blick an seinem Unterleib hängen. »Und jetzt?«, fragte sie mit großen Augen.
4
Während der Fahrt ließ Toni die Musik aus. Das erste Entsetzen über Sofies Betrug hatte sich gelegt und wich einer tiefen Traurigkeit. In seinen Zukunftsträumen waren die Verhältnisse klar gewesen. Nun drohte alles im Chaos zu versinken.
Die Landschaft rauschte an ihm vorbei. Er sah kleine Waldstücke, Wiesen mit grasenden Pferden und Felder, auf denen runde Strohballen lagen. Das Laub einiger Alleebäume verfärbte sich bereits. Er hatte die Ursprünglichkeit und Lieblichkeit des Havellandes immer gemocht, jetzt kam ihm die Gegend zum ersten Mal feindlich vor.
Nach wenigen Minuten erreichte er Ketzin, das für die zahlreichen Seen und die Bruchlandschaft bekannt war. Überall hingen Plakate für die anstehende Bundestagswahl. Früher war Toni häufiger hier gewesen, weil sein Sohn immer mit der Seilfähre »Charlotte« fahren wollte. Er parkte vor einem schmucklosen Einfamilienhaus, das am alten Havellauf lag.
Eine ungepflegte, ungefähr dreißigjährige Frau öffnete ihm die Tür. Die aschblonden Haare hingen ihr kraftlos vom Kopf und betonten den ungesunden Teint. Im rechten Nasenflügel steckte ein Brillant, der wie der gescheiterte Versuch aussah, gegen ihr Unglück anzukämpfen. Obwohl ihr ruheloser Blick verriet, dass sie ihn nicht einschätzen konnte, bewies sie ein feines Gespür, als sie in knapper brandenburgischer Manier feststellte: »Schlechte Nachrichten!«
Toni zog seinen Dienstausweis aus der Hosentasche und sagte: »Vielleicht ist es besser, wenn wir reingehen und drinnen reden.«
»Wenn es sein muss«, sagte die Frau und schlurfte ins Wohnzimmer voraus, wo sie sich auf ein altes Sofa fallen ließ. Durch ein großes Fenster sah man über ein gemähtes Rasenstück auf die alte Havel. Die Wasseroberfläche wirkte stahlgrau, vielleicht wegen der aufziehenden Wolken. Auf dem Tisch lag eine angebrochene Tüte Erdnussflips, daneben stand ein Aschenbecher.
»Dann mal los«, sagte sie. »Schlimmer kann es eh nicht werden.«
Toni griff nach der Fernbedienung und schaltete den Fernseher aus, auf dem gerade eine Daily Soap lief. »Sind Sie Frau Jenny Seitz?«
»Hm.«
»Dann sind Sie die Schwiegertochter von Herrn Jürgen Seitz?«
»Hm!«
»Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Schwiegervater tot aufgefunden wurde. Zu den genauen Umständen darf ich mich noch nicht äußern. Es tut mir sehr leid.«
Hatte Frau Seitz eben noch so etwas wie trotzige Schicksalsergebenheit gezeigt, wurde jetzt offenbar, wie heftig sie von der Nachricht getroffen wurde. »Ist das wahr?«, fragte sie zitternd.
Toni nickte mitfühlend.
»Ein Herzinfarkt?«
»Nein, ein gewaltsamer Tod.«
Frau Seitz starrte ihn an. »Auch das noch!«, sagte sie und kam schwankend auf die Beine. Kurz schien es so, als würde sie das Gleichgewicht verlieren und stürzen. Toni hatte bereits den Arm ausgestreckt, um sie aufzufangen, aber dann stabilisierte sie sich und schleppte sich zu der alten Kommode. Auf einem Tablett standen Spirituosenflaschen und Schnapsgläser. Während sie sich einen Obstbrand einschenkte, fragte sie: »Sie auch?«
Toni atmete tief durch. Über die sechzehnjährige Suche nach seiner verschwundenen Ehefrau war er zum Alkoholiker geworden. Die Ungewissheit hatte er nur ertragen, indem er sich betäubte. Seit über drei Jahren war er trocken. Normalerweise konzentrierte er sich in solchen Situationen auf das, was er in der Gruppe gelernt hatte. Aber anstelle des Notfallplans sah er nur Sofie mit ihrer Freundin vor sich.
»Ich kenne das«, sagte Frau Seitz.
»Wie bitte?«
»Ich hab immer zu Jürgen gesagt: Ich hab kein Problem mit Alkohol. Ich hab nur eins ohne«, erwiderte sie und ließ ein verächtliches Schnauben folgen. »Ich stelle Ihnen einfach einen Schnaps hin. Sie müssen ihn ja nicht trinken.«
Toni starrte auf das Glas, das nun vor ihm auf dem Couchtisch stand und bis zum Rand gefüllt war. Ein scharfer Birnengeruch verbreitete sich. In seinem Mund sammelte sich Speichel, und in seinem Magen zog sich etwas zusammen. Beinahe gewaltsam riss er sich von dem Anblick los und fragte: »Hatte Ihr Schwiegervater Feinde?«
Frau Seitz schenkte sich schon den nächsten Obstbrand ein. »Bestimmt nicht. Er war manchmal schroff, aber er war viel zu ehrlich, um richtige Feinde zu haben. Früher wurde er von allen respektiert, in letzter Zeit tat er allen nur noch leid.«
»Wieso leid?«
»Wissen Sie es nicht?«, fragte Frau Seitz und kippte den Schnaps hinunter. Mit ihrer schmalen Hand wischte sie sich den Mund. »Hier weiß doch sonst jeder Bescheid. Mein Mann, also Jürgens Sohn, und meine Schwiegermutter sind bei einem schlimmen Verkehrsunfall gestorben. Mein Mann war sofort tot. Meine Schwiegermutter lag noch zwei Monate im Koma, bis es zu Ende ging. Hinterher hat sich herausgestellt, dass der Fahrer an einem illegalen Autorennen teilgenommen hat.«
Toni wollte gerade etwas anmerken, als Frau Seitz ihm zuvorkam und sagte: »Ich weiß, was Sie jetzt glauben. Sie meinen, dass die Geschichte mit dem Tod meines Schwiegervaters zusammenhängt, aber da täuschen Sie sich. Jürgen war nicht so. Er hat den Fahrer nicht gehasst. Hinterher hat er nur gesagt, dass wir nach vorne schauen und an Marie denken müssen. Ja, er wollte, dass wir uns um die Kleine kümmern.«
»Vielleicht war Ihr Schwiegervater nicht so, aber ob das auch für den Unfallverursacher gilt, müssen wir überprüfen. Möglicherweise hat er eine hohe Strafe erhalten und fühlt sich ungerecht behandelt.«
»Was? Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen«, sagte Frau Seitz und machte große Augen. Ihre Unterlippe zitterte plötzlich, und eine Träne rollte ihre Wangen hinab. Sie tropfte auf die hellgraue Jogginghose, wo sie einen dunklen Fleck hinterließ.
Toni gab ihr einen Moment Zeit. »Marie ist Ihre Tochter?«
Mehrmals unternahm Frau Seitz den Versuch zu antworten, aber sie brachte nur ein Schluchzen heraus. Mit einem Mal redete sie so schnell los, als würde sie fürchten, den Satz nicht beenden zu können. »Meine achtjährige Tochter, ja. Damals bei dem Unfall war sie noch gesund, aber vor einem knappen Jahr wurde bei ihr eine… eine…«
»Eine Krankheit festgestellt?«, fragte Toni. »Was hat sie denn?«
»Haben Sie selbst Kinder?«
»Einen zwanzigjährigen Sohn.«
»Dann wollen Sie nicht wissen, was sie hat. Es gibt Krankheiten, die so schlimm sind, dass man besser gar nicht von ihnen erfährt.«
Toni nickte und sah vorerst von weiteren Nachfragen ab.
»Marie wird sterben«, fuhr Frau Seitz fort. »Schon bald. In drei Monaten oder spätestens in vier. Erst Arne, dann Beate, dann Jürgen, dann Marie. Was soll ich dann noch hier? Können Sie mir das mal erklären? Können Sie mir nur einen einzigen Grund nennen?«, fragte Frau Seitz, goss sich erneut ihr Glas voll und hob es an. »Ich weiß gar nicht, was ich verbrochen habe. Ich zermartere mir das Hirn, aber ich finde keine Antwort. Wollen Sie nicht doch einen mittrinken? Allein ist es so deprimierend.«
Toni schluckte hart und starrte auf das Glas. War es nicht ein Gebot der Menschlichkeit, ihr diesen Wunsch zu erfüllen? Musste er in einer solchen Situation nicht seine eigenen Befindlichkeiten zurückstellen? Vor über drei Jahren hatte er mit dem Trinken aufgehört, weil ihn sein Sohn vor die Wahl gestellt hatte und weil er Sofie finden wollte. Aroon lebte mittlerweile mit seiner Freundin in den Vereinigten Staaten im Silicon Valley und brauchte ihn nicht mehr. Sofie zog es vor, mit ihrer Krankengymnastin rumzumachen. Was hielt ihn zurück?
Wenn er ein Glas trank, um dieser verzweifelten Frau beizustehen, musste er ja nicht wieder mit dem Saufen anfangen. Mal einen Schluck bei einem Geburtstag oder mal ein Sekt zu einem besonderen Anlass. Das musste doch möglich sein. Er konnte den Konsum dosieren und in Maßen trinken, so wie es Millionen anderer Deutscher auch taten. Warum sollte es ihm nicht gelingen?
Er griff nach dem Schnaps, hob ihn leicht gegen Frau Seitz an und kippte den Obstbrand hinunter. Der Alkohol bahnte sich über seine Mundschleimhaut, die Speiseröhre und den Magen einen Weg in seine Blutbahn. Tausende Moleküle fluteten seine Adern und brannten ein Feuerwerk ab. Plötzlich fühlte er sich leicht, er war hellwach, seine Niedergeschlagenheit war verflogen.
Als Frau Seitz ihm nachschenken wollte, hielt er seine Hand über das Glas. »Einer reicht«, sagte er entschieden. »Sonst kann ich nicht mehr fahren. Ihr Schwiegervater war zum Havelport unterwegs. Was hatte er danach vor?«
»Er wollte noch eine Woche arbeiten und dann Urlaub nehmen.«
»Urlaub? Ist das nicht ungewöhnlich?« Toni wusste, dass Binnenkapitäne sich nur freinahmen, wenn die Wasserstraßen zugefroren oder aus einem sonstigen Grund unpassierbar waren. Meistens lebten die Ehefrauen mit an Bord. Die ganze Familie musste für diesen Beruf viele Opfer bringen.
»Es ging nicht anders«, erwiderte Frau Seitz. »Maries Zustand hat sich verschlechtert. Ich bin eben erst aus dem Krankenhaus gekommen. Jürgen wollte alles vorbereiten, um sie in die USA zu fliegen. Da wird eine neue Behandlungsmethode erprobt. Die Ärzte und ich glauben nicht daran, aber Jürgen wollte es unbedingt versuchen. Er konnte sehr stur sein.«
»Kosten die Behandlung und der Krankentransport in die USA nicht viel Geld?«
»Natürlich. Das ist Betrug. Da wird den Leuten Mist erzählt, damit sie ihr Erspartes zusammenkratzen und es irgendwelchen Gierschlünden in den Rachen werfen. Wie das Leid ausgenutzt wird, ist unterste Schublade. Die Ärzte und ich haben immer wieder auf Jürgen eingeredet, aber er wollte nicht hören. Bei jeder Bank hat er vorgesprochen. Er wollte sogar sein Schiff verkaufen und das Haus beleihen, aber es hat alles nicht geklappt. Ich dachte eigentlich, dass die Sache erledigt wäre, aber gestern hat er mich angerufen und war ganz aufgekratzt. Er sagte, dass ich mir keine Sorgen machen müsse. Er hätte genügend Geld beschafft.«
»Woher?«
»Das hab ich ihn auch gefragt. Zuerst wollte er nicht mit der Sprache rausrücken. Dann hat er den Namen seines Reeders fallen lassen.«
»Mehr hat er nicht gesagt?«
»Nein.«
»Hm«, machte Toni. Das konnte alles Mögliche bedeuten. »Und Sie? Hätten Sie die Reise in die USA erlaubt? Letztendlich wäre es doch Ihre Entscheidung gewesen.«
»Wahrscheinlich hätte Jürgen mich so lange bequatscht, bis ich nachgegeben hätte.«
»Wie heißt der Reeder?«
»Jens Mittelstädt.«
Toni hatte vorerst genügend Informationen gesammelt und bedankte sich für die Auskunftsbereitschaft. Er zog seine Karte aus dem Portemonnaie und schrieb auf die Rückseite eine Zahlenreihe. »Das ist die Telefonnummer unseres psychologischen Notdienstes. Sie können dort jederzeit anrufen, wenn Sie jemandem zum Reden brauchen. Sie können sich auch bei mir melden. Über die Handynummer erreichen Sie mich fast immer.«
Frau Seitz nahm die Karte wortlos entgegen und steckte sie unbesehen in ihre Jogginghose. Vermutlich würde sie den Obstbrand vorziehen.
5
Als Toni den Besprechungsraum im Kommissariat betrat, montierte Gesa gerade einen defekten Fensterbeschlag ab. Mit beiden Händen hielt sie einen Schraubenzieher und wandte viel Kraft auf, um die Befestigung zu lösen. Der Hausmeister hatte sich mehrfach entschuldigen lassen, weil er Dringenderes zu tun hatte, und nun erledigte die praktisch veranlagte Kollegin den Job selbst.
Neben ihr hatte sich Kriminalkommissar Nguyen Duc Phong auf einen Stuhl gefläzt und die kurzen, stämmigen Beine ausgestreckt. Auf seinem beachtlichen Bauch stand eine Schüssel mit Süßigkeiten. Während er sich eine Handvoll Gummibärchen in den Mund stopfte, gab er Gesa schlaue Tipps, auf die sie vermutlich verzichten konnte.
Der Sohn vietnamesischer Boatpeople trug ein ausgewaschenes The-Doors-T-Shirt, das mit dem Schriftzug »Light My Fire« versehen war und an den Bündchen die speckigen Oberarme einschnürte. In dem dreiköpfigen Ermittlungsteam war er für alle Arbeiten zuständig, die vom Büro aus erledigt werden konnten. Es war erstaunlich, was seine Recherchen zutage förderten. Außerdem hatte er sich als Verbindungsmann zur KTU und Gerichtsmedizin ein breites Wissen in den kriminalistischen Hilfsdisziplinen angeeignet.
Toni grüßte die beiden, setzte sich an den Besprechungstisch und schenkte sich Mineralwasser ein. Auf der Herfahrt hatte er starken Durst bekommen. Sein Mund fühlte sich staubtrocken an. In einem Zug trank er das erste Glas aus, goss sich nach und leerte auch das zweite.
»Bist du unter die Kamele gegangen?«, fragte Phong grinsend und schob seine getönte Brille den Nasenrücken hoch. »Wo versteckst du deine Höcker?«
Toni war nicht zu Scherzen aufgelegt und überging die Bemerkung. »Worüber ich schon die ganze Zeit nachdenke«, sagte er. »Wie ist der Täter aufs Schiff gekommen? Ich meine, war er schon an Bord und ist irgendwann aus seinem Versteck gekrochen? War er vielleicht ein Gast von Kapitän Seitz? Oder hat er die MS›Beate‹ geentert?«
»Geentert?«, fragte Gesa. »Was soll das heißen?«
»Mir sind nur Actionfilme eingefallen, in denen ein schnelles Schlauchboot längsseits festmacht und jemand an Bord klettert. Hinterher ist er ja auch wieder weggekommen. Oder ist er in den Havelkanal gesprungen und ans Ufer geschwommen?«
»Berechtigte Fragen«, sagte Gesa. »Ein Besatzungsmitglied ist er jedenfalls nicht. Der Bootsmann hat ausgesagt, dass sie sich nur zu zweit auf dem Schiff aufgehalten haben. Die einzige Passagierin, die von Zeit zu Zeit mitgefahren ist, soll die Enkelin von Seitz gewesen sein. Ich hab den Bootsmann übrigens für morgen Nachmittag um siebzehn Uhr zur Befragung einbestellt.«
»Sehr gut«, erwiderte Toni zerstreut. »Jedenfalls müssen wir unbedingt herausfinden, wo, wie und wann der Täter aufs Schiff gekommen ist. Das wäre eine Aufgabe für dich, Phong.«
»Äh«, machte der Kriminalkommissar und kaute mit offenem Mund eine Lakritzschnecke. »Wie soll ich das anstellen?«
»Lass dir was einfallen«, erwiderte Toni.
»Wartet mal«, sagte Gesa und blätterte die Papiere durch. »Seitz ist in Hamburg gestartet. Von der Hamburger HafenlogistikAG. Die betreiben einen Universalterminal, wo das ganze Programm angeboten wird: Warenumschlag, Zoll und Lagerung. Ver- und entladen werden Stückgüter, Massengüter und Container.«
»Und wo fährt man von Hamburg nach Wustermark längs?«, fragte Phong. »Ich muss zumindest wissen, wo er haltgemacht hat.«
»Die Schiffe nehmen entweder die Kanäle oder die Elbe, würde ich meinen«, erwiderte Gesa. »Eigentlich müssten diese Angaben im Fahrtenbuch stehen, aber die letzte Tour fehlt. Vielleicht hatte Seitz die Angewohnheit, die Einträge erst am Zielhafen vorzunehmen, um die Fahrzeiten noch korrigieren zu können. Oder er war mit seinen Gedanken woanders und hat es vergessen.«
»Das kriegen wir raus«, sagte Toni und massierte sich die Schläfen, hinter denen sich ein stechender Schmerz eingenistet hatte. Während er ein weiteres Glas Wasser hinunterstürzte, dachte er, dass er heute nicht in der Stimmung für Überstunden war. Seine Entdeckung setzte ihm zu. Er wollte die Aufgaben delegieren und hier rauskommen. »Phong, mach mir bitte für morgen früh einen Termin bei dem Befrachter. Ich möchte mit dem Reeder Jens Mittelstädt sprechen. Er wird uns alle praktischen Fragen beantworten und auch sonst einige Auskünfte geben«, sagte Toni und berichtete, was er bei Frau Seitz in Erfahrung gebracht hatte.
»Er hat ihm einen größeren Geldbetrag vorgeschossen?«, fragte Gesa.
»Nein, das hat Frau Seitz so nicht gesagt. Ihr Schwiegervater hat wohl nur den Namen des Reeders fallen lassen und es ihr überlassen, Schlüsse daraus zu ziehen. Es kann alles Mögliche bedeuten.«
»Von wie viel Geld reden wir?«
»Das wusste sie nicht«, erwiderte Toni. »Ihr Schwiegervater hatte sie erst gestern informiert.«
»Krankentransport in die USA und Behandlungskosten«, sagte Gesa. »Dazu die Reisekosten für zwei Erwachsene. Es wäre vermutlich ein längerer Aufenthalt geworden. Vielleicht fünfundzwanzig- oder dreißigtausend Euro. Und wenn die Therapie teuer ist, einiges mehr. Es ist schon für weniger Geld getötet worden.«
»Sehe ich genauso«, sagte Toni. »Wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass die Enkelin von Seitz nicht mehr lange zu leben hat. Er wollte sie unbedingt retten und stand unter enormem Druck. Insofern ist fraglich, was er alles getan hätte, um an das Geld zu kommen und ihr die Behandlung zu ermöglichen. Vielleicht hat er den Reeder erpresst, vielleicht hat er sich von ihm einen Kredit geben lassen, vielleicht hat er sich auf etwas Illegales eingelassen, oder der Reeder steckt selbst mit drin. Möglicherweise haben sie Giftmüll transportiert oder Diebesgut geschmuggelt.«
»Du meinst Hehlerware?«
»Ich meine gar nichts, ich hab nur ein bisschen dahergeredet. Lasst uns jetzt nicht weiter spekulieren. Wir sollten zuerst die Fakten sammeln. Morgen wissen wir mehr.«
»Was ist mit dem Raser, der Seitz’ Frau und Sohn auf dem Gewissen hat?«, fragte Phong und gähnte herzhaft.
»Finde alles über ihn heraus«, erwiderte Toni. »Hast du die Fotos der Schaulustigen ausgedruckt?«
»Die Druckerpatrone ist leer, und im Lager habe ich keine neue bekommen«, antwortete Phong. »Die müssen erst welche bestellen. Und der Beamer ist auch kaputt. Du weißt, dass ich ihn schon vor vier Wochen zur Reparatur gegeben habe. Wenn du unbedingt willst, kann ich den Laptop holen, und wir klicken sie durch.«
»Ich hab sie lieber an der Pinnwand und in der Handmappe.« Toni arbeitete nicht sonderlich gerne mit elektronischen Akten. In ihnen übersah man zu leicht etwas. »Sieh zu, dass du das Druckerproblem löst. Was hast du über das Opfer herausbekommen?«
»Nicht viel, aber ich habe auch noch nicht richtig gesucht. Hier war ganz schön viel los.«
»Dann fang endlich an«, sagte Toni.
»Yes, Sir.« Phong führte Zeige- und Mittelfingerspitze an die Schläfe, als würde er salutieren.
»Gesa«, sagte Toni. »Steht irgendetwas Verdächtiges in den Schiffspapieren? Bist du sie durchgegangen?«
»Ich bin noch nicht fertig«, erwiderte die Kollegin, »aber bisher habe ich keine Unregelmäßigkeiten feststellen können. Die Frachtpapiere sind in Ordnung. Er hatte einen Generator geladen, der für einen Berliner Industriebetrieb bestimmt war. In der Vergangenheit wurde das Fahrtenbuch vorbildlich geführt, und die Fahrzeiten wurden stets eingehalten. Die Handyortung hat übrigens nichts ergeben.«
»Das wäre auch zu schön gewesen. Jedenfalls werden die Binnenschiffer nicht weniger Druck als die Lkw-Fahrer haben und zu Überschreitungen gezwungen sein«, sagte Toni. »Kontaktiere die Kollegen von der Wasserschutzpolizei und lass dir zeigen, welche Kontrollmöglichkeiten sie haben.«
»Das hatte ich ohnehin vor«, erwiderte Gesa.
»Was ist mit der KTU, hat sie auf dem Schiff etwas gefunden?«
Gesa und Phong tauschten einen Blick aus.
»Was ist?«, fragte Toni ungeduldig. Das Pochen hinter seinen Schläfen war kaum noch zu ertragen. Er musste hier raus. Er musste an die frische Luft und sich bewegen.
»Kurz bevor du gekommen bist, war Kriminalrat Schmitz hier«, sagte Gesa.
»Und?«, fragte Toni und hatte eine böse Vorahnung. Vor einiger Zeit hatte er einen Untersuchungsbericht geschrieben, der zweifelsfrei bewies, dass sich der Mörder vom Baumblütenfest in Werder noch auf freiem Fuß befand. Sein Vorgesetzter war dem Hinweis nicht nachgegangen und hatte damit seine Aufklärungspflicht verletzt. Er hatte sich angreifbar gemacht, und das hatte Toni ausgenutzt, um bei einem Fall zusätzliches Personal zu verlangen. Es war eine berechtigte Forderung gewesen, aber ihr angespanntes Verhältnis hatte sich seitdem weiter verschlechtert.
»Er hat uns darüber informiert, dass er die Kollegen abgezogen hat«, fuhr Gesa fort.
»Was? Die gesamte Mannschaft?«
»Ja, sieht so aus.«
»Hat er eine Begründung angegeben?«
»Nein, er war so plötzlich wieder draußen, wie er reingekommen ist.«