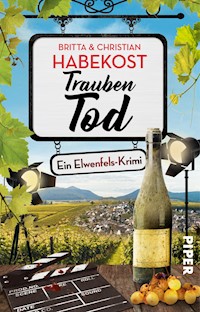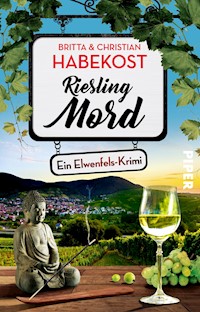10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Mord an der Weinstraße – Carlos Herb ermittelt Den Hamburger Privatermittler Carlos Herb verschlägt es in das pfälzische Dorf Elwenfels. Er soll das Verschwinden des millionenschweren Messe-Magnaten Hans Strobel aufklären. Strobels Frau Nadine hat Herb engagiert, hofft aber eigentlich, dass ihr Mann nicht mehr unter den Lebenden weilt, damit sie an sein Vermögen kommt. Unaufhaltsam wird Carlos Herb in die Welt der Elwenfelser gezogen und stellt immer mehr fest, dass er das Großstadtleben und seinen Job am liebsten an den Nagel hängen würde, um in der pfälzischen Provinz einen Neuanfang zu wagen. Nordlicht Carlos hat es mit den Dorfbewohnern allerdings nicht leicht, findet jedoch mit viel gutem Wein und Hartnäckigkeit die Wahrheit. Zwischen Weinreben und Pfälzer Lebensart wartet eine tödliche Überraschung … und jede Menge rasanter Krimi-Spaß! In vino veritas – der Täter hat keine Chance! Packen Sie Ihre Koffer und auf nach Elwenfels! Jeder Fall für Privatermittler Carlos Herb ist ein Weinfest für Krimi-Fans und kann unabhängig voneinander gelesen werden. Unser Serviervorschlag: Bei "Weingartengrab" anfangen, nach vorne durcharbeiten und wieder neu beginnen. Denn diesen Regionalkrimi werden Sie ins Herz schließen! Alle Bücher der Elwenfels-Reihe: Band 1: Rebenopfer Band 2: Winzerfluch Band 3: Rieslingmord Band 4: Weingartengrab Alle Bände sind unabhängig voneinander lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2020Covergestaltung: FAVORITBUERO, MünchenCovermotiv: SilkenOne / Getty Images und Motive von Shutterstock.comKarte: Tino Latzko
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Karte
Achtung / Owacht
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Epilog
Abspann
Glossar
Donkschää!
Karte
Achtung / Owacht
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Prolog
Das würzige Waldbodenaroma kam nicht länger gegen den Gestank seiner Angst an. Irgendwo auf dem langen Weg durchs Unterholz hatte sein Herz angefangen zu stolpern, als würde es vor einer drohenden Gefahr davonlaufen. Die wenigen Erinnerungsfetzen, die immer wieder wie Dunstschwaden in seinem dröhnenden Kopf aufstiegen, schienen das Stolpern nur noch zu verstärken. Ein Herzinfarkt wäre jetzt nicht das schlechteste Ende, dachte er. Es sei denn, er stieße auf einen Weg und würde gefunden.
Warum musste es in diesem Wald nur so still sein? Es dämmerte doch bereits, warum waren hier denn keine Geräusche? Wenigstens ein bisschen Gezwitscher, ein kleines Rascheln? Es hätte ihn getröstet mit dem Gefühl, noch am Leben zu sein. So aber war er unsicher, ob das Ganze nur eine unendliche Traumschleife in einer tiefen Ohnmacht war. Konnte man so einen Sturz überhaupt überleben? Offensichtlich schon. Aber wenn ihn nicht bald jemand fand, hätte er genauso gut unten am Abhang liegen bleiben können.
Er hob den Kopf und blinzelte. Das fahle Morgenlicht drang wie ein Keil in seine Augen. Stöhnend schloss er die Lider und ließ den Kopf zurückfallen auf den modrig riechenden Teppich aus Laub, Kiefernnadeln und Sand. Ausruhen … du musst dich ausruhen, dachte er.
Als er das nächste Mal aufwachte, war der Schmerz in seinem linken Bein so stark, dass er einfach weiterkroch, um sich davon abzulenken. Er dachte an das weitverzweigte Wegenetz in diesem Wald. Er hatte es auf der Wanderkarte gesehen. Irgendwann mussten Leute hier entlangkommen. Er konnte doch nicht ganz allein sterben!
In einem langen Aufmarsch zogen die Fehler seines Lebens an ihm vorbei. Da waren einige, die ihn bis heute verfolgten. Aber büßen würde er jetzt für den Fehler, sich nach einem arbeitsreichen Jahr ein bisschen Naturnähe gewünscht zu haben. Da hast du deine Natur … bitteschön, so viel Natur wirst du nie wieder bekommen.
Das Licht brach in langen Lanzen durch die Baumkronen. Er robbte mit geschlossenen Augen weiter, ignorierte stachelige Brombeerranken und Steine, biss sich auf die Unterlippe. Immer noch hüllte ihn eine unnatürliche Stille ein.
Plötzlich war ihm nicht mehr klar, was eigentlich das Beängstigende an seinem Zustand war: das gebrochene Bein und die blutende Wunde an seiner Schulter oder diese laute Stille inmitten der Bäume.
Da! Ein Rascheln, gleich hinter ihm! Keuchend drehte er den Kopf und bereute es sofort. Kurz darauf ein tiefes Schnarren, wie von einer gigantischen Schranktür. Er schob sich ein Stück weiter durchs Gestrüpp. Das bildest du dir ein, es war bestimmt nur ein Specht. Ein verdammt großer Specht …
Jetzt ertönte das Rascheln wieder, irgendwo vor ihm. Und dann ein Schrei. Ein schriller, lang gezogener Schrei. Er erstarrte. Sein Herz pumpte panisch, das zirkulierende Blut in seinen Ohren spülte alle anderen Geräusche weg. Das ist eine Sinnestäuschung … hat etwas mit der Gehirnerschütterung zu tun. Die verstärkt wahrscheinlich den leisesten Ton ums Hundertfache.
Er zwang sich weiter. Ganz unvermittelt verschwand das Unterholz. Das Licht … so gleißend hell. Die dunkle Wand des Waldes wich zurück. Gleichzeitig meldeten ihm seine letzten noch funktionierenden Synapsen eine Lichtung und helles, leuchtendes Grün.
Ein Picknickplatz, flehte er innerlich. Irgendeine Joggerin, die sich an den Holzbänken die Waden dehnt … Bitte! ln diesem Augenblick schien etwas Großes durchs Gehölz zu dringen. Er zuckte zusammen. Über ihm ein kühler Luftzug, Flügelschlagen und dann wieder dieses hölzerne Schnarren. Und ein weiterer Schrei.
Vögel, dachte er. Nur Vögel … Er ignorierte seine Angst und das intensive Gefühl von Bedrohung und schob sich vorwärts, doch sein Kopf stieß gegen etwas Hartes. Eine neue Schmerzwelle, eine neue Ohnmacht.
Dann lag er auf dem Rücken. Komischerweise fühlte er sich gut dabei. Es roch nach Gras und Wiese und noch nach etwas anderem, das er nicht erkannte. Etwas Frisches, das den Geruch von kaltem Schweiß überdeckte. Seine Zunge lag schwer und pelzig im Mund, sein Durst vertrieb sogar den Schmerz im Bein. Das Gras in seinem Rücken fühlte sich sehr weich an. Auf seinem zerschrammten Gesicht kitzelte die Sonne, und das Licht tat nicht länger in den Augen weh. Er blinzelte und schaute in ein Kaleidoskop aus hellgrünen, gezackten Flecken und goldenen Wirbeln. Wie schön … Man konnte ewig hinsehen.
Ein Gefühl von Frieden überkam ihn. Er wunderte sich auch gar nicht über den riesigen Vogel mit dem sehr langen, gebogenen Schnabel, der neben ihm hockte und ihn aus honiggelben Augen anstarrte. Er starrte zurück. Was hätte er auch sonst tun sollen. In nächster Nähe erklang wieder das Schnarren, sein Blickfeld verkleinerte sich. Er versank in einem Strudel aus goldenen Lichtflecken, grünen Blättern und diesen Vogelaugen. Es gelang ihm nicht, die ganze Gestalt des Vogels zu erfassen. Das Tier war halb verdeckt von gezackten Blättern. Zwischen den Blättern schimmerte etwas, das aussah wie Haut. Der Vogel ruckte mit dem Kopf nach vorn, als versuchte er, nach ihm zu hacken. Er wollte zurückweichen, aber er konnte sich nicht mehr bewegen. Seine anfängliche Verwunderung versank sofort wieder in Gleichgültigkeit. Es war ohnehin alles nicht real. Real war nur dieses seltsam wohlige Gefühl, das ihn allmählich herauslöste aus Schmerz, Schwäche und Angst. Er schaute nach oben und folgte den leise rauschenden Blättern in ihrem Tanz mit dem Morgenlicht. Das alles war wunderschön. Und weil es so schön war, wusste er, dass er sterben würde.
»Messekönig« Strobel weiterhin verschwunden
Zwei Wochen nach dem Verschwinden des bekannten Hamburger Messeunternehmers Hans Strobel konzentrieren sich die Ermittlungen der Polizei nun weitgehend auf das private Umfeld des Mannes. Inzwischen kann ein Verbrechen nicht mehr ausgeschlossen werden. Nachdem Strobel am 29. August zu einer privaten Reise ins rheinlandpfälzische Deidesheim aufgebrochen war, meldete ihn seine Frau drei Tage später als vermisst. Die Millionärsgattin kann keine Gründe für die Reise nennen. Strobel wurde am 1. September zurückerwartet, war jedoch die vorangegangene Nacht schon nicht mehr in seinem Hotel in Forst an der Weinstraße gesehen worden. Er hat dort niemals ausgecheckt.
Die befragten Zeugen vor Ort konnten keine Hinweise zum Verbleib des Mannes geben. Anlass zur Beunruhigung gibt vor allem die ergebnislose Ortung seines Mobiltelefons. Strobels Frau gab an, dass ihr Mann sein Handy niemals ausgeschaltet habe, aus Angst, eine wichtige Nachricht zu verpassen.
Hans Strobel gilt als unumstrittene Nummer eins im europäischen Messemanagement und richtete zwei Wochen vor seinem Verschwinden die legendäre »European Wine Trophy« in München aus, zu der sich jährlich ein internationales Spitzenpublikum einfindet. Als auffällig gilt die Tatsache, dass Strobel so kurz nach der Messe zu einem unbekannten privaten Zweck nach Deidesheim aufbrach, wo er zuletzt in einem renommierten Weingut gesehen wurde. Dies sei, so Nadine Strobel, völlig untypisch für ihren Mann, denn in diese Zeit fiel die Vorbereitung für die Elektronikmesse in München, für die Strobel Tag und Nacht hätte abrufbar sein müssen.
Strobels Jaguar wurde auf dem Parkplatz des Hotels gefunden. Seine Bankkonten blieben seit seinem Verschwinden unberührt.
Fall Strobel – Ermittlungen eingestellt
Das Rätsel um den verschwundenen Messeunternehmer Hans Strobel bleibt wohl ungelöst. Laut Polizei hat sich auch nach intensiver Nachforschung keine neue Spur ergeben.
Ermittlungen im privaten Umfeld des Mannes blieben ohne Ergebnis. Um den Konzern Eurotrade weiterführen zu können, stehen Strobels Partner seit einigen Wochen in Verhandlungen über eine Nachfolge. Die Akte Strobel wird zunächst nicht geschlossen, aber die Ermittlungseinheit wird nun aufgelöst. Kriminalhauptkommissar Schreiber sagte der Presse, dass alles darauf hindeute, dass der Verschwundene einem Verbrechen zum Opfer gefallen sei. Hans Strobel verschwand Ende August des vergangenen Jahres im pfälzischen Deidesheim, sechshundert Kilometer von Hamburg entfernt.
Kapitel 1
Wie ein Hamburger in die pfälzische Wildnis vorstößt und dabei fast verdurstet
Später, als alles vorbei war, dachte Carlos Herb noch einmal zurück an ein geflügeltes Wort, das die Leute in dieser Gegend verwendeten: »Wer long frogt, geht long err.« – Wer lange fragt, geht lange in die Irre. Heute konnte er darüber lachen. Nichts ist treffsicherer und dadurch schmerzhafter als alte Volksweisheiten. Doch damals, als er diesen Satz zum ersten Mal hörte, in diesem als einfache Weinstube getarnten Tempel der Schoppenglas-Philosophie, da dachte er noch, die Eingeborenen mit ihren seltsamen speichelzischenden Kehllauten wollten ihn wieder mal an der Nase herumführen. Sein erster Übersetzungsversuch mit »Wer lange fragt, wird langsam irre« löste Gelächter und Kopfschütteln in der Runde der rotbackigen Zecher aus. Die Reaktion hätte für seine gerade beginnenden Nachforschungen nicht passender sein können. Er fühlte sich fremd hier, ausgesetzt in einem wilden Sprachdschungel, für den es kein Wörterbuch gab. Kein Ort der Welt konnte weiter von seiner Heimatstadt Hamburg entfernt sein als dieses Elwenfels.
Er war nicht freiwillig hier in der pfälzischen Wildnis gelandet. Eigentlich sollte er ernsthafte Nachforschungen anstellen, Informationen beschaffen, für die seine Klientin ihn gut bezahlte. Und was bekam er zu hören: folkloristische Weisheiten, Trinksprüche und Eingeborenen-Witze. Dazu immer wieder einen Satz, der aus dem Repertoire uninspirierter Krimiautoren stammen könnte: Das haben wir doch alles schon der Polizei gesagt. Klar. Als ob er das nicht gewusst hätte. Und Nadine Strobel wusste es auch.
Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er auch getrost zu Hause bleiben können, in seiner schönen Wohnung mit Dachterrasse in Alsternähe. Das Problem war nur, dass er sich in letzter Zeit echt schwertat, die happige Miete für sein Zuhause aufzubringen. Vor zwei Jahren war er den bewaffneten Beamtenstatus losgeworden, eine ganz blöde Geschichte …
Er schirmte die Augen mit der Hand gegen die Sonne ab und schaute auf die Ziffern seiner Uhr: 16:37. Zeit für ein kaltes Bier und etwas zu beißen. Aber hier konnte er nicht bleiben. Unmöglich. Nicht in dieser brodelnden Menschenmasse, die sich unter der heißen Septemberabendsonne übers Kopfsteinpflaster schob und an dem Gesöff festhielt, nach dem die berühmte Straße am Haardtrand benannt war. Wein? Pfui Teufel! Dass die Leute ihn aus einer Art gepunkteter Blumenvase tranken, machte die Sache nicht besser. Ganz im Gegenteil.
Carlos Herb rief sich ins Gedächtnis, was er über Hans Strobel wusste, diesen stattlichen Fünfziger mit dem begehbaren Humidor in seiner Villa an der Außenalster und dem untrüglichen Gespür für alles Kostspielige, Edle, Exklusive. Er dachte an seinen Besuch bei Nadine Strobel, bei dem sie ihn ins Arbeitszimmer ihres verschwundenen Gatten geführt hatte. Er ärgerte sich jetzt noch über das Gefühl der Einschüchterung, das ihn beim Anblick der teuren Clubsessel, des echten van Gogh und der unbezahlbaren Aussicht befallen hatte. Er hatte sich umgesehen, aber nur flüchtig. Das hier war nur die Fassade des Verschwundenen. Zwischen den futuristischen Möbeln, den Art-déco-Lampen und den Designer-High-Heels seiner Bewacherin hatte sich die Sammlung alter Schallplatten von Cole Porter, Oscar Peterson und James Price Johnson überraschend intim ausgenommen. Es war fast, als würde zwischen den antiquierten Papphüllen der menschliche Teil Hans Strobels hervorblinzeln.
Er hatte sich gefragt, warum Strobels Frau ihm den protzig ausgestatteten Raum mit so viel unverhohlenem Stolz präsentierte. Als genüge es, dass sie nur den Nachlass ihres Mannes vorzeigen müsse, um sich als sorglose Millionärsgattin zu fühlen. Aber nicht mehr lange. Wurde nicht binnen drei Jahren der Tod Strobels nachgewiesen, ginge sein gesamtes Vermögen an eine humanitäre Stiftung in Laos. Seine Frau würde in die Röhre gucken.
Dass er diese Bedingung ein halbes Jahr vor seinem Verschwinden in seinem Testament verfügt hatte, machte die Ermittler mehr als stutzig. Es schien, als habe Strobel gewusst, dass er verschwinden würde. Dass jedoch nur im Fall seines nachgewiesenen Todes das Vermögen an seine Frau ausgezahlt werden sollte, rückte Nadine Strobels Auftrag an Carlos in ein ganz anderes Licht. Sie wollte, dass Herb ihren Mann fand. Am besten tot.
Aber wenn Strobel schon verschwinden musste, warum dann nicht irgendwo anders? Warum ausgerechnet hier, in der tiefsten Provinz? Gut, dieser Teil Deutschlands galt zwar als Toskana-Ersatz für alle, die es nicht über die Alpen schafften. Aber Carlos Herb wollte einfach nicht verstehen, was die Leute so toll fanden an den paar lang gestreckten Bodenwellen, auf denen hektarweise trinkbare Monokultur wuchs. Die vereinzelten Burgruinen auf dem Mittelgebirgsrücken, zu deren Füßen sich eine brave Reihe von Dörfern versammelte, erinnerten ihn in ihrer gespreizten Niedlichkeit an die Märklin-Modelleisenbahn seiner Kindheit.
Und was noch viel wichtiger war: Was hatte Hans Strobel hier gemacht? Dieser souveräne Lebemann mit den edlen Manschettenknöpfen und den handgefertigten John-Lobb-Schuhen, der in Paris, Rom und London zu Hause war, auf den Seychellen seinen von zehnstelligen Zahlen rauchenden Kopf in den Indischen Ozean tauchte und auf dem Hamburger Flughafen einen Privatjet parkte. Was hatte der hier gemacht? In dieser weinseligen Puppenstube, wo die Leute unter der Woche nichts Besseres zu tun hatten, als Hintern an Hintern auf Holzbänken zu sitzen und sich an diesen seltsamen Riesengläsern festzuhalten. Er versuchte, sich eines dieser Gläser in Hans Strobels gepflegten Händen vorzustellen. Das Bild kippte sofort.
Carlos Herb schwitzte und hatte großen Durst. Die letzte Flüssigkeitsaufnahme, die die Trinkwecker-App seines iPhone eingefordert hatte, war ein eisgekühlter Nescafé an einer Autobahnraststätte gewesen und schon eine ganze Weile her. Jetzt steckte er hier fest in dieser wogenden, brodelnden, herumkrakeelenden Menschenmenge. Er reckte sich, um über den Köpfen einen Ausgang, einen Notausgang aus dieser alkoholisierten Masse zu finden. Irgendwo spielte jemand Akkordeon. Es wurde gesungen und geschunkelt. Wie putzig.
Plötzlich ertönte ein Schrei: »Schoppegewitter!!!«, dann lautes Gläserklirren und noch lauteres Lachen. Eingeborene und ihre Rituale, er mittendrin. Ausgeliefert und durstig. Sollte er sich in eine der langen Schlangen vor den Verkaufsständen einreihen, um dann vielleicht zu erfahren, dass es Wasser nur mit Wein gemischt gab?
Wie würden diese Leute hier reagieren, wenn er sie fragte, warum auf den Angebotstafeln kein Bier aufgelistet war? Er wusste nicht, wie die Menschen hier tickten, wenn der Alkoholpegel erst einmal den Geräuschpegel überholt hatte.
Lieber raus aus Deidesheim, weg von diesem Weinfest. Irgendwohin, wo es ruhiger war. Dicht an ihm vorbei drängte sich eine junge Frau, vier randvolle Gläser in den Händen. Carlos sah die schwappende, zartgelbe Flüssigkeit und wie zwischen den runden Einbuchtungen des Glases kleine Bläschen aufstiegen. Er musste schlucken. Dann schon lieber eine Fanta. Die Kellnerin mit den Gläsern wurde an einem Tisch mit lauten Freudenrufen begrüßt: »O, o, o mol do, un hopp!«
Carlos hatte keine Ahnung, was diese Aneinanderreihung von einsilbigen Lauten zu bedeuten hatte. Aber mit welcher Urgewalt diese Laute aus den Kehlen gepresst wurden! Kein Wunder, dass sie so durstig waren. Es klirrte, sie johlten – und schon wurde genüsslich getrunken. Wie übertrieben sie sich gaben, dachte Carlos. Das hier war kein Bordeaux, sondern Pfälzer Weinschorle. Wie konnte man da so herzhaft ausatmen und laut schmatzend seufzen? Rasch schob er sich weiter. In seine Nase stieg fettiger Fleischgeruch, und sein Magen quengelte. Er hatte ja nicht wissen können, dass hier ein Weinfest stattfand. Obwohl es natürlich zu dieser Gegend passte.
Immer wieder drückte sich das Bild von Strobel in seine Gedanken. Der Konzernchef passte hierher wie ein edles Rennpferd in eine schlammsuhlende Horde Hippos. Eigentlich wäre Herbs erste Adresse das Weingut gewesen, in dem Strobel zum letzten Mal lebend gesehen worden war. Es galt als edel und renommiert, aber Carlos kam gar nicht erst bis zur Tür. An dem ehrwürdigen alten Holztor des Weinguts Gebrüder Kruse hing ein Schild: »Wegen Weinfest geschlossen. Sie finden uns am Stand 20.«
Das war für Carlos das Zeichen, seine Befragung lieber zu vertagen. Niemand würde sich Zeit für ihn nehmen, wenn sie gerade mit der Flüssigkeitsversorgung ihrer Landsleute zugange waren. Er versuchte es bei der winzigen Touristeninformation im Stadtkern. Der Mann hinter dem Schalter sah aus, als würde er zumindest nicht seit gestern in diesem Büro arbeiten. Auf Carlos’ routinierte Fragen nach Strobel rollte er entnervt mit den Augen und antwortete mit dem Spruch: »Das ham mir doch alles schon der Polizei verzählt.«
Dieser Dialekt! Verzählt! Hatte er nun geredet oder gerechnet? Immerhin wusste der einheimische Mathematiker noch, wer gemeint war. Wahrscheinlich hatten sie damals ganz Deidesheim befragt. Strobels Verschwinden lag jetzt genau ein Jahr zurück.
Carlos Herb zwängte sich durch die schwitzende Menge, die anscheinend nur das eine wollte: einen Platz in den Reihen vor der Tränke. Seine Ellbogen wurden ein bisschen spitzer, die Schritte etwas fester. Er war kurz davor, die Geduld zu verlieren. Am liebsten hätte er jemanden getreten. So viel Körperkontakt mit wildfremden Menschen innerhalb einer Viertelstunde hatte er noch nie gehabt. Doch dann lichtete sich die Menge, und er atmete auf.
Im Auto drehte er sofort den Regler der Klimaanlage auf und brauste auf die Umgehungsstraße. Viele Autos parkten zwischen den Rebzeilen. Überall pilgerten Leute ins Innere des Ortes. Genau: Sie pilgerten! Das hier war so eine Art religiöses Massenphänomen. Nur schnell weg hier!
Er entdeckte ein Schild, das in Richtung des Nachbarortes zeigte, und Carlos blinkte sich in die Ausfahrt. Forst. Dort war das Hotel, in dem Strobel übernachtet hatte. Na, dann konnte er hier ja gleich weitermachen mit seiner Befragung dieser überaus eloquenten und auskunftsfreudigen Einheimischen. Wo beginnen mit einer Suche, die vollkommen sinnlos schien und von offizieller Seite bereits abgeschlossen war? Wo anfangen mit der Beschaffung von Informationen, die es nicht gab? Hans Strobel konnte sonst wo sein! Die Nachforschungen der Polizei und alles, was Herb aus der Akte wusste, glichen dem berühmten Witz von einem Mann, der seine verlorene Brieftasche nur deswegen unter einer Straßenlaterne suchte, weil dort die besten Lichtverhältnisse herrschten.
Vom Rücksitz angelte er sich eine Flasche Cola und trank den letzten, warmen Schluck. Besser als nichts. Er warf einen Blick in den Rückspiegel, gab sich wenig Mühe, das aufkommende Rülpsen zu unterdrücken, und verzog das Gesicht. Sein Barthaar wuchs schnell. Er sah schon nach wenigen Stunden aus, als hätte er drei Tage aufs Rasieren verzichtet. Was nicht besonders gepflegt wirkte. Erst recht, weil die dunklen Stoppeln, in die sich auch schon ein paar graue schmuggelten, zusammen mit seinem müden Blick nicht gerade auf einen gesunden und vitalen Menschen schließen ließen. Dabei fühlte er sich eigentlich gut. Aber seine Augenfarbe wechselte von einem hellen Blau in ein schlammiges Grün, wenn es ihm zu viel wurde. Wahrscheinlich war dieser Farbwechsel auch ein Anzeichen für zu wenig Flüssigkeit. Vielleicht gab es ja in diesem Forst-Dorf einen netten kleinen Biergarten.
Aber Carlos Herb wurde enttäuscht. Forst glich einer kleineren Ausgabe seines feierwütigen Nachbarortes, nur dass hier statt dem wilden Treiben stille, fast schon kitschige Beschaulichkeit angesagt war. Sein Audi rumpelte über das Kopfsteinpflaster der Hauptstraße. Alle paar Meter ein offener Hof mit Feigenbäumen und Palmenkübeln. Und natürlich das Unvermeidliche: Weinstube hier, Weinstube da. In jedem zweiten Hof. Auch hier saßen Leute, denen der Durst in den Gesichtern stand. Verrückte Gegend.
Als er am Hotel Rebstöckel aus seinem Wagen stieg, wunderte er sich erneut über Hans Strobel. Wieso stieg so ein Mann in einem Zwei-Sterne-Hotel ab, wenn er sich doch in Deidesheim in einem Nobelhotel hätte einquartieren können? Herb betrat den Eingangsbereich und kniff die Augen zusammen, um überhaupt etwas sehen zu können. Durch die gelben Butzenscheiben drang so viel Licht wie in eine alte, verstaubte Flasche. Als er gerade ein halbherziges »Hallo« ausstoßen wollte, schallte es ihm aus der Finsternis entgegen.
»Mir sin ausgebucht!«
Carlos prallte fast gegen die Frau, die mit verschränkten Armen vor der Rezeption stand, ein für diese Gegend so typisches, resolutes Exemplar mit Blumenkleid und Dauerwelle, das ein intensives Kartoffelsalat-Aroma ausströmte. Oder kam der Geruch von draußen? Carlos sah in das entschlossene, aber nicht abweisende Gesicht.
»Ich suche auch kein Zimmer«, sagte er.
»Alla donn. Is sowieso alles dicht. Von do un runner bis Därkem und nuff bis Londaa.«
»Äh … wohin?« Carlos verzog das Gesicht. Am liebsten hätte er die Dame an den Schultern gepackt und geschüttelt, damit aus diesem Mund wenigstens ein kleiner Anstandsrest an Deutsch herauskam. Unglaublich war das. In einer Touristenregion derart zu radebrechen. Da verstand er ja die alten Leute oben an der Nordsee mit ihrem Plattdeutsch besser.
»Ah, es ist halt ziemlich voll alles. Wege de Woiles … also, weil die Weinlese gerade stattfindet und das Woifescht … also Weinfest.«
Wollte die Frau ihn jetzt auf den Arm nehmen, oder war das ein Versuch in hochdeutscher Grammatik? Woi, so sprachen sie den Rebsaft also aus. Vielleicht lag es ja an der kurzatmigen Phonetik, dass sie hier so viel davon trinken mussten.
»Naja, dann komm ich am besten wieder, wenn das Fest in Deidesheim vorbei ist, oder?«, fragte Carlos.
»Wenn des rum, also vorbei is, dann fangt unsers an. Eins nachem annere, nunner bis Därkem un …«
»… un nuff bis London, genau, ich hab’s verstanden«, beendete Herb den Satz für sie, nicht ohne ein schnelles, friedensstiftendes Lächeln hinterherzuschieben.
Die Frau lachte, dass sich die Blumen auf ihrem Kleid wölbten. »Na alla, dann haben Sie des schon mal begriffe, odder? Wenn Sie jetzt noch en Elwetritsch fange, dann sind Sie schon en halbe Pälzer, gell!«
»Naja, ich weiß gar nicht, ob ich das will … äh, darf, also soll …«, stammelte Herb im Angesicht der angedrohten Eingemeindung. Was brabbelte die da? Was sollte er fangen? Er beschloss, die Gesprächsführung wieder an sich zu reißen, und bemühte sich um einen eindringlich ernsten Ton. »Gute Frau! Darf ich Sie etwas Wichtiges fragen? Ich suche jemanden. Dringend!«
Das Blumenkleid straffte sich. »Ou, Sie sin aber kein Journalischt, odder? Sind Sie do wege dem Struwwel?«
»Bitte wer?«, wisperte Carlos. Wie nannte sie den Verschwundenen? Der Durst machte ihn fertig und verlangsamte allmählich sein Denken. Er war nicht in der Lage, der Frau zu folgen. Sie ließ ihn auch gar nicht zu Wort kommen.
»Ich sag nix mehr zu der Sach. Un mein Mann aach net. Des habe mir doch alles schon der Bolizei …«
»… die hat sich verzählt, ich weiß, ich weiß. Ist schon gut«, winkte Carlos ab und verabschiedete sich. Im Hinausgehen fiel ihm ein Ständer mit allerlei Prospekten über das dürftige Freizeitangebot der Region auf. Er interessierte sich weder für Burgen, Keltenwege, Vogelwanderungen und erst recht nicht für Wein. Aber seine Erfahrung sagte ihm, dass er sich auf diese Provinz einlassen musste, wenn er irgendwie weiterkommen wollte. Also verbuchte Carlos die kurzen, unerquicklichen Erlebnisse im Weingut und im Hotel Rebstöckel als praktische erste Tuchfühlung. Als Basis für sein weiteres Vorgehen. Immerhin wusste er jetzt, mit was für einer Sorte Mensch er es hier zu tun hatte. Leute, die sich nicht gerne etwas fragen lassen und dafür aber gerne etwas ganz anderes, so hatte er gelernt, verzählen. Trotzdem nahm er einige Prospekte mit, einfach so aus Gewohnheit.
Er stiefelte zurück zu seinem Audi und startete den Motor. Als er den Schalthebel auf »D« stellte und überlegte, in welche Richtung er jetzt fahren sollte, erkannte er, dass er hier mehr oder weniger gestrandet war. Wo sollte er heute Nacht schlafen, wenn das, was die Frau gesagt hatte, stimmte?
Er hätte diesen ganzen Fall nicht annehmen sollen. Es war doch völliger Blödsinn, Zeitverschwendung und blanker Masochismus. Carlos dachte an Hamburg. Wie schön wäre es gewesen, jetzt an der Alster zu sitzen, vor sich ein kaltes Jever. Aber Hans Strobel war nun einmal hier verschwunden, irgendwo in diesem bewaldeten Gürtel, der das eintönige Rebenmeer beendete. Und seine Frau, Nadine Strobel, war nun einmal davon überzeugt, dass die Polizei irgendetwas übersehen hatte. Dass es einen Hinweis geben musste auf den Verbleib ihres Mannes. Und er, um die Sache rund zu machen, brauchte nun einmal das Geld.
Carlos wendete den Audi und fuhr zurück auf die Weinstraße in Richtung Deidesheim. Die Sonne war weitergewandert, und ihm wurde immer heißer. Seine Finger begannen, nervös auf dem Lenkrad zu trommeln. Eine Abfahrt tauchte vor seinen Augen auf. Die Straße führte nach rechts auf die Hügelkette zu, die hier Haardt genannt wurde. Ohne zu wissen warum, steuerte er den Wagen in die Kurve – und musste im nächsten Moment scharf bremsen. Aus einem schmalen Weg zwischen den aufgereihten Weinstöcken kam ein absurd kleines landwirtschaftliches Gefährt herausgefahren. Es sah aus wie ein kleiner, seitlich zusammengestauchter Traktor, und sein Anhänger war mit einem Berg staubig-grüner Trauben beladen. Carlos scherte aus und überholte. Auf dem Fahrersitz saß ein alter Mann mit Strohhut. Über dem Bund seiner Cordhosen wölbte sich ein wohlgenährter fester Bauch, über den sich Hosenträger spannten. Er trug ein blau-weiß gestreiftes Hemd, das aussah wie das Oberteil eines Schlafanzugs. Über seinen bläulich-rosa Backenwölbungen blitzten Carlos erstaunlich jung wirkende, leuchtende Augen entgegen. Der Mann nickte und lachte. Seine Lippen formten Worte, die Carlos wahrscheinlich auch dann nicht verstanden hätte, wenn er sie gehört hätte.
Der hat die Ruhe weg, dachte er und versuchte, gegen seine gereizte Stimmung anzukämpfen. Aber es gelang ihm nicht. Er musste seine Nerven beruhigen, irgendwo ankommen. Einen klaren Kopf kriegen. Er wusste eigentlich nur eins: Geld war keine ausreichende Motivation, um an einem Ort wie diesem zu sein.
Die letzten Weinreihen schmiegten sich hier an eine Anhöhe. Dann veränderte sich die Vegetation schlagartig, und Carlos dachte an ein Wort, das ihn schon als Kind im Erdkundeunterricht irgendwie fasziniert hatte: Baumgrenze. Das hier war zwar streng genommen keine Baumgrenze, aber die Reben mit ihrem gelb leuchtenden Laub endeten eben genau da, wo ihnen die Bäume ihre Grenze setzten. Hier begann der Pfälzerwald, das, so hatte einer der Prospekte mit großen Lettern beworben, größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands. Denselben Satz hatte er auch schon mal über den Thüringer Wald gehört. Typisch. Das waren die Superlative, mit denen sich die Provinz schmücken musste, damit man überhaupt Notiz von ihr nahm.
Er sehnte sich nach Hafenluft und Nebelhörnern. Aber kaum schlossen sich die Baumkronen wie ein Tunnel über der Straße, fühlte Carlos sich besser. Er wunderte sich selbst ein wenig über die Erleichterung, die ihn überkam. Ohne dass er sich den Grund dafür erklären konnte, übten Bäume eine beruhigende Wirkung auf ihn aus. Er hatte früher einmal eine Wohnung gekündigt, weil die große Kastanie vor seinem Fenster gefällt werden musste, und sich danach eine neue Bleibe gesucht, die in der Nähe eines Parks lag. Andere Leute brauchten Südbalkon und einen Aufzug. Er brauchte die Nähe zu einem Baum, und sei es zur Not auch nur eine kleine Birke. Hier und jetzt, als er eintauchte in die dunkelgrüne Dämmerung, war es, als fiele die Last des unangenehmen Starts unten an der Weinstraße wie ein Stein von ihm ab. Er schaltete die Klimaanlage aus und fuhr alle vier Fenster herunter. Waldluft. Dann hatte die Pfalz also doch noch etwas mehr zu bieten außer ihrem langweiligen Rebenmeer.
Eine ganze Weile fuhr er die sanft gewundene Straße bergauf, nur begleitet von herbstlich gefärbtem Mischwald. Am Rand der Straße hockten Krähen, ein Stück weiter entdeckte Herb einen toten Bussard. Er schaute schnell weg und lenkte das Auto auf die Gegenfahrbahn. Zwischen den Bäumen verdichtete sich das Abendlicht. Er fuhr direkt auf die Sonne zu. Mit der rechten Hand tastete er nach der Sonnenbrille auf dem Beifahrersitz. Ein Ferrari-Gestell, keine Ahnung, wo er das herhatte. Herb fand die Brille mit dem protzigen, gelben Emblem auf den Bügeln albern, aber sie war seine einzige. Gegen die niedrig stehende Sonne war sie aber trotzdem machtlos.
Da, eine Abzweigung. Carlos kannte die Ortschaften entlang der Weinstraße mittlerweile im Schlaf, aber die hier war während der Vorbereitungen zu seinen Nachforschungen nicht aufgetaucht. Weder in der umfangreichen Kopie der Ermittlungsakte noch in den Berichten der Polizei aus Neustadt, die die Suche nach Strobel koordiniert hatte.
Elwenfels.
Später würde Carlos Herb die spontane Entscheidung, dort abzubiegen und der schmaler werdenden Straße weiter in den Wald zu folgen, mit der Tatsache begründen, dass er endlich wegwollte von den blendenden Sonnenstrahlen, die ihm die Sicht nahmen und seine Windschutzscheibe in einen Spiegel verwandelten. Und dass er sich wie magisch angezogen fühlte von diesem Wald. Ein Ort, der so schön darin eingebettet lag, konnte nicht verkehrt sein. Sofern dort kein Weinfest stattfand. Die Chancen dafür standen gut, denn soweit er wusste, wuchsen in bewaldeten Gebieten keine Reben. Und er hoffte, dass die Bewohner vielleicht nicht ganz so aufdringlich der offensichtlichen Lieblingsbeschäftigung ihrer Landsleute unten an der Weinstraße nachgingen.
Auf dem Schild hatte er die Kilometerzahl acht gesehen, die sich auf der schmalen, gewundenen Straße, die mal bergauf, mal bergab führte, ganz schön zogen. Kein Auto kam ihm entgegen. Das Sonnenlicht brach hier immer noch gleißend hell durch die Baumkronen, wechselte sich aber mit tiefdunklen, schattigen Abschnitten ab. Der rasche Wechsel von Hell und Dunkel malte undeutliche Schemen auf den Asphalt. Die Straße führte steil bergab hinter eine Kuppe. Die Fahrspur wurde immer enger. Missmutig schlängelte Carlos sich den Hell-Dunkel-Parcours entlang, als plötzlich etwas gegen die Windschutzscheibe knallte. Er stemmte seinen Fuß aufs Bremspedal und schloss die Augen.
Keuchend befreite Herb sich von seinem Gurt, riss die Tür auf und sprang aus dem Wagen. Der Audi war nur um Haaresbreite vor einem dicken Kastanienbaum zum Stehen gekommen. Carlos setzte sich auf den Hintern und starrte eine gefühlte Ewigkeit den winzig kleinen Abstand zwischen der Motorhaube und dem Baum an. Sein Herzschlag fiel nur widerwillig in einen normalen Rhythmus zurück. Er dachte an seinen letzten Erste-Hilfe-Kurs, den man bei den Bullen alle paar Jahre neu machen musste. Was tun bei Schock? Und Flüssigkeitsmangel? Carlos zwang sich, die frische Waldluft tief einzuatmen.
Was um Himmels willen war das gewesen? Ein schemenhaftes Etwas, das gegen die Scheibe geprallt war. Dunkel und ziemlich groß. Schon wieder ein Bussard, wie der, auf den sich weiter unten die Krähen gefreut hatten? Hatten die Viecher hier so eine Art Selbstmordkommando? Kaum war Herbs Puls wieder einigermaßen normal, kam die Wut zurück. Was musste er an diesem Scheißtag noch alles erleben? Wenn es nun ein Reh war? Oder ein Fuchs? Musste man so einen Wildunfall eigentlich melden?
Es war die Sorge um seinen Audi, die ihn aufstehen ließ. An dem Wagen war alles in Ordnung. Die Scheibe war ganz, der Lack unversehrt. Nur eine einzelne große Feder zitterte zwischen den Scheibenwischern. Herb zog sie hervor und betrachtete sie. Sie war so lang wie sein Unterarm, rostrot und mit kleinen weißen Punkten gesprenkelt.
Eine schöne Feder, dachte er und fühlte plötzlich eine unbegreifliche Wehmut. Wahrscheinlich ein Vogel, der unter Naturschutz stand und jetzt irgendwo auf dem Waldboden verendete. Carlos ging widerwillig auf die Knie und spähte unters Auto. Nichts. Er suchte die Stellen neben der Straße ab. Auch nichts. Dann fiel ihm die Stille auf. Eine Stille wie auf einem Berg. Kein Rascheln, kein Fiepen, kein Zwitschern. So, als hielte der ganze Wald den Atem an. Wo war nur dieser Vogel? Hatte der Aufprall ihn so weit weggeschleudert? Carlos hielt noch immer die Feder in der Hand und starrte angestrengt ins Zwielicht. Die Feder lief spitz zu und war am Stiel ganz flauschig und dick. Kein Blut. Vielleicht hatte das Vieh es doch überlebt.
In diesem Moment hörte er das Knattern. Ein stotterndes, röhrendes Geräusch. Er zuckte zusammen. Das war ein Motor. Und obwohl nichts passiert war, durchfuhr ihn ein neuer Schreck. Jetzt konnte er sich nicht mehr einfach aus dem Staub machen. Das Geräusch näherte sich nur langsam. Carlos hätte einsteigen und weiterfahren können. Aber er fühlte sich mit einem Mal seltsam hilflos, fast ausgeliefert.
Da ertönte ein Rascheln. Er fuhr herum. Doch das Unterholz blieb unbewegt. Irgendwo hinter den Bäumen erklang ein Vogelgeräusch, zumindest glaubte Carlos das. Er war ja kein Experte, aber dieses schnarrende Gackern konnte nur von einem Vogel kommen. Es hörte sich an, als würde ihn jemand aus der schattigen Finsternis des Waldes auslachen.
Dann kam die Quelle des stotternden Motors über die Kuppe, und Carlos starrte ihm entgegen. Der Mann auf dem Fahrersitz fächelte sich mit seinem Strohhut Luft zu, und sein Singen übertönte den Krach. Das konnte doch unmöglich sein … ein Gefährt, das höchstens dreißig Stundenkilometer fuhr. Wie war der Mann so schnell so weit gekommen? Carlos beschloss, auf den Mini-Traktor mit den Trauben im Anhänger zu warten.
Der Mann mit dem Strohhut stoppte und sah ihn lächelnd an. »Morsche«, sagte er.
Was wohl so viel heißen sollte wie »Guten Morgen«, ein Gruß, der angesichts der fortgeschrittenen Uhrzeit eine ziemliche Absurdität war. Der Traktor sah aus, als hätte er den Zweiten Weltkrieg noch mitgemacht und irgendwie überlebt.
»Äh … ja, hallo«, stammelte Carlos. »Sagen Sie, haben Sie auf dem Weg hierher einen verletzten Vogel gesehen?« Irgendwie klang diese Frage absurd. Aber das war wohl der Schock. Von Nahem betrachtet bot der Mann vor ihm die vermutete landwirtschaftlich geprägte Erscheinung. Aber etwas an ihm war anders. Das hier war wohl nicht die Kategorie »schweigsamer Hinterwäldler«. Jetzt kratzte er sich unter seinen Hosenträgern, und ein spitzbübisches Lächeln schien sein Gesicht auf die doppelte Breite zu vergrößern. Carlos fiel auf, dass er in Hamburg noch nie einem älteren Menschen begegnet war, der so strahlend lächelte. Und auch keinem jüngeren.
»En Voggel?«, fragte der Mann. Dann schielte er auf die Feder in Carlos’ Hand.
Der bekam sofort einen Schweißausbruch. Wie war das hier mit Naturschutz und seltenen Tierarten?
Doch der Mann sagte in freundlichem Ton, aber unverständlichen Worten: »Unser Vöggel do können ganz gut uff sich selbscht aufpasse.«
»Ach so …«
Der Mann wiegte den Kopf. »Außer es kommt einer, wo schneller fahrt wie ich, gell?«
»Äh, wie?«
Der Mann lachte. »Net jeder, wo schneller fahrt, kommt aach schneller an, gell?«
»Ja, da haben Sie wohl recht.«
»Jo. Un Sie wolln jo sischer gut ankumme in unserm Elwefels, odder?«
»Woher wissen Sie, dass ich da hin will?«
»Ah, wohin dann sonscht?«
Natürlich, dachte Carlos, es führte ja nur diese eine Straße in das Dorf. Was er dort wollte, wusste er inzwischen selbst nicht mehr.
»Jeder, wo was sucht, richtig sucht, der kummt irgendwann nach Elwefels.« Der alte Mann war jetzt auf einmal sehr ernst. Er sprach das »sucht« mit einem kurzen »u« aus, wie in Drogensucht.
»Wie meinen Sie das?«, fragte Carlos irritiert.
»Genau so, wie ich’s gesagt hab, so mein ich’s«, gab er lächelnd zurück. »Un hebe Sie die Feder gut uff. So en Glücksbringer hat net jeder, gell!« Er ließ den Motor an. »Alla dann.«
»Alla dann?«, echote Carlos fragend.
»Auf Wiedersehen, bis zum näggschde Mal«, übersetzte der alte Pfälzer und tuckerte davon.
Carlos sah auf die seltsame Feder in seiner Hand, die im späten Sonnenlicht fast schon kitschig leuchtete. Der Mini-Traktor entfernte sich im Schneckentempo über die nächste Hügelkuppe. Wie hypnotisiert starrte Carlos dem Gefährt hinterher. Der Gedanke, den alten Mann auf den verbleibenden sechs Kilometern bis Elwenfels noch einmal überholen zu müssen, war ihm auf einmal peinlich. Also wartete er. Eine kleine Pause nach diesem Schock konnte ja nicht falsch sein. Im Wald herrschte nicht mehr diese unendliche Stille. Jetzt sangen die Vögel in den Zweigen, ein Specht tackerte einen Baumstamm, und in den Blättern säuselte der Wind. Zwischen all diesen Geräuschen, so bildete er sich ein, war wieder das seltsame vogelartige Glucksen zu hören.
Er fühlte sich, als sei er aus einem Traum aufgewacht. Er klemmte die Feder hinter die hochgeklappte Sonnenblende des Beifahrersitzes und holte sein iPhone aus dem Handschuhfach. Kein Netz. Und auch keine Nachrichten. Niemand wusste, dass er im Auftrag von Nadine Strobel in den Süden Deutschlands gereist war. Private Schnüffler erzählten für gewöhnlich nicht, wo sie gerade unterwegs waren. Da passte es auch, dass Herb keine Frau hatte. Keine Kinder. Und irgendwie auch sonst niemanden, den das interessiert hätte.
Jetzt saß er hier in einem Niemandsland namens Pfälzerwald, hielt Ausschau nach einem seltsamen Vogel mit gepunkteten Federn und wartete darauf, dass der einzige andere Verkehrsteilnehmer in dieser gottverlassenen Gegend genug Vorsprung hatte. Carlos seufzte. Sein Durst ließ ihn schließlich weiterfahren. Auf der ganzen restlichen Strecke war nichts von dem kleinen Traubentransporter zu sehen.
Kapitel 2
Warum Rieslingschorle und Bratkartoffeln nicht geeignet sind als Grundlage für eine gespenstische Nacht
Während seiner Zeit als Hauptkommissar, aber auch in den beiden Jahren, in denen er sein Handwerk für private Auftraggeber ausübte, hatte Carlos eine Sache gelernt: Wenn man in einem aussichtslosen Fall eine Lösung finden will, muss man von einem anderen Standpunkt aus suchen und die abgegrasten Gefilde verlassen. In dieser Hinsicht war das abgelegene Dorf im Wald sogar ein guter Anfang. Zumindest redete Carlos sich das ein. Er glaubte nicht an die sprichwörtliche Fähigkeit des Erdbodens, Leute einfach so verschlucken zu können. Diese Gewissheit hatte er auch nicht verloren, nur weil er jetzt keinen Dienstausweis und keine Waffe mehr vorzeigen konnte. Er war froh, die halbautomatische P6 nicht mehr tragen zu müssen. Er hatte das Ding nie gemocht. Und dass er auch nicht damit umgehen konnte, hatte er ja hinreichend bewiesen …
Das Ortsschild von Elwenfels war überwuchert von Kletterpflanzen, der Ortsname fast unleserlich. Beim Anblick der kleinen blumengeschmückten Steinbrücke, die über einen Bach führte, überkam ihn eine intensive Urlaubssehnsucht. Warum nicht einfach ein paar Tage ausspannen und Nadine Strobel sagen, dass er bereits tief in die Nachforschungen eingetaucht sei? Er berechnete der Frau mit den starren Mundwinkeln den doppelten Tagessatz und Extraspesen. Sie würde ohnehin nicht merken, wenn er, anstatt Strobel zu suchen, erst mal ein bisschen vom Gas ging. Vor Carlos öffnete sich eine schmale Straße ohne jegliche Ausweichmöglichkeiten. Das Kopfsteinpflaster war derart schmal bemessen, dass er mit seinem Audi A6 gerade so knapp hindurchpasste. Niemand war zu sehen zwischen den niedrigen Sandsteinhäusern. Nur eine ziemlich dicke Katze spazierte von der einen zur anderen Straßenseite, und Carlos musste schon wieder scharf bremsen. Langsam fuhr er weiter und hielt Ausschau nach einem Lokal, einem Kiosk, irgendetwas. Seine anfängliche Erleichterung darüber, dass hier offensichtlich kein Weinfest stattfand, verwandelte sich in Enttäuschung. Das Dorf lag so ausgestorben, wie er befürchtet hatte. Die mussten hier doch ein Gasthaus haben.
Die Straße wurde etwas breiter und mündete in einen Platz mit einer alten Kirche, derer sich das Denkmalamt erbarmt hatte. Sie war von oben bis unten eingerüstet und mit grünen Planen verhängt.
In der Platzmitte plätscherte ein mit Blumen geschmückter Brunnen. Das Kopfsteinpflaster war so glatt, dass es die abendlichen Sonnenstrahlen widerspiegelte. Ringsum geschlossene Geschäfte, heruntergelassene Rollläden und schattige Gassen. Der Platz war vollkommen leer. Carlos entdeckte an einer Ecke ein geöffnetes Tor, über dem ein rotgoldener Vorhang aus Weinranken hing. An der Hauswand prangte ein Kasten mit Speisekarte. Er stellte den Wagen am Rand des Platzes ab, neben einem Gebäude, das eigentlich auf eine französische Postkarte gehörte: das Rathaus. Nur schien es, als sei es nur noch Kulisse, als würde hier nichts Offizielles mehr stattfinden, so, als sei kein Verwaltungsakt wichtig genug, um hier wieder Geschäftigkeit aufleben zu lassen.
Carlos stieg aus und war überwältigt von der Stille, die über dem leeren Platz lag. Keine Geräusche – nur ein paar gurrende Tauben auf den Dächern und leise säuselnder Wind. Wo waren all die Menschen? Hockten sie an einem so schönen Abend in den Häusern? Die grünen Netze rings um das Baugerüst an der Kirche rauschten leise, aber die Baustelle sah aus, als wären die Arbeiten dort längst eingestellt worden. Nur das Gasthaus machte ein bisschen auf sich aufmerksam, aber nicht durch Stimmen oder Gläserklirren. Über dem Eingang hing ein rostiges Schild, das leise im lauen Abendwind quietschte. An der Hauswand, zwischen Weinranken, war ein unleserlich gewordener Schriftzug zu sehen.
Carlos beschleunigte seine Schritte. Am liebsten hätte er gleich aus dem Brunnen getrunken, so groß war sein Durst inzwischen.
Am Tor warf er einen Blick in den rostigen Speisekartenkasten. Aber dort hing nur ein handgeschriebenes Blatt, auf dem stand: »Wenn’s Licht brennt, is uff«.
Wenn das Licht brennt, ist geöffnet. Na, das war ja wieder mal sehr putzig. Und wie war das dann tagsüber? Da galt dieser Spruch wohl offensichtlich nicht, dachte Carlos genervt, denn brennendes Licht konnte er nirgendwo entdecken. Er durchquerte den rankenverhangenen Durchgang und gelangte in einen Hof voller Tische und Stühle. Eine offene Tür führte in einen Gastraum, Stimmen drangen heraus. Carlos straffte die Schultern und betrat das Wirtshaus. Urplötzlich war es stockdunkel, und er rumpelte gegen einen Stuhl,
»So e Sonnebrill macht halt ganz schön dunkel, gell?«, rief jemand. Lautes Gelächter.
Natürlich, dachte Carlos, und jetzt wusste er auch, was ihn störte. Das Ding hatte sich wohl bei seinem Beinahe-Unfall verbogen und in seine Nasenwurzel gebohrt. Carlos nahm das demolierte Gestell rasch ab und sah sich einer hölzernen Theke gegenüber. Eine alte Frau stand dahinter und schälte Kartoffeln. Er schätzte sie auf achtzig Jahre. Ihre Finger waren flink, sie wirbelte mit dem Messer um die Kartoffeln, ohne hinzusehen. Stattdessen guckte sie ihn an. Direkt, nicht unfreundlich, aus klaren, scharfen Augen.
»Guten Abend«, sagte Carlos. »Ich hätte gerne ein Pils.«
Allein das Wort ließ sein Inneres erwartungsvoll zucken. Die Vorstellung, gleich seine Finger um ein kaltes, feuchtes Glas zu schließen, den frischen Schaum an den Mund zu heben und dann den Hopfensaft diese elende Trockenzeit hinwegspülen zu lassen, war einfach nur paradiesisch. Vielleicht war heute auch ein guter Tag, um nicht nur ein oder zwei Pils zu trinken. Sondern so viel, bis es ihm egal war, wie dieser Tag endete. In den letzten Monaten hatte es viele dieser Tage gegeben.
»Was wolle Sie?«, fragte die Frau verwundert und ließ das Kartoffelmesser sinken. Gütiger Himmel, hatte die Pranken. Wie ein Holzfäller.
»Ein Pils. Oder ein Bier. Also irgendein Bier halt.« So langsam passte sich wohl auch sein Sprachgebrauch an die sich anbahnende Dehydrierung seines Hirns an. Hinter ihm an dem runden Tisch wurde glucksendes Lachen laut.
Die Frau schaute ihn betroffen an. »Ou. Des dut mir leid. Bier habe mir do net. Schon seit de Werner 1959 gestorbe is, gibt’s ke Bier mehr do.«
»Wie bitte?« Carlos fühlte den kalten Hauch der Enttäuschung. »Wir sind hier in Deutschland. In einer öffentlichen Gaststätte. Und Sie führen kein Bier? Warum das denn?« Seine Stimme war etwas schrill geworden.
»Ah, weil’s keiner will. Der letschde war anno 59 …«
»… der Werner, ich weiß.«
»Ah, Sie kenne de Werner?«, fragte die Wirtin, ohne ihr Schmunzeln zu unterdrücken. »Warn Sie schon emol do gewese bei uns in Elwenfels?«
»Ja, nein. Natürlich nicht. 1959 war ich noch nicht mal auf der Welt.«
»Ich wollt grad sage, do defür haben Se sich aber gut gehalte, gell?«
Das Kichern am Tisch hatte sich in ein lautes Lachen gesteigert. Carlos warf einen ärgerlichen Blick über die Schulter. Die Männer schauten ihn alle mit unverhohlener Belustigung an. Aber das Schlimmste, was Carlos wahrnahm, waren die Gläser, die sie in den Händen hielten: wieder diese Glasbottiche. Gefüllt mit unterschiedlichen Pegelständen von Wein. Seine Gereiztheit brach sich nun ungehindert Bahn.
»Ja, ich bin die urkomische Dorfattraktion!«, blaffte er die glotzende Runde an. »So was habt ihr noch nie in eurem Leben gesehen. Ja? Einer, der keinen Wein trinkt! Was ist so witzig an einem Biertrinker?«
»Ha, nix. Mir trinke halt lieber Woi do, weider nix«, kam die Antwort. Wie auf einen geheimen Befehl erhoben nun alle ihre Gläser und stießen miteinander an, wobei auch noch ein ganzes Arsenal von Sprüchen ausgestoßen wurde.
»Zum Wohl!«
»Alla hopp!«
»Proschd!«
»Sin mer wieder gut, bei dem Sauwetter do!«
Carlos fühlte, wie er blass wurde. »Ja, ja, ich weiß, Schopfengewitter«, winkte er ab – nicht ganz sicher, ob er das seltsame Wort, das er vorhin aufgeschnappt hatte, korrekt wiedergab – und drehte sich wieder zu der Wirtin hinter der Theke. Sie schien seine Not zu bemerken. Im Handumdrehen stand eines dieser großen Gläser mit den kleinen, runden Vertiefungen vor ihm, in das sie Apfelsaft und Mineralwasser füllte.
»So, jetzt denken Sie sich den Schaum einfach dazu und runner damit! Verdurschdet is bei uns noch niemand!«
Ohne dem Sinn ihrer Worte auf den Grund zu gehen, packte Carlos das Glas und leerte es mit wenigen, langen Zügen. Für einen Moment war er ganz schwach vor Erleichterung und konnte sich tatsächlich nicht vorstellen, dass irgendein Bier dieselbe Wirkung auf ihn gehabt hätte. Er ließ sich auf einen der Barhocker sinken und stellte das Glas ab.
Die Wirtin musterte ihn. »Na alla, jetzt geht’s uns wieder besser, odder?«
Er nickte. »Ja, danke.«
Carlos spähte nach hinten. Die Männer redeten nun wild gestikulierend durcheinander und schienen das Interesse an ihm verloren zu haben. Es war der typische Haufen von Leuten, die wahrscheinlich schon tagsüber in einer schummrigen Kneipe beisammen saßen und diese Treffen als eine Art Job begriffen. Rotwangige, breitschultrige Typen Anfang fünfzig in Latzhosen und in unterschiedlichen Stadien des Haarverlusts. Mit einer Ausnahme. Am linken Tischrand saß ein Mann, der eigentlich in einen Headshop in der Großstadt gepasst hätte. Ein überraschend durchtrainierter Mann mit zimtbrauner Haut und Bob-Marley-Gedächtnisfrisur. Er trug ein blauweiß gestreiftes Shirt, knielange Hosen und Gummistiefel, sein Lächeln war breit und einladend. Er war auch der Einzige in der Runde, der keinen Wein in seinem Glas hatte, sondern Orangensaft. Und offensichtlich wurde das von den anderen akzeptiert.
Er sah sich in der Gaststube um. Es war eine dieser Dorfkneipen, die den jahrzehntealten Dunst von Küchendampf, Fett und Wein-Atem in jeder Holzritze und jedem Sitzkissen gespeichert hatten. Der Gastraum selbst war relativ klein, doch hinter den gelben Scheiben einer breiten Schiebetür neben der Theke erahnte er einen größeren Saal. An den Wänden hingen billige Ölgemälde, die ziemlich alt aussahen. So wie das ganze Mobiliar. Der Holzboden war ganz blank gerieben. Und die Schüssel, in der die geschälten Kartoffeln lagen, sah aus, als hätte schon die Urgroßmutter der betagten Wirtin ihr Gemüse hineingeschnippelt.
»Un wege was sin Sie jetzt bei uns do zu B’such?«, fragte die Frau plötzlich und nahm wieder das Messer zur Hand.
Carlos nickte. »Besuch? Ja genau. Woher wissen Sie das? Ich suche jemanden.«
»Ah?« Die alte Frau schmunzelte.
»Ja, es geht um einen Mann, der letztes Jahr an der Weinstraße verschwunden ist. Ich bin im Auftrag seiner Versicherung hier, denn der Mann …«
»Also bei uns hat er sich jedenfalls net versteckelt!«, unterbrach ihn die Frau.
Carlos zwang sich zu einem Lächeln. »Das habe ich auch nicht angenommen. Aber vielleicht haben Sie ihn ja mal gesehen.« Er holte sein Handy aus der Jackentasche, drückte drei nicht befolgte Erinnerungen der Trinkalarm-App weg und zeigte ihr das Bild von Hans Strobel. »Könnte ja sein, dass er einen Abstecher in Ihr Dorf, also Ihre schöne Ortschaft gemacht hat«, versuchte er es.
»Du bischt en ganz höflischer, gell?«, schnarrte die Frau und schaute kurz auf das Foto im Display. Hans Strobel sah schon auf dem offiziellen Vermisstenbild der Polizei nicht gerade aus wie ein Mann, der alle Herzen öffnete. Und auf diesem privaten Foto, das Carlos von Nadine Strobel bekommen hatte, war der Eindruck nicht besser. Ein bulliger Mann, dem man den Stress genauso ansah wie die Genusssucht und das viele Geld. Das Bewusstsein, sich über nichts Sorgen machen zu müssen, quoll aus den tiefliegenden Mundwinkeln, dem weichen Gesichtsfett und den fast verschlagen wirkenden Augen. Der Mann war keine Schönheit. Beim Anblick der jovial-kühlen Gesichtszüge verstand Carlos, warum Nadine Strobel ihren Mann mit so viel Geringschätzung bedacht hatte. Eine Geringschätzung, die sie nach außen hin tunlichst verbarg, aber Carlos konnte sie nichts vormachen. Ihm wäre Hans Strobel auch nicht sympathisch gewesen, aber darum ging es nicht. Die Frage war, ob sich irgendjemand an den übergewichtigen Mann in den teuren Anzügen erinnern würde. Es war ihm unangenehm, immer wieder dieses Bild Strobels auf dem Display zu öffnen. Er freute sich schon auf den Moment, wenn er es wieder würde löschen können. Und ihm wurde bewusst, wie vollkommen egal es ihm eigentlich war, ob Strobel tot war oder nicht.
»Wer soll des sein?«, fragte die Alte hinter der Theke etwas unwirsch und schälte schneller.
»Sein Name ist Hans Strobel. Die Polizei hat monatelang nach ihm gesucht. Die ganze Weinstraße rauf und runter. Sagen Sie bloß, Sie haben davon nichts in der Presse gelesen.«
Eine Hand legte sich auf Carlos’ Schulter, und ein bulliger Mann mit blauer Arbeitskluft neben ihm sagte: »Großer, ich sag dir was. Des Einzigschde, was mir do lese, sin Traube. Un die einzigschde Presse, wo uns do interessiert, is die Traubepresse im Weingut Bitterlinger, verstehscht?« Der Mann roch durchdringend nach frischem Holz.
»Hopp, Willi«, ging die Wirtin dazwischen, »lass’n in Ruh! Unsern Freund mag ken Woi.«
»Ken Woi? Ah, ken Wunder, dass er donn so durschdisch aus de Wäsch guckt.«
Wie war das? Durschdisch? Durstig … aus der Wäsche guckt. Ja genau. So langsam bekam er den Hauch eines Gefühls für diese exotischen oralen Klänge. Ein weiterer Mann in Jeans und rotem Hemd kam nun an die Theke und musterte ihn aufmerksam. Neben Carlos’ leerem Glas standen jetzt zwei dieser Wein-Vasen, und im Licht, das aus der Küche fiel, sah er die breiten Fingerabdrücke der Männer darauf. Ihm war auf einmal etwas mulmig zumute, dass sie ihm so zu Leibe rückten.
»Jetzt pass mol uff, was ich dir sag«, hob Willi zu einer scharfen Zurechtweisung an. Doch ein eindringlicher Blick der Wirtin ließ ihn sofort etwas zurückweichen. Er spitzte übertrieben die Lippen und fuhr in einem gekünstelten Flüsterton fort: »Äh, Sie werden entschuldische, der Herr. Ich det, also ich hätt mal gern eine Frage gestellt haben an Sie.«
Sein Nachbar gluckste. Er verströmte den Geruch nach Maschinenöl. Sie schienen also tatsächlich noch anderen Tätigkeiten nachzugehen außer dem betreuten Trinken im Gasthaus.
»Ja, fragen Sie ruhig«, sagte Carlos so gelassen wie möglich.
»Hascht du schon emol Woi getrunke?«
»Ja. Und ich weiß, dass er mir nicht schmeckt, weil …«
»Pälzer Woi?«, unterbrach ihn der Mann schnell.
»Nein, das war Rotwein. Bordeaux, um genau zu sein. Also sicherlich kein schlechter.«
»Un? Wie war des dann?« Willi machte ein durchaus interessiertes Gesicht.
»Naja, es war irgendwie pelzig im Mund und … Hören Sie, ich möchte mich jetzt hier nicht rechtfertigen müssen, nur weil ich keinen …«
»Nix, nix! Keiner hat gesagt, dass du dir die Gosch verrenke sollschd. Jetzt geht’s mal um was anderes: Was machscht du, wenn de Durscht haschd?«
»Durscht? Sie meinen Durst?«
»Richtig große Durscht, mein ich. Wenn die Sunn dir massiv uff de Schädel brennt un dein Gorgelzäppel am verdozzle is. Weeschwieschmään?«
Carlos verstand kein Wort, aber irgendwie hatte er auf einmal wieder einen ganz trockenen Mund. Die Wirtin kicherte und schlug mit einem Geschirrtuch nach Willi.
Carlos straffte sich. »Wissen Sie was? Wenn ich Durst habe, dann trinke ich Bier und fertig«, blaffte er und hoffte, dass die Diskussion damit beendet wäre.
Doch der Mann kam nun ganz nah an ihn heran und bemühte sich offensichtlich um einen eindringlichen Ton. Dazu senkte er seine Stimme auf eine Lautstärke, die für ihn wohl ein Flüstern darstellte, aber außerhalb dieses Sprachraums immer noch ein lauthals donnerndes Rufen war. »Dann hascht du noch nie en richtige Durscht gehabt.«
Sein Nachbar, der die ganze Zeit schweigend zugehört hatte, nickte bedeutungsschwer. Und auch die Wirtin setzte nun einen fast schon philosophisch anmutenden, wissenden Gesichtsausdruck auf und verschwand unter der Theke, um nach einigem Klappern mit zwei Flaschen und einem dieser Tupfengläser wieder aufzutauchen. Carlos verdrehte die Augen. Was sollte das hier werden? Eine Art Initiationsritus?
»Owacht!«, dröhnte Willi ihm ins Ohr. Aus seinem Ärmelaufschlag rieselten Sägespäne auf den Boden. Er zog den Korken von der grünen Weinflasche und stellte sie neben das Glas. Dann drehte er den Verschluss von der Mineralwasserflasche und stellte sie in die Reihe. »Wie mischt man en Pälzer Schorle?« Bei dieser Frage drehte er sich von der Theke weg, um den gesamten Gastraum mit einzubeziehen.
Carlos blickte nach hinten. Die Gespräche an dem großen Tisch waren verstummt, alle Augen waren auf die Szene an der Theke gerichtet. Auf einmal hatte sich die Gaststube in ein Klassenzimmer verwandelt. Auch der exotische Fruchtsafttrinker schaute aufmerksam zur Theke.
Theatralisch hob Willi eine Hand in die Höhe, wobei er die Finger eng zusammenlegte und den Daumen darunter versteckte. »Vier Finger!«, rief er in den Raum. Und dann zu Carlos: »Ganz einfach, odder?«
Der hatte keine Lust mehr, sich hier vorführen zu lassen. »Ja, genau. Vier Finger Wein, vier Finger Wasser«, sagte er so lässig wie möglich.
Ein Raunen ging durch den Gastraum.
Willi lächelte jetzt väterlich. »Fascht richtig.« Er legte eine Hand an das Glas, packte mit der anderen Hand die grüne Flasche und goss den Wein ein, bis der vierfingrige Pegelstand erreicht war. Damit war der Bottich allerdings schon fast ganz gefüllt.
»Un jetzt noch mal vier Finger!« Er drehte die Hand in die Waagrechte, setzte sie an das obere Ende des Glases und goss einen kleinen Schwall Mineralwasser dazu. »Des is en Pälzer Schorle!«, verkündete Willi donnergleich.
Was für eine Vorstellung, dachte Carlos. Es hätte nur noch gefehlt, dass der Gastraum in lauten Jubel ausbrach. Diese Leute hatten außerdem eine eigentümliche Art, sich die Realitäten zurechtzudrehen. Durch diese Manipulation einer einfachen Schorlemischung hatten sie die beste Ausrede, noch mehr zu trinken, als sie es ohnehin schon taten.
Mit einem breiten Lächeln drückte Willi Carlos die bis an den Rand gefüllte Blumenvase in die Hand. »Zum Wohl, die Pfalz. Herzlisch willkomme in Elwefels.«
Carlos nahm das Glas mit einem bemühten Lächeln. Der Mann ging einfach über seine Ablehnung hinweg, so wie man über einen schlafenden Hund drübersteigt, der im Weg liegt. Sein Widerstand bröckelte. Diese Lektion hatte er schon in Abenteuerbüchern seiner Kindheit gelernt. Willkommensgeschenke von Eingeborenen durfte man auf keinen Fall ablehnen, wenn man nicht Gefahr laufen wollte, später in deren Kochtopf zu enden.
Willi zog ihn nun von der Theke zu dem großen Tisch, schob einen Stuhl in die ohnehin schon dicht gedrängte Runde und drückte Carlos samt schwappendem Glas darauf.
»Kumm, do hock dich her!«, krakeelte einer der Tischgenossen.
»Bei uns bleibt niemand allein, wenn er Durscht hat, gell?«, rief der nächste.
»Do bischt du genau richtig! Genau do!«, sagte der Mann mit den Dreadlocks.
Aha, sind wir jetzt alle beim Du, dachte Carlos. Das Glas in seiner Hand fühlte sich an wie ein Fremdkörper.
»Hopp, jetzt trink mol e Schlückel, dann seh’n ma weiter!«, empfahl Willi.
Carlos fühlte sich tatsächlich genötigt, der Aufforderung nachzukommen. Zögerlich führte er das Glas zum Mund. Er machte das hier nicht für sich, dachte er. Das ist Arbeit. So verdienst du dein Geld. Ein guter Ermittler muss sich den Gegebenheiten anpassen. Wenn er Informationen wollte, musste er sich auf diese exotischen Riten einlassen. Unter den wachsamen, gespannten Blicken der sechs Männer hob er das Glas und nickte mit einem verkniffenen Lächeln in die Runde. Wie auf Kommando packten jetzt alle ihre Bottiche und ließen sie mit seinem zittrig gehaltenen zusammenstoßen, dass sich ein ganzer Schwall auf den Tisch ergoss. Wie gut, das muss ich schon mal nicht mehr trinken, dachte Carlos erleichtert. Und schon dröhnten wieder die Sprüche durch den Raum.
»Zum Wohl!«
»Alla hopp!«
»In de Kopp!«
»Durscht is schlimmer wie Heimweh!«
Meine Güte, warum machten sie nur so einen Aufstand, dachte er. Und er verstand es auch dann noch nicht, als er den ersten Schluck getrunken hatte. Die Weinschorle prickelte frischer, als er es erwartet hatte, aber sein Ding war dieses Gesöff trotzdem nicht. Da fehlte einfach der Schaum. Und die Würze. Die war hier wohl als eine Art Säuerlichkeit getarnt. Etwas neidisch schielte er auf den Orangensaft im Glas des dunkelhäutigen Mannes. Wie dieser an einen Ort wie Elwenfels gekommen war, musste ihm mal einer erklären. Du weltfremder Griesgram, schalt ihn sein Inneres, aber Carlos ignorierte es.
»So, jetzt verzähl doch mal, was du für einer bischt«, forderte ihn ein hagerer Mann auf. Sein Gesicht sah aus, als hätte er in seinem Leben nicht allzu viele geschlossene Räume von innen gesehen.
»Genau!«, rief sein Nachbar, ein etwas schmächtiger Kerl mit Hornbrille und einem Tattoo auf dem Handrücken, das eine Art Vogel zeigte. »Wer bischt’n du? Was machscht’n du? Wem gehörsch’n du?«
Ein kurzes Auflachen in der Runde. Dann schoben sich alle noch ein paar Zentimeter näher an Carlos heran und schauten ihn erwartungsfroh an. Dem war diese ganze Aufmerksamkeit einfach zu viel. Andererseits konnte er jetzt gleich mehreren Leuten seine Fragen stellen. Also begann er erst einmal artig mit seinem Namen.
»Ich heiße Carlos Herb.«
»Ah, da kannst disch gleich mit dem do zusammehocke«, rief der vorwitzige Brillenträger und schlug seinem älteren Nebenmann auf die schmale Schulter. »Des is unsern Pfarrer, der heißt auch Karl. Ha, Karl und Karl. Was ein Gespann, odder?«
Die Runde lachte brüllend, und Carlos lächelte säuerlich. Erinnerungen an seinen ersten Schultag kamen hoch.
»Carlos. Ich heiße Carlos.«
»Bischt du Italiener?«, wollte der Pfarrer Karl wissen. Er sah nicht aus wie jemand, der sich am Sonntag seinen weißen Kragen umband. Carlos konnte sich viel eher vorstellen, dass er seinen Gottesdienst lieber gleich in die Wirtschaft verlegte. Er trug das Haar schulterlang und etwas zottelig, dazu ein T-Shirt mit dem Konterfei von David Bowie. Widerwillig musste Carlos schmunzeln. Das war auch seine Musik.
»Meine Mutter war Spanierin«, präzisierte er dann.
»Jo, macht doch nix!«, schallte es zurück.
»Un? Schmeckt der Woi?«, fragte der Mann mit den Dreadlocks.
Carlos blinzelte irritiert. Die Klischees in seinem Kopf rebellierten. Jamaica und der Pfälzerwald, Dreadlocks und Gummistiefel … Er nippte noch einmal demonstrativ an seinem Glas und nickte wortlos.
»Des is halt auch der Einzige, wo’s do gibt. Der Wingert gehört zu uns, is aber Kilometer weit weg, vorn, direkt an der Weinstraße. Weil do im Wald wachst kein Woi.«
»Ah ja«, sagte Carlos tonlos. Was war ein Wingert?
»De Woi kann man trinke. Obwohl der Winzer en Dollbohrer is.«
»Was für ein Bohrer?«, fragte Carlos.
»Ha, en Dollbohrer, en Einfaltspinsel. Do gibt’s bei euch da oben bestimmt auch e Wort defür, odder?«
»Dösbaddel.«
Die Runde lachte gutmütig, und Carlos trank noch einen Schluck von der Weinschorle. Naja, für zwischendurch war das ja ganz okay, aber keineswegs zum Angewöhnen.
»Alla hopp, Karl, jetzt, wo de Durscht nachlosst, sag uns mol, was du do willscht«, fragte Willi. Er war hier offensichtlich so eine Art Wortführer.
Carlos wiederholte das, was er der Wirtin schon gesagt hatte. Er schmückte die Geschichte dabei noch ein wenig aus und erzählte, dass er im Auftrag der Versicherung von Hans Strobel nach ihm suchte.
»Verstehen Sie die Brisanz, meine Herren?«, Carlos blickte wichtig in die Runde. »Die Versicherung ist dazu verpflichtet, eigene Nachforschungen anzustellen, weil es in diesem Fall um sehr viel Geld geht.«
»Geld, Geld!«, platzte nun sein unmittelbarer Nachbar heraus, der so aufdringlich nach Motoröl roch. Er war Mitte vierzig, hatte sein langes graues Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden und sprengte mit seiner breiten Brust fast die Hemdknöpfe. »Immer geht’s ums Geld. Soll ich dir was sagen, Carlos? Ich bräucht kein Geld, wenn die andere keins wollten!«
Die Runde wieherte, und die Gläser klirrten ihren eigenen Refrain.
»Ja, also«, Carlos bemühte sich um einen ernsthaften Ton, »ich bin beauftragt, Hans Strobel zu suchen, damit diese Sache endlich abgeschlossen werden kann. Da hängen Existenzen dran.«
Das stimmte nicht wirklich. Die einzige Existenz, die davon abhing, war die von laotischen Waisenkindern, wenn er Strobel nicht fand. Und die von Nadine Strobels extravagant überfülltem Kleiderschrank, wenn der Mann tot war.
»Und warum sucht man dann ausgerechnet do bei uns, in Elwefels?«, wollte der Pferdeschwanz wissen.
»Wissen Sie«, versuchte Carlos sich an einer Erklärung, »wenn man nicht mehr weiterkommt bei einer Suche, dann muss man neue Wege gehen. Also, hier ist noch mal das Bild.« Er hob das Handy mit Strobels Foto hoch.
Die Männer schauten es sich an. Dann allgemeines Kopfschütteln. Schweigen. Trinken. Diesmal allerdings ohne die obligatorischen Sprüche.
»Niemand hat ihn gesehen? Vielleicht hat er Elwenfels letztes Jahr besucht? Hat sich eure alte Weinpresse angeschaut …«
Die Männer seufzten. Willi stieß seinen Nachbarn mit der breiten Brust an. »Hopp, Otto, sag’s ihm.«
Otto beugte sich zu Carlos und fixierte ihn eindringlich. »Also, unsern Ort do hat genau dreihundertdreiundzwanzig Einwohner, zehn Hunde un siebzehn Katze. Die Bettel führt Buch über die Leut, die wo von außerhalb herkommen.« Er deutete auf die offene Küchentür, wo Carlos die Wirtin immer noch mit Schälen beschäftigt sah.
»So. Un? Willst du wissen, wie viele Auswärtische im letzte Jahr do ware?«
Carlos nickte und trank aus seinem Glas. Es lag ganz gut in der Hand. Besser als die dünnen Pilsgläser jedenfalls.