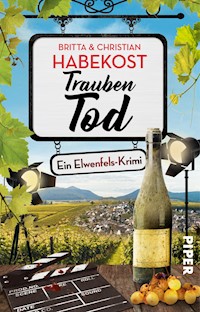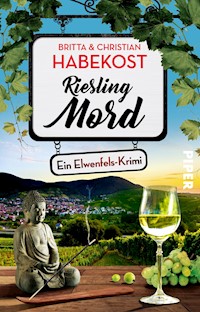
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wein verändert die Wahrnehmung − und führt manchmal zur Erleuchtung. Privatermittler Carlos Herb muss vor der Mafia aus Hamburg fliehen und kennt nur einen Ort, an dem er Zuflucht finden kann: Elwenfels in der Pfalz. Dort trifft er auf eine Gruppe spiritueller Aussteiger, die das kleine Dorf im Pfälzerwald auserkoren haben, um hier Erleuchtung zu finden. Zwischen Yogamatten und Räucherstäbchen kommt es allerdings zu einem Mord! Alles sieht nach einem Unfall aus, doch schnell kommen Carlos Herb Zweifel. Sind die spirituell gesinnten Besucher wirklich so harmlos, wie sie tun? Oder verbirgt sich unter der friedlichen Oberfläche eine grausame Lüge, die die Elwenfelser Dorfgemeinschaft zu entzweien droht? Zwischen Weinreben und Pfälzer Lebensart wartet eine tödliche Überraschung … und jede Menge rasanter Krimi-Spaß! In vino veritas – der Täter hat keine Chance! Packen Sie Ihre Koffer und auf nach Elwenfels! Jeder Fall für Privatermittler Carlos Herb ist ein Weinfest für Krimi-Fans und kann unabhängig voneinander gelesen werden. Unser Serviervorschlag: Bei "Rebenopfer" anfangen, nach vorne durcharbeiten und wieder neu beginnen. Denn diesen Regionalkrimi werden Sie ins Herz schließen! Alle Bücher der Elwenfels-Reihe: Band 1: Rebenopfer Band 2: Winzerfluch Band 3: Rieslingmord Band 4: Weingartengrab Band 5: Traubentod Band 6: Weinbergblut Alle Bände sind unabhängig voneinander lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Krimi gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Rieslingmord« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Si vis amari, ama – weeschwieschmään?!
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: SilkenOne / Getty Images und Motive von Shutterstock.com
Karte: Tino Latzko
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Cover & Impressum
Karte
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Prolog
Irgendwo in Südindien
Der Indische Ozean streichelte das nächtliche Ufer, und unter dem ausladenden Mandelbaum, der seine Zweige bis weit auf den menschenleeren Strand reckte, war der Frieden perfekt. So perfekt er eben nur sein konnte, wenn eine Armee blutrünstiger Moskitos auf Sauftour war, der eigene Magen hingegen vom tagelangen Verzehr unreifer Mangos murrte und aus dem nächsten Zelt das nervige Schnarchen von Samudra ertönte – der eigentlich Tobias hieß, auch wenn ihn niemand so nannte.
Wenn es eins gab, was Ferdinand in Indien gelernt hatte, dann den Frieden aufzuspüren, auch wenn der unter dem Chaos schwer auszumachen war. Dazu hatte er auch wahrlich genug Zeit gehabt. Es waren jetzt fünfzehn Jahre, und der innere Frieden kam wenigstens ab und an zum Händeschütteln vorbei. Das letzte Mal, dass er sich die Ehre gegeben hatte, lag jedoch schon eine ganze Weile zurück. Und das frustrierte ihn. War die Suche nach der Erleuchtung vielleicht doch nur der Wunsch, eine Fata Morgana festzuhalten?
Eine riesige Fledermaus flatterte an der Mondscheibe vorbei, und im Palmenhain hinter ihm fiel eine Kokosnuss zu Boden. In der Luft lag der Geruch nach Salz und Urwald und den süßen Räucherstäbchen, die zwischen den Zelten glühten. Er erinnerte sich an eine Zeit, in der das hier das absolute Paradies gewesen war – und Grund genug, aus Deutschland abzuhauen.
Und jetzt? Jetzt war da einfach nur noch ein schwarzes Loch, das irgendwo in seiner Brust klaffte, und in diesem Loch wuchsen Wünsche, die er gegenüber den anderen niemals hätte gestehen können. Zum Beispiel war da das ganz profane Verlangen nach Fast Food, das einfach mal ein anderes Lustzentrum befriedigte als das des verdammten dritten Auges, in das er gerade vergebens hineinatmete.
Als würde seine Unzufriedenheit wie eine Drohung über der tropischen Nacht liegen, wurde in diesem Augenblick die Plane von einem der Zelte zurückgeschlagen, und eine Gestalt kam auf ihn zu. Er schloss die Augen und biss sich auf die Zunge. Gleichzeitig begann sein Herzmuskel, dieser blöde Verräter, erwartungsvoll zu klopfen. Die Gestalt entpuppte sich als Amana, die nur mit einem dünnen Sari bekleidet war. Als er die Augen aufschlug, erkannte er unter dem feinen Stoff trotz der Dunkelheit die Formen ihres geschmeidigen Körpers. Was machst du jetzt, mein lieber innerer Frieden?, fragte er sich stumm und legte die Hände vor der Stirn zusammen, als Amana sich, begleitet vom zarten Klimpern ihrer zahlreichen silbernen Armreifen und Fußkettchen, neben ihm niederließ.
Amana hieß eigentlich Sabrina und kam aus Saarbrücken. Aber wenn man sie so betrachtete, hätte sie ebenso gut eine etwas hellhäutige weibliche Hindugöttin sein können. Zumindest nahm er sie so wahr. Vielleicht war das ja sein Problem, dachte er. Nicht das asketische Leben unter freiem Himmel, nicht das karge und immer gleiche Linsencurry-Reis-Mango-Weizenfladen-Essen, nicht das verdammte Heimweh, das ihn neuerdings plagte, sondern sie. Amana, die Anemone, die es meisterlich verstand, ihm immer wieder zu entschlüpfen und ihn in einem immer gleichen Tanz aus Annäherung und Abstoßung seit Jahren erschöpfte. In diesem Moment hätte er sie am liebsten angeschnauzt und gefragt, was das alles denn bitte noch für einen Sinn habe.
Vor allem, wenn man bedachte, was sie für ein Geheimnis verbarg. Wahrscheinlich verbarg, musste man sagen, so ganz sicher war sich Ferdinand nämlich nicht, und auch diese Ungewissheit nagte unaufhörlich an ihm. Doch Amana erschien ihm, auch wenn er diesen Verdacht hegte, einfach nur Ehrfurcht gebietend und wunderschön. Deswegen sagte er nichts und schaute hinaus auf die silbernen Wellen.
»Was plagt dich, Thambi?«, säuselte sie. »Ich kann deine Schwingungen auf meinem Kopfkissen spüren. Was ist los mit dir, warum so düster?«
»Du hast doch gar kein Kopfkissen«, sagte er müde. »Du schläfst auf dem nackten Boden, weil du glaubst, dass dich das energetisch mit Mutter Erde verbindet.«
»Warum bist du auf einmal so abfällig? Was ist los mit dir?« Sie legte ihre Hände auf seinen Oberschenkel.
Er wusste nicht, ob er sie abwehren oder einfach diesen seltenen Moment der Nähe genießen sollte. Du bist so ein Feigling, dachte er.
»Na komm, wir richten dich wieder auf«, sagte sie leise und pustete gegen seinen nackten Oberarm. »Die anderen haben auch manchmal diese kleinen Krisen. Und das ist gut so, damit wir wissen, wohin die Reise geht.«
»Du hast gut reden, Sabrina. Du hängst ja auch nicht nonstop mit den anderen zusammen. Du nimmst dir deine Freiheit und verschwindest wochenlang, und keiner von uns hat einen blassen Schimmer, was du in dieser Zeit treibst.«
»Thambi, ich habe dir gesagt, dass ich diese Zeit für die innere Einkehr brauche. Ich muss mein Alleinsein feiern.«
»Ach, Blödsinn. Jedes Mal, wenn du zurückkommst, hast du ein bisschen was mehr auf den Rippen, und deine Haare riechen nach Hibiskus-Shampoo. Was auch immer du treibst, tu es. Aber erzähl mir nicht, dass das mit dem Lagerkoller ein Teil des Erleuchtungspfades ist!« Jetzt wäre ein guter Moment gewesen, sie herauszufordern. Sie damit zu konfrontieren, was er glaubte zu wissen. Einfach nur, um zu sehen, wie sie reagierte. Aber er verbiss es sich, zum vielleicht hundertsten Mal in den letzten Jahren.
Amana ließ sich von seinen unterschwelligen Anklagen nicht verunsichern. »Lass uns zusammen meditieren, dann gewinnst du wieder mehr Klarheit«, sagte sie mit ihrer besten »Weiblicher Guru öffnet dir die Pforten zur Seligkeit«-Stimme.
»Ich will aber nicht meditieren!«, zischte er unwillig. Dass Sabrina aber auch nie merkte, wenn es mal genug war mit diesem spirituellen Blabla. Dass sie bei all ihrer angeblichen Feinfühligkeit nie spürte, wenn jemand aus der Gruppe etwas anderes brauchte als die immer gleichen Mantras und diese blöden Räucherrituale.
Sie wich zurück. »Thambi, was ist los mit dir?«, flüsterte sie.
»Hör auf, mich so zu nennen.«
»Na gut, was ist los mit dir, Ferdinand?«
Sie hörte sich ein bisschen alarmiert an, und das befriedigte ihn zutiefst. »Sabrina, was machen wir hier?«
»Wo hier? In Tamil Nadu?«
»Nein, hier, verdammt. Wird das ewig so weitergehen? Durch Indien wandern und so tun, als wären wir erleuchtet? Geld für die Armen sammeln, um heilende Energie ins Universum zu blasen? Wann endet es? Wann ist es jemals genug?«
Amana stieß einen sanften Seufzer aus, aber ein Teil von ihr – Sabrina – zupfte nervös an ihren Holzperlenketten herum.
Bevor sie zu einer ihrer berühmten Reden ansetzen konnte, begriff Thambi alias Ferdinand, dass er an einem Punkt angelangt war, an dem es kein Zurück mehr gab. »Du brauchst mir keinen Vortrag zu halten«, kam er ihr zuvor. »Ich bin jetzt seit neun Jahren bei der Gruppe, und ich komme immer wieder an diesen Punkt der Sinnlosigkeit und Leere. Ich begreife, dass ich immer nur weglaufe. Seit fünfzehn Jahren laufe ich weg.«
»Und vor was läufst du weg?«
»Tja, das kann ich ja wohl kaum hier herausfinden.«
»Sag bloß, du hast Heimweh.«
»Ja, e bissel schon.«
»Was?«
»Ja, ein bisschen schon.«
Sabrina sah ihn fragend an.
Aus dem Zelt von Samudra drang ein Geräusch, als würde ein rostiges U-Boot belüftet werden. Ferdinand hatte nicht übel Lust, ihm einen Eimer kaltes Wasser über den Kopf zu schütten.
»Du hast mir nie gesagt, warum du damals aus Deutschland weggegangen bist«, flüsterte Amana schließlich.
Es stimmte. Er hatte es ihr nicht erzählt und auch keinem der anderen, weil … ja, warum eigentlich? »Des is auch e langi Gschicht …«, sagte er und erschrak, weil er auf einmal, und ohne es zu wollen, in seinen heimatlichen Dialekt verfiel. In diese weich zischenden Verformungen der Worte, die er als Jugendlicher so verachtet und sich deswegen aus Protest ein neutrales Hochdeutsch angewöhnt hatte. Klammheimlich war diese vergessene, längst abgelegte Sprache wieder zurück in seinen Mund geschlichen – es fühlte sich viel besser an als jedes Mantra.
Sabrina stieß ein ungläubiges Lachen aus. »Was? Wie klingst du denn auf einmal? Ist das der Dialekt, den sie in deinem Heimatkaff sprechen?«
»Ja. Und dieses Heimatkaff ist tausendmal mehr wert als die bescheuerten Ashrams und Tempel, durch die wir seit Jahren ziehen«, giftete er zurück.
»Na, dann geh doch zurück in dein altes Leben, wenn du das hier so schrecklich findest!«
Die erhabene, ruhige Amana war jetzt vollständig verschwunden. Neben ihm saß Sabrina, die ihn jetzt beleidigt anfunkelte und anfing, an einem Fingernagel zu kauen. Es war einer dieser seltenen Augenblicke, in denen ihm alles in absoluter Klarheit vor Augen stand. Sie liefen gemeinsam weg, sie alle, vor sich selbst. Schlagartig lichtete sich seine schlechte Laune, und er sagte: »Weißt du, Amana, ich habe heute überhaupt keine Ahnung mehr, warum ich abgehauen bin. Ich glaubte damals, dass ich am spießigsten Ort auf der ganzen Welt leben würde, wo die Leute nichts anderes im Kopf hätten als Wein und Essen und Fußball und ihre Stammtisch-Beschaulichkeit. Aber jetzt sehne ich mich zurück an diesen Ort. Es ist einfach ein kleines Dorf in einem riesigen Wald, wie es Hunderte in Deutschland gibt. Aber mein Dorf … Ich glaube, ich habe fünfzehn Jahre gebraucht, um zu begreifen, dass es etwas ganz Besonderes ist.« Er schaute hinaus auf das brausende Meer und spürte Sabrinas Haare, als sie sich an seine Schulter lehnte.
»Erzähl mir davon«, bat sie leise.
Thambi alias Ferdinand seufzte und wiederholte, was er ihr eben schon einmal gesagt hatte: »Des is e lange Gschicht.«
Kapitel 1
Wie ein bereits immer mehr Lesern bekannter Hamburger Privatdetektiv seinen Dämonen zu entkommen versucht und dabei pfälzischen Geistern in die Arme läuft
Seltsamerweise geisterten ihm buddhistische Weisheiten und schlaue Kalendersprüche durch den Kopf, als er sich bergauf durch den stockdunklen Herbstwald kämpfte, während ihn ein heftiger Wind vor sich hertrieb. Vielleicht geisterten diese Dinge aber gar nicht durch seinen Kopf, dachte er. Vielleicht wisperten es ihm die halb entblätterten Bäume zu, die im Sturm groteske Verrenkungen veranstalteten und ihm immer wieder nasse Blätter ins Gesicht warfen.
Die Erfahrung von Verlust ist der Beginn absoluter Freiheit … Erst wenn es nicht mehr weitergeht, öffnet sich die Tür zum wahren Selbst … Nur in der Leere kann Schönheit wachsen.
Die Antwort in seinem Kopf auf diese schlauen Sprüche war Wut. Eine kalte, hoffnungslose Wut. Was wussten sie denn schon über den Horror, den er gerade erlebte? Und hatten diese scheiß Bäume und der Wind und der Regen wirklich nichts Besseres zu tun, als ihm auch noch die letzte Etappe seiner Flucht zu erschweren?
Carlos Herb war am Ende.
Das hatte er zwar schon öfter in seinem Leben gedacht, aber diesmal fühlte es sich verdammt aussichtslos an. Diesmal war das Chaos perfekt, das ihn aus seinem vertrauten Umfeld hinauskatapultiert hatte. Es gab keinen Weg zurück.
Er konnte sich tagsüber nicht mehr blicken lassen. Und das galt nicht nur für Hamburg. Sondern für alle Orte, an denen es Überwachungskameras gab und Leute, die Nachrichten lasen oder die Fahndungsaufrufe der Polizei lasen, zum Beispiel über Facebook. In früheren Zeiten hätte man seinen Zustand als vogelfrei bezeichnet.
Seine Feinde hatten ganze Arbeit geleistet. Obwohl Carlos Herb in seiner Zeit als Hauptkommissar (und auch in den Jahren danach) eine Menge übler Geschichten erlebt hatte, musste er sich jetzt eingestehen, dass er sich nicht einmal im Traum hätte ausmalen können, wie schlimm es tatsächlich werden konnte, wenn man sich … tja, wenn man sich mit der Mafia anlegte.
Obwohl er total erschöpft war, beschleunigte er jetzt seine Schritte, als wäre der Teufel hinter ihm her. Beim Gedanken an seine eigene Dummheit zogen sich seine Eingeweide zusammen. Aber das Stadium der Selbstvorwürfe hatte er eigentlich längst hinter sich gelassen. Jetzt ging es nur noch um eins: Überleben. Und möglichst nicht im Knast zu landen.
Die gut organisierte Bande von Kulekovs Söhnen war nicht der einzige Teufel, der ihm im Nacken saß. Es waren auch noch seine ehemaligen Kollegen. Carlos Herb, ehemaliger Kriminalkommissar und seit vier Jahren Privatdetektiv, stand nun wegen Mordes an einem einflussreichen Immobilien-Mogul auf der Fahndungsliste. Nicht dass Herb den Mord tatsächlich begangen hätte – nur interessierte diese »Petitesse« derzeit niemanden.
Die Leute von Kulekov hatten die Indizien gegen ihn so platziert, dass es ihm unmöglich geworden war, seine Unschuld zu beweisen. Und das war noch nicht alles. Wenn Carlos daran dachte, was sie alles unternommen hatten, um die Schlinge um seinen Hals immer weiter zuzuziehen, wurde ihm noch kälter.
Er war hundemüde und durchnässt, und seine Füße taten so weh, als wäre er die sechshundert Kilometer, die hinter ihm lagen, barfuß gegangen. Dabei waren es unzählige öffentliche Verkehrsmittel gewesen, die er zur Flucht aus Hamburg genutzt hatte. Dank Bummelzügen, Bussen und einer Mitfahrgelegenheit in einem Geflügeltransporter war er drei Tage lang auf den unmöglichsten Strecken und mit großen Umwegen quer durch Deutschland gegondelt. In dieser ganzen Zeit hatte er kaum geschlafen, nur wenig gegessen und nicht einmal eine Gelegenheit zum Duschen gefunden. Das alles nur, um in Bewegung zu bleiben und möglichst wenig mit großen Menschenmengen in Berührung zu kommen. Er war auf dem Weg zum einzigen Ort in Deutschland, an dem man wusste, dass Carlos Herb kein Mörder war. Zu dem einzigen Fleckchen Erde, wo es keine Überwachungskameras gab und ihn keiner von Kulekovs Bluthunden finden würde. Zu dem einzigen Platz, wo er noch so etwas wie ein Zuhause hatte. Elwenfels.
Carlos blieb stehen und ließ seine Reisetasche sinken, die nur das Allernötigste enthielt. Er brauchte eine Pause. Gestern Abend war er mit dem Zug in Heidelberg angekommen und mit dem letzten Bus weiter in Richtung Mannheim gefahren. Dort war er in eine Straßenbahnlinie gestiegen, die ihn kurz nach Mitternacht in Bad Dürkheim ausgespuckt hatte. Er hatte sich sofort auf den Weg in Richtung Deidesheim gemacht. Natürlich hätte er auch einfach für die letzten Kilometer in ein Taxi steigen können, aber er befürchtete, dass sich diese Bequemlichkeit als Fehler entpuppen und der Taxifahrer ihn erkennen und verraten könnte. Außerdem passte es zu seiner Weltuntergangsstimmung, dass er die letzte Etappe vor seinem Ziel zu Fuß ging und sich körperlich und mental so richtig fertig machte. Als befürchte ein Teil von ihm, dass die Elwenfelser ihm nur glaubten, wie schlimm es um ihn stand, wenn er als Wrack vor ihnen erschien.
Du Idiot, schalt er sich. Die Leute dort mochten ihn und hatten ihm versprochen, dass er immer willkommen sei. Da musste er nicht auch noch sein Elend vor sich hertragen.
Kurz vor dem Ortseingang des beliebten Weinortes Deidesheim führte eine schmale Straße auf die Hügelkette der Haardt zu, die um diese Nachtzeit dalag wie der Buckel eines schwarzen, schlafenden Drachens. Vor einer knappen Stunde hatte Carlos endlich die Abzweigung passiert und war dort abgebogen, wo eigentlich ein Hinweisschild nach Elwenfels hätte stehen müssen. Eigentlich, wenn nicht ein paar Leute aus dem Dorf es abmontiert hätten, weil sie der Meinung waren, dass man keine Straßenschilder benötigte, um das Paradies zu finden.
Jetzt lief er stetig bergauf und folgte dem Verlauf der nassen, unbeleuchteten Straße, die er vor mehr als einem Jahr zum ersten Mal in seinem Audi hinaufgefahren war. Das Auto gab es nicht mehr. Seit er vor einer Woche erlebt hatte, wie es in die Luft geflogen war, nachdem er den Wagen einem alten Kumpel geliehen hatte, kam er sich vor wie Michael Corleone in Der Pate. Sein Kumpel war tot. Der Audi ein schwarzes Metallskelett. Und Carlos Herb wusste zum ersten Mal in seinem Leben, wie es sich anfühlte, völlig schutzlos zu sein.
Langsam ging er weiter und kämpfte die Erinnerungen nieder. Elwenfels konnte nicht mehr weit sein. Sonderbarerweise ging es ihm plötzlich ein bisschen besser. Seit er in den dunklen Wald oberhalb der Rebzeilen am Haardtrand eingetaucht war, schienen der Stress und die Angst der letzten Wochen langsam von ihm abzufallen. Obwohl die Bäume ihn an die Filmkulissen von Sleepy Hollow erinnerten und der Wind in den Zweigen jaulte, kehrte so langsam etwas Ruhe in ihm ein. Bald würde alles gut werden. Sobald er in Elwenfels wäre, würde man sich seiner annehmen, und er würde in diese Umarmung aus pfälzischer Gastfreundlichkeit, herzlicher Fürsorge und liebevoller Freundschaft einsinken, so wie man in ein warmes, weiches Bett sinkt. Und das hatte er auch bitter nötig.
Zusätzlich war da noch die Sehnsucht nach einem ganz besonderen Bewohner von Elwenfels. Charlotte. Für die Gedanken an sie hatte er in den letzten Wochen und Monaten kaum Zeit gehabt, weil alles immer schlimmer geworden war. Sie hatten einige Male telefoniert, und Carlos hatte sich sogar zu dem Versuch aufgerafft, ihr ganz altmodisch einen Brief zu schreiben. Es war allerdings beim Versuch geblieben, und dieser war auch noch zusammen mit anderen Papieren aus seiner Wohnung von der Polizei beschlagnahmt worden. Zum Glück hatte er auf den dafür vorgesehenen Umschlag noch nicht die Adresse geschrieben, sonst würden sie sicher auf die Idee kommen, hier nach ihm zu suchen.
Natürlich hatte er sich ihr Wiedersehen anders vorgestellt. Er hatte nicht vorgehabt, Charlotte in einem derart derangierten Zustand wieder unter die Augen zu treten. Aber der starke, stattliche Ritter, den es irgendwann einmal in ihm gegeben hatte, kauerte zusammengekrümmt in einer Ecke seines Bewusstseins und fragte sich immer wieder, wie die Dinge nur so aus dem Ruder hatten laufen können.
Carlos Herb raffte sich zu einer letzten Anstrengung auf und ignorierte den schneidenden Herbstwind. Jetzt hätte er sich über das Knattern eines alten Traktors wirklich gefreut. Erwin hatte ihm beim vorletzten Besuch mehr als einmal eine ruckelnde Mitfahrgelegenheit geboten, zusammen mit so manchen enigmatisch-philosophischen Weisheiten aus dessen Munde. Sie verwunderten Carlos umso mehr, seit er wusste, dass der alte Winzer … nun, ein Geist war. Dass er dabei so überaus lebendig und lebenslustig wirkte, war wohl der Tatsache geschuldet, dass in dieser Region die Geister wohl ohne ihren Körper auskommen konnten, nicht aber ohne ihre pfälzische Mentalität.
Doch leider tauchte das geisterhafte Gefährt in dieser Nacht nicht auf. Bis auf den Wind war es mal wieder ungewöhnlich still im Wald um Elwenfels.
Nein. Nicht ganz. In diesem Moment erklang aus dem Unterholz ein seltsames Schnarren. Carlos fuhr erschrocken zusammen. Da! Gelbe Augen blitzten zwischen den Zweigen auf. Im nächsten Moment schoss der dunkle, gefiederte Schemen aus dem Unterholz und watschelte in unglaublicher Schnelligkeit über die Straße. Carlos stieß ein erleichtertes Lachen aus. Ein Elwetritsch. Dann konnte es ins Dorf nicht mehr weit sein. Er lief weiter. Sein Herz schlug schneller. Das Auftauchen eines Tieres, das es nicht geben durfte und das offiziell auch nicht existierte, war nun doch ein bisschen zu viel für seine gereizten Nerven. Und noch dazu in dieser Nacht. Morgen war Allerheiligen. Auf dem langen Fußmarsch war Carlos an ausgehöhlten Kürbissen vorbeigekommen, die ihn mit schiefen Zähnen angegrinst hatten. Dazu ausgelassene Jugendliche in Zombie-Kostümen und mit Fledermäusen aus Plastik. Er hatte nie viel übriggehabt für Halloween. Aber jetzt, in diesem dunklen Wald mit den gruseligen kleinen Viechern im Unterholz, wurde ihm bewusst, dass es in Elwenfels einiges gab, was den Zombie-Teenagern unten an der Weinstraße das Blut in den Adern gefrieren lassen würde.
Carlos hastete weiter. Und dann sah er es endlich, das mit Efeu überwucherte Ortseingangsschild von Elwenfels. Jetzt hörte er auch das leise Rauschen des Baches, der unter einer verwitterten Steinbrücke dahinfloss. Die schlagartige Erleichterung erschöpfte ihn noch mehr. Er bog in die schmale Gasse zwischen den alten Sandsteinhäusern ein und überlegte sich, an welcher Tür er am besten klopfen sollte. Bei Willi? Nein, das Sägewerk lag am anderen Ende des Dorfes, und seine Füße trugen ihn kaum noch. Bei Karls Pfarrhaus neben der alten Kirche? Oder doch lieber bei Michael, der Arzt im Ort? Er hätte es ja bei Anthony versucht, doch der exotische Friedhofswärter weilte derzeit nicht in Elwenfels. Carlos hatte erst vor drei Wochen ganz altmodisch eine Postkarte von Anthony und seiner großen Liebe Trudy bekommen, die seit einigen Monaten in Jamaika Urlaub machten. Er entschied sich für den Arzt als Anlaufstation, denn der hatte ihn schon einige Male in nicht vorzeigbarem Zustand erlebt.
Als Carlos langsam durch die stille, menschenleere Hauptstraße des kleinen Dorfes schlurfte, fiel es ihm auf: Elwenfels lag in tiefem Schlummer, bis auf den Wind rührte sich nichts. Und doch war an dieser Stille etwas Merkwürdiges. Plötzlich begriff Carlos, was ihn die ganze Zeit über gewundert hatte. Die Türen und Fenster der Häuser waren alle sperrangelweit geöffnet.
Er blieb stehen und sah sich um. Er wusste, dass in Elwenfels niemand besonders viel für Haustürschlüssel übrighatte. Dann fiel ihm noch etwas anderes auf. In den Fenstern und auf den Treppenabsätzen standen nicht nur ausgehöhlte Kürbisse, sondern auch Laternen und Windlichter, die ein heimeliges Licht auf die Straße warfen. Carlos fühlte sich unerträglich einsam. Er wollte nur noch irgendwo ankommen. Sich in ein Bett legen und mit dem Bewusstsein einschlafen, dass am nächsten Morgen eine bessere Welt auf ihn wartete.
In diesem Moment glitt etwas an ihm vorbei wie ein kalter Nebel. Erschrocken drehte Carlos sich um. Aber da war niemand, er stand ganz allein mitten auf der Straße. Er lief weiter, vorbei an unverschlossenen Haustüren und offenen Küchenfenstern. Auf dem Dorfplatz der gleiche Anblick. Die Tür der Bäckerei stand sperrangelweit auf. Wie eine Einladung. Ebenso Alfreds kleiner Tante-Emma-Laden. Sogar die Kirchentür gähnte zwischen den vom Wind aufgeblähten Bauplanen, die immer noch vom Gerüst hingen. Und überall kleine Laternen, die den Platz in eine entrückte Stimmung tauchten. Was war hier nur los? Wo waren denn alle Dorfbewohner? Sie konnten doch unmöglich schlafen, während ihre Häuser offen standen wie für eine Festgesellschaft. Vielleicht weilten sie mal wieder auf ihren heimlichen Treffen in dem Gewölbe unterhalb des Dorfplatzes. Aber Carlos war zu erschöpft, um durch die ebenfalls offen stehende Weinstube in den Keller und von dort aus in den Versammlungsraum zu gehen. Die Vorstellung, dass das gesamte Dorf ihn in diesem Zustand sah, war das Gegenteil von dem, was er jetzt brauchte.
Bevor er hier zusammenbrach, entschloss er sich kurzerhand dazu, einfach in das nächstbeste Haus zu gehen, in diesem Falle Sofies Haus. Nicht nur sein Landsmann Hans Strobel teilt das Bett mit der von den Elwenfelsern hoch verehrten Winzerin, sondern hier gab es auch eine Art öffentliche Bücherei, in der die Dorfbewohner jederzeit ein und aus gehen konnten. Dort stand ein gemütliches Sofa, wie Carlos sich erinnerte.
Er bog in die kleine Gasse neben der Bäckerei ein und ging auf Sofies Haus zu, das ebenfalls von Kürbislichtern beleuchtet wurde. Rasch überquerte er die Schwelle, ging hinein und steuerte die Treppe zur Dorfbücherei im ersten Stock an. Doch etwas ließ ihn innehalten. Der Geruch … Im Haus lag der Duft von köstlichen Speisen, der so verlockend war, dass sich der Griff der Müdigkeit sofort ein bisschen lockerte, weil ein anderes Bedürfnis sich in den Vordergrund drängte. Er wandte sich nach links, in Richtung Küche. Leise und vorsichtig schob Carlos die Tür auf und blieb wie angewurzelt stehen.
Auf dem großen Tisch in der Mitte des Raumes stand ein Festessen. Und nicht nur dort, auch auf den Anrichten und dem Herd warteten volle Platten und Schüsseln auf eine Schar hungriger Gäste, die offensichtlich ausgeblieben war. Was um alles in der Welt war hier los?
Zögernd betrat Carlos die Küche, in der die köstlichsten Gerüche seine Nase und seinen leeren Magen auf eine harte Probe stellten. Auf dem Herd stand eine leise knisternde Pfanne voller Dampfnudeln, die so verführerisch dufteten, dass Carlos ganz schwach wurde vor Verlangen. Und dann die Schüsseln voll buttrig glänzender Kartoffeln. Eine Platte mit gebratenen Saumagenscheiben. Ein Blech voll dampfendem Pflaumenkuchen. Ein Topf blubberte leise vor sich hin und verströmte das Aroma von Kartoffelsuppe. Brotlaibe und eine große Schüssel mit Quark. Und dann der Wein … In der ganzen Küche waren Dubbegläser verteilt, dazwischen standen geöffnete Wein- und Sprudelflaschen – ein pfälzischer Gaumenschmaus par excellence. Aber für wen? Und warum in einer schummrig beleuchteten Küche, in einem unnatürlich stillen Haus?
Plötzlich kam Carlos ein Gedanke, bei dem sich seine Nackenhaare aufstellten. Das Ganze mutete wie die Szenerie eines Films an, bei dem die Bewohner eines Dorfes urplötzlich durch irgendein okkultes Ereignis verschwunden und ihre Häuser stumme Zeugen der letzten alltäglichen Verrichtungen waren. Er schob den Gedanken rasch beiseite. Das hier war Elwenfels. Er erlebte so etwas hier nicht zum ersten Mal.
Trotzdem, der gedeckte, aber verwaiste Tisch war mehr als eigenartig.
Und extrem einladend. Carlos’ ungute Ahnungen wurden von einem lauten Knurren seines Magens übertönt. Er trat an den Tisch und griff nach einer der dampfenden Kartoffeln. Er wollte sie gerade zum Mund führen und freute sich bereits auf diesen existenziellen Moment der puren Bedürfnisbefriedigung, als er einen Luftstoß an seinem Hinterkopf spürte. So, als puste ihm jemand in den Nacken. Erschrocken fuhr Carlos herum. Aber da war niemand. Nur ein Luftzug, dachte er und wollte sich wieder umdrehen. Doch plötzlich nahm er aus dem Augenwinkel eine Bewegung an der Tür wahr.
»Ou, mol do, de Carlos«, sagte eine vertraute Stimme. »Schää, dich zu sehe. Aber bischt du dir sicher, dass des alles do auch für dich is?«
Erwin?! Carlos ließ beinahe die Kartoffel fallen. Eine menschliche Gestalt huschte an der Tür vorbei. Das war doch … War das nicht der alte Traktorfahrer gewesen? Carlos blinzelte. Nein, das konnte nicht sein. Niemand war zu sehen, und es erklangen auch keine Schritte auf dem Flur. Aber er hatte die Stimme ganz deutlich gehört. Ein Frösteln krabbelte über seinen Körper. Verwirrt umrundete er den Tisch und sah aus dem Fenster. Erst jetzt fiel ihm auf, wie kalt es in der Küche war. Wie konnte das sein, wenn es immer noch aus den Töpfen und Schüsseln dampfte? Carlos wollte jetzt einfach nur noch rasch ein paar Happen essen und dann so schnell wie möglich nach oben gehen. In der Küche ging irgendetwas vor, und es war ihm alles andere als geheuer. Er hob die Kartoffel an den Mund und wollte gerade hineinbeißen, als …
»Hear, Carlos, isch tät mir des noch mol üwwerlege an deiner Stell«, sagte die Stimme.
Carlos hielt inne und starrte aus dem Fenster. Er ließ die Hand mit der Kartoffel sinken. Eben noch war sie heiß gewesen, jetzt fühlte sie sich an wie ein Klumpen Eis.
Draußen, vor dem offenen Küchenfenster, tauchte eine Gestalt auf. Es war tatsächlich Erwin. Er zwinkerte Carlos zu, hob warnend seinen Zeigefinger und deutete auf die Kartoffel in seiner Hand. »Denk dran, mein Guder! Was passiert, wenn ma die Speise von de Tote anrührt?«
»W… was?«, stotterte Carlos. Er musste träumen. Das konnte nicht real sein, oder seine heruntergewirtschafteten Nerven spielten ihm einen bösen Streich. Dann drang ein einzelner klarer Gedanke zu ihm durch. Natürlich, dachte er. Halloween. Die Nacht der Geister. Dunkel erinnerte er sich an eine Reportage, die er einmal über den heidnischen Ursprung des Festes gesehen hatte. Dass in dieser Nacht die Häuser offen standen und in den Küchen ein Festmahl für die Verstorbenen bereitgestellt wurde. Die Lebenden durften diesem Schauspiel nicht beiwohnen und verkrochen sich in ihre Betten, während die Ahnen sich an den dargebotenen Speisen gütlich taten und in dieser Nacht frei über die Erde wandeln durften. Ein uralter Brauch aus vorchristlicher Zeit. Zum Leben erweckt in einem kleinen pfälzischen Dorf. Das war mal wieder typisch für Elwenfels.
Carlos’ Knie verwandelten sich in den Quark, den er eigentlich gern zusammen mit der Kartoffel gegessen hätte. Jetzt fiel ihm auch wieder ein, was man über die Menschen sagte, die in dieser Nacht ihre Neugierde nicht bändigen konnten und heimlich den Besuch aus dem Jenseits beobachteten. Geschweige denn, dass sie etwas von ihrem Essen nahmen … Carlos’ Hand erschlaffte, und die Kartoffel fiel auf den Küchenboden.
Erwin nickte schmunzelnd. »Brav«, sagte er. »So isses besser, mein Großer.«
»Aber … aber ich wusste doch nicht …«, wisperte Carlos. »Außerdem habe ich … solchen Hunger.«
Erwin winkte ab und nahm eines der gefüllten Dubbegläser ins Visier, die am Fenster auf der Anrichte standen. Langsam streckte er seine durchsichtigen Finger aus und griff danach. »Jo, du kannscht auch morge früh noch ebbes esse. Vergiss net, dass es im Jenseits ke Grumbeere gebt un ken weiße Käs. Un ke Rieslingschorle.«
»Entschuldigung«, hauchte Carlos.
»Jo. Macht doch nix. Isch freu misch trotzdem, disch wiederzusehe. Guckscht e bissel zerfleddert aus de Wäsch, aber des wird schon wieder.« Die andere durchscheinende Hand tastete nach einer Rieslingflasche.
Carlos nickte benommen und versuchte krampfhaft, das Klappern seiner Zähne unter Kontrolle zu kriegen. Er wollte Erwin gerade fragen, was jetzt mit ihm passieren würde, als sein Blick auf die Szenerie fiel, die sich hinter dem alten Winzer abspielte.
Schemenhafte Gestalten lösten sich aus der Dunkelheit und näherten sich Sofies Haus. Aus allen Richtungen strömten sie herbei. Aber … es waren keine Menschen. Es war eher ein Nebel in menschlicher Form. Männer, Frauen und Kinder, Alte und Junge. Viele der durchscheinenden Körper trugen altertümliche Gewänder und Frisuren. Sie betraten die Häuser durch die Türen und kletterten durch die Fenster. Sie sahen hungrig aus. Und entschlossen.
Carlos hatte nun keine Kontrolle mehr über seine beiden Zahnreihen, die haltlos aufeinanderklapperten. Auch seine Füße wollten ihm nicht mehr gehorchen. Er wäre gern aus der Küche heraus nach oben gerannt, aber er war wie gelähmt. Erschrocken starrte er Erwin an.
»Hopp! Mach’s wie die Grumbeere«, schlug Erwin vor und deutete auf die Kartoffel, die zwischen Carlos’ Füßen auf dem Boden lag.
»Wie meinst du das?«, fragte er und hörte seine zitternde Stimme wie aus weiter Ferne.
»So wie isch’s sag, so mään isch’s«, erwiderte Erwin gewohnt rätselhaft.
Die Ahnen der Elwenfelser kamen immer näher. Schon hatte der erste das Küchenfenster beinahe erreicht. Carlos hatte das Gefühl, als würde kaltes Wasser an seiner Wirbelsäule entlangfließen. Dann begann die ganze Küche sich um ihn zu drehen. Als er neben der Kartoffel auf dem Boden zum Liegen kam, wusste er auch, was Erwin gemeint hatte. Eine Ohnmacht war definitiv das Beste, was ihm in dieser Situation passieren konnte.
Kapitel 2
Zwei Wochen zuvor: eine exotische Begegnung am Dorfbrunnen
Der Tag, an dem Willis Welt auf den Kopf gestellt wurde, war ein milder, sonniger Mittwoch. Eigentlich hingen keinerlei ungute Ahnungen in der Luft, nur die gerade geschlagenen Kiefern, die vor dem Sägewerk auf einem hohen Stapel lagen, verströmten ihren würzigen Duft. Es war kurz vor Mittag, und Willi hatte eine ganze Menge Arbeit vor sich. Er ließ seine wenigen Angestellten im Sägewerk die letzten Vorbereitungen treffen und verabschiedete sich für eine halbe Stunde, um im Dorf noch einen Kaffee zu trinken. Vielleicht würde es auch eine Schorle werden, dachte er, als er den schmalen Weg neben dem Friedhof entlanglief. Es war der 17. Oktober, aber über dem Dorf lag die letzte Ahnung des heißen Sommers. Bei dem Datum huschte plötzlich ein dunkler Gedanke durch seinen Kopf: Heute vor fünfzehn Jahren war es passiert.
Schnell verscheuchte Willi die Erinnerung, aber es war bereits zu spät. Seine gute Laune hatte eine Delle abbekommen. Also doch eine Rieslingschorle, dachte er. Hin- und hergerissen zwischen Vorfreude und einer sonderbaren Unruhe bog er in die Straße zum Dorf ein, vorbei an den herbstlichen Obstgärten und dem Weingut, auf dem der jahreszeittypische Hochbetrieb herrschte. Er winkte Charlotte und ihrer Schwester Sofie zu, die im Hof gerade den Vorderreifen eines kleinen Traktors mit einer Leichtigkeit auswechselten, als wäre es das Rad einer Schubkarre.
»Un, wie, ihr Mädels?«, rief Willi. »Wenn ma euch so sieht, könnt ma meine, dass die Fraue heutzutags gar ke Männer mehr brauche.«
»Ou, do is aber mol jemand scharfsinnig unnerwegs heut«, rief Charlotte zurück.
Sofie setzte ihr Zauberlächeln auf. »Kennscht du net den Spruch, Willi? Brauche nichts, wünsche alles, wähle, was sich zeigt!«
»Hä?« Willi blieb wie angewurzelt stehen und kratzte sich demonstrativ am Kopf: »Ihr wern entschuldige, isch wollt jetz ke philosophische Debatiererei anfange. Dafür isses zu früh. Isch hab noch ken Droppe gfrühstückt. Alla dann.« Damit ließ Willi die lachenden Frauen stehen und ging kopfschüttelnd weiter.
Kurz bevor die Straße auf den Platz mündete, straffte er sich. Er wollte nicht, dass die anderen sahen, wie schwer ihm die Erinnerung an diesen Tag vor fünfzehn Jahren fiel. Hört das denn nie auf?, fragte er sich. Würde er bis an sein Lebensende daran knabbern müssen? Und noch etwas war seltsam. Es war der erste Tag seit fünfzehn Jahren, an dem er sich wünschte, nicht mehr so tun zu müssen, als habe er das alles verarbeitet und abgelegt. Die anderen sprachen ja auch nicht mehr darüber. Vielleicht dachten sie, dass es ihm nichts mehr ausmachte. Er stellte sich vor, er ginge ins Gasthaus und bestellte ohne das übliche gut gelaunte Poltern eine Schorle und gestand dann den anderen, dass es da eine Stelle in seiner breiten Brust gäbe, die einfach immer noch sauweh tat. Otto würde ihm auf die Schulter hauen und sagen: »Hopp, Willi, is doch net so schlimm. Is doch schon so lang her. Wir sin doch jetzt die Familie. Alla hopp, trinke ma äner.«
Manchmal wirkte diese Art der grob-herzlichen Aufmunterung. Aber heute, das ahnte Willi, würde sie nicht helfen. Warum war er heute nur so dünnhäutig? Und so traurig?
Was Willi nicht ahnte: Die Antwort auf seine Frage wartete nur dreißig Meter entfernt auf ihn.
Als er an der Bäckerei vorbeiging, verlangsamte er seine Schritte. Normalerweise war um diese Zeit nicht viel los, aber heute war der Platz für Elwenfelser Verhältnisse ziemlich belebt. Willi runzelte die Stirn. Er konnte sich das, was er sah, auf den ersten Blick nicht erklären. Lauter fremde Gestalten. Rasch zählte er die Neuankömmlinge. Am Brunnen standen neun Leute, vier Frauen und fünf Männer, die so sonderbar aussahen, dass er blinzelte.
Sie wirkten nicht wie verirrte Touristen oder wie die Störenfriede von den offiziellen Stellen der benachbarten Verbandsgemeinde. Als Erstes fiel Willi auf, dass sie allesamt so aussahen, als hätten sie sich seit Jahren ausschließlich von rohem Gemüse ernährt. Dünne, beinahe ausgemergelte Frauen und Männer in seltsamen, farbenfrohen Gewändern. Er hatte von fahrenden Zirkusleuten gehört, die quer durchs Land reisten und überall dort, wo man sie willkommen hieß, ihre Zelte aufschlugen. Aber diese Leute hier sahen nicht so aus, als verdienten sie ihren Lebensunterhalt im Zirkus. Willi entdeckte einen dunkelhäutigen Mann in orangen Pluderhosen und mit einem ausgeblichenen Turban. Ein paar der anderen waren in lange, bestickte Kittel gehüllt. Die Frauen trugen Sandalen und weite, bunte Kleider. Vielleicht fand irgendwo eines dieser Mittelalterfeste statt, dachte Willi. Er hätte ihnen allen am liebsten einen kleinen Sandsack zur besseren Bodenhaftung an die Knöchel gebunden, denn die Truppe sah aus, als würde nur ein leichter Windhauch genügen, um sie allesamt wie bunte Segel davonfliegen zu lassen. Ob sie wohl deswegen alle so seltsam lächelten?
Einige der Gestalten trugen einen dunkelroten Punkt zwischen den Augenbrauen. Also doch kein Mittelalterfest. Aber was dann? Willi runzelte die Stirn. Dann sah er, dass sein Freund Otto und Pfarrer Karl bei dem seltsamen Haufen standen, ebenso Elsbeth, die Wirtin. Er löste sich aus seiner Verwunderung und marschierte auf die Gruppe los.
Obwohl Karl gerade leise mit einer der Frauen redete, schob Willi sich dazwischen. »Was’n do los?«, wollte er wissen und war in diesem Moment einfach nur froh, dass diese Leute ihm einen Grund gaben, sich von seiner melancholischen Stimmung abzulenken.
»Ah Willi, gut, dass du kommscht!«, begrüßte ihn der Pfarrer. »Des hier könnt dich wahrscheinlich intressiere.«
»Wie määnscht’n des?«, fragte der mit einem Blick in die Runde.
In einer simultanen Bewegung legten die Leute ihre Hände aneinander, hoben sie vor die Stirn und senkten den Kopf in einer synchronen Verbeugung.
»Jo, des is interessant«, sagte Willi, zog die Augenbrauen hoch und schnupperte.
In der Luft lag ein würzig-süßlicher Geruch, der eindeutig von den Neuankömmlingen verströmt wurde. Als wäre ein Blumenladen in Flammen aufgegangen, und jemand hätte versucht, das Ganze mit Hustensaft zu löschen.
Die Frau, mit der Karl gesprochen hatte, löste sich aus ihrer Verbeugung und sah Willi an. »Namaste. Ich grüße dich«, sagte sie.
»Ja sehr nett. Aber isch heiß Willi.«
Sie sah aus wie eine abgemagerte Version der Heiligen Jungfrau Maria, ganz in Hellblau und Rosa und mit langen blonden Haaren, die ein gebräuntes Gesicht mit riesigen, babyblauen Augen einrahmten. Willi wusste nicht warum, aber in seiner Brust bahnte sich ein dröhnendes Lachen seinen Weg nach oben. Er warf einen Blick auf Otto, ob der wohl mitlachen würde. Aber sein alter Freund schaute die Dame geradezu ehrfürchtig an. Und um Karl stand es nicht besser. Willi wusste sich nicht anders zu helfen, imitierte den seltsamen Gruß mit den zusammengelegten Händen und versuchte sich an einem kleinen Knicks. Dabei fuhr es ihm ins Kreuz, und er musste an die fünf Dutzend Kiefernstämme vor dem Sägewerk denken.
»Willi, du glaubscht net, woher die Leut do komme«, sagte Karl. »Du darfst rate. Es fängt mit I an.«
»Was? De ganze lange Weg aus Impflinge?«
»Nää, Indien.«
»Indien?« Willi begann zu verstehen. Zumindest ein bisschen. Ein wenig ärgerte es ihn, dass er das nicht selbst erkannt hatte. »Ja, un was macht ihr do in Elwefels?«, fragte er.
Die Frau mochte vielleicht Mitte dreißig sein, wirkte aber älter und jünger zugleich, was Willi sehr irritierte. Sie machte einen Schritt auf ihn zu und legte ihre Hände über der Brust zusammen.
Willi wollte es ihr gerade nachmachen, da sagte Karl: »Die Leut suche Erleuschtung. Hier bei uns, in Elwenfels. Kannscht du des glaube, hä?«
»Erleuschtung? Des is jo dann dein Job, Herr Pfarrer.«
»Nein, diese Art von Erleuchtung meinen wir nicht«, sagte die Frau lächelnd und ergriff ohne Umstände Willis Hand. »Ich möchte mich dir vorstellen, lieber Mann. Mein Name ist Amana. Das bedeutet Frieden. Und nichts als Frieden führen wir mit uns.« Sie deutete auf die kleine lächelnde Gruppe, die das in Elwenfels beheimatete Farbspektrum auf schier unglaubliche Weise erweiterte. Vor allem Orangetöne dominierten die Garderobe. »Uns ist zu Ohren gekommen, dass dies ein besonderer Ort ist. Dass es hier etwas gibt, was man nirgendwo sonst auf der Welt findet, nicht einmal in Indien. Und das will etwas heißen, nicht wahr?« Sie schickte ein helles, weiches Lachen hinterher und schloss in gespielter Verzückung die Augen.
»Ja? Un was genau will des jetzt heiße?«, hakte Willi nach und entzog der jungen Frau seine Finger.
»Wenn es den lieben, guten Mitmenschen hier nichts ausmacht, dann würden wir gerne eine Weile an diesem Kraftort bleiben und uns in den Wäldern da draußen auf die Suche nach dem Wesentlichen machen.«
»Des Wesentliche?«, echote nun Otto, und Willi war froh, dass sich sein Freund endlich mit einschaltete in das immer merkwürdiger werdende Gespräch.
»Des Wesentliche liegt aber net im Wald. Sondern do drin, hinter der Tür do!« Er deutete auf die Hofeinfahrt zur Weinstube.
Elsbeth pflichtete ihm bei. »Jo, do drin gibt’s ebbes, was es in Indien garantiert net gibt. Un annerschdwo auch net.«
»Alla hopp, deswege bin isch nämlich do!«, sagte Willi und wandte sich dem Gasthaus zu. »Isch hab noch was zu schaffe heut. Elsbeth, was is?« Er bedeutete der Wirtin, ihm zu folgen, aber Elsbeth – Bettl – war offensichtlich nicht bereit, sich so schnell von den exotischen Gästen zu trennen.
Die Frau, die sich Amana nannte, sagte: »Das meinen wir nicht.«
»Jo alla. Papperlapapp!«, meinte Elsbeth. »Wer unsern Schorle noch net probiert hat, der weiß eigentlich gar nix über Erleuschtung.«
»Wir niemals trinken Alkohol«, sagte ein drahtiger, chinesisch aussehender Mann mit glatt rasiertem Schädel und einer Kette aus Holzperlen, die ihm fast bis zu den Knien reichte. »Alkohol not good.« Aus unerklärlichen Gründen fing er bei diesen Worten an wie ein kleiner Junge zu kichern.
»Schorle is aus Wasser. Un Woi is auch dabei!«, rief Willi. »Un Woi is ken Alkohol.«
»Genau«, pflichtete Otto ihm bei. »Bei uns is des e Grundnahrungsmittel.«
»Wir ham auch Traubensaft«, sagte Elsbeth.
Amana senkte den Kopf, und ihr Lächeln bekam etwas Distanziertes. »Wir bedanken uns für eure Gastfreundschaft«, meinte sie, und wie auf Kommando verneigten sich die anderen ebenfalls.
Willi fragte sich, was sie mit diesen sonderbaren Gesten bezweckten. »Man meint grad, euch is de Kopp e bissel schwer geworde von der lange Reise, hä?«, fragte er. »Vor uns muss ma sich net verbeuge. Wir sin ganz normale Leut un ke … Wie nennt ma des bei euch?«
Amana sah ihn fragend an.
»Die Type, die wo de ganze Tag nur rumhocke un ihr Füß hinter de Ohre verknote.«
»Was du määnscht, sind Gurus«, sprang Otto ihm bei.
»Jo, genau. Wir sind ke Gurus.«
»Das wollten wir damit auch nicht andeuten«, sagte Amana. »Was wir suchen, ist die unverfälschte Natur des Waldes. Wir haben Indien den Rücken gekehrt, um hier das Mysterium des Lebens zu erkunden. Uns wurde zugetragen, dass dies hier ein Ort voller Wunder sei. Dass hier die Trennlinie zwischen den sichtbaren und den unsichtbaren Dingen dünner ist als anderswo.«
»Un wie wollt ihr des erfahre, wenn ihr ken Riesling trinken?«, fragte Willi. Eigentlich hätte er gerne gewusst, wer den Neuankömmlingen das alles über Elwenfels erzählt hatte, aber er kam nicht dazu.
»Jo genau«, meinte Otto lachend.
»Hopp, Männer«, ging Elsbeth dazwischen, »jetzt lasst mol die Leut in Ruh. Nach der lange Reise seid ihr doch bestimmt arg müd un hungrig, oder?«
»Ja. Wir sind müde und hungrig«, bestätigte der blonde Engel. »Wir würden jetzt gerne unser Lager aufschlagen und uns ausruhen. Aber bitte macht euch nicht die Mühe, uns etwas zum Essen zu bringen. Wir haben unsere eigene Verpflegung dabei.«
»Ach ja?«, fragte Otto neugierig. »Wassersupp?«
»Zur Not ernähren wir uns auch von Wasser«, räumte ein dunkelhäutiger Mann mit Turban ein, dem das Gespräch wohl zu lange dauerte. Sein Deutsch war perfekt, aber seine Sprachmelodie klang, als würde man ein paar Kilo Kichererbsen in einen Leierkasten werfen. In seinem Gesicht wuchs ein Bart, der aussah, als brüte ein Vogel darin. »Das haben wir in Indien ausreichend trainiert. Bevor wir etwas Unreines essen, essen wir lieber nichts.«
Elsbeth riss die Augen auf. »Ebbes Unreines? Wie määnscht’n des, junger Mann?«
»Liebe Frau, was Jayan dir sagen will, ist, dass wir kein Fleisch essen und auch sonst nichts, was inkarnierte Tierseelen nicht freiwillig zur Verfügung stellen würden«, erklärte Amana.
»Dekantierte Tierseelen?«, murmelte Otto fassungslos. »Was’n des?«
Elsbeth nickte langsam und bemühte sich, zu verstehen, was sie da gehört hatte. »Ah … des … is gut zu wisse.«
»Ja, un was wollt ihr jetz do bei uns im Wald?«, fragte Willi. »Nachts wird’s nämlisch ganz schää kalt do drauße. Un ungefährlich isses auch net.«
Amana winkte sanft ab. »Wir haben in Indien viele gefährliche Situationen gemeistert. Wir begegnen den Dingen mit bedingungsloser Liebe. Mit dieser Einstellung sind wir perfekt vor allen Gefahren geschützt.«
Willi starrte sie an. Es hatte mal eine Zeit gegeben, da war Elwenfels ein weißer Fleck auf der Landkarte gewesen. Ein Ort, der genauso gut der Fantasie von lokalpatriotischen Schriftstellern hätte entspringen können. Sogar im benachbarten Deidesheim hatte es Leute gegeben, die nicht einmal vermuteten, dass hinter dem ersten Hügelkamm der Haardt seit 1300 Jahren ein eigentümliches Dorf existierte. Jahrzehntelang war die Zahl derer, die von außen nach Elwenfels kamen, so überschaubar gewesen wie die Anzahl von Goldfischen im Dorfbrunnen (bevor die Katze von Cordula die kleine Population immer weiter dezimiert hatte). Niemals wäre es jemandem eingefallen, sich in Elwenfels zu verstecken, so wie es Hans Strobel im letzten Jahr getan hatte. Oder sich den Wald für ein militärisches Übungsmanöver auszusuchen, wie sie es vor gerade einmal fünf Monaten erlebt hatten. Und jetzt diese abgerissenen, abgemagerten Hippies aus Indien, die sich Elwenfels als Station auf ihrem Erleuchtungstrip ausgesucht hatten. War das zu glauben? Willi hatte in den letzten Monaten viel mit den anderen darüber diskutiert, ob Elwenfels seinen Status als verstecktes, geheimes Fleckchen Erde allmählich aufgeben musste. Offensichtlich lag das Dorf nun wie eine Art Verkehrsinsel mitten auf einer viel befahrenen Straße, die in alle Richtungen abzweigte. Bei diesem Gedanken hatte er ein sehr ungutes Gefühl. Wie kam es überhaupt, dass man in Indien von Elwenfels wusste?
Willi baute sich vor der charmant säuselnden Wortführerin auf und stemmte die Hände in die Hüften. »Jetz pass mol uff, was ich dir sag!«, rief er. »Wegen mir könnt ihr ruhig im Wald e bissel Erleuchtung spiele. Aber erwartet bloß net, dass wir do mitspiele.«
»Nein, das erwarten wir überhaupt nicht«, erwiderte sie lächelnd. »Das ist ja das Gute am Leben. Es zeigt sich von seiner schönsten Seite, wenn man es nicht mit selbstsüchtigen Erwartungen verstellt.«
Ihre souveränen, freundlichen Worte lösten etwas in Willi aus. Er konnte es nicht genau benennen, aber er fühlte sich von diesem zarten, lächelnden Wesen auf den Arm genommen. »Ah ja? Un wie soll des Ganze ablaufe?«, fragte er. »Ihr macht Campingurlaub in unserm Wald? Was is, wenn wir wollten, dass ihr wieder gehe sollt? Das letzte Mal, wo bei uns Leut im Wald campiert sind, hat des e böses End genomme.«
»Die Soldaten der U. S. Army«, bestätigte Amana. »Das wissen wir bereits.«
Willi wechselte einen alarmierten Blick mit Otto, der die Augen aufriss und einen ungläubigen Laut ausstieß. Wie konnte es sein, dass diese Sache publik geworden war? Nach dem, was vor fünf Monaten in den Wäldern rund um Elwenfels geschehen war, hatte Willi angenommen, dass die Army das Mäntelchen des Schweigens um dieses peinliche Ereignis gebreitet hatte. Wie kam es, dass ausgerechnet diese bunten Flattergewänder davon erfahren hatten?
»Du hältst uns vielleicht für weltfremd, aber das sind wir nicht«, sagte Amana. »Und auch in Indien gibt es Internet. Wir sind vor einigen Monaten zufällig auf den Blog eines ehemaligen US-Soldaten gestoßen, der sich vom blinden Herdentier des Todes in ein bewusstes und friedvolles Wesen gewandelt hat. Und den Auslöser für diese wundervolle Wandlung hat er hier in Elwenfels erlebt.«
»Was?«, donnerte Willi. »Des glaub ich jetzt net!«
»Ja, es ist ja eigentlich auch unglaublich. Aber es ist wahr.« Amanas Augen leuchteten. »Der Mann hat ausführlich über die tiefe Erfahrung geschrieben, die ihm hier zuteilwurde. Er schreibt, dass dieser Ort geheimnisvolle, unerklärliche Energien freisetze, die seine Seele aus ihren Fesseln befreite. Er könne sich zwar nicht erklären, was genau mit ihm passiert sei, aber er schildert, dass er ein vollkommen anderer Mensch sei, seit er in Elwenfels war.«
»Jo, wahrscheinlich hat er sich zu arg gegruselt, wo de Erwin nachts uffgetaucht is«, murmelte Otto.
»Wer ist Erwin?«, wollte der indisch aussehende Mann mit dem Turban wissen.
»Na ja, eigentlich könnt man sagen, dass de Erwin so was is wie unser Guru«, erklärte Karl mit einem hinterlistigen Lächeln, und Willi sah fassungslos zu, wie die Augen einiger Besucher zu leuchten begannen.
Amana zuckte die Schultern. »Also, von einem Guru hat er nichts geschrieben. Nur von einer massiven Energie, die ihn in den Wäldern ergriffen hat. Wir alle verspüren den innigen Wunsch zu erleben, was dieser erwachte Soldat erlebt hat.«
»Liebes, ich will mich ja net aufdränge«, sagte Karl vorsichtig, »aber des, was der Soldat hier erlebt hot, des kann man auch in de Bibel nachlese.«
»Du meinst die Apostelgeschichte des Lukas, Kapitel 9, Vers 1 bis 43?«, erwiderte Amana, ohne mit der Wimper zu zucken.
Karl schnappte nach Luft.
»Und bevor du fragst, warum ich das jetzt so genau weiß – ich beschäftige mich mit Religionen. Mit allen! Deswegen suchen wir ja auch einen Weg, der abseits davon verläuft.«
In der Gruppe stieß jemand ein leises Schnauben aus, aber Willi konnte nicht erkennen, von wem es kam. Er verfolgte den kleinen Schlagabtausch zwischen dem spirituellen Oberhaupt von Elwenfels und dem weit gereisten Hippiemädchen nur noch halbherzig, denn in seinem Innern braute sich etwas zusammen, das er schon sehr lange nicht mehr gespürt hatte. Seine Laune sank auf einen neuen Tiefststand, der mit nichts zu vergleichen war. Nicht einmal mit dem, was vor ein paar Monaten war, als diese dreißig Elitesoldaten im Wald gecampt und ein unbeschreibliches Chaos inklusive Mord angerichtet hatten. Elwenfels hatte diese Krise gerade halbwegs überstanden, und jetzt kündigte sich die nächste Invasion an. Natürlich war dieser bunte Haufen aus Indien etwas ganz anderes als die Typen von der Armee. Wahrscheinlich saßen sie den lieben langen Tag im Wald, umarmten Bäume und streichelten Blumen. Und was, wenn sie dabei selbst Wurzeln schlugen? Willi wusste nicht, warum sich in ihm so viel Widerstand regte, denn was wäre so schlimm daran? Aber ein Teil von ihm hätte gerne wie ein trotziges Kleinkind aufgestampft und »Neinneinnein!« geschrien.
»Na, alla, dann weißt du jo, wie des gemeint is mit dem Paulus«, nahm Karl den Faden wieder auf. »Glaubst du net, dass der arme Soldate-Lottel aus Yankeestanien bloß e bissel verwirrt war und deswege …«
»Er hat hier etwas gefunden, was wir in Indien seit Jahren vergeblich suchen«, unterbrach ihn Amana. »Und dieses Etwas hat er sehr anschaulich beschrieben. Wir wollen hier nicht für immer bleiben, keine Sorge.«
»Jo, des wolle wir hoffe!«, polterte Willi. Seine Stirn zog sich zusammen, und seine Mundwinkel fühlten sich auf einmal an wie verbogene Büroklammern.
»Aber ein kleines Weilchen schon und dabei den heilenden Geist dieses Waldes empfangen«, beendete Amana den Satz.
»Also, ich geb’s uff«, brummte Otto. »Elsbeth, lass mich jetz endlich den heilenden Geist des großen Rieslings empfange.«
»Genau. So sei es!«, verkündete Willi. Er hatte gerade beschlossen, dass er den Kiefernstämmen vor seinem Sägewerk heute ihre Ruhe lassen würde.
»Ich kumm mit«, sagte Pfarrer Karl. »Bevor ich mich noch vom Paulus zurück in de Saulus verwandel, weeschwieschmään?«
»Verstehen wir das jetzt richtig?«, fragte Amana. »Ihr seid also dagegen, dass wir hier unser Lager aufschlagen? Wir sind hier nicht willkommen?«
Willi schnaubte unwillig. »Erleuchtung in Elwenfels. Wenn ihr do mol net zu viel erwarten!«
Hinter Amana hob der dürre Chinese lächelnd eine Hand, wie ein Kind in der Schule.
»Was?!«, herrschte Willi ihn an.
»Will erzählen gute Witz: Zen-Mönch schenkt Meister zu siebzigste Geburtstag große Kiste mit Schleife. Meister öffnet Kiste. Und sieht: Nichts drin. Ruft: Ah, genau das, was ich wollte!«
Eine Weile sagte keiner etwas, bevor es aus Otto herausplatzte: »Was määnt er?«
Auch der Pfarrer und Willi schauten den leise kichernden Chinesen völlig verständnislos an.
»Das ist unser Freund Chang«, sagte Amana. »Er will euch verdeutlichen, dass Erleuchtung durchaus etwas ist, das man auch mit Humor sehen kann …«
»Immer lachen«, unterbrach der Chinese sie. »Immer lachen, gute Laune machen!«, er kicherte auf eine Art, die Willi glauben ließ, dass der Mann vielleicht irgendein weißes Pulver geschnupft hatte. Vielleicht hatte er von dem ganzen Gekicher auch zu viel Sauerstoff im Gehirn.
»Was unser Freund Chang damit sagen will«, nahm Amana den Faden wieder auf, »ist, dass wir keineswegs zu viel erwarten, wenn wir in eurem Wald nach dem Wesentlichen suchen. Denn wenn wir es nicht finden, dann kommen wir der Erleuchtung trotzdem näher. Versteht ihr?« Sie sah lächelnd in die Runde. »Manchmal liegt gerade in der Nichterfüllung von Erwartungen ein großer Reichtum.«
Willi schüttelte den Kopf. »Kumm, geh fort!«, blaffte er. Er hatte endgültig genug von diesem kryptischen Geschwätz.
»Komm, geh fort«, griff der Chinese das pfälzische Paradoxon auf und kicherte wieder. »Das muss ich merken, sehr gut, sehr gute Witz.«
Willis Schläfen pulsierten bedrohlich unter dem immer größer werdenden Zorn. Diese Leute wollten ihn und die anderen doch auf den Arm nehmen. Und dabei bedienten sie sich einer seltsamen Sprache, die er nicht wirklich verstand. Er wollte gerade seinem Ärger Luft und die dauerlächelnde Wortführerin darauf aufmerksam machen, dass der Elwenfelser Wald kein Wellnessbereich für Verrückte war, da trat Elsbeth vor und warf einen besänftigenden Blick in die Runde.
»Jo, Mädel, jetz wo ihr schon mol do seid«, sagte sie und tätschelte Amanas dünnen Arm in dem hellblauen Batikshirt. »Wir wern euch schon net vertreibe. Jetzt ruhn euch erst mol aus. Dann sehn wir weiter.«
Die Gruppe verneigte sich wieder synchron. »Danke vielmals, gute Frau!«, sagte Amana und drückte Elsbeths Hände.
»Alla«, sagte die.
»Wie bitte?«
»Alla donn.«
Ein verständnisloses Lächeln huschte über das Gesicht der Wortführerin, und die anderen bückten sich nach ihren Gepäckstücken, unter denen sich auch einige Trommeln befanden.
»Wenn ihr irgendebbes braucht, dann meldet euch, ja?«, sagte Elsbeth in ihrer bedingungslos mütterlichen Art.
»Also isch brauch jetzt uff jeden Fall ebbes!«, knurrte Willi. »Un zwar jetzt sofort un noch mehr wie sonst.« Er wandte sich Otto zu, der schon ein paar Schritte in Richtung Weinstube gegangen war.
In diesem Moment nahm er aus dem Augenwinkel etwas wahr, das ihn innehalten ließ. Willi schaute über die Schulter zurück. In der nächsten Sekunde sackte sein Magen ganz tief nach unten. Er blinzelte, schaute noch einmal hin und begriff schlagartig mehrere Dinge gleichzeitig. Und davon war die Erkenntnis, dass ihm die Lust auf eine Rieslingschorle plötzlich vergangen war, nicht einmal die Schlimmste. Mit wild klopfendem Herzen zwang er sich hinzusehen. So gelähmt wie er war, blieb ihm auch nichts anderes übrig.
Er fing einen Blick auf. Einen ruhigen, abwartenden und wissenden Blick. Willi schluckte. Er senkte den Kopf, starrte die Pflastersteine des Dorfplatzes an und lauschte den harten, aufgeregten Herzschlägen in seiner Brust. Eben noch hatte er sich gefragt, wie sie eigentlich den Weg nach Elwenfels gefunden hatten und woher sie wussten, wo sie ihr Lager aufschlagen sollten. Auf einmal war ihm alles klar. Nicht nur der Blog dieses bekehrten Ami-Soldaten war der Grund, warum sie hier waren. Willi zitterte. Am liebsten hätte er laut losgeheult.
»Hear, Langer, wo bleibscht denn?«
Das war Ottos Stimme, die wie von ganz weit an Willis Ohr drang. Mit einem Ruck zwang er sich, sich umzudrehen und auf die Weinstube zuzueilen.
Drinnen setzte er sich an den runden Tisch zu Otto und Karl und hoffte, dass sie ihm nichts anmerkten. Er versuchte, so zu tun, als würde ihm die frische Rieslingschorle schmecken, obwohl ihm plötzlich alles wehtat und er einen dicken Kloß im Hals hatte. Aber sie ließen sich nicht täuschen.
Karl legte ihm die Hand auf den Arm. »Was’n los mit dir?«, fragte er. »Du siehst aus wie e weiße Wand. Ärgert’s dich so arg, dass jetz schon wieder Besucher do sin?«
»Des wird schon net so schlimm!« Otto winkte ab.
»Aber des mit der weiße Wand stimmt«, sagte Elsbeth und tätschelte Willi besorgt die Wange.
Willi wischte ihre Hand weg und funkelte die Wirtin und seine beiden Freunde zornig an. »Un weiter?«, schnauzte er. »Dann bin isch halt jetzt e weiße Wand. Besser wie überall die weiße Zähn do drauße. Ach Gott, was wird do gelächelt! Habt ihr schon gemerkt, dass die Leut die ganze Zeit nur lächeln wie die Bleede?«
»Jo, des is doch schää«, erwiderte Karl. »Un besser wie wenn se die ganze Zeit nur rummotze, so wie du.«
Willi schnaubte. »Isch sag dir was: Wer viel lächelt, braucht en gute Zahnarzt.« Dann ergriff er mit zitternder Hand sein Glas und stürzte die Rieslingschorle ohne jeden Genuss in sich hinein. Dabei verfluchte er sich selbst, dass er eine weitere Chance verpasst hatte, seinen Freunden endlich zu zeigen, wie es wirklich in ihm aussah.
Kapitel 3
In dem der Wunsch nach einem Zufluchtsort zunächst unter einem Küchentisch in Erfüllung geht
»Wenn ich’s net besser wüsst, tät ich sage, des is de Carlos.«
»Jo, aber dazu isser e bissel zu blass.«
»Ma könnt grad meine, er wär tot.«
»Isser aber net.«
»Do guck, die Auge.«
»Hat auch schon mol besser geroche, de Carlos.«
»Schluss jetz! Seht ihr net, dass der völlig fertig is mit der Welt? Lasst’n doch erst mal aufwache!«
»Jo, is jo gut. Ich hol mal de Doktor.«
Die Stimmen drangen wie durch eine dicke Watteschicht an sein Ohr. Dazwischen spürte Carlos immer wieder ein nicht gerade sanftes Klopfen auf seine Wange, und jemand zupfte an ihm herum. Ganz allmählich fand er wieder zurück in eine schwache, unscharfe Version seines Bewusstseins. Vorsichtig schlug er die Augen auf und klappte sie gleich wieder zu.
»Ah, do bischt jo wieder, mein Guder!«, dröhnte eine Stimme an seinem Ohr, die niemandem anderen gehören konnte als Otto. Zu jedem anderen Zeitpunkt hätte Carlos sich über die Anwesenheit des Automechanikers gefreut, aber jetzt drang sein volltönendes Organ ein wenig zu brachial zu Carlos vor.
»Was machst du denn da unter dem Tisch, alter Freund?«, fragte eine andere, deutlich norddeutsch gefärbte Stimme, die eindeutig von Hans Strobel kam.
»Jetz lasst ihn doch erst mal zu sich komme!«, mahnte eine leise Frauenstimme, begleitet von einer zarten, kühlen Hand, die sich auf seine Stirn legte.
Sofie. Unwillkürlich musste Carlos lächeln. Zaghaft öffnete er die Augen erneut und blickte in vier besorgte Gesichter, die direkt über ihm zu schweben schienen, eingerahmt von der Unterseite einer Tischplatte. Das vierte Gesicht gehörte Elsbeth, Sofies Großmutter und Wirtin des einzigen Gasthauses von Elwenfels, die trotz ihrer zweiundachtzig Jahre immer noch die Fähigkeit besaß, unter Tische zu kriechen, wenn es sein musste. Und jetzt gerade musste es wohl sein, weil er hier unten lag: auf dem Boden unter einem Tisch – ohne genau zu wissen, wie er hierhergekommen war.
»Dich kann ma äfach net allein lasse, gell Carlos?«, lamentierte Elsbeth und sah ihn voller Sorge an. »Weißt du net, wie gfährlich so e Nacht is für einer wie dich?«
Bestimmt schob Sofie ihre Großmutter zur Seite und beugte sich über Carlos.
Oh, wie gut ihr Anblick ihm tat. Als würde man nach einem langen, erschöpfenden Kampf in der Obhut einer Elben-Prinzessin aufwachen. Sofies lange Haare kitzelten seine Wangen, und er hätte gerne gelächelt, aber in seiner Brust saß ein dicker Klumpen und in seinen Augenwinkeln kitzelte es verdächtig. Nur gut, dass Charlotte ihn so nicht sehen konnte. »Es tut mir leid …«, fing er an, aber Sofie legte ihm den Finger auf die Lippen.
»Schon gut, Carlos. Du musst nix sagen. Wir verstehn schon.«
»Gar nichts versteht ihr«, widersprach er und versuchte sich aufzurappeln, aber Sofie drückte ihn mit sanfter Gewalt zurück auf den Küchenboden, der so kalt und hart war, dass sich sein Rücken mittlerweile anfühlte wie eine Eislaufbahn.
»Und ob wir verstehe«, sagte eine andere Stimme, und das Gesicht von Michael Schaf schob sich in Carlos’ Gesichtsfeld. »Immer wenn du auftauchst bei uns, gibt’s dramatische Verwicklunge. Stimmt doch, oder net?«
Carlos nickte. »Ich … Ich dachte einfach, euer altes Motto, das nehm ich mal wörtlich.«
»Motto? Was soll des heiße?«, fragte der Arzt und leuchtete mit einer kleinen Stablampe unsanft in Carlos’ Augen.
»Na, dass jeder, der etwas sucht, richtig sucht …« Weiter kam er nicht. Sein Bewusstsein schwebte wie ein Ballon mit durchtrennter Schnur davon, und Carlos bekam nur noch mit, wie Sofie seinen Satz leise vervollständigte.
»… irgendwann nach Elwenfels kommt.«
Er spürte, wie sie ihn unter dem Tisch hervorzogen, wie kräftige Hände ihn hochhoben und er fortgetragen wurde. Dabei fühlte er sich wie ein kleiner Weidenkorb auf dem Rücken eines Ochsen. Irgendwie drang auch noch ein gemurrter Satz zu ihm durch, den er sich vielleicht auch nur einbildete.
Ende der Leseprobe