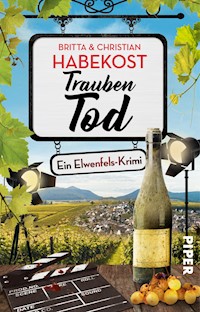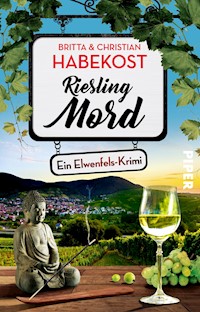9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein zweitausend Jahre alter Fluch. Und eine mutige Frau, auf der Suche nach ihrem Bruder.
England, im Jahr 1789. Um ihre Familie nach dem Verschwinden ihres Bruders David vor dem Untergang zu bewahren, soll die junge Elinda Audley einen Mann von adliger Herkunft heiraten. Dabei könnte Elinda ihren zukünftigen Gatten nicht mehr verachten. Statt sich dem Willen ihres Vaters zu beugen, begibt sie sich auf die gefährlichste Reise ihres Lebens. Gemeinsam mit dem geheimnisumwobenen Blake Colbert flüchtet sie Richtung Pompeji. Alles deutet darauf hin, dass sie David dort finden wird. Doch je näher sie den Mauern der aschetoten antiken Stadt kommen, desto deutlicher wird, dass eine finstere Macht sie dort erwartet …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 652
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Britta Habekost, geboren 1982 in Heilbronn, studierte Literatur und Kunstgeschichte und arbeitete unter anderem als Museumsführerin.
In ihren historischen Kriminalromanen Stadt der Mörder und Melodie des Bösen beschwört sie das Paris der 1920er-Jahre herauf.
Als leidenschaftliche Weltenbummlerin gilt ihr besonderes Interesse den historischen Reiseberichten berühmter Schriftsteller*innen wie Mary Shelley. In Der Untergang von ThorntonHall verwebt die Autorin eine Reise ins Italien des 18. Jahrhunderts mit den düsteren Elementen der klassischen Gothic Novel.
Außerdem von Britta Habekost lieferbar:
Stadt der Mörder. Roman.
Melodie des Bösen. Roman.
www.penguin-verlag.de
Britta Habekost
DER
UNTERGANG VON
THORNTON
HALL
ROMAN
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Dataminings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2024 by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Claudia Alt
Umschlaggestaltung: Favoritbuero
Covermotive: © Shutterstock/Andrew Swarga, Kriengsuk Prasroetsung; © Trevillion Images/Nic Skerten; © Arcangle/Yolande de Kort
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-32090-4V001
www.penguin-verlag.de
Für Christian,
der auf alten Friedhöfen Verstecken spielt,
in römischen Ruinen picknickt und die Piraten
zum Tee eingeladen hat.
Prolog
Pompeji, Oktober 79 n. Chr.
»Heute ist ein guter Tag für einen Fluch«, murmelte die alte Frau und legte einen brennenden Span in eine Kupferschale mit scharf riechenden Kräutern. Ihre Lippen formten unhörbare Worte. Ihre Hände vollführten geheimnisvolle Bewegungen im aufsteigenden Rauch. Alles an ihr wirkte befremdlich, als würde in ihrem Gewand kein Mensch stecken, sondern ein übergroßes Insekt.
Vibia knetete nervös die Falten ihrer Palla. Sie hatte Mühe, sich nicht anmerken zu lassen, wie beklommen ihr zumute war. Sie war noch vor Sonnenaufgang zur Hütte der alten Frau außerhalb der Stadt gekommen, damit niemand sie sah.
Verstohlen sah Vibia sich in der Hütte um. Von der Decke hingen Körbe mit Flaschen und Phiolen. In ihnen mussten sich jene Substanzen verbergen, für die man im Morgengrauen zu der Alten ging. Kräuter, Harze, seltsame Mixturen, um gewisse Dinge zu bekommen, meistens aber, um gewisse Dinge wieder loszuwerden. Man munkelte, dass die Alte mit den Göttern der Unterwelt im Bunde war, mit Nemesis, den Manen, Pluto, Proserpina. Und natürlich den Furien, den alten Rachegöttinnen. Statuen dieser Götter standen auf Schreinen im ganzen Raum verteilt. Blakende Talglichter belebten ihre strengen Gesichter, die Vibia anzustarren schienen. Ihre Unruhe wurde zu Furcht. Was sie hier tun würde, stand unter strengster Strafe. Doch das war es nicht, was ihr die meiste Angst einflößte. Es waren die leichten Vibrationen unter ihren Füßen. Sie spürte sie schon seit Tagen, war sich aber nie sicher, ob sie sich das Ganze nur einbildete. Die anderen Frauen im Lupanar schienen die kaum merklichen Erschütterungen nicht zu spüren.
»Vibia, du verbringst den ganzen Tag auf dem Rücken liegend oder mit dem Kopf unten«, hatte Myrte versucht, Vibias gestörten Gleichgewichtssinn zu erklären, und dabei ihr ansteckendes Lachen ausgestoßen. Aber dann hatte Vibia gestern einen der Freier sagen hören, dass im Garten seines Hauses der Brunnen trockengefallen war und dass am Morgen lauter tote Eidechsen und Spinnen auf den gesprungenen Fliesen lagen. »Und diese seltsame Wärme überall …«
Vibia hatte keine Erklärung für diese Dinge. Sie wusste nur, dass weder ein nahendes Erdbeben oder sonst eine Katastrophe sie von dem abhalten würde, weswegen sie die Alte aufgesucht hatte. Sie warf einen scheuen Blick auf die Statuen und wurde das Gefühl nicht los, von ihnen geprüft zu werden. War ihr Anliegen wirklich groß genug, um dafür die Hilfe der Unterwelt anzurufen?
Die Alte reichte Vibia einen Schreibgriffel und deutete auf eine kleine Bleitafel, nicht größer als Vibias Hand. »Ritze dort ein, was du von den Göttern forderst.«
»Ich … ich kann nicht schreiben.«
Ein Seufzen kam als Antwort. »Natürlich. Wie dumm von mir. Dann sag mir, was du willst, und ich werde es für dich einritzen.«
»Ich soll dir … erzählen, was mir widerfahren ist?«
Vibias Stimme stockte bei der Erinnerung an die vorige Woche, als ein Patrizier sie und andere Mädchen in seine Villa geholt hatte, wo ein großes Festmahl stattfand. Das war nichts Ungewöhnliches, Vibia wurde oft zu derartigen Feiern ausgeliehen. Man gab ihr ein edles Gewand, das sie hinterher wieder zurückgeben musste, es sei denn, es war ihr während der Feiern in Fetzen gerissen worden. Dann häuften sich ihre Schulden bei Tullius, ihrem Besitzer. Beim Gedanken an ihn ballte sie die Fäuste. Tullius hatte ihren Zustand nach der Feier gesehen, ihren mit Striemen und Prellungen übersäten Körper, das Blut, das aus ihr herauslief. Er hatte auch den schlaffen Körper der dreizehnjährigen Nafi gesehen, die diesen gewaltvollen Ansturm männlicher Begierden nicht überlebt hatte. Aber er hatte nur in falscher Wehmut geseufzt, hatte Vibia drei Tage Ruhe eingeräumt, den kindlichen Leichnam weggeschafft und das Gold der Patrizier eingesteckt.
Tränen traten in Vibias Augen. Nafi war wie eine kleine Schwester gewesen. Vibia selbst war mit vierzehn ins Lupanar verkauft worden und hatte Nafi, die aus Ägypten kam, in alle Geheimnisse eingeweiht und die Kleine, auch wenn sie ihre Sprache nicht verstand, in den späten Nachtstunden getröstet, wenn sie zitternd vor Erschöpfung auf dem Bett kauerte. Vielleicht war es besser, dass Nafi tot war. So hatte der Totengott Pluto eine Zeugin für die dringende Notwendigkeit des Fluchs.
»Du sollst es mir nicht erzählen«, riss die Alte sie aus ihren Gedanken. »Du sollst mir sagen, was ich auf diese Bleitafel ritzen soll. Was soll den Betreffenden widerfahren? Und halte dich kurz, es müssen wenige, aber treffende Worte sein.«
Vibia nahm einen tiefen Atemzug von der würzigen Luft und wollte etwas sagen, doch ein heftiges Rumpeln fuhr durch den Boden der Hütte und warf eine der Götterstatuen um. Die Alte sprang auf und stellte die Statue demütig murmelnd wieder auf.
»Vor siebzehn Jahren war es das Gleiche«, sagte sie. »Ein schlimmes Erdbeben. Vielleicht solltest du deinen Fluch rasch auf den Weg bringen und für ein paar Tage aus der Stadt verschwinden.«
Vibia hatte bereits einige Leute gesehen, die mit Gepäck und Hausrat das Herkulaner Tor passierten, um über die westlichen Zugangsstraßen die Stadt zu verlassen. Aber wo sollte sie denn hin? Sie besaß weder Geld noch geeignete Kleidung für eine Reise. Sie war Tullius ausgeliefert.
»Also?« Die Frau sah sie ungeduldig an.
»Gut … ich… ich möchte, dass Spurius und Aulus und ein Mann namens Antonius zugrunde gehen. Und es soll auf schlimme Weise geschehen. Ich will, dass ihnen ihre Schwänze verfaulen und dass ihre Zungen schwarz werden, dass jeder Atemzug sie schmerzt, als wäre Glut in ihrer Lunge!«
Die Worte sprudelten nur so aus ihr heraus. Es war auf eine bittere Weise wunderbar, sich vorzustellen, wie die drei Männer, die ihr und Nafi das angetan hatten, eines Morgens nur noch einen schwarz verkümmerten Wurm zwischen ihren Beinen hatten. Sie würden nie wieder ein Mädchen zu Tode schänden.
»Und ich binde sie an den Tod. Sie sollen im Fieber zergehen und nichts und niemand darf ihnen Hilfe leisten oder sie erlösen.«
Die Alte ritzte die Worte in das Blei. Vibia hätte zu gern gewusst, wie die Zauberformeln aussahen. Erneut ging eine Vibration durch die Hütte. Es fühlte sich an, als würde sich eine riesige Schlange tief unten im Boden winden und aufbäumen.
»Was jetzt?«, fragte Vibia.
Die Alte schob ihr das Bleitäfelchen hin. »Du musst es nun zusammenfalten. Nimm diese Nadel und zerstoße es ein paarmal.« Sie reichte Vibia eine dicke Schusternadel. »Dein ganzer Hass muss in deine Hände fließen. Sprich mir nach: Ich binde das Leben dieser Männer an Vernichtung und Tod …«
»Ich binde das Leben dieser Männer an Vernichtung und Tod!«
Vibias Knöchel traten weiß hervor. Sie flehte die Götter der Unterwelt an und dachte an Nafi.
»Geh jetzt zurück in die Stadt«, sagte die Alte. »Du kommst an der Gräberstraße vorbei. Such dir ein Grab aus, am besten von einem jung Verstorbenen. Vergrab es tief und sprich: Totendämon, wer du auch bist, ich übergebe dir … dann nennst du die drei Namen, auf dass sie eines schrecklichen Todes sterben.«
»Und es wird wirken?«, fragte Vibia.
»Diese Frage habe ich nicht gehört«, murmelte die Alte und streckte die Hand aus. »Das macht acht Asse.«
Vibias Hände zitterten, als sie das Fluchtäfelchen in ihren Beutel steckte und die Münzen hervorholte. Acht Asse – so viel bekam Tullius für vier Freier, die Vibia bestiegen. Sie selbst hatte es ein ganzes Jahr gekostet, diese lächerliche und doch so hohe Summe anzusparen.
»Venus möge dich schützen, Kind. Und nun geh.«
Vibia wäre gerne noch ein wenig länger bei ihr geblieben, auch wenn ihr die Alte unheimlich war. Es tat gut, außerhalb des Lupanars zu sein und nicht wie eine Hure behandelt zu werden.
Als sie aus der Hütte trat, war die Sonne bereits aufgegangen. Ein Gefühl von Leichtigkeit beflügelte Vibias Schritte. Sie sog tief die frische Luft ein, die für diese Jahreszeit ungewöhnlich warm war, aber so wohltat. Weit weg vom Gassengewirr der Stadt mit ihren vielen Menschen und Ausdünstungen, weit weg von ihrem Gefängnis, in dem sie schon bald den ersten Mann empfangen musste. Vibia schloss die Hand um das gefaltete Bleitäfelchen in ihrem Beutel. Sie hatte sich noch nie so machtvoll gefühlt. Kurz vor der Stadtmauer fiel es ihr schließlich auf. Sie hatte es schon im Morgengrauen bemerkt, hätte aber nicht sagen können, was genau es war. Jetzt war es ihr schlagartig klar.
Kein einziger Vogel sang. In den Bäumen und Büschen war es vollkommen still. Sie sah auch keinen Vogel. Eine bedrückende Stille lag über allem. Rasch passierte Vibia das Herkulaner Tor und ging zwischen den großen Grabbauten auf die Stadt zu. Es war niemand zu sehen. Nur ein Fuhrmann mit seinem Ochsengespann nahm denselben Weg. Vibia schlüpfte zwischen zwei Mausoleen hindurch, hockte sich zwischen Efeuranken und Farn und tastete nach dem stumpfen Messer, das sie mitgenommen hatte. Rasch war eine zehn Finger tiefe Mulde ausgehoben. Sie legte das Fluchtäfelchen hinein und wiederholte die Beschwörung an den Totengeist dessen, der hier begraben lag. In Verbindung mit den Unterweltgöttern, die seine Seele besaßen, würde der Fluch seinen Weg zu den Lebenden finden.
Vibia schaufelte Erde in das Loch und schob drei größere Steine darüber. Ihr Herz pochte, Schweiß floss an ihrem Hals hinab.
Da zerriss auf einmal ein fremdartiges Geräusch die Stille. Als würde irgendwo ein riesiges Laken zerrissen. Ein Grollen folgte. Alarmiert richtete Vibia sich auf und trat zurück auf die Straße. Zwei Frauen kamen vorüber. Schnell zog sie ihre Palla in die Stirn. Doch die Blicke der Frauen wurden von etwas anderem angezogen. Vesuvius.
Über dem Berg hing eine gewaltige Wolke. Sie sah ganz anders aus als gewöhnliche Wolken. Als käme sie aus dem Berg selbst. Jetzt begriff Vibia auch, dass das merkwürdige Geräusch von seinen Hängen ausging.
Rasch wandte sie sich der Stadt zu. Wie seltsam, dachte sie, als sie sich bei dem Wunsch ertappte, zurück ins Lupanar zu kommen. Sie sehnte sich nach Schlaf, denn die Aufregung hatte sie vollkommen erschöpft.
An diesem Morgen war ungewöhnlich wenig los auf den Straßen Pompejis. Tullius stand draußen und starrte mit zusammengekniffenen Augen die Wolke an. Er bemerkte Vibia gar nicht. Sie stieg ins Obergeschoss, legte sich in ihrem Gemach auf das gemauerte Bett, unter das schon tausendmal betrachtete Wandgemälde eines Mannes, der eine Frau von hinten nimmt. Ihre Matratze war dünn, und sie hasste es, dass sie am selben Ort schlief, wo sie die Freier bedienen musste. Doch sie schlief sofort ein.
Ein lautes Donnern ließ sie hochschrecken. Das Licht, das durchs Fenster fiel, zeigte ihr, dass es bereits Mittag war. Beunruhigt richtete sie sich auf. Unten in der Gasse war hektisches Stimmengewirr zu hören. Vibia wurde das Gefühl nicht los, dass irgendetwas Schreckliches im Gange war.
Der Hunger fuhr zwischen ihre Gedanken. Sie würde zum Bäcker Modestus gehen, bei dem es die besten Brote von ganz Pompeji gab. Dann einen Becher Wein, und die Welt war vielleicht wieder ein wenig berechenbarer.
Auf der Gasse geriet Vibia in eine Menge aufgeregter Menschen. Alle starrten in Richtung des Berges. Die riesige graue Wolke stand immer noch dort. Und sie schien sich an den Hängen abwärts zu bewegen, als würde sie fließen.
Da, schon wieder ein Knall.
»Was ist das?«, fragte sie niemand bestimmten. Vor Modestus’ Backstube stand eine Traube Leute. Doch niemand hatte eine Antwort auf diese Frage. Beunruhigt sah Vibia sich um. Und in ihrem Kopf bildete sich erneut ein schrecklicher Gedanke. Hatte ihr Fluch diese unheilvollen Ereignisse ausgelöst? Unsinn, schalt sie sich. Warum sollten Pluto und Proserpina über den Rachewunsch einer armen Hure derart in Rage geraten?
Ein weiterer Knall ertönte, so laut, dass die Menschen auf der Straße zurücksprangen. Sogar Tullius duckte sich wie ein Hund unter den Balkon des Lupanars. Vibia hatte Angst. Aber noch größer war die Genugtuung, Tullius so zu sehen. Da entdeckte sie ihre Freundin Myrte, die aus einer der angrenzenden Gassen kam. Sie war bleich wie das Innere eines Seeigels. Erschrocken klammerte sie sich an Vibia und starrte sie an.
»Hast du es getan?«, wisperte sie.
Vibia nickte. »Sie werden alle sterben. Pluto wird sie in den Orkus hinabziehen.«
»Und uns alle mit dazu«, beschied ihr Myrte.
Wie um ihre Worte zu bekräftigen, ertönte ein noch lauterer, dumpfer Knall, und der Boden zitterte. Und plötzlich schoss aus dem Berg eine graue Säule. Höher und höher stieg sie in den Himmel, wie eine unendlich lange Lanze. Vibia legte, ohne zu atmen, den Kopf in den Nacken. Sie sah eine weiße, ringförmige Wolke, weit oben im Himmel. Die Wolke wurde immer größer, schob sich über den Berg, seine Hänge, bewegte sich auf die Stadt zu. Schon war das Licht der Sonne nur noch eine Erinnerung. Fassungslos starrten die Pompejaner auf das furchterregende Schauspiel. Die Leute drückten sich gegen die Häusermauern, Frauen hoben ihre Schals vor das Gesicht, um das Entsetzen zu verbergen.
Tullius griff nach Vibias Schulter und stieß Myrte an. »Ins Haus mit euch, los.«
Doch die beiden rührten sich nicht. Und der beunruhigende Anblick brach auch Tullius übliche Unnachgiebigkeit. Sein Mund stand offen, während er den Weg der Rauchsäule in den Himmel verfolgte.
»Vielleicht ist es nur vorübergehend«, vermutete der Bordellbesitzer, wie um sich selbst Mut zuzusprechen. »Die Priesterkollegien werden ein Opfer für den Gott Vulcanus bringen, um ihn zu besänftigen.«
Vibias Nacken schmerzte. Beim Blick auf die wie versteinert stehenden Menschen wurde ihr kalt. Die graue Säule schraubte sich immer höher in den Himmel. Ein matter, abendlicher Schein legte sich über die Stadt. Etwas veränderte sich dort oben im Himmel. Einige Leute stießen jetzt Schreie aus und deuteten zur grauen Wolke. Das Schreien setzte sich durch die Gassen fort, als andere einfielen.
»Beim großen Jupiter«, wisperte Myrte. »Was ist das?«
Riesige Brocken, groß wie Häuser, schossen seitlich aus der grauen Rauchsäule heraus und fielen auf die Hänge des Berges herab. Das Donnern und Krachen hatte aufgehört. Jetzt war es still. Entsetzlich still. Wie konnte ein derartiges Schauspiel der Natur so geräuschlos sein?, dachte Vibia noch. Dann schoss in unmittelbarer Nähe ein faustgroßer Stein herab und durchschlug das Dach einer Schenke. Unwillkürlich duckte sie sich. Dem Stein folgten weitere. Mit einem Mal war es mit der Stille des unheimlichen Schauspiels vorbei, und ein Krachen und Prasseln überzog die Stadt, als überall kleine und große Steine herabregneten.
Es war Tullius, den es als Erster traf. Ein Geschoss, groß wie ein Laib Brot, riss ihn von den Füßen. Blut rann zwischen den Pflastersteinen. Vibia starrte atemlos den zerquetschten Leib an. Ein seltsamer Gedanke schnitt sie für Sekunden von der Außenwelt ab. Sie hatte Tullius nicht auf dem Fluchtäfelchen erwähnt, weil sie ihm ohnehin ausgeliefert war und ein Zuhälter schlimmer war als der andere. Gaben die Götter ihr so zu verstehen, dass ihre Rache zu zahm war?
»Wenn schon, denn schon …«, murmelte sie verwirrt.
Myrte packte ihre Hand und riss sie von dem erschlagenen Tullius weg. Das Entsetzen fegte Vibias Genugtuung hinfort. Schreiende Menschen stoben in alle Richtungen auseinander, überall, wo man hinsah, herrschte heilloses Durcheinander.
»Zum Forum«, brüllte einer in hilfloser Hörigkeit an die Staatsmacht.
Vibia dachte an die Arkadengänge des Forums und dass sie niemals rechtzeitig dort sein würden, um unter ihnen Schutz zu suchen. Bei Modestus rissen sie sich um die Brote. Eine Frau schleppte eine Truhe vorüber. Panik stand in ihren Augen, während sie den Steinen auf der Straße auswich. Ein Mann trieb einen Esel mit der Peitsche an, auf dem Rücken des Tiers hockte ein kleiner Junge.
»Raus aus der Stadt!«, schrie es überall. »Holt die Familien und dann weg hier!«
Vibia klammerte sich an Myrte. »Wohin?!«
Doch es war Vesuvius, der eine Antwort gab, während der steinerne Regen auf die Stadt immer dichter wurde und alles in albtraumhafte Finsternis hüllte.
Nirgendwohin.
1
April 1789
Der Handelsschoner mit Namen Allison lief erwartungsgemäß um zwölf Uhr mittags im Hafen von Dover ein, als der Nebel, der die Schiffsmasten verschluckte, Elinda eine Frage zuflüsterte.
Was, wenn David ihr fremd geworden war?
Der Tag war kalt, und es wurde nicht richtig hell, als würde sich der Winter in den späten April beugen. Elinda fror in ihrem hellblauen Mantel, den ihre Mutter sie gezwungen hatte anzuziehen, obwohl Elinda das alberne Ding mit den aufgestickten Blumen verabscheute.
»Dann sieht David dich gleich in der Menge, wenn er vom Schiff kommt!«, hatte Bérénice Audley ihrer Tochter versichert.
Der Gedanke war schön, aber die merkwürdige Beklommenheit erstickte Elindas Freude. Was, wenn sie ihm fremd geworden war?
Elinda schob das Gefühl auf die dumpfe, kalte Luft am Hafen, die ihr durch die Kleider und die Samthaube drang.
Die pfingstrosenfarbene Robe ihrer Mutter, eigens ausgewählt für diesen freudigen Tag, wirkte im Nebellicht fahl und schäbig. Der Gehstock ihres Vaters Robert Audley glitt auf dem glitschigen Pflaster immer wieder aus. Und der verhangene Himmel schien der versammelten Menge am Pier mitzuteilen, dass es keinen Grund gab, herausgeputzt und ungeduldig trippelnd darauf zu warten, dass von der Allison die Zugangsbrücke herabgelassen wurde. Elinda nahm einen tiefen Atemzug, aber der Nebel verstärkte die Beklommenheit in ihrer Brust nur noch mehr.
Warum freue ich mich nicht?, dachte sie. Heute war der Tag, auf den sie seit zehn Monaten sehnsüchtig wartete. Ihr Bruder würde endlich von einer Reise zurückkehren, von der sie immer geglaubt hatte, dass sie sie gemeinsam erleben würden. Die Grand Tour ins Land ihrer Träume. Italien.
Dabei hatte ihr Vater sie immer daran erinnert, dass diese Reise nicht umsonst auch Kavaliersreise genannt wurde.
»Du bist eben kein angehender Kavalier, Elinda. Du bist ein Mädchen.«
»Aber ich kann alles, was David auch kann!«, hatte sie ihm widersprochen, schon damals, als sie noch viel jünger war. Ihr Vater hatte ihr über den Kopf gestrichen, wie immer, wenn sie ihrem Bruder bei den spielerischen Fechtstunden standhielt oder ihn im Zitieren lateinischer Verse übertrumpfte.
»Du schlaues kleines Mädchen!«
Elinda hatte ununterbrochen von dieser gemeinsamen Reise geträumt. Eines Tages würde ihr Vater einsehen müssen, dass sie denkbar ungeeignet war für das, was von anderen kleinen Mädchen erwartet wurde, wenn sie erst einmal erwachsen wurden. Alles, was sie von ihren Cousinen in dieser Hinsicht lernte, bestärkte sie in dem Verdacht, dass sie nicht dazu gemacht war, in einem weißen Kleid auf Bällen zu tanzen, Rosen zu züchten und Menuette auf dem Klavier zu spielen. Doch diese wohlerzogenen Mädchen in ihrem Umfeld erschienen ihr nur wie eine blasse Vorstufe zum wahren Albtraum der Weiblichkeit.
Ein schreckliches Bild durchzuckte ihre Gedanken. Elinda schüttelte den Kopf und starrte ins Hafenbecken.
Ein scharfer Wind bewegte das Wasser, hob und senkte es an den Docks und den Schiffsrümpfen und zeigte das uralte Gewebe des Meeres – Seepocken, schartige Muscheln, eingerahmt von einer Flut hellgrünen Tangs, die im Hafenwasser wogte. Elinda sah an den hochaufragenden Schiffswänden empor. Diese vom Meer gebeizten Planken hatten so viel mehr von der Welt gesehen als sie und würden noch so viel mehr sehen. Sie wandte den Blick ab und spürte auf einmal wütende Tränen aufsteigen, die sie rasch herunterschluckte.
Warum freue ich mich nicht auf David?, ging ihr durch den Kopf.
Die Menge ringsum wurde ungeduldig, längst schon hätte sich auf der Allison etwas bewegen müssen. Doch die Reling war leer, keine der Luken öffnete sich, und niemand machte Anstalten, die Ladung zu löschen.
»Warum dauert das denn so lange?«, murmelte Elindas Mutter.
In diesem Moment erschien oben an der Reling der Kapitän. Der Mann nahm seinen Dreispitz ab und senkte den Kopf. Da wusste Elinda, dass etwas Schreckliches geschehen war, noch ehe der Kapitän an die Menge gewandt rief.
»An Bord wurde soeben ein Toter gefunden!«
Erschrockenes Raunen übertönte das Möwengemecker, Hände fuhren auf; vor gebürsteten Samtrevers wurde das Kreuz geschlagen. In Elindas Magen schien sich eine Eisschicht zu bilden. Sie fühlte die Hand ihrer Mutter nach der ihren greifen.
»Und da ankert ihr nicht draußen, sondern legt am Pier an?«, brüllte einer aus der Menge.
Der Kapitän hob beschwichtigend die Hände: »Der Tote wurde gerade eben erst entdeckt. Wir werden ihn an Land bringen und die übrigen Passagiere ins Quarantänehaus überführen. Die Mannschaft bleibt an Bord. Wir sollten bald wissen, ob die Todesursache ansteckender Natur ist und dann …«
»Nennt uns den Namen!«, schrie eine Frau. Ihre vor Sorge ausgedünnte Stimme schnitt in Elindas Gehör. Die Frau war genau wie ihre Mutter fein gekleidet, wartete ebenso auf einen Sohn oder Ehemann, und auch sie schien insgeheim etwas Böses zu befürchten.
Der Kapitän hob ein Stück Papier. »Der Name des Toten lautet Lester Pellingham!«
Elinda atmete auf.
»Gott sei’s gedankt«, flüsterte ihre Mutter und ließ ihre Hand los.
Ihr Vater allerdings zog scharf die Luft ein. »Pellingham ist einer von Davids Reisegefährten.«
Bérénice sah ihren Mann besorgt an. »Robert, wenn es also eine ansteckende Krankheit wäre …«
»Weiß man’s? Der Gesündeste war Pellingham nun allerdings auch wieder nicht. Er hatte doch dieses Lungenleiden. So etwas passiert nun einmal, vor allem auf Reisen, Gott hab ihn selig.«
»Man wird nun den Weg zum Quarantänehaus freimachen!«, rief der Kapitän der Menge entgegen. »Schafft Platz, ihr guten Leute!«
Einige folgten der Aufforderung sofort. Sie mochten miterlebt haben, wie grassierende Seuchen in diesem Hafen an Land gekommen waren. Andere machten nur widerwillig murrend Platz.
»Ich werde nicht nach Hause gehen, ehe ich nicht einen Blick auf David geworfen haben«, beschloss Bérénice.
Elinda hätte ihrer Mutter noch bis vor Kurzem zugestimmt. Doch nun bemerkte sie erschrocken, dass ihre Erleichterung auch die Tatsache umfasste, David nicht zu sehen. Noch nicht.
Ihn nicht zu sehen, bedeutete einen Aufschub jenes Augenblicks, auf den Elinda sich geglaubt hatte zu freuen. Doch nun spürte sie die Schwingungen einer unerklärlichen Furcht. Was, wenn die Kluft dieser zehnmonatigen Trennung sich nicht schließen ließ? Wenn der junge Kavalier nichts mehr anfangen konnte mit seiner daheimgebliebenen Schwester, deren aufregendstes Erlebnis ihr Debütantinnenball im Februar gewesen war. Trotzdem schlich sich ein triumphierendes Lächeln in ihr Gesicht. Wenn sie David erst erzählen würde, wie sie nach dem Ball all die hoffnungsvollen Bewerber vergrault hatte, würden sie sich zusammen vor Lachen biegen, und er würde sie beglückwünschen, dass sie in seiner Abwesenheit nicht zu einer anständigen Frau geworden war.
Einer anständigen Frau. Ihre Mundwinkel ließen das Lächeln wieder fallen, als wäre es zu schwer geworden.
Männer vom Hafenamt und einige Polizisten machten sich nun daran, die Menge zu zerstreuen. Eine Absperrung wurde errichtet, doch die Menschen blieben dicht dahinter stehen. Niemand ließ es sich nehmen, wenigstens einen fernen Blick auf die Heimgekehrten zu werfen.
Elindas Blick wurde plötzlich von einer Gestalt am Rand der Menge angezogen.
Ein Mann stand gegen eine der Laternen gelehnt. Ein schäbiger Dreispitz verdeckte einen langen Zopf, der auf den schwarzen Kutschermantel hing. Sein wettergegerbtes Gesicht und die breiten Schultern verrieten den Seemann. Doch in der ruppigen Erscheinung lag etwas, das Elinda irritiert den Blick auf ihm verharren ließ. Etwas Feines, das nicht zu dem grobschlächtigen Gesamteindruck passen wollte. Seine ruhige und zugleich wie in höchster Konzentration gespannte Haltung kam ihr vage bekannt vor, doch sie hätte nicht sagen können, wo sie ihn schon einmal gesehen hatte. Was für ein absurder Gedanke. Wo sollte ihr, der überbehüteten, abgeschirmten Tochter aus gutem Hause ein solch finsterer Kerl begegnet sein?
Elinda spürte eine Berührung an der Hand. Robert Audley hatte sich den Gehstock unter den Arm geklemmt, nahm Frau und Tochter bei den Händen und zog sie zu den Stufen an der Seite einer der Warenlager. Von hier aus eröffnete sich ihnen ein guter Blick auf das Schiff. Es schien Ewigkeiten zu dauern, ehe sich an Deck etwas bewegte. Dann flogen von der Reling Taue herab, die von den schwieligen Händen der Hafenarbeiter aufgefangen wurden. Schließlich ließ man an einer Seilwinde ein breites Brett herab. Darauf festgeschnürt lag ein menschlicher Umriss unter einem Laken. Die Menge bekreuzigte sich erneut, und von den Taubündeln und Pfosten aus beäugten die Möwen das Geschehen. Elinda sah das Gelb ihrer Augen und das gefräßige Bedauern darin.
Robert Audley stützte sich auf seinen Stock und erläuterte seiner Familie das Prozedere. »Im schlimmsten Falle bleiben die Passagiere zwei Wochen im Quarantänequartier. Die Angehörigen können für bessere Verpflegung bezahlen. Man kann auch für frisches Bettzeug aufkommen und Bücher schicken. Wenn in dieser Frist keine Anzeichen für eine Seuche auftauchen, darf man gehen.«
An der Reling wurde eine Planke angebracht, kurz darauf erschien das Gesicht des ersten Passagiers. Nach einem Moment gespannter Stille bahnte sich ein erschrockenes Raunen durch die Menge.
»Der Mann ist ja bleich wie der Tod«, stellte Bérénice fest.
»Das … das scheint Lord Ruthwen zu sein«, erkannte Robert Audley den Mann.
Elinda warf ihrem Vater einen Blick zu. »Er war doch auch ein Begleiter von David, nicht wahr?«
Sie konnte sich noch gut an die vier Lords erinnern, die vergangenen Mai zum Dinner nach Thornton Hall eingeladen worden waren, um ihren Schützling David persönlich kennenzulernen. Die erhabene Selbstverständlichkeit, die sie ausstrahlten und das gönnerhafte Lächeln, als ihr Vater ihnen seine bescheidene Sammlung antiker Marmorbüsten zeigte. Und an das Zittern in Elindas Bauch, weil sie erfolglos vorgetäuscht hatte, sich für ihren Bruder zu freuen.
»Miss Audley, auch Ihr werdet eines Tages den Kontinent sehen«, hatte Lord Pellingham sie aufgemuntert. »An der Seite Eures Ehemanns.«
Was ein Trost hätte sein sollen, hatte in Elindas Ohren geklungen wie eine Drohung.
Lord Henry Ruthwen, der sich eben den Laufsteg nach unten tastete, war im Mai letzten Jahres ein kräftiger Mann mit rosigen Wangen gewesen. Nun erinnerte er an ein Gespenst, wie er über die Planke tapste. Hinter Ruthwen tauchten weitere Passagiere auf, doch diese sahen bedeutend gesünder aus.
»Das wird doch die Seekrankheit sein, nicht wahr?« Bérénice nestelte an ihrem Taschentuch herum. Sie bekam keine Antwort.
Elinda wusste nicht, warum, aber ihr Blick ging immer wieder zu dem Mann mit dem schwarzen Mantel. Er lehnte immer noch an der Laterne, aber in seiner Haltung lag nun etwas Lauerndes, Alarmiertes.
Am Hafen warteten Kutschen, die je sechs der Passagiere in die Quarantänehäuser bringen würden. Die Kutscher hatten sich Tücher über Mund und Nase gezogen. Ihre Pferde tänzelten nervös. In der Menge hoben sich winkende Hände. Namen wurden gerufen, Grüße und Fragen drangen auf die Neuankömmlinge ein, doch nur wenige schienen die Worte ihrer Angehörigen zu hören.
David war nicht unter ihnen.
Elinda biss sich auf die Unterlippe. Die Anspannung schnürte ihr den Hals zu.
Ein sehr bleicher Mann wurde nun schlaff von zwei anderen in die Mitte genommen und auf die Planke geführt. Unter Aufbietung letzter Kräfte ging der Mann hinab. Kaum berührten seine Füße den Pier, sank er zu Boden. Die Menge zuckte zusammen, als hätte ein Peitschenhieb sie getroffen. Man brachte den Bewusstlosen rasch in eine der Kutschen, die ruckartig anfuhr und davonrollte.
Elindas Herz pochte schmerzhaft. Sie suchte den Blick ihres Vaters. Er umklammerte den Griff seines Gehstocks, dass die Knöchel weiß hervortraten.
»Und das war Lord Algernon Charswick, nicht wahr?«, fragte Elinda. »Derjenige, der hauptsächlich für Davids Reise bezahlt hat?«
Weil die Audleys nicht die Mittel dazu haben, fügte sie in Gedanken an. Weil das Familienvermögen nicht ausreichte, um den einzigen Sohn auf seine Kavaliersreise zu schicken. Diese Reise, die dafür sorgte, dass David danach ein guter Posten in der Politik offenstand. Die Grand Tour bedeutete nicht nur die Besichtigung der ehrwürdigen antiken Stätten, sondern hauptsächlich den letzten Schliff an einer Erziehung, die aus Söhnen hoher Familien vollendete Gentlemen machte, versehen mit der Einsicht in fremde Sitten, Sprachen und diplomatische Kenntnis und ausgestattet mit einem Blick auf die tieferen Zusammenhänge im Weltgefüge. Männern, die ihre Kavaliersreise absolviert hatten, standen gesellschaftliche Türen offen, die anderen verschlossen blieben. Erst recht für einen Jungen wie David Audley, der nur noch dem Namen nach ein höhergestellter Sohn war.
Elindas Vater starrte der Kutsche mit Lord Charswick hinterher, und nun war auch er sehr blass.
Elindas Blick schweifte erneut zu dem Mann im schwarzen Kutschermantel. Er schaute mit gesenktem Kopf auf einen Zettel in seiner Hand, ehe er aufsah und das Verschwinden der letzten Kutsche verfolgte. In seinen dunklen Augen lag immer noch der merkwürdige lauernde Ausdruck, der so wenig zu der aufgewühlten Situation passte.
Bérénice packte ihren Mann am Ärmel. »David kommt doch, oder? Du hast den Brief gelesen, in dem er ankündigte, dass er dieses Schiff nimmt, nicht wahr?«
»Aber sicher doch …«
»Wo ist er dann? Warum ist er nicht bei den Männern, mit denen er gereist ist?«
»Er kommt bestimmt noch«, murmelte Robert Audley zerstreut.
Doch an der Reling wurde nun eilig die Gangway zurückgezogen, während am Hafen die letzte schwarze Kutsche davonrollte. Der Kapitän warf noch einen Blick über die Menge, ehe er mit seiner Besatzung unter Deck verschwand.
Elindas Herz zog sich zusammen. »David war nicht an Bord. Oder er hat sich auf der Reise so verändert, dass wir ihn nicht wiedererkannt haben.«
»Unsinn!«, fauchte Bérénice. »Dann hätte er doch uns wiedererkennen müssen.«
Sie warf Elindas hellblauem Mantel, mit dem sie wie ein Wellensittich aus der Menge herausleuchtete, einen vorwurfsvollen Blick zu, als wäre das alberne Kleidungsstück schuld an allem.
»Dafür muss es eine Erklärung geben«, sagte Robert Audley, der immer eine Erklärung für alles suchte und meistens auch eine fand. »Vielleicht hat der dumme Junge die Abfahrt verpasst. Er wird mit dem nächsten Schiff kommen.«
Elinda schloss die Augen. Ihr Atem fühlte sich an, als würde kalter Sand in ihr Inneres dringen.
Ein Gedanke fuhr wie ein Stachel in die widerstreitenden Gefühle.
Was, wenn sie David nie wiedersehen würde?
2
Als sie vor dem Quarantänequartier ankamen, konnte Elinda sich einmal mehr davon überzeugen, dass ihr Vater auf Fremde eine Autorität wirken ließ, die weitaus mehr bestach als ein Samtrock nach der neuesten französischen Mode.
»Ich verlange augenblicklich mit den Männern zu sprechen, die gerade eben durch diese Tür gebracht wurden!«
Robert Audley deutete auf die Holztür in der weiß gekalkten Fassade des kasernenartigen Gebäudes, das am Ende des Hafens zwischen Bootsschuppen und einer ruinösen Werft lag. Krähen hockten auf dem flachen Dach, als hätten sie mit den Möwen heimlich eine Wachablösung vereinbart.
»Es ist von allergrößter Dringlichkeit. Ihr seid also bitte so freundlich?«
Audleys Tonfall verriet keinen Zweifel darüber, dass er es gewohnt war, andere nach seinen Wünschen handeln zu sehen. Der Wachsoldat zögerte nur kurz, ehe er sich mit einem Mann im Wachhäuschen gleich neben der Tür besprach.
»Sie lassen die Besucher nicht näher als vier Meter an die vergitterten Fenster heran«, murmelte Robert Audley. »Das Essen und die Kleidung muss man den Insassen mit einer Stange reichen.«
»Wie furchtbar würdelos.« Bérénice atmete schwer unter der ungewohnten Anstrengung, ihr Zimmer in Thornton Hall zu verlassen, wo sie die meiste Zeit matt auf einer Récamiere verbrachte und nicht die Kraft aufbrachte, dafür zu sorgen, dass Elinda ein Korsett trug oder David seinen täglichen Apfel aß. Sie hatte nicht einmal bemerkt, dass ihr Dienstmädchen nicht mehr hinter den Vorhängen fegte, sodass dort eine Maus ihr Nest gebaut hatte. Elinda hatte es entdeckt, jedoch nichts gesagt.
»Wie willst du auf diese Entfernung etwas von ihnen erfahren?«, fragte Elinda ihren Vater nun. »Die Mylords sind sicher zu schwach, um so laut zu sprechen.«
»Wir müssen es versuchen. Aber ich werde allein gehen. Du und deine Mutter …«
»Das kommt nicht infrage«, unterbrach Bérénice ihn. Es war das erste Mal, dass Elinda ihre Mutter ihrem Vater widersprechen hörte.
Kurz darauf wurden sie von einem Krankenwärter empfangen. Der Mann hatte ein weißes Tuch um Mund und Nase geschlungen und empfahl ihnen, mit ihren Halstüchern ebenso zu verfahren. Robert Audley nannte die Namen von Davids Reisegefährten.
»Die Lords Ruthwen, Charswick und Veland. Ich nehme doch an, sie wurden zusammen und gesondert von den anderen untergebracht?«
Der Mann blätterte in einigen Papieren, die auf einem Holzbrett befestigt waren. Dann bedeutete er ihnen, ihm zu einem Gebäude auf der Rückseite des Areals zu folgen. Mittlerweile waren weitere Angehörige vom Pier am Quarantänequartier angekommen. Lautes Rufen und drängende Fragen wogten auf und ab. Elinda war so durchgefroren, dass sie ihre Finger kaum noch spürte, und sie wurde das Gefühl nicht los, mit diesem salzigen Nebel gleichzeitig etwas Unheilvolles einzuatmen, das sich in ihrem Innern einnisten und sie nie wieder loslassen würde.
Vielleicht schmeckte so die Zukunft. Eine Zukunft ohne David.
»Und David Audley?«, fragte sie den Wärter. »Steht sein Name auf der Liste?«
Ehe ihr Vater sie für ihren Vorstoß zurechtweisen konnte, warf der Wärter einen weiteren Blick auf seine Liste und schüttelte den Kopf.
»Nein. Keiner dieses Namens. Aber wir haben noch nicht alle erfasst. Kann dauern. Wollt Ihr die armen Teufel nun sehen oder nicht?«
Robert Audley nickte bestimmt. Sie wurden zu einem vergitterten Fenster knapp oberhalb der Erde geführt, hinter dem ein dunkler Raum lag. Eine weiße Schnur war in einigem Abstand vor dem Fenster aufgespannt.
»Näher heranzutreten ist untersagt«, warnte der Mann. »Macht Euch nicht zu viele Hoffnungen. Einer von denen ist … nun, hat seine Seele bereits Gott anbefohlen.«
»Ihr meint Lord Pellingham«, vermutete Robert Audley. »Der wurde ja schon vorhin tot auf dem Schiff gefunden.«
»Nein, Sir, nicht der.« Der Wärter schien sich zu freuen, Audley widersprechen zu können. »Will damit sagen, von den dreien, die hier ankamen, leben noch zwei.«
Bérénice blickte in den trüben Himmel hinauf und presste die Lippen zusammen.
Elindas Mitleid für die Männer hielt sich in Grenzen. Aus Davids Briefen wusste sie, was für eine Sorte Mensch diese vier Lords waren, und sie hatte Mühe, sich nicht anmerken zu lassen, dass ihr Zustand sie nicht sonderlich bekümmerte.
Robert Audley nahm an der weißen Markierung Aufstellung. Elinda trat neben ihn. Ihr Körper spannte sich in einer Mischung aus Angst und einer seltsamen morbiden Neugier.
»Denkst du, Lord Charswick wird sich die Blöße geben, mir Auskunft zu geben, wenn du dabei hockst wie ein Huhn?«, zischte ihr Vater.
»Charswick wird schlimmere Sorgen haben«, gab Elinda zurück.
Sie hatte in den vergangenen zehn Monaten eine gewisse Übung darin erlangt, ihrem Vater zu widersprechen. Doch lange würde ihr Widerstand nicht mehr bestehen können, das ahnte Elinda. Sie wusste, was auf sie zukam. Der Albtraum der Weiblichkeit. Wer mochte wissen, wie lange sie noch die Gelegenheit hatte, sich aufzulehnen? So sehr ihr die Sorge um David das Herz einengte, genoss Elinda die Weite der Schlupflöcher, die ihre Erziehung ihr gestattete. Widersprechen. Nicht gehorchen müssen. Es fühlte sich so gut an.
Plötzlich erschien hinter den Gittern ein Gesicht. Kreidebleich, fast grau, mit fiebrig glänzenden, unsteten Augen.
»Meine Güte, Charswick!«, stieß Robert Audley hervor. »Was ist Euch bloß widerfahren?«
»Wo ist David?«, drängte Bérénice sich vor.
»Verloren … Euer Junge ist verloren.« Lord Charswicks Stimme war kaum mehr als ein heiseres Flüstern.
Elinda presste die Fingernägel in ihre Handflächen. Am liebsten hätte sie den ausgemergelten Mann durch die Gitter hindurch geschüttelt.
»Was sagt Ihr da?« Ihr Vater beugte sich vor. »Ihr müsst ein wenig lauter sprechen. David, verloren? Was meint Ihr damit? Ist mein Sohn verstorben?«
»Das ist unmöglich!«, herrschte Bérénice den Mann an. »Erst vorgestern kam noch ein Brief von ihm aus Calais.«
Charswicks weiße Finger suchten Halt an den Gitterstäben. Seine Augen fielen zu, mühsam zwang er sie wieder auf. »Ihr müsst mir verzeihen, Audley. Wir konnten ihn nicht beschützen. David … wir haben ihn verloren. In Pompeji. Ich wollte es Euch sagen, wenn wir zurück sind. Bitte glaubt mir.«
Elinda zuckte zusammen. Pompeji.
Längst war bekannt, dass die uralten Mauern, die vor einigen Jahrzehnten am Golf von Neapel aus der Vulkanasche gegraben wurden, zu der legendären antiken Stadt gehörten. Jener Stadt, die im Jahr 79 nach Christus bei einem Ausbruch des Vesuvs unter einer meterdicken Schicht aus Asche begraben worden war und mit ihr Menschen, Tiere, Schätze, Fresken, Marmorskulpturen und die Alltagsgegenstände eines Lebens, das vor achtzehn Jahrhunderten von einem Moment auf den nächsten ausgelöscht worden war.
David hatte in seiner Vorfreude auf die Grand Tour die Reiseberichte und Gemälde studiert, die englische Reisende der Öffentlichkeit zugänglich machten. Allen voran der englische Botschafter in Neapel, Sir William Hamilton, der der Royal Society in London seine Forschungsarbeiten über Pompeji und der Gegend um den Vesuv geschickt hatte. David und Elinda hatten diesen Bericht so genau studiert, dass die Seiten zerfledderten. Aber nur David durfte die Ungeduld spüren, die majestätische Tragik dieses Ortes bald selbst zu erleben. Elinda hatte diese Tatsache so wehgetan, dass sie Hamiltons Schrift am liebsten in den Kamin geschleudert hätte.
Sie beneidete ihren Zwillingsbruder um alles, was er auf seiner Kavaliersreise sehen würde. Frankreich, die wilden Schweizer Alpen, das geheimnisvolle Venedig, die herrlichen Stätten der Renaissance, natürlich Rom mit seinen kolossalen Ruinen sowie Neapel, die im süßen südlichen Licht badende Stadt am Vesuv. Aber es war das über Jahrhunderte aschetote und nun langsam ans Licht kommende Pompeji, um das sie ihn am meisten beneidete.
Und nun sagte dieser zu einem lebenden Gespenst geschwächte Mann, sie hätten David in Pompeji verloren.
»Erklärt Euch, Charswick!«, drang Robert Audley auf den Kranken ein.
Der griff sich an den Hals. Seine Adern zuckten dunkel unter der bleichen Haut. Er holte qualvoll Luft. »Ich kann nicht. Es ist ein Fluch … wir sind alle verflucht.«
»Was soll das heißen?«, fuhr Elinda dazwischen. »Habt Ihr etwas von dort mitgenommen?«
Sie dachte an die Legende, die besagte, dass es Unglück brachte, wenn man etwas aus den Ruinen von Pompeji mitnahm. Selbst der kleinste Lavabrocken oder ein Steinchen aus den antiken Bodenmosaiken, ganz zu schweigen von Gegenständen oder Teilen der Wandmalereien sorgte dafür, dass der Dieb fortan von Unfällen und Krankheiten heimgesucht wurde. In den Berichten englischer Reisender wurde dieser Fluch natürlich belächelt. Vor allem da man ihm die Frage gegenüberstellen musste, warum er nicht auch die neapolitanischen Könige traf, die die Ruinen Pompejis bekanntlich wie Raubgräber hatten ausplündern lassen. Die wertvollen Skulpturen und Wandmalereien waren in die königlichen Prunkräume gewandert, die Alltagsgegenstände und kleineren Kunstwerke in ein Museum in Portici. Vieles war aber auch einfach auf dem Müll gelandet.
Vielleicht traf dieser Fluch nur Normalsterbliche.
»Hat David etwas mitgenommen aus Pompeji?«, formulierte sie die Frage um.
In dieser beängstigenden Situation schien es Elinda das Naheliegendste, was sie hätte fragen können.
Charswick hustete. »Wir haben alle … etwas von dort mitgenommen.«
Ihr Vater machte eine unwirsche Handbewegung, um Elinda zum Schweigen zu bringen. »Was ist meinem Sohn zugestoßen? Nun redet schon! Ist in Pompeji etwas passiert, von dem wir nichts wissen? Warum hat David uns nicht davon geschrieben?«
Hinter Charswick ertönte in der finsteren Kammer ein röchelndes Husten, und jemand, wahrscheinlich Lord Veland, stammelte: »Lüg den Mann nicht an, Henry. In Rom haben wir den Bengel verloren. Das Fieber …« Ein heiseres Kichern ertönte und wurde von einem Hustenanfall erstickt. »Haben den Jungen aber anständig begraben.«
Elinda erstarrte. In ihrem Kopf türmten sich die Fragen, doch ihr Mund blieb stumm.
Ihre Mutter machte Anstalten, hinter die Absperrung zu treten. »Was sagt Ihr da?«
Robert zog sie am Arm zurück. Er war mit einem Mal leichenblass.
»Du hast sie doch gehört, Bérénice, ein Fieber hat ihn …«
»Audley, nein«, keuchte Lord Charswick. »Der Pompejanische Fluch hat ihn ereilt, wie uns alle. Wir hätten es wissen müssen. Der Junge büßt für unsere Sünden. Die Rachegöttinnen kennen kein Erbarmen.«
Es machte den Anschein, als würde der Mann sich kurzzeitig erholen, seine Worte klangen klar, sogar sein Blick öffnete sich ein wenig. Doch schon im nächsten Moment sackte er wieder hustend zusammen. Etwas Schwarzes tropfte von seiner Unterlippe.
Furchtbare Bilder schwärmten plötzlich in Elindas Gedanken aus.
David, wie er, ebenfalls schwarzes Blut aushustend, in einer römischen Herberge zusammengekrümmt auf einem Bett sein Leben aushauchte. David, wie er vom Fieber geschüttelt irgendwo in einem Gasthaus bei Pompeji lag und nach seiner Mutter rief, kein angehender Kavalier mehr, nur noch ein verlassenes Kind.
Aber das konnte nicht stimmen. Ihr Bruder hatte ihnen Briefe geschrieben von seiner Rückreise durch die Toskana, Venedig, die Alpen und Frankreich.
»Was in Gottes Namen …?« In Robert Audleys Stimme hatte sich eine Schwingung eingeschlichen, die Elinda noch nie gehört hatte, nicht einmal an dem schrecklichen Tag vor fünf Jahren, als sie ebenfalls am Hafen von Dover auf ein Schiff warteten, das aber nicht kam. Die Waren aus Vaters Pachtplantage auf Jamaika, seine ganze finanzielle Hoffnung – verloren auf dem Meeresgrund.
Elinda wurde schwindelig. Die Kälte schien nicht mehr rings um sie zu sein, sondern aus dem vergitterten Verlies zu strömen, in dem man Davids Reisebegleiter zum Sterben sich selbst überlassen hatte.
Robert Audley versuchte noch einmal, Lord Charswick eine Erklärung zu entlocken, aber dieser presste ein Taschentuch gegen seinen Mund und schloss die Augen. Seine andere Hand löste sich von den Gitterstäben und wanderte zu seiner Rocktasche. Er nestelte etwas daraus hervor und legte es auf den Boden vor die Fensteröffnung. »Das hier … ist der Ursprung des Fluchs.«
Elinda konnte nicht erkennen, was es war. Ein unförmiges, dunkelgraues Ding, wie geschmolzenes Metall. Robert Audley forderte Charswick auf, es zu ihm hinüber zu werfen, doch der Mann sank mit einem Seufzen zu Boden.
»Betet für meine Seele …«
Aus der Zelle ertönte nur noch ein leises, gequältes Husten. Das finstere Fensterloch schien auch Elindas Lebenskraft einzusaugen. Doch sie schüttelte die Lähmung ab. Zwei rasche Schritte, und sie war an der vergitterten Öffnung, ergriff das metallene Etwas und trat schnell wieder zurück. Doch nicht schnell genug. Etwas drang zwischen zwei ihrer Wimpernschläge. Die leblosen Leiber der drei Männer, die ihren Bruder zehn Monate lang begleitet hatten. Drei Männer, einstmals pfauenstolz in ihren eleganten Seidenröcken, Brokatwesten und schneeweißen Perücken, knallenden Schnallenschuhen und ihrer Selbstsicherheit, so straff wie Segel voll Wind. Drei Männer, die nun schlaff in der Hand des Todes hingen. Elinda hatte keine Angst vor einer möglichen Ansteckung.
Sie hatte nur Angst um David.
Unwirsch nahm ihr Vater ihr das metallene Ding ab und betrachtete es stirnrunzelnd. Es war nicht größer als ihre Handfläche und schien einmal eine quadratische Form gehabt zu haben. Er schob seinen Fingernagel zwischen die Schichten des aufgeworfenen Randes. Die Oberfläche war schartig und hatte drei kleine Durchbrüche.
»Was ist das?«, fragte Elinda.
Robert Audley hob es hoch und kniff die Augen zusammen. »Ich habe so etwas bisher nur einmal gesehen, damals in Rom, bei einer Ausgrabung auf dem Forum. Man wusste nichts damit anzufangen und warf es zu den Scherben. Vielleicht eine Art geschmolzene Hülle – wie soll man das nach all den Jahrhunderten wissen?«
Elinda wollte nicht glauben, dass Lord Charswick einer geschmolzenen Hülle, und mochte sie auch noch so alt sein, eine derartige Bedeutung beimaß.
Bérénice wandte sich mit einem sichtbaren Schaudern ab. »Was, wenn daran diese schreckliche Krankheit klebt? Oder der Fluch, von dem Lord Charswick sprach?«
»Die Krankheit könnte wohl daran kleben«, sagte Robert Audley. »Aber schwerlich ein Fluch. Elinda, lass die Hände aus dem Gesicht, bis du sie dir waschen kannst.«
Bérénice schnappte nach Luft. »Gott bewahre, Elinda! Warum musstest du das schauderhafte Ding auch anfassen? Robert, was meinte Lord Charswick mit diesem Fluch?«
Auf ihrem blassen Gesicht blühten die roten Blumen ihrer hektischen Sorge.
Robert Audley schüttelte brüsk den Kopf. »Wir sind Engländer. Wir glauben nicht an Flüche.«
3
»Wenn ich mir erlauben darf, Lady Audley, Sir Audley, aber an dem Gegenstand in Eurer Hand haftet durchaus ein Fluch.«
Die Stimme war ganz nah hinter ihnen. Elinda und ihre Eltern fuhren herum.
Da stand er. Der abgerissen wirkende Mann vom Hafen. Ehe Elinda sich fragen konnte, warum er ihre Familie ansprach, spürte sie wieder die eigenartige Faszination, die schon aus der Ferne von ihm ausgegangen war. Er war ein Mann Mitte dreißig und strahlte etwas Junges, gleichzeitig aber auch Altes aus. Etwas Wildes, Raues umfasste seine edlen Gesichtszüge wie ein grob zusammengezimmerter Rahmen für ein wertvolles Gemälde.
Erneut wurde Elinda das Gefühl nicht los, den Mann von irgendwoher zu kennen.
Robert Audley blinzelte überrascht und wollte etwas erwidern, doch von einer Sekunde auf die nächste erstarrte seine Miene vor Abscheu und Ablehnung.
»Dass Ihr es wagt, Euch anständigen Leuten zu nähern!«
Doch der Mann schien derartige Erwiderungen entweder gewohnt zu sein, oder sie glitten an ihm ab wie der nun einsetzende Regen auf seinem gewachsten Mantel.
»Nun, Sir Audley, Euresgleichen haben dafür gesorgt, dass ich nur noch unter unanständigen Leuten mein Brot verdienen kann. Aber bisweilen haben auch die Anständigen unter Euch Sorgen, derer ich mich annehmen kann.«
Elinda wusste, was man von ihr verlangte. Sie sollte sittsam den Kopf senken und abwarten, bis ihr Vater das Gespräch für beendet erklärte. Aber sie war zu irritiert von dem Auftauchen des Fremden, seiner gewählten Ausdrucksweise und seinem Selbstbewusstsein, als dass sie wie ein schüchternes Mädchen ihre Schuhspitzen angestarrt hätte.
»Warum glaubt Ihr, dass wir Sorgen haben?«, fragte sie ihn.
Ihre Mutter stieß ihr warnend gegen den Rücken, doch Elinda ignorierte es.
Der Mann streifte sie mit einem Lächeln, ehe er wieder ihren Vater ansah.
»Sir Audley, wenn ich richtig gesehen habe, vermisst Ihr Euren Sohn David. Er war nicht an Bord der Allison. Und seine Begleiter sind nicht mehr in der Lage, Euch Auskunft über seinen Verbleib zu geben.«
»Wisst Ihr etwa, wo mein Sohn abgeblieben ist?«, blaffte Robert Audley. »Und ich warne Euch!« Er trat einen Schritt auf den Fremden zu und starrte ihn feindselig an. »Wenn Ihr es wisst, dann sagt Ihr es besser. Oder wollt ihr etwa Eurem Ruf Ehre machen und für diese Information Geld verlangen?«
Der Mann erwiderte Audleys Blick gelassen, doch etwas Trauriges huschte durch seine Augen.
»Nein. Ich weiß nicht, wo Euer Sohn abgeblieben ist. Aber ich weiß, dass dieses Artefakt in Euren Händen ein antikes Fluchtäfelchen ist.« Er deutete auf das metallische Etwas zwischen Audleys Fingern. »Damit riefen die alten Griechen und Römer die Götter der Unterwelt an, um anderen Menschen Schaden zuzufügen, ihnen Krankheit und Tod zu wünschen.«
Für einen Moment schimmerte Neugierde in Robert Audleys Blick auf.
»Das hat Lord Charswick doch gemeint«, sagte Bérénice mit unpassender Genugtuung. »Ein Fluch hat diese Männer getötet und David womöglich auch!«
»Es gibt keine Flüche«, sagte der Mann. »Aber fragt Ihr Euch nicht, warum Lord Charswick und Lord Veland glauben, dass von diesem Täfelchen eine böse Kraft ausgeht?«
Elinda kannte ihren Vater gut genug, um zu wissen, wie sehr ihn die Worte des Mannes in die Enge trieben. Robert Audley war seit jungen Jahren oft in Italien gewesen, hatte die Ausgrabungen der Villa des Kaisers Hadrian gesehen, war in Pompeji und sogar in Sizilien gewesen und hatte einen Großteil seines Geldes für antike Marmorskulpturen aufgewendet, bevor sein Vermögen in die jetzige Schieflage geriet. Er galt als versierter Altertumskenner und Kunstsammler, und es gab nur wenige, die ihm in Geschichtskenntnis das Wasser reichen konnten. Und nun stand dieser schäbig gekleidete und offenbar schlecht beleumundete Kerl vor ihm und erklärte ihm, was das rätselhafte metallische Ding war, das eben aus Lord Charswicks sterbenden Händen geglitten war.
»Ich frage mich viel eher«, griff Robert Audley die Worte des Mannes auf, »was Euch das überhaupt angeht. Habt Ihr keinen Schmuggler, dem Ihr mit Eurem unseligen Talent zur Hand gehen könnt oder sonst eine zwielichtige Aufgabe?«
»Doch«, erwiderte der Mann ruhig. »Aber ich bin vielleicht der Einzige, der Euren Sohn aufspüren kann.«
»Was erdreistet Ihr Euch?«, blaffte Robert Audley. »Glaubt Ihr im Ernst, ich erwäge auch nur eine Sekunde, Euch …«
»Vater, vielleicht solltest du ihn aussprechen lassen«, entfuhr es Elinda.
»Sei still!«, zischte Bérénice.
»Nein, ich bin nicht still«, hielt Elinda dagegen. »Ich will wissen, was mit meinem Bruder geschehen ist. Wenn dieser Herr uns nun helfen könnte …«
»Elinda, ich muss doch sehr bitten!«
Ihr Vater starrte sie an, als hoffte er, die Kräfte der Medusa zu erlangen, doch in diesem Moment fiel es Elinda wie Schuppen von den Augen.
»Ich weiß, wer Ihr seid!« Sie sah dem Mann offen ins Gesicht, ihr Herz pochte vor Aufregung schneller. »Ihr wart hier am Hafen, als mein Bruder im Juli letzten Jahres aufbrach.«
Das Bild stand ihr nun ganz deutlich vor Augen. Sie war bei David am Pier gewesen und hatte mühsam ihre Tränen heruntergeschluckt. Das Gepäck wurde gerade verladen, und Robert Audley hatte seinem Sohn noch ein paar letzte gute Ratschläge mit auf den Weg gegeben. Da war Davids Blick plötzlich an einem Mann in der Menge hängen geblieben, und in seine Augen war ein Ausdruck getreten, den Elinda noch nie an ihm gesehen hatte.
»Siehst du den Kerl mit dem schwarzen Kutschermantel da drüben?« David hatte ihre Hand gepackt und sie auf einen Mann aufmerksam gemacht, der am Rand der Menge auf irgendjemanden zu warten schien.
»Was würde ich drum geben, mit ihm zu reisen und nicht mit diesen vier bornierten Lords«, hatte David gesagt und geseufzt.
»Wer ist er?«, wollte Elinda wissen.
»Das ist Blake Colbert. Ich habe dir doch von ihm erzählt. Der berühmteste bearleader aller Zeiten.« Davids Augen hatten geleuchtet, und er konnte den Blick kaum losreißen von dem Mann, der jedoch nicht den Anschein machte, als würden adelige Familien ihre Söhne für Kavaliersreisen in seine Obhut geben.
»Er ist ein Abenteurer, der nicht bloß lehrmeisterlich die historischen Stätten besichtigen lässt«, hatte David erzählt. »Ich habe gehört, dass er eigenhändig drei Piraten vor Genua mit dem Säbel den Garaus gemacht hat. Er kennt überall in Italien interessante Leute und geheimnisvolle Orte, die man normalerweise nicht zu sehen bekommt.«
David besuchte damals das Royal College of St. Peter, und dort hatten ihm Mitschüler die Geschichten über Blake Colbert erzählt, die sie wiederum von ihren großen Brüdern hörten. Elinda hatte damals kein Ohr für die Abenteuer des bearleaders gehabt und seinen Namen gleich wieder vergessen. Überhaupt fand sie den Begriff – Bärenführer – ziemlich unpassend für die verantwortungsvolle Aufgabe eines Tutors, der im Ausland auf junge Männer achtgeben musste. Doch seit in einer englischen Zeitschrift einmal die Karikatur eines solchen Tutors mit seinem Schützling in Gestalt eines jungen Bären in extravaganter Kleidung erschienen war, hatte sich der Begriff etabliert.
Als Davids Begeisterung über Blake Colbert so kurz vor seiner eigenen Grand Tour wieder aufflammte, hatte Robert Audley seinen Sohn entrüstet zurechtgewiesen.
»Du weißt ja nicht, was du da redest. Was glaubst du wohl, warum der Kerl hier so zwielichtig am Hafen herumlungert? Mein Junge, selbst wenn ich alles Geld der Welt hätte – niemals würde ich dich ihm anvertrauen. Sei dankbar für die vier guten Männer, mit denen du reisen wirst.«
Elinda war vom Abschiedsschmerz zu überwältigt gewesen, um den geheimnisvollen Fremden näher wahrzunehmen. Doch nun, da ihr diese Szene wieder einfiel, schien es, als würde dieser Mann aus der Vergangenheit heraus nach ihr greifen.
»Natürlich stand er damals am Hafen herum!«, blaffte Robert Audley nun in Elindas Richtung. »Leute wie er haben nämlich nichts Besseres zu tun, als sich den schändlichsten Kreaturen anzudienen, um sich für Dinge bezahlen zu lassen, für die man Euch hängen könnte, Mister Colbert!«
Blake Colbert blieb gelassen. »So schlimm ist es nun auch wieder nicht.«
»Bleibt mir aus den Augen, habt Ihr gehört?« Robert Audley warf Elinda einen auffordernden Blick zu und reichte Bérénice seinen Arm. »Und wagt es nie wieder, mich in der Öffentlichkeit anzusprechen.«
Er ergriff Elindas Hand und zog sie mit sich. Sie warf noch einen Blick über die Schulter zurück. Blake Colbert schien keineswegs erschüttert zu sein über Audleys harte Worte.
»Wenn Ihr es Euch anders überlegt, Sir Audley, Ihr erfahrt gewiss, wo man mich findet«, rief er den Davoneilenden hinterher.
»Vater, warum lässt du ihn so stehen?«, protestierte Elinda. »Was ist, wenn er weiß, wie wir David finden können?«
Er packte sie nun schmerzhaft am Handgelenk und riss sie mit.
»Was du noch lernen musst, junge Lady, ist, dass man im Beisein erwachsener Männer den Mund hält!«, zischte er.
»Sehr richtig«, pflichtete ihre Mutter ihm bei. »Du solltest dich schämen!«
Elinda war fassungslos, dass ihre Eltern in dieser Situation noch versuchten, sie zu korrigieren. Am liebsten hätte sie sich losgerissen und wäre zu dem Mann zurückgerannt, um ihm all die quälenden Fragen zu stellen, die ihr auf der Zunge lagen. Sie bemerkte kaum den Regen, der durch ihre Haube drang und ihr Haar durchnässte.
»Wir müssen doch etwas tun, um David wiederzufinden«, drang sie weiter auf ihren Vater ein.
»Wir werden alles Nötige unternehmen«, versicherte Robert Audley. »Aber dazu gehört gewiss nicht, mit diesem abgerissenen Halunken zu sprechen.«
»Was hat er getan, dass du so von ihm sprichst?«
Robert Audley eilte weiter in Richtung ihrer Kutsche, die am Hafen auf sie wartete. »Das tut nichts zur Sache.«
Elinda blieb stehen. »Ich will es wissen!«
»Du gibst ja doch keine Ruhe«, schnaubte ihr Vater, bedeutete ihr jedoch nachdrücklich, weiterzugehen.
»Mister Colbert war früher ein angesehener Reiseführer, der durch verantwortungsloses Handeln seinen guten Ruf ruiniert hat. Niemand würde je wieder seine Söhne mit ihm nach Italien schicken. Nach einer äußerst unschönen Geschichte vor etwa acht Jahren entzog er sich dem Skandal, indem er zur See fuhr. Vor einem Jahr etwa ist er wieder aufgetaucht, und was man so von ihm hört, ist er nun ein Handlanger für allerlei zwielichtiges Gesindel. Jeder kann ihn gegen Bezahlung für die niedersten Dienste anheuern. Er hilft Schmugglern, räumt hinter Verbrecherbanden auf. Mehr musst du nicht wissen.«
»Und wenn das nun alles Gerüchte sind?«, widersprach Elinda. Sie wusste nicht, woher ihr Bedürfnis kam, Partei für Mister Colbert zu ergreifen. War es nur Davids Begeisterung für ihn? Oder die unergründliche Faszination, die sie empfunden hatte, als sein Blick ihrem begegnet war?
»Oh, das sind gewiss keine Gerüchte!«
»Aber woher wusste er dann, dass wir David vermissen? Und woher kannte er die Namen der Lords?«
»Männer wie er sind immer über alles gut im Bilde, weil sie überall ihre schmutzigen, geldgierigen Finger drin haben. Und nun will ich kein Wort mehr hören, Elinda. Ich habe genug Sorgen.«
»Die könnte Mister Colbert vielleicht zerstreuen«, widersprach sie. »Ist es nicht gleichgültig, was er für einen Ruf hat, wenn er dafür David aufspüren könnte?«
Robert Audleys Geduld war am Ende. Er fuhr zu ihr herum, und Elinda glaubte schon, er würde sie erneut anherrschen. Doch in diesem Moment öffnete der Himmel seine Schleusen, und der Regen wurde zu einem Sturzbach, der alle möglichen Reaktionen auf ihre Hartnäckigkeit mit sich fortspülte.
4
Als Kind hatte Elinda es geliebt, nach Thornton Hall zurückzukehren und sei es auch nur von einem Ausflug ins nahe London. Der alte Landsitz aus der Zeit Königin Elisabeths mit seinen großen Fenstern und den Mauern, die an cremefarbenen Topas erinnerten, lag am Ende einer Kastanienallee auf einer sanft geschwungenen Anhöhe. Die Sonne hatte sich in den blank geputzten Scheiben gespiegelt und die Fassade am Abend mit einem goldenen Schimmer überzogen. Jetzt war das Herrenhaus ergraut und brüchig wie ein sehr alter Mann, der sich weigerte zu sterben. Schon aus der Ferne, noch durch die Zweige der kahlen Bäume hindurch sah man, dass einige Fenster von innen vernagelt worden waren, dass das Dach an einigen Stellen eingesunken war und der Rasen einer riesigen, schlecht verheilenden Narbe glich. Es war nichts Tröstliches mehr im Moment des Heimkommens.
Erst recht nicht an diesem Tag. Robert Audley hatte Elinda und Bérénice in einer Taverne am Hafen vor dem Regen in Sicherheit gebracht und war allein losgezogen, um erste Erkundigungen einzuziehen. Die Taverne war von den vielen Menschen überfüllt, die heute vergeblich auf die Rückkehr ihrer Angehörigen gewartet hatten, und in Elindas Ohren hallten immer noch der laute Chor besorgter und verärgerter und mit vorgerückter Stunde zunehmend betrunkener Stimmen.
Irgendwann war ihr Vater mit der Botschaft zurückgekehrt, dass innerhalb der letzten Stunden auch der letzte der Lords, Sir Veland, gestorben war. Robert Audley hatte nicht mehr tun können, als eine Nachricht nach Calais schicken zu lassen, um dort nach Davids Verbleib zu forschen.
Während der ganzen Kutschfahrt zurück nach Thornton Hall hatte er kein Wort mehr über die unheimlichen Andeutungen Lord Charswicks verloren. Das uralte Bleitäfelchen hatte seine Kanten durch den fadenscheinigen Stoff seiner Rocktasche gedrückt, und Elindas Gedanken waren immer wieder zu Mister Colbert zurückgewandert.
Die Pferde hielten, und ihr Vater stieß den Kutschenverschlag auf. Die Zeiten, dass ein Butler sie erwartete, waren vorbei. Wenigstens brannte im Salon ein Feuer. Doris, das Küchenmädchen, verkündete, dass es später zum Dinner Hechtklöße geben würde. Elinda drehte es beinahe den Magen um.
Der Abend versammelte sich bereits mit Nebel und tropfender Finsternis vor den Fenstern. Ihr Vater schloss die Türen des Salons hinter sich und seiner Frau, und Elinda konnte sie dahinter aufgeregt, aber gedämpft sprechen hören. Sie war versucht, an der Tür zu lauschen, da drang die Stimme ihrer Mutter laut und deutlich hinter dem Holz hervor.
»Bring ihn mir zurück! Ich kann nicht noch ein Kind verlieren!« Ein haltloses Schluchzen folgte.
Elinda wich von der Tür zurück.
Nicht noch ein Kind…
Der Schmerz der Erinnerung, die hinter den Worten ihrer Mutter lag, entwich in einem zitternden Atemzug. Sie stand allein in der Mitte der dunklen Eingangshalle des alten Landsitzes.
Elinda konnte sich an eine Zeit erinnern, in der diese Halle ein warmer, heller Ort gewesen war. Brennende Kandelaber und ein großes Feuer im Kamin neben der gewundenen Steintreppe. Das Licht hatte sich golden an die Schatten geschmiegt. Die alten Familienporträts schienen jeden Eintretenden zu begrüßen. Oder neugierig herabzuschauen, wenn sie und David auf der Treppe Fangen spielten. Nun erschien Elinda die Halle wie eine gigantische Gruft. Es kam ihr vor, als hätten die letzten Kerzen an einem Begräbnis gebrannt, das lange zurücklag. An einem Tag, der den Untergang der Familie Audley eingeläutet hatte. Damals, als das Schiff mit den Waren aus Vaters Pachtplantage in Jamaika gesunken war, war beschlossen worden, keine unnötigen Ausgaben mehr in Form von Feuerholz, Wachskerzen und sonstigem Luxus zu tätigen.
Elinda konnte hören, wie ihr Vater nun versuchte, Bérénice mit der allgegenwärtigen Stimme der Vernunft zu trösten, die für jede denkbare Situation Rahmen, Richtschnur und Rettung war. Aber es gab Dinge, denen mit Vernunft nicht beizukommen war, und Davids Verschwinden gehörte dazu.
Elinda fragte sich, warum ihr Vater nicht das Bedürfnis hatte, auch sie zu trösten.
Die Kälte des nackten Bodens drang durch ihre Sohlen und die immer noch feuchten Kleider. Ohne Wärme und Licht war dieser Teil von Thornton Hall der Herrschaftsbereich der Steine. Ihre Kälte erinnerte alle Bewohner daran, woran es mangelte. Es gab kein Licht mehr. Alles versank in einer beinahe greifbaren Dunkelheit, die selbst die strahlendsten Frühlingstage nie ganz vertreiben konnten.
Auch darum hatte Elinda David beneidet. Um das Licht, dem er entgegengereist war. In einem Brief vergangenen September hatte er von einer Fülle von Licht geschrieben, die man sich in England nur schwer vorstellen konnte. Und von einer Hitze, die einem die Kälte sämtlicher Winter aus den Knochen zog.
Schwesterlein, mal dir diese Sonne nur einmal aus. Wie ich ihre versengende Gnade liebe! Unter ihr springen Orangenblüten auf, und die Frauen flüchten sich in die Kühle der Kirchen. Gestandene Männer fallen ohnmächtig von ihren Gäulen, und die Eidechsen drücken ihre Bäuche an den erhitzten Marmor …
Da war David gerade kurz vor Rom gewesen und hatte seinem Brief eine kleine Zeichnung beigefügt. Eine Landschaft mit Pinien und Zypressen, an deren Horizont man Kuppeln und Türme erahnen konnte.
Elinda hatte sich die italienische Sonne als granatrote Lampe vorgestellt, deren Licht Dutzende Meilen entfernt die Kuppel von Sankt Peter überzog und die Fassaden der Paläste aufleuchten ließ. Wie die Strahlen in die Zimmer stiegen und purpurne Flecken darin aufblitzten, als würde dort ein Kardinal vorübereilen. Wenn sie die Augen schloss, sah sie die satten, fast ordinären Farben, die man in England nirgendwo fand.
Nun, in der eisigen Steinhalle sehnte sich Elinda so sehr nach dieser Sonne, dass ihr ein wütendes Schluchzen entwich.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: