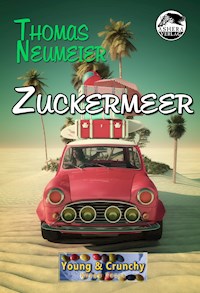Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Das bayerische Reinheitsgebot jährt sich zum 500. Mal, doch den ersten Sud seines Jubiläumsbieres erlebt Traditionsbrauer Adalbert Biber nicht mehr. Sein rätselhafter Selbstmord hinterlässt rivalisierende Erben und viele Fragen. Die drängendste: Wer ist die Leiche im Kirchenbrunnen? Erna Starck von der Kripo Ingolstadt nimmt die Ermittlungen auf - und stößt im idyllischen Altmühltal auf ein dunkles Geheimnis. Und auf eine ganz besondere Variante des Reinheitsgebots....
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Neumeier lebt und arbeitet im idyllischen Naturpark Altmühltal. Hauptberuflich Bürokaufmann, hatte er schon als Kind eine Affinität zum Schreiben und Erzählen. Ein nachgeschobenes Studium hat ihn auf den Literaturbetrieb losgelassen.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: shutterstock.com/Wolfilser Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-95451-963-9 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Als ich von den schlimmen Folgen des Trinkens las,gab ich sofort das Lesen auf.
Henny Youngman (1906–
Prolog
Ein machtvoller Ort sollte das hier sein, sagten die Spinner. Geheimnisvolle Kräfte gingen von dem lehmigen Boden aus, weil es da unten ein paar Wasseradern gab. Die erzeugten unterirdische Kraftfelder und entzogen den Menschen ihre Energien. Deshalb wurde man hier immer so schläfrig. So jedenfalls hatte ihm das mal einer dieser Esoterikfuzzis erklärt, die hier bei schönem Wetter mit Wünschelruten und Pendeln umherspazierten. Auf die Idee, dass die Müdigkeit vom vorangehenden Aufstieg rühren könnte, kamen diese Gestalten nicht.
Er fühlte sich kein bisschen schläfrig. Nicht heute Nacht. Er glaubte nicht an diesen New-Age-Kram, dieses späte Vermächtnis der 68er, deshalb war er für die hier angeblich wirkenden Kräfte auch nicht empfänglich. Außerdem überflutete ihn die Gewissheit um seinen bevorstehenden Tod mit Adrenalin. Da war kein Platz für Müdigkeit. Nicht heute Nacht– seiner letzten.
An Geister glaubte er auch nicht, obwohl ihm hier oben stets welche begegneten. Geister aus vergangenen Zeiten. Er sah sie nicht, aber sie waren da. Stimmen, Gelächter, Gesang– und Angst. Vor allem die. Sie waren überall. Lauerten. Grinsten. Kicherten. Er ignorierte sie. Wie immer.
Mit seiner geladenen Schrotflinte fest in beiden Händen, ging er seinen letzten Gang. Er hätte sich für diesen Anlass ein paar Sterne als Zeugen gewünscht, aber der Nachthimmel war weitenteils pechschwarz. Nur hoch über den Wäldern auf der anderen Talseite graute kaum sichtbar ein fahles Glimmen hinter den schwarzen Schlieren. Nicht einmal der Mond wollte ihm zusehen. Sei’s drum.
Die Spalier stehenden Büsche und Bäume wiesen ihm den Weg vorbei an den beiden von Moos überwucherten Opfersteinen. In der lichtlosen Dunkelheit waren sie nur als schemenhafte Hügel zu erkennen. Grabhügel, dachte er. Wie passend.
Grund zur Eile bestand nicht. Er hatte die ganze Nacht Zeit, dies zu Ende zu bringen. So lange würde er nicht brauchen.
Etwa fünfzehn Meter voraus an der Talkante markierte der steinerne Obelisk, den sie »Wodansburg« nannten, das Ende seines Weges. Eine wiedererrichtete altgermanische Richt- und Opferstätte sollte das sein, hieß es. Für ihn war es einfach nur ein grobschlächtiges Phallussymbol. Schon immer. Ein rudimentär gemauerter Sockel, einem Altar nicht unähnlich, mit einem spitzen, mehrere Meter hohen Aufbau, welcher der Dunkelheit zum Trotz mit jedem Schritt mehr Konturen gewann. Das Bildnis wirkte bedrohlich. Wie etwas noch Finstereres in der Finsternis, das unmissverständlich klarstellen sollte, wem dieses Aussichtsplateau gehörte. Er aber war nicht weiter beeindruckt. Hier hatte es angefangen. Und hier würde es nun enden. Endlich.
Als er den Sockel erreichte, berührte er den rauen, kalten Stein. Moos und Gestrüpp rankten in den Vertiefungen. Im weiten Tal dahinter glommen schwach die Nachtlichter seiner Heimatstadt im Nebel.
»Hahaha! Ich habe geahnt, dass du dich so aus der Affäre ziehen würdest«, sprach eine unangebracht heitere Stimme, und eine Gestalt erhob sich von einer der beiden Sitzbänke auf der dem Tal zugewandten Seite des Steinsockels. »Und dass du es hier tun würdest.«
Er erkannte die Stimme auf Anhieb, hatte fast mit ihr gerechnet.
»Hier, wo alles begonnen hat«, fuhr sie ausgelassen fort. »Wie ungemein stimmig! So… nun ja, konsequent, würde ich fast sagen. So schließt sich endlich der Kreis. Muss sehr tröstend für dich sein.«
»Was willst du hier?«, raunte er.
»Na, ich will dir dabei zusehen«, bekam er zur Antwort. »Damit mir nichts entgeht, habe ich sogar eine Taschenlampe dabei. Hier, siehst du?«
Ein unsäglich greller Lichtstrahl schoss ihm in die Augen. Mit einem Fluch auf den Lippen wandte er den Blick ab. »Schalte sie ab! Sofort!«
»Jaja, schon gut.« Das Licht erlosch. »Sehe ich mir später eben das blutige Kunstwerk an, wenn dein Gehirn stückchenweise über den Stein verteilt ist. Das wird mir genügen. Bis es vollbracht ist, sollst du deine Privatsphäre haben. Man macht so etwas schließlich nicht jeden Tag, was? Ha! Genauer gesagt, höchstens einmal im Leben. Also mach hin, ja? Ich habe heute Nacht noch was vor.«
»Ich will, dass du verschwindest.«
»Schon gut, ich lasse dich allein. Aber verschwinden werde ich nicht.«
Kaum zähmbarer Zorn stieg in ihm auf. Die dumpfen Schritte seines Gegenübers umrundeten den Sockel, passierten ihn und entfernten sich raschelnd ins dunkle Gespinst der Bäume.
»Eins noch!«, gebot er, woraufhin sie verstummten.
»Ja?«
»Die Brauerei. Sie bleibt, wie sie ist, klar?«
Die Antwort aus der rückwärtigen Schwärze kam verzögert: »Das habe ich nicht in der Hand.«
* * *
Ich bin ein Schatten. Das ist wenig und doch genug. Ich habe mich für dieses Dasein entschieden. Nicht in jeder Nacht bin ich nur ein Schatten, aber doch in vielen. Ich bin die blitzschnelle Bewegung auf dem Asphalt, die nächtliche Spaziergänger aus den Augenwinkeln wahrnehmen, wenn sie unter einer Straßenlaterne hindurchgehen. Ich bin das Vorbeihuschen einer unförmigen Silhouette an einer Mauer, die Gestalt gewordene Dunkelheit einsamer Gassen und das schauderhafte Frösteln, das die Leute dort heimsucht. Wenn ich einen Gartenzaun überquere, verschmelze ich mit den Schatten der Zaunlatten und Gartensträucher. Wenn ich eine Terrasse einnehme, jage ich die Schatten streunender Katzen. Komme ich einem Fenster zu nah, bin ich der Schatten eines Nachtvogels, der kurz die Sterne verdeckt hat. Besteige ich eine Leiter oder eine Efeuranke, werde ich damit eins. Schatten sind nicht unsichtbar, aber niemand achtet auf sie.
Ein entfernter Schuss, den ein vorbeifahrender Kleinwagen beinahe übertönt hätte, gellte über die Hausdächer. Ein Jäger in den umliegenden Hochwäldern, keine Frage. Der Schatten hörte sie oft, wenn er die Nächte durchstreifte. Dort droben in den lichtlosen Baumschluchten wäre er vollkommen, wie ihm bewusst war. So vollkommen, dass er gar nicht mehr existieren würde. Ein Nichts im Nichts, ohne Bedeutung. Nur wo Licht war, konnten Schatten sein.
Der Schatten erklomm die Stadtmauer der Altstadt, sprintete in seiner Geschmeidigkeit einem Panther gleich zehn Meter weit auf einen der Türme zu, bevor er seitwärts ausbrach und als lautloser Nachtvogel über die Gasse segelte. Er landete auf dem flachen Dachanbau gegenüber. Dort wurde er eins mit dem dunklen Ziegeldach und stieg die eingearbeiteten Sprossen für den Kaminkehrer hoch zum First. Zuoberst angelangt, nahm er in entspannter Haltung rittlings Platz und holte sein Nachtsichtglas und den Feldstecher aus dem Rucksack.
Er hatte diesen Platz erst vor ein paar Wochen ausgekundschaftet. Seitdem kam er regelmäßig her. Es gab keinen günstigeren Ort, um das alte Brunnenwächterhaus zu observieren. Von hier überschaute man die rückläufige Umzäunungsmauer in einem Winkel, der durch den Terrassenanbau einen umfassenden Einblick ins Wohnzimmer des Hauses gestattete. Vorausgesetzt, die Vorhänge waren nicht zugezogen. Das waren sie zum Glück selten. Die Bewohnerin sah anscheinend keinen Grund dazu. In einem von einer fast drei Meter hohen Mauer eingeschlossenen Haus war das nachvollziehbar.
Sie war eine sehr hübsche Frau, fand der Schatten. Halblanges blondes Haar, mittelgroß, zierliche Gestalt, vielleicht dreißig Jahre alt oder auch ein paar mehr. »Christina Grangel« stand draußen auf dem Briefkasten neben dem Eisentor. Der Schatten beobachtete sie gern.
Bislang hatte sich wenig Spektakuläres in diesem Wohnzimmer abgespielt. Meistens las sie oder schaute fern, und sie tat das immer allein. Dem Schatten reichte das aus. Es freute ihn sogar. Seine Ansprüche und Erwartungen waren so bescheiden wie seine Natur. Ihm genügte es vollauf, sie in ihrem Sessel sitzen oder auf ihrer Couch liegen zu sehen. Wenn die Nächte bald wärmer wurden, würde sie bestimmt auch die Terrasse benutzen. Warum sie allein und so zurückgezogen lebte, wusste er nicht, und es war ihm auch egal. Er war ihr dankbar, dass sie sein Leben bereicherte. Dass sie dem Schatten etwas Licht gab.
Auch ohne seine Gläser erkannte er, dass in ihrem Wohnzimmer im Moment kein Licht brannte. Wahrscheinlich war sie früher als üblich schlafen gegangen. Das war bedauerlich. Vor allem, weil sich auch auf dem Nachbargrundstück nichts regte. Gleich neben dem Brunnerwächterhaus befand sich das Firmengelände der »Biber-Brauerei«, das der Schatten nur allzu gut kannte. Dort spielten sich nachts zuweilen interessante Sachen ab. Vor allem im Büro der Juniorchefin hatte der Schatten schon ein paar anschauliche Szenen bestaunen dürfen, die kaum konträrer zum sittsamen Geschehen im Brunnenwächterhaus hätten sein können. Heute aber lag zu beiden Seiten der Mauer alles in Dunkelheit.
Der Schatten wollte sich schon wieder zurückziehen und einen seiner anderen Bezugspunkte aufsuchen, als seine geschärften Sinne eine Veränderung registrierten. Da war eine Bewegung. Eine Bewegung, so schattenhaft und nachtgleich wie er selbst. Er nahm das Nachtsichtglas auf und lenkte das Okular zum Brunnenwächterhaus. Es lag nach wie vor in Finsternis, doch in der lichtlosen Kaverne zwischen dem Haus und der Außenmauer regte sich etwas. Dem Schatten stockte der Atem. Er wollte es kaum glauben, aber da war noch ein anderer Schatten. Kein Zweifel. Er erkannte seinesgleichen.
Flink wie ein Wiesel huschte der andere um die Hausecke und verschwand aus seinem Sichtfeld. Keine Minute später durchforstete der schwache Schein einer Taschenlampe das Wohnzimmer.
Der Schatten auf dem First verharrte in unruhiger Erwartung. Ein Schatten, der zu Besuch kam– was hatte das zu bedeuten?
Eine weitere Minute verstrich, vielleicht auch zwei oder drei, dann flammte am Vorderhof des Hauses Licht auf. Der Schatten auf dem First verstand sofort. Christina Grangel war gar nicht im Haus. Aber sie kam gerade heim. Das Eisentor hatte sich beiseitegeschoben, ihr Wagen fuhr ein. Sie würde ihn parken und ins Haus gehen, nicht ahnend, dass sich dort ein Schatten herumtrieb, der da nicht hingehörte.
Der Schatten erspähte seinen unbekannten Bruder im ersten Stock, wo er aus einem Fenster stieg, es wieder hinter sich schloss und elegant und sicher, wie es nur Schatten können, ins weiche Gras hinabsprang. Der Schatten auf dem First verfolgte seinen Weg auf die das Grundstück umzingelnde Mauer. Als er sie erklomm, ging hinter ihm das Licht im Wohnzimmer an. Christina Grangel trat ein und ließ sich erschöpft in ihren Lesesessel fallen. Der Schatten auf der Mauer hielt ein und schaute ihr dabei zu. Der Schatten auf dem First beobachtete sie beide. Voller Staunen. Und Entzücken.
Am Ende des Regenbogens
Der Sex mit Ilana war wie immer gut gewesen. Doch am meisten schätzte Ludwig an ihr, dass sie, auch nachdem sie fertig waren, noch eine Weile bei ihm blieb. Dann bettete sie ihren Kopf auf seine Brust und lauschte, wenn er sich die Widrigkeiten seines nicht weiter aufregenden Lebens als Versicherungsvertreter von der Seele redete. Sie sprach nicht gut genug Deutsch, um daraus eine Konversation zu machen. Auch wusste Ludwig, dass sie bestenfalls die Hälfte von dem verstand, was er ihr erzählte– vom Druck von oben oder dem zunehmend schlechten Ruf seiner Branche. Das spielte aber keine Rolle. Die Illusion einer verständnisvollen Partnerin, die ihm zuhörte und seine Sorgen teilte, war ihm genug. Danach fühlte er sich besser.
»Mittwoch, gleiche Zeit?« Dezent geschminkt kam Ilana aus dem Badezimmer und steckte ihre Ohrringe an. Sie hatte sich angezogen, ihren schönen Körper unter einer ausgewaschenen Bluse und einem knöchellangen Rock versteckt, der bestimmt das eine oder andere Jahrzehnt auf dem Buckel hatte. Die bescheidene Kleidung wurde ihr nicht gerecht, was sie Ludwig umso reizvoller erscheinen ließ. Sie war ein feiner Riesling in einem Zahnputzbecher. Ihre zurückhaltende Art, die schüchtern lächelnden Lippen und das volle schwarze Haar hatten ihn schon bei ihrem ersten Treffen betört. Daran hatte sich nichts geändert.
»Also?«
»Äh… was?«
»Mittwoch. Ich soll wiederkommen?«
»Nein, da werde ich wahrscheinlich nicht in der Stadt sein«, sagte Ludwig und setzte sich im Bett auf. »Ich bin eine Weile weg. Wenn ich wieder da bin, rufe ich dich an.«
»Wohin gehst du?«, fragte sie. Die Ohrringe saßen. Sie nahm ihre Handtasche.
»Zurück nach Bayern«, antwortete Ludwig. »In mein Heimat-städtchen. Mein Vater ist gestorben.«
Sie suchte wieder seinen Blick. »Das tut mir leid.« Ihre Anteil-nahme wirkte nicht gespielt. »Ist er gewesen… krank?«
Ludwig zuckte mit beiden Achseln. »Keine Ahnung. Kann schon sein. Er hat sich erschossen.« Mit den Fingern der rechten Hand imitierte er einen Kopfschuss. »Mit einer Schrotflinte, wie ich gehört habe.«
Ilana blieb ein paar Sekunden lang erstarrt stehen. Dann trat sie näher und setzte sich am Fußende aufs Bett. Ihre dunklen Augen rangen um Verständnis. »Du hast die ganze Zeit von Arbeit geredet!«, fuhr sie ihn vorwurfsvoll an. »Dein Vater tot und sich erschossen und du redest von Arbeit! Warum?«
Noch einmal zuckte Ludwig unbeholfen mit den Achseln. Er bemühte sich, nach außen lässig zu bleiben, und merkte selbst, wie gründlich er dabei versagte. Schon bereute er es, das Thema überhaupt angeschnitten zu haben. »Ich will dich nicht damit belasten. Lass es gut sein, Ilana. Er und ich, wir haben uns nicht gut verstanden. Noch nie. Ich bin nicht traurig, verstehst du?«
Ilana musterte ihn eine Weile stumm. »Aber er ist dein Vater«, sagte sie schließlich. Sie hob eine Hand und schien abzuwägen, ob sie sie ihm irgendwo zärtlich auflegen sollte. Auf sein Knie etwa, das seitlich unter dem Bettlaken hervorlugte. Sie tat es nicht. Sie erhob sich und ging langsam Richtung Tür. Ludwig wünschte, sie hätte es getan. Er brauchte keinen Trost, aber eine Geste ehrlicher Anteilnahme hätte ihn berührt. In zweifacher Weise.
An der Kommode neben der Tür langte Ilana nach seinem Geldbeutel. Ludwig wusste, dass sie nicht zu viel herausnehmen würde.
»Du rufst mich an, wenn du hast getrauert«, sagte sie. Der Vorschlag klang mehr wie ein Befehl, und ihr stechender Blick verlangte dasselbe.
Ludwig aber wollte sich nicht ergeben. Ob er trauern würde oder nicht, war allein seine Sache. Er würde sich dafür nicht rechtfertigen, wie es auch kommen mochte. »Ich rufe dich an«, entgegnete er bündig.
Ilana nickte kaum merklich, dann verschwand sie durch die Tür und ließ Ludwig mit gemischten Gefühlen zurück. Etwas an dem kurzen Gespräch hatte ihn aufgewühlt. Trauer um seinen toten Vater war es nicht. Eher das vollkommene Ausbleiben selbiger, verbunden mit Scham und Schuldgefühlen, weil anständige Menschen nun mal trauerten, wenn ihre Väter starben. Er tat das nicht, und er glaubte auch nicht, dass er es übermorgen bei der Beerdigung tun würde.
Er drehte den Kopf umständlich zu seinem Radiowecker. Es war fast elf. Meistens schlief er um die Zeit schon, aber jetzt war nicht an Schlaf zu denken. Er beschloss, noch etwas fernzusehen, am besten bei einer Tasse Tee.
Im Badezimmer betrachtete er sich im Spiegel. Imaginär stellte er seinen Vater neben sich, so wie er ihn in Erinnerung hatte. Den großen, kantigen und verboten gut aussehenden Kerl, der auch jenseits der vierzig noch jede Studentin rumkriegen konnte– wofür er nach Mamas Einweisung alle Freiheiten gehabt hatte. Ludwig hätte ihm kaum unähnlicher sein können. Er war kleiner als die meisten Frauen, die ihm begegneten, notorisch übergewichtig und hatte schon mit dreißig das meiste Haar verloren. Inzwischen schmückte nur noch ein Haarkranz seinen Kopf. Ein dunkler Haarkranz mit zunehmend silbernen Anleihen.
Der imaginäre Vater lächelte auf ihn herab, jovial, streng und abweisend. Mach doch, was du willst, sagte er wie beiläufig.
Ludwig verzog sich aus dem Badezimmer und brühte in der Küche eine Tasse Pfefferminztee auf. Sein Vater schaute ihm dabei über die Schultern. Nicht weil er an dem interessiert wäre, was sein Sohn da tat, sondern weil er Bestätigung suchte, dass dieser nichts zuwege brachte, was ihn in irgendeiner Form beeindrucken könnte.
Du gibst zumindest dein Bestes, sagte er und verschwand endlich wieder ins Nichts.
Ludwig ging mit seinem Tee ins Wohnzimmer. Als wollte ihn auch der Fernseher verhöhnen, lief ein James-Bond-Film mit Pierce Brosnan, als er einschaltete. Sein Vater sah Brosnan ungeheuer ähnlich. Von seinem Charme und seinem guten Aussehen hatte Ludwig leider wenig abbekommen. Dieser Teil seines genetischen Erbes war umfänglich an seine kleine Schwester gegangen. Der Gedanke an sie trug nicht gerade zu Ludwigs Ausgeglichenheit bei. Auch ihr beider Verhältnis war schwierig. Sie war immer Papas Liebling gewesen. Er hatte sie stets bevorzugt, wodurch sie schon früh angefangen hatte, auf ihren großen Bruder herabzusehen. Mit sechzehn hatte sie ihn dann auch noch an Körpergröße überholt.
Ludwig nahm den Teebeutel aus seiner Tasse, quetschte ihn mit dem Löffel aus und legte ihn auf den Untersetzer. Die kommende Woche würde er sich gern ersparen.
* * *
An der Zufahrtsschranke löste Harald Falter einen Parkschein und schlüpfte mit seinem Mini Cooper in die nächste freie Lücke. Feiner Nieselregen, mehr wehend als fallend, deckte den Wagen ein. Ein Schleier aus Wasser, der gerade durch jede Straße und jeden Winkel der Stadt zog. Die Mauern des Krankenhauskomplexes lagen grau und blassgrün dahinter.
Harald strich über das Brandmal auf seinem rechten Handrücken. Feuer hatte ihm das angetan. Wasser hatte ihn vor schlimmeren Verletzungen bewahrt. Diese Narbe würde ihm bleiben, ein Leben lang, doch Harald würde sie mit Stolz tragen. Er lächelte, als sie plötzlich zu jucken anfing, was sie ständig tat, seit er den Verband abgenommen hatte. Er würde noch so manche Schererei mit ihr haben, doch sie war ein geringer Preis dafür, dass er ein Leben gerettet hatte. Er stieg aus und ergab sich der Ummantelung des feuchten Schleiers. Wasser ist Leben. Wie wahr.
Neben einem Restaurant, einem Zeitungskiosk und einer Bücherei gab es auch einen Blumenladen in der Eingangshalle des Klinikums. Harald erstand einen bunten Strauß und eine dazu passende Vase, dann erkundigte er sich am Empfang nach dem Krankenzimmer von Julia Öttl.
In den ausladenden Fluren herrschte wenig Betrieb. Hier und da eine Schwester hinter Glas, vage Stimmenfragmente und Rascheln aus offenen Zimmern, einsame Patienten in Morgenmänteln beim Spaziergang. Den in Krankenhäusern so typischen Geruch nach Hygienemitteln empfanden viele Menschen als unangenehm. Vielleicht weil er schlimme Krankheitserinnerungen weckte oder unbequeme Vorahnungen schürte. Vielleicht auch weil er tief im Unterbewusstsein wühlte. Dieser Geruch war schließlich einer der ersten, die ein Säugling nach dem Geburtstrauma in dieser Welt aufnahm. Er rührte auch in Harald, doch Harald empfand den Geruch als sehr angenehm. Er sprach von Reinheit. Von Sterilität. Von vollkommen keimfreier Sauberkeit.
Eine Erwiderung auf Haralds Klopfen an Julia Öttls Patientenzimmer ließ nicht auf sich warten. »Ja? Bitte?«, rief eine heisere, aber glasklar weibliche Stimme.
Harald sog die Luft ein, richtete sich gerade und trat ein. Da lag sie. An Kopf, Arm und Schulter bandagiert, letztere auf einem Gestell fixiert. Von ihrem langen blonden Haar war nichts zu sehen. Nur ihr hübsches Gesicht hatte man frei gelassen. Eine Mumie, zu schön, um sie völlig zu verhüllen.
Ein wachsames blaues Augenpaar schaute Harald entgegen. Nein. Zwei blaue Augenpaare schauten ihm entgegen. In einem Stuhl am Fußende des Bettes saß noch eine andere Blondine. Sie trug Straßenkleidung, woraus Harald folgerte, dass sie wohl nicht die Patientin des leeren Bettes nebenan war. Eine Schwester war sie auch nicht. Er hatte erwartet, Julia Öttl allein anzutreffen. Freunde und Verwandte kamen üblicherweise an den Wochenenden zu Besuch, nicht an einem Montagnachmittag.
»Entschuldigung, mein Name ist Harald Falter«, stellte er sich vor. »Ich habe mir unten Ihre Zimmernummer geben lassen.«
»Das haben Sie wirklich gut gemacht«, sagte die Bandagierte im Krankenbett. »Verzeihen Sie, dass ich nicht applaudiere. Sollte ich Sie kennen?«
»Nein, wohl nicht«, entgegnete Harald mit einem unsicheren Lächeln. »Sie waren ja nicht bei Bewusstsein. Ich bin der Feuer-wehrmann, der Sie aus dem Auto gezogen hat.«
»Ah«, machte Julia Öttl, und ihre Augen wanderten von ihm ab und verloren sich an der Raumdecke. Ihre blassen Lippen zuckten kurz, so als wollten sie etwas sagen, was ihnen die Kehle verweigerte.
Stille Sekunden zerrannen, die Harald wie eine Ewigkeit vorkamen.
»Schade, dass Sie nicht schneller waren«, fügte Julia Öttl halblaut hinzu, nun mit Blick zur breiten Fensterfront des Krankenzimmers. Wasserschlieren liefen die Scheiben hinunter. Dahinter war in einer Suppe von dunklem Grau Ingolstadt zu erahnen.
»Wir sind so schnell gekommen, wie es ging«, entgegnete Harald weich. »Mehr haben wir nicht tun können. Wie geht es Ihnen?«
Die Patientin antwortete nicht. Dafür meldete sich die andere Frau zu Wort. »Geht es hier um irgendeine Versicherungssache?«, blaffte sie Harald an und stand auf. »Oder warum sind Sie hier? Was hat das zu bedeuten?«
Gemessen und ohne Hast ging Harald zu dem kleinen Tisch in der Ecke und stellte seine Blumen ab. Diese Frau kam ihm bekannt vor, aber er wusste nicht, wo er sie einordnen sollte. »Keine Versicherungssache«, sagte er. »Ich bin nur hier, weil ich wissen wollte, wie es der Frau Öttl geht.«
»Nicht so prächtig, wie Sie sehen, oder?«
»Nun, sie lebt noch«, setzte Harald dem entgegen, als er sich wieder den beiden Frauen zuwandte. Er hatte Julia Öttl aus einem brennenden Autowrack geholt und dabei sein Leben und seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Mit einem Begeisterungssturm hatte er nicht gerechnet, aber doch wenigstens mit Dank anstelle von Vorhaltungen.
Die Blonde auf den Beinen hielt seinem Blick stand. Harald beobachtete einen tiefen Atemzug. Woher kannte er diese Frau? Er war sich sicher, sie schon irgendwo gesehen zu haben. Ihrem Dialekt nach sortierte er sie in den Regensburger Raum.
»Na gut«, schnaufte sie und fuhr zu der Patientin herum. »Ich mache mich dann auf den Heimweg. Melde dich, wenn ich etwas für dich tun kann, ja? Oder soll ich noch bleiben, solange…« Mit einem unverhohlenen Kopfwippen deutete sie auf Harald hinter sich.
Julia Öttl schüttelte mit einem Ausdruck der Dankbarkeit den Kopf, soweit es ihre Verbände zuließen. »Danke, Christina. Ich komme schon klar. Bis bald.«
Die andere streifte noch einmal Haralds Blick, dann nahm sie ihre Jacke auf und marschierte davon. Harald war ein wenig ratlos und fragte sich, was hier los war und was er falsch gemacht hatte. Wofür hielt die sich? Der Name »Christina« half ihm nicht, sie einzuordnen. Vielleicht hatte ihre herablassende Haltung gar nichts mit ihm zu tun. Manche Leute waren eben so.
Harald schaute ihr nach, bis sie die Zimmertür hinter sich geschlossen hatte. Damit war er allein mit der unbekannten Schönheit, die er aus dem Feuer gerettet hatte. Allzu dankbar schien sie dafür nicht zu sein.
»Einer der Sanitäter an der Unfallstelle hat gemeint, es würde Zeit brauchen, aber die bekämen Sie schon wieder hin«, trug er ihr an und hoffte, ein wenig Eis zu brechen. »Verbrannte Haut kann man transplantieren. Also… ich meine, man kann sie mit gesunder Haut ersetzen. Das wird bestimmt alles wieder.«
Julia Öttl blickte wieder versonnen zum Regen hinaus. »Gilt das auch für ein Ohr? Kann man das auch ersetzen? Transplantieren? Neu machen?«
Harald wusste nichts darauf zu sagen. Dass man es ihm hier so schwer machen würde, hatte er nicht erwartet. Offensichtlich war es ein Fehler gewesen, herzukommen.
Julia Öttl schien seine Gedanken erraten zu haben. »Entschuldigen Sie, ich bin unmöglich«, wisperte sie und schaute ihn aus traurigen Augen an. Die rechte Braue war angesengt, die Stirn darüber lag unter Mullbinden. Harald erinnerte sich an die schrecklichen Bilder am Unfallort. Ihr Haar hatte schon Feuer gefangen, als er und der Armin sie mit Schaum eingedeckt hatten. Zu spät, um Verbrennungen zweiten, vielleicht dritten Grades zu verhindern. Ihre rechte Kopfseite hatte besonders übel ausgesehen. Inklusive ihrem Ohr.
»Wie heißen Sie noch mal?«
»Harald. Harald Falter.«
»Sie sind also mein Lebensretter.«
Er lächelte. Nun endlich konnte er sich so bescheiden aufspielen, wie er es sich vorgenommen hatte und wie es einem echten Helden zustand. »Ich habe nur meine Pflicht getan. Ihr Leben haben die Ärzte gerettet.«
»Warum besuchen Sie mich?«
Um mich gut zu fühlen, wollte er nicht sagen. »Um zu erfahren, wie es Ihnen geht, natürlich«, antwortete er. »Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht.«
»Besuchen Sie alle Menschen, denen Sie helfen?«
»Nein, es ist das erste Mal«, sagte er der Wahrheit verpflichtet. »Aber es war auch das erste und einzige Mal, dass ich jemanden aus einem brennenden Fahrzeug geholt habe.«
»Was machen Sie denn sonst so? Kätzchen aus Bäumen retten?«
»Wir werden oft zu Unfällen gerufen und müssen Leute rausschneiden, aber normalerweise brennen die Autos nicht.«
»Warum hat meins gebrannt?«
»Manchmal passiert es eben doch. Können Sie sich an den Unfallhergang erinnern? Warum sind Sie von der Straße abgekommen?«
Julia Öttl senkte den Blick und schüttelte unter all ihren Bandagen kaum merklich den Kopf. »Keine Ahnung. Ich versuche schon die ganze Zeit, mich zu erinnern, aber es klappt nicht. Ich weiß nur noch, wie ich die Straße entlanggefahren bin. Nicht sehr schnell. Wegen dem Nebel. Dann ist alles weg. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich bin jedenfalls niemand, der während der Fahrt telefoniert oder raucht oder sonst was. Vielleicht bin ich eingeschlafen. War ja schon ziemlich spät.«
»Wo wollten Sie denn noch hin um die Zeit? Doch nicht etwa bis nach Stuttgart?«
Da schlich sich etwas Dunkles in Julia Öttls Gesichtszüge, ihr Blick gefror, und die Wachsamkeit kehrte zurück. »Woher wissen Sie, wo ich wohne?«, fragte sie eisig.
Die Sperrschranke, die sie damit zwischen ihnen zog, war beinahe greifbar, ihr starrer Blick anklagend, die blutleeren Lippen nur noch ein schmaler Strich. Harald war versucht, ein Stück zurückzuweichen, doch er blieb standhaft am Fußende ihres Bettes stehen.
»Na, durch Ihr Autokennzeichen«, erwiderte er verwirrt und kam sich ein zweites Mal wie auf einem Minenfeld vor. Die Patientin hatte offenbar ähnliche Neurosen wie ihre vormalige Besucherin. Dieser Gedanke diktierte ihm seine nächste Frage. Auch auf die Gefahr hin, auf eine weitere Mine zu treten. »War das eine Freundin von Ihnen?« Er deutete mit dem Kinn auf den leeren Stuhl.
Julia Öttl starrte ihn unbewegt an. Sie wirkte seltsam angespannt. Harald konnte sich keinen Reim darauf machen.
»Wieso stellen Sie all diese Fragen?«, schnarrte sie mit einer Grabesstimme, die sich tief in Haralds Verstand fräste.
Was hatte er denn falsch gemacht? Er wollte doch nur ein kleines Dankeschön für seine mutige Tat entgegennehmen. Irgendwie war das gründlich schiefgegangen, und er sah der Patientin an, dass die Situation auch mit Small Talk nicht mehr zu retten war. Er war auf eine Mine getreten. Auf welche, wusste er nicht.
»Ich möchte, dass Sie gehen!«, verlangte Julia Öttl streng und mit zunehmend flatternden Nasenflügeln. »Gehen Sie! Und kommen Sie nicht zurück!« Ihr Atem ging schneller. Mit ihrem freien linken Arm wies sie zur Tür. »Gehen Sie!«, schrie sie mit aufkeimender Panik. »Raus hier! Haben Sie nicht gehört? Gehen Sie! Jetzt! Gehen Sie! Gehen-Sie-gehen-Sie-gehen-Sie! Sofort!«
Harald, von ihrem unerwarteten Ausbruch völlig vor den Kopf gestoßen, stolperte einen Schritt rückwärts. »Schon gut«, sagte er mit einer beschwichtigenden Geste. »Ich gehe. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie gestört habe.« Er fuhr herum und durchmaß den Raum zur Tür. Julia Öttls vorwurfsvolle Blicke spürte er auch noch draußen im Korridor.
Auf dem Weg zum Auto schalt er sich für die blöde Idee, eine ihm völlig unbekannte Frau im Krankenhaus zu besuchen. Er hatte sie aus ihrem Fahrzeug geborgen, aber das reservierte ihm offensichtlich keinen Platz an ihrem Krankenbett. Das war schade, sogar frustrierend, doch er akzeptierte es. Wer wusste schon, was in den Leuten vorging.
Als er Ingolstadt über Lenting hinter sich ließ, klarte der Himmel auf. Zwanzig Minuten später, als er in Beilngries einfuhr, schien schon die Sonne auf die nass glänzenden Straßen. Es war kurz nach drei. Der Sud müsste inzwischen fertig gekocht sein und konnte ausschlagen. Wenn sich der Wastie an seine Vorgaben gehalten hatte, sollte alles geklappt haben. Die Messung der Stammwürze und der Geschmackstest würden es gleich zeigen.
Harald hatte durchaus Vertrauen zu seinem Lückenbüßer, aber die »Extradolde« war seine Kreation, und deshalb ließ er den Brauprozess ungern unbeaufsichtigt und machte am liebsten alles selbst. Die richtige Menge Hopfenpellets in die Würzepfanne zu geben, hatte er sich weiterzudelegieren getraut. Die Hefedosierung vor dem Gärkeller würde er selbst übernehmen.
Harald passierte das Brunnenwächterhaus und bog ins Brauereigelände ein. In dem Moment fiel bei ihm der Groschen. Natürlich! Die andere Blondine in Julia Öttls Krankenzimmer, das war die Mieterin von nebenan. Die Frau, die seit etwa einem halben Jahr im Brunnenwächterhaus wohnte. Er schüttelte den Kopf. Was es doch für Zufälle gab.
Drüben neben der Schwankhalle rangierte der Armin mit dem Stapler und belud den Lkw für die Lieferung zum Jankerwirt. Harald würde ihm nachher erzählen, dass ihr Brandopfer einen ziemlichen Knacks in der Birne hatte. Ob ihn das überhaupt interessierte, war fraglich. Der Armin hatte sich gut eingegliedert in Beilngries, war prompt der Freiwilligen Feuerwehr beigetreten, aber meistens blieb er für sich und interessierte sich weder für Fußball noch für ihren Freitagsstammtisch. Für Frauen interessierte er sich auch nicht, wie es schien. Harald wusste nicht, ob ihn irgendetwas interessierte, den schmächtigen Mann aus dem Nordosten der Bundesrepublik. Von Judith hatte er neulich erfahren, dass er neuerdings auch im örtlichen Karateclub war. Immerhin etwas.
Vor dem Bürogebäude parkte ein schwarzer Audi mit Düsseldorfer Kennzeichen. Harald ahnte, wem der gehörte. Der Ludwig wohnte seines Wissens nach in Düsseldorf. Anscheinend war er nach Hause gekommen, um seinen Vater zu beerdigen.
Harald stellte seinen Wagen daneben ab und atmete tief durch. Er konnte noch immer nicht fassen, dass sich der Chef erschossen hatte. In derselben Nacht, in der er ein Leben gerettet hatte, hatte der Chef seines eigenhändig beendet. Der Krankenbesuch in Ingolstadt hatte ihn aufmuntern sollen, aber das war nach hinten losgegangen. Er fühlte sich deplatzierter als vorher. Mit dem Chef hatte die Brauerei auch Herz und Seele verloren. Nun gab es nur noch eins, was ihn ein wenig aufbauen konnte: ein gelungener Sud Extradolde. Hoffentlich hatte es der Wastie nicht verbockt.
Er hatte es verbockt. Harald fiel aus allen Wolken. »Wie bitte? Umgekippt? Was soll das heißen?«
Der Wastie hob betreten die Schultern und wurde immer kleiner. »Tut mir ja echt leid, Harry, aber da war was faul«, gab er duckmäuserisch zu Protokoll. »Ich hab’s zum Glück gemerkt, bevor ich den Hopfen reingelassen habe.«
»Was redest du für einen Blödsinn?«, fuhr Harald ihn an. »Im Maischebottich war noch alles in Ordnung. Das habe ich überprüft, bevor ich weg bin.«
»Glaub ich dir schon«, erwiderte der Wastie. »In der Pfanne nach dem Läutern aber nicht mehr. Probier es doch selbst. Es schmeckt wie verbrannte Kartoffeln. Wahrscheinlich stimmt im Wasserzulauf irgendwas nicht. Da ist irgendwas reingekommen. Der Hansi ist schon dran an der Sache.« Der Hansi war ihr Hauselektriker und außerdem Klempner und Fahrzeugwart. Das Mädchen für alles, ohne das hier gar nichts lief.
Harald marschierte schnurstracks zum Braukessel und ließ eine Probe aus dem Hahn ab. Der Wastie hatte recht. Irgendetwas stimmte nicht. »Pfui Deibel.« Er spuckte auf den Boden. »Na gut, lass es ab. Den Sud können wir vergessen. Scheiße! Scheiße noch mal!«
»Hey, das ist nicht unsere Schuld, klar?«, meinte der Wastie und parkte eine Hand auf Haralds Schulter. »Nicht deine und nicht meine. Und es hätte schlimmer kommen können. Sei froh, dass ich den Hopfen noch nicht zugegeben habe.«
Harald entwand sich der kumpelhaften Geste. »Weiß es die Chefin schon?«
»Ja.«
»Was hat sie gesagt?«
»Eigentlich gar nichts. Hat sie gar nicht interessiert, glaub ich. Sie hat nach dir gefragt, wollte etwas mit dir klären.«
»So? Hat sie erwähnt, was?«
»Nein. Und du kannst jetzt auch nicht rein zu ihr. Der Ludwig ist vorhin gekommen.«
»Hab mir schon gedacht, dass er das ist. Wie viel Malz ist noch da?«
»Was?«
»Reicht es für einen weiteren Sud?«
»Ja, schon«, bestätigte der Wastie. »Aber schau mal auf die Uhr, Harry.«
»Die Uhr ist mir scheißegal!«, erwiderte Harald scharf. »Los, fang an!«
Der Wastie zierte sich und trat von einem Fuß auf den anderen. »Ach, Harry… du, jetzt hör mal, meine Tochter hat heute Geburtstag. Ich muss heute wirklich pünktlich heim.«
»Du hast doch nur eine Tochter, oder, Wastie?«
»Ähm… ja, schon.«
»Sollte die nicht im September Geburtstag haben?«
»Wieso im September?«
»Weil du wegen ihrem Geburtstag letztes Jahr mal die Spätschicht hast ausfallen lassen. Erinnerst du dich? Das war an einem Abend, als die Sechz’ger zu Hause gespielt haben.«
Der Wastie verdrehte die Augen und nickte ertappt. »Okay, unsere Tochter hat kurz vor Weihnachten Geburtstag«, gab er zu. »Aber heute ist unser Kegelabend. Scheiße, Harry, wir können doch jetzt nicht noch einen Sud aufsetzen!«
»Mach es«, erwiderte Harald und hielt auf sein Büro zu, ein kleines Kabuff neben dem Aufzug in den alten Gärkeller. »Und dann hau meinetwegen ab. Ich mache das schon. Ich habe keinen Kegelabend, weißt du?«
Der Wastie eilte ihm hinterher. »Jetzt warte halt. Lass mich nicht so stehen. Ich will dir ja helfen, wenn es sein muss. Aber willst du nicht erst mal schauen, ob der Hansi herausfindet, was falsch gelaufen ist? Vielleicht hat es gar keinen Sinn, heute noch was anzusetzen…«
Harald sah ein, dass er recht hatte. Überaktionismus half ihnen jetzt auch nicht. Sich zu beschäftigen würde seinem Gemütszustand guttun, aber der Firma half es wahrscheinlich nicht.
»Das mit dem Chef macht uns alle fertig«, sagte der Wastie im Verschlag. »Aber wir müssen jetzt cool bleiben. Oder fürchtest du etwa, dass wir unsere Jobs verlieren?«
Harald schaute ihn an. »Wie kommst du denn darauf?«
Der Wastie zuckte unbeholfen mit den Achseln. Eine Geste, die er im Schnitt dreißig Mal am Tag vollführte. »Ich denke mir halt, wenn der Ludwig die Hälfte von der Brauerei bekommt, sind wir bald geliefert. Die Chefin kann ihn doch unmöglich auszahlen.«
Das stimmte zweifellos. Harald hatte keinen Einblick in die Bücher, aber die Brauerei verfügte garantiert nicht über so viele Rücklagen, um einen gleichberechtigten Erben auszulösen. Falls der Ludwig auf seinen Anteil bestünde, wäre die Firma in bestehender Form am Ende. Man müsste sie verkaufen. Harald glaubte allerdings nicht, dass sich die Sachlage so verhielt. Der Seniorchef– Gott hab ihn selig– hatte nicht viel übriggehabt für seinen Sohnemann. Die Brauerei war sein Ein und Alles, und bevor er sich den Kopf mit einer Schrotflinte weggeblasen hatte, hatte er garantiert testamentarisch verfügt, dass alles an Ulrike ging. Das hoffte Harald zumindest inständig.
* * *
Frau Schiffkowitz grüßte Ludwig schüchtern aus ihrem offenen Büro. Ludwig grüßte mit einer flapsigen Handbewegung zurück. Der Papa hatte sie als Buchhalterin eingestellt, als er noch ein Teenie war. Sie war inzwischen etwa doppelt so schwer wie damals, und die krausen Locken auf ihrem Kopf waren ergraut. Ludwig verspürte eine boshafte Genugtuung ob der Erkenntnis, dass auch andere Leute grauer, älter und dicker wurden.
Das Geländer an der Treppe zum ersten Stock hoch wackelte, wie es schon immer gewackelt hatte. Die nichtssagenden Bilder an den Wänden, der dunkelblaue Industrieteppich am Boden, hier hatte sich rein gar nichts verändert. Vom Keller stieg ein aromatisches Duftgemisch aus geschrotetem Malz und Hopfen auf. Ludwig glaubte darin Nuancen von Kakao, Karotten und den Geruch alter Bücher zu entdecken. Er hatte das schon immer gemocht. Für fertiges Bier hatte er sich allerdings nie erwärmen können. Er trank lieber Wein. Vielleicht ein zusätzlicher verspäteter Grund, warum es zwischen ihm und seinem Vater nie geklappt hatte. Oder schlichtweg eine unterbewusste Trotzreaktion.
Papas Büro, das erste Zimmer nach dem Treppenhaus, stand offen. Der alte Schreibtisch aus schwarzem Mahagoni war aufgeräumt, am Fenstersims hinter dem Ledersessel blühten Blumen. Der Sonneneinfall durch das große Fenster gestaltete den Raum warm und freundlich. Ludwig hatte sich hier einige Male aufgehalten. Wärme und Freundlichkeit hatte er allerdings nie erfahren. Im besten Fall Gleichgültigkeit. Distanzierte Gleichgültigkeit.
Nebenan befand sich Ulrikes Büro. Die Tür war geschlossen. Ludwig klopfte und wurde nach kurzem Verharren hereingebeten.
Ulrike schaute düster von ihrem Schreibtisch auf. Sie war ein bildschönes Frauenzimmer, das mit freundlichen Blicken noch hübscher gewesen wäre. Solche hatte sie in seiner Gegenwart jedoch selten übrig. Sie war ganz die Tochter ihres Vaters: groß und gut aussehend, mit vollen schwarzen Haaren, die seit jeher lang und ungebunden fielen. All die coolen Jungs damals, mit denen Ludwig gern befreundet gewesen wäre, hatten ihr zu Füßen gelegen. Die Hellste war sie allerdings nicht. Auch ein Grund, warum sie mit siebzehn schwanger geworden war und es einen DNA-Abgleich gebraucht hatte, um den Vater zu ermitteln.
»Schau an, der verlorene Sohn kehrt heim. Hast dir ziemlich Zeit gelassen, findest du nicht?«
»Zeit gelassen? Ah, ich verstehe, du hättest Beistand bei der Trauerbewältigung gebraucht«, frotzelte Ludwig zurück. »Tut mir leid, ich war mir sicher, du hast genug Schultern, an denen du dich ausweinen kannst. Starke Schultern und warme Betten. Darf ich mich setzen?«
»Keine Ahnung. Frag deinen Orthopäden.«
Ludwig seufzte und nahm ihr gegenüber Platz. Sie versprühte gerade die Aura einer dunklen Gewitterwolke. Ihr Büro war moderner eingerichtet als das vom Papa. Ein flexibler Multifunktionsschreibtisch mit zwei Laptops, Kopiergerät und Fax unauffällig und platzsparend in ein massives Regal an der Wand gepfercht. Blumen oder Grünzeug suchte man vergebens, dafür gab es ein paar kitschige Wandstickereien und ein schwarzes Sitzpolster in der Ecke. Vielleicht zum Meditieren. Sie war der Typ für so was.
»Das ist jetzt der Moment, in dem du mir Kaffee anbieten könntest, liebe Schwester.«
»Tja, es ist aber der Moment, in dem ich dir sage, dass du mich kreuzweise kannst.«
»Ah ja, die Herzlichkeit in diesen Mauern habe ich am meisten vermisst.«
»Wenn du was zu sagen hast, sag es jetzt, ich habe nicht ewig Zeit.«
»Er hat sich also erschossen«, resümierte Ludwig sachlich. »Also bitte, erzähl mal. Warum hat er das getan? War er desillusioniert, nachdem du versucht hast, etwas Schlaues zu sagen?«
Sie reagierte nicht auf die Spitze, sondern senkte den Blick und schüttelte unmerklich den Kopf. »Ich weiß es nicht.«
»Diesen Zustand bin ich von dir gewohnt. Nun gut, dann rate doch.«
»Hey, glaub bloß nicht, du kannst hier einfach reinschneien und den Ton angeben!«, fauchte sie und fuhr explosionsartig von ihrem Stuhl hoch. »Niemand hier ist dir irgendwelche Rechenschaft schuldig! Ich zuallerletzt!«
»Schon gut, beruhige dich«, sagte Ludwig und schaute zu ihrer hoch aufragenden Gestalt auf. »Setz dich bitte wieder und lass uns in aller Ruhe darüber reden.«
Sie formte ein hässliches Grinsen. »Darüber reden? Ich habe nichts mit dir zu bereden, Bruder«, stellte sie geziert klar und nahm wieder auf ihrem lehnenbewehrten Drehstuhl Platz. »Die Beerdigung und die Trauerfeier habe ich schon allein organisiert. Es ist alles in bester Ordnung. Deine Hilfe wird nicht gebraucht. Du hast morgen selbstverständlich einen Platz an unserem Tisch und darfst Ralf und mich mit deiner erfrischenden Gesellschaft erfreuen.«
»Das ist ja reizend, ich bin gerührt«, entgegnete Ludwig. »Die Einladung nehme ich dankend an. Worauf darf ich mich außerdem noch freuen? Wird jemand eine Grabrede über unseren großartigen Papa halten? Werden wir uns an den Händen halten und uns an unsere ach so glücklichen Kindertage erinnern?«
Mit einer unmissverständlichen Geste wies sie zur Tür. »Wenn du jetzt bitte verschwinden würdest, ich habe zu tun.«
Ludwig blieb unbewegt. »Ulrike, ich bin’s, dein Bruder«, sagte er. »Du kannst mich nicht so abspeisen. Jetzt erzähl mir schon, was los war.«
»Ach, schau an, du möchtest plötzlich Anteil nehmen«, erwiderte sie schneidend. »Jetzt, wo er tot ist, interessierst du dich für unseren alten Herrn. Schielst auf deinen Erbteil, wie? Da muss ich dir wohl ein paar Illusionen nehmen. Der wird sehr gering ausfallen.«
»Komm mir nicht so! Ich will nichts von euch. Rein gar nichts! Und das fehlende Interesse aneinander war nicht einseitig, wie du sehr genau weißt.«
»Oh, darf ich mir jetzt wieder deine alte Mitleidstour anhören? Papa hasst mich!«, äffte sie ihn mit dümmlich quäkender Stimme nach. »Papa kann mich nicht ausstehen! Papa will mich versagen sehen! Er gibt mir keine Chance!«
Ludwig hatte vorausgeahnt, dass dieses Treffen so ablaufen würde, deshalb konnte sie ihn jetzt auch nicht provozieren. »Habt ihr irgendwelche Probleme mit der Firma?«, fragte er. »Hat er deshalb Schluss gemacht?«
»Nein, haben wir nicht«, erwiderte sie hoheitsvoll. »Das Geschäft läuft gut. Unser Bier hat den besten Ruf und gehört zu den beliebtesten in der Region.«
»Warum hat unser Papa sich dann umgebracht?«
»Ich weiß es nicht, Scheiße noch mal!«
»Du musst wenigstens irgendetwas ahnen«, hielt Ludwig ihr entgegen. »Man bringt sich nicht einfach so um. Verflucht, ihr wohnt sogar im selben Haus! Du musst doch etwas mitbekommen haben!«
»Ich weiß aber nichts.« Sie begann zu schreien. »Ich! Weiß! Nichts! Kapierst du? Ich habe keine Ahnung, warum er sich den Schädel weggeblasen hat! Nicht die geringste beschissene Ahnung! Kapiert?«
Ludwig wartete ein paar stille Sekunden ab. »Woher hat er überhaupt eine Schrotflinte? Ist er unter die Entenjäger gegangen?«
»Ich habe nicht gewusst, dass er eine hat. Ich habe sie auch nie im Haus gesehen«, schnaubte Ulrike angriffslustig wie eine halbsatte Löwin, die man besser nicht noch weiter reizen sollte.
Ludwig war es einerlei. Er wollte ein paar Antworten. »Du hast also nicht gewusst, dass er eine Schrotflinte hat, und hast noch weniger Schimmer, warum er aus dem Leben scheiden wollte«, rieb er ihr hin. »Klingt so, als wäre ich nicht der Einzige, der sich von ihm entfernt hat.«
Ulrike schrie wie eine Furie auf und schleuderte eine leere Kaffeetasse nach ihm, der er nur mit einem Satz von seinem Stuhl ausweichen konnte. Die Tasse traf die Lehne, machte einen sachten Hopser auf die Sitzfläche und fiel dann ohne zu zerbrechen auf den Teppichboden.
»Jetzt hör schon zu spinnen auf!«, rief Ludwig, rappelte sich hoch und nahm wieder Platz. Schon sitzend, hob er die Tasse auf und stellte sie auf den Schreibtisch zurück. Ulrike stand ihm gegenüber und malträtierte ihn mit vergifteten Blicken. Ludwig war ihr nicht böse. Er hatte erreicht, was er wollte. Aus ihr sprach der Schmerz. Aus ihrer harschen Reaktion schloss er echte Betroffenheit. Deshalb durfte er davon ausgehen, dass sie weitgehend die Wahrheit sagte und dass zwischen ihr und dem Papa tatsächlich alles in Ordnung gewesen war. Zumindest aus ihrer Sicht.
»Lass uns noch mal von vorn anfangen«, bat er nun mit sanfter Stimme. »Was meinst du? Kriegen wir das hin?«
Sie nickte und entspannte sich etwas. »An mir soll es nicht liegen. Aber noch ein blödes Wort von dir und ich zerquetsche dich wie einen Wurm.« Sie setzte sich wieder, wobei sie Ludwig nicht aus den Augen ließ. Sie hatte die Beherrschung verloren. Damit war sie in der Defensive– genau wo er sie haben wollte.
»Wie geht es dem Ralf denn?«, streute er zur Auflockerung ein. Sein Neffe musste inzwischen sechzehn sein, rechnete er nach. »Wie kommt er damit zurecht?«
»Bestens«, behauptete Ulrike.
»Hat er ein gutes Verhältnis zum Papa gehabt?«
»Ja. Er macht heuer seinen Schulabschluss, dann nimmt ihn der Falter Harry unter seine Fittiche. Er will Braumeister werden.«
»Du ziehst ihn also als zukünftigen Chef auf.«
»Was dagegen?«
Ludwig war es gleich. »Geht mich nichts an, der Betrieb. Du wirst schon wissen, was du tust. War das auch im Sinn vom Papa? Ihn heranzuziehen?«
»Sicher, was denkst du denn? Er hat sich seinen Platz hier verdient.« Im Gegensatz zu dir, ließ sie unausgesprochen, aber Ludwig konnte es trotzdem hören. Ihre Augen sagten es, schleuderten es ihm geradezu entgegen, voller Verachtung und Selbstgerechtigkeit.
Ludwig ärgerte weniger, dass sie ihn nicht mochte, sondern dass sie ihn nicht respektierte und ihn für einen Trottel und Versager hielt. Er schob den Gedanken beiseite. Es war der falsche Zeitpunkt, an diesem Zustand zu arbeiten. »War an den Todesumständen irgendetwas unklar?«
»Was soll denn unklar gewesen sein?«
»Na ja, warum ist die Leiche erst jetzt, nach anderthalb Wochen, freigegeben worden? Warum ist er so lange untersucht worden?«
»Standardprozedur bei Selbstmorden«, antwortete Ulrike lakonisch. »Hat jedenfalls diese Polizistin gesagt, die hier war.«
»Wie heißt die? Eine von hier?«
»Nein, eine aus Ingolstadt. Warum willst du das wissen?«
»Vielleicht will ich mich mit ihr unterhalten.«
»Das habe ich schon getan.«
»Und was hat sie gesagt?«
»Scheiße, was willst du überhaupt?«
»Ich will mir ein Bild machen, was sonst? Der Papa bringt sich um, und die Polizei untersucht anderthalb Wochen lang seine Leiche. Wirst du da etwa nicht stutzig?«
»Nein, warum sollte ich? Hat wohl etwas länger gedauert, weil die noch andere Leichen zu untersuchen haben.«
Ludwig musterte seine Schwester. Anscheinend war sie von dem überzeugt, was sie sagte. Nun, Schlussfolgerungen waren noch nie ihre Stärke gewesen. Er war sich nicht mal sicher, ob sie damals einen Zusammenhang zwischen ihren vielen Liebschaften und ihrer Schwangerschaft hergestellt hatte. Ludwig wiederum neigte gewöhnlich dazu, mehr hineinzuinterpretieren, als da war, und im hiesigen Fall gab es beängstigend viel Spielraum.
* * *
Die reguläre Besuchszeit war schon um, als an diesem Tag noch ein dritter Besucher hereinschneite. Drei mehr als Julia Öttl erwartet hatte. Mit diesem hatte sie am allerwenigsten gerechnet. Der Anblick des Mannes rührte in finsteren Erinnerungen, die sie in die hintersten Winkel ihres Gedächtnisses verbannt hatte und die dort trotzdem jeden Tag von sich reden machten. Was sie auch tat, ob sie kochte, Sport trieb oder im Kino saß, irgendetwas spülte sie immer in den Vordergrund. Sie zu ignorieren, war ein unmögliches Unterfangen. Sie waren noch zu präsent, um sie mit Alltagsbanalitäten zu überspielen. Julia hatte akzeptiert, dass sie fortan Teil ihres Lebens sein würden. Die Gerüche, die seltsame Musik, die panischen Schreie, alles war noch da und so frisch, als wäre es erst gestern passiert. Und die Angst. Vor allem die war noch da.
Der Mann, der nun steif und mit langen Schritten in ihr Krankenzimmer einmarschierte, hatte sie gezwungen, all die Schmach und den Schmerz noch ein zweites Mal zu durchleben. Wer weiß, vielleicht hätte die natürliche Schutzfunktion ihres Gehirns sie die Sache vergessen lassen, hätten dieser Mann und seine Kollegen nicht dafür gesorgt, dass sie für immer konserviert wurde. Sie hatten sie und ihre Mitgefangenen nach der Befreiung intensiv befragt. Geführt hatte es zu nichts.
»Die müssen mir ganz schön starke Schmerzmittel verabreichen«, sagte Julia, ohne den Blick von dem Besucher zu nehmen. »Im Augenblick habe ich eine besonders böse Halluzination.«
Zuletzt hatte sie ihn vor einem Jahr gesprochen. Hauptkommissar Rupert Östergrund war seitdem ziemlich grau geworden. Aber er war noch immer drahtig. Eine Gazelle mit dem spitzen Gesicht eines Fuchses und den scharfen Augen eines Raubvogels. Angezogen war er wie ein Pinguin und sah damit mehr wie ein Versicherungsvertreter als ein LKA-Beamter aus.
»Ich fürchte, so viel Glück haben Sie nicht«, entgegnete er mit einer angedeuteten Verbeugung. »Ich bin aus Fleisch und Blut, bedaure.«
»Nicht so sehr wie ich. Tja, das mit dem Glück ist eben so eine Sache.« Sie bewegte ihren eingegipsten rechten Arm, soweit es die Fixierung zuließ. »War schon immer so, nicht wahr? Die einen haben es, die anderen nicht.«
»Zu welcher Sorte zählen Sie sich?«, fragte er.
Hätten sie die Schmerzmittel nicht ein Stück weit sediert, hätte sie diese selten dämliche Frage zornig gemacht. »Sehen Sie mich an«, sagte sie und versuchte, ein kaltes Grinsen hinzubekommen. »Und dann raten Sie mal.«
»Nun, Sie haben drei Monate in der Gewalt eines Psychopathen überlebt und jetzt einen Autounfall«, sagte Östergrund und zog einen Stuhl heran. »Meiner Einschätzung nach gehören Sie zu denen, die Glück haben.« Er nahm neben ihrem Bett Platz. »Verzeihen Sie den späten Überfall, Julia. Wie geht es Ihnen?«
»Wie Sie nur fragen können, Sie mieser…« Dann brach sie ab, weil sie einsah, dass sie ihren Frust auf die falsche Person projizierte. Die Schmerzmittel stimmten sie anscheinend auch milde. Trotzdem wehrte sich in ihr gerade alles gegen ein Gespräch mit diesem Mann. Gespräche mit ihm bedeuteten Erinnerungen. Gespräche mit ihm bedeuteten Angst. Ihn zu sehen oder auch nur an ihn zu denken, war schon genug. Auch wenn er und seine Kollegen nur helfen wollten, sie hielten den Alptraum in ihr wach und lebendig. »Haben Sie mir wenigstens Blumen mitgebracht?«, schob sie hinterher.
Er schüttelte den Kopf. »Sie hätten keinen Wert darauf gelegt. Sie hätten es als scheinheilige Anbiederei empfunden, was es auch gewesen wäre. Mit Blumen hätte ich uns somit beide beschämt.«
»Ja, wahrscheinlich«, antwortete sie heiser und räusperte sich. »Was zum Geier machen Sie in Ingolstadt?«
»Ich bin Ihretwegen hergekommen.«
Julia war verwirrt. »Wegen dem Unfall? Wie haben Sie davon erfahren? Beschatten Sie mich etwa?«
»Sagen wir, ich halte mich über Sie und Christina auf dem Laufenden. Wenn Sie umziehen, wenn Sie Ihre Arbeitsstellen wechseln oder wenn Sie in Krankenhäuser eingeliefert werden, dann erfahre ich das.«
»Wie rührend, Ihre Sorge um uns.«
»Reiner Pragmatismus. Ich hasse offene, ungelöste Angelegenheiten.«
»Lassen Sie uns endlich in Ruhe. Wir sind gerade dabei, unser Leben wieder in den Griff zu bekommen. Sie behindern uns dabei. Kapieren Sie das denn nicht? Wann immer Sie auftauchen, durchleben wir die ganze Scheiße noch einmal!«
»Das tut mir leid und entspricht nicht meiner Absicht«, entgegnete Östergrund resolut. »Sie bekommen Ihr Leben also wieder in den Griff? Ich freue mich, das zu hören.«
Nach außen trug er diese Freude nicht. Östergrund wirkte so stoisch und außen vor wie immer. Hellwach und nüchtern, zweifellos, aber ein freundliches Gesicht hatte ihr der Fuchs noch nie gezeigt. Vermutlich hatte er keins.
»Wie sieht Ihr Leben denn derzeit aus?«, fragte er. »Möchten Sie mir davon erzählen?«
Die Frage ärgerte Julia bis ins Bodenlose. »Sehen Sie doch mal genau hin, verdammt noch mal!«, fauchte sie ihn an. »Wollen Sie sich über mich lustig machen?«
»Das liegt mir fern«, antwortete er. »Meine Frage zielt nicht auf Ihren Unfall und seine Folgen ab. Haben Sie eine Beziehung?«
»Was geht Sie das an?«
»Es interessiert mich.«
»Sie sind ein Widerling.«
»Mag sein. Also? Haben Sie?«
Er schien sie mit seinen Blicken aufzuspießen, und Julia überflutete eine Mischung aus Scham und Ärger, wobei die Scham zuletzt die Oberhand gewann. Ihre Augen wurden feucht. »Bitte gehen Sie«, bat sie, nicht mehr als flüsternd. »Sehen Sie denn nicht, dass Sie mir nicht guttun? Sie machen alles nur noch schlimmer.«
»Ich bin nicht nur aus Fürsorge hier, Julia«, entgegnete Öster-grund und bemühte sich jetzt wenigstens, freundlich und einfühlsam zu klingen.
Ein schlechter Imitator, dachte Julia, denn solche Eigenschaften waren diesem Mann nicht zu eigen.
»Wie hat sich Ihr Unfall zugetragen? Bitte schildern Sie mir den Hergang.« Östergrund sprang von einem Thema ins nächste, womit er Julias von Schmerzmitteln vernebeltes Gehirn noch zusätzlich malträtierte. Als ob seine Anwesenheit nicht schon genug wäre. Wahrscheinlich steckte eine Absicht dahinter. Der Mann war ein rücksichtsloser Sadist.
»Ich bin von der Straße abgekommen«, gab sie ihm zur Antwort. Sie musste antworten. Anders würde sie ihn nicht los. So gut kannte sie ihn.
»War noch ein anderes Fahrzeug beteiligt?«
Die Frage erstaunte sie. »Nein. Nein, ich glaube nicht.«
»Sie glauben nicht?«
»Ich kann mich nicht genau erinnern.«
»An was erinnern Sie sich denn?«
»Lärm, Hitze, Stimmen… und dann war ich hier. Im Krankenhaus.«
»Was war davor? Wie hat sich der Unfall ereignet?«
»Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern.«
»Was ist das Letzte, woran Sie sich erinnern? Denken Sie nach. War da noch ein zweites Fahrzeug?«
»Nein! Nein. Zumindest hat mir niemand von einem zweiten Fahrzeug erzählt. Weder der Arzt noch die Feuerwehr.«
»Mit wem haben Sie über den Unfall gesprochen?«
Seine Fragen fielen lärmend und polternd über ihren Verstand her. Am liebsten wollte sie laut aufschreien. Ihre freie Hand wanderte zu dem Knopf, mit dem man die Schwester rufen konnte. »Hören Sie auf«, flehte sie geschlagen, den Finger mit dem Knopf auf Tuchfühlung. »Hören Sie bitte auf. Ich kann nicht mehr. Gehen Sie!«
Östergrund verharrte ein paar Sekunden lang bewegungslos. Julia konnte nicht in seinem Gesicht lesen, aber offenbar hatte sie ihn erreicht. Vielleicht hatte er kapiert, dass er zu weit ging. Überraschend senkte er den Kopf und erlöste sie für kurze Momente von seinem sezierenden Blick. Eine Entschuldigung folgte nicht, doch immerhin hatte er sich von ihr aufhalten lassen. Der wütende Bulldozer, der seine Fragen wahllos in ihren Kopf hämmerte, hielt inne und drosselte seinen Motor.
Als Östergrund sich ihr wieder zuwandte, wirkte er… ja, wie? Traurig? Nein, ausgeschlossen. Die Schmerzmittel mussten ihr einen Streich spielen. Er diagnostizierte das unbenutzte Nachbarbett. »Sie haben dieses Zimmer für sich allein?«
Schon wieder eine neue Fragerichtung. Julia gab ihren nutz-losen Widerstand auf, schloss die Augen und nickte. Sie wünschte, dass der Mann verschwunden wäre, wenn sie sie wieder öffnete, wusste aber auch, dass er ihr diesen Gefallen nicht tun würde. Er war ein Folterer. Er folterte mit Fragen. Schon so oft hatte sie ihn ertragen müssen, und selbst jetzt, im Krankenbett nach ihrem schweren und beinahe tödlichen Autounfall, ließ er nicht von ihr ab.
»Mir wäre wohler, Sie wären hier nicht allein«, sagte er.
Julia schlug die Augen wieder auf. »Ich wünschte, ich wäre überhaupt nicht hier. Was wollen Sie von mir, Herr Östergrund?«
»Versuchen Sie sich zu erinnern«, bat er eindringlich. »Wie hat sich der Unfall zugetragen? Was ist das Letzte, woran Sie sich erinnern?«
Um ihn loszuwerden, gewährte ihm Julia den Gefallen und suchte in ihrem Kopf nach Bildern, Fragmenten, die mit dem Unfall zu tun hatten. Er hatte nach einem zweiten Fahrzeug gefragt. War da eins? Julia fand keins. Sie rekapitulierte die Unfallnacht, so gut sie konnte, und sah nur Nacht und die Scheinwerfer ihres eigenen Fahrzeugs, die Straße, das Gras am Fahrbahnrand und ab und zu einen Baum. Gegenverkehr? Ja, gelegentlich hatte es entgegenkommende Fahrzeuge gegeben, aber keines war ihr zu nahe gekommen. Keines hatte sie geblendet. Sie kramte nach Gedanken. Woran hatte sie beim Autofahren gedacht? An das aufwühlende Gespräch mit Christina natürlich. Und an Bobby, ihren Freund, der ihr Leben seit ein paar Wochen erträglicher machte. Ihm einen Anstrich von Normalität gab. Würde er bei ihr bleiben? Jetzt, da sie so entstellt war? Panik drohte sie einzuholen, doch Julia drängte sie fürs Erste erfolgreich zurück. Nicht in Östergrunds Gegenwart, impfte sie sich ein. Nicht vor ihm.
»Ich weiß nichts mehr«, stellte sie klar. »Wahrscheinlich bin ich am Steuer eingeschlafen.«
Östergrund nickte so ausdruckslos wie eine Holzpuppe mit Wackelkopf, der man einen kleinen Schubs gegeben hat. »Was hatten Sie mit Christina zu bereden?«
In Julias Kopf schrillten Alarmglocken. »Woher wissen Sie–«
»Bitte, das liegt doch auf der Hand«, unterbrach er sie mit erhobener Hand. »Warum sonst wären Sie hier in der Gegend? Also, was hatten Sie mit Christina zu bereden? Haben Sie irgend-welche Sorgen? Belastet Sie etwas?«
Julias Gedanken rotierten im Kreis. Was ging hier vor? Was wollte Östergrund von ihr? Warum stellte er ihr und Christina immer noch nach?
»Julia«, sprach er in einem Tonfall, der sie wohl beruhigen sollte. »Mich zu sehen und mit mir zu reden, das muss Sie sehr aufwühlen. Das verstehe ich. Wirklich. Den gleichen psychologischen Effekt sollte nach meinem Verständnis aber auch ein Gespräch mit Christina bei Ihnen auslösen. Bitte erklären Sie es mir. Sie war Ihre Mitgefangene. Müsste sie denn nicht noch viel mehr schreckliche Erinnerungen in Ihnen wachrufen als ich?«
Doch, aber Christina ist erträglicher als du, dachte Julia. »Bitte gehen Sie«, bat sie noch einmal und entzog ihm den Blick.
»Bald«, sagte Östergrund. »Sehr bald. Aber vorher müssen Sie mir noch ein paar Fragen beantworten.«
Julia resignierte und gab allen Widerstand auf. Dieser Mann kannte kein Erbarmen. Sie könnte eine der Schwestern rufen, doch das war nicht die Art und Weise, wie sie diesen Kampf führen wollte. Sie hatte ihn so oder so verloren. Sie hatte alles verloren. Sollte er ruhig noch den Rest bekommen. Es war ihr egal. Es spielte keine Rolle mehr. Auch Bobby würde sie verlassen, wenn er sie erst ohne Bandagen zu Gesicht bekäme. Ihr bliebe nichts mehr. »Stellen Sie Ihre verdammten Fragen«, verlangte sie mit erstickter Stimme.
»Haben Sie derzeit eine Beziehung?« Die vorgeschützte Einfühlsamkeit war anscheinend ausgereizt. Östergrund hatte wieder auf kalt und emotionslos geschaltet.
Julia nickte.
»Wie lange schon?«
»Seit etwa vier Wochen.«
»Ist es Ihre erste Beziehung seit der Entführung?«
Julia nickte und spürte erneut Tränenwasser in den Augen.
»Ist es ein Mann?«
Nicken.
»Weiß er von dem Unfall? Wo ist er? Kommt er Sie bald besuchen?«
»Er ist beruflich viel unterwegs. Im Moment in Córdoba. Er weiß noch nicht Bescheid.«
»Warum haben Sie Christina besucht?«
»Wir wollten reden. Christina wollte reden«, verbesserte sie sich.
Östergrund starrte sie an und spielte erneut die Wackelpuppe. »Und Sie sind Christinas Ruf gefolgt«, konstatierte er. »Worüber haben Sie geredet?«
»Ihr geht es nicht sehr gut. Sie lebt allein. Sehr zurückgezogen. Schreibt zu Hause. Hat keine Freunde. Sie wohnt in einem Haus in Beilngries mit einer hohen Mauer außen herum, das sie fast nie verlässt. Sie hat Panikattacken. Regelmäßig. Fühlt sich beobachtet. Fühlt sich verfolgt. Sie glaubt, dass der Kerl wieder hinter ihr her ist.«
»Glauben Sie das auch?«
Julia schaute ihn wieder an. Gern hätte sie mit Nein geantwortet, aber das konnte sie nicht. Es wäre gelogen. Auch nach drei Jahren meinte sie fast jeden Tag die stierenden Blicke ihres damaligen Entführers im Genick zu spüren. Drei quälend lange Monate waren sie in seiner Gewalt gewesen. Sie, Christina und Anita. Drei Monate lang hatte er sie wie Tiere in einem Käfig gehalten, sie gedemütigt und gefoltert. In ihren Träumen tat er es noch.
»Manchmal«, setzte sie an, »fühle ich mich beobachtet. Manchmal spüre ich Augen, wo keine sind. Manchmal fühle ich mich… von Schatten verfolgt.«
Für Julia gänzlich unerwartet, nahm Östergrund ihre freie Hand fast zärtlich in seine. »Es gibt da etwas, das ich Ihnen bis heute vorenthalten habe«, sagte er. »Anitas Autounfall vor einem Jahr… nun, es ist noch ein zweiter Wagen daran beteiligt gewesen. Das hat die Untersuchung des Autowracks ergeben. Es gab Lackspuren eines anderen Wagens an der Karosserie.«
Julia war verwirrt, erst von seiner Geste, jetzt von seinen Worten. »Was… ich verstehe nicht. Was hat das zu bedeuten?«
»Unfall mit Fahrerflucht«, antwortete Östergrund sachlich. »So steht es im Untersuchungsbericht. Das andere Fahrzeug, falls es eins gab, konnte nicht ermittelt werden.«
»Was heißt das, falls es eins gab?«
»Es ist auch möglich, dass die fremden Lackspuren schon älter waren. Dass sie sich schon vor dem tödlichen Unfall an Anitas Auto befunden haben.«
In Julias Kopf reifte ein Gedanke, der zu schrecklich war, um ihn auszusprechen. »Unfall mit Fahrerflucht«, wiederholte sie wie in Trance.
»Anita war damals auf dem besten Weg, ihr Trauma zu überwinden«, fuhr Östergrund fort. »Sie ist eine Beziehung eingegangen, haben Sie das gewusst? Sie hat wieder einen Menschen in ihr Leben gelassen. Einen jungen Mann. Wenig später hatte sie den tödlichen Unfall.«
Julias Herz schlug schneller. Worauf Östergrund da anspielte, war ungeheuerlich. Und fast noch ungeheuerlicher war, dass er ihr das auf dem Krankenbett antrug. »Nein«, hauchte sie.
Östergrund ließ ihre Hand los und wurde wieder der kühle Rationalist, der er meistens war. »Die Parallele ist vielleicht nur Zufall«, erklärte er. »Unfälle passieren schließlich jeden Tag. Menschen kommen von der Fahrbahn ab, zum Beispiel weil sie dämlich genug sind, am Steuer zu telefonieren.«
»Aber das glauben Sie nicht«, wisperte Julia.
Östergrund zog eine Schnute, bevor er antwortete. »Sie drei haben damals einheitlich erklärt, dass Sie der Entführer zur geistigen, sexuellen und körperlichen Reinheit erziehen wollte. Vor einem Jahr nun fand Anita die Kraft, sich wieder auf eine Beziehung einzulassen. Sie schien das Trauma hinter sich zu lassen. Doch ihr Glück währte nicht lange. Nur ein paar Wochen. Ein tödlicher Autounfall hat alles beendet.« Er nahm einen tiefen Atemzug und fixierte sie wieder mit seinem Blick. »Hier und heute liegen Sie im Krankenhaus. Nach einem Autounfall. Und Sie erzählen mir, dass Sie seit ein paar Wochen eine Beziehung haben.«
Die Erkenntnis, worauf Östergrund hinauswollte, schien Julia kopfüber in ein schwarzes Loch zu stürzen. Sie drückte den Knopf, der die zuständige Schwester alarmierte. Sie drückte ihn mehrfach– und brach dabei in Tränen aus. »Er beobachtet uns«, bahnte sich die Gewissheit ihren Weg nach draußen. »Er beobachtet uns noch immer.« Weiterhin drückte sie im Stakkato den Alarmknopf. Das Zimmer begann sich um sie herum zu drehen, und plötzlich glaubte sie sich wieder in dem scheußlichen Käfig. Zusammen mit den beiden anderen Frauen. Die grellen blauen Lichter in der Finsternis, die laute Musik und der unheilvolle Schatten, der unentwegt um den Käfig tanzte, alles war wieder da. »Er beobachtet uns!« Sie und Christina saßen noch immer in dem Käfig. Nur Anita hatte entkommen können. Durch ihren Tod.
»Die Besuchszeit ist um, bitte gehen Sie«, verlangte die dicke Schwester namens Silvia. Julia hatte nicht bemerkt, dass sie hereingekommen war. Sie malträtierte noch immer den Alarmknopf, bis Silvia zärtlich ihre Hand davon löste. »Alles in Ordnung, Frau Öttl. Beruhigen Sie sich. Alles wird gut.«
Nichts wird gut! Julia schaute sich um. Östergrund war aufgestanden und schob seinen Stuhl in die Sitzecke zurück. »Wann haben Sie mit der Feuerwehr Kontakt gehabt?«, schoss er die nächste Frage auf sie ab.
»Was?«
Schwester Silvia fuhr ärgerlich zu ihm herum. »Ich bitte Sie, jetzt zu gehen, mein Herr. Die Besuchszeit ist um, und die Patientin–«