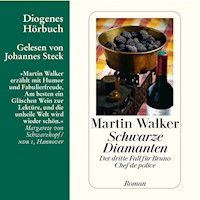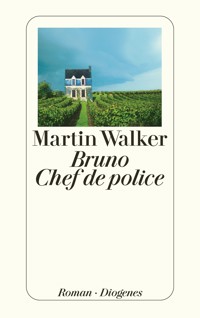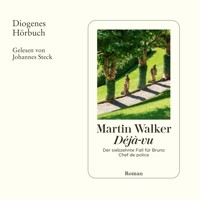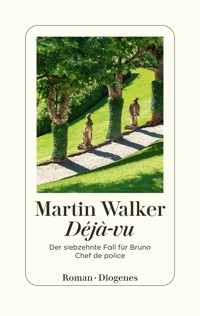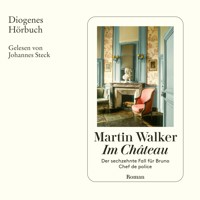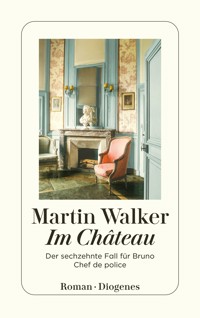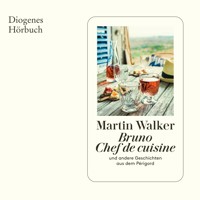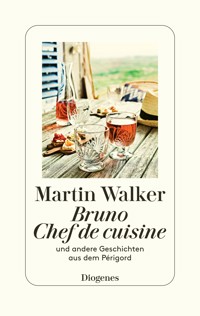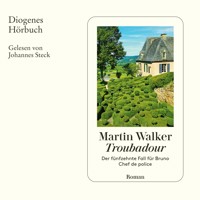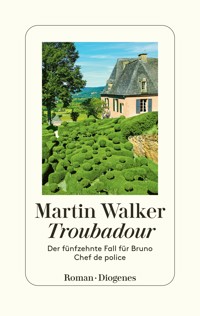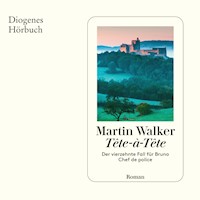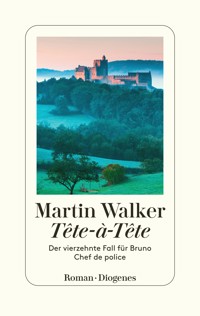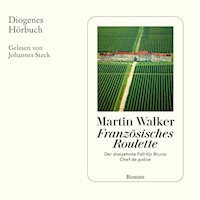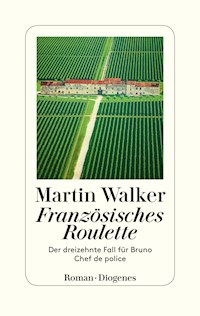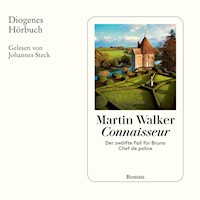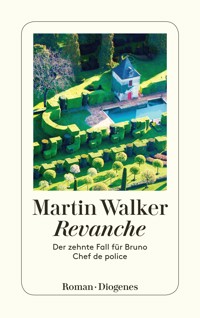
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Bruno, Chef de police
- Sprache: Deutsch
Martin Walkers Romane spielen im geschichtsträchtigen Périgord mit seinen herrlich trutzigen Burgen. Von einer davon, Commarque, brachen im Mittelalter die Tempelritter zu Kreuzzügen nach Jerusalem auf. Tausend Jahre später nimmt das einstige Morgenland eine späte Revanche in der Person einer jungen Archäologin, die bei den damaligen Eroberern einen sagenumwobenen geraubten Schatz sowie ein politisch höchst explosives altes Dokument zutage fördern will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Martin Walker
Revanche
Der zehnte Fall für Bruno, Chef de police
Roman
Aus dem Englischen von Michael Windgassen
Diogenes
Für Adèle
1
Bruno Courrèges, Chef de police der französischen Kleinstadt Saint-Denis, erwachte wenige Sekunden vor sechs, kurz bevor es hell wurde. Sein Hahn Blanco, benannt nach einer französischen Rugbylegende, begrüßte den neuen Tag, als Bruno in seinen Trainingsanzug schlüpfte und sich die Laufschuhe schnürte. Er freute sich auf seine allmorgendliche Joggingrunde durch den Wald hinter seinem Haus. Heute strahlte die Sonne durch das matte Grün der jungen Knospen und Blätter der Bäume, der Morgen war knackig und frisch, aber doch warm genug, dass er auf Handschuhe verzichten konnte, als er mit Balzac, seinem Basset, loslief.
Als er zurückkam, schimmerten die alten Steinmauern seines Hauses im frühen Sonnenlicht. Bruno fütterte seine Gänse und Hühner, wässerte den Gemüsegarten und schaute sich in dem neuen Treibhaus, das er als Bausatz gekauft und selbst aufgestellt hatte, die Setzlinge an. Danach stellte er den Wasserkessel für seinen Kaffee auf den Herd und ließ in einem Stieltopf zwei frische Eier garen, während er seine E-Mails checkte und dann das Radio einschaltete, das auf den Sender France Bleu Périgord eingestellt war. Er toastete die vom Vortag übriggebliebene Baguettehälfte, gab Balzac ein Stück davon ab und schnitt seines in pommes-große Stäbchen auf, mit denen er das noch flüssige Eidotter auftunkte. Als die wichtigsten überregionalen Meldungen verlesen worden waren, schaltete er auf den lokalen Nachrichtensender um. Die dritte Meldung ließ ihn aufhorchen.
»Madame Marie-France Duteiller, Psychologin aus Périgueux, kritisiert die Staatsanwaltschaft wegen schleppender Ermittlungen in den rund dreißig Jahre zurückliegenden Fällen mutmaßlicher sexueller Übergriffe auf Kinder in einem von der Kirche geführten Waisenhaus in der Gemeinde Mussidan. Sie bezeichnete die von Chefermittler Jean-Jacques Jalipeau geleiteten Untersuchungen als ›unsensibel und nachlässig‹ und wirft ihm vor, den Opfern nicht gerecht zu werden, die ihrerseits mehreren namhaften Persönlichkeiten vorwerfen, sie zur Zeit ihres Heimaufenthaltes missbraucht zu haben. Von Commissaire Jalipeau war gestern Abend zu hören, dass die Nachforschungen fortgesetzt würden, obwohl nur vage Verdachtsmomente vorlägen, da alle Anschuldigungen ausschließlich auf Erinnerungen basierten, die von Psychologin Duteiller in Hypnosesitzungen erfasst worden seien.«
Was Bruno da hörte, versetzte seiner guten Stimmung einen Dämpfer. Er seufzte voller Mitgefühl für seinen Freund Jean-Jacques, der schon seit Monaten an diesem Fall arbeitete und offenbar nicht weiterkam. Und das war ungewöhnlich. Bruno mochte durchaus einräumen, dass Jean-Jacques mitunter recht unsensibel sein konnte, aber Nachlässigkeit war das Letzte, was sich dem bulligen und etwas ungepflegten Mann vorwerfen ließ, mit dem er, Bruno, immer wieder gern zusammenarbeitete. Solche Kooperationen endeten für gewöhnlich mit einem Restaurantbesuch, zu dem Jean-Jacques als spendabler Gastgeber einlud, nicht nur zur Feier des Tages, sondern auch, um sich für die vielen Male zu revanchieren, die er an Brunos gastlichem Tisch hatte sitzen dürfen. Jean-Jacques’ heitere Persönlichkeit passte zu seiner Leibesfülle, und wie Bruno hatte er ein ausgeprägtes Faible für gutes Essen und guten Wein. Ihr freundschaftliches Verhältnis hatte auch keinen Schaden genommen, als nach einer noch nicht lange zurückliegenden terroristischen Straftat in einer Zeitung eine bissige Karikatur erschienen war, die Bruno als Asterix den Gallier und Jean-Jacques als seinen großen beleibten Freund Obelix darstellte, beide mit einer Flasche Bergerac-Wein in der Hand als Ersatz für den Zaubertrank, mit dem sich Asterix gegen römische Legionäre wappnete.
Anders als die meisten seiner Kollegen von der Police nationale schaute Jean-Jacques auf städtische Polizisten wie Bruno nicht herab. Im Gegenteil, er schätzte Brunos umfangreiche Kenntnisse der kommunalen Besonderheiten von Saint-Denis, die er als aktives Mitglied des Tennis-, des Rugby- und des Jagdvereins seiner Stadt über Jahre gesammelt hatte. Er akzeptierte dessen ganz eigene Art, mit der er seinen Aufgaben nachging, und konnte neidlos Brunos Anteil daran anerkennen, dass Saint-Denis die niedrigste Kriminalitätsrate im ganzen Département der Dordogne aufzuweisen hatte. Bruno seinerseits respektierte Jean-Jacques als strengen und gesetzestreuen Kriminalbeamten, der sich mit verblüffender Leichtigkeit im Dickicht der französischen Strafverfolgung zurechtfand. Egal, was im Radio über ihn kolportiert wurde – für Bruno gab es keinen Zweifel daran, dass Jean-Jacques Manns genug war, sich in allen Lebens- und Berufslagen zu behaupten. Und wenn er Brunos Hilfe brauchte, wusste er, dass er einfach nur darum bitten musste.
Bruno hatte sich vorgenommen, zur Reitschule seiner schottischen Freundin Pamela zu fahren, um Hector, sein Pferd, zu bewegen, und erst dann sein Büro in der mairie aufzusuchen. Vielleicht würden ihm im Sattel Ideen für die Rede einfallen, die er am Wochenende halten sollte. Und vielleicht wäre auch ein neuer Anzug fällig, dachte er, als er in Gedanken an die bevorstehende Hochzeit seinen Kleiderschrank durchforstete.
Zwei Drittel des Schranks nahm seine Berufsbekleidung in Anspruch: Polizeiuniformen für Sommer und Winter, dazu eine komplette Paradeuniform und ein Überzieher. Vor der Rückwand hing ein separater Kleidersack, in dem er seine Reservistenuniform mit dem Rangabzeichen als Sergeant der französischen Armee aufbewahrte. Damit hatte er anzutreten, wenn er dazu aufgerufen wurde. In der Abstellkammer stand neben der Waschmaschine ein verschließbarer Spind, in dem zum einen seine Jagdgewehre untergebracht waren, zum anderen seine tarnfarbene Kampfmontur, die er auch für die Jagd nutzte, sowie der alte Trainingsanzug aus seiner Militärzeit, den er nach seiner frühmorgendlichen Joggingrunde zum Lüften nach draußen gehängt hatte.
An ziviler Kleidung hatte Bruno nicht viel. Es gab einen Anzug aus dunkelblauer Schurwolle, den er sich gekauft hatte, nachdem er von einem Scharfschützen in Bosnien an der Hüfte verletzt und aus dem Militärdienst ausgemustert worden war. Die während des monatelangen Krankenhausaufenthaltes zugelegten Pfunde hatte er längst wieder abgespeckt, so dass ihm der Anzug mindestens eine Nummer zu groß war. Ein dunkelblauer Blazer und eine graue Tuchhose teilten sich einen weiteren Holzkleiderbügel. Daneben hingen Khaki-Chinos und eine dunkelrote Windjacke, die Bruno über seinem Uniformhemd trug, wenn er in Zivil auftreten wollte. Eine ähnliche Jacke in Schwarz hatte er in seinem Dienstwagen dabei, einem Kleintransporter. Auf dem Einlegeboden seines Kleiderschranks lagen zusammengefaltet ein Paar Jeans, mehrere Polohemden und Sweater, seine Polizei-képis sowie ein zerkratzter und verbeulter Blauhelm der UN-Friedenstruppe, den er aus sentimentalen Gründen aufbewahrt hatte.
Das Innenleben dieses Schranks, dachte Bruno, erzählte auf einen Blick die Geschichte seiner beruflichen Laufbahn mit den Stationen im Militär- und Polizeidienst. Außerdem machte er deutlich, dass sein Besitzer sehr viel häufiger Uniform trug als Zivil und sparsam mit seinem Geld umging, zumal sich in puncto Kleidung der Staat um fast alles kümmerte, was er brauchte. Der dunkle, einzige Anzug war von zeitloser Eleganz und unabhängig von den Launen der Mode, die die Hosen mal eng, mal weit sehen wollte und die Krawatten oder Revers im einen Jahr breit, im nächsten schmal.
Bruno war klar, dass seine Garderobe selbst für einen Polizisten vom Lande recht bescheiden ausfiel. Selbstkritisch befand er, dass er ein Mann war, dem es an Phantasie und Stilbewusstsein mangelte, hielt sich aber zugute, womöglich nur andere Prioritäten zu setzen. Er hasste Kaufhausbesuche, konnte aber stundenlang in Katalogen blättern und sich über Jagdgewehre informieren, die er sich ohnehin nicht leisten konnte, oder über Angelruten, wenn er wieder einmal mit dem Baron Forellen fangen wollte.
Das Gute an Hochzeiten war, dachte er, dass die Gäste normalerweise nur Augen für die Braut hatten. Niemanden würde interessieren, was er anhatte, und der dunkelblaue Anzug wäre durchaus angemessen. Die Trauung sollte in der mairie stattfinden und anschließend im engeren Freundeskreis im Nationalmuseum für Vorgeschichte in Les Eyzies gefeiert werden. Mit dessen lebensgroßen Modellen steinzeitlicher Menschen, die, in Tierhäute gehüllt, Speere in den Händen hielten oder Flintsteine bearbeiteten, bildete dieser Ort einen eher ungewöhnlichen Rahmen für eine Hochzeit. Bruno aber fand ihn durchaus geeignet, da sowohl die Braut als auch der Bräutigam hochangesehene Archäologen waren. Clothilde leitete das Museum als Chefkuratorin, während Horst, ein emeritierter Universitätsprofessor aus Deutschland, ihr als Assistent zur Seite stand und für archäologische Grabungen zuständig war. Auch die meisten Hochzeitsgäste stammten aus ihrem beruflichen Umfeld.
Bruno fragte sich, ob vielleicht paläolithische Kost auf dem Speiseplan stehen würde statt einer neuzeitlich-zünftigen Speisefolge. Wohl eher nicht, glaubte er. Horst hätte wahrscheinlich sein Vergnügen an Früchten, Nüssen und angekohltem Fleisch, aber Clothilde war eine vernünftige Französin. Ihr war natürlich bewusst, dass sich Gäste, die zu Besuch ins kulinarische Herzland Frankreichs kamen, auf Spezialitäten aus dem Périgord freuten.
Als Horsts Trauzeuge war Bruno ein bisschen nervös wegen der Tischrede, die er zu halten hatte, zumal er nicht umhinkommen würde, mit ein paar Worten auch auf die akademische Vita seines Freundes einzugehen, und das vor einem Publikum, zu dem einige der weltweit führenden Experten für Altertumsforschung zählten. Auf Brunos Nachttischchen lag die jüngste Ausgabe von Archéologie mit einem Aufsatz von Professor Horst Vogelstern, in dem er kleine weibliche Statuetten von verschiedenen europäischen Fundorten miteinander verglich.
Schon lange vor seiner Freundschaft mit Horst hatte Bruno diese Zeitschrift, die sich nicht nur an Fachleute wandte, abonniert, denn seit eh und je faszinierten ihn die überaus vielfältige Höhlenkunst und Vorgeschichte seiner heimatlichen Umgebung. Das Titelbild der aktuellen Ausgabe zeigte eine aus Ton gebrannte Frauengestalt mit gigantischen Hüften, einer ausgeprägten Vulva und Schlauchbrüsten; die Bildunterschrift lautete: »Miss Europa, 25000 v. Chr.« Neben der »ältesten Keramikfigur ihrer Art«, der Venus von Dolní Věstonice, benannt nach ihrem Fundort im heutigen Tschechien, illustrierten Horsts hochinteressanten Artikel noch etliche ähnliche Abbildungen.
Bruno war tief beeindruckt gewesen, als er gelesen hatte, dass bislang europaweit in Höhlen und Gräbern über hundert solcher Venusfigurinen aus der Zeit zwischen 28000 und 20000 Jahren v. Chr., also dem Jungpaläolithikum oder der frühen Altsteinzeit, gefunden worden waren. Unseren steinzeitlichen Vorfahren sei offenbar, so glaubte Horst, eine Faszination für großzügig proportionierte Frauen gemeinsam gewesen. Durchschnittlich fünf bis zwanzig Zentimeter hoch, waren diese Figurinen die ersten bekannten Darstellungen menschlicher Gestalten in äußerst stilisierter Form. Die Frauen – es waren durchweg weibliche Gestalten – kennzeichneten, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, enorme Brüste, ausladende Hüften und Schenkel, ein geschwollener Bauch und eine hervorgehobene Scham. Manche hatten raffinierte, sorgfältig modellierte Frisuren oder Kopfschmuck aus kleinen Muscheln, vergleichbar mit demjenigen, der im Museum von Les Eyzies ausgestellt war.
Die Überbetonung der primären Geschlechtsmerkmale ließ darauf schließen, dass man in ihnen Fruchtbarkeitssymbole gesehen hatte. Zahllose Bücher waren über diese Figurinen und ihre mutmaßliche Rolle in vorgeschichtlichen Kulturen verfasst worden. Häufig wurde vermutet, dass sie auf frühe matriarchale Stammesgesellschaften verwiesen, in denen weibliche Fruchtbarkeit als Mysterium schlechthin angesehen und angebetet worden war.
All dies eignete sich ausgesprochen gut als Material für eine witzige, vielleicht auch etwas stichelnde Rede zur Hochzeit, fand Bruno. Er könnte sich über Horsts lebenslange Faszination für Venusfigurinen im Besonderen und die weibliche Gestalt im Allgemeinen auslassen, was schmeichelhaft für die Braut wie den Bräutigam wäre und beider Leidenschaft für die Vorgeschichte anspräche. Er würde sagen, dass Horst in Clothilde die perfekte Frau gefunden hätte, und damit schließen, dass die Verbindung der französischen Frau Dr. Clothilde Daumier mit dem deutschen Professor Horst Vogelstern von der Kölner Universität das Beste des neuen Europa symbolisiere.
Bruno machte sich ein paar Notizen und spürte, wie ihm eine Last von den Schultern fiel. Reden zu schwingen gefiel ihm ganz und gar nicht. Wenn er nicht umhinkam, eine zu halten, bereitete er sich immer extrem gründlich darauf vor, was paradoxerweise zur Folge hatte, dass inzwischen alle Freunde ihn zu gegebenen Anlässen als Redner zu engagieren versuchten. Immerhin hatte er die Rede für Clothilde und Horst nunmehr skizziert. Für die Ausarbeitung würde er noch ein, zwei Stunden brauchen. Dabei hatte er an diesem Tag ohnehin genug zu tun. So musste er zum Beispiel um zehn in Sarlat bei einem Gerichtsverfahren als Zeuge aussagen. Bruno warf einen prüfenden Blick in den Kleiderschrankspiegel, pfiff Balzac von seiner morgendlichen Patrouille durch den Garten zurück und machte sich auf den Weg zur Reitschule. Er hatte sich gerade ans Steuer gesetzt, als sein Handy vibrierte. Es war Ahmed von der Feuerwehr, der als Festangestellter ein Team von zumeist freiwilligen pompiers anführte. Sie waren nicht nur für Brandbekämpfung zuständig, sondern kamen auch in der Notfallambulanz zum Einsatz.
»Wir haben einen Notruf von Commarque, das ist diese Schlossruine an der Straße nach Sarlat«, informierte Ahmed. »Anscheinend ist eine Frau vom Fels oder von der Burgmauer gestürzt. Sie soll tot sein. Der Mann, der uns informiert hat, Jean-Philippe Fumel, betreibt den Kiosk am Eingang. Er erwartet dich. Fabiola hat heute Bereitschaft und ist schon auf dem Weg. Sehen wir uns gleich?«
Bruno versprach zu kommen und rief Pamela in der Reitschule an, um ihr zu sagen, dass er sich an diesem Vormittag nicht um Hector würde kümmern können. Fabiola habe ihr schon von dem Unglück berichtet, erwiderte sie und erklärte, dass sie ihn dann am Abend zum Ausritt erwarte.
»Bisous«, sagte sie noch, was Bruno immer ein bisschen irritierte. Ihre Affäre war seit etlichen Monaten beendet, wenngleich sich beide immer noch zueinander hingezogen fühlten, was Bruno daran erinnerte, dass zwischen ihnen auch jetzt noch mehr als Freundschaft war. Aber für solche Gedanken hatte er jetzt keine Zeit. Er meldete sich in der mairie und erklärte, warum er erst später im Büro erscheinen werde. Dann suchte er in seinem Adressbuch nach der Nummer des Grafen von Commarque, eines überaus zuvorkommenden hünenhaften Mannes, der sich seit dreißig Jahren mit der Erforschung und Restaurierung des großartigen Châteaus seiner Vorfahren beschäftigte. Bruno kannte ihn vom Rugbyklub und fand, dass er möglichst schnell informiert werden sollte, zumal er vielleicht nützliche Hinweise geben konnte. Es war erst kurz nach sieben, und dass der Graf selbst nicht antwortete, wunderte Bruno nicht. Also hinterließ er eine Nachricht.
Noch vor der Abfahrt hatte Bruno einen Blick in seinen Briefkasten geworfen, auf dem deutlich sichtbar die Worte »Pas de pub« standen, mit denen er darauf aufmerksam machte, dass er keine Werbung wünschte. Im Kasten fand er einen Brief mit Kontoauszügen und eine Ansichtskarte aus London, die ein beeindruckendes modernes Bauwerk zeigte: die Zentrale von New Scotland Yard, wie es in der Bildunterschrift hieß. Auf der Rückseite las er: »Ich wünschte, du wärst hier. Grüß Balzac herzlich und fühl dich von mir umarmt.«
Unterschrieben war der Gruß mit dem Kürzel I für Isabelle, die Frau, die sich davongemacht hatte. Nein, korrigierte sich Bruno. Als sie aus dem Périgord fortgezogen war, um einen Karrieresprung ins Innenministerium zu wagen, hatte sie gehofft, dass er sie begleiten würde. Aber Bruno konnte sich ein Leben in irgendeinem Pariser Appartement ohne Garten nicht vorstellen, das einem Hund nicht zuzumuten wäre, geschweige denn seinen Hühnern. Außerdem hätte er den Kontakt zu seinen Freunden und Vereinskollegen verloren und auch die Schulkinder nicht länger trainieren können, was einen Großteil seines Alltagslebens ausmachte. Isabelle war inzwischen noch weiter aufgestiegen und koordinierte jetzt die französischen und europäischen Antiterrormaßnahmen. Sie hatte ihm Balzac geschenkt, nachdem sein vorheriger Hund getötet worden war, und wenn sie ihm nun gelegentlich Postkarten aus anderen Hauptstädten schickte, schien sie dabei weniger an ihn als an Balzac zu denken. Oder vielleicht war es auch einfach nur ihre Art, ihn daran zu erinnern, worauf er verzichtet hatte. Was gar nicht nötig war. Er hielt die Karte an seine Nase und fragte sich, ob da tatsächlich eine Spur ihres Parfüms wahrnehmbar war oder ob er sich das nur einbildete. Als er Balzac daran schnuppern ließ, schlug der leise klagend an. Auch er vermisste sie.
2
Mit Balzac auf dem Beifahrersitz fuhr Bruno nach Les Eyzies. Wie immer winkte er im Vorbeifahren zu der Statue des steinzeitlichen Mannes weit oben auf dem Felssims über der Durchgangsstraße. Die Statue stand für die Bedeutung der Stadt als Zentrum prähistorischer Forschung. Nachdem 1868 bei Bauarbeiten für eine Eisenbahntrasse erstmals menschliche Knochenreste der Urzeit freigelegt worden waren, konnten weitere Skelettteile geborgen und von denen der Neandertaler eindeutig unterschieden werden. Die Entdeckung der sogenannten Cro-Magnon-Menschen, benannt nach dem Fundort, fiel ausgerechnet in die Zeit, da Charles Darwins neue Evolutionstheorie die ganze Welt verunsicherte. Um die vielen Besucher unterbringen zu können, die schon damals dieser Funde wegen herbeiströmten, wurde ein Hotel gebaut und – wie hätte es anders sein können? – Cro-Magnon getauft. Eine Vielzahl archäologischer Grabungen, die folgten, kam zu dem Ergebnis, dass das Tal der Vézère eine außergewöhnliche Lagerstätte menschlicher und vormenschlicher Überreste darstellte.
Nahe der Höhle, in der die ersten Skelettteile der Cro-Magnon-Menschen gefunden worden waren, befindet sich der Abri Pataud, ein rund hundert Meter langer Balkon unter einem Felsüberhang, auf dem moderne Archäologen Spuren von nicht weniger als vierzig verschiedenen Lagerstätten nomadisierender Rentierjäger entdeckt haben. Diese frühen Menschen hatten aus den vorgefundenen Steinen am Rand des Balkons eine Mauer errichtet und somit einen geschützten Raum gewonnen, der offenbar über einen längeren Zeitraum bewohnt gewesen war. Dort fand man auch die über zwanzigtausend Jahre alten Skelette einer jungen Frau und eines kleinen Kindes. Die Knochen dienten als Vorlage für eine lebensgroße Nachbildung der Frau, die nun im angeschlossenen Museum ausgestellt war. Bruno mochte die junge Frau sehr, und er war auch voller Bewunderung für eine andere Frauengestalt, die, wie er erst aus einem von Horsts Aufsätzen erfuhr, ganz in der Nähe gefunden worden war: eingraviert in einen Felsblock. Diese sogenannte Venus vom Abri Pataud repräsentierte vieles von dem, was Bruno an diesem Tal so sehr gefiel, in dem die Frühgeschichte der Menschen noch greifbar nah war und er sich durchaus vorstellen konnte, dass hier vor über zweihundert Jahrhunderten eine Frau zu Hause gewesen war, in die er sich vielleicht hätte verlieben können. Und so warf er ihr, als er an dem Abri vorbeikam, eine Kusshand zu, ehe er sein eigentliches Ziel ansteuerte, die mittelalterliche Festung von Commarque.
Zwischen Dordogne und Vézère thront auf einem Felsvorsprung das halbverfallene Château, eines der beeindruckendsten seiner Art in der Region, wie Bruno fand. Im Unterschied zu den berühmten Burgen von Beynac und Castelnaud, die – während des Hundertjährigen Krieges zwischen England und Frankreich Stützpunkte der verfeindeten Lager – sich zu beiden Seiten der Dordogne trutzig gegenüberstehen, lag Commarque immer schon abseits der befahrenen Touristenroute. Seine Abgeschiedenheit machte es für Bruno umso reizvoller. Die Außenmauern fassen ein ganzes Dorf ein, bestehend aus sechs großen Festungshäusern, die in der Hand verschiedener Adelsgeschlechter waren, und dem Bergfried, den die Familie der Commarque bewohnte. Diese Anlage sei eine Art Feriencamp der feudalen Elite gewesen, hatte Bruno einmal gelesen, ein Ort, wo man sich an Festtagen zusammenfand, um Ränke zu schmieden, Ehen anzubahnen oder einfach nur die schöne Aussicht über das Tal der Beune zu genießen.
Bruno hatte einmal mit dem Grafen hoch oben auf dem Turm gestanden und von ihm erfahren, dass von dort aus Lichtsignale von der zwanzig Kilometer weit entfernten Stadt Sarlat empfangen worden waren. Im Mittelalter hatte man die Höhen gerodet, um Holzkohle für die vielen Hüttenwerke und Schmieden zu gewinnen. Wo längst wieder Wälder aufgeforstet wurden, hatten damals Schafe geweidet.
Bruno lenkte seinen Transporter über eine holprige Piste hinunter zum Château und parkte vor dem Eingang. Kaum hatte er die Beifahrertür geöffnet, sprang Balzac hinaus und erkundete mit seinem Geruchssinn die nähere Umgebung, und es schien, dass er sich an frühere Besuche erinnerte. Der junge Mann im Kiosk staunte über den Anblick eines Polizisten, den ein Basset begleitete. Er gab Bruno die Hand, stellte sich als Jean-Philippe vor und fragte: »Ein Spürhund?«
»Es gibt keinen besseren«, antwortete Bruno und ließ sich den Weg zu der verhängnisvollen Felsklippe zeigen, wo Fabiola, die befreundete Ärztin, bereits auf ihn wartete. Anscheinend hatte sie ihre vorläufige Untersuchung abgeschlossen, denn sie schaute interessiert zu den Mauern und dem hohen Turm auf und achtete nicht länger auf die Leiche der Frau zu ihren Füßen, die einen blauen Trainingsanzug trug. Ein aufgerissenes Hosenbein entblößte einen anscheinend mehrfach gebrochenen Schenkel. Unter der ebenfalls aufgerissenen Jacke sah Bruno einen Rippenknochen, der die Haut durchstoßen hatte, wobei aber nur wenig Blut hervorgetreten war. Beim Aufprall musste das Herz schon zu schlagen aufgehört haben, glaubte Bruno.
Wie immer, wenn er einen toten Menschen sah, überkam ihn tiefe Traurigkeit. Er konnte sich an den Anblick einfach nicht gewöhnen, obwohl er während seiner Militärzeit und als Polizist schon ungezählte Leichen gesehen hatte, Menschen, die eines gewaltsamen oder eines natürlichen Todes gestorben waren. Wenn er denn jemals davon unberührt bliebe, würde er seinen Dienst quittieren.
Als er neben Fabiola stand, erinnerte sich Bruno: Sie hatte einmal davon gesprochen, dass sie während ihres Medizinstudiums an einem Pflichtkurs zum Thema »Ärzte und Tod« teilgenommen hatte. Ärzte in Krankenhäusern begegneten dem Tod Hunderte, wenn nicht Tausende von Malen, allerdings meist in anonymer Gestalt. Niedergelassene Ärzte hatten dagegen sehr viel weniger mit dem Tod zu tun, aber wenn, betraf es in der Regel Menschen, die sie gut und möglicherweise über Jahre kannten. Sowohl für die einen als auch für die anderen Ärzte, so habe die Seminarleiterin damals gesagt, nehme die emotionale Belastung mit der Zeit sogar zu. Bruno machte kurz die Augen zu und versuchte, sich dann auf den Leichnam zu konzentrieren.
Die Tote hatte kurze dunkle Haare und ein rundliches Gesicht, das auffallend stark sonnengebräunt war, obwohl die südfranzösische Frühjahrssonne erst wenig Kraft hatte. Über die rechte Wange verlief ein blutunterlaufener Striemen. Sie lag auf dem Rücken, und der Kopf war so extrem nach rechts verdreht, dass der Hals gebrochen sein musste. Der rechte Arm war angehoben und im Ellbogen angewinkelt. Ein altes Kuhhorn schien ihr aus der Hand gerutscht zu sein. Die andere Hand lag auf dem Bauch in einer angesichts der Tatsache, dass sie offenbar zu Tode gestürzt war, seltsam friedlich anmutenden Pose. Der Fuß des mehrfach gebrochenen Beins war nackt, während der andere in einem billigen, für Kletterpartien völlig ungeeigneten Laufschuh steckte. Bruno schaute sich um. Der zweite Schuh war nirgends zu sehen.
»Sie ist definitiv tot. Deshalb habe ich die pompiers wieder abziehen lassen. Für sie ist hier nichts zu tun«, sagte Fabiola, nachdem sie Bruno mit Wangenküssen begrüßt und auch Balzac die gebührende Aufmerksamkeit hatte zukommen lassen, dessen heftig wedelnder Schwanz erkennen ließ, wie sehr er sich freute, sie zu sehen. An dem Fuß der Toten schnüffelte er kurz, zog sich aber sofort wieder zurück, setzte sich und schaute zu seinem Herrchen auf.
»Die Frakturen an Hals und Bein deuten auf einen Sturz hin«, fuhr Fabiola mit nüchterner Sachlichkeit fort. »Ihr Fingerabdrücke abzunehmen dürfte schwerfallen, da die Fingerkuppen ganz wund sind, vom Klettern, wie es scheint. Hinweise auf Fremdverschulden sehe ich keine. Ich würde sagen, sie ist ungefähr vierzig Jahre alt. Außerdem ist sie übergewichtig, weshalb es mich wundert, dass sie sich in diesen Fels gewagt hat.«
»Für dich wäre er doch kein Thema, oder?«, fragte Bruno, der wusste, dass Fabiola als Studentin eine gute Bergsteigerin gewesen war.
»Ich würde hier jedenfalls nicht im Dunkeln rauf- oder runterklettern«, erwiderte sie und schüttelte entschieden den Kopf. »Und bei Tag nicht mal ohne Seil und Mauerhaken. Ich glaube, sie hat nicht gewusst, worauf sie sich da einlässt; dafür spricht auch das Schuhwerk.«
Bruno legte den Kopf in den Nacken und blickte nach oben. Der zerklüftete Fels über dem Überhang ragte rund zwanzig Meter in die Höhe, und auf ihn setzte eine etwa ebenso hohe Turmmauer auf. Im Fels waren mehrere tiefe Nischen, in denen, wie sich Bruno erinnerte, in vorgeschichtlichen Zeiten Höhlenmenschen gehaust hatten. Auch gab es in diesen Nischen eine Küche, Lagerräume und Kammern, in denen im Mittelalter Dienstboten des Schlosses untergebracht worden waren. Auch als nach den Religionskriegen im 17. Jahrhundert das Schloss verlassen worden war, hatten in den Nischen weiterhin Menschen gelebt. Während des Zweiten Weltkriegs hatten Widerstandskämpfer dort Unterschlupf gefunden. Die Höhlen waren trocken, aber in der Nähe gab es Wasser.
Vom Grafen wusste Bruno, dass sich durch das ganze Felsmassiv, auf dem das Château gebaut war, eine Vielzahl von Spalten und Hohlräumen zog. In manchen hatte man Zeugnisse von Menschen aus der Jungsteinzeit gefunden, so zum Beispiel einen in den Stein gravierten, fünfzehntausend Jahre alten Pferdekopf. Bruno traute seinen Augen kaum, als er hoch oben auf der Turmmauer eine Folge von frisch mit gelbroter Leuchtfarbe aufgetragener Buchstaben entdeckte.
»I-F-T-I«, buchstabierte er. »Sagt dir das was?«
»Darüber habe ich mir auch schon den Kopf zerbrochen«, antwortete Fabiola. »Schau dir das letzte Zeichen genauer an; mir scheint, dass es nicht fertig geworden ist. Vielleicht hatte die Frau ein L oder ein K schreiben wollen und ist dann abgestürzt. Oder vielleicht auch ein R oder Y. Keine Ahnung, ich war noch nie gut in Kreuzworträtseln.«
»Mir fällt kein französisches Wort ein, das mit I-F beginnt. Es könnte etwas Englisches sein«, meinte Bruno. »Jedenfalls ist die Farbe da oben dieselbe wie die an der Hand der Toten. Eindeutig.«
»Stimmt. Und was hat es wohl mit diesem Kuhhorn auf sich? Sie wird es wohl kaum in der Hand gehalten haben. Entweder hat es hier schon gelegen, oder es ist ihr aus der Tasche gefallen. Möglich auch, dass es nachträglich dorthin gelegt worden ist. In dem Fall wäre jemand hier gewesen. Übrigens habe ich mich schon umgeschaut und nirgends eine Spraydose gefunden. Vielleicht hat dieser jemand sie eingesteckt.«
»Wie lange ist sie wohl schon tot?«, fragte Bruno.
»Schätzungsweise drei bis vier Stunden. Bestimmt nicht mehr als acht. Das heißt, sie wird im Dunkeln in der Wand gewesen sein. Eine Taschenlampe kann ich auch nirgends finden. In ihren Taschen ist jedenfalls keine.«
»Vielleicht war der Mond hell genug. Er ist fast voll.« Bruno hatte als Gärtner den Mondkalender stets im Blick. »Ich werde mich erkundigen, ob es in der Nacht bewölkt war oder nicht. Fällt dir an ihrem Gebiss irgendwas auf?«
»Das sind nur ein paar Standardfüllungen, die überall in Europa gemacht worden sein könnten. Jedenfalls wirst du einen Zahnarzt zu Rate ziehen müssen. Ich wäre hier jedenfalls fertig und würde gern in die Klinik zurückkehren.«
»Gibt es, von dem Kuhhorn abgesehen, noch etwas, das dir sonderbar vorkommt?«, fragte Bruno, der an Fabiola nicht nur ihre fachlichen Kompetenzen schätzte, sondern auch ihren Spürsinn.
»Am Handgelenk und am Hals sind Spuren, aus denen ich noch nicht schlau geworden bin. Sie könnten von einem Seil herrühren, aber ich sehe hier keins. Die Polizei wird einen genaueren Blick darauf werfen müssen. Es wäre mir aber peinlich, wenn ich was Wichtiges übersehen hätte.«
»Darf ich mal deine Lupe haben?« Bruno beugte sich damit über die besagten Stellen an Hals, Handgelenk und Unterarm und entdeckte mehrere Fasern eines grünlichblauen Materials.
»Könnten das Nylonfädchen sein, vielleicht von einem Kletterseil?«, fragte er und reichte ihr die Lupe.
Sie schaute hin. »Durchaus.«
»Dann hatte sie wahrscheinlich einen Kletterpartner, der sich nach dem Sturz mit Seil und Spraydose aus dem Staub gemacht hat. Das müsstest du im Totenschein anmerken.«
Fabiola nickte. »Trotzdem sehe ich keinen Anlass für eine teure Autopsie.«
»Das entscheidet Jean-Jacques«, erwiderte Bruno. »Sie würde aus seinem Budget bezahlt.«
Als Chefermittler der Police nationale musste sich Jean-Jacques mit jedem Todesfall befassen, der Fragen offenließ. Was nur selten vorkam. In seinem Département lagen die jährlichen Tötungsdelikte im einstelligen Bereich, und fast immer überführte er den oder die Täter, manchmal mit Brunos Hilfe.
»Viel Erfolg bei ihrer Identifizierung«, sagte Fabiola und klappte ihren Arztkoffer zu. »Wenn du dich freimachen kannst, komm doch nach Feierabend, und wir reiten zusammen aus. Den Totenschein kannst du dir in der Klinik abholen. Als Todesursache trage ich Sturzverletzungen ein, versehen mit einem Fragezeichen. Eigentlich müsste ich Dummheit attestieren.« Sie warf ihm zum Abschied eine Kusshand zu.
Bruno winkte ihr nach und holte sein Handy aus der Tasche, um Jean-Jacques anzurufen. Balzac gab er zu verstehen, dass er sich auf Spurensuche machen solle. Als er den Commissaire benachrichtigt hatte, fing Balzac tatsächlich zu bellen an, um kundzutun, dass er etwas gefunden hatte. Bruno ging ein paar Schritte am Fuß der Klippe entlang, wo sein Hund vor dem zweiten Schuh der toten Frau stand. Bruno lobte und tätschelte ihn, forderte ihn auf, die Suche fortzusetzen, und ging dann zurück zu seinem Transporter, wo er sein Fernglas aus dem Handschuhfach holte und die Felswand damit abscannte. Ungefähr zwanzig Meter über der Fundstelle des Schuhs und etwas nach rechts versetzt sah er etwas in der Morgensonne glitzern. Vielleicht war es ein Mauerhaken, wie ihn Bergsteiger zur Absicherung nutzten. Sollte Jean-Jacques einen Blick darauf werfen!
Wieder schlug Balzac an, diesmal von einer rund hundert Meter entfernt gelegenen Stelle. Sein Schwanz stand waagerecht nach hinten ab, eine Vorderpfote war angehoben und der Kopf vorgereckt. Diese Haltung nahm er ein, wenn er Wild entdeckt hatte. Bruno eilte zu ihm und spürte, wie der Boden unter seinen Füßen sumpfig wurde. Er näherte sich der Beune, die hier viele kleine Nebenläufe ausgebildet hatte. Sein Hund wartete geduldig, wie er es in seiner Ausbildung zum Jagdbegleiter gelernt hatte, und war von der Schwanzspitze bis zur Schnauze wie ein Pfeil ausgerichtet auf eine Stelle jenseits der Schwemmaue. Anscheinend hatte die fremde Frau, von dort kommend, die wässrige Weide überquert. Seltsam, dass es an ihren Beinen oder Schuhen keinerlei Schlammspuren gab.
Bruno kehrte zu dem Leichnam zurück und nahm sein Handy aus der Tasche. Zwar würde das Team von Jean-Jacques Fotos machen, doch wollte er selbst welche haben, um mit der Identifizierung beginnen zu können. Er schoss ein paar Bilder vom Fundort, zoomte die Großbuchstaben auf der Turmmauer heran und machte mehrere Nahaufnahmen vom Gesicht der Toten, bevor er sich die Hände noch einmal genauer anschaute. Tatsächlich waren sämtliche Fingerkuppen blutig aufgeschürft; die Kriminaltechnik würde trotzdem zumindest einen Teil der Papillarleisten rekonstruieren können.
Weitere Fragen drängten sich Bruno auf: War sie gestürzt oder gestoßen worden? Was hatte sie bewogen, die Steilwand zu erklimmen? Wer in das Château eindringen wollte, fand auch einen weniger gefährlichen Weg, zum Beispiel auf der gegenüberliegenden Seite, wo es nur eine brüchige Außenmauer zu überwinden galt. Oder hatte sie einfach nur einen Slogan an den Turm malen wollen? Vielleicht wusste der Graf eine Antwort darauf.
3
Der Graf ließ nicht lange auf sich warten. Er eilte auf Bruno zu, der am Fuß der Klippe, wo Balzac den Schuh gefunden hatte, mit einem Stock im Gras herumstocherte. Balzac kam herbeigelaufen, um den Neuankömmling zu begrüßen, der vor ihm in die Hocke ging und seine langen Ohren streichelte. Bruno berichtete ihm, was er bisher in Erfahrung gebracht hatte, und führte ihn zu der Toten.
»Die habe ich noch nie gesehen. Keine Ahnung, wer sie ist. Möge sie in Frieden ruhen.« Der Graf, den die meisten nur in heiterer Stimmung kannten, betrachtete die Tote mit ernster Miene und schüttelte den Kopf. Dann hob er die Hand und bekreuzigte sich. Als er schließlich zur Felswand emporblickte und die Schriftzeichen auf dem Turm entdeckte, wich er unwillkürlich mehrere Schritte zurück.
»Was um alles in der Welt …?« Er schaute zurück auf die Tote, dann wieder hinauf zu den leuchtenden Buchstaben, die im Licht der Sonne zu glühen schienen. »Soll das Graffiti-Kunst sein? Hat sie diese Buchstaben aufgesprüht? Und was haben sie zu bedeuten? Mir sagen sie nichts.«
»Ich hatte gehofft, Sie könnten mir bei der Identifizierung der Toten helfen oder mir erklären, was es mit diesen Schriftzeichen auf sich hat. Sie hat keine Ausweispapiere bei sich, und es wird schwer sein, der Toten Fingerabdrücke abzunehmen.«
»Spontan fällt mir nur ein, dass sie vielleicht zu den Templerfreunden gehört hat. Es gab kürzlich Ärger mit ihnen. Sie haben einzubrechen versucht, um eigene Grabungen vorzunehmen. Ich habe einige von ihnen eingeladen, sich anzusehen, was die Archäologen zutage gefördert haben, damit sie sich mit eigenen Augen überzeugen können, dass es eben nicht der legendäre Templerschatz ist, der hier angeblich zu finden ist. Ich dachte, damit hätte sich die Sache erledigt. Übrigens habe ich da noch eine E-Mail-Adresse vom Schriftführer dieses Vereins. Vielleicht kann der die arme Frau hier identifizieren.«
»Auf den ersten Blick sieht das hier nach einem tragischen Kletterunfall aus. Aber manche Details geben mir zu denken«, sagte Bruno und erklärte, warum er Jean-Jacques gerufen hatte. »Zum Beispiel ist mir nicht klar, wie sie hierhergekommen ist.«
»Vielleicht hat sie ihren Wagen oben auf dem Hügel abgestellt«, erwiderte der Graf. »Ich bin von der anderen Seite gekommen.«
»Ich habe auf dem Parkplatz kein Auto gesehen, und sie hat auch keinen Autoschlüssel in der Tasche.«
»Vielleicht werfen Sie auch einen Blick auf den Parkplatz von Cap Blanc auf der anderen Talseite. Er ist bequem zu Fuß zu erreichen, wenn auch ein bisschen weiter weg.« Er zeigte in die Richtung, in die Bruno auch von Balzac geführt worden war.
»Ich wusste gar nicht, dass Cap Blanc so nah ist«, sagte Bruno. Der Abri war bekannt für seine prähistorischen Halbreliefs von Pferden und Wisenten, die so lebendig wirkten, dass sie gleichsam aus der Wand zu springen schienen.
»Ganz in der Nähe«, schwärmte der Graf, der die Tote zu seinen Füßen vorübergehend vergessen zu haben schien, »ist noch ein anderer gisement, eine Grotte, in der die Venus von Laussel gefunden wurde. Und Sie kennen doch bestimmt den Pferdekopf, der in der Höhle unterhalb der Felswand in den Stein geritzt wurde. Hier bei uns sind mehr prähistorische Fundstätten als sonst irgendwo auf der Welt.« Dann, als würde ihm erst jetzt der Grund ihres Treffens wieder bewusst, wurde sein Ton sachlich: »Hören Sie, Bruno, ich hoffe, die Tote wird bald abgeholt. Gegen Mittag kommt eine Schulklasse aus Bergerac. Was haben Sie jetzt mit der Leiche vor?«
»Kollegen von der Police nationale in Périgueux sind bereits auf dem Weg hierher. Die werden sich um alles Weitere kümmern. Ich schätze, die Tote wird in die Pathologie nach Bergerac gebracht. Wenn sie identifiziert werden kann, müssen sich auch Angehörige ausfindig machen lassen, die entscheiden, was mit ihr geschehen soll. Wenn nicht, werden wir die Öffentlichkeit bitten, bei der Identifizierung mitzuhelfen.«
Der Graf nickte und blickte wieder auf die tote Frau hinab. Plötzlich fiel ihm etwas auf. »Das Horn da neben ihrer Hand …«, sagte er scharf. »Wer hat es da hingelegt?«
»Es lag da, als ich angekommen bin. Ich wollte gleich den jungen Mann im Kiosk fragen, ob er mir etwas dazu sagen kann. Wissen Sie vielleicht, was es damit auf sich hat?«
Der Graf antwortete nicht, sondern ging auf das Häuschen zu, in dem Jean-Philippe Broschüren, Reiseführer und Souvenirs auf einer kleinen Theke ausgelegt hatte. Es duftete nach Kaffee, und Bruno sah im hinteren Teil der Hütte eine Maschine dampfen.
»Nein, natürlich nicht. Wie käme ich dazu? Das Horn lag schon neben ihrer Hand, als ich sie heute früh entdeckt habe«, erklärte Jean-Philippe auf die Frage des Grafen, der ihn mit strenger Miene betrachtete.
»Da hat sich jemand einen makabren Scherz erlaubt«, sagte der Graf. Er nahm eine Broschüre von der Theke, schlug eine Seite darin auf und reichte sie Bruno. »Sehen Sie, Bruno. Hier. Die Venus mit Horn, gefunden gleich dort drüben, oberhalb von Schloss Laussel.«
Das Foto, das er Bruno unter die Nase hielt, kannte dieser schon aus Horsts wissenschaftlicher Abhandlung. Es zeigte eine in Stein gravierte dickliche Frau, die sich mit ihrer rechten erhobenen Hand ein Horn in Ohrhöhe an den Kopf hielt, fast wie einen Telefonhörer. Die Frau hatte kein Gesicht, denn der Fels oberhalb ihrer Brust war erodiert. Doch auf der dem Horn abgewandten Kopfseite war eine prächtige lange Haarpracht angedeutet.
»Genau die gleiche Haltung«, bemerkte der Graf. »Das kann kein Zufall sein. Jemand, der die Venus kennt, hat der Toten absichtlich das Horn neben die Hand gelegt.«
Und sie war nicht allein in der Wand, dachte Bruno. Er betrachtete das Foto. Diese Venus war keine Figurine, sondern ein in Stein gemeißeltes Werk. In welcher Größe, ließ sich nicht erkennen. Bruno erkundigte sich.
»Ungefähr einen halben Meter hoch. Außer ihr wurden noch mehrere andere Darstellungen dieser Art gefunden, alle aus derselben Epoche. Sie sind circa fünfundzwanzigtausend Jahre alt«, erklärte der Graf. Es hatte eine zweite, weniger gut erhaltene Venus gegeben, die ebenfalls ein Horn in der Hand zu halten schien, die sogenannte Venus von Berlin. Sie wurde 1912 an ein deutsches Museum verkauft und galt seit dem Zweiten Weltkrieg als verschollen. Weitere vergleichbare Exemplare waren zum einen die Seitenansicht einer schlankeren, jungen Frau, zum anderen zwei Frauen, die sich an den Hüften berührten, wobei die eine aufrecht sitzend, die andere kopfüber dargestellt war.
»Wir haben hier einen echten Schatz«, fuhr der Graf fort. »Da wäre zum Beispiel noch die Femme à la Tête Quadrillée, eine Venus mit Kopfbedeckung, wie es scheint. Wenn alles an Ort und Stelle geblieben wäre, hätten wir hier ein großartiges Museum, aber die Sammlung wurde aufgelöst, und die wichtigsten Exponate sind jetzt in Bordeaux zu sehen.«
»Lässt sich mit Bestimmtheit sagen, dass es sich um ein Horn handelt?«, fragte Bruno. »Es könnte doch auch eine große Muschel sein.«
»Oder eine Mondsichel«, erwiderte der Graf. »Es sind nämlich dreizehn Kerben darauf eingeritzt, die möglicherweise auf die dreizehn Mondphasen im Jahr hinweisen beziehungsweise die dreizehn Menstruationszyklen, was zur Deutung der Venusfigurinen als Fruchtbarkeitssymbole passen würde. Genaueres lässt sich nicht sagen. Manche Forscher sind der Ansicht, dass es sich auch um eine Art Musikinstrument handeln könnte, vielleicht um ein Jagdhorn.«
»Glauben Sie immer noch, dass die Templerfreunde dahinterstecken?«
Der Graf zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht, aber diese Leute waren mehrmals hier, mit Metalldetektoren und Spaten. Die wollen wir hier nicht sehen, während seriöse Archäologen stets willkommen sind, denn die halten sich an Vorschriften und reichen entsprechende Anträge beim Kulturministerium und dem Museum von Les Eyzies ein. In diesem Sommer erwarten wir zwei genehmigte Grabungen unter der Leitung von Professor Vogelstern. Außerdem hat sich ein Spezialistenteam für Seismik und Echolotung angesagt, das nach Höhlen suchen will, die wir noch nicht entdeckt haben. Madame Daumier hat das veranlasst.«
»Erzählen Sie mir von diesen Templerleuten. Wonach suchen die eigentlich?«, wollte Bruno wissen und nickte Jean-Philippe dankbar zu, als der ihm einen Pappbecher Kaffee reichte. »Ich weiß, dass die Templer Kreuzfahrer waren, irgendein christlicher Orden im Heiligen Land. Mehr aber auch nicht.«
Der Graf verzog die Lippen zu einem spitzbübischen Grinsen. »Sind Sie jemals über die Pont Neuf in Paris gegangen?«
Bruno nickte. »Hin und zurück.«
»Dann sind Sie auch am Eingang zum Place Dauphine vorbeigekommen. Genau an der Stelle wurde Jacques de Molay, der letzte Großmeister des Templerordens, auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Das war 1314. Sterbend soll er König Philipp IV., den Papst und das Geschlecht der Kapetinger insgesamt verflucht und deren baldigen Untergang beschworen haben. Tatsächlich starben der König und der Papst noch im selben Jahr, und der Thron Frankreichs ging an das Haus der Valois über. Der Templerfluch hatte sich bewahrheitet.«
Seine Zerschlagung des Ritterordens hatte der König, so der Graf weiter, mit der Unterstellung begründet, dieser sei korrupt, übe schwarze Magie aus und betreibe Unzucht. Die eigentlichen Motive des Königs aber waren weniger fromm: Er fürchtete, dass die Templer einen Staat im Staat bildeten, und wollte deren Grundbesitz und Geld. Nicht lange zuvor hatte er zu einem Pogrom gegen die französischen Juden aufgerufen und deren Vermögen konfisziert. Nachdem es aufgebraucht war, boten sich die Templer als nächstes Opfer an.
»Dazu noch eine interessante Geschichte«, fuhr der Graf fort. »Als fast fünfhundert Jahre später Ludwig XVI. guillotiniert wurde, soll jemand ein Taschentuch in das Blut des Königs getunkt und ausgerufen haben: ›Jacques de Molay, endlich bist du gerächt.‹ Das war natürlich auf dem Place de la Concorde.«
»Die Templer waren also nicht ausgestorben?«
Der Graf zuckte wieder mit den Achseln. »Viele Freimaurergruppen des achtzehnten Jahrhunderts behaupteten, Nachfahren der Templer zu sein. Freimaurer plädierten für Reformen, für eine Verfassung und die Beschneidung kirchlicher Macht. Sie standen für die Ideale der Aufklärung. Nicht von ungefähr waren mehrere Anführer der amerikanischen Revolution Freimaurer. Haben Sie sich schon mal einen Dollarschein genauer angesehen? Darauf ist das Auge in der Pyramide abgebildet, eines der Symbole der Illuminaten, einer Freimaurersekte. Bemerkenswert, nicht wahr?«
Bruno waren schon verschiedene Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit den Freimaurern zu Ohren gekommen. Er fragte: »Aber was interessiert die Leute immer noch so sehr an den Templern?«
»Der legendäre verschollene Schatz. Die Templer sollen enorm reich gewesen sein. Was sich der König unter den Nagel gerissen hat, wäre demnach nur ein Bruchteil ihres Vermögens gewesen. Ich bin kein Experte, aber in Sarlat wohnt ein ausgewiesener Fachmann namens Dumesnil. Er hat mehrere Bücher über die Templer geschrieben. Ich glaube, er unterrichtet am lycée in Brive.«
»Und was hatten die Templer mit Ihrem Château zu schaffen?«, fragte Bruno, während sie langsam zur Toten zurückgingen.
»Es war einer ihrer Stammsitze. Mein Vorfahr Gérard de Commarque beteiligte sich Mitte des zwölften Jahrhunderts am Zweiten Kreuzzug und vertraute die Burg den Templern an.«
»Wann hat Ihre Familie sie wieder in Besitz genommen?«
»Gute Frage. Die Eigentumsverhältnisse waren lange Zeit unklar. Aber sie gehört zweifellos uns, auch wenn die Grafen von Beynac immer wieder Besitzansprüche erhoben haben. Karl der Große schenkte die Ländereien ringsum meinem frühesten bekannten Vorgänger Bovon de Commarque für tapfere Dienste im Kampf gegen die Wikinger. Sie wissen vielleicht, dass sie Bordeaux und Bergerac überfallen und sogar die Abtei von Paunat gleich neben Saint-Denis geplündert haben.«
Bruno nickte. »Das haben auch König Philippe und die Templer.«
Der Graf lachte. »Ein König plündert nicht.« Dann betrachtete er wieder die Tote und fügte ernst hinzu: »Manchmal frage ich mich, ob wir hier in Frankreich nicht womöglich allzu viel Geschichte haben.«
»Ihre Familie hat eine Menge dazu beigetragen«, sagte Bruno und versuchte, einen neutralen Ton beizubehalten. Er, der seine Eltern nie kennengelernt hatte, ging fast selbstverständlich davon aus, dass seine Familie in der französischen Vergangenheit keine nennenswerte Rolle gespielt hatte. Bestenfalls, dachte er, waren seine Vorfahren Bauern gewesen, die von früh bis spät hart hatten arbeiten müssen; möglich aber auch, dass sie gewöhnliche Kriegsknechte gewesen waren, Kanonenfutter für die Träume und Ambitionen des Adels. Seiner politischen Gesinnung nach war Bruno ein strammer Republikaner, der die Revolution von 1789 als Glücksfall für Frankreich ansah, ohne die Schrecken ihrer terroristischen Auswüchse unter den Tisch zu kehren. Der Graf dagegen wusste wahrscheinlich von Vorfahren, die der Guillotine zum Opfer gefallen waren, und mochte daher eine andere Einstellung haben.
Der Graf musterte ihn scharf. »Ihre Familie bestimmt auch, so oder so. Meine Ahnen waren immerhin klug genug, ihre Frauen woanders zu suchen als ihre aristokratischen Pairs. Wahrscheinlich ist unsere Linie deshalb nie ausgestorben. Übrigens habe ich diesen Besitz hier nicht geerbt. Ich musste ihn zurückkaufen.«
»Kompliment, wie Sie damit umgehen«, sagte Bruno, was er auch so meinte. Er war voller Respekt für den Einsatz, den der Graf seit drei Jahrzehnten für Forschung und Restaurierung zeigte. »Ich würde gern Kontakt mit dem Sekretär der Templerfreunde aufnehmen.«
Der Graf holte ein Handy aus der Tasche und las einen Namen und eine Telefonnummer vor. »Ein netter Bursche, wenn auch ein bisschen langweilig; hat früher für das Finanzministerium gearbeitet. Vermutlich haben die Templer ein bisschen Schwung in sein Leben gebracht. Und hier ist dieser Templerforscher, den ich erwähnt habe, Auguste Dumesnil. Eine Telefonnummer habe ich nicht, dafür seine E-Mail-Adresse.«
Bruno bedankte sich und schrieb alle Angaben in sein Notizbuch. »Könnte es für die Frau einen anderen Grund – außer dem der Schatzsuche – gegeben haben hierherzukommen?«
»Wenn sie die Klippe erklommen hat, um zur Donjon-Wand zu gelangen, war sie mit Sicherheit nicht auf einen Schatz aus«, antwortete der Graf. »In den Innenhof, wo so mancher Schatzsucher mit Metalldetektoren herumläuft, kommt man ohne weiteres. Und wer da nicht fündig geworden ist, sucht in den Höhlen.«
»Was könnte sie Ihrer Meinung nach an dem Donjon interessiert haben?«
»Keine Ahnung«, antwortete der Graf kopfschüttelnd. »Schon zu Beginn der Restaurierungsarbeiten ist der Wohnturm gründlich untersucht worden, und abgesehen von einer allgemein zugänglichen Ausstellung von Fotos über archäologische Funde ist dort nichts zu sehen. Über die Jahrhunderte kam es immer wieder zu Plünderungen. Es wurden sogar Mauern abgetragen, um Steine zu erbeuten. Wahrscheinlich wollte die Frau hier nur mit Graffiti auf sich aufmerksam machen, und sie ist nicht den Turm hinauf-, sondern von oben nach unten geklettert. Vielleicht gehen wir mal nach oben und schauen nach.«
Er öffnete das Eingangstor und stieg mit Bruno über eine Spindeltreppe durch den Bergfried nach oben. Doch die geführte Tour des Grafen ergab keine neuen Aufschlüsse. Die Räume, durch die sie kamen, waren bis auf ein paar Schaukästen im Obergeschoss, die die Restaurierungsarbeiten dokumentierten, völlig leer. Als sie wieder hinabgestiegen waren, sah Bruno auf der Zufahrt Jean-Jacques’ Dienstwagen näher kommen, gefolgt vom Transporter der Kriminaltechnik.
Bruno warf einen Blick auf seine Armbanduhr, erklärte, dass man ihn vor Gericht erwartete, und stellte Jean-Jacques und den Grafen einander vor. Gemeinsam gingen sie zum Fundort der Leiche, wo Bruno den Commissaire auch sogleich auf die Farbspuren auf der Turmmauer aufmerksam machte.
»Wenn ich von Sarlat zurückkomme, werde ich die Fotos, die ich gemacht habe, an Presse und Fernsehen weiterleiten«, sagte er. »Wenn ich sonst noch etwas tun kann, lassen Sie es mich bitte wissen.«
»Wir bleiben in Kontakt«, erwiderte Jean-Jacques. Er betrachtete das Graffito und kratzte sich am Kopf. »Hat jemand eine Ahnung, was das heißen könnte?«
»Ich vermute, es ist entweder Englisch oder eine andere Fremdsprache«, antwortete Bruno. »Französisch ist es jedenfalls nicht.«
»Ich melde mich am Nachmittag bei Ihnen, nach dem Treffen mit dem Präfekten wegen dieser Päderasten-Geschichte, das, wie ich fürchte, unangenehm werden könnte.«
»Was hat er damit zu tun?«, fragte Bruno. »Zuständig ist doch unstrittig die Polizei.«
Präfekten wurden vom Präsidenten ernannt und vertraten den französischen Staat in allen hunderteins Départements des Landes. Ihre Hauptaufgabe bestand darin sicherzustellen, dass regionale Regierungsentscheidungen im Einklang mit der nationalen Politik standen. Im Fall von nationalen Katastrophen hatten Präfekten auch die verschiedenen Teile der Polizeikräfte miteinander zu koordinieren. Konkrete Einsatzmaßnahmen aber blieben der Polizei überlassen.
»Er sagt, es gehe um das öffentliche Vertrauen in die Polizeiarbeit.«
»Kommen Sie mit den Ermittlungen voran?«
»Nicht wirklich. Ein vertrackter Fall ist das, zumal er an die dreißig Jahre zurückliegt. Drei Kläger waren in psychiatrischer Behandlung. Deren Anschuldigungen basieren auf dem, was die behandelnden Therapeuten ›recovered memory‹ nennen, die Wiederherstellung traumatischer Erinnerungen. Mit anderen Worten, die Kläger haben nie von sich aus von Missbrauch gesprochen und sind erst durch die Behandlung dieser Frau damit herausgerückt. Wir haben viele ehemalige Heimkinder ausfindig gemacht und befragt, aber keins war selbst betroffen.« Er schaute Bruno in die Augen. »Sie waren doch auch in einem dieser kirchlichen Waisenheime, oder, Bruno?«
»Ja, in dem von Bergerac. Und das auch nur für ein paar Jahre, bis meine Tante in der Lage war, mich zu sich zu nehmen. Im Heim sind mir manchmal Stockhiebe auf den Hosenboden oder Schläge mit dem Lineal auf die Handknöchel verabreicht worden, aber zu sexuellen Übergriffen ist es nie gekommen. Das Schlimmste, woran ich mich erinnere, war die Aussage eines Priesters, wonach Tiere keine Seele haben und deshalb nicht in den Himmel kommen. Das hat mir das Herz gebrochen. Ich muss ungefähr fünf gewesen sein und habe damals meinen Kinderglauben verloren.«
Jean-Jacques nickte. »Tja, wie gesagt, das Ganze ist ziemlich vertrackt. Meine Mitarbeiter drohen mit Streik, wenn sie noch länger an diesem Fall arbeiten müssen, der, wie sie finden, nur aus Phantasien und Falschaussagen besteht. Aber die zuständige Staatsanwältin scheint zu glauben, was diese Psychologin behauptet, und besteht darauf, dass wir unsere Nachforschungen fortsetzen. Und die Frau des Präfekten will’s ebenfalls.«
»Was sagt Prunier dazu?«, fragte Bruno, womit er sich auf Jean-Jacques’ Vorgesetzten, den Polizeipräsidenten, bezog.
»Er würde die Akte gern schließen, aber der Präfekt ist dagegen – obwohl fast alle ehemaligen Bewohner des Heims von Mussidan bezeugen, dass es solche Vorfälle nie gegeben hat. Nur die drei Kläger und eine ehemalige Nonne sagen, dass damals die diskrete Regel galt, zwei bestimmte Priester mit Kindern nicht allein zu lassen. Und die Frau ist keine besonders glaubwürdige Zeugin, weil sie nach ihrem Austritt aus der Kirche zu trinken angefangen hat.« Jean-Jacques verdrehte die Augen. »Sie wird übrigens von derselben Psychologin betreut.«
»Ziemlich dünne Beweislage, wie’s aussieht.«
»Nicht für die Staatsanwältin. Sie will sich offenbar einen Namen machen und hält alles, was diese Psychologin sagt, für die reine Wahrheit. Wie dem auch sei, mein Problem ist es nicht. Ich rufe Sie an, wenn ich beim Präfekten gewesen bin.«
4
Bruno erreichte wenige Minuten vor Verhandlungsbeginn das Gericht in Sarlat, wo ihm allerdings zwei kleine Gruppen von Demonstranten, die gegeneinander protestierten, den Weg ins Gebäude versperrten. Die einen gaben sich als Anhänger des Gewerkschaftsbundes CGT zu erkennen, der traditionell den Kommunisten nahestand. Sie forderten auf ihren Transparenten »Keine Sklavenarbeit« und skandierten »Sonntage bleiben frei«, während die anderen in der weißen Arbeitskleidung von Bäckern und mit mehlbestäubten Gesichtern dagegenhielten und »Wir wollen arbeiten« riefen. Auf Bruno wirkte die Szene nicht unfriedlich. Einer der Gewerkschafter, den er vom Rugby kannte, grüßte ihn sogar per Handschlag. Aber Bruno wusste auch, dass es in solchen Fällen plötzlich und unerwartet zu Ausschreitungen kommen konnte.
Ruhig und ohne handgreiflich zu werden, sorgten zwei Kollegen der städtischen Polizei dafür, dass Bruno ins Haus kam. Vor dem Sitzungssaal wurde er von Hugues und seinem Anwalt begrüßt. Sie lächelten erleichtert, obwohl er, Bruno, nur geladen war, um sich zur Person des Beklagten auszulassen. Hugues war in Saint-Denis geboren und aufgewachsen und führte einen gutgehenden Bäckereibetrieb im Industriegebiet am Stadtrand von Sarlat. Bruno hatte ihn schon gekannt, als er nach dem Schulabschluss zu Fauquet in die Bäckerlehre gegangen war. Nach dem Tod der Großmutter hatte die Familie deren Haus geerbt, das der Vater auf Hugues’ Drängen hin verkaufte, um in eine eigene Bäckerei investieren zu können. Das war kurz vor der Bankenkrise, und der Immobilienmarkt verlangte Höchstpreise, weshalb sich Hugues anfangs mit der Pacht einer kleinen, verschlafenen Bäckerei in einem Außenbezirk Sarlats begnügte.
Er hatte allerdings sehr viel weiterreichende Pläne und genug Geld, um neue Maschinen anzuschaffen, und sah die Backindustrie am Rand einer Revolution, an der er sich fleißig beteiligen wollte. Das traditionelle Geschäft des Bäckers, der einen festen Kundenstamm aus seiner Nachbarschaft bediente, wurde von Supermärkten bedroht, die Brot und Kuchen sehr viel billiger verkaufen konnten. Hugues erkannte aber früh seine Chance auf einem anderen Markt. Er besuchte jedes Hotel, jedes Restaurant und jeden Campingplatz in der Umgebung und machte ihnen das Angebot, jeden Morgen zur Frühstückszeit frisches Brot und Croissants zu liefern – in der ersten Woche umsonst und bei Zufriedenheit im Rahmen eines festen Vertrags.
Er ließ sich also darauf ein, seine Waren an sieben Tagen in der Woche pünktlich auszuliefern. Dadurch geriet er in Schwierigkeiten. Nach französischem Arbeitsrecht mussten Bäckereien ihren Betrieb mindestens vierundzwanzig Stunden in der Woche ruhen lassen und der Belegschaft einen freien Tag gewähren. Hugues hatte inzwischen eine zweite Bäckerei in Périgueux aufgemacht und beschäftigte nunmehr sechzehn Personen, die bei ihm über dem Mindestlohn verdienten und darüber hinaus am Erfolg beteiligt wurden. Gemäß der gesetzlichen Fünfunddreißigstundenwoche führte er einen Schichtbetrieb ein, der so organisiert war, dass jeder Angestellte nur fünf Tage in der Woche arbeiten musste, obwohl die Backöfen rund um die Uhr beheizt wurden. Hugues war guten Glaubens, den Gesetzen vollauf zu entsprechen.
Der Clic-P, ein Bündnis des gewerkschaftlich organisierten Einzelhandels und des Dienstleistungssektors, das zu einer landesweiten Kampagne gegen Sonntagsarbeit und späte Öffnungszeiten aufgerufen hatte, war jedoch anderer Meinung. Bruno hatte Verständnis für den Aufruf, konnte aber nicht verstehen, warum man sich ausgerechnet auf Hugues eingeschossen hatte. Vielleicht, vermutete er, sahen die regionalen Gewerkschaftsführer in ihm ein leichtes Ziel.
»Ich kann nicht glauben, dass ich für meine sonntäglichen Brotlieferungen als Straftäter belangt werden soll«, empörte sich Hugues. »Auch meine Mitarbeiter sind fassungslos.« Er deutete nach draußen, wo seine Angestellten für ihn demonstrierten, viele immer noch in den weißen Schürzen und mit den Haarnetzen, die sie am Arbeitsplatz trugen.
»Werden Sie wirklich den Betrieb einstellen müssen?«, fragte Bruno.
»Nein, schließlich haben wir jetzt die zweite Bäckerei. Wenn wir an beiden Standorten sechs Tage in der Woche arbeiten, lässt es sich irgendwie einrichten, dass wir jeden Tag frisches Brot anbieten können«, antwortete er. »Aber wenn ich für nur einen Tag von Périgueux aus Sarlat und Umgebung zu beliefern habe, muss ich zusätzliche Kräfte nur für die Lieferung einstellen. Das treibt die Kosten in die Höhe, wo ich doch ohnehin jede Menge Schulden für die zweite Bäckerei zu tilgen habe. Ganz zu schweigen von den Kosten, die jetzt für dieses Verfahren anfallen. Am meisten ärgert mich, dass diese ganze Angelegenheit politisch geworden ist. Die Gewerkschaften legen es darauf an, dass die linken Bürgermeister und Stadträte mein Geschäft ruinieren, während die Konservativen eine Art Märtyrer aus mir zu machen versuchen. Die Rolle passt mir nun wirklich überhaupt nicht.«
Das Verfahren wurde eröffnet. Weil die Angelegenheit als Bagatellsache eingestuft war, fiel sie in die Zuständigkeit eines Polizeigerichts, in dem ein Einzelrichter, nur von einem Rechtsreferenten unterstützt, entschied. Brunos Auftritt war ganz kurz. Er kannte Hugues seit zehn Jahren persönlich und wurde als Leumundszeuge vernommen. Er schilderte ihn als großzügigen und freundlichen Mann, der nicht nur eigene Interessen, sondern auch das Allgemeinwohl im Auge hatte. Am Ende eines jeden Tages ließ er das unverkaufte Brot an das Resto du Coeur, die Tafel für Bedürftige, und andere karitative Einrichtungen der Region ausliefern. Hugues’ Anwalt rief drei seiner Angestellten auf, die alle Gewerkschaftsmitglieder waren und von denen einer die Sozialisten im Stadtrat vertrat. Sie priesen ihren Arbeitgeber und die Bedingungen am Arbeitsplatz. Das eigentliche Problem, meinte der Anwalt, sei der unsauber formulierte Gesetzestext.
»Es ist deutlich geworden, dass wir es hier mit einem vorbildlichen Arbeitgeber zu tun haben, dem nicht unterstellt werden kann, dass er das Recht zu beugen versucht hat«, erklärte der Richter schließlich. »Ich kann ihn gut verstehen und schlage all jenen Gewerkschaftsmitgliedern, die zurzeit arbeitslos sind, vor, ihre Gewerkschaftsführer zu fragen, ob es sinnvoll ist, ausgerechnet gegen diese besondere Bäckerei zu protestieren. Weil mir aber die Gesetzeslage nichts anderes übriglässt, muss ich zu meinem Bedauern den Beklagten mit einer Mindeststrafe von fünfhundert Euro belegen und ihn auffordern, seinen Betrieb an einem Tag in der Woche zu schließen.«
Vor dem Gericht warteten mehrere Medienvertreter, die Interviews mit Demonstranten führten, als sich Vaugier, der Vertreter der Gewerkschaft, mit vollem Körpereinsatz brüsk an Bruno und Hugues vorbeischob, um als Erster die bereitgehaltenen Mikrofone zu erreichen und den Sieg der Gewerkschaft zu verkünden.
»Das ist erst der Anfang. Ich warne alle, die unsere Mitglieder auszubeuten versuchen und gegen geltendes Recht verstoßen. Wir werden so etwas nicht durchgehen lassen«, verkündete Vaugier, ein Mann mit schmalem Gesicht und kurzgeschnittenen grauen Haaren, an dessen Revers ein Abzeichen der Parti de Gauche steckte.
Die Polizei war verschwunden, und es kam zu einem kleinen Handgemenge, als zwei von Hugues’ Angestellten dem Gewerkschaftsmann wütend entgegentraten und ihn als Lügner beschimpften. Bruno ergriff Hugues beim Arm und hielt ihn zurück.
»Halten Sie sich lieber raus, und überlassen Sie Ihrem Anwalt das Reden«, riet Bruno. »Jedes falsche Wort macht alles nur noch schlimmer.«
Bruno versuchte, sich mit Hugues zur Seite hin zu entfernen, doch ein Hüne von einem Mann versperrte ihnen den Weg. Er trug ein Schild mit der Aufschrift »Die Reichen sollen zahlen« und skandierte einen Slogan, auf den sich Bruno keinen Reim machen konnte. Mit seiner großen Pranke griff er nach Hugues, doch Bruno wehrte ihn ab und drängte weiter. Der riesige Kerl wollte gerade mit seinem Schild auf Bruno eindreschen, als jemand anders von hinten nach seinen Armen griff.