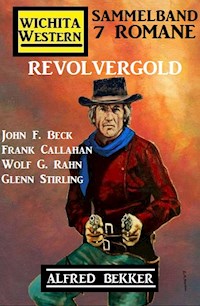
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Männer im Kampf um Recht und Rache. Dramatische Romane aus der harten Zeit des Wilden Westens, von Top-Autoren des Genres in Szene gesetzt Dieser Sammelband enthält folgende Western-Romane: (599) Glenn Stirling: Die Pantherin schlägt zu Frank Callahan: Keinen Cent für Chacos Leben John F. Beck: Shengs Goldkutsche Alfred Bekker: Nugget-Jäger Wolf G. Rahn: Greg Türner und das blutige Gold Wolf G. Rahn: Carringo und die Galgenvögel Wolf G. Rahn: Carringo und der Sohn des Killers xx Wahlkampf in Arkansas! Der amtierende Gouverneur Harry Houston hat einen ernstzunehmenden Gegner bekommen: „Terry“ Rory O´Hagan – ein Mann, dem es gelungen ist, in kürzester Zeit die Sympathien vieler Wähler zu gewinnen. Kurz vor dem entscheidenden Wahltag wird er entführt. Niemand kennt seinen Aufenthaltsort – aber wenn er nicht bald wieder frei kommt, dann hat er die Wahl verloren. Braddock und Yumah greifen ein – und sie erkennen sehr rasch, dass dieser Wahlkampf bisher alles andere als ehrlich abgelaufen ist. Eine schmutzige Intrige folgt der anderen, und bald ist klar, wer hinter der Entführung von O´Hagan steckt. Derjenige fühlt sich zwar noch sicher – aber wenn Braddock und Yumah sich einmischen, dann gibt es jede Menge Ärger...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 919
Ähnliche
Wolf G. Rahn, Alfred Bekker, Glenn Stirling. Frank Callahan, John F. Beck
Inhaltsverzeichnis
Revolvergold: Wichita Western Sammelband 7 Romane
Copyright
Die Pantherin schlägt zu
Keinen Cent für Chacos Leben
Shengs Goldkutsche
Nugget-Jäger
Greg Turner und das blutige Gold
Carringo und die Galgenvögel
Carringo und der Sohn des Killers
Revolvergold: Wichita Western Sammelband 7 Romane
Alfred Bekker, Wolf G. Rahn, Frank Callahan, John F. Beck, Glenn Stirling
Männer im Kampf um Recht und Rache. Dramatische Romane aus der harten Zeit des Wilden Westens, von Top-Autoren des Genres in Szene gesetzt
Dieser Sammelband enthält folgende Western-Romane:
Glenn Stirling: Die Pantherin schlägt zu
Frank Callahan: Keinen Cent für Chacos Leben
John F. Beck: Shengs Goldkutsche
Alfred Bekker: Nugget-Jäger
Wolf G. Rahn: Greg Türner und das blutige Gold
Wolf G. Rahn: Carringo und die Galgenvögel
Wolf G. Rahn: Carringo und der Sohn des Killers
xx
Wahlkampf in Arkansas! Der amtierende Gouverneur Harry Houston hat einen ernstzunehmenden Gegner bekommen: „Terry“ Rory O´Hagan – ein Mann, dem es gelungen ist, in kürzester Zeit die Sympathien vieler Wähler zu gewinnen. Kurz vor dem entscheidenden Wahltag wird er entführt. Niemand kennt seinen Aufenthaltsort – aber wenn er nicht bald wieder frei kommt, dann hat er die Wahl verloren.
Braddock und Yumah greifen ein – und sie erkennen sehr rasch, dass dieser Wahlkampf bisher alles andere als ehrlich abgelaufen ist. Eine schmutzige Intrige folgt der anderen, und bald ist klar, wer hinter der Entführung von O´Hagan steckt. Derjenige fühlt sich zwar noch sicher – aber wenn Braddock und Yumah sich einmischen, dann gibt es jede Menge Ärger...
Copyright
CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author / COVER EDWARD MARTIN
© dieser Ausgabe 2021 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Die Pantherin schlägt zu
Ein Western von Glenn Stirling
IMPRESSUM
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Author/ Titelbild: Firuz Askin, 2016
© dieser Ausgabe 2016 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
www.AlfredBekker.de
Wahlkampf in Arkansas! Der amtierende Gouverneur Harry Houston hat einen ernstzunehmenden Gegner bekommen: „Terry“ Rory O´Hagan – ein Mann, dem es gelungen ist, in kürzester Zeit die Sympathien vieler Wähler zu gewinnen. Kurz vor dem entscheidenden Wahltag wird er entführt. Niemand kennt seinen Aufenthaltsort – aber wenn er nicht bald wieder frei kommt, dann hat er die Wahl verloren.
Braddock und Yumah greifen ein – und sie erkennen sehr rasch, dass dieser Wahlkampf bisher alles andere als ehrlich abgelaufen ist. Eine schmutzige Intrige folgt der anderen, und bald ist klar, wer hinter der Entführung von O´Hagan steckt. Derjenige fühlt sich zwar noch sicher – aber wenn Braddock und Yumah sich einmischen, dann gibt es jede Menge Ärger...
Der Mann steht am Fenster. Die Gardine ist nur einen Spalt geöffnet. Groß und breit ist der Rücken des Mannes, der hinaus auf die Straße schaut, der die Klänge der Musikkapelle hört, der die Menschen unten sieht, die sich drängen, um „Terry“ Rory O’Hagan zu sehen, den Mann, dem das Volk in Arkansas zujubelt.
Der Mann am Fenster würde niemals jubeln. Der Mann am Fenster will nur sehen, ob sein Plan richtig eingefädelt ist. Er ist kein Freund von „Terry“ Rory O’Hagan wie all die Menschen da unten.
Solche Wahlveranstaltungen hat der Mann am Fenster schon viele gesehen.
Und immer wurde Rory O’Hagan zugejubelt. Die Leute wollen ihren „Terry“ sehen, das ist sein Spitzname, für ihn fast ein Kosename. Sie lieben ihn, und jetzt ist er auch auf dem Podium erschienen.
Jubel brandet auf. Die Fackeln leuchten mit zuckenden Flammen auf die Szene. Das Licht erhellt die straffe, sehnige Gestalt von Rory O’Hagan.
Er hebt die Hände, bedankt sich für den Beifall. Und dann ist es auf einmal still.
Sie warten auf seine Rede. Gebannt schauen sie zu ihm hin.
Rund um das Podium stehen die Männer, die Terry auf seiner Wahlreise begleiten.
Der Mann am Fenster verzieht sein Gesicht. Es ist kein schönes Gesicht, voller Falten und Narben. Das Gesicht eines Kämpfers. Er wird El Capitan genannt. Ein Name, den ihm seine mexikanischen Gegner gegeben haben. Denn er selbst ist kein Mexikaner. Seine Augen sind blau, sein schütteres Haar, dort, wo es noch nicht ergraut ist, war einmal blond. Dreißig Jahre seines fünfzigjährigen Lebens sind Kampf gewesen. Und solange er atmet, wird sein Leben Kampf sein.
Unten hat Terry zu reden begonnen. Eine Rede, die El Capitan kennt. Er könnte sie selbst aufsagen, so oft hat er sie gehört. Denn dieser Mann dort unten, der seine Zuhörer in Bann schlägt und so begeistern kann, möchte Gouverneur von Arkansas werden, mit Reformen, mit einem Blick auf eine neue Zukunft, auf eine ganz andere Zukunft, in der alle Menschen gleich sind, auch der mexikanische Teil der Bevölkerung, ja sogar die Neger. In Frieden will er mit allen anderen leben. Und er möchte die Armen besserstellen, nicht alles den Reichen zufließen lassen. Und von Freiheit, von sehr viel Freiheit ist die Rede.
El Capitan kennt diese Sätze, und er hört gar nicht mehr hin. Er beobachtet nur, wo seine Männer stehen, ob sie dort sind, wo er sie haben will.
Hinter ihm knarrt es. Aber Capitan dreht sich nicht um. Er weiß, wer da noch mit im Zimmer steht und sich jetzt mit langsamen Schritten nähert, neben ihm stehenbleibt.
Mitch Brighton, sein bester Mann, kleiner als er, aber breit in den Schultern, mit einem muskulösen Nacken, einem sonnengebräunten, kantigen Gesicht. Auch er hat blaue Augen. Auch bei ihm ist das Haar nicht mehr so dicht wie früher. Doch Mitch Brighton ist gut zehn Jahre jünger als El Capitan. Immerhin reiten sie seit zwanzig Jahren Bügel an Bügel.
„ Es ist alles richtig, nicht wahr, El Capitan?“, sagt Brighton mit spröder Stimme.
El Capitan antwortet mit abgrundtiefem Bass:
„ Ich habe lange genug auf diesen Augenblick gewartet. Jetzt schnappen wir ihn uns.“
„ Auch die Frau?“, will Mitch Brighton wissen.
Ihrer beider Blicke konzentrieren sich auf eine Gestalt neben dem Podium. Eine auffallend schöne Gestalt. Sie ist nicht so blond wie ihr Bruder, diese strahlend schöne junge Frau. Sie hat rotes Haar, langes, bis zu den Schultern reichendes rotes Haar. Sie ist schlank, und ihr Äußeres verrät etwas von dem Feuer, das sie besitzt.
Dieses Feuer ist auch in ihren Augen.
„ Er kann gut reden“, stellt Mitch Brighton fest, „und dazu hat er dieses Kapital von Weib.“
El Capitan verzieht das Gesicht und lächelt. Dabei vermehren sich noch die Falten in seinem Antlitz. „Ja, ein hübsches Biest ist sie schon. Verfolgt sie dich in deinen Träumen, Mitch?“
„ Manchmal schon“, gibt Mitch zu.
So etwas würde er nie einem anderen sagen, nur El Capitan. Weil sie Freunde sind. Freunde auf einem Höllenpfad, den sie seit zwanzig Jahren gemeinsam reiten.
„ Mit einer Verfolgung ist nicht zu rechnen“, sagt Mitch. „Das habe ich alles abgeklärt. Die paar Mann von der Nationalgarde werden einer falschen Spur folgen, so wie es abgemacht ist. Der Sheriff unternimmt überhaupt nichts, auch das ist abgemacht. Terry ist uns in die Falle gelaufen. Hier in der Stadt hätte er nie aufkreuzen dürfen. Aber jeder macht nun mal seinen Fehler. Er ist so sicher, dass ihn alle lieben, da kommt er gar nicht darauf, dass es hier doch eine ganze Menge gibt, die ganz anders denken. Eigentlich schade um den Burschen. Wenn er auf unserer Seite stünde, könnte er uns verdammt helfen.“
„ Solche Leute stehen nie auf unserer Seite“, erwidert El Capitan. „Und jetzt wollen wir nicht länger reden. Wenn er mit seiner Ansprache fertig ist und das Podium verlässt, schlagen wir zu. Ist wirklich alles bereit? “
„ Alles, El Capitan“, versichert Mitch. „Ernest steht ihm am nächsten. Die anderen haben ihre Positionen eingenommen, und die Scharfschützen befinden sich bereits auf den Dächern.“
„ Ich will kein Blutbad in der Menge, verstehst du?“, erklärt El Capitan. „Das ist nicht abgemacht.“
„ Nur zur Sicherheit, El Capitan, nur zur Sicherheit. Es sind Leute, die sich nachher wieder unter die Menge mischen und uns irgendwann folgen. Wir müssen eine Nachhut haben, El Capitan. Wir müssen dafür sorgen, dass es nicht dazu kommt, wenn ein paar Verrückte sich auf die Pferde schwingen und uns zu folgen versuchen. Auch ungeübte Burschen können uns, wenn sie etwas Glück haben, gefährlich werden. Das müssen wir verhindern.“
„ Dann schießt auf die Pferde und nicht auf die Männer. Man wird sowieso behaupten, dass Harry Houston hinter allem steckt. Diesen Eindruck müssen wir verwischen.“
„ Wenn die Lösegeldforderung herauskommt, ist dieser Eindruck verwischt. Dann denkt niemand mehr, dass sich Houston Vorteile verspricht, weil er wieder Gouverneur werden will. Sie werden annehmen, dass es ein Banditenstück ist, und nicht mehr.“
„ Bist du Republikaner?“, fragt El Capitan lächelnd.
„ Ich bin weder Demokrat noch Republikaner. Ich bin für gar keine Partei. Die einzige Partei, die ich kenne, der gehören wir beide an. Das sind wir zwei.“
El Capitan lacht und wendet sich Mitch Brighton zu, schlägt ihm auf die Schulter und sagt, während er zu ihm herabblickt: „Ich denke genau wie du. Es ist das einzige, was einen über Wasser hält, wenn man selbst die eigene Partei Ist und sonst gar nichts. Sie bezahlen uns gut, und das ist das, was mich wirklich interessiert. Denn Houston redet denselben Stuss wie Terry. Sie sind alle gleich. Sie wollen an die Macht.“
„ Na, ich bin mir nicht so sicher, ob Terry so denkt. Weißt du, El Capitan, das ist ein Idealist, ein Verrückter.“
„ Deshalb muss er weg, so einfach ist das.“
„ Das heißt in anderen Worten, dass wir ihn früher oder später umlegen.“
El Capitan hebt beschwörend die Hand. „Aber nicht doch! Erst einmal darf ihm gar nichts geschehen, denn sie werden Beweise verlangen, dass er lebt. Immerhin wollen wir Lösegeld.“
„ Und was unternimmt Houston? Er kann doch nicht einfach tatenlos zusehen. Bedenke mal, wieviel Anhänger Terry inzwischen hat. Wenn heute Wahltag wäre, steckte er mit seinen Demokraten die Republikaner in die Tasche! Dann wäre er Gouverneur.“
„ Natürlich“, meint El Capitan lächelnd. „Das ist es ja. Aber Houston wird natürlich eine Menge tun. Wahrscheinlich schickt er ein paar Marshals hinter uns her, aber zu befürchten haben wir nichts. Natürlich müssen wir aufpassen, dass nicht irgendein Übereifriger darunter ist. Der hat dann eben Pech gehabt.“
„ Es ist gleich soweit“, sagt Mitch Brighton und blickt aus schmalen Augen hinunter auf die Szene um das Podium.
Sie lauschen wieder beide. Die Sätze, die von unten heraufklingen und die sie durchs geöffnete Oberfenster hören können, sind ihnen beiden vertraut.
„ Terry“ Rory O’Hagan kommt zum Schluss seiner Rede. Immer wieder unterbrochen von Beifall, holt er nun zum großen Finale aus.
Mitch Brighton beobachtet die Frau, die ganz dicht an dem Podium steht und zum Sprecher hinaufschaut. Die Fackeln werden von ihren Augen reflektiert, so dass es den Eindruck hat, als würden diese Augen leuchten.
Mitch Brighton weiß, wer diese Frau ist. Terrys Schwester und seine engste Mitarbeiterin in diesem Wahlkampf um den Gouverneursposten. Eine betörend schöne Frau, die besonders von den Männern unter den Zuhörern mit größtem Interesse beobachtet wird. Und jetzt steigt sie ebenfalls zum Podium empor. Zwei Männer neben ihr helfen ihr hinauf.
Terry breitet die Arme aus. Beifall brandet auf. Er hat seine Rede beendet.
Und dann kommt seine Schwester Patty.
Groß, schlank, das rote Haar leuchtet im Schein der Fackeln wie Feuer. Ihr Gesicht erscheint ein wenig blass, aber es ist ein ausgesprochen schönes Gesicht. Das dunkelblaue Kleid, das sie trägt und das bis zum Boden reicht, umschließt ihren Körper wie eine zweite Haut. Ein schlanker, hinreißend schöner Körper für alle jene, die Patty O’Hagan da oben sehen.
Und nun, als der Beifall abebbt, spricht sie, wie immer nach der Wahlrede ihres Bruders ein paar Worte, fordert die Zuhörer auf, ihren Bruder zu wählen, weil er ein Garant für all das ist, was er ihnen zugesagt hatte, sollte er Gouverneur werden.
Der Beifall nach diesen wenigen Sätzen fällt noch stürmischer aus als zuvor. Patty lächelt ebenso wie ihr Bruder den Zuschauern zu, und sie weiß sicherlich, dass es nicht nur ihre Worte waren, die besonders die Männer unter den Zuschauern begeistern. Sie selbst ist es.
„ Ganz schön kluges Weib! Sieh nur, Mitch, wie die sich bewegt. Geschmeidig wie ein Pantherweibchen.“
„ Du hast das schon mal gesagt, El Capitan“, meint Mitch grinsend.
„ Was gesagt?“
„ Du hast sie schon einmal Pantherin genannt.“
„ Sie ist gefährlich. Ich glaube, sie ist klüger als ihr Bruder. Die ganzen Wahlreisen hat sie organisiert. Vielleicht hat sie auch seine Reden geschrieben“, meint El Capitan.
„ Fährt sie mit weg?“
„ Um Himmels willen, nein, obgleich es das beste wäre. Aber diesen Fehler dürfen wir nicht machen, auch wenn es sich anbietet.“
Er zieht seine Taschenuhr aus der Weste, lässt den Deckel aufspringen und sagt: „Ganz pünktlich. Jetzt ist es soweit.“
Sie sehen, wie eine Kutsche auf die Menge zurollt. Dahinter ein zweiter Wagen, begleitet von zwei Reitern. Ihre Gesichter sind in der Dunkelheit, abseits des Fackelscheins, nicht zu sehen, so wenig wie das Gesicht des Kutschers.
Der Wagen hält. Einer von den acht Männern, die „Terry“ Rory O’Hagan begleiten, kommt zur Kutsche herüber und will zum Bock hinaufsteigen.
Plötzlich sind da drei Gestalten um ihn. Alles spielt sich abseits des Lichtscheines ab. Der Begleiter verschwindet. Aber dann zieht sich ein anderer hinauf auf den Bock. El Capitan und Mitch Brighton wissen, dass es nicht einer von den Begleitern Terrys ist, sondern einer von ihren Männern. Aber die Kleidung ähnelt sich.
Und dann kommen die sieben anderen Begleiter, umringen Terry und seine Schwester, die von den Menschen umjubelt wird, halten die übereifrigen Männer, die Patty aus allernächster Nähe sehen wollen, zurück, ebenso wie die Frauen, die sich zu Terry drängen, der in seinem Wahlkampf ganz besonders die Frauen auf seiner Seite hat, obgleich sie gar nicht wählen dürfen. Aber er ist ihr Idol, sie umjubeln ihn. Ein Mann wie aus dem Bilderbuch.
Aber da sind auch andere, die nur so tun, als jubelten sie den beiden zu. Männer, die sich ebenfalls herandrängen, zwischen die Begleiter schieben.
Terry und seine Schwester steigen in die Kutsche. Zwei der Begleiter steigen ebenfalls ein. Ein dritter will es, aber plötzlich verschwindet er wie durch Zauberhand, sackt einfach weg und ist in der Menge nicht mehr zu sehen. Einem anderen geht es ebenso.
Und plötzlich sind vorn am Gespann Männer, die der Kutsche eine Gasse bahnen. Männer, die aussehen wie die Begleiter Rory O’Hagans. Aber es sind die Männer von Mitch Brighton, auch wenn sie die Kleidung so tragen wie die kleine Schutzgarde des Bewerbers um den Gouverneursposten.
„ Nur zwei sind drin. Es hat besser geklappt, als ich dachte“, sagt El Capitan, der sich eine Zigarre angebrannt hat und gelassen daran zieht, während er sich zugleich das Spektakel da unten ansieht wie auf einer Bühne.
Und dann fährt die Kutsche los. Sie fährt ziemlich schnell los. Die Gasse ist frei. Reiter sind in den Sätteln.
Plötzlich schreit jemand:
„ Hilfe! Er hat ein Messer in der Brust, Hilfe!“
Die Stimme einer Frau, gellend und durchdringend.
Jetzt kommt Bewegung in die Menge da unten. Dann wieder der Ruf, dass irgendwo zwischen ihren Füßen einer liegt, tot, erstochen.
Die Kutsche fährt schon davon, wird schneller. Ein Rudel Reiter kommt aus einer Seitengasse, schwärmt um die Kutsche herum, begleitet sie aus der Stadt Saldown.
„ Es ist erledigt“, meinte Mitch Brighton und blickt erleichtert auf El Capitan.
Der zieht an seiner Zigarre. Sein Gesicht wirkt unbewegt. Dann nimmt er die Zigarre aus dem Mund und erwidert, ohne den Blick von der Straße zu wenden:
„ Vier von denen haben sie jetzt gefunden. Aber sie gackern durcheinander wie die Hühner. Du hast es gut berechnet, Mitch.“
Mitch grinst stolz: Es ist nicht sein erster Auftrag, den er durchorganisiert hat.
Männer rufen nach dem Sheriff. Und dann spielt sich auf einmal alles das ab, was in Mitch Brightons Organisationsplan passt. Aber es vergeht immerhin noch eine halbe Stunde, bis sie alle fünf niedergemachten Begleitleute gefunden haben.
Vier liegen tot auf der Straße. Der fünfte ist besinnungslos, aber ansonsten unverletzt. Der sechste und der Kutscher des Wagens werden ebenfalls bewusstlos gefunden, doch sie sind beide nicht niedergeschlagen worden. Unmittelbar in ihrer Nähe liegen Wattebäusche, die mit Chloroform getränkt waren.
Der Sheriff und seine beiden Deputies haben alle Hände voll zu tun, die Leute zurückzudrängen, damit sie ihre Untersuchungen einleiten können.
Niemand macht nur den Versuch oder den Vorschlag, der Kutsche zu folgen. Man kennt diese Männer nicht, die da am Boden liegen, weiß aber, dass sie zur Begleitung gehört haben. Aber so richtig begreift keiner der Menschen da unten, um was es wirklich geht und was da überhaupt passiert ist.
Erst als der Kutscher aus seiner Bewusstlosigkeit erwacht, scheint Licht in das Dunkel dieses Vorgangs zu kommen. Aber der Sheriff nimmt sich sofort des Kutschers an, und der Arzt der Stadt, ein alter Säufer, ist mit zwei schroffen Worten davongescheucht worden. Nachdem sich der Kutscher mehrmals übergeben hat, weil er das Chloroform nicht verträgt, ist es der Sheriff, der hört, dass Unbekannte den Kutscher überwältigt haben und ihm den mit Chloroform getränkten Wattebausch vor die Nase hielten.
Es gibt keine Spur, keinen Hinweis, nichts. Nur dass Fremde in der Stadt gewesen waren. Fremde, die nicht zur Begleitung „Terry“ Rory O’Hagans gehörten.
So lässt der Sheriff nach Fremden suchen. Aber nicht im Hotel, wo El Capitan und Mitch Brighton sind. Die Scharfschützen von den Dächern sind längst weg, haben sich vorhin schon unter die Menge gemischt, als noch ein lebhaftes Durcheinander herrschte.
Und jetzt sind sie längst verschwunden. Nur El Capitan und Mitch Brighton sind noch in der Stadt. Aber die waren schon Tage vor dem Eintreffen Rory O’Hagans hier. Für die Stadt sind es keine Fremden, sondern gute Freunde vom Sheriff. Zwei Männer, die ihn besucht haben und erst morgen Abend, wenn die Linienkutsche kommt, weiterreisen werden.
Der einzige, der einen Zusammenhang kennt, ist der Sheriff. Und der ist wirklich ein alter Freund von El Capitan, ist früher selbst einmal an dessen Seite geritten und hat bei der von langer Hand vorbereiteten Falle mitgewirkt, in die Rory O’Hagan hier, in diesem Ort, tappen sollte. Und er ist hineingetappt.
El Capitan zieht wieder die Uhr heraus, lässt den Deckel aufschnappen und sagt zu Mitch Brighton:
„ In einer halben Stunde holen sie ihn aus dem Wagen. Hoffentlich machen deine Leute keinen Unfug. Ich meine, was Patty O’Hagan angeht.“
Mitch Brighton schüttelt empört den Kopf. „Aber nein! Die halten sich genau an meine Anweisungen.“
„ Sie ist eine sehr hübsche Frau. Darüber könnte mancher deine Anweisungen vergessen, mein lieber Mitch“, erwidert El Capitan mit hartem Lächeln.
*
Noch bevor die Kutsche die Stadt verlassen hat, ist der Begleitfahrer aufs Dach gekrochen. Und am Stadtrand fallen die Schüsse.
Er feuert zweimal blindlings in die Richtung, wo die beiden Begleiter von Rory O’Hagan und seiner Schwester im Wagen sitzen.
Das Mündungsfeuer ist kaum erloschen, da preschen zwei der Begleitreiter heran. Aber es sind eben nicht Rory O’Hagans Männer. Und als er das begreift, ist es zu spät.
Die beiden Begleiter in der Kutsche sind beide nicht tödlich getroffen, versuchen, ihre Revolver noch in Anschlag zu bringen ... zu spät!
Durch das offene Fenster fallen die Schüsse. Dann pariert der Kutscher das Gespann. Und die Kutsche ist von Männern umringt, die ganz und gar nicht Rory O’Hagans Bewunderer sind.
Patty O’Hagan ist unbewaffnet. Aber als die Männer in die Kutsche eindringen, wehrt sie sich wie ein Mann. Sie schlägt, sie tritt nach ihnen. Aber sie hat keine Chance, mit ihnen fertigzuwerden, so wenig wie Rory O’Hagan. Als der seinen Revolver, den er noch an einer ungünstigen Stelle unter seiner Jacke trägt, herausziehen will, fliegt ihm durchs offene Fenster ein Sack ins Gesicht, und dann stürzen sich zwei Männer auf ihn, entwinden ihm die Waffe, reißen ihm den Sack vom Gesicht und pressen ihm etwas auf Nase und Mund.
Er versucht, sich ihnen zu entwinden. Aber mittlerweile sind sie zu dritt. Und einer von ihnen hat Arme wie Stahlzwingen.
Rory O’Hagan ist kein Athlet, der die Möglichkeit gehabt hätte, mit ihnen fertigzuwerden. Und dieser Bausch, mit Chloroform getränkt, lässt seine Kräfte rasch erlahmen. Alles beginnt sich um ihn zu drehen, und er sinkt in eine tiefe Ohnmacht.
Indessen versuchen zwei andere Männer, denen jetzt ein dritter noch zu Hilfe eilt, die tobende Patty O’Hagan zu bändigen.
Als einer von ihnen mit dem Revolverkolben nach Pattys Kopf schlagen will, brüllt der schnauzbärtige Ernest Warren, der die Mannschaft führt:
„ Bist du wahnsinnig? Verletze sie nicht!“
Es gelingt den drei Männern, mit vereinter Kraft Patty O’Hagan zu überwältigen, aus dem Wagen zu reißen, auf den Boden zu pressen, um ihr dann, genau wie ihrem Bruder, einen Wattebausch mit Chloroform getränkt ins Gesicht zu pressen.
Sekunden später hat sie das Bewusstsein verloren.
Sie wird wieder in den Wagen geladen,und ein großer, sehr hagerer, fast dürrer Mann betrachtet die beiden Bewusstlosen. Vorsichtshalber träufelt er wieder Chloroform auf einen Wattebausch, hält ihn aber in der Hand und wartet darauf, dass einer der beiden zu sich kommen könnte.
Indessen fährt die Kutsche weiter, fährt durch die Nacht, und die Pferde laufen, was sie können.
Eine halbe Stunde später wird die Kutsche angehalten, werden die Pferde gewechselt. Frische Tiere werden von einer kleinen Reitergruppe, die dort wartet, bereit gehalten. Die ausgespannten Pferde lässt man einfach laufen. Dann fährt die Kutsche weiter, wieder so schnell es möglich ist.
Nach einstündiger Fahrt ist wieder Pferdewechsel. Alles scheint wie am Schnürchen zu klappen.
Die Zahl der Begleiter wird immer größer. Mittlerweile sind es achtundzwanzig Reiter, die neben der Kutsche reiten. Im Wagen sitzen weitere drei Männer. Einer davon ist „Doc“ Bill Maugham, der Mann, der dafür sorgt, dass die beiden immer wieder betäubt werden, sobald sie zu sich kommen.
Warren reitet einmal, als die Pferde der Kutsche Schritt gehen,neben dem Wagen und ruft durchs offene Fenster Bill Maugham zu:
„ Doc, halte sie bewusstlos! Ich will nicht, dass sie irgend etwas sehen, vor allen Dingen die Frau.“
„ Das kann ich nicht ewig so weitermachen“, erwidert Maugham. „Ich bringe sie damit um.“
„ In Ordnung. Wir haben nur noch eine halbe Stunde.“
„ Selbst wenn sie zu sich kommen“, ruft Maugham nach draußen, „sind sie nicht völlig da. Sie werden sich erbrechen. Chloroform ist ein Teufelszeug. Sie fühlen sich den ganzen Tag so mies, dass sie keinen klaren Gedanken fassen.“
„ Wenn es so ist, dann hör auf. Ich sagte ja, eine halbe Stunde“, brüllt Warren in den Wagen.
Eine halbe Stunde später hält die Kutsche in einem Arroyo, dem Tal eines ausgetrockneten Regenflusses voller Steine und struppigem Buschwerk an den Ufern. Es wächst hier unten etwas Gras, obgleich dieses Flussbett nur zwei oder dreimal im Jahr etwas Wasser führt.
Die Pferde grasen, die Männer machen Rast, und all jene, die sich der Kutsche oder in der Nähe befinden, müssen auf Warrens Befehl hin Halstücher über die untere Gesichtshälfte ziehen. Zwar sind die beiden Gefangenen immer noch benommen, aber Warren möchte kein Risiko eingehen. Er kann nicht abschätzen, ob die beiden alles um sie herum wahrnehmen oder nicht.
Als die Rast so gut wie vorüber ist, befiehlt Warren mit gedämpfter Stimme, die Frau aus dem Wagen zu ziehen.
Patty O’Hagan kann sich mit Mühe aufrecht halten. Sie ist wachsbleich, Brechreiz überkommt sie, und sie muss sich übergeben, kaum dass sie aus dem Wagen ist.
Niemand kümmert sich um sie, niemand hält sie noch fest. Aber bis sie das begreift und überhaupt weiß, was ihr geschah, setzt sich die Kutsche wieder in Bewegung, der Hufschlag vieler Pferde ertönt, und die ganze Kavalkade mit der Kutsche in der Mitte prescht davon.
Patty O’Hagan ist nicht in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen. Sie kniet am Boden, und immer wieder würgt es sie im Hals, obgleich sie gar nichts mehr erbrechen kann. Ihr ist speiübel und hundeelend. Aber trotzdem wird ihr allmählich klar, dass man sie von ihrem Bruder getrennt hat. Sie ist freigelassen worden, hier in der Wildnis, und sie weiß nicht einmal, wo sie sich befindet. Aber ihren Bruder hat man mitgenommen.
Plötzlich hört sie den Hufschlag eines einzelnen Pferdes. Sie nimmt es nur im Unterbewusstsein wahr. Denn wieder würgt es sie im Hals, und sie hat das Gefühl, sterben zu müssen.
Sie verhält sich ganz still, damit sie nicht neuer Brechreiz überkommt, atmet mit offenem Mund und stützt ihren Oberkörper auf die Arme. Sie selbst kniet und kommt sich wie ein Tier vor, wie ein geprügeltes, ausgesetztes waidwundes Tier.
Plötzlich sieht sie die Beine schemenhaft vor sich in der Nacht. Sie blickt höher, und das kostet sie schon Mühe. Alles um sie herum scheint sich zu drehen, wenn sie den Kopf hebt.
Ein Mann.
„ Du hast gedacht“, hört sie eine fremde Stimme sagen, „dass du einfach so ungeschoren davonkommst? So etwas wie dich habe ich noch nie vor mir gehabt. Darauf musste ich mein ganzes Leben warten. Aber jetzt ist meine Stunde da. Du hast mir von Anfang an gefallen. Sieh mich an! Komm weg hier von dieser Schweinerei. Steh auf!“,
Sie steht nicht auf. Sie blickt nur zu ihm empor. Und das kostet sie Kraft.
Und dann sieht sie, wie er seinen Waffengurt öffnet, ihn beiseite wirft, wie er damit anfängt, seine Hose aufzuknöpfen.
„ Los, ein Stück weiter hinüber, weg von diesem Dreck!“, hört sie ihn sagen.
Sie begreift, was er will. Er will sie. Und er geniert sich nicht, sich vor ihr auszuziehen.
Plötzlich ertönt wieder Hufschlag. Patty versucht, ihre Gedanken zusammenzufassen, will klar denken, aber es gelingt ihr nicht. Immer wieder dieses Summen im Kopf, dreht sich alles um sie herum. Und dann dieser würgende, widerliche Brechreiz.
Er überkommt sie gerade in dem Augenblick, als der Mann in ihrer Nähe plötzlich seine Hosen wieder hochzieht und ihr absolut keine Aufmerksamkeit mehr schenkt.
Und dann auf einmal ist der Reiter da.
Wie durch Watte hört Patty O’Hagan diesen Reiter brüllen:
„ Ich habe es gewusst! Ich habe es doch gewusst, du verdammter Hundesohn! Hatte ich euch nicht gesagt, dass sie nicht angerührt wird? Und du hast geglaubt, ich merke nicht, dass du zurückgeblieben bist? Du bist ein Verräter, ein gottverdammter Verräter!“
Und plötzlich kracht der Schuss.
Aus den Augenwinkeln sieht es Patty aufblitzen, hört den Knall, und dann schlägt der Mann, der sie haben wollte, vor ihr zu Boden. Er gibt keinen Laut mehr von sich. Er fällt einfach hin, liegt auf dem Rücken, und das schwache Licht der Sterne spiegelt sich in seinen weit geöffneten Augen.
Der Reiter sitzt ab, hebt irgend etwas auf, und Patty ist gar nicht dazu imstande, zu beobachten, dass es der Waffengurt des Toten ist, den er an sich nimmt. Er führt sein Pferd hinüber zu dem Pferd des Toten, sitzt wieder auf, jagt das ledige Pferd davon und verschwindet, ohne ein Wort zu Patty zu sagen.
Sie fühlt sich viel zu schlecht, ist viel zu erschöpft und noch zu benommen, um überhaupt zu begreifen, dass sie allein mit einem Toten hier zurückbleibt.
Erst als der Tag graut, geht es ihr besser. Da sieht sie den Toten, der noch immer so liegt wie vorhin. Die gebrochenen Augen sind zum Himmel gerichtet.
Patty ist keine Mimose. Sie ist mit ihrem Bruder auf einer Farm groß geworden und hat schon viele Dinge gesehen, die ein sanftes Gemüt verschrecken können.
Aber der Anblick des Toten ist ihr nicht gleichgültig. Es kostet sie Überwindung, ihn nach Waffen abzutasten, nach einem Messer wenigstens. Denn ein Messer könnte sie brauchen. Ihr ist klar, dass sie sich zu irgendeiner Siedlung durchschlagen muss. Die Gegend ist ihr abseits der Kutschenstraße unbekannt.
Sie findet ein Messer, und als erstes schneidet sie sich vom Rock des Kleides ein paar Handbreit ab, um sich besser bewegen zu können. Sie ist noch gar nicht damit fertig, als ihr der Zufall zu Hilfe kommt.
Sie schaut einmal auf und sieht am Rande des Arroyos plötzlich ein reiterloses Pferd stehen. Erst beim zweiten Hinsehen erkennt sie das Tier, das dem Toten gehörte.
Es ist gesattelt, der Zügel hängt herunter, das Tier steht mit hängendem Kopf in etwa zweihundert Schritt Entfernung.
Patty zögert keine Sekunde. Sie springt auf, aber das tut ihr nicht gut. Wieder überkommt sie Brechreiz. Sie atmet tief durch, und da geht es besser. Dann macht sie sich auf den Weg, läuft in Richtung zu diesem Pferd hinüber.
Die Schuhe, die sie trägt, sind nicht sehr gut für einen Marsch durch das Geröll geeignet. Aber da reißt sie kurz entschlossen die Schuhe von den Füßen und schleudert sie beiseite. Barfuß, auf ihren Seidenstrümpfen, geht sie weiter.
Als sie das Pferd erreicht, begreift sie, warum es nicht weitergelaufen ist. Es hat sich im Zügel verfangen und ist darauf getreten und kommt nicht weg.
Sie hebt dem Pferd den Huf an, zieht den Zügel hervor, tätschelt das Pferd freundschaftlich und führt es dann übers Geröll zurück zu der Stelle, wo der Tote liegt.
Unterwegs ist ihr Plan gereift.
Sie mustert den Toten. Dann tut sie etwas für eine Frau Ungewöhnliches. Sie entkleidet den Mann, weil sie seine Sachen braucht, zieht sich selbst aus, steigt in die Hosen des Toten, schneidet ihr Kleid bis zur Taille ab und zieht sich das Oberteil wie eine Bluse an. Dann streift sie sich die Jacke des Toten über, schleppt die Leiche weiter vom ausgetrockneten Flussbett weg, bis an eine Stelle, von der sie glaubt, dass das Wasser, sollte es einmal regnen, nicht bis hierher reicht. Sie bedeckt den Toten mit Steinen und schafft so ein eigenwilliges Grab. Als sie damit fertig ist, spricht sie ein kurzes Gebet, geht dann in den viel zu großen Stiefeln des Toten zum Pferd, das sie angebunden hat, löst die Zügel und sitzt auf.
Sie ist eine hervorragende Reiterin, und im Herrensitz im Sattel zu sitzen ist ihr keinesfalls ungewohnt. Das Tier merkt das rasch.
Während des Rittes kramt sie in der Satteltasche des Toten und findet zu ihrer Überraschung einen Revolver, dessen Trommel geladen ist.
Sie steckt ihn in die Satteltasche zurück, aber so, dass sie jederzeit danach greifen kann.
Als sie eine Anhöhe erreicht und einen besseren Rundblick hat, versucht sie sich zu orientieren.
In ihrer Erinnerung müsste östlich von hier eine Siedlung sein. Und soviel sie weiß, ist das sogar eine mit einem Telegrafen. Aber sie hat keine Ahnung, wie weit das von hier entfernt ist.
Sie reitet nach Osten, und kurz nach Mittag, als die Sonne unerträglich heiß herunterbrennt, stößt sie auf einen Wagenweg.
Kurz entschlossen folgt sie ihm in nordöstlicher Richtung.
Es wimmelt hier von Huf und Wagenradspuren. Sie hat keinen Zweifel, dass sie früher oder später eine Siedlung erreichen muss. Sie hofft nur, dass es Gratty ist, wo es diesen Telegrafen gibt.
Den Plan, den deutlichen Spuren der Entführer zu folgen, gibt sie auf. Ihr ist da vorhin schon, als sie das Pferd gefunden hatte, eine viel bessere Idee gekommen. Es gibt da einen Menschen, der ihr einmal sehr viel bedeutet hat. Ein Mensch, den sie noch immer liebt, aber der ein sehr ruheloser Mensch ist. Ein Mann, den es nie an einer Stelle hält.
Wenn mir jemand helfen kann, mir und meinem Bruder, dann gibt es nur ihn und seinen Freund. Dann werden mir Braddock und Yumah bestimmt zu Hilfe kommen. Und bis dahin werde ich vielleicht das Versteck der Entführer von Terry bestimmt ausfindig gemacht haben...
*
Von Gratty aus, das Patty O’Hagan einen Tag später erreicht, macht sich Sheriff Nance mit einer zufällig anwesenden Patrouille der Nationalgarde und drei seiner Deputies auf den Weg. Patty lässt es sich nicht nehmen, die Männer zu begleiten, um sie zu der Stelle zu führen, wo man sie ausgesetzt hat.
Sheriff Nance ist ein entschlossener Mann. Und da Gratty überwiegend demokratisch wählt, gehört er der gleichen Partei an wie Rory O’Hagan.
Die Männer der Nationalgarde interessieren sich überhaupt nicht für Politik, und schon gar nicht Lieutenant Ross, der sie führt.
Die Patrouille, achtundzwanzig Mann stark, folgt zusammen mit den Sheriffs und Patty den Spuren. Diese Spuren sind deutlich, fast zu deutlich nach dem Geschmack von Sheriff Nance. Und diese Spuren führen geradewegs auf den Red River zu, der hier an dieser Stelle die Grenze zwischen Arkansas und Texas bildet und hier durch fruchtbares Tiefland fliesst. Am Fluss aber enden alle Spuren.
Sheriff Nance und zwei seiner Begleiter legen ihren Stern ab und fahren auf einem Floß auf die andere Seite, um den Anschluss der Spuren zu finden.
Sie finden nichts und müssen auch zusehen, wieder zurück auf das Gebiet von Arkansas zu kommen, denn auf der anderen Seite ist texanisches Gebiet, und dort kennt man auch Sheriff Nance. Er hätte dort in seiner Eigenschaft als Gesetzeshüter keinerlei Vollmachten. Die Männer der Nationalgarde bleiben schon gleich auf dem diesseitigen Ufer.
Immerhin ist es Patty gelungen, Nance zu überzeugen, dass er doch wenigstens mit Farmern auf texanischem Gebiet sprechen sollte.
Sie bleiben die Nacht über am Ufer auf der Seite von Arkansas, überqueren aber in den Morgenstunden nochmals den Fluss, dessen Namen von der roten Färbung herstammt, die von rotem Ton verursacht wird, über den er lange Strecken fließt.
Ein breiter, und stellenweise sehr, sehr tiefer Fluss.
Auf der anderen Seite führen Nance, seine Deputies und Patty durch, was sie sich vorgenommen haben. Sie erreichen Farmen, fragen da und dort, und niemand kann ihnen eine Auskunft geben, die ihnen weitergeholfen hätte. Es ist, als wären die Entführer mit einem Schiff weitergefahren. Aber ein so großes Schiff, um so viele Pferde und Männer aufzunehmen und dazu noch eine Kutsche, hätte es hier gar nicht gegeben. Die einzige Möglichkeit wäre, dass es sich um ein Floß gehandelt hätte.
Sheriff Nance resigniert. Lieutenant Ross von der Nationalgarde sieht sowieso keine Möglichkeit, etwa auf texanischem Gebiet weiterzusuchen, weil er dazu keine Vollmacht hat.
Patty hofft auf Braddock und Yumah. Sie hat eine Telegramm an eine Stelle aufgegeben, die nicht einmal Sheriff Nance ein Begriff ist. Patty aber weiß, dass es diese Handvoll Special Deputies gibt, die überstaatlich eingesetzt werden, ohne offizielle Vollmachten zu besitzen. Sie müssen in Eigeninitiative ihre Vorhaben ausführen.
Pattys Verdacht, dass Gouverneur Houston irgendwie die Hand im Spiel hat, lässt sich auch durch die Tatsache nicht mindern, dass Ross den Auftrag bekommt, mit einer Verstärkung von weiteren dreißig Männern in Arkansas nach den Entführern zu suchen.
Ross hat seine Meldung ebenfalls telegrafisch zu seiner Befehlsstelle weitergegeben, und der Kommandeur der Nationalgarde in Arkansas berichte dem Gouverneur.
Harry Houston, der Gouverneur, veranlasst in ganz Arkansas, dass Sheriffs und Nationalgarde nach einer Spur der Entführer suchen, und er lässt sogar Steckbriefe herausbringen, auf denen aber nicht nach einer bestimmten Person, sondern nach sehr vage beschriebenen Entführern gesucht wird. Immerhin setzt Houston eine Belohnung von tausend Dollar für denjenigen aus, der Hinweise geben kann, die zur Ergreifung der Entführer führen.
*
Eine Woche vergeht, dann melden sich die Entführer selbst.
Patty hat Gratty längst wieder verlassen und ist in Fort Smith, das vor dem schon das Hauptquartier ihres Bruders im Wahlkampf war.
Die befestigte Stadt am Südufer des Arkansas River liegt unmittelbar an der Grenze zu Oklahoma, dem ehemaligen Indianerterritorium.
Und hier in Fort Smith trifft an einem Sonntagmorgen, als die Kirchenglocken von Fort Smith läuten und viele der Bewohner auf dem Weg zum Gottesdienst sind, die Nachricht ein.
Es ist eine braune Fotografie, mit einem Plattenapparat aufgenommen, und auf ihr ist vor einer Bretterwand Rory O’Hagan zu sehen. Er ist an einen Pfahl gefesselt, und an sein Hemd ist eine Zeitung geheftet, die auf der Fotografie deutlich zu erkennen ist. So gut, dass man sogar das Datum der Zeitung sehen kann. Das Foto ist demnach höchstens fünf Tage alt.
Zusammen mit dem Foto liegt ein von Rory O’Hagan selbst geschriebener Brief in dem Umschlag. Der Text ist ihm offensichtlich diktiert worden. Er schreibt, dass es ihm noch gut gehe und er frei sei, würde man ein Lösegeld von 50.000 Dollar zahlen. Eine Summe von unvorstellbarer Höhe zu dieser Zeit.
Zu diesem Zeitpunkt ist Fort Smith die absolute Hochburg der Demokraten in Arkansas. In der Zeitung Pioneer, die in ganz Arkansas erscheint, ruft Patty O’Hagan zu einer Sammlung für das Lösegeld auf, mit dem sie ihren Bruder zu befreien hofft.
Aber es werden Tage vergehen, bis die Zeitung überall an den Mann gebracht worden ist. Immerhin aber verkehrt zwischen Hutchinson in Arkansas und New Orleans seit elf Jahren eine Eisenbahn, die auch Fort Smith berührt. Die Bahnstrecke führt am Ufer des Arkansas River entlang. Und mit Hilfe der Bahn können die Pakete druckfrischer Zeitungen rasch ins Land gebracht werden. Außerdem die Flugzettel, die Patty mit einem Aufruf an alle Anhänger ihres Bruders verteilen lässt.
Rory O’Hagans Wahlhelfer arbeiten rund um die Uhr, und Patty ist die eifrigste von allen. Manchen Tag schläft sie nur ein oder zwei Stunden und hält sich mit starkem Kaffee auf den Beinen. Sie gibt die Hoffnung nicht auf, das Geld zusammenzubringen, obgleich sie nicht einmal weiß, an wen und wo sie es übergeben müsste. Aber ihr Bruder hat geschrieben, dies werde ihr noch bekannt gegeben, und sie habe acht Tage Zeit, das Geld zu beschaffen.
Acht Tage, denkt Patty. Wenn doch endlich Braddock und Yumah kämen! Und diesmal denkt sie bei Braddock weniger an den Mann, den sie noch immer liebt, als an den Kämpfer, der ihr helfen soll, ihren Bruder zu befreien.
Sie weiß nicht, dass Braddock und Yumah längst da sind.
*
Die Höhle hat mit Mühe für zwei Mann Platz. Aber sie ist gut geschützt und von außen nicht einsehbar. Braddock kann sich leisten, eine Kerze anzuzünden und sie neben die Landkarte zu stellen, die er vor sich ausgebreitet hat.
Im Schneidersitz hockt er hinter der Karte, dicht neben ihm, mit einer Pemmican-Wurst in den Händen, Yumah.
Der Schein der Kerze zuckt. So sieht es aus, als bewege sich das Gesicht von Braddock. Ein schmales, kantiges Gesicht mit wenigen scharfen Falten, buschigen Augenbrauen, ein Schnauzbart und im Mundwinkel eine Zigarette. Aus stahlblauen Augen blickt Braddock auf die Karte.
Yumah neben ihm, Spross von Yumah-Indianern, sieht eigentlich gar nicht wie ein Indianer, sondern mehr wie ein Mexikaner aus. Er trägt das Haar länger als Braddock, und im Gegensatz zu Braddocks dunkelblondem Haar ist das von Yumah schwarz. Dunkel sind auch seine Augen. Das schmale, bronzehäutige Gesicht verrät wenig von dem, was an Können in dem Mann schlummert.
„ George Jenkins hat gesagt“, beginnt Yumah, „dass nach fünf Tagen das Bild bei Patty O’Hagan gewesen ist. Ich denke aber, dass der Bursche, der das Bild gemacht hat, einen Tag brauchte, bis es fertig war. Erinnerst du dich, als wir beide in Dodge City ein Bild machen ließen?“
Braddock lächelt. „Stimmt. Er hat ja fast eine halbe Stunde gebraucht, bis endlich das Bild gemacht war und dann noch mal einen Tag, bis er es entwickelt hatte. Also gut. Für mich war es trotzdem ein Wunder, mich selbst auf einem Bild zu sehen. Also ein Tag meinst du, und dann vier Tage, bis es dort gewesen ist. Sie werden keine Zeit versäumt haben.“
„ Nein“, meint Yumah. „Also sind sie vier Tage von Fort Smith entfernt.“
„ Ich hätte mit Richter Parker sprechen sollen. Immerhin sind seine Marshals im Indianerterritorium unterwegs“, sagt Braddock. „Und ich glaube, wenn wir diese Burschen suchen sollen, die Rory O’Hagan versteckt haben, werden sie nicht ins Indianerterritorium gegangen sein. Die Cheyenne würden sie an die Lighthorses verraten, und die Indianerpolizei würde sie Richter Parkers Marshals ausliefern. Nein, das Indianerterritorium kommt nicht in Frage. Bleibt also der Süden von Fort Smith, der Norden und der Osten. Im Norden werden sie nicht sein, dort sind zu viele Farmen. Dasselbe gilt für den Osten. Also suchen wir im Süden. Und genau dort endet ja auch die Spur am Red River. Vier Tage weit nach Süden. Langsam ist der Bursche, der den Brief gebracht hat, bestimmt nicht geritten. Also vier schnelle Reittage nach Süden.
„ Wenn du auf einem schnellen Pferd reitest“, meint Yumah, „dann bist du ja beinahe am Red River. Und wir beide sind es doch auch. Er ist eine Gewehrschussweite von uns entfernt. Deine Theorie war doch von Anfang an, dass es vier Tage nach Süden ist. Warum zweifelst du daran und fängst noch einmal von vorn an?“
„ Weil ich sichergehen will.
„ Ich sage dir, es ist der Berg.“
„ Der Berg mit dem Gästehaus von Houston?“, fragt Braddock zweifelnd. „Glaubst du wirklich, dass Houston so dumm ist, einen Entführten bei sich unterzubringen?“
Yumah zieht die Schultern hoch. „Vielleicht ist er einfach zu sicher. Er kann sich nicht vorstellen, dass jemand darauf kommt. Es ist auch ganz einfach, überleg doch! Die Nationalgarde sucht sonstwo. Richter Parkers Marshals haben Auftrag, im Indianergebiet danach zu suchen. Alle Welt ist aufgescheucht. Aber natürlich suchen alle in der falschen Richtung. Wer kommt auf die Idee, dass der Gouverneur seinen Rivalen beseitigen wollte. Soviel Gemeinheit trauen sie ihm auch wieder nicht zu.“
Braddock schüttelt den Kopf. „Ich kann es mir nicht vorstellen. Es wäre Dummheit. Es gibt eine ganze Menge Leute, die annehmen, dass Houston die Finger im Spiel hat. Er braucht ja nur einen einzigen Angestellten haben, der mit ihm unzufrieden ist. Die Sache kommt heraus, fliegt auf und Houston wird mit Schimpf und Schande davongejagt. Damit kommt er hier in diesem Land nicht durch. Nein, ich kann es nicht glauben.“
„ Aber dieser Berg ist bewacht, das hast du doch schon gestern Abend gesehen. Ich habe die ganze Nacht aufgepasst. Da brennt kein Licht und nichts, und trotzdem wissen wir vom Tag her, dass der Berg bewacht wird.“
Braddock nickt. „Du hast recht, bewacht wird er. Aber das muss ja nicht mit der Entführung zusammenhängen. Wir werden ihn jedenfalls, wenn es hell wird, wieder beobachten. Du solltest dich für ein paar Stunden hinlegen und pennen. Ich passe solange auf. Und geh mal zu den Pferden, ob alles in Ordnung ist.“
Er kriecht hinaus, und Yumah sieht ihm kurz nach, dann streckt er sich aus, verschränkt die Arme unter dem Kopf und versucht zu schlafen.
Nach einer Weile kommt Braddock wieder. Yumah ist noch wach.
„ Mit den Pferden ist alles in Ordnung, sie haben reichlich zu fressen dahinten in dieser schmalen Schlucht. Auf dem Berg ist immer noch kein Licht.“
„ Die Hauptsache ist, dass sie uns nicht gesehen haben. Meinst du, dass die Lassos reichen?“
Braddock zuckt die Schultern. „Ich weiß nicht. Ich weiß nicht einmal, ob wir diesen Trick überhaupt anwenden können. Auf alle Fälle müssen wir noch einen ganzen Tag warten.“
„ Wieviel Zeit haben wir noch, bis Patty das Geld haben muss?“
„ Nach meiner Berechnung noch zwei Tage.“
„ Vielleicht weiß sie inzwischen, wem sie das Geld geben soll und wo“, entgegnet Yumah.
„ Vielleicht. Ich kann sie jetzt nicht fragen. Auf alle Fälle haben wir keine Zeit zu verschenken. Ich will wieder nach vorn und den Berg beobachten. Schlaf du endlich.“
Braddock bläst die Kerze aus und kriecht nach vorn. Der Gang, der in die Höhle hineinführt, macht einen kleinen Knick. Und deshalb hat man von außen auch das Licht nicht sehen können. Zudem ist vor dem Höhleneingang Gestrüpp.
Braddock schiebt es beiseite und kann nun über die Ebene hinweg zu dem Berg sehen. Es ist kein sehr hoher Berg, eigentlich ein Hügel. Aber oben ist er felsig, und darauf steht ein Haus. Es gibt nur einen einzigen Zugang, der hinauf führt, ein Weg, der sich in vielen Serpentinen nach oben windet. Es ist ein Kinderspiel, das Haus und die baumlosen Felsen rundherum zu bewachen. Um das Haus herum befindet sich eine Mauer, in die Schießscharten eingeschnitten sind. Die Mauer ist alt, sie stammt noch aus der mexikanischen Zeit. Einst hatten die mexikanischen Hidalgos an dieser Stelle so etwas wie eine Befestigung. Auf den Grundmauern ist das Gästehaus des Gouverneurs errichtet. Am Fuß des Berges, wo der Weg beginnt, der hinauf führt, befindet sich ein Blockhaus. Braddock weiß ungefähr, wo es steht, und er blickt durch sein Fernglas in diese Richtung und hofft, dass da ein Licht brennt, das verrät, ob dort Menschen sind oder nicht. Aber alles ist dunkel.
Am Tag haben sie dort Männer mit Pferden gesehen, die zwar versuchten ungesehen zu bleiben, aber von Braddock und Yumah doch entdeckt wurden.
Braddock denkt schon, dass er wirklich bis zum Morgengrauen warten muss, ehe er wirklich etwas von da drüben sieht, da bemerkt er plötzlich, wie sich gegen den Nachthimmel vom Haus eine Rauchwolke erhebt.
Es ist völlig windstill, und der Rauch steigt kerzengerade in die Höhe.
Dann als er immerzu das Haus im Auge hat und durch das Fernglas beobachtet, sieht er einmal kurz Licht aufblitzen, so als habe jemand ein Streichholz angezündet.
Braddock ist jetzt ganz sicher, dass da drüben jemand in dem Haus ist. Sein Verdacht hatte sich insgeheim sofort auf das Gästehaus des Gouverneurs gerichtet, ganz gleich, ob Houston, der Gouverneur, nun die Finger mit im Spiel hat oder nicht. Dieses Gästehaus könnten ja auch andere für diesen Zweck ausgewählt haben.
Gegen zwei Uhr geht der Mond auf. Es ist noch kein Vollmond, aber auch die breite Sichel wirft mit einem Mal sehr viel Licht auf das nächtliche Land. Was Braddock sieht in dieser diffusen Beleuchtung, wirkt zunächst gespenstisch und unwirklich. Aber seine Augen, die sich an die Dunkelheit gewöhnt haben, sehen dann doch die Reiterschar, die sich dem Berg nähert. Es können nicht mehr als ein Dutzend Reiter sein. Und doch verursachen die Hufe ihrer Pferde eine gewaltige Staubwolke, die infolge der Windstille nur langsam in sich zusammensinkt und längere Zeit in der Luft steht.
Die Reiter reiten genau auf diesen Hügel zu und sind nach einiger Zeit dort, wo nach Braddocks Meinung das Holzhaus steht. Er kann die Reiter nur noch zum Teil erkennen, weil sie im Schlagschatten des Berges verschwinden. Der Mond steht nicht so hoch, dass er den Berg völlig erhellen kann.
Aber dann sieht Braddock die Reiter bald wieder.
Er hat wieder das Fernglas vor Augen und kann erkennen, wie sie in einer Kehre auf dem Serpentinenweg ins Mondlicht geraten. Und dabei sind sie so deutlich zu sehen, dass Braddock sie zählen kann. Es sind elf Reiter.
Braddock denkt, dass das viele Geld, das dieses Fernglas gekostet hat, das er sich aus Europa schicken ließ, gut angelegt ist. Durch dieses hervorragende Glas kann er Dinge erkennen, die er mit seinem alten Fernrohr nie gesehen hat.
Es dauert lange Zeit, bis die Reiter endlich oben sind. Aber da kann Braddock sie nicht mehr sehen, sie sind wiederum im Schlagschatten.
Auf einmal geht aber an einem Fenster des Hauses Licht an und kurze Zeit danach auch hinter einem zweiten Fenster. Es ist ein zuckendes, unscharfes Licht. Vermutlich das einer Kerze, die im Durchzug steht.
Nachher brennt das Licht ruhiger, und Braddock kann sich denken, dass nun alle Männer im Haus sind und die Türen geschlossen wurden.
Der Rauch, der aus dem Schornstein quillt und zum Himmel steigt, verdichtet sich.
Braddock kombiniert, dass für die Männer, die eben angekommen sind, gekocht wird.
Er will schon das Fernglas sinken lassen, da bemerkt er plötzlich etwas Überraschendes: Zwei Reiter tauchen plötzlich am Fuß des Berges auf. Sie müssen die Serpentinen heruntergeritten sein, ohne dass er es bemerkte, weil er sich zu sehr auf das Licht am Haus konzentrierte.
Sie reiten jetzt genau in die Richtung, aus der die elf Reiter gekommen sind. Sie reiten langsam. Einmal halten sie sogar an. Sie scheinen es nicht eilig zu haben.
Das ist es, denkt Braddock. Die fange ich ab!
Er kriecht rasch nach hinten und weckt Yumah.
Der ist gerade eingeschlafen und hat Mühe, sofort zu begreifen, um was es geht. Aber dann kriechen sie aus der Höhle heraus, bewegen sich im Schlagschatten des Mondlichtes nach hinten zur Schlucht, wo die Pferde stehen.
Es sind vier Pferde, die dort warten. Zwei sind Packtiere.Auf die kann Braddock jetzt verzichten. Er wird sie hierlassen. Nur die beiden Reitpferde werden gebraucht.
„ Wie willst du es machen?“, fragt Yumah.
„ Sie werden die Richtung beibehalten. Und wir fangen sie ab, wenn sie hinten am Hügelsattel sind.“
Yumah hat verstanden. Eine weitere Erklärung ist für ihn nicht nötig. Er fragt nur noch:
„ Und wenn es Leute des Gouverneurs sind? Wir haben schließlich keinen Beweis, dass Rory da oben ist.“
„ Den werden die uns liefern. Komm jetzt...“
*
Am sogenannten Hügelsattel erwartet Braddock und Yumah eine Überraschung. Kurz bevor Yumah sich von Braddock trennen will, um den beiden Reitern zu folgen, die Braddock von vorn erwarten möchte, hören sie plötzlich einen sich nähernden Wagen.
Das Geklapper der Hufe, aber auch der Räder und Gespannteile hallt weit durch die Nacht.
Der Wagen kommt von der anderen Seite, fährt den Reitern also entgegen.
Braddocks Spannung wächst. Was hat das zu bedeuten?, fragt er sich und ist sich klar darüber, dass sie ihren Plan ändern müssen.
An der Stelle, wo die Schlucht des Hügelsattels am engsten ist, hält die Kutsche an. Ja, es ist eine Kutsche. Braddock sieht es, als das Mondlicht die Pferde, aber auch den vorderen Teil des Wagens erreicht. Ein schwarzgekleideter Mann auf dem Bock. Wer im Wagen sitzt, kann Braddock natürlich nicht sehen.
Er selbst ist abgesessen, hat sein Pferd in Deckung zurückgelassen und schleicht jetzt näher heran. Mittlerweile beträgt die Entfernung höchstens hundert Schritt. Näher kann er sich nicht heranwagen, ohne möglicherweise entdeckt zu werden. Er kauert hinter einem Busch, und das Schnauben der Pferde, das Klirren der Gebissketten, aber auch das Klappern der Wagscheite sind zunächst die einzigen Geräusche, die zu hören sind. Dann mischt sich der Hufschlag von zwei sich nähernden Pferden darunter.
Braddock hat seine Marlin in den Händen, bereit, mit dem Präzisionsgewehr zu schießen, wenn es nötig sein sollte. Aber im Augenblick gibt es dafür keinerlei Anlass.
Irgendwo hinter den beiden Reitern, die jetzt zu sehen sind, muss Yumah sein. Braddock weiß, dass Yumah seinem Schecken eine Art Lederstiefel über die Hufe gezogen hat, um den Hufschlag zu dämpfen.
Jetzt haben die beiden Reiter, es sind jene, die vom Hügel kamen, die Kutsche erreicht. Einer der beiden hält in Höhe des Kutschers, und sie sprechen gedämpft miteinander. Braddock kann nur Murmeln hören, mehr nicht.
Der zweite Mann reitet neben die Kutsche, und Braddock sieht, wie er sich nach unten beugt, als wolle er in den Wagen hineinsehen.
Durch den Lärm, die die Pferde machen, die auf der Stelle stampfen und schnauben, das eine scharrt sogar mit den Hufen, ist von den Worten, die gesprochen werden, für Braddock nichts zu verstehen. Dabei hätte er zu gerne gehört, was drüben gesagt wird.
Er riskiert es, sich näher heranzuschleichen. Immer nur von Busch zu Busch, von Deckung zu Deckung. Zuletzt kriecht er und schiebt sich ganz vorsichtig näher.
Er schafft es, bis auf etwa vierzig Schritte heranzukommen. Aber noch weiter kann er sich beim besten Willen nicht wagen. Und selbst das ist schon eine äußerst gefährliche Position.
Die Mühe ist umsonst. Die beiden Reiter ziehen ihre Pferde herum und reiten zurück. Die Kutsche folgt ihnen ein Stück, aber dann wird sie zu Braddocks Überraschung gewendet und kommt wieder vorbei.
Braddock fragt sich, wo Yumah steckt. Aber der wird schon wissen, was er zu tun hat. Er selbst muss handeln, und da kann er sich nicht um Yumah kümmern.
Er wirft noch einmal einen prüfenden Blick in Richtung auf die beiden Reiter, die sich immer mehr entfernen.
Die Kutsche fährt wegen des schlechten Bodens im Schritt. Und auch da poltern noch die Räder, schaukelt der Wagen wie verrückt hin und her.
Braddock nimmt sich jetzt Zeit: Er geht zurück, um sein Pferd zu holen, sitzt auf und reitet ohne große Eile in die Schlucht hinunter.
Als er sich umdreht, taucht Yumah auf.
„ Was ist mit den beiden? Warum lässt du die ziehen?“, fragt er.
„ Mich interessiert die Kutsche noch mehr. Du hast sie gesehen, nicht wahr?“
„ Habe ich. Ich hatte nur nicht damit gerechnet. Um ein Haar hätten die mich entdeckt.“
„ Bist du sicher, dass sie es nicht haben?“, will Braddock wissen.
„ Todsicher“, erwidert Yumah. „Hast du gesehen, wer in der Kutsche sitzt?“
„ Nein. Ich hatte den Eindruck“, meint Braddock, „die haben dem Insassen irgend etwas übergeben. Aber sicher bin ich nicht. Vielleicht war es eine mündliche Botschaft.“
„ Ich habe übrigens einen von den beiden Reitern erkannt. Sie sind ja ganz dicht bei mir vorbeigekommen“, sagt Yumah. „Und außerdem würde ich den auch auf größere Entfernung sehen.“
„ Wovon sprichst du?“, fragt Braddock.
„ Ich spreche von Doc. Ich meine Bill Maugham. Den würde ich unter Tausenden wiedererkennen. Und wenn er sich nur vor den hellen Himmel stellt. So eine Figur hat nur einer weit und breit.“
„ Doc‘ Bill Maugham, das ist doch einer von El Capitans Männern! Du hast dich bestimmt getäuscht.“
Yumah lacht leise vor sich hin. „Bist du das von mir gewöhnt, dass ich mich ständig täusche?“
„ Nein, zum Teufel. Und du bist sicher?“
„ So sicher, wie sie mich nicht gesehen haben. Es war ,Doc‘ Bill Maugham. Und der andere trug die Uniform eines State Troopers.“
„ Nationalgarde?“
„ Genauso“, erwidert Yumah. „Und wenn ich mich nicht getäuscht habe, war es ein Offizier. Jedenfalls hatte er irgend etwas Goldenes auf seinem Schulterstück.“
„ Ein Offizier, Nationalgarde, und dann zusammen mit ,Doc‘ Bill Maugham, das ist doch fast unmöglich. Das gibt es doch gar nicht!“, meint Braddock. „Aber wenn ich richtig überlege, dann trägt die ganze Geschichte ohnehin El Capitans Handschrift. So ausgeschlossen scheint es mir doch nicht zu sein. Aber wenn es so ist, dann brauchen wir uns keine Hemmungen zuzulegen, mein lieber Yumah. Dann holen wir uns die Kutsche.“
Wie auf ein Kommando treiben sie ihre Pferde an und jagen in vollem Galopp der Kutsche nach.
Sie können sie schon erkennen, als das Gefährt aus der Schlucht herausfährt und wieder voll ins Mondlicht gerät.
Plötzlich sieht Braddock eine Bewegung halb rechts am Rande der Schlucht.
Es ist zu spät. An wenigstens zehn Stellen blitzt es plötzlich auf. Braddock spürt, wie die Einschläge sein Pferd treffen. Es bricht unter ihm zusammen, und er wirft sich aus dem Sattel.
Er hört den Schrei von Yumah, sieht aber nicht, was aus dem Freund geworden ist.
Die Marlin in der Rechten, schlägt Braddock auf, rollt sich ab und bleibt trotz seines gelungenen Aufschlages ein wenig benommen liegen. Er braucht kostbare Sekunden, bis er imstande ist, die Lage zu übersehen.
Sie sind in einen Hinterhalt geraten, das ist ihm sofort klar. Und er hat noch Glück dabei. Das Pferd ist zusammengebrochen und liegt schräg vor ihm. Mit seinem Körper schafft es Braddock, in Deckung zu gehen.
Aber was ist mit Yumah?
*
Yumah ist vom Pferd gesprungen, hat sich dreimal überschlagen. Ein Streifschuss hat ihn an der Hüfte erwischt. Er wälzt sich zur Seite und spürt nur den dumpfen Druck der Verletzung. Mehr ist es noch nicht. Aber er weiß, dass der Schmerz bald deutlicher zu spüren sein wird.
Sein Pferd ist noch ein paar Galoppsprünge weit gekommen, ehe es im Feuer der Schüsse zusammenbrach. Jetzt liegt es da vorn und damit außer Reichweite für ihn, so dass er nicht an seine besonderen Kampfmittel herankommt, die er in solchen Situationen anwendet.
Immerhin hat er seinen Revolver. Seine Winchester und die schwere Sharpsbüffelbüchse sind vorn beim Pferd. Vielleicht sind beide Waffen durch den Sturz beschädigt worden.
Er denkt nicht darüber nach. Er presst sich flach auf den Boden, um kein Ziel zu bieten. Noch haben ihn seine Gegner nicht gesehen.
Wieder blitzen drüben Schüsse auf. Aber sie gehen in eine andere Richtung.
Yumah schiebt sich, flach auf den Boden gepresst, Handbreit für Handbreit nach vorn. Er will sein Pferd erreichen, das sich in etwa Steinwurfweite befindet. Die Gefahr, dass man ihn auf diesem Weg dorthin entdecken wird, ist groß. Aber er muss an seine Satteltaschen kommen, sonst gibt es keinen Weg, um mit den Gegnern fertigzuwerden.
Wieder blitzen Schüsse auf. Die Schützen sind zu weit weg für einen Revolverschuss. Yumah verzichtet darauf, seine Position zu verraten. Immer noch gehen die Schüsse in eine andere Richtung, und Yumah nimmt an, dass irgendwo da drüben, wohin die Gegner zielen, Braddock sein muss.
Er versucht vergeblich, Braddock zu entdecken und sieht nur den Kadaver des Pferdes von ihm. Das tote Tier liegt in etwa gleicher Höhe mit Yumah. Und auf diesen Kadaver schießen offensichtlich die Gegner.
Yumah schiebt sich langsam weiter nach vorn. Und er ist immer gewärtig, dass er plötzlich entdeckt wird und sich das Feuer der Gegner auf ihn konzentriert. Aber noch ist es nicht der Fall.
Als er wieder einmal nach links blickt, bemerkt er eine Bewegung dicht hinter dem Kadaver von Braddocks Pferd.
Das muss Braddock sein, denkt er. Und dann sieht er deutlicher, wie sich ein Mann an den Pferdekadaver heranschiebt.
Es ist Braddock, denkt Yumah überzeugt. Und er ist absolut sicher, als er sehen kann, dass sich ein Arm hebt, der sich vorsichtig auf den Pferdekadaver schiebt.
Er will ebenso an seine Satteltaschen heran, denkt Yumah und wartet erst einmal ab. Vielleicht gelingt es Braddock, an den Inhalt der Satteltasche zu kommen. Und das wäre die Möglichkeit, das Blatt wieder zu wenden.
Von der Kutsche ist nichts mehr zu sehen und zu hören. Stattdessen krachen immer wieder Schüsse, und sie klatschen drüben in den Pferdekadaver.
Braddock hat seinen Arm wieder zurückgezogen, wartet offenbar noch ab, weil er nicht in die Hand getroffen werden will. Aber dann sieht Yumah, dass es Braddock abermals versucht, die Satteltasche jetzt auch gepackt hat, und während er selbst in Deckung hinter dem Pferdebauch liegt, die Satteltasche auf sich zuzieht.
Ein zweiter Arm wird sichtbar. Etwas blinkt nur den Bruchteil einer Sekunde im Mondlicht. Ein Messer.
Yumah sieht, wie Braddock drüben die Satteltasche auf einmal schnell wegziehen kann. Er muss die Gurte durchschnitten haben.
Plötzlich blitzt direkt hinter dem Bauch des toten Pferdes ein Mündungsfeuer auf, und Yumah weiß sofort, aus welcher Waffe es stammt. Ein dünner Feuerstrahl zischt gen Himmel, und dann wird es auf einmal leuchtend hell. Hoch über den Köpfen der Gegner ist plötzlich eine strahlendhelle Kugel zu sehen. Viel heller als der Mond, so dass die Stelle, wo sich die Gegner befinden, taghell erleuchtet wird.
Im selben Augenblick peitschen Schüsse hinter dem toten Pferd drüben hervor, wo Braddock liegt.
Das Knallen dieser Waffe hätte Yumah unter vielen heraushören können. So feuert nur eine Marlin. Und so präzise, wie diese Waffe zu schießen imstande ist, wenn sie der richtige Mann bedient, so jagen die Schüsse aus dem Lauf.
Sekundenlang ist alles hell erleuchtet. Und genau die Zeit braucht Braddock, um seine Gegner zu sehen. Sie sind plötzlich nicht mehr im schützenden Schlagschatten, sondern werden hell erleuchtet, bieten ein Ziel, und er schießt und trifft.
Yumah wartet keinen Augenblick länger. Er nutzt die Überraschung der Gegner, springt auf und rast hinüber zu seinem toten Pferd, wirft sich dahinter, und dann erst kommen vereinzelte Schüsse von drüben, sind für ihn aber keine Gefahr mehr.
Sein Pferd liegt anders als das von Braddock. Es streckt seine Beine den Gegnern entgegen, so dass Yumah keine Schwierigkeiten hat, an seine Satteltasche zu kommen. Aber ihn interessiert jetzt seine Winchester mehr als das, was er ursprünglich vorhatte.
Mit einem Ruck hat er die Winchester aus dem Scabbard und ist froh, dass der Sattelschuh auf der oberen Seite ist und dass die Waffe nicht beschädigt sein kann. Er hebelt durch und kann gerade noch feuern, bevor die Leuchtkugel erlischt und das Land wieder in tiefe Dunkelheit versunken ist.
Noch eine Leuchtkugel, denkt er. Braddock muss noch eine abschießen.
Aber da fällt schon drüben der dumpfe Schuss der Leuchtpistole, und als die zweite Leuchtkugel oben am Himmel erstrahlt und wiederum das Land in helles Licht setzt, haben die Gegner versucht, Deckung zu finden. Sie sind vom zweiten Schuss einer Leuchtkugel so überrascht worden, dass sie jetzt überhaupt keine Deckung mehr haben. Zwei von ihnen rennen über offenes Feld, ein anderer sitzt zu Pferde und will davonpreschen.
Jetzt ist es Yumah, der als erster zu Schuss kommt. Bevor noch die Marlin wieder losdonnern kann, peitschen die Schüsse aus der Winchester.
Yumah trifft den Mann im Sattel, erwischt einen anderen, der ohne Deckung ist und reißt einen dritten, der fast eine deckende Bodenwelle erreicht hat, von den Beinen.
Danach ist es still.
Yumah ist sicher, dass die Gegner nicht schachmatt gesetzt sind. Es waren einfach zu viele. Seiner Meinung nach mussten es zehn oder sogar mehr gewesen sein. Bestimmt ist die Hälfte noch kampffähig genug, um sie mit heißem Blei zu empfangen, falls Braddock und Yumah etwas riskieren würden.
Aber Yumah ist bei seinem Pferd und damit bei seinen Waffen. Auf der oberen Seite ist noch der Bogen, sein indianischer Bogen, und da sind auch die Pfeile neben dem Sattelschuh. Der Bogen ist nicht zerbrochen, die Sehne nicht zerrissen. Als er das weiß, bekommt sein Optimismus wieder Oberhand.
Aus der Satteltasche zieht er Dynamitpatronen. Mit wenigen Handgriffen hat er eine der etwa zigarrenlangen und ebenso dicken Dynamitpatronen an den Schaft seines Pfeiles gebunden, duckt sich nun hinter das schützende tote Pferd, reißt ein Zündholz an, zündet die Zündschnur, die schon ziemlich kurz geschnitten ist, an, dann legt er den Pfeil an Bogen und Sehne, erhebt sich kurz und schießt, fällt aber sofort in die Deckung zurück, und das nicht zu früh.
Während drei seiner Gegner sofort das Feuer auf ihn eröffnet haben, zischt der Pfeil mit der gefährlichen Ladung durch die Luft.
Yumah kann nicht sehen, wo er landet, aber er hört den Donnerschlag, als die Dynamitpatrone krepiert.
Kaum hat es gekracht, fährt Yumah wieder hoch, hat die Winchester gepackt und schießt kniend über den Kadaver des Pferdes hinweg, als er die Männer drüben sieht, die davonzulaufen versuchen.
Auch die Marlin hämmert wieder einen Schuss nach dem anderen heraus.
Drüben gehen drei Männer zu Boden, danach ist wieder Stille.
Plötzlich preschen hinter einem Ausläufer des Hügels mehrere Pferde hervor und jagen in derselben Richtung davon, in die die Kutsche gefahren ist.
Yumah gibt noch ein paar Schüsse ab, weiß aber nicht, ob er getroffen hat.
Er hat nicht auf Pferde gezielt. Er liebt Pferde und würde ein Tier mitsamt dem Reiter lieber entkommen lassen, als das Pferd zu töten.
Braddock ist da weniger zimperlich Die Gegner sind eben eine Gefahr, und wenn sie kommen, könnte das für ihn und Yumah tödlich sein. Er zielt mit seiner Marlin auf die vordersten Pferde, trifft auch zwei von ihnen, und die Tiere brechen zusammen. Andere bäumen sich auf oder stürzen, als sie gegen die fallenden Artgenossen prallen.
Trotzdem jagen fünf Pferde davon, und auf ihnen sind Reiter. Doch die Sicht ist so schlecht, dass die Schüsse der Marlin möglicherweise ihr Ziel nicht gefunden haben.
Braddock lasst sein Gewehr sinken, wartet aber noch ab, weil er nicht sicher ist, ob nicht womöglich zwei oder drei der Gegner darauf warten, dass er sich ihnen zeigt.
Indessen hat Yumah seine Deckung verlassen und kriecht, nur die Winchester bei sich, in Richtung auf die Stelle, wo die Gegner waren. Ein Stück entfernt steht das Pferd, dessen Reiter er vorhin aus dem Sattel geholt hat. Der Mann selbst liegt ein Stück entfernt am Boden, reglos.
Yumah spürt, wie ihm das Blut am Oberschenkel herunterläuft. Jetzt kommt der Schmerz. Jede Bewegung tut weh.
Als er mit seiner Hand an die Seite tastet, ist die Kleidung feucht und klebrig.
Braddock ist aufgesprungen und läuft jetzt zu dem Pferd hinüber, hat es, sitzt auf und jagt davon.
Yumah versucht ebenfalls zu stehen, aber der Schmerz ist so stark, dass er sich zu Boden setzt und nach seiner Verletzung sieht. Es ist zu dunkel, als dass er erkennen kann, was da wirklich ist. Er fragt sich, ob es sich um einen Streifschuss oder einen Steckschuss handelt.
Nach Indianerart legt er einen provisorischen Verband an und bleibt sitzen, während er auf Braddock wartet.
Es vergeht eine Viertelstunde, bis Braddock wieder auftaucht. Er hat ein zweites Pferd am Zügel und kommt direkt in Richtung auf Yumah zurück.
Als er Yumah erreicht, beugt er sich vom Pferd und fragt:
„ Hat es dich erwischt?“
„ Ein bisschen.“
„ Wo denn? Schlimm?“
„ Hüfte. Es geht, ich weiß nichts Genaues. Du musst mal nachsehen.“
„ Jetzt muss ich erst mal nachsehen, ob nicht einer von denen am Leben ist und uns eine Kugel in den Rücken jagt. Halte die Zügel der Pferde. Schaffst du das?‘„
„ Aber immer“, sagt Yumah, dessen Schmerzen erheblich zugenommen haben.
Braddock sitzt ab und läuft hinüber zu den Toten. Nach einer Weile kommt er zurück. Noch bevor er bei Yumah anlangt, wirft er einen besorgten Blick zum Himmel. Dort sind Wolken aufgetaucht. Zeitweise verdunkeln sie auch den Mond. Es ist merkwürdig schwül geworden.
Aber im Osten zeigt sich schon ein schmaler, hellgrauer Streifen. Nicht mehr lange, und es wird Tag werden.
Braddock hätte Licht gebraucht, um sich um die Verletzung seines Freundes zu kümmern. Aber genau das hat er nicht. Denn waren es eben noch wenige Wolken, so werden es immer mehr. Und sie verdunkeln den Mond jetzt völlig. Dieser schmale Silberstreifen am östlichen Horizont reicht nicht aus.
„ Was ist mit ihnen?“, fragt Yumah, als Braddock sich neben ihn kniet.
„ Für die ist es gelaufen. Aber einen von ihnen kenne ich. Jetzt besteht kein Zweifel mehr, dass wir es mit den Leuten von El Capitan zu tun haben. Und das war sicher wirklich ,Doc‘ Bill Maugham gewesen, der diesen Uniformierten begleitet hat.“
„ Und was folgerst du daraus?“, fragt Yumah, beißt sich aber plötzlich schmerzerfüllt mit den Zähnen auf die Unterlippe, als Braddock zufällig an die Wunde gerät.
„ Daraus kann man eine ganze Menge schließen. Vor allen Dingen, dass Houston dahintersteckt. Aber das ist im Moment nicht das Thema. Ich muss mich um deine Verletzung kümmern. Leg dich mal mehr auf die Seite!“
Er reißt ein Zündholz an, hält es in der hohlen Hand und beleuchtet die Wunde. Dann braucht er noch ein zweites.
„ Einwandfrei ein Streifschuss. Du hast Schwein gehabt, mein Junge. Aber es hat dir ein ganz schönes Kotelett aus deinem Astralleib herausgerissen. Nun leg dich mal entspannt hin.“
„ Du brauchst ja nicht auf mir herumzulaufen, verdammt noch mal!“, knurrt Yumah. Aber dann hört Braddock nichts mehr von ihm, keinen Schmerzenslaut, kein Stöhnen. In diesem Punkt ist Yumah Indianer. Und das durch und durch.
Braddock muss die Wunde desinfizieren. Er macht es mit Alkohol, den er aus seiner Satteltasche holt. Es ist hochprozentiger Brandy.
Auch jetzt zuckt Yumah zwar zusammen, aber kein Schmerzenslaut kommt über seine Lippen.
„ Dann wollen wir mal diese neumodischen Dinger ausprobieren, die ich letztens gekauft habe, diese Klebebänder“, sagt Braddock und verpflastert Yumah. So ein Klebepflaster ist eine neue Sache.
Braddock ist fast fertig mit dem Verband, als Wind aufkommt. Wenig später wird aus dem Wind Sturm. Und hinten im Osten, wo es Tag werden will, verdunkeln jetzt dicke schwarze Wolken das Morgengrauen. Es ist noch immer dunkel, der Himmel stark bewölkt, und die Wolken werden immer schwärzer und segeln immer tiefer übers Land, vom Wind getrieben.
Braddock veranlasst Yumah, noch ein wenig sitzen zu bleiben und kümmert sich darum, die Pferde umzusatteln. Als Yumah ihm helfen will, faucht er ihn an, und Yumah empfindet noch viel zu viel Schmerz, um sich dagegen zu sträuben.
Als die eigenen Sättel auf den erbeuteten Pferden liegen, sagt Braddock:
„ Sehen wir zu, dass wir zu unserer Höhle kommen. Hier geht gleich etwas los. Die Kutsche zu verfolgen, hat keinen Zweck mehr. Wir würden in eine zweite Falle laufen. Verkrümeln wir uns.“
Sie sitzen noch nicht richtig in den Sätteln, da beginnt es zu regnen. Der Sturm peitscht den Regen beinahe horizontal von Nord nach Süd. Blitze zucken zur Erde, und der Donnerschlag folgt immer rascher. Das Gewitter nähert sich in rasender Geschwindigkeit. Mit einem Mal ist nichts mehr vom Morgengrauen zu sehen.
Die bedrohlich näher rückende Gewitterfront und das grelle Aufleuchten der Blitze erschreckt die Pferde. Beide Männer haben Mühe, sie im Zaum zu halten.
Als ein Blitz in nächster Nähe in einen Felsen einschlägt und der unmittelbar folgende Donnerschlag wie die Detonation einer riesigen Sprengladung anzuhören ist, da brechen die Pferde aus.





























