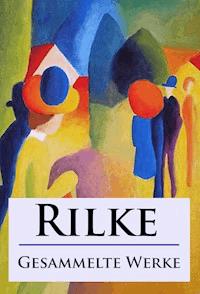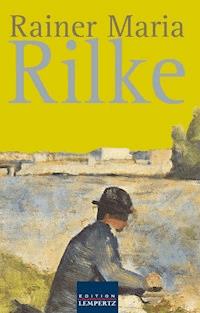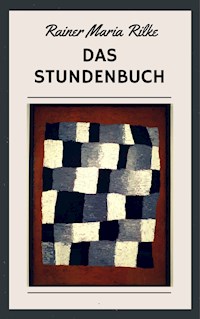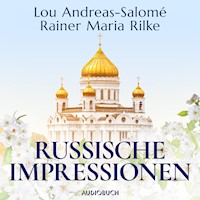9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Anaconda Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
Briefe, Lyrik, Prosa - der perfekte Einstieg in Rilkes Werk
Rainer Maria Rilke ist der Inbegriff des Dichters in der Moderne. Sein gesamtes Schaffen war geprägt von dem Ziel, die großen Weiten der inneren Welt, der Gefühle wie der philosophischen Reflexion in zeitlos gültige Verse zu fassen. Die Rilke-Verehrung ist weltweit bis heute ungebrochen. Dieser Band umfasst den gesamten Kosmos Rilkes: Sein lyrisches Werk einschließlich aller wichtigen Zyklen wie dem Stunden-Buch und den Duineser Elegien, die Briefe an einen jungen Dichter und Rilkes einzigen Roman, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge.
- »An Rainer Maria Rilke kommt im deutschsprachigen Raum keiner vorbei.« FAZ
- Enhält: »Geschichten vom lieben Gott«, »Briefe an einen jungen Dichter«, »Cornet Christoph Rilke«, »Malte Laurid Brigge«, »Stunden-Buch«, »Buch der Bilder«, »Neue Gedichte«
- & »Der neuen Gedichte anderer Teil«, »Duineser Elegien«, »Sonette an Orpheus«, »Die weiße Fürstin« - mit einem Verzeichnis der Gedichtanfänge und Überschriften
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 889
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Rainer Maria RilkeGesammelte Werke
Rainer Maria Rilke
Gesammelte Werke
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2013 Anaconda Verlag GmbH, Köln
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-86647-926-5eISBN [email protected]
Inhalt
Geschichten vom lieben Gott
Das Märchen von den Händen Gottes
Der fremde Mann
Warum der liebe Gott will, dass es arme Leute gibt
Wie der Verrat nach Russland kam
Wie der alte Timofei singend starb
Das Lied von der Gerechtigkeit
Eine Szene aus dem Ghetto von Venedig
Von einem, der die Steine belauscht
Wie der Fingerhut dazu kam, der liebe Gott zu sein
Ein Märchen vom Tod und eine fremde Nachschrift dazu
Ein Verein, aus einem dringenden Bedürfnis heraus
Der Bettler und das stolze Fräulein
Eine Geschichte, dem Dunkel erzählt
Briefe an einen jungen Dichter
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke
Die Weiße Fürstin
Das Stunden-Buch
Das Buch vom mönchischen Leben
Das Buch von der Pilgerschaft
Das Buch von der Armut und vom Tode
Das Buch der Bilder
Des ersten Buches erster Teil
Des ersten Buches zweiter Teil
Des zweiten Buches erster Teil
Des zweiten Buches zweiter Teil
Neue Gedichte
Der neuen Gedichte anderer Teil
Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge
11. September, rue Toullier
Bibliothèque Nationale
Ein Briefentwurf
Duineser Elegien
Die erste Elegie
Die zweite Elegie
Die dritte Elegie
Die vierte Elegie
Die fünfte Elegie
Die sechste Elegie
Die siebente Elegie
Die achte Elegie
Die neunte Elegie
Die zehnte Elegie
Die Sonette an Orpheus
Erster Teil
Zweiter Teil
Verzeichnis der Gedichtüberschriften und -anfänge
Quellenverzeichnis
Geschichten vom lieben Gott
Meine Freundin, einmal habe ich dieses Buch in Ihre Hände gelegt, und Sie haben es lieb gehabt wie niemand vorher. So habe ich mich daran gewöhnt, zu denken, dass es Ihnen gehört. Dulden Sie deshalb, dass ich nicht allein in Ihr eigenes Buch, sondern in alle Bücher dieser neuen Ausgabe Ihren Namen schreibe; dass ich schreibe:
DIE GESCHICHTEN VOM LIEBEN GOTTGEHÖREN ELLEN KEY.
Rainer Maria Rilke.
Rom, im April 1904.
Das Märchen von den Händen Gottes
Neulich, am Morgen, begegnete mir die Frau Nachbarin. Wir begrüßten uns.
»Was für ein Herbst!«, sagte sie nach einer Pause und blickte nach dem Himmel auf. Ich tat desgleichen. Der Morgen war allerdings sehr klar und köstlich für Oktober. Plötzlich fiel mir etwas ein: »Was für ein Herbst!«, rief ich und schwenkte ein wenig mit den Händen. Und die Frau Nachbarin nickte beifällig. Ich sah ihr so einen Augenblick zu. Ihr gutes gesundes Gesicht ging so lieb auf und nieder. Es war recht hell, nur um die Lippen und an den Schläfen waren kleine schattige Falten. Woher sie das haben mag? Und da fragte ich ganz unversehens: »Und Ihre kleinen Mädchen?« Die Falten in ihrem Gesicht verschwanden eine Sekunde, zogen sich aber gleich, noch dunkler, zusammen. »Gesund sind sie, gottseidank, aber –«, die Frau Nachbarin setzte sich in Bewegung, und ich schritt jetzt an ihrer Linken, wie es sich gehört. »Wissen Sie, sie sind jetzt beide in dem Alter, die Kinder, wo sie den ganzen Tag fragen. Was, den ganzen Tag, bis in die gerechte Nacht hinein.« »Ja«, murmelte ich, – »es gibt eine Zeit …« Sie aber ließ sich nicht stören: »Und nicht etwa: Wohin geht diese Pferdebahn? Wie viel Sterne gibt es? Und ist zehntausend mehr als viel? Noch ganz andere Sachen! Zum Beispiel: Spricht der liebe Gott auch chinesisch? und: Wie sieht der liebe Gott aus? Immer alles vom lieben Gott! Darüber weiß man doch nicht Bescheid –.« »Nein, allerdings«, stimmte ich bei, »man hat da gewisse Vermutungen …« »Oder von den Händen vom lieben Gott, was soll man da –.«
Ich schaute der Nachbarin in die Augen: »Erlauben Sie«, sagte ich recht höflich, »Sie sagten zuletzt die Hände vom lieben Gott – nicht wahr?« Die Nachbarin nickte. Ich glaube, sie war ein wenig erstaunt. »Ja« – beeilte ich mich anzufügen, – »von den Händen ist mir allerdings einiges bekannt. Zufällig –« bemerkte ich rasch, als ich ihre Augen rund werden sah, – »ganz zufällig – ich habe – – – nun« schloss ich mit ziemlicher Entschiedenheit, »ich will Ihnen erzählen, was ich weiß. Wenn Sie einen Augenblick Zeit haben, ich begleite Sie bis zu Ihrem Hause, das wird gerade reichen.«
»Gerne«, sagte sie, als ich sie endlich zu Worte kommen ließ, immer noch erstaunt, »aber wollen Sie nicht vielleicht den Kindern selbst? …«
»Ich den Kindern selbst erzählen? Nein, liebe Frau, das geht nicht, das geht auf keinen Fall. Sehen Sie, ich werde gleich verlegen, wenn ich mit den Kindern sprechen muss. Das ist an sich nicht schlimm. Aber die Kinder könnten meine Verwirrung dahin deuten, dass ich mich lügen fühle … Und da mir sehr viel an der Wahrhaftigkeit meiner Geschichte liegt – Sie können es den Kindern ja wiedererzählen; Sie treffen es ja gewiss auch viel besser. Sie werden es verknüpfen und ausschmücken, ich werde nur die einfachen Tatsachen in der kürzesten Form berichten. Ja?« »Gut, gut«, machte die Nachbarin zerstreut.
Ich dachte nach: »Im Anfang …«, aber ich unterbrach mich sofort. »Ich kann bei Ihnen, Frau Nachbarin, ja manches als bekannt voraussetzen, was ich den Kindern erst erzählen müsste. Zum Beispiel die Schöpfung …« Es entstand eine ziemliche Pause. Dann: »Ja – – und am siebenten Tage …«, die Stimme der guten Frau war hoch und spitzig. »Halt!«, machte ich, »wir wollen doch auch der früheren Tage gedenken; denn gerade um diese handelt es sich. Also der liebe Gott begann, wie bekannt, seine Arbeit, indem er die Erde machte, diese vom Wasser unterschied und Licht befahl. Dann formte er in bewundernswerter Geschwindigkeit die Dinge, ich meine die großen wirklichen Dinge, als da sind: Felsen, Gebirge, einen Baum und nach diesem Muster viele Bäume.« Ich hörte hier schon eine Weile lang Schritte hinter uns, die uns nicht überholten und auch nicht zurückblieben. Das störte mich, und ich verwickelte mich in der Schöpfungsgeschichte, als ich folgendermaßen fortfuhr: »Man kann sich diese schnelle und erfolgreiche Tätigkeit nur begreiflich machen, wenn man annimmt, dass eben nach langem, tiefem Nachdenken alles in seinem Kopfe ganz fertig war, ehe er …« Da endlich waren die Schritte neben uns, und eine nicht gerade angenehme Stimme klebte an uns: »O, Sie sprechen wohl von Herrn Schmidt, verzeihen Sie …« Ich sah ärgerlich nach der Hinzugekommenen, die Frau Nachbarin aber geriet in große Verlegenheit: »Hm«, hustete sie, »nein – das heißt – ja, – wir sprachen gerade, gewissermaßen –.« »Was für ein Herbst«, sagte auf einmal die andere Frau, als ob nichts geschehen wäre, und ihr rotes, kleines Gesicht glänzte. »Ja« – hörte ich meine Nachbarin antworten: »Sie haben recht, Frau Hüpfer, ein selten schöner Herbst!« Dann trennten sich die Frauen. Frau Hüpfer kicherte noch: »Und grüßen Sie mir die Kinderchen.« Meine gute Nachbarin achtete nicht mehr darauf; sie war doch neugierig, meine Geschichte zu erfahren. Ich aber behauptete mit unbegreiflicher Härte: »Ja jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind.« »Sie sagten eben etwas von seinem Kopfe, das heißt –«, die Frau Nachbarin wurde ganz rot.
Sie tat mir aufrichtig leid, und so erzählte ich schnell: »Ja sehen Sie also, solange nur die Dinge gemacht waren, hatte der liebe Gott nicht notwendig, beständig auf die Erde herunterzuschauen. Es konnte sich ja nichts dort begeben. Der Wind ging allerdings schon über die Berge, welche den Wolken, die er schon seit lange kannte, so ähnlich waren, aber den Wipfeln der Bäume wich er noch mit einem gewissen Misstrauen aus. Und das war dem lieben Gott sehr recht. Die Dinge hat er sozusagen im Schlafe gemacht, allein schon bei den Tieren fing die Arbeit an, ihm interessant zu werden; er neigte sich darüber und zog nur selten die breiten Brauen hoch, um einen Blick auf die Erde zu werfen. Er vergaß sie vollends, als er den Menschen formte. Ich weiß nicht bei welchem komplizierten Teil des Körpers er gerade angelangt war, als es um ihn rauschte von Flügeln. Ein Engel eilte vorüber und sang: ›Der Du alles siehst …‹
Der liebe Gott erschrak. Er hatte den Engel in Sünde gebracht, denn eben hatte dieser eine Lüge gesungen. Rasch schaute Gottvater hinunter. Und freilich, da hatte sich schon irgendetwas ereignet, was kaum gutzumachen war. Ein kleiner Vogel irrte, als ob er Angst hätte, über die Erde hin und her, und der liebe Gott war nicht imstande, ihm heimzuhelfen, denn er hatte nicht gesehen, aus welchem Walde das arme Tier gekommen war. Er wurde ganz ärgerlich und sagte: ›Die Vögel haben sitzen zu bleiben, wo ich sie hingesetzt habe.‹ Aber er erinnerte sich, dass er ihnen auf Fürbitte der Engel Flügel verliehen hatte, damit es auch auf Erden so etwas wie Engel gebe, und dieser Umstand machte ihn nur noch verdrießlicher. Nun ist gegen solche Zustände des Gemütes nichts so heilsam wie Arbeit. Und mit dem Bau des Menschen beschäftigt, wurde Gott auch rasch wieder froh. Er hatte die Augen der Engel wie Spiegel vor sich, maß darin seine eigenen Züge und bildete langsam und vorsichtig an einer Kugel auf seinem Schoße das erste Gesicht. Die Stirne war ihm gelungen. Viel schwerer wurde es ihm, die beiden Nasenlöcher symmetrisch zu machen. Er bückte sich immer mehr darüber, bis es wieder wehte über ihm; er schaute auf. Derselbe Engel umkreiste ihn; man hörte diesmal keine Hymne, denn in seiner Lüge war dem Knaben die Stimme erloschen, aber an seinem Mund erkannte Gott, dass er immer noch sang: ›Der Du alles siehst.‹ Zugleich trat der heilige Nikolaus, der bei Gott in besonderer Achtung steht, an ihn heran und sagte durch seinen großen Bart hindurch: ›Deine Löwen sitzen ruhig, sie sind recht hochmütige Geschöpfe, das muss ich sagen! Aber ein kleiner Hund läuft ganz am Rande der Erde herum, ein Terrier, siehst Du, er wird gleich hinunterfallen.‹ Und wirklich merkte der liebe Gott etwas Heiteres, Weißes, wie ein kleines Licht hin und her tanzen in der Gegend von Skandinavien, wo es schon so furchtbar rund ist. Und er wurde recht bös und warf dem heiligen Nikolaus vor, wenn ihm seine Löwen nicht recht seien, so solle er versuchen, auch welche zu machen. Worauf der heilige Nikolaus aus dem Himmel ging und die Türe zuschlug, dass ein Stern herunterfiel, gerade dem Terrier auf den Kopf. Jetzt war das Unglück vollständig, und der liebe Gott musste sich eingestehen, dass er ganz allein an allem schuld sei, und beschloss, nicht mehr den Blick von der Erde zu rühren. Und so geschah’s. Er überließ seinen Händen, welche ja auch weise sind, die Arbeit, und obwohl er recht neugierig war zu erfahren, wie der Mensch wohl aussehen mochte, starrte er unablässig auf die Erde hinab, auf welcher sich jetzt, wie zum Trotz, nicht ein Blättchen regen wollte. Um doch wenigstens eine kleine Freude zu haben nach aller Plage, hatte er seinen Händen befohlen, ihm den Menschen erst zu zeigen, ehe sie ihn dem Leben ausliefern würden. Wiederholt fragte er, wie Kinder, wenn sie Verstecken spielen: ›Schon?‹ Aber er hörte als Antwort das Kneten seiner Hände und wartete. Es erschien ihm sehr lange. Da auf einmal sah er etwas durch den Raum fallen, dunkel und in der Richtung, als ob es aus seiner Nähe käme. Von einer bösen Ahnung erfüllt, rief er seine Hände. Sie erschienen ganz von Lehm befleckt, heiß und zitternd. ›Wo ist der Mensch?‹, schrie er sie an. Da fuhr die Rechte auf die Linke los: ›Du hast ihn losgelassen!‹ ›Bitte‹, sagte die Linke gereizt ›du wolltest ja alles allein machen, mich ließest du ja überhaupt gar nicht mitreden.‹ ›Du hättest ihn eben halten müssen!‹ Und die Rechte holte aus. Dann aber besann sie sich, und beide Hände sagten einander überholend: ›Er war so ungeduldig, der Mensch. Er wollte immer schon leben. Wir können beide nichts dafür, gewiss, wir sind beide unschuldig.‹
Der liebe Gott aber war ernstlich böse. Er drängte beide Hände fort; denn sie verstellten ihm die Aussicht über die Erde: ›Ich kenne euch nicht mehr, macht was ihr wollt.‹ Das versuchten die Hände auch seither, aber sie können nur beginnen, was sie auch tun. Ohne Gott gibt es keine Vollendung. Und da sind sie es endlich müde geworden. Jetzt knien sie den ganzen Tag und tun Buße, so erzählt man wenigstens. Uns aber erscheint es, als ob Gott ruhte, weil er auf seine Hände böse ist. Es ist immer noch siebenter Tag.«
Ich schwieg einen Augenblick. Das benützte die Frau Nachbarin sehr vernünftig: »Und Sie glauben, dass nie wieder eine Versöhnung zustande kommt?« »O doch«, sagte ich, »ich hoffe es wenigstens.«
»Und wann sollte das sein?«
»Nun, bis Gott wissen wird, wie der Mensch, den die Hände gegen seinen Willen losgelassen haben, aussieht.«
Die Frau Nachbarin dachte nach, dann lachte sie: »Aber dazu hätte er doch bloß heruntersehen müssen …«
»Verzeihen Sie«, sagte ich artig, »Ihre Bemerkung zeugt von Scharfsinn, aber meine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Also, als die Hände beiseite getreten waren und Gott die Erde wieder überschaute, da war eben wieder eine Minute, oder sagen wir ein Jahrtausend, was ja bekanntlich dasselbe ist, vergangen. Statt eines Menschen gab es schon eine Million. Aber sie waren alle schon in Kleidern. Und da die Mode damals gerade sehr hässlich war und auch die Gesichter arg entstellte, so bekam Gott einen ganz falschen und (ich will es nicht verhehlen) sehr schlechten Begriff von den Menschen.« »Hm«, machte die Nachbarin und wollte etwas bemerken. Ich beachtete es nicht, sondern schloss mit starker Betonung: »Und darum ist es dringend notwendig, dass Gott erfährt, wie der Mensch wirklich ist. Freuen wir uns, dass es solche gibt, die es ihm sagen …« Die Frau Nachbarin freute sich noch nicht: »Und wer sollte das sein, bitte?« »Einfach die Kinder und dann und wann auch diejenigen Leute, welche malen, Gedichte schreiben, bauen …«»Was denn bauen, Kirchen?« »Ja, und auch sonst, überhaupt …«
Die Frau Nachbarin schüttelte langsam den Kopf. Manches erschien ihr doch recht verwunderlich. Wir waren schon über ihr Haus hinausgegangen und kehrten jetzt langsam um. Plötzlich wurde sie sehr lustig und lachte: »Aber, was für ein Unsinn, Gott ist doch auch allwissend. Er hätte ja genau wissen müssen, woher zum Beispiel der kleine Vogel gekommen ist.« Sie sah mich triumphierend an. Ich war ein bisschen verwirrt, ich muss gestehen. Aber als ich mich gefasst hatte, gelang es mir ein überaus ernstes Gesicht zu machen: »Liebe Frau«, belehrte ich sie, »das ist eigentlich eine Geschichte für sich. Damit Sie aber nicht glauben, das sei nur eine Ausrede von mir (sie verwahrte sich nun natürlich heftig dagegen), will ich Ihnen in Kürze sagen: Gott hat alle Eigenschaften, natürlich. Aber ehe er in die Lage kam, sie auf die Welt – gleichsam – anzuwenden, erschienen sie ihm alle wie eine einzige große Kraft. Ich weiß nicht, ob ich mich deutlich ausdrücke. Aber angesichts der Dinge spezialisierten sich seine Fähigkeiten und wurden bis zu einem gewissen Grade: Pflichten. Er hatte Mühe, sich alle zu merken. Es gibt eben Konflikte. (Nebenbei: das alles sage ich nur Ihnen, und Sie müssen es den Kindern keineswegs wiedererzählen.)« »Wo denken Sie hin«, beteuerte meine Zuhörerin.
»Sehen Sie, wäre ein Engel vorübergeflogen, singend: ›Der Du alles weißt‹, so wäre alles gut geworden …«
»Und diese Geschichte wäre überflüssig?«
»Gewiss«, bestätigte ich. Und ich wollte mich verabschieden. »Aber wissen Sie das alles auch ganz bestimmt?« »Ich weiß es ganz bestimmt«, erwiderte ich fast feierlich. »Da werde ich den Kindern heute zu erzählen haben!« »Ich würde es gerne anhören dürfen. Leben Sie wohl.« »Leben Sie wohl«, antwortete sie.
Dann kehrte sie nochmals zurück: »Aber weshalb ist gerade dieser Engel …« »Frau Nachbarin«, sagte ich, indem ich sie unterbrach, »ich merke jetzt, dass Ihre beiden lieben Mädchen gar nicht deshalb so viel fragen, weil sie Kinder sind –« »Sondern?«, fragte meine Nachbarin neugierig. »Nun, die Ärzte sagen, es gibt gewisse Vererbungen …« Meine Frau Nachbarin drohte mir mit dem Finger. Aber wir schieden dennoch als gute Freunde.
Als ich meiner lieben Nachbarin später (übrigens nach ziemlich langer Pause) wieder einmal begegnete, war sie nicht allein, und ich konnte nicht erfahren, ob sie ihren Mädchen meine Geschichte berichtet hätte und mit welchem Erfolg. Über diesen Zweifel klärte mich ein Brief auf, welchen ich kurz darauf empfing. Da ich von dem Absender desselben nicht die Erlaubnis erhalten habe, ihn zu veröffentlichen, so muss ich mich darauf beschränken, zu erzählen, wie er endete, woraus man ohne Weiteres erkennen wird, von wem er stammte. Er schloss mit den Worten: »Ich und noch fünf andere Kinder, nämlich, weil ich mit dabei bin.«
Ich antwortete, gleich nach Empfang, Folgendes: »Liebe Kinder, dass euch das Märchen von den Händen vom lieben Gott gefallen hat, glaube ich gern; mir gefällt es auch. Aber ich kann trotzdem nicht zu euch kommen. Seid nicht böse deshalb. Wer weiß, ob ich euch gefiele. Ich habe keine schöne Nase, und wenn sie, was bisweilen vorkommt, auch noch ein rotes Pickelchen an der Spitze hat, so würdet ihr die ganze Zeit dieses Pünktchen anschauen und anstaunen und gar nicht hören, was ich ein Stückchen tiefer unten sage. Auch würdet ihr wahrscheinlich von diesem Pickelchen träumen. Das alles wäre mir gar nicht recht. Ich schlage darum einen anderen Ausweg vor. Wir haben (auch außer der Mutter) eine große Anzahl gemeinsamer Freunde und Bekannte, die nicht Kinder sind. Ihr werdet schon erfahren, welche. Diesen werde ich von Zeit zu Zeit eine Geschichte erzählen, und ihr werdet sie von diesen Vermittlern immer noch schöner empfangen, als ich sie zu gestalten vermöchte. Denn es sind gar große Dichter unter diesen unseren Freunden. Ich werde euch nicht verraten, wovon meine Geschichten handeln werden. Aber, weil euch nichts so sehr beschäftigt und am Herzen liegt, wie der liebe Gott, so werde ich an jeder passenden Gelegenheit einfügen, was ich von ihm weiß. Sollte etwas davon nicht richtig sein, so schreibt mir wieder einen schönen Brief, oder lasst es mir durch die Mutter sagen. Denn es ist möglich, dass ich mich an mancher Stelle irre, weil es schon so lange ist, seit ich die schönsten Geschichten erfahren habe, und weil ich seither mir viele habe merken müssen, die nicht so schön sind. Das kommt im Leben so mit. Trotzdem ist das Leben etwas ganz Prächtiges: auch davon wird des Öfteren in meinen Geschichten die Rede sein. Damit grüßt euch – Ich, aber auch nur deshalb einer, weil ich mit dabei bin.«
Der fremde Mann
Ein fremder Mann hat mir einen Brief geschrieben. Nicht von Europa schrieb mir der fremde Mann, nicht von Moses, weder von den großen, noch von den kleinen Propheten, nicht vom Kaiser von Russland oder dem Zaren Iwan, dem Grausen, seinem fürchterlichen Vorfahren. Nicht vom Bürgermeister oder vom Nachbar Flickschuster, nicht von der nahen Stadt, nicht von den fernen Städten; und auch der Wald mit den vielen Rehen, darin ich jeden Morgen mich verliere, kommt in seinem Briefe nicht vor. Er erzählt mir auch nichts von seinem Mütterchen oder von seinen Schwestern, die gewiss längst verheiratet sind. Vielleicht ist auch sein Mütterchen tot; wie könnte es sonst sein, dass ich sie in einem vierseitigen Briefe nirgends erwähnt finde! Er erweist mir ein viel, viel größeres Vertrauen, er macht mich zu seinem Bruder, er spricht mir von seiner Not.
Am Abend kommt der fremde Mann zu mir. Ich zünde keine Lampe an, helfe ihm den Mantel ablegen und bitte ihn, mit mir Tee zu trinken, weil das gerade die Stunde ist, in welcher ich täglich meinen Tee trinke. Und bei so nahen Besuchen muss man sich keinen Zwang auferlegen. Als wir uns schon an den Tisch setzen wollen, bemerke ich, dass mein Gast unruhig ist; sein Gesicht ist voll Angst und seine Hände zittern. »Richtig«, sage ich, »hier ist ein Brief für Sie.« Und dann bin ich dabei den Tee einzugießen. »Nehmen Sie Zucker und vielleicht Zitrone? Ich habe in Russland gelernt den Tee mit Zitrone zu trinken. Wollen Sie versuchen?« Dann zünde ich eine Lampe an und stelle sie in eine entfernte Ecke, etwas hoch, sodass eigentlich Dämmerung bleibt im Zimmer, nur eine etwas wärmere als früher, eine rötliche. Und da scheint auch das Gesicht meines Gastes sicherer, wärmer und um vieles bekannter zu sein. Ich begrüße ihn noch einmal mit den Worten: »Wissen Sie, ich habe Sie lange erwartet.« Und ehe der Fremde Zeit hat zu staunen, erkläre ich ihm. »Ich weiß eine Geschichte, welche ich niemandem erzählen mag als Ihnen; fragen Sie mich nicht warum, sagen Sie mir nur, ob Sie bequem sitzen, ob der Tee genug süß ist und ob Sie die Geschichte hören wollen.« Mein Gast musste lächeln. Dann antwortete er einfach: »Ja.« »Auf alles drei: Ja?« »Auf alles drei.«
Wir lehnten uns beide zugleich in unseren Stühlen zurück, sodass unsere Gesichter schattig wurden. Ich stellte mein Teeglas nieder, freute mich daran, wie goldig der Tee glänzte, vergaß diese Freude langsam wieder und fragte plötzlich: »Erinnern Sie sich noch an den lieben Gott?«
Der Fremde dachte nach. Seine Augen vertieften sich ins Dunkel, und mit den kleinen Lichtpunkten in den Pupillen glichen sie zwei langen Laubengängen in einem Parke, über welchem leuchtend und breit Sommer und Sonne liegt. Auch diese beginnen so, mit runder Dämmerung, dehnen sich in immer engerer Finsternis bis zu einem fernen, schimmernden Punkt: dem jenseitigen Ausgang in einen vielleicht noch viel helleren Tag. Während ich das erkannte, sagte er zögernd und als ob er sich nur ungern seiner Stimme bediente: »Ja, ich erinnere mich noch an Gott.« »Gut«, dankte ich ihm, »denn gerade von ihm handelt meine Geschichte. Doch zuerst sagen Sie mir noch: Sprechen Sie bisweilen mit Kindern?« »Es kommt wohl vor, so im Vorübergehen, wenigstens –« »Vielleicht ist es Ihnen bekannt, dass Gott infolge eines hässlichen Ungehorsams seiner Hände nicht weiß, wie der fertige Mensch eigentlich aussieht?« »Das habe ich einmal irgendwo gehört, ich weiß indessen nicht von wem« – entgegnete mein Gast, und ich sah unbestimmte Erinnerungen über seine Stirn jagen. »Gleichviel«, störte ich ihn, »hören Sie weiter. Lange Zeit ertrug Gott diese Ungewissheit. Denn seine Geduld ist wie seine Stärke groß. Einmal aber, als dichte Wolken zwischen ihm und der Erde standen viele Tage lang, sodass er kaum mehr wusste, ob er alles: Welt und Menschen und Zeit nicht nur geträumt hatte, rief er seine rechte Hand, die so lange von seinem Angesicht verbannt und verborgen gewesen war in kleinen unwichtigen Werken. Sie eilte bereitwillig herbei; denn sie glaubte, Gott wolle ihr endlich verzeihen. Als Gott sie so vor sich sah in ihrer Schönheit, Jugend und Kraft, war er schon geneigt, ihr zu vergeben. Aber rechtzeitig besann er sich und gebot, ohne hinzusehen: ›Du gehst hinunter auf die Erde. Du nimmst die Gestalt an, die du bei den Menschen siehst, und stellst dich, nackt, auf einen Berg, sodass ich dich genau betrachten kann. Sobald du unten ankommst, geh zu einer jungen Frau und sag ihr, aber ganz leise: Ich möchte leben. Es wird zuerst ein kleines Dunkel um dich sein und dann ein großes Dunkel, welches Kindheit heißt, und dann wirst du ein Mann sein und auf den Berg steigen, wie ich es dir befohlen habe. Das alles dauert ja nur einen Augenblick. Leb wohl.‹
Die Rechte nahm von der Linken Abschied, gab ihr viele freundliche Namen, ja es wurde sogar behauptet, sie habe sich plötzlich vor ihr verneigt und gesagt: ›Du, heiliger Geist.‹ Aber schon trat der heilige Paulus herzu, hieb dem lieben Gott die rechte Hand ab, und ein Erzengel fing sie auf und trug sie unter seinem weiten Gewand davon. Gott aber hielt sich mit der Linken die Wunde zu, damit sein Blut nicht über die Sterne ströme und von da in traurigen Tropfen herunterfiele auf die Erde. Eine kurze Zeit später bemerkte Gott, der aufmerksam alle Vorgänge unten betrachtete, dass die Menschen in den eisernen Kleidern sich um einen Berg mehr zu schaffen machten, als um alle anderen Berge. Und er erwartete, dort seine Hand hinaufsteigen zu sehen. Aber es kam nur ein Mensch in einem, wie es schien, roten Mantel, welcher etwas schwarzes Schwankendes aufwärts schleppte. In demselben Augenblicke begann Gottes linke Hand, die vor seinem offenen Blute lag, unruhig zu werden, und mit einem Mal verließ sie, ehe Gott es verhindern konnte, ihren Platz und irrte wie wahnsinnig zwischen den Sternen umher und schrie: ›Oh, die arme rechte Hand, und ich kann ihr nicht helfen.‹ Dabei zerrte sie an Gottes linkem Arm, an dessen äußerstem Ende sie hing, und bemühte sich loszukommen. Die ganze Erde aber war rot vom Blute Gottes, und man konnte nicht erkennen, was darunter geschah. Damals wäre Gott fast gestorben. Mit letzter Anstrengung rief er seine Rechte zurück; sie kam blass und bebend und legte sich an ihren Platz, wie ein krankes Tier. Aber auch die Linke, die doch schon manches wusste, da sie die rechte Hand Gottes damals unten auf der Erde erkannt hatte, als diese in einem roten Mantel den Berg erstieg, konnte von ihr nicht erfahren, was sich weiter auf diesem Berge begeben hat. Es muss etwas sehr Schreckliches gewesen sein. Denn Gottes Rechte hat sich noch nicht davon erholt, und sie leidet unter ihrer Erinnerung nicht weniger, als unter dem alten Zorne Gottes, der ja seinen Händen immer noch nicht verziehen hat.«
Meine Stimme ruhte ein wenig aus. Der Fremde hatte sein Gesicht mit den Händen verhüllt. Lange blieb alles so. Dann sagte der fremde Mann mit einer Stimme, die ich längst kannte: »Und warum haben Sie mir diese Geschichte erzählt?«
»Wer hätte mich sonst verstanden? Sie kommen zu mir ohne Rang, ohne Amt, ohne irgendeine zeitliche Würde, fast ohne Namen. Es war dunkel, als Sie eintraten, allein ich bemerkte in Ihren Zügen eine Ähnlichkeit –« Der fremde Mann blickte fragend auf. »Ja«, erwiderte ich seinem stillen Blick, »ich denke oft, vielleicht ist Gottes Hand wieder unterwegs …«
Die Kinder haben diese Geschichte erfahren, und offenbar wurde sie ihnen so erzählt, dass sie alles verstehen konnten; denn sie haben diese Geschichte lieb.
Warum der liebe Gott will, dass es arme Leute gibt
Die vorangehende Geschichte hat sich so verbreitet, dass der Herr Lehrer mit sehr gekränktem Gesicht auf der Gasse herumgeht. Ich kann das begreifen. Es ist immer schlimm für einen Lehrer, wenn die Kinder plötzlich etwas wissen, was er ihnen nicht erzählt hat. Der Lehrer muss sozusagen das einzige Loch in der Planke sein, durch welches man in den Obstgarten sieht; sind noch andere Löcher da, so drängen sich die Kinder jeden Tag vor einem anderen und werden bald des Ausblicks überhaupt müde. Ich hätte diesen Vergleich nicht hier aufgezeichnet, denn nicht jeder Lehrer ist vielleicht damit einverstanden, ein Loch zu sein; aber der Lehrer, von dem ich rede, mein Nachbar, hat den Vergleich zuerst von mir vernommen und ihn sogar als äußerst treffend bezeichnet. Und sollte auch jemand anderer Meinung sein, die Autorität meines Nachbars ist mir maßgebend.
Er stand vor mir, rückte beständig an seiner Brille und sagte: »Ich weiß nicht, wer den Kindern diese Geschichte erzählt hat, aber es ist jedenfalls unrecht, ihre Fantasie mit solchen ungewöhnlichen Vorstellungen zu überladen und anzuspannen. Es handelt sich um eine Art Märchen –« »Ich habe es zufällig erzählen hören«, unterbrach ich ihn. (Dabei log ich nicht, denn seit jenem Abend ist es mir wirklich schon von meiner Frau Nachbarin wieder berichtet worden.) »So«, machte der Lehrer; er fand das leicht erklärlich. »Nun, was sagen Sie dazu?« Ich zögerte, auch fuhr er sehr schnell fort: »Zunächst finde ich es unrecht, religiöse, besonders biblische Stoffe frei und eigenmächtig zu gebrauchen. Es ist das alles im Katechismus jedenfalls so ausgedrückt, dass es besser nicht gesagt werden kann …« Ich wollte etwas bemerken, erinnerte mich aber im letzten Augenblick, dass der Herr Lehrer »zunächst« gebraucht hatte, dass also jetzt nach der Grammatik und um der Gesundheit des Satzes willen ein »dann« und vielleicht sogar ein »und endlich« folgen musste, ehe ich mir erlauben durfte, etwas anzufügen. So geschah es auch. Ich will, da der Herr Lehrer diesen selben Satz, dessen tadelloser Bau jedem Kenner Freude bereiten wird, auch anderen übermittelt hat, die ihn ebenso wenig wie ich vergessen dürften, hier nur noch das aufzeichnen, was hinter dem schönen, vorbereitenden Worte: »Und endlich« wie das Finale einer Ouverture kam. »Und endlich … (die sehr fantastische Auffassung hingehen lassend) erscheint mir der Stoff gar nicht einmal genügend durchdrungen und nach allen Seiten hin berücksichtigt zu sein. Wenn ich Zeit hätte, Geschichten zu schreiben –« »Sie vermissen etwas in der bewussten Erzählung?«, konnte ich mich nicht enthalten ihn zu unterbrechen. »Ja, ich vermisse manches. Vom literarisch-kritischen Standpunkt gewissermaßen. Wenn ich zu Ihnen als Kollege sprechen darf –« Ich verstand nicht, was er meinte, und sagte bescheiden: »Sie sind zu gütig, aber ich habe nie eine Lehrertätigkeit …« Plötzlich fiel mir etwas ein, ich brach ab, und er fuhr etwas kühl fort: »Um nur eins zu nennen: es ist nicht anzunehmen, dass Gott (wenn man schon auf den Sinn der Geschichte soweit eingehen will), dass Gott, also – sage ich – dass Gott keinen weiteren Versuch gemacht haben sollte, einen Menschen zu sehen, wie er ist, ich meine –« Jetzt glaubte ich den Herrn Lehrer wieder versöhnen zu müssen. Ich verneigte mich ein wenig und begann: »Es ist allgemein bekannt, dass Sie sich eingehend (und, wenn man so sagen darf, nicht ohne Gegenliebe zu finden) der sozialen Frage genähert haben.« Der Herr Lehrer lächelte. »Nun, dann darf ich annehmen, dass, was ich Ihnen im Folgenden mitzuteilen gedenke, Ihrem Interesse nicht ganz ferne steht, zumal ich ja auch an Ihre letzte, sehr scharfsinnige Bemerkung anknüpfen kann.« Er sah mich erstaunt an: »Sollte Gott etwa …« »In der Tat«, bestätigte ich, »Gott ist eben dabei, einen neuen Versuch zu machen.« »Wirklich?«, fuhr mich der Lehrer an, »ist das an maßgebender Stelle bekannt geworden?« »Darüber kann ich Ihnen nichts Genaues sagen –«, bedauerte ich – »ich bin nicht in Beziehung mit jenen Kreisen, aber wenn Sie dennoch meine kleine Geschichte hören wol-len?« »Sie würden mir einen großen Gefallen erweisen.« Der Lehrer nahm seine Brille ab und putzte sorgfältig die Gläser, während seine nackten Augen sich schämten.
Ich begann: »Einmal sah der liebe Gott in eine große Stadt. Als ihm von dem vielen Durcheinander die Augen ermüdeten (dazu trugen die Netze mit den elektrischen Drähten nicht wenig bei), beschloss er, seine Blicke auf ein einziges hohes Mietshaus für eine Weile zu beschränken, weil dieses weit weniger anstrengend war. Gleichzeitig erinnerte er sich seines alten Wunsches, einmal einen lebenden Menschen zu sehen, und zu diesem Zwecke tauchten seine Blicke ansteigend in die Fenster der einzelnen Stockwerke. Die Leute im ersten Stockwerke (es war ein reicher Kaufmann mit Familie) waren fast nur Kleider. Nicht nur, dass alle Teile ihres Körpers mit kostbaren Stoffen bedeckt waren, die äußeren Umrisse dieser Kleidung zeigten an vielen Stellen eine solche Form, dass man sah, es konnte kein Körper mehr darunter sein. Im zweiten Stock war es nicht viel besser. Die Leute, welche drei Treppen wohnten, hatten zwar schon bedeutend weniger an, waren aber so schmutzig, dass der liebe Gott nur graue Furchen erkannte und in seiner Güte schon bereit war, zu befehlen, sie möchten fruchtbar werden. Endlich unter dem Dach, in einem schrägen Kämmerchen, fand der liebe Gott einen Mann in einem schlechten Rock, der sich damit beschäftigte, Lehm zu kneten. ›Oho, woher hast du das?‹, rief er ihn an. Der Mann nahm seine Pfeife gar nicht aus dem Munde und brummte: ›Der Teufel weiß woher. Ich wollte, ich wär Schuster geworden. Da sitzt man und plagt sich …‹ Und was der liebe Gott auch fragen mochte, der Mann war schlechter Laune und gab keine Antwort mehr. – Bis er eines Tages einen großen Brief vom Bürgermeister dieser Stadt bekam. Da erzählte er dem lieben Gott, ungefragt, alles. Er hatte so lange keinen Auftrag bekommen. Jetzt, plötzlich, sollte er eine Statue für den Stadtpark machen, und sie sollte heißen: die Wahrheit. Der Künstler arbeitete Tag und Nacht in einem entfernten Atelier, und dem lieben Gott kamen verschiedene alte Erinnerungen, wie er das so sah. Wenn er seinen Händen nicht immer noch böse gewesen wäre, er hätte wohl auch wieder irgendwas begonnen. – Als aber der Tag kam, da die Bildsäule, welche die Wahrheit hieß, hinausgetragen werden sollte, auf ihren Platz in den Garten, wo auch Gott sie hätte sehen können in ihrer Vollendung, da entstand ein großer Skandal, denn eine Kommission von Stadtvätern, Lehrern und anderen einflussreichen Persönlichkeiten hatte verlangt, die Figur müsse erst teilweise bekleidet werden, ehe das Publikum sie zu Gesicht bekäme. Der liebe Gott verstand nicht weshalb, so laut fluchte der Künstler. Stadtväter, Lehrer und die anderen haben ihn in diese Sünde gebracht, und der liebe Gott wird gewiss an denen – Aber Sie husten ja fürchterlich!« »Es geht schon vorüber –«, sagte mein Lehrer mit vollkommen klarer Stimme. »Nun, ich habe nur noch ein weniges zu berichten. Der liebe Gott ließ das Mietshaus und den Stadtpark los und wollte seinen Blick schon ganz zurückziehen, wie man eine Angelrute aus dem Wasser zieht, mit einem Schwung, um zu sehen, ob nicht etwas angebissen hat. In diesem Falle hing wirklich etwas daran. Ein ganz kleines Häuschen mit mehreren Menschen drinnen, die alle sehr wenig anhatten, denn sie waren sehr arm. ›Das also ist es –‹, dachte der liebe Gott, ›arm müssen die Menschen sein. Diese hier sind, glaub ich, schon recht arm, aber ich will sie so arm machen, dass sie nicht einmal ein Hemd zum Anziehen haben.‹ So nahm sich der liebe Gott vor.«
Hier machte ich beim Sprechen einen Punkt, um anzudeuten, dass ich am Ende sei. Der Herr Lehrer war damit nicht zufrieden; er fand diese Geschichte ebenso wenig abgeschlossen und gerundet, wie die vorhergehende. »Ja« – entschuldigte ich mich – »da müsste eben ein Dichter kommen, der zu dieser Geschichte irgendeinen fantastischen Schluss erfindet, denn tatsächlich hat sie noch kein Ende.« »Wieso?«, machte der Herr Lehrer und schaute mich gespannt an. »Aber, lieber Herr Lehrer«, erinnerte ich, »wie vergesslich Sie sind! Sie sind doch selbst im Vorstand des hiesigen Armenvereins …« »Ja, seit etwa zehn Jahren bin ich das und –?« »Das ist es eben; Sie und Ihr Verein verhindern den lieben Gott die längste Zeit, sein Ziel zu erreichen. Sie kleiden die Leute –« »Aber ich bitte Sie«, sagte der Lehrer bescheiden, »das ist einfach Nächstenliebe. Das ist doch Gott im höchsten Grade wohlgefällig.« »Ach, davon ist man maßgebenden Orts wohl überzeugt?«, fragte ich arglos. »Natürlich ist man das. Ich habe gerade in meiner Eigenschaft als Vorstandsmitglied des Armenvereins manches Lobende zu hören bekommen. Vertraulich gesagt, man will auch bei der nächsten Beförderung meine Tätigkeit in dieser Weise – – – Sie verstehen?« Der Herr Lehrer errötete schamhaft. »Ich wünsche Ihnen das Beste«, entgegnete ich. Wir reichten uns die Hände, und der Herr Lehrer ging mit so stolzen, gemessenen Schritten fort, dass ich überzeugt bin: er ist zu spät in die Schule gekommen.
Wie ich später vernahm, ist ein Teil dieser Geschichte (soweit sie für Kinder passt) den Kindern doch bekannt geworden. Sollte der Herr Lehrer sie zu Ende gedichtet haben?
Wie der Verrat nach Russland kam
Ich habe noch einen Freund hier in der Nachbarschaft. Das ist ein blonder, lahmer Mann, der seinen Stuhl, winters wie sommers, hart am Fenster hat. Er kann sehr jung aussehen, ja in seinem lauschenden Gesicht ist manchmal etwas Knabenhaftes. Aber es gibt auch Tage, da er altert, die Minuten gehen wie Jahre über ihn, und plötzlich ist er ein Greis, dessen matte Augen das Leben fast schon losgelassen haben. Wir kennen uns lang. Erst haben wir uns immer angesehen, später lächelten wir unwillkürlich, ein Jahr lang grüßten wir einander, und seit Gott weiß wann erzählen wir uns das eine und das andere, wahllos, wie es eben passiert. »Guten Tag«, rief er, als ich vorüberkam und sein Fenster war noch offen in den reichen und stillen Herbst hinaus. »Ich habe Sie lange nicht gesehen.«
»Guten Tag, Ewald –.« Ich trat an sein Fenster, wie ich immer zu tun pflegte, im Vorübergehen. »Ich war verreist.« »Wo waren Sie?«, fragte er mit ungeduldigen Augen. »In Russland.« »Oh so weit –«, er lehnte sich zurück, und dann: »Was ist das für ein Land, Russland? Ein sehr großes, nicht wahr?« »Ja«, sagte ich, »groß ist es und außerdem –« »Habe ich dumm gefragt?«, lächelte Ewald und wurde rot. »Nein, Ewald, im Gegenteil. Da Sie fragen: was ist das für ein Land? wird mir Verschiedenes klar. Zum Beispiel woran Russland grenzt.« »Im Osten?«, warf mein Freund ein. Ich dachte nach: »Nein.« »Im Norden?«, forschte der Lahme. »Sehen Sie«, fiel mir ein, »das Ablesen von der Landkarte hat die Leute verdorben. Dort ist alles plan und eben, und wenn sie die vier Weltgegenden bezeichnet haben, scheint ihnen alles getan. Ein Land ist doch aber kein Atlas. Es hat Berge und Abgründe. Es muss doch auch oben und unten an etwas stoßen.« »Hm –«, überlegte mein Freund, »Sie haben recht. Woran könnte Russland an diesen beiden Seiten grenzen?« Plötzlich sah der Kranke wie ein Knabe aus. »Sie wissen es«, rief ich. »Vielleicht an Gott?« »Ja«, bestätigte ich, »an Gott.« »So« – nickte mein Freund ganz verständnisvoll. Erst dann kamen ihm einzelne Zweifel: »Ist denn Gott ein Land?« »Ich glaube nicht«, erwiderte ich, »aber in den primitiven Sprachen haben viele Dinge denselben Namen. Es ist da wohl ein Reich, das heißt Gott, und der es beherrscht, heißt auch Gott. Einfache Völker können ihr Land und ihren Kaiser oft nicht unterscheiden; beide sind groß und gütig, furchtbar und groß.«
»Ich verstehe«, sagte langsam der Mann am Fenster. »Und merkt man in Russland diese Nachbarschaft?« »Man merkt sie bei allen Gelegenheiten. Der Einfluss Gottes ist sehr mächtig. Wie viel man auch aus Europa bringen mag, die Dinge aus dem Westen sind Steine, sobald sie über die Grenze sind. Mitunter kostbare Steine, aber eben nur für die Reichen, die sogenannten ›Gebildeten‹, während von drüben aus dem anderen Reich das Brot kommt, wovon das Volk lebt.« »Das hat das Volk wohl in Überfluss?« Ich zögerte: »Nein, das ist nicht der Fall, die Einfuhr aus Gott ist durch gewisse Umstände erschwert –« Ich suchte ihn von diesem Gedanken abzubringen. »Aber man hat vieles aus den Gebräuchen jener breiten Nachbarschaft angenommen. Das ganze Zeremoniell beispielsweise. Man spricht zu dem Zaren ähnlich wie zu Gott.« »So, man sagt also nicht: Majestät?« »Nein, man nennt beide Väterchen.« »Und man kniet vor beiden?« »Man wirft sich vor beiden nieder, fühlt mit der Stirn den Boden und weint und sagt: ›Ich bin sündig, verzeih mir, Väterchen.‹ Die Deutschen, welche das sehen, behaupten: eine ganz unwürdige Sklaverei. Ich denke anders darüber. Was soll das Knien bedeuten? Es hat den Sinn zu erklären: Ich habe Ehrfurcht. Dazu genügt es auch, das Haupt zu entblößen, meint der Deutsche. Nun ja, der Gruß, die Verbeugung, gewissermaßen sind auch sie Ausdrücke dafür, Abkürzungen, die entstanden sind in den Ländern, wo nicht so viel Raum war, dass jeder sich hätte niederlegen können auf der Erde. Aber Abkürzungen gebraucht man bald mechanisch und ohne sich ihres Sinnes mehr bewusst zu werden. Deshalb ist es gut, wo noch Raum und Zeit dafür ist, die Gebärde auszuschreiben, das ganze schöne und wichtige Wort: Ehrfurcht.«
»Ja, wenn ich könnte, würde ich auch niederknien –«, träumte der Lahme. »Aber es kommt« – fuhr ich nach einer Pause fort – »in Russland auch vieles andere von Gott. Man hat das Gefühl, jedes Neue wird von ihm eingeführt, jedes Kleid, jede Speise, jede Tugend und sogar jede Sünde muss erst von ihm bewilligt werden, ehe sie in Gebrauch kommt.« Der Kranke sah mich fast erschrocken an. »Es ist nur ein Märchen, auf welches ich mich berufe«, eilte ich ihn zu beruhigen, »eine sogenannte Bylina, ein Gewesenes zu deutsch. Ich will Ihnen kurz den Inhalt erzählen. Der Titel ist: ›Wie der Verrat nach Russland kam‹.« Ich lehnte mich ans Fenster, und der Gelähmte schloss die Augen, wie er gerne tat, wenn irgendwo eine Geschichte begann.
»Der schreckliche Zar Iwan wollte den benachbarten Fürsten Tribut auferlegen und drohte ihnen mit einem großen Krieg, falls sie nicht Gold nach Moskau, in die weiße Stadt, schicken würden. Die Fürsten sagten, nachdem sie Rat gepflogen hatten, wie ein Mann: ›Wir geben dir drei Rätselfragen auf. Komm an dem Tage, den wir dir bestimmen, in den Orient, zu dem weißen Stein, wo wir versammelt sein werden, und sage uns die drei Lösungen. Sobald sie richtig sind, geben wir dir die zwölf Tonnen Goldes, die du von uns verlangst. Zuerst dachte der Zar Iwan Wassiljewitsch nach, aber es störten ihn die vielen Glocken seiner weißen Stadt Moskau. Da rief er seine Gelehrten und Räte vor sich, und jeden, der die Fragen nicht beantworten konnte, ließ er auf den großen, roten Platz führen, wo gerade die Kirche für Wassilij, den Nackten, gebaut wurde, und einfach köpfen. Bei einer solchen Beschäftigung verging ihm die Zeit so rasch, dass er sich plötzlich auf der Reise fand nach dem Orient, zu dem weißen Stein, bei welchem die Fürsten warteten. Er wusste auf keine der drei Fragen etwas zu erwidern, aber der Ritt war lang, und es war immer noch die Möglichkeit, einem Weisen zu begegnen; denn damals waren viele Weise unterwegs auf der Flucht, da alle Könige die Gewohnheit hatten, ihnen den Kopf abschneiden zu lassen, wenn sie ihnen nicht weise genug schienen. Ein solcher kam ihm nun allerdings nicht zu Gesicht, aber an einem Morgen sah er einen alten, bärtigen Bauer, welcher an einer Kirche baute. Er war schon dabei angelangt, den Dachstuhl zu zimmern und die kleinen Latten darüberzulegen. Da war es nun recht verwunderlich, dass der alte Bauer immer wieder von der Kirche herunterstieg, um von den schmalen Latten, welche unten aufgeschichtet waren, jede einzeln zu holen, statt viele auf einmal in seinem langen Kaftan mitzunehmen. Er musste so beständig auf- und niederklettern, und es war gar nicht abzusehen, dass er auf diese Weise überhaupt jemals alle vielhundert Latten an ihren Ort bringen würde. Der Zar wurde deshalb ungeduldig: ›Dummkopf‹, schrie er (so nennt man in Russland meistens die Bauern), ›du solltest dich tüchtig beladen mit deinem Holz und dann auf die Kirche kriechen, das wäre bei Weitem einfacher.‹ Der Bauer, der gerade unten war, blieb stehen, hielt die Hand über die Augen und antwortete: ›Das musst du schon mir überlassen, Zar Iwan Wassiljewitsch, jeder versteht sein Handwerk am besten; indessen, weil du schon hier vorüberreitest, will ich dir die Lösung der drei Rätsel sagen, welche du am weißen Stein im Orient, gar nicht weit von hier, wirst wissen müssen.‹ Und er schärfte ihm die drei Antworten der Reihe nach ein. Der Zar konnte vor Erstaunen kaum dazu kommen, zu danken. ›Was soll ich dir geben zum Lohne?‹, fragte er endlich. ›Nichts‹, machte der Bauer, holte eine Latte und wollte auf die Leiter steigen. ›Halt‹, befahl der Zar, ›das geht nicht an, du musst dir etwas wünschen.‹ ›Nun, Väterchen, wenn du befiehlst, gib mir eine von den zwölf Tonnen Goldes, welche du von den Fürsten im Orient erhalten wirst.‹ ›Gut –‹, nickte der Zar. ›Ich gebe dir eine Tonne Goldes.‹ Dann ritt er eilends davon, um die Lösungen nicht wieder zu vergessen.
Später, als der Zar mit den zwölf Tonnen zurückgekommen war aus dem Orient, schloss er sich in Moskau in seinen Palast, mitten im fünftorigen Kreml ein und schüttete eine Tonne nach der anderen auf die glänzenden Dielen des Saales aus, sodass ein wahrer Berg aus Gold entstand, der einen großen schwarzen Schatten über den Boden warf. In Vergesslichkeit hatte der Zar auch die zwölfte Tonne ausgeleert. Er wollte sie wieder füllen, aber es tat ihm leid, so viel Gold von dem herrlichen Haufen wieder fortnehmen zu müssen. In der Nacht ging er in den Hof hinunter, schöpfte feinen Sand in die Tonne, bis sie zu drei Vierteilen voll war, kehrte leise in seinen Palast zurück, legte Gold über den Sand und schickte die Tonne mit dem nächsten Morgen durch einen Boten in die Gegend des weiten Russland, wo der alte Bauer seine Kirche baute. Als dieser den Boten kommen sah, stieg er von dem Dach, welches noch lange nicht fertig war, und rief: ›Du musst nicht näher kommen, mein Freund, reise zurück samt deiner Tonne, welche drei Vierteile Sand und ein knappes Viertel Gold enthält; ich brauche sie nicht. Sage deinem Herrn, bisher hat es keinen Verrat in Russland gegeben. Er aber ist selbst daran schuld, wenn er bemerken sollte, dass er sich auf keinen Menschen verlassen kann; denn er hat nunmehr gezeigt, wie man verrät, und von Jahrhundert zu Jahrhundert wird sein Beispiel in ganz Russland viele Nachahmer finden. Ich brauche nicht das Gold, ich kann ohne Gold leben. Ich erwartete nicht Gold von ihm, sondern Wahrheit und Rechtlichkeit. Er aber hat mich getäuscht. Sage das deinem Herrn, dem schrecklichen Zaren Iwan Wassiljewitsch, der in seiner weißen Stadt Moskau sitzt mit seinem bösen Gewissen und in einem goldenen Kleid.‹
Nach einer Weile Reitens wandte sich der Bote nochmals um: der Bauer und seine Kirche waren verschwunden. Und auch die aufgeschichteten Latten lagen nicht mehr da, es war alles leeres, flaches Land. Da jagte der Mann entsetzt zurück nach Moskau, stand atemlos vor dem Zaren und erzählte ihm ziemlich unverständlich, was sich begeben hatte, und dass der vermeintliche Bauer niemand anderes gewesen sei, als Gott selbst.«
»Ob er wohl recht gehabt hat damit?«, meinte mein Freund leise, nachdem meine Geschichte verklungen war.
»Vielleicht –«, entgegnete ich, »aber, wissen Sie, das Volk ist – abergläubisch – indessen, ich muss jetzt gehen, Ewald.« »Schade«, sagte der Lahme aufrichtig. »Wollen Sie mir nicht bald wieder eine Geschichte erzählen?« »Gerne –, aber unter einer Bedingung.« Ich trat noch einmal ans Fenster heran. »Nämlich?«, staunte Ewald. »Sie müssen alles gelegentlich den Kindern in der Nachbarschaft weitererzählen«, bat ich. »Oh, die Kinder kommen jetzt so selten zu mir.« Ich vertröstete ihn: »Sie werden schon kommen. Offenbar haben Sie in der letzten Zeit nicht Lust gehabt, ihnen etwas zu erzählen, und vielleicht auch keinen Stoff, oder zu viel Stoffe. Aber wenn einer eine wirkliche Geschichte weiß, glauben Sie, das kann verborgen bleiben? Bewahre, das spricht sich herum, besonders unter den Kindern!« »Auf Wiedersehen.« Damit ging ich.
Und die Kinder haben die Geschichte noch an demselben Tage gehört.
Wie der alte Timofei singend starb
Was für eine Freude ist es doch, einem lahmen Menschen zu erzählen. Die gesunden Leute sind so ungewiss; sie sehen die Dinge bald von der, bald von jener Seite an, und wenn man mit ihnen eine Stunde lang so gegangen ist, dass sie zur Rechten waren, kann es geschehen, dass sie plötzlich von links antworten, nur, weil es ihnen einfällt, dass das höflicher sei und von feinerer Bildung zeuge. Beim Lahmen hat man das nicht zu befürchten. Seine Unbeweglichkeit macht ihn den Dingen ähnlich, mit denen er auch wirklich viele herzliche Beziehungen pflegt, macht ihn, sozusagen, zu einem den anderen sehr überlegenen Ding, zu einem Ding, das nicht nur lauscht mit seiner Schweigsamkeit, sondern auch mit seinen seltenen leisen Worten und mit seinen sanften, ehrfürchtigen Gefühlen.
Ich mag am liebsten meinem Freund Ewald erzählen. Und ich war sehr froh, als er mir von seinem täglichen Fenster aus zurief: »Ich muss Sie etwas fragen.«
Rasch trat ich zu ihm und begrüßte ihn. »Woher stammt die Geschichte, die Sie mir neulich erzählt haben?«, bat er endlich. »Aus einem Buch?« »Ja« – entgegnete ich traurig, »die Gelehrten haben sie darin begraben, seit sie tot ist; das ist gar nicht lange her. Noch vor hundert Jahren lebte sie, gewiss sehr sorglos, auf vielen Lippen. Aber die Worte, welche die Menschen jetzt gebrauchen, diese schweren, nicht sangbaren Worte, waren, ihr feind und nahmen ihr einen Mund nach dem; anderen weg, sodass sie zuletzt, nur sehr eingezogen und ärmlich, auf ein paar trockenen Lippen, wie auf einem schlechten Witwengut, lebte. Dort verstarb sie auch, ohne Nachkommen zu hinterlassen, und wurde, wie schon erwähnt, mit allen Ehren in einem Buche bestattet, wo schon andere aus ihrem Geschlechte lagen.« »Und sie war sehr alt, als sie starb?«, fragte mein Freund, in meinen Ton eingehend. »400 bis 500 Jahre«, berichtete ich der Wahrheit gemäß, »verschiedene von ihren Verwandten haben noch ein ungleich höheres Alter erreicht.« »Wie, ohne jemals in einem Buche zu ruhen?«, staunte Ewald. Ich erklärte: »Soviel ich weiß, waren sie die ganze Zeit von Lippe zu Lippe unterwegs.« »Und haben nie geschlafen?« »Doch, von dem Munde des Sängers steigend, blieben sie wohl dann und wann in einem Herzen, darin es warm und dunkel war.« »Waren denn die Menschen so still, dass Lieder schlafen konnten in ihren Herzen?« Ewald schien mir recht ungläubig. »Es muss wohl so gewesen sein. Man behauptet, sie sprachen weniger, tanzten langsam anwachsende Tänze, die etwas Wiegendes hatten, und vor allem: sie lachten nicht laut, wie man es heute trotz der allgemeinen hohen Kultur nicht selten vernehmen kann.«
Ewald schickte sich an, noch etwas zu fragen, aber er unterdrückte es und lächelte: »Ich frage und frage, – aber Sie haben vielleicht eine Geschichte vor?« Er sah mich erwartungsvoll an.
»Eine Geschichte? Ich weiß nicht. Ich wollte nur sagen: Diese Gesänge waren das Erbgut in gewissen Familien. Man hatte es übernommen und man gab es weiter, nicht ganz unbenützt, mit den Spuren eines täglichen Gebrauchs, aber doch unbeschädigt, wie etwa eine alte Bibel von Vätern zu Enkeln geht. Der Enterbte unterschied sich von den in ihre Rechte eingesetzten Geschwistern dadurch, dass er nicht singen konnte, oder er wusste wenigstens nur einen kleinen Teil der Lieder seines Vaters und Großvaters und verlor mit den übrigen Gesängen das große Stück Erleben, das alle diese Bylinen und Skaski dem Volke bedeuten. So hatte zum Beispiel Jegor Timofejewitsch gegen den Willen seines Vaters, des alten Timofei, ein junges, schönes Weib geheiratet und war mit ihr nach Kiew gegangen, in die heilige Stadt, bei welcher sich die Gräber der größten Märtyrer der heiligen, rechtgläubigen Kirche versammelt haben. Der Vater Timofei, der als der kundigste Sänger auf zehn Tagereisen im Umkreis galt, verfluchte seinen Sohn, und erzählte seinen Nachbarn, dass er oft überzeugt sei, niemals einen solchen gehabt zu haben. Dennoch verstummte er in Gram und Traurigkeit. Und er wies alle die jungen Leute zurück, die sich in seine Hütte drängten, um die Erben der vielen Gesänge zu werden, welche in dem Alten eingeschlossen waren, wie in einer verstaubten Geige. ›Vater, du unser Väterchen, gib uns nur eines oder das andere Lied. Siehst du, wir wollen es in die Dörfer tragen, und du sollst es hören aus allen Höfen, sobald der Abend kommt und das Vieh in den Ställen ruhig geworden ist.‹ Der Alte, der beständig auf dem Ofen saß, schüttelte den ganzen Tag den Kopf. Er hörte nicht mehr gut, und da er nicht wusste, ob nicht einer von den Burschen, die jetzt fortwährend sein Haus umhorchten, eben wieder gefragt hatte, machte er mit seinem weißen Kopf zitternd: Nein, nein, nein, bis er einschlief und auch dann noch eine Weile – im Schlaf. Er hätte den Burschen gerne ihren Willen getan; es war ihm selber leid, dass sein stummer, verstorbener Staub über diesen Liedern liegen sollte, vielleicht schon ganz bald. Aber hätte er versucht, einen von ihnen etwas zu lehren, gewiss hätte er sich dabei seines Jegoruschka erinnern müssen und dann – wer weiß – was dann geschehen wäre. Denn nur, weil er überhaupt schwieg, hatte ihn niemand weinen sehen. Hinter jedem Wort stand es ihm, das Schluchzen, und er musste immer sehr schnell und vorsichtig den Mund schließen, sonst wäre es einmal doch mitgekommen.
Der alte Timofei hatte seinen einzigen Sohn Jegor von ganz früh an einzelne Lieder gelehrt, und als fünfzehnjähriger Knabe wusste dieser schon mehr und richtiger zu singen als alle erwachsenen Burschen im Dorfe und in der Nachbarschaft. Gleichwohl pflegte der Alte meistens am Feiertag, wenn er etwas trunken war, dem Burschen zu sagen: ›Jegoruschka, mein Täubchen, ich habe dich schon viele Lieder singen gelehrt, viele Bylinen und auch die Legenden von Heiligen, fast für jeden Tag eine. Aber ich bin, wie du weißt, der Kundigste im ganzen Gouvernement, und mein Vater kannte sozusagen alle Lieder von ganz Russland und auch noch tatarische Geschichten dazu. Du bist noch sehr jung, und deshalb habe ich dir die schönsten Bylinen, darin die Worte wie Ikone sind und gar nicht zu vergleichen mit den gewöhnlichen Worten, noch nicht erzählt und du hast noch nicht gelernt, jene Weisen zu singen, die noch keiner, er mochte ein Kosak sein oder ein Bauer, hat anhören können ohne zu weinen.‹ Dieses wiederholte Timofei seinem Sohne an jedem Sonntag und an allen vielen Feiertagen des russischen Jahres, also ziemlich oft. Bis dieser nach einem heftigen Auftritt mit dem Alten, zugleich mit der schönen Ustjënka, der Tochter eines armen Bauern, verschwunden war.
Im dritten Jahre nach diesem Vorfall erkrankte Timofei, zur selben Zeit, als einer jener vielen Pilgerzüge, die aus allen Teilen des weiten Reiches beständig nach Kiew ziehen, aufbrechen wollte. Da trat Ossip, der Nachbar, bei dem Kranken ein: ›Ich gehe mit den Pilgern, Timofei Iwanitsch, erlaube mir, dich noch einmal zu umarmen.‹ Ossip war nicht befreundet mit dem Alten, aber nun, da er diese weite Reise begann, fand er es für notwendig, von ihm, wie von einem Vater, Abschied zu nehmen, ›Ich habe dich manchmal gekränkt‹, schluchzte er, ›verzeih mir, mein Herzchen, es ist im Trunke geschehen und da kann man nichts dafür, wie du weißt. Nun, ich will für dich beten und eine Kerze anstecken für dich; leb wohl, Timofei Iwanitsch, mein Väterchen, vielleicht wirst du wieder gesund, wenn Gott es will, dann singst du uns wieder etwas. Ja, ja, das ist lange her, seit du gesungen hast. Was waren das für Lieder. Das von Djuk Stepanowitsch zum Beispiel, glaubst du, ich habe das vergessen? Wie dumm du bist! Ich weiß es noch ganz genau. Freilich, so wie du, – du hast es eben gekonnt, das muss man sagen. Gott hat dir das gegeben, einem anderen gibt er etwas anderes. Mir zum Beispiel –‹
Der Alte, der auf dem Ofen lag, drehte sich ächzend um und machte eine Bewegung, als ob er etwas sagen wollte. Es war als hörte man ganz leise den Namen Jegors. Vielleicht wollte er ihm eine Nachricht schicken. Aber als der Nachbar, von der Türe her, fragte: ›Sagst du etwas, Timofei Iwanitsch?‹, lag er schon wieder ganz ruhig da und schüttelte nur leise seinen weißen Kopf. Trotzdem, weiß Gott wie es geschah, kaum ein Jahr nachdem Ossip fortgegangen war, kehrte Jegor ganz unvermutet zurück. Der Alte erkannte ihn nicht gleich, denn es war dunkel in der Hütte, und die greisen Augen nahmen nur ungern eine neue fremde Gestalt auf. Aber als Timofei die Stimme des Fremden gehört hatte, erschrak er und sprang vom Ofen herab, auf seine alten, schwankenden Beine. Jegor fing ihn auf, und sie hielten sich in den Armen. Timofei weinte. Der junge Mensch fragte in einem fort: ›Bist du schon lange krank, Vater?‹ Als sich der Alte ein wenig beruhigt hatte, kroch er auf seinen Ofen zurück und erkundigte sich in einem anderen strengen Ton: ›Und dein Weib?‹ Pause. Jegor spuckte aus: ›Ich hab sie fortgejagt, weißt du, mit dem Kind.‹ Er schwieg eine Weile. ›Da kommt einmal der Ossip zu mir; Ossip Nikiphorowitsch?, sag ich. Ja, antwortet er, ich bin’s. Dein Vater ist krank, Jegor. Er kann nicht mehr singen. Es ist jetzt ganz still im Dorfe, als ob es keine Seele mehr hätte, unser Dorf. Nichts klopft, nichts rührt sich, es weint niemand mehr, und auch zum Lachen ist kein rechter Grund. Ich denke nach. Was ist da zu machen? Ich rufe also mein Weib. Ustjënka – sag ich – ich muss nach Hause, es singt sonst keiner mehr dort, die Reihe ist an mir. Der Vater ist krank. Gut, sagt Ustjënka. Aber ich kann dich nicht mitnehmen, – so erklär ich ihr – der Vater, weißt du, will dich nicht. Und auch zurückkommen werd ich wahrscheinlich nicht zu dir, wenn ich erst einmal wieder dort bin und singe. Ustjënka versteht mich: Nun, Gott mit dir! Es sind jetzt viele Pilger hier, da gibt es viel Almosen. Gott wird schon helfen, Jegor. Und so geh ich also fort. Und nun, Vater, sag mir alle deine Lieder.‹
Es verbreitete sich das Gerücht, dass Jegor zurückgekehrt sei und dass der alte Timofei wieder singe. Aber in diesem Herbst ging der Wind so heftig durch das Dorf, dass niemand von den Vorübergehenden mit Sicherheit ermitteln konnte, ob in Timofei’s Hause wirklich gesungen werde oder nicht. Und die Tür wurde keinem Pochenden geöffnet. Die beiden wollten allein sein. Jegor saß am Rande des Ofens, auf welchem der Vater lag, und kam mit dem Ohr bisweilen dem Munde des Alten entgegen; denn dieser sang in der Tat. Seine alte Stimme trug, etwas gebückt und zitternd, alle die schönsten Lieder zu Jegor hin, und dieser wiegte manchmal den Kopf oder bewegte die herabhängenden Beine, ganz, als ob er schon selber sänge. Das ging so viele Tage lang fort. Timofei fand immer noch ein schöneres Lied in seiner Erinnerung; oft, nachts, weckte er den Sohn, und indem er mit den welken, zuckenden Händen ungewisse Bewegungen machte, sang er ein kleines Lied und noch eines und noch eines – bis der träge Morgen sich zu rühren begann. Bald nach dem schönsten starb er. Er hatte sich in den letzten Tagen oft arg beklagt, dass er noch eine Unmenge Lieder in sich trüge und nicht mehr Zeit habe, sie seinem Sohne mitzuteilen. Er lag da mit gefurchter Stirne, in angestrengtem, ängstlichen Nachdenken, und seine Lippen zitterten vor Erwartung. Von Zeit zu Zeit setzte er sich auf, wiegte eine Weile den Kopf, bewegte den Mund, und endlich kam irgendein leises Lied hinzu; aber jetzt sang er meistens immer dieselben Strophen von Djuk Stepanowitsch, die er besonders liebte, und sein Sohn musste erstaunt sein und tun, als vernähme er sie zum ersten Mal, um ihn nicht zu erzürnen.
Als der alte Timofei Iwanitsch gestorben war, blieb das Haus, welches Jegor jetzt allein bewohnte, noch eine Zeit lang verschlossen. Dann, im ersten Frühjahr, trat Jegor Timofejewitsch, der jetzt einen ziemlich langen Bart hatte, aus seiner Tür, begann im Dorfe hin und her zu gehen und zu singen. Später kam er auch in die benachbarten Dörfer, und die Bauern erzählten sich schon, dass Jegor ein mindestens ebenso kundiger Sänger geworden sei, wie sein Vater Timofei; denn er wusste eine große Anzahl ernster und heldenhafter Gesänge und alle jene Weisen, die keiner, er mochte ein Kosak sein oder ein Bauer, anhören konnte, ohne zu weinen. Dabei soll er noch so einen sanften und traurigen Ton gehabt haben, wie man ihn noch von keinem Sänger vernommen hat. Und dieser Ton fand sich immer, ganz unerwartet, im Kehrreim vor, wodurch er besonders rührend wirkte. So habe ich wenigstens erzählen hören.«
»Diesen Ton hat er also nicht von seinem Vater gelernt?«, sagte mein Freund Ewald nach einer Weile. »Nein«, erwiderte ich, »man weiß nicht, woher der ihm kam.« Als ich vom Fenster schon fortgetreten war, machte der Lahme noch eine Bewegung und rief mir nach: »Er hat vielleicht an sein Weib und sein Kind gedacht. Übrigens, hat er sie nie kommen lassen, da ja sein Vater nun tot war?« »Nein, ich glaube nicht. Wenigstens ist er später allein gestorben.«
Das Lied von der Gerechtigkeit
Als ich das nächste Mal an Ewalds Fenster vorüberkam, winkte er mir und lächelte: »Haben Sie den Kindern etwas Bestimmtes versprochen?« »Wieso?«, staunte ich. »Nun, als ich ihnen die Geschichte von Jegor erzählt hatte, beklagten sie sich, dass Gott in derselben nicht vorkäme.« Ich erschrak: »Was, eine Geschichte ohne Gott, aber wie ist denn das möglich?« Dann besann ich mich: »In der Tat, es ist wahr, von Gott sagt die Geschichte, wie ich sie mir jetzt überdenke, nichts. Ich begreife nicht, wie das geschehen konnte; hätte jemand von mir eine solche verlangt, ich glaube ich hätte mein ganzes Leben nachgedacht, ohne Erfolg …«