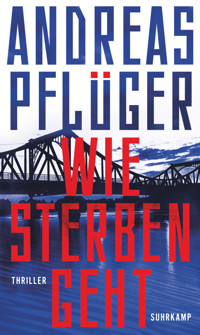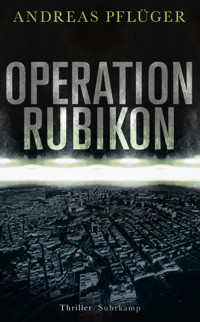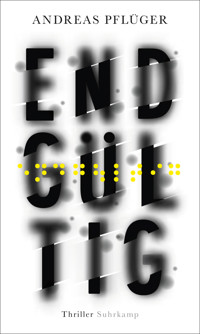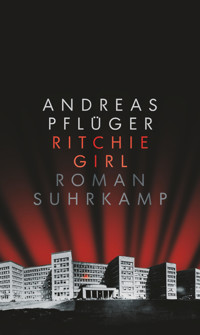
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paula Bloom kehrt nach ihrer Ausbildung in Camp Ritchie, Maryland als amerikanische Besatzungsoffizierin in ein zerstörtes und gebrochenes Deutschland zurück, das sie vor neun Jahren über Nacht verlassen hatte. Als Tochter eines amerikanischen Geschäftsmannes führte sie im Berlin der Nazizeit ein Leben im goldenen Käfig. Ein Leben, das eine Lüge war. Jetzt glaubt Paula, dass sie niemals vergeben kann. Nicht den Deutschen. Und nicht sich selbst.
Während in Nürnberg über die Hauptkriegsverbrecher gerichtet wird, arbeitet man in einem Camp der US-Army nahe Frankfurt längst wieder mit Nazitätern zusammen. Im Maschinenraum des Kalten Krieges haben Pragmatiker das Sagen, an deren Zynismus Paula verzweifelt. Hier trifft sie auf Johann Kupfer, einen österreichischen Juden, der den Amerikanern seine Dienste anbietet. Er behauptet, der größte Spion des Zweiten Weltkriegs gewesen zu sein. Paula soll herausfinden, ob das die Wahrheit ist. Doch wer die Wahrheit sucht, muss sie auch ertragen.
In einem Roman von ungeheurer erzählerischer Wucht schreibt Pflüger über Schuld und Scham, aber auch über Hoffnung und die Kraft der Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 644
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Andreas Pflüger
RITCHIEGIRL
Roman
Suhrkamp
Widmung
Für meinen wichtigsten Menschen
Motto
KEINE, DIESOGINGWIEICH
Jenen Boden zu berühren könnte eine Heimkehr sein
In demselben Kleid aus Asche wie am Tag, an dem ich ging
Doch bis hoch zum Wolkenturm, in dem mein Bildnis hing
Wären’s tausend Schritte und ein Atemzug aus Stein
Keinem, den ich kannte, ist ein Hauch von mir geblieben
Ich will stehen, wo sie starben, will weinen, wo sie lachten
Begreifen, wer sie waren, an wessen Grab sie wachten
Ganz als sei ich noch dieselbe, so als könnt ich wieder lieben
Wär’s allein ein Ozean, der mich jetzt davon trennt
Alles, was vom Abschied blieb: ein Stich, ich spürt’ ihn kaum
Ein Koffer mit Gebeten, ein Kuss, und sei’s im Traum
Und mich nicht bitter sehnen, dass einer mich noch kennt
In den dunklen Raubtierstunden war es Trost, fast Glück
Zu wissen, was mich gehen ließ aus jenem kalten Land
Als könnt ich dereinst wiederkehr’n, weil ich all dies verstand
Doch keine, die so ging wie ich, kommt einfach so zurück
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Motto
Inhalt
Mae West
Purple Heart Valley
Kandierte Kirschen
Bella Ciao
Atmen, träumen
Sunrise
Paulette
Moonshine
Bigfoot
Trueless Tomato
Ein tiefes Seufzen
Jeanne d’Arc, Maschinistin
Turm der blauen Pferde
Brot aus Asche
Spinnfädchen
In the Mood
Glasperlenspiel
Fremde Heere
Katze mit Mädchen
Sieben
Jauche und Forellen
Stalins Arsch
Der Mann im Mond
Mephisto
Komet
Statik
Tanzende Bären
Beichte
Odyssee
Trojanisches Pferd
Zaunpflock
Paputschka
Lunch mit Richard Nixon
Nach dem Licht drängen
Brotkrumen
September Lullaby
FRU-line ICE-ler
Nuttenbrosche
Unsichtbare Bomben
Götter
Regen in der Sahara
Hitler und Jesus
Lunapark
Omaha Beach
Welt aus Glas
Stanley Cup
Citizen Kane
Mädchen mit Tiger
Boot fahren
Nosferatu, Clown
Judas
Hotel Pannonia
Wollknäuel
Dornbusch
Baum der Erkenntnis
Krieg und Frieden
SCHU
-
GUMM
Bittermandel
Blutente
Bieranstich
German Schrecklichkeit
Windhauch
Achtzehnbittengebet
Ein Grab in Budapest
Dieses Lächeln
Ithaka
The Return Place
Nachwort
Bodo V. Hechelhammer
:
Geschmeidige Männer
Quellennachweise
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Mae West
Diese eine Welle würde sie nie vergessen. Noch bevor der taumelnde Bug des Schiffes sie rammte, fühlte Paula sie heranrollen, eine Walze von seelenloser Urgewalt, geschmiedet nur für den Moment, in dem sie den Stahl der U.S.S. Coleman zum Beben und Knirschen brachte und das zweite Unterdeck in ein Panoptikum von zitternden Fratzen verwandelte.
Sie starrte in die Augen von Violet auf der Pritsche über ihr, dachte, wie kann das sein, und wurde gewahr, dass sie auf dem Boden lag. Violets Mund klappte zu einem Schrei auf, stumm, weil Paulas Herzhämmern alles andere übertönte; die mollige Violet, gleich alt, keine dreißig, die am Pier in New Jersey von den Großeltern und einer Tante verabschiedet worden war, so innig, dass Paula, die kein Lebewohl bekam, von niemandem, einen Stich gespürt hatte.
Als der Schiffskörper wie eine Glocke dröhnte, auf die King Kong eindrosch, und die zweite Welle, jetzt aus nackter Angst, durch die sechshundert Menschen raste, die man in drei Lagen übereinandergestapelt hatte, füllte Violets weit aufklaffender Mund Paulas ganzes Blickfeld aus.
Sie vermeinte, in der Luft zu hängen, eine schwebende Jungfrau in einem Zaubertrick des Meeres. Sie wollte sich an einer Strebe festhalten, streckte sich, griff ins Leere. Sie ruderte mit den Armen, flog gegen ein Heizungsrohr.
Etwas schlug nach ihr. Es wurde stockfinster, dann flackerten die zwei roten Funzeln wieder, erloschen, flackerten. Vor Paula zuckten Gesichter von Männern auf, wirre Blicke, eine schneeweiße Faust, die den Schaft eines Bajonetts umschloss; Soldaten, die noch beim Kohlenbunkern in Gibraltar, wo der Hafen schwarz von britischen Kriegsschiffen gewesen war, an der Reling gestanden und Mädchen hinterhergepfiffen hatten, in den Mundwinkeln lässig Kippen.
Aber jetzt, nach drei Tagen Sturm und der dauernden Angst vor deutschen U-Booten, sah Paula in allen Augen, was auch sie wie eine Atemnot quälte: die Frage, ob sie in diesem Krieg, den die meisten bloß aus March of Time kannten, je ankämen oder ob sie hier unten sterben mussten, in diesem Gefängnis, das von Ungeziefer starrte, in dem es nach Diesel, Schmieröl, klammer Kleidung und Erbrochenem stank.
Als sie aus einem Dämmer hochschreckte, Bewusstlosigkeit näher als Schlaf, war es vorbei. Sie wusste nicht, ob Tag oder Nacht war. Das Schiff schaukelte sachte. Dass sie Fahrt machten, erkannte Paula nur am Stampfen der Motoren. Violet, die schon beim Ausrücken aus Camp Ritchie resolut erklärt hatte, dass sie auf gar keinen Fall ungeschminkt in den Krieg ziehen würde, malte die Lippen nach. Aber ihre Augen waren stumpf, noch in der Hölle der letzten Tage.
Zum ersten Mal seit Ewigkeiten wagte Paula sich nach oben. Vom Fallreep warf sie einen Blick in das zweite Quartier, auch dort sechshundert, apathisch. Draußen herrschte tiefe Nacht. Soldaten lehnten an der Reling. Alle hatten Mae West am Hals, die Schwimmweste, die niemand ablegen durfte, nicht einmal beim Schlafen. Die Männer flüsterten, noch zerschlagen vom tagelangen Beten.
Sterne so fett wie mit Fingerfarben an den Himmel gemalt, aber nirgends Land. Paula saugte die klare Salzluft ein, um die Angst nicht mehr zu schmecken. Sie spürte Blicke. Vermutlich waren die Frauen des Women’s Army Corps, die sich an Bord befanden, für diese Männer die letzten Amerikanerinnen, die sie auf lange Zeit zu Gesicht bekamen. Sie verstand das. Doch jetzt wollte sie für sich sein. Sie sehnte sich danach, den widerwärtigen Geruch loszuwerden, wollte ihr Zittern nicht hinter Geplänkel verstecken.
Erneut fragte sie sich, wohin man sie bringen würde. Allein die höheren Offiziere kannten das Ziel. Einem mickrigen First Sergeant wie ihr blieben nur Mutmaßungen. Bei ihrem letzten Deckaufenthalt war es nach Osten gegangen; das konnte alles und nichts bedeuten. Vielleicht Malta, ein sonniger Posten in dem dortigen Hauptquartier, das die amerikanisch-britischen Operationen im Mittelmeerraum koordinierte.
Oder Sizilien, wo der Krieg längst vorbei war.
Wenn sie Pech hatte: Griechenland. Dort kämpften die Engländer gegen kommunistische Partisanen, wie Paula in Camp Ritchie erfahren hatte. Die Alliierten tauschten das Personal je nach Bedarf; keiner wurde nach einer Wunschliste gefragt.
Paula sah zum Himmel und suchte den Polarstern, rätselte, welcher es war. Violet wüsste es. In Ritchie waren die Männer in Wetterbeobachtungen geschult worden, und Violet war für das Unterrichtsmaterial zuständig gewesen. Obgleich sie eine Zeit auf derselben Stube gelegen hatten, kannten sie einander nur flüchtig. Paula wusste wenig mehr von Violet, als dass sie aus Texas stammte und ihr Mann bei den Bombern im Pazifik war. Als Dexter ausrücken musste und Violet sich in Galveston an der Bushaltestelle von ihm verabschiedet hatte, war sie von einer sympathischen Frau in der Uniform des Women’s Army Corps angesprochen worden. Die Frau hatte sie gefragt, ob sie helfen wolle, ihren Mann schnell heimzubringen. Kaum hatte Violet genickt, war sie um eine Unterschrift gebeten worden. Sie hielt es für eine Art Petition, wurde indes eines Besseren belehrt, als sie sich kurz darauf in Ritchie wiederfand.
»Trotzdem Schwein gehabt«, hatte sie erklärt, nachdem sie ihre Geschichte dort zum Besten gegeben hatte. »Als ich eine Woche hier war, kam Hurricane Surprise auf einen Sprung in Galveston vorbei und hat unser Haus zum Baden in die West Bay geschickt. Stellt euch vor, ich wäre drin gewesen; ich kann doch gar nicht schwimmen.« Sie war eine von denen, die sich über den verrückten Jitterbug, den ein Leben tanzen konnte, keine großen Gedanken machten. Violet und Paula waren die einzigen Schreibkräfte an Bord; die anderen Frauen gehörten dem Schwesterncorps an, GI Nightingales. Etliche würden auf der Coleman bleiben, um bei der Rückfahrt die Verwundeten zu pflegen, die sie in ihrem Zielhafen aufnähmen. Die Übrigen kämen sicher an die Front.
Paula dachte an Sam, ihren besten Freund in Ritchie. Wie mochte es ihm ergangen sein? Ende November hatte sie einen Brief von ihm bekommen, Zeilen, bei denen er hoffen musste, dass sie durch die Zensur gehen würden. Ritchie besaß dafür eine eigene Dienststelle, und Sam konnte nicht wissen, dass Paula inzwischen eine von denen war, die in der Feldpost alles schwärzten, was Hinweise auf das jeweilige Einsatzgebiet und die dortige Lage hätte geben können. Ihre Vorgesetzten glaubten, dass Frauen ein scharfes Gespür dafür hätten, verborgene Botschaften in den Briefen zu entdecken.
Als ob Schnüffeln uns im Blut läge, hatte Paula gedacht.
Aber es ließ sich nicht leugnen, sie war sehr gut darin. Auch Sam hatte ihr einen Hinweis hinterlassen, als er schrieb, dass das Essen erstaunlich lecker ist, fast wie an dem Tag im Camp, als man uns diesen Vortrag über Sexualhygiene hielt und wir so lachen mussten. Es hatte Paula verraten, dass Sam in Frankreich war, denn an besagtem Abend hatte ihr neuer Koch, ein Franzose, der zuvor Küchenchef im Waldorf Astoria gewesen war, ein fulminantes Cassoulet aufgetischt, und Ritchie hatte sich für eine Stunde in einen fast lebenswerten Ort verwandelt.
Die Arbeit in der Zensurstelle war nur ein kleiner Teil von Paulas Arbeit gewesen. Sie beherrschte fließend Französisch und Deutsch; vor allem hatte sie Nachrichten der Résistance übersetzt, außerdem Funksprüche von Widerstandsgruppen wie der Roten Kapelle. Doch am härtesten war die Zensur der Feldpost für die in Ritchie stationierten Frauen, deren Männer im Krieg kämpften. Häufig hatte sie schlimme Nächte, wachgehalten von der Frage, ob sie das Recht hatte, ihnen zu unterschlagen, wie es um ihre Liebsten stand. Das waren dieselben Frauen, die sie aufsuchen musste, wenn deren Antwortbriefe nicht patriotisch genug waren. Sie hatte ihnen einzuschärfen, keine Sorgen zu erwähnen, mochten sie noch so bedrängend sein, nie zu klagen, ihre Männer mit keinem Leid zu belasten, sondern zu betonen, dass an der Heimatfront alles gut war.
Vor diesen Frauen hatte sie den Blick senken müssen. Alice, der Schwiegervater an Krebs erkrankt. Florence, deren Sohn wegen des Diebstahls von lachhaften zwei Dollar vor Gericht sollte. Majorie mit der Fehlgeburt. Viele mehr. Manche hatten Paula gehasst. Und es stand ihnen zu. Darum hatte sie irgendwann begonnen, selbst zu entscheiden, was sie schwärzte und was nicht. Aber an ihren Träumen hatte es nichts geändert.
Die Coleman pendelte die Dünung aus, eine Kinderwippe, ganz so, als wollte sie zwölfhundert junge Menschen in einen sorgenlosen Schlaf wiegen. Die Sterne waren das einzige Licht auf dem verdunkelten Schiff. Paula schlang die Arme um ihren Körper, fror trotz der warmen Brise.
Als sie wieder unter Deck ging, hörte sie einen GI zu einem anderen sagen: »Ich wette: Norditalien. Die Nazis haben aus den Alpen eine verdammte Festung gemacht, und wir werden dort ins Feuer geschmissen.«
Im Bauch des Schiffes wusste die Zeit nichts mit sich anzufangen, trödelte saumselig vor sich hin. Am Morgen reinigten die Frauen des Schwesterncorps das Quartier mit Kernseife, bis nichts mehr an die letzten Tage erinnerte, außer dem sauren Geruch. Paula half mit, froh, etwas tun zu können, sei es noch so eklig. Keiner der Männer rührte auch nur einen Finger. Sie wären eher auf ihrem eigenen Erbrochenen ausgerutscht, als einen Schrubber in die Hand zu nehmen. Das ist Frauenarbeit, sagten ihre stoischen Mienen, während sie Comics lasen und Karten spielten. Ihr kriegt einen lockeren Job in der Etappe, aber wir riskieren für euch unser Leben.
Erneut war Entlausungs-Appell, zum dritten Mal seit New Jersey. Ein Corporal quetschte mit einer Art Pferdespritze ein Desinfektionsmittel in den Kragen der Bluse, in Ärmel, Stiefel, zuletzt in den Rocksaum. Jetzt juckte es mehr als vorher.
Paula verstand nicht, dass viele wieder essen konnten. Sie musste sich zu jedem Bissen zwingen. Doch das Wenige, was sie hineinquälte, behielt sie wenigstens bei sich. Unten war es schrecklich heiß und stickig. So viele Menschen auf engstem Raum waren lauter als der Times Square. Wie sie die Männer beneidete, die im Unterhemd waren; manche nicht mal das.
Für jeden Atemzug an Deck war sie dankbar. Noch immer Wasserwüste. Im Heckwirbel balgten Möwen um Abfälle, am Himmel ab und zu ein Brummen hinter der Kimm. Aufklärer vermutlich, aber wohl keine deutschen. Die Alliierten besaßen längst die Lufthoheit, wie über Lautsprecher angesagt worden war, um die Moral zu stärken.
Einmal, in tiefer Nacht, hörte sie Violets leise Stimme über sich: »Bist du wach?«
»Ja.«
Violet kletterte herunter und setzte sich neben Paula. Ihre Augen waren blank, sie hatte geweint. »Du warst doch auf der Poststelle«, flüsterte sie. »Kam es da vor, dass ihr Briefe nicht an uns weitergeleitet habt? Also, nicht einmal mit schwarzen Stellen?« Als Paula sich ihre Antwort noch zurechtlegte, stieß Violet hervor: »Ich habe Dexter jede Woche geschrieben, aber es ist bald ein halbes Jahr her, dass er zuletzt geantwortet hat. Und ich weiß nicht, ob … ob …«
»Wenn ihm etwas passiert wäre, hättest du es ganz sicher erfahren«, sagte Paula. »Sowas wird nicht zurückgehalten.«
»Das meine ich ja nicht«, brachte Violet heraus. »Er ist auf Hawaii stationiert. Ich habe mal Aufnahmen gesehen, in der Kinowochenschau. Dort scheint es ganz ungezwungen zuzugehen. Die Frauen in dem Film waren …« Sie schluchzte auf. »Ich weiß ja, dass ich keine Schönheit bin. Eigentlich habe ich nie verstanden, wieso Dexter mir den Hof gemacht hat.«
Paula verlieh ihrer Stimme Festigkeit. »Wir hatten doch die Anweisung, Post aus Hawaii besonders streng zu behandeln, weil da so viele Japaner sind«, flüsterte sie. »Jeden Satz haben wir fünfmal durchkauen müssen. Manchmal war am Ende fast alles schwarz, und der Captain hat dann gemeint: ›Den lassen wir verschwinden, sonst denkt seine Frau noch, er hätte wer weiß was geschrieben.‹«
Violets Augen trieben im Tränenwasser. »Ach so?«
»Das muss unter uns bleiben«, raunte Paula. »Ich dürfte dir das gar nicht sagen.«
Im ersten Moment fühlte die Lüge sich falsch an, aber als sie Violets glückliches Gesicht sah, setzte Paula hinzu: »Ich kann mich sogar an einen langen Brief von Dexter erinnern. Er liebt dich sehr und vermisst dich.«
Ganz gleich, wie es um die Ehe stand: Wer im Krieg nichts zum Festhalten hatte, stürzte ins Nichts. Sie wusste das genau. Und auch, dass es bei ihr so sein würde.
Purple Heart Valley
Morgens weckte sie das Gebrüll des Master-Sergeant-Gorillas. »Alle raus! Marschgepäck fassen! Frauen zuerst!«
Sie hatten nicht einmal Zeit, sich notdürftig zurechtzumachen, wankten an Deck. Ein englisches Geschwader jagte am grauen Himmel über sie hinweg, so tief, dass Paula die blauen Auspuffabgase sah. Sie ankerten eine Viertelmeile vor einem Hafen oder dem, was einmal ein Hafen gewesen war. Zuerst glaubte sie, dass Stahlbarrieren aus dem Becken ragten, dann erkannte sie ausgebrannte Schiffsrümpfe mit zerfetzten Aufbauten, die Türme von U-Booten. Ein riesiger Flugzeugträger versperrte die Einfahrt, bis knapp unters Deck ins Wasser eingesunken. An der Kommandoinsel prangten die italienischen Farben, darüber stand Aquila.
Sie sprach einen Major an. »Verzeihung, Sir, wo sind wir?«
»Genua.«
Bärtige Männer standen auf Fischerbooten und begrüßten sie mit ratternden Salven aus Maschinenpistolen. Sie waren in verwegenem Räuberzivil, trugen rote Halstücher, reckten die Fäuste und lachten. Es war drückend schwül, aber einer, klein und knochig wie Stan Laurel, trug eine Pelzmütze, als käme er eben aus Stalingrad. Von den Quais hingen Krangerippe halb ins Wasser, ihr Stahl verbogen von gewaltiger Hitze. Dahinter sah Paula Schutthügel emporwachsen, einst Häuser, Fabriken. Rauchsäulen standen am Horizont.
Es roch wie damals, an dem Tag des großen Feuers, als ihr Bildnis zu Asche wurde.
Sie hörte zwei Offiziere: »Ist der Schrottplatz von uns?«
»Nein, das waren die Tommies; den Träger haben die Jerrys gesprengt, bevor sie vor drei Tagen getürmt sind.«
Befehle schnarrten aus den Lautsprechern: »Am Fallreep Gasse freilassen! Frauen in die erste Reihe!«
Paula sah Barkassen in einem Zickzackkurs auf die Coleman zuhalten, derart überladen, dass sie bei stärkerer Dünung vollgelaufen wären. Dann erkannte sie amerikanische Uniformen. Männer hingen halb überm Bug und dirigierten vorsichtig.
»Der Hafen ist vermint«, raunte einer hinter ihr.
Die erste Barkasse wurde vertäut. Mit den Winden wurden Verwundete an Bord gehievt. Sie waren bei Bewusstsein, aber teilnahmslos. Als man sie an den Frauen vorbeitrug, verstand Paula, warum man sie in der ersten Reihe haben wollte. Diese Männer sollten ein weibliches Wesen sehen, ein Lächeln. Also strahlte sie wie die anderen übers ganze Gesicht und machte aufmunternde Bemerkungen. »Sag nicht, dass du verheiratet bist … Dich päppeln wir schon wieder auf … Na, lädst du mich heute Abend auf einen Drink ein? … Hallo, Großer, bist du der Bruder von Errol Flynn?«
Der Letzte war ein halbes Kind, beide Hände amputiert, die Verbände an den Stümpfen schwarz. Es schnürte ihr das Herz ab, als sie sagte: »Wegen so einer Schramme willst du heim?«
Die Parade der Sanitäter war durch irgendetwas ins Stocken geraten, und der Junge sah zu Paula hoch. Das linke Auge war von Sekret so verklebt, dass er es nicht aufbekam. In den eingefallenen Lippen war kein Blut mehr. Sie beugte sich zu ihm, küsste seine eiskalte Stirn. Er flüsterte etwas.
Paula ging mit ihrem Ohr nah an seinen Mund.
»Sagen Sie das meiner Verlobten.«
Sie schämte sich für ihr Zittern, schämte sich, dass sie ihre Tränen wegwischen konnte, dass sie einen lächerlichen Sturm für den Krieg gehalten hatte. Violet gab ihr einen Schubs; sie hatten Befehl, eine Barkasse zu besteigen. Schulter an Schulter kauerten die Frauen auf ihren Seesäcken, sprachen nicht. Der Minenlotse bestimmte den Kurs mit heiseren Rufen. Auf dem Wasser schwamm gelber Schaum. Ein Schachspiel, eine Bibel, verschmortes Bakelit, aufgedunsene Tierkadaver, Fetzen von Uniformen, immer wieder Leichen.
Als sie sich den Partisanenbooten näherten, hörte Paula sie singen, ein schmissiges Kampflied. Doch sie musste an einen traurigen Song von Sinatra denken, dessen Titel ihr nicht einfiel.The loveliest day, the brightest sun is like a night without a star. These are the lonely, gloomy hours like only in love or at war. Die Männer winkten und warfen den Frauen Kusshände zu. Paula wollte lächeln, aber ihre Mundwinkel waren starr.
»Was denkst du, wo wir hinkommen?« flüsterte Violet.
Sie zuckte die Schultern, es war ihr gleich.
Am Pier saßen hunderte amerikanische Soldaten auf ihren Tornistern und warteten mit grauen, eingefallenen Gesichtern darauf, endlich eingeschifft zu werden. Sie sahen aus, als fielen sie um, wenn sie stehen müssten.
Paula ging von Bord. An Land gab es kein heiles Stück Holz oder Metall, keinen Stein, den nicht Maschinengewehrgarben beharkt hätten. Selbst der Himmel hing in Fetzen. Auf einem deutschen Militärtransporter waren Leichen wie Klafterholz aufgeschichtet, alle nackt, darunter Frauen. Fliegengeschmeiß hatte sich auf ihnen niedergelassen. Paula würgte. Sie musste wegsehen und sich ein Taschentuch vor die Nase halten.
Der Master Sergeant brüllte: »Schwesterncorps zu mir!«
Als die anderen sich in Reih und Glied aufstellten, standen Paula und Violet verloren da, unsicher, wohin sie sich wenden sollten. Dann hielt ein »Pile Car« neben ihnen, ein bulliger GI sprang aus dem Jeep. Er hatte die Ärmel hochgekrempelt; das Gesicht war wie aus grobem, dunklem Lehm gebrannt.
»Ist eine von Ihnen Paula Bloom?« fragte er.
»Ich.«
»Harvey Davis, Ma’am. Ich habe Befehl, Sie mitzunehmen.« Er schnappte sich kurzerhand ihren Seesack und warf ihn auf die Rückbank des Jeeps.
»Sagen Sie mir zuerst, wo es hingeht«, forderte Paula.
Davis verschränkte die Arme. Zwar war er ein einfacher GI, ein Dogface, aber als Frau durfte sie ihm keine Befehle erteilen, selbst wenn sie Colonel wäre.
»Geh schon«, sagte Violet. »Und schreib mir mal.«
Sie umarmten einander; Fremde, und doch kannten sie in diesem Land sonst niemanden. Als sie abfuhren, wandte Paula sich noch einmal um, sah Violet winken, plötzlich nicht mehr pummelig, jetzt ganz klein und zart.
Eine halbe Stunde oder länger kurvten sie kreuz und quer in der Hafengegend herum. Davis suchte seinen Weg auf Straßen, die immer wieder durch Schutt so eng geworden waren, dass der Jeep kaum hindurchpasste und sie an Gestein, Beton, rostigen Eisenstreben langschrammten. Manchmal ragte ein Arm aus Trümmern, ein Bein; nackte, ausgebleichte Knochen. Oft musste Davis stoppen, umdrehen, weil Geröll alles blockierte. Menschen sahen sie kaum, und wenn, dann krochen sie in der Verheerung herum, durch Gelump, Unrat, Schrott, und suchten irgendetwas. Einmal, mitten auf der Straße, eine Madonna ohne Kopf. Wie vom Himmel gefallen.
Davis bremste hart. Vor ihnen drängte eine zeternde Meute aus dem Torso eines Depots. Sie hatten lauter unnütze Dinge ergattert: Bügeleisen, Essgeschirr, Putzeimer, Besen. Ein abgemagerter Mann stellte einer alten Frau ein Bein. Er wollte ihr einen Staubwedel aus den Händen winden und trat ihr, als sie die Beute wimmernd verteidigte, so lange gegen den Kopf, bis er das Utensil hatte. Er rannte fort, blieb stehen, starrte es an, schmiss es achtlos weg. Die Menschen stießen Triumphgeheul aus, das wie Wehklagen klang. Einige ließen ihre Eroberungen fallen, stürmten mit geballten Fäusten auf den Jeep los. Davis bleckte gelbe Zähne. Er stieß zurück, wendete tollkühn. Den Revolver steckte er erst weg, als das Gebrüll verklungen war. Paulas rechte Hand tat weh. Sie hatte ihre Fingernägel so tief hineingegraben, dass es blutete.
Dann, endlich, lag die Stadt hinter ihnen. Die kurvige Landstraße war unbeschädigt bis auf tiefe Rillen von Panzerketten. Dörfer krallten sich an die Hänge, auf den Weinbergen waren die Reben verdorrt. Als Paula einen Blick zurückwarf, sah sie das graue Meer, Kriegsschiffe am Horizont. Lauter unsinnige Gedanken jagten durch ihren Kopf. Sie fragte sich, ob Albert Einstein je in Italien gewesen war; ob man auf dem Rasen vor dem Weißen Haus noch picknicken durfte; wo Otto Dix jetzt sein mochte; dass sie als Frau bei einer Gefangennahme nicht nach dem Haager Abkommen behandelt werden müsste.
Paula bemerkte, dass Davis auf ihre Beine starrte, und zog den Rock glatt. »Genießen Sie die Aussicht, Soldat?«
Er grinste. Aber mehr aus Unsicherheit.
»Wo kamen die Verwundeten her, die in Genua aufs Schiff gebracht wurden?« fragte sie.
»Von der 34ten.«
Drei Worte, als sei jedes weitere zu viel.
»Haben Sie Angst, dass ich Sie für einen Schwätzer halte?«
»Wir waren die Ersten, die nach England geschickt wurden, im Mai 1942«, sagte er. »Sie haben uns nach Algier gebracht. Dort haben die Vichy-Franzosen mit Acht-Achtern Scheibenschießen auf uns veranstaltet. Wir haben uns nach Tunesien vorgearbeitet, dabei sind über zweitausend verreckt. Im September 43 ging’s nach Salerno. Am Abend davor hieß es, die Italiener hätten kapituliert. Wir haben uns besoffen. Morgens sind wir ins Feuer von drei deutschen Divisionen gerannt. Von meinen Freunden war Jimmy der Einzige, der’s überlebt hat.« Davis’ Stimme klang ganz unbeteiligt. »Wir sind nach Norden und haben in gut sechs Monaten weniger als hundert Meilen Gewinn gemacht. In den Bergen konnte der Nachschub wegen dem vielen Geröll und Schnee nur mit Mauleseln rangeschafft werden. Der Schlamm hat die Zehen gefressen, nachts haben sich Hunde über die Toten hergemacht. Als wir damals ausgerückt sind, hat Jimmy zu mir gesagt: ›Kann sein, dass Krieg die Hölle ist, aber wir werden einen höllisch guten Krieg haben.‹ Jetzt liegt er in Purple Heart Valley, so haben wir eine von den Schluchten getauft.« Davis hielt Paula seine Old Golds hin. Sie lehnte ab, er klopfte eine aus der Packung. »Im Januar darauf sind wir im Schlachthaus von Monte Cassino gewesen. Es soll demnächst einen Film darüber geben, stand in Stars and Stripes. Mit einem Robert Mitchum; nie von dem gehört.«
»Er hat in Thirty Seconds Over Tokyo mitgespielt.«
»Kann er was?«
»Traurig gucken.«
»Dann ist er der Richtige.« Davis hielt seine Zigarette, wie Mitchum sie halten würde. »Im Juni haben wir den Stoß gegen Rom angeführt, auch dort waren wir beim Sterben die Ersten. Der General hat ans Kriegsministerium geschrieben und verlangt, dass wir heimdürfen. War reine Papierverschwendung. Vorgestern ist unser Konvoi neunzig Meilen südlich von hier in eine Sprengfalle der Rothemden gebrettert. Haben Sie den Jungen ohne Hände gesehen?«
Paula nickte.
»Das war Benny Lawrence. Kannte ihn drei Jahre, hab ihn nie lachen sehen.«
Es ging immer weiter in die Berge. In einem Tal das Wrack einer Vickers. Raben stiegen von der zerbrochenen Glaskanzel auf. Blaue und rote Pflanzen blühten. Sie wusste nicht, welche, kannte sich mit der Natur nicht aus. »Wieso soll ich zur 34ten, hat man Ihnen das gesagt?« fragte sie.
»Nein. Und ich kutschiere Sie nicht zur 34ten, sondern zum IV Corps, steht vor Mailand; dort sind vorgestern die Jerrys vor den Partisanen stiften gegangen. Was können Sie denn?«
»Tippen und übersetzen.«
»Sie haben einen Akzent«, sagte Davis. »Deutsch?«
»Ja. Mein Vater war Amerikaner.«
»Meiner war Wolgadeutscher, hat sich von Hans Drübnitsch in Harold Davis umbenannt. Mein zweiter Vorname ist Fritz, von meinem Großvater.« Er wechselte ins Deutsche. »Ich bin aus Hastings in Nebraska, dort ist Deutsch quasi Amtssprache. Wie isses so im Teutoburger Wald?«
»Kalt.«
»Kälter als in Nebraska wird’s nicht sein.«
Auf einmal verlangsamte er das Tempo. Aus dem Unterholz tauchten barfüßige Kinder auf, zwölf oder dreizehn Jahre alt. Karabiner schlackerten von den dürren Schultern, einer hatte einen viel zu großen Wehrmachtshelm auf dem Kopf.
Paula wurde heiß, als sie sah, dass der Mund des Jungen rot verschmiert war. Erst als er ihr unreife Kirschen aus einem verrotzten Taschentuch hinhielt, atmete sie aus. Dann sah sie die anderen Kinder auf der Lichtung. Sechs, auch mit Gewehren. Sie zielten auf einen Landser, der mit erhobenen Händen vor ihnen kniete. Tränen liefen übers verdreckte Gesicht. »Ich bin nur einfacher Soldat«, beschwor er die Kinder. Seine Stimme war von Angst zerschlagen. Sie musterten ihn neugierig, verstanden kein Wort. »Ich habe eine Frau und zwei Söhne, so alt wie ihr. Sie heißen Jan und Martin. Wartet, ich zeige euch ein Foto.« Überlangsam griff er an seine Brusttasche. Die Kinder schossen. Sie durchwühlten die Kleidung nach Brauchbarem, ohne nachzuschauen, ob der Mann noch lebte. Einer fand das Foto, warf es weg.
Davis gab Gas. Nach Meilen meinte er: »Bin kein Nazi. Das wird Hitler auch schwören, wenn er auf den Stuhl kommt.«
Einige Male musste er wegen Bombenkratern ins Gelände ausweichen. Dann öffnete die Landschaft sich zu einer Ebene, die Schnellstraße war noch nass von einem Starkregen. Paula sah ein Schild im Graben: Milano 35. Sie hörte dunkles Grollen, das anschwoll, bis der ganze Jeep vibrierte. Vor ihnen kam ein Panzerkonvoi in Sicht. Auf den Shermans stand Old Ironsides. Sie waren mit Pin-ups von Betty Grable, Rita Hayworth, Jean Harlow beklebt. MG-Schützen dämmerten im infernalischen Donner, auf ihren Gesichtern eine Melasse aus Schweiß und Modder. Andere streiften Paula mit ausgelaugten Blicken. Alle trugen schwarze Armbinden.
»Was bedeuten die Armbinden?« fragte sie.
»Roosevelt ist tot«, sagte Davis. »Wussten Sie das nicht?«
Paula war sich nicht sicher, ob sie weinte, aber es fühlte sich so an. »Wann?« brachte sie heraus.
»Am Zwölften. Hirnschlag, hieß es.«
Sie schwiegen bis zu den ersten Ausläufern der Stadt, einem zerschossenen Castell, Industrieanlagen mit kalten Schloten, und erreichten endlich das Feldlager des IV Army Corps, drei Meilen außerhalb Mailands.
Davis übergab Paula an einen Corporal, der ihr eine Pritsche in einem großen Zelt zuwies, ohne ihr sagen zu können, wozu sie hier war.
»Sorry, Ma’am, ich soll Ihnen nur Quartier beschaffen.«
Kandierte Kirschen
Sie teilte sich die Unterkunft mit Frauen des Schwesterncorps; keine nahm Notiz von Paula. Sie kamen und gingen, fielen mit den blutbesudelten Schürzen auf das Lager, wo sie in Stiefeln einschliefen, keinen Mucks von sich gaben.
Der Lärm schlug wie ein Vorschlaghammer auf das Zelt ein. Einer solchen Kakophonie aus Lautsprechergebrüll, Motorengeheul, Geschrei war Paula zuletzt in Fort Des Moines ausgesetzt gewesen, bei der Grundausbildung vor zwei Jahren.
Achthundert Frauen aus dem ganzen Land hatten sich freiwillig gemeldet, die ersten in der Geschichte der Army. Etliche waren aus der Rüstungsindustrie gekommen; sie hatten zuvor Liberator-Bomber zusammengeschraubt, Cadillacmotoren in M3-Panzer eingebaut, Bordgeschütze gefräst.
Rosie the Riveter, Rosie, die Nieterin. Jeder kannte die Plakate mit dem kämpferisch dreinblickenden All-American Girl, das seine Armmuskeln wie Popeye spielen ließ. Wer einen Küchenmixer bedienen kann, weiß auch mit einer Bohrmaschine umzugehen. Aber schon in den Fabriken hatten sie erfahren, dass viele Männer es nicht ertrugen, neben einer Frau am Fließband zu stehen. Als seien ein Bolzenschneider oder ein Schweißgerät von einer höheren Macht verliehene männliche Insignien, die entweiht würden, sobald eine Frau sie in die Hand nahm.
Dazu kamen in Des Moines Hochschulabsolventinnen wie Paula. Sie wussten, wie es war, in einem Universitätsseminar, ja in einem ganzen Fachbereich die einzige Frau zu sein und später bei einem Einstellungsgespräch gefragt zu werden, ob man Kaffee kochen könne. Doch als sie dem WAC-Programm beitraten, schlug ihnen blanker Hass entgegen, befeuert durch eine Schmutzkampagne, an der sich führende Zeitungen des Landes beteiligten. Sie wurden als Flittchen oder Schlimmeres bezeichnet, seien bei der Army nur darauf aus, mit Männern anzubandeln, würden zu viel trinken und sich in öffentlichen Parks unzüchtig verhalten; die Krankenhäuser in Des Moines hätten vermehrt mit Geschlechtskrankheiten zu schaffen. In der New York Daily News setzte John O’Donnell das Gerücht in die Welt, dass in einer strenggeheimen Aktion des Kriegsministeriums Unmengen Verhütungsmittel an das Women’s Army Corps ausgegeben worden seien.
Die Frauen in Fort Des Moines schluckten es wie eine bittere Medizin, die sie von der Illusion kurierte, Männer würden ihnen für ihre Entscheidung Respekt erweisen. In den Nächten lernte Paula alle Laute der Verzweiflung kennen. Ein Stöhnen im Traum, Schluchzen unter der Zudecke, geflüsterte Gebete. Aber keine von ihnen quittierte den Dienst. Sie wollten zeigen, dass sie mehr waren als die Beute eines Reklamefeldzugs. Das brutale körperliche Training erkannten sie als Versuch, sie zu zermürben und zu demoralisieren. Doch auch das bestanden sie. Und dann kam der Tag, an dem Paula hundskaputt in die Augen des schärfsten Schleifers schaute, eines Mannes, dessen Frauenbild zu Dickens’ Zeiten antiquiert gewesen wäre; den sie Karloff nannten, weil schon sein Schädel schaurig war. Sie sah ihn unmerklich nicken. Das steckte sie sich in die Tasche, ohne zu lächeln.
Nach den sechs Wochen erfuhren sie, dass man nicht daran dachte, sie nach Übersee zu entsenden. Die Besten von ihnen wurden Schreibkräfte, in Des Moines oder Camps wie Ritchie; andere versahen Dienst auf der Poststelle, als Telefonistinnen, Fahrerinnen, Elektrikerinnen. Einige wenige durften Bombercrews im Instrumentenflug trainieren. Sie wurden von Paula beneidet, bedeutete es doch beinahe, am Krieg teilzunehmen. Doch bei ihren Sprachkenntnissen hatte von Anfang an außer Zweifel gestanden, dass sie zu den Übersetzerinnen käme. Bisweilen wünschte Paula sich, sie wäre eine Russin. In der Roten Armee kämpften Frauen an der Front; es gab Kampfpilotinnen, Pionierinnen, Panzerkommandantinnen, Scharfschützen wie Ljudmila Michailowna Pawlitschenko, von deren dreihundert Abschüssen alle Zeitungen berichtet hatten, nachdem sie von Roosevelt im Weißen Haus empfangen worden war.
Abends lagen die Frauen in der Baracke und erzählten sich flüsternd von den Zudringlichkeiten der Vorgesetzten. Wenn sie Glück hatten, blieb es bei anzüglichen Bemerkungen, aber die meisten wussten, wie sich ein ungebetener Arm um ihre Hüfte anfühlte, ein Gesicht, das sich einfach in ihre Halsbeuge vergrub, eine Hand auf dem Hintern. Gleichzeitig wurden sie angehalten, sich zu schminken, ihre Haare adrett zu frisieren, Parfüm zu benutzen, im Dienst ansprechende Zivilkleidung zu tragen. Auch die Betonung, dass es ihre patriotische Pflicht sei, die Moral der männlichen Soldaten zu stärken, fühlte sich wie eine Hand auf dem Hintern an.
Paula schminkte sich weder in Fort Des Moines noch später in Ritchie. Aber Major Keeling strich ihr dort im Kartenraum wie beiläufig über den Busen. Sie rang sich durch, das als Missgeschick zu deuten. Bei nächster Gelegenheit wiederholte er es jedoch und sagte: »Heute bleiben Sie länger, ich habe noch für Sie zu tun.« Dass sie Keeling daraufhin meldete, bezahlte sie mit sechs Wochen Küchendienst, der niedersten Arbeit in Ritchie. Doch Paula formte zwei Brüste aus Karamellpudding, garnierte sie mit kandierten Kirschen und servierte sie Keeling in der Messe, wo er puterrot anlief, während die Männer ihn anstarrten und sie sich hocherhobenen Kopfes abwandte. Sie wurde nie wieder angefasst.
In Mailand hatte sich auch Stunden später noch keiner um sie gekümmert. Sie lief durch das Camp, ein riesiges Schlammloch, in dem es nicht eine ruhige Ecke gab. Alles war in Bewegung, peitschte, stampfte, walzte, wogte. Dennoch nutzte jeder die kleinste Gelegenheit, irgendwo niederzusinken, die Augen zu schließen, und sei es für Sekunden. Einer hing schief auf einer Munitionskiste; das Gesicht zuckte in einem dunklen Traum. In seinem Schoß lag ein aufgeweichtes Yank-Heft mit einem Bill-Mauldin-Cartoon. Zwei GIs kauerten im Schützengraben, bis zur Brust in einer trüben Brühe, über ihnen Flakgewitter und der Text: Ich wollte, ich könnte mich hinstellen und schlafen.
Sie sah viele südländisch aussehende Soldaten, die in einer gutturalen, weichen Sprache redeten, und rätselte, wo sie herstammen mochten, bis sie auf einem der großen Zelte Força Expedicionária Brasileira las. Darunter Fotos von Kameraden, Gefallenen, derer sie gedachten. Zwischen Panzern wuschen Männer Socken und Unterwäsche in Stahlhelmen. Sie hatten offene Feuer entzündet, über denen sie Stiefel und Gamaschen trockneten. Manche warfen Konservendosen in die Flammen und pulten sie mit Bajonetten wieder raus, aßen alles mit den Fingern, selbst irgendeinen Brei.
In Ritchie hatte sie Berichte gelesen, sich vom Kriegsverlauf ein Bild verschaffen können. Sie wusste von der Tragödie an Omaha Beach, dem zähen Stellungskampf in Frankreich, der geglückten Luftlandeoperation in Holland. Von Rückschlägen wie Triumphen. Doch hier, in diesem Camp der 5. Armee, an dessen Lazarettzelt Sorrow Fields geschrieben stand, sah sie Männer, die vor wenigen Jahren noch Eishockey und Baseball gespielt hatten und über Nacht zu Greisen geworden waren.
In einem entfernten Winkel waren die Käfige, mit Stacheldraht umzäunte Gehege, in denen Faschisten verhört wurden, Schwarzhemden und Kollaborateure. Viele von ihnen hatten zerschlagene Gesichter, nicht einen Zahn mehr im Mund. Ein alter Mann war darunter, die Brille zerbrochen, die Nase nur noch ein Huckel. Ein Lieutenant fuchtelte mit seiner Hundemarke vor ihm herum und schrie: »Sieh dir das genau an, du Drecksack! Das H steht für Hebräisch! Ich werde auf Mussolinis Asche tanzen, und dich liefern wir morgen den Partisanen aus, damit sie Brennholz aus dir machen!«
Bei Einbruch der Dämmerung merkte sie den Hunger, aber ekelte sich davor zu essen. Roosevelt war gestorben, ohne die Leiche von Hitler gesehen zu haben. Ein weiterer Beweis, dass Gott nicht existierte.
Sie ging ins Zelt, legte sich hin und wurde entsetzlich traurig, weil sie spürte, wie verloren sie seit Genua war. Sie sehnte den Schlaf herbei und war schon im Traum. Vor ihr kniete der Landser. Er hatte Georgs Gesicht und flehte sie an, ihn nicht zu töten. »Ich hatte einmal eine Liebste«, beschwor er Paula unter Tränen. »Sie sah genauso aus wie du. Warte, ich zeige dir ein Foto.« Er griff an die Brusttasche, und Paula schoss ihm ohne Zögern in den Kopf. Sie durchsuchte seine Sachen, fand das Foto. Betrachtete ihr Konterfei. Schmiss es weg.
Morgens setzte sich in der Messe ein Major zu ihr. »Walton Hyde. Ich hoffe, Sie haben sich eingelebt.«
»Sir?« fragte sie.
»Walt. Ich bin vom CIC, dort sind wir nicht so förmlich. Sie sind ein Ritchie Girl, Paula, also wissen Sie, was das Z ist.«
»Counter Intelligence Corps, der Geheimdienst der Army.«
»Aus Ritchie schicken sie gute Leute«, sagte er. »Ich hatte in Le Havre mit einem Stefan Heym zu tun; ist beim Second Mobile Radio, schreibt glänzende Flugblätter.« Er legte Pathos in seine Stimme. »Deutscher, wofür kämpfst Du noch? Der Starke muss die Wahrheit nicht fürchten!« Er lachte auf. »Dieser Heym hätte es weit bringen können, ein Jammer, dass er Kommunist ist. Kennen Sie ihn?«
»Flüchtig.« Paula dachte an den Abend zurück, an dem im Campkino Hostages gezeigt worden war, die Verfilmung seines ersten Romans. Heym musste damals stolz gewesen sein, aufgeregt. Doch nichts davon hatte man ihm angesehen. Er war in sich gekehrt, still wie immer. Am Schluss war er vor die Leinwand getreten und hatte erklärt: »Ich bitte euch zu vergessen, dass ich jemals hier stand, denn in einer Armee gibt es nichts Unangenehmeres als eine Sonderrolle.« Von seiner allerersten Stunde an hatte er kein Hehl daraus gemacht, Kommunist zu sein. Sowas war wohl nur in Camp Ritchie, Maryland, möglich, Ausbildungsstätte für Propaganda und psychologische Kriegsführung, Labyrinth versprengter Seelen, Babylon von Flüchtlingen aus aller Herren Länder, unter ihnen Dichter, Gelehrte, Philosophen. Einmal hatten sie und Heym über Deutschland gesprochen. Wie es wohl sein würde, sollten sie jemals zurückkehren. »Gott beschloss, Sodom und Gomorrha wegen ihrer Sünden gänzlich zu vernichten«, hatte Heym gesagt. »Doch er versprach Abraham, wenigstens Sodom zu verschonen, wenn es dort zehn wahrhaftige Menschen gäbe. Denkst du, dass sich zehn in Deutschland finden, Paula?«
Sie schob ihr Tablett weg. »Keinen Hunger?« fragte Hyde.
Paula schüttelte den Kopf.
»Kenne ich«, sagte er, schnappte sich ihren Teller und ließ sich die kalten Rühreier schmecken. Er war Mitte dreißig, der rotblonde Schnäuzer so sauber gestutzt wie eine Buchsbaumhecke. Hyde lächelte Paula an, als sei sie ein kleiner Hund oder ein niedliches Baby. Fraglos hätte er ihr Gewicht aufs Gramm genau nennen können, dazu ihre Körbchengröße und ihr Eau de Cologne. Sollte Hyde behaupten, noch Junggeselle zu sein, würde sie ihm kein Wort glauben.
»Sind Sie Sam Yaeger begegnet?« fragte Paula. »Er müsste auch in Frankreich gewesen sein; groß, hager, um die dreißig, schon mit grauen Haaren.«
»Kann mich nicht erinnern«, entgegnete er. »Aber sollten Sie in diesem Krieg einen Mann ohne graue Haare finden, ist er keine Woche hier.« Er schob ihr das Deckblatt einer Akte zu. »Mit dem da werden wir es zu tun bekommen.«
Subjekt: SS Colonel Walther Rauff
Alter: etwa vierzig
Mittelgross, schlank, blond, dunkle Augen
Sprachen: Deutsch, schlechtes Englisch
»Mailand ist gefallen«, bemerkte Hyde. »Aber von Spähtrupps abgesehen, haben wir noch keinen Fuß ins Stadtgebiet gesetzt. Mit zweihundert SS-Männern hat Rauff sich in einem Hotel verschanzt, dem Regina, jetzt Hauptquartier der Gestapo. Die Partisanen haben es umstellt. Rauff will mit uns verhandeln.«
»Sir, warum …«
»Walt.«
»Walt, warum hat man es nicht einfach gestürmt?«
»Die Situation ist kompliziert. Auch wenn die Rebellen versichert haben, sich nach dem Einrücken der Army in Mailand unserer Kontrolle zu unterstellen, ist fraglich, ob sie das wirklich tun werden. Das haben sie erst gestern bewiesen.« Er sah Paulas Blick. »Nicht gehört? Man hat den Duce, seine Geliebte und drei ihrer Begleiter am Comer See hingerichtet. Obwohl wir darauf bestanden hatten, dass Mussolini an uns übergeben wird.« Hyde schaufelte kalten Speck in sich hinein, redete mit vollem Mund. »So wichtig die Resistenza für den Feldzug war, nun müssen wir sie kujonieren, um den Kommunisten keinen Einfluss auf die künftige Regierung zu erlauben. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, hätten wir schneller nach Norden vordringen können, aber es gibt in Washington nicht Wenige, die darauf gebaut haben, dass die Deutschen mit den Partisanen kurzen Prozess machen. Na, wie finden Sie das?«
Paula schwieg.
»Ich heiße es auch nicht gut und stelle es nur fest. Wie dem auch sei: Wir müssen Stärke zeigen. Das Oberkommando legt Wert darauf, dass Rauff sich uns ergibt, keinem anderen. Übermorgen ist die offizielle Übergabe der Stadt. Dann wird Chief Crittenberger sich mit Cadorna, dem Anführer der Befreiungsarmee, fotografieren lassen; bis dahin muss alles in trockenen Tüchern sein. Und Sie dolmetschen bei Rauff für mich.« Hyde lächelte über ihre Verblüffung, dass er so offen mit ihr sprach. »Sie werden verschwiegen damit umgehen. Davon abgesehen ist Rauff ein äußerst gefährlicher Mann. Sie sollen wissen, mit wem wir es zu tun bekommen und was auf dem Spiel steht.«
»Wieso haben Sie sich die Mühe gemacht, mich aus Genua holen zu lassen? Sicher ist Ihnen bekannt, dass ich über keine Erfahrung mit solchen Verhandlungen verfüge.«
»Wir hatten dreizehn Deutsch-Übersetzer«, antwortete er. »Dummerweise hat es einer B-17 vor drei Tagen gefallen, eine Zweihundertfünfzig-Pfund-Bombe direkt über deren Zelt zu verlieren. Auch wenn es Ihnen nicht schmeichelt, Paula: Sonst steht im Moment niemand zur Verfügung.«
»Warum wurde der Geheimdienst mit Rauff betraut?« Fast kam es ihr schon normal vor, solche Fragen stellen zu dürfen.
»Er ist in Oberitalien Chef des SD, des Sicherheitsdienstes der SS; dem Nazi-Pendant zum CIC, wenn Sie so wollen. Das macht uns zu seinem natürlichen Ansprechpartner.«
Hyde entschuldigte sich kurz. Als er wiederkam, sah sie ihn zu ihrer Verwunderung in der Uniform eines Colonels. »Wir haben es mit einem Standartenführer zu tun«, sagte er. »Man kann mit keinem Offizier Verhandlungen führen, wenn man im Rang unter ihm steht. Das ist bei den Jerrys nicht anders als bei uns.« Grinsend legte er nach: »Außerdem kleidet mich der Zwirn.«
Bella Ciao
Sie brachen sofort auf. Paula, Hyde und ein Corporal, der aus Sizilien stammte und bei den Partisanen übersetzen sollte. Er war so klein wie dick; seine Glubschaugen hätten Peter Lorre blass aussehen lassen. Hyde hatte ihn als »Sal« vorgestellt, ihr den Nachnamen nicht genannt. Harvey Fritz Davis fuhr den Jeep, das beruhigte Paula ein wenig. Auf den fünf Lastern, die ihnen folgten, hockten zweihundert Infanteristen. Sie sollten Rauffs Männer entwaffnen und beim Abzug bewachen.
Einst musste die Stadt eine wahre Schönheit gewesen sein. Aber eine gigantische Faust hatte ganze Häuserblöcke herausgerissen, sie zu Splitt, Kies, Sand zerrieben und alles verstreut. Mailand, Geburtsstadt des Faschismus, war ein Stillleben von Braque. Keine Form passte mehr auf die andere, alle Geraden waren gekappt, nur noch zerstörte Geometrie.
Ab und an ferne Schüsse, Schreie, einmal Geschützdonner. Aus manchen Straßen waren alle Pflastersteine verschwunden. An Mauern sah Paula Parolen. »Tod den Schwarzhemden!« übersetzte Sal eine. Und gleich danach: »Rotes Gesindel verrecke!«
Verlumpte Fahnen beider Seiten lagen im Dreck, tote Gäule, tote Menschen, tote Materie. Ein Bus überholte ihren Jeep mit schrillem Hupen, schwarz vom Ruß, die Fenster leere Höhlen. Männer saßen auf dem Dach und schmetterten das Lied, das Paula schon im Hafen von Genua gehört hatte.
»Was ist das für ein Lied?« fragte sie Sal.
»Bella Ciao«, erwiderte er. »O Schöne, ciao, Schöne, ciao! Dies ist die Blume des Partisanen, der für die Freiheit starb!«
Sie kamen in die Innenstadt und fanden sich unvermittelt auf einer noblen Allee wieder, die ganz heil war, kein Braque mehr, jetzt ein Liebermann, ein Ort wie aus der Zeit gefallen, vom Krieg vergessen, mit feinen Geschäften, deren Auslagen aussahen, als wäre bloß Mittagspause. Es hätte genauso Paris sein können, wo Paula sich hinträumte, ohne es zu wollen, in diese Flitterwoche mit Georg, die sie sich ausgemalt hatte, als sie in ihrem schönsten Kleid vor dem Spiegel stand und ihre Verabredung im Bristol nicht erwarten konnte, ihr Herz eine Spieluhr mit einer irrsinnig schnellen, niemals zuvor gehörten Melodie, weil sie sicher war, dass Georg ihr an diesem Abend sagen würde, dass er sie liebte.
Hyde tippte Paula an. Neben einem Kiosk, der Postkarten, Zeitschriften und Souvenirs feilbot, saß eine Frau auf einem Stuhl, adrett frisiert und gekleidet, wieder ein Riss in der Zeit. Zwei Schritte von ihr entfernt lag ein Wehrmachtsoffizier, in der Stirn ein schartiges Einschussloch, in der Hand noch ein deutsches Journal. Der Jeep fuhr langsam. Die Frau stand auf, entwand dem Toten das Blatt und bot es ihnen strahlend an.
Wenig später ragte, nicht einmal einen Windstoß weit weg, der Dom hoch. Er hatte, einem Wunder gleich, den Angriffen getrotzt, aber eine der zarten Fialen neigte sich wie ein Halm, als ducke sie sich noch immer vor dem Bombenhagel.
Davis hielt an einer Straßensperre der Partisanen. Ein Stück die Straße hinunter sah Paula das Hotel Regina; Belle-Epoque, mit Stahlreitern und Sandsäcken armiert.
Hyde bedeutete ihr, im Jeep zu bleiben. Er ging mit Sal zu dem Anführer der Partisanen, einem vierschrötigen Burschen, der Hyde beäugte und jedes Wort sorgfältig kaute, ohne den Finger vom Abzug seiner Maschinenpistole zu nehmen. Davis ließ den Mann nicht aus den Augen. Er steckte sich eine Old Gold zwischen die dünnen Lippen. Es schien, als würde er den Rauch nicht ausstoßen, gar nicht atmen.
Als der Vierschrötige vor seinen gut zweihundert Männern eine zotige Geste machte, die sie zum Grölen brachte, wusste Paula, dass es hier nichts zu übersetzen geben würde.
Davis legte den Rückwärtsgang ein. »Ich hab Kerle wie die schon mal so lachen sehen«, presste er durch die Zähne.
Hyde befahl den Infanteristen den Rückzug und kam mit Sal zum Jeep zurück. »Mein neuer Freund Alessandro möchte, dass wir einen kleinen Ausflug machen.«
Als der Partisanenführer mit sechs seiner Männer in einem Fiat losfuhr, wurde Davis von Hyde aufgefordert zu folgen.
»Was bedeutet das?« fragte Paula.
»Er hat mir mitgeteilt, das Mussolini und seine Hure Petacci von Italienern gerichtet werden mussten, das habe die Würde seines Volkes verlangt. Und wir sollen es als Vertreter der US-Armee mit einem symbolischen Akt anerkennen.«
»Ich verstehe nicht«, antwortete Paula.
»Wir fahren zum Piazzale Loreto«, sagte Sal. »Dort haben die Nazis im letzten August fünfzehn Geiseln erschossen.«
Anfangs kamen sie zügig voran, dann füllte die Straße sich mit immer mehr Menschen, ein Strom, der sich in gleißender Sonne nach Norden ergoss und ein Weiterfahren unmöglich machte. Tausendfache Rufe hallten in den Häuserschluchten wider, Gesänge, Schüsse, Schreie. Alessandro und seine Leute ließen das Auto stehen und glitten in die Drift, ohne sich um die Amerikaner zu kümmern. Hyde hieß Davis zurückzubleiben; er zog Paula mit sich, Sal im Schlepptau. Sie rannten, bis sie Alessandro eingeholt hatten. Männer stolzierten an ihrer Seite, ihre Anzüge schmutzstarrend, jedoch von modischem Schnitt. Paula sah Krawattennadeln, gar Einstecktücher. Einer hatte einen perfekten Knick im Borsalino, als wollte er in die Scala. Sie mochten Krämer, Apotheker, Professoren gewesen sein, aber nun waren sie Freiheitskämpfer und trugen über der Brust gekreuzte Patronengurte wie Westernhelden.
In einer Einfahrt sah Paula junge Kerle, die mit Holzlatten auf einen Mann eindroschen, sah ihn zu Boden sinken, seinen Schädel aufplatzen. Niemand nahm davon Notiz, außer einem Mädchen mit fröhlichen Zöpfen, das neben Paula an der Hand der Mutter giggelte.
Sie geriet aus dem Tritt, doch Sal zischte ihr zu: »Das ist ein Kollaborateur, wagen Sie nicht, ihm zu helfen.«
Eine Frau lachte sie an. Als wäre es nichts, hatte sie ein MG geschultert, mit dem zwei Soldaten ihre Mühe gehabt hätten. Sie lachte selbst dann noch, als alle Schritte auf das Pflaster zu trommeln begannen und aus dem Marsch ein Taumel wurde.
Immer neue Menschen strömten herbei und schlossen sich ihnen an, wurden von der Flut mitgerissen, die der Boulevard kaum noch zu fassen vermochte. Paula glaubte zu ersticken, um sie war eiskalte Luft. Sie spürte die gleiche qualvolle Enge wie im Bauch des Schiffs, war nur noch schlingernder Spielball einer mächtigen Woge aus Rausch und Hass und der Sehnsucht nach Erlösung. Dankbar merkte sie, dass Hyde ihre Schulter umfasste, damit sie nicht getrennt wurden.
Bald hob ein Donnern an, das wie die Niagarafälle klang, an dem Tag, als sie auf diesem Aussichtsdampfer gestanden hatte und der Kapitän so nah herangefahren war, dass die Gischt sie am ganzen Körper durchnässte.
Irgendwo vor ihnen war die Welle auf ein Hindernis gestoßen und staute sich. Alles kochte und brodelte auf der Stelle. Alessandro schoss mit seiner Maschinenpistole zwei Salven in die Luft. Paula fühlte den gewaltigen Sog der Menschensee, in der sie nur ein Tropfen war. Sie schwamm mit Hyde und Sal weiter, trieb Alessandros Männern hinterher, die mit Schüssen und Fäusten eine Furt bahnten. Wie durch einen Flor ahnte sie dann, dass sie auf einem riesigen Platz war, pechschwarz von Menschen. Manche waren auf Laternenmasten geklettert, um besser sehen zu können, andere standen auf Karren, Inseln in einem Strom aus Zorn und Entzücken, gegen die Menschenbrecher mit derartiger Wucht prallten, dass sie die Karren umrissen, alles fortspülten. Direkt vor Paula ging eine Frau unter und streckte in Todesangst die Hand nach ihr aus, ihr Blick ein einziges Flehen. Für eine Ewigkeit, und doch nur ein Blinzeln, war sie mit dieser Frau allein, das Brausen und Tosen nichts als fernes Wispern. Paula wollte die Hand greifen, berührte sie beinahe mit den Fingerspitzen, aber wurde fortgeschwemmt und sah die Woge noch über dem Bündel zusammenschlagen, es verschlingen. Sal hatten sie längst in der See verloren. Paula schrie Hyde an, sie wegzuschaffen, so laut, dass ihre Stimme trotz des Infernos in den Ohren hallte, doch er umklammerte sie bloß noch fester, auch in seinen Augen blanke Angst, weil nirgends ein Ausweg war.
Plötzlich sah Paula an einer Holzwand Fotos, Totenbilder, die Opfer der Hinrichtungen aus dem August, an dieser Stelle erschossen, ein Altar, den die Woge verschonte, um ihn nicht zu entweihen. Menschen knieten davor nieder. Sie bekreuzigten sich, beteten, küssten den Boden.
Dann erblickte sie die fünf Leichen, direkt vor ihr.
Im ersten Moment hätte sie unmöglich sagen können, ob es Männer oder Frauen waren, die da lagen, ihre Gesichter grausam entstellt, klumpiges blaues und grünes Fleisch. Bis sie ein Kleid sah. Clara Petacci. Neben ihr Mussolini. Der Mund war offen, in seiner starren Hand steckte eine Art Feldherrenstab, den man ihm zum Hohn beigegeben hatte. Aus dem rasierten Schädel fraß sich das rechte offene Auge, noch im Tod fiebrig.
Männer mit Waffen bildeten einen Ring, hatten sich untergehakt, stemmten sich gegen die unerbittliche Brandung aus Hass. Ein unnützes Unterfangen bei den Tausenden, die mit solcher Macht walzten, dass der Kordon gesprengt wurde und die Männer in Panik den Feuerwehrleuten zuwinkten, die mit Löschwagen vor einer Tankstelle standen.
Paula sah Menschen die Leichen treten, mit Messern auf sie einstechen, sie schlagen, bespucken, hörte sie die Namen von Kindern, Müttern, Vätern rufen, Mussolini gellend verfluchen, als könnte der es noch hören. Aus den Feuerwehrschläuchen schossen harte Wasserstrahlen auf die Dünung aus Menschen, trieben Paula mit all den anderen zuckenden Leibern von den Leichen weg. Die heulende See zog sich zurück, um abermals zur Flut zu werden, noch gewaltiger als zuvor, und Paula dann vor Mussolinis Visage zu Boden zu werfen.
Sie wusste wieder, wie sie 1934 in den Prater-Lichtspielen eine Wochenschau mit Bildern von Hitlers Besuch in Venedig gesehen hatte. Begrüßung durch Mussolini auf dem Flughafen, der Führer verdruckst wie ein Lakai, vor dem großen Vorbild schüchtern seinen Hut knetend; Fahrt im Vaporetto über den Canal Grande, Mussolini leger in Feldgrau, Hitler unpassend im verknitterten Mantel, ein Zauberlehrling und sein Meister, nur wenige Jahre bevor er die Welt verschlang und Mussolini zu seinem Hofnarren machte und Paula alles nahm, weil der, dessen Fratze sie hier anglotzte, ihm den Weg gewiesen hatte.
Es war gänzlich unmöglich, diese Gedanken innerhalb von Wimpernschlägen zu haben, all diese Bilder zu sehen, doch als Hyde sie hochzerrte, standen sie so deutlich vor ihren Augen, dass sie sich von ihm losriss und auf Mussolinis Leiche eintrat und schrie, schrie, schrie, bis Tränen aus ihr herausschossen.
Alle Zeit hatte sich aufgelöst, war nichts mehr in dem Hades, der Paula verschlang, als die Leichen am Dach der Tankstelle kopfüber hochgezogen wurden und sich ein Schrei aus tausenden Kehlen rang, der ihren Schrei aufnahm und Paula zittern, schluchzen, glühen ließ, wie zuvor nur einmal, auf der Straße vor dem Bristol, in der Nacht, als sie ihr Glück wegwarf.
Atmen, träumen
Über das Geschehene hatten sie kein Wort gesprochen; nicht auf der Fahrt zurück ins Feldlager, nicht als sie dort auseinandergingen. Hyde hatte sie nur knapp gebeten, abends um acht für eine Besprechung zu ihm zu kommen. Paula fiel dumpf auf die Pritsche. Sie fühlte keine Genugtuung, keine Trauer, nicht einmal Erschöpfung. Gar nichts.
Hyde besaß ein Zelt für sich allein. Als Paula kam, schenkte er Whisky in zwei Blechtassen und warf Eiswürfel hinein. Er hielt ihr eine Tasse hin. Sie schüttelte den Kopf.
»Ich habe unseren Quartiermeister mit einem Monatssold bestochen, um das Eis zu kriegen«, sagte er. »Soll ich mich für nichts ruiniert haben?« Hyde wies auf einen Klappstuhl. Als sie sich gesetzt hatte, prostete er Paula zu. »Und – hat es sich gut angefühlt, den Hurensohn zu treten?«
»Ja.«
»Hätt’s vielleicht auch tun sollen.«
»Sie hatten genauso viel Angst wie ich«, sagte sie.
»Ich habe schon oft Angst gehabt. Und heute war bestimmt nicht das letzte Mal.«
Draußen dröhnten noch immer Motoren, hallten Rufe; das Camp kam nie zur Ruhe.
»Was ist mit Rauff?« fragte Paula.
»Morgen früh um zehn.«
»Sicher wissen Sie viel mehr über ihn als das bisschen, was Sie mir erzählt haben«, sagte sie. »Dürfen Sie mit mir darüber sprechen?«
»Nein, aber ich tu’s. 42 war er in Tunesien; seinen genauen Auftrag kennen wir nicht. Gesichert ist, dass er den Juden auf Djerba hundert Pfund Gold abgepresst hat. Ab September 43 war Rauff in Norditalien für die Bekämpfung von Partisanen verantwortlich. Die Hinrichtungen der Geiseln auf der Piazza waren auf seinen Befehl erfolgt. ›Sühnemaßnahme‹ nannte er das. Jeder in Mailand kennt das Regina. Es hat über zweihundert Zimmer, etliche haben als Folterzellen gedient.«
»Mit so jemandem wollen Sie verhandeln? Worüber?«
»Das ist eine sehr gute Frage«, antwortete Hyde bedächtig. »Auf die ich wirklich nicht antworten darf. Sagen wir es so: Er scheint ein vorausblickender Mann zu sein. Als absehbar war, dass wir Mailand einnehmen würden, hatte Rauff den Befehl, die Wasserkraftwerke in Norditalien zu sprengen, tat es aber nicht. Er war in Geheimverhandlungen eingeweiht, die Karl Wolff, sein unmittelbarer Vorgesetzter und Oberbefehlshaber der SS in ganz Italien, mit dem Vatikan geführt hat.«
»Mit welchem Ziel?« fragte Paula.
»Das wissen wir nicht. Fest steht, dass die Bedingungen für inhaftierte Priester verbessert wurden. In einigen Fällen sind sie dem Vatikan übergeben worden.«
Sie schwieg einen Moment. »Das macht doch nicht gut, was Rauff vorher getan hat«, sagte sie dann.
»Nein. Aber interessant ist es allemal.« Er lächelte. »Keine Sorge, Paula, in Bezug auf Rauff habe ich keinerlei Illusionen. Um mit Roosevelt zu sprechen: Einen Tiger zähmt man nicht durch Streicheln. Kürzlich hat Rauff im Regina noch eine Feier zum Geburtstag des Führers ausgerichtet. Obwohl die Russen schon in Berlin sind und Hitler sich in irgendeinem Loch verkrochen hat. Nebenbei war Rauff unseres Wissens der letzte Deutsche, der Mussolini lebend gesehen hat. Es gibt ein Foto davon. Die zwei wirken wie beste Freunde.«
»Worauf muss ich morgen achten?« fragte Paula.
»Wichtig ist, dass Sie alles möglichst wörtlich wiedergeben. Lassen Sie Rauff einen Gedanken zu Ende bringen, bevor Sie übersetzen; es sei denn, er wird überheblich. Das ist alles.«
Paula stellte die Whiskytasse ab. »Wenn es nichts mehr zu besprechen gibt, möchte ich mich gern zurückziehen.« Als die Antwort ausblieb, stand sie auf.
»Ich bin über Ihren Nachnamen gestolpert«, meinte Hyde. »Sind Sie mit den Washingtoner Blooms verwandt?«
»Die Familie meines Vaters«, erwiderte sie steif.
Sie dachte an den Marmorpalast am Kalorama Circle; an die Teller aus massivem Gold, auf denen selbst das Frühstück serviert wurde. Das hätte Paula den Blooms nachgesehen. Nicht jedoch die kalte Verachtung, mit der sie ihre Mutter straften, eine Frau, die Schneiderin in einem Maßatelier gewesen war, als sie Paulas Vater begegnete. Dass er sich ihretwegen von der Familie losgesagt hatte, nahm Paula bis heute für ihn ein.
»Dann sind Sie reich?« fragte Hyde.
Sie hoffte, dass ihr Lächeln souverän wirkte. »Nein, fürchte ich. Wir haben keinen Kontakt.«
»Wie kam es, dass Sie in Berlin aufgewachsen sind?«
Spätestens jetzt hätte Paula nicht mehr antworten müssen. Doch sie setzte sich wieder. »Mein Vater hat vor dem Ersten Weltkrieg meine Mutter dort kennengelernt.«
»Was hat er beruflich gemacht?«
Im Grunde hatte sie ihn niemals arbeiten sehen. Als kleines Mädchen fragte sie ihn einmal, was er in diese blauen Kladden schrieb, die er in seinem Wandtresor im Salon verschloss. Er sagte, dass er helfe, amerikanisches Geld im Reich zu vermehren, und sich dazu Notizen mache. Wie enttäuscht sie war. Im Stillen hatte Paula sich ihren Vater als Schriftsteller vorgestellt und gedacht, dass die wundervollsten Geschichten in seinen Kladden stünden. Er konnte hemmungslos albern sein. Dann tagelang ein Fremder.
»In den Zwanzigerjahren hatte er die Berliner Dependance einer amerikanischen Werbeagentur geleitet. Später vertrat er einige US-Konzerne in Deutschland«, sagte Paula.
Mit Geschäftspartnern traf er sich in Restaurants wie dem Horcher oder auch im Quartier Latin. Er hatte kein Büro, kein Arbeitszimmer in der Grunewaldvilla, wo sie aus ihrem Fenster den Hundekehlesee sah. Den alten Baum mit der Schaukel, auf der sie bis zum Mond flog. Aber auch den Wald, vor dem Paula sich gefürchtet hatte, als sie klein war. Ihr Vater lachte sie deswegen aus; in ihrer Kindheit wusste er noch nicht, was Angst war. Wenn in der Nacht die Schatten übern See kamen, floh sie in das Bett ihrer Gouvernante. Henriette war bereits betagt und roch etwas muffig, aber Paula hing sehr an ihr und besuchte sie noch auf ihrem Altenteil.
Das war der Krieg vor allem: die Frage nach dem Schicksal derer, die sie hatte zurücklassen müssen. Diese Ungewissheit, die sie aß, trank, atmete, träumte.
Ihre Berliner Großeltern waren trotzige Sozialdemokraten, der Opa Schweißer bei Siemens. Paula hatte alles versucht, sie zum Mitkommen zu bewegen, aber sie wollten nicht. »Hitler muss gehen, nicht wir«, hatte der Großvater gesagt. Von den beiden war Paula nur der Abschiedskuss geblieben, die letzte Umarmung, die sie in der Dunkelheit noch spürte. Ein Hauch von Rasierwasser, Pitralon, ein Koffer mit Gebeten.
»Paula?«
»Entschuldigung – was sagten Sie?«
»Dass Ihr Vater sicher gute Kontakte hatte.«
Sie nahm den Unterton wahr, antwortete nicht gleich.
Er kannte tout Berlin, darunter viele Adlige, die den Nazis die Stiefel leckten. Mit Preußenprinz August Wilhelm, immer in vollem SA-Wichs, war er per Du. Damals hatte Paula nicht verstanden, warum ihr Vater sich mit diesem Pack abgab. Und mit Männern wie von Ribbentrop, dem Sekthändler, der sich seinen Adelstitel gekauft und 1938 das Münchner Abkommen ausgehandelt hatte. Mit Albert Speer. Mit Wirtschaftsminister und Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht, dem Finanzgenie hinter Hitlers Aufrüstung.
Wenige waren Paula so zuwider gewesen; als Kind nannte sie Schacht nur Dachs, weil er wie einer aussah, bloß mit Brille. Seiner fetten Frau hatte er ein brillantenbesetztes Hakenkreuz geschenkt, das sie auf Empfängen über dem Busen trug.
Von alldem hätte Paula Hyde erzählen können; stattdessen sagte sie: »Bei uns waren alle möglichen Leute zu Gesellschaften und Tees, sogar ein russischer Revolutionär, Ilja Ehrenburg. Aber vor allem Amerikaner. Randolph Hearst, Thomas Wolfe, Charles Lindbergh, Allen Dulles.«
Den letzten Namen ließ sie bewusst fallen, um die Reaktion zu beobachten. Er goss zwei Finger breit Whisky nach. »Dulles ist mittlerweile beim OSS, dem Nachrichtendienst des Kriegsministeriums, also der Konkurrenz«, erwähnte er beiläufig.
Paula zauberte Überraschung in ihr Gesicht.
»Er steht ihrer Residentur in Bern vor, eine Anlaufstelle für Naziüberläufer. Man prophezeit ihm eine glänzende Zukunft, so wie auch seinem Bruder John Foster Dulles, der New Yorks größte Wirtschaftskanzlei leitet und von manchen bereits als künftiger Außenminister gehandelt wird.« Hyde schien nicht gewillt, das Thema zu vertiefen. »Wie war Lindbergh denn?«
»Er kam 36 zu einem Essen. Ich hörte ihn mit vollem Mund zu seiner Tischdame sagen: ›Die amerikanischen Juden haben dermaßen viel Besitz angehäuft, dass man es eine feindliche Übernahme nennen muss. Sie kontrollieren alles: Film, Presse, die Wirtschaft und die Regierung.‹ Dass er das Wetter ausließ, sehe ich ihm nach.«
»Trug er dabei auch das drei Pfund schwere Verdienstkreuz, das Hitler ihm verliehen hatte?« fragte Hyde.
»Nein. Vielleicht aus Angst, es könnte in die Suppe fallen.«
Hyde lachte auf. »Für Landsleute wie Lindbergh muss man sich schämen. Später hat er sich sogar noch dreister geäußert. Sie werden sich an das ein oder andere erinnern.«
»Sie meinen, dass die Juden Kriegstreiber wären?«