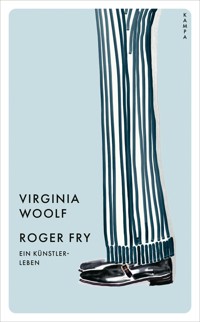
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Biographie des Londoner Malers und Kunstkritikers Roger Fry ist Virginia Woolfs letztes Buch, veröffentlicht ein Jahr vor ihrem Tod. Dass sie es schrieb, war Frys ausdrücklicher Wunsch: Ihr Leben lang hatte die Schriftstellerin sich nicht nur literarisch – etwa in der fiktiven Biographie Orlando und in Flush, der Lebensgeschichte eines Cocker spaniels –, sondern auch in Essays mit der Frage auseinandergesetzt, wie man über das Leben eines Menschen schreiben könne. Ihr Freund Roger Fry schlug ihr vor, ihre Überlegungen an seiner Biographie auszuprobieren. Entstanden ist das Porträt einer der prägendsten Figuren der avantgardistischen Bloomsbury-Group: Mit der Ausstellung Manet und die Postimpressionisten in den Londoner Grafton Galleries, die 1910 einen Skandal auslöste, läutete Fry die Klassische Moderne in England ein. Fry, der eine Zeit lang Kurator des New Yorker Metropolitan Museum war, gilt bis heute als Schlüsselfigur der Kunstgeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Virginia Woolf
Roger Fry
Ein Künstlerleben
Aus dem Englischen und mit Anmerkungen, Zeittafel und Auswahlbibliographie von Hans-Christian Oeser
Kampa
Statt eines GeleitwortsEin Brief von Margery Fry
LONDON, April 1940
LIEBEVIRGINIA,
vor Jahren, nach einer jener Diskussionen über die Methoden der Kunst, die seine lange und glückliche Freundschaft mit Ihnen prägten, schlug Roger halb im Ernst vor, Sie sollten Ihre Theorien über das Handwerk des Biographen mit einem Porträt von ihm in die Praxis umsetzen. Als der Zeitpunkt kam, sein Leben zu schildern, baten einige von uns, die ihm sehr nahegestanden haben, Sie darum, seine Biographie in Angriff zu nehmen. Es wäre sein Wunsch gewesen, ebenso wie es der unsrige war.
Ich habe gebeten, diese Seite zur Verfügung gestellt zu bekommen, um unsere Dankbarkeit dafür auszudrücken, dass Sie eine weder geringfügige noch mühefreie Auftragsarbeit zum Abschluss gebracht haben. Da das Buch kein förmliches Geleitwort haben wird, darf ich wie Sie all denen, die die Verwendung von Briefen und Fotos in ihrem Besitz genehmigt haben, unseren Dank abstatten.
MARGERYFRY
Erstes KapitelKindheit und Schule
I
»Die ersten sechs Jahre meines Lebens habe ich indem kleinen, aus dem 18. Jahrhundert stammenden Haus Nr. 6 in The Grove, Highgate, verbracht. Für mich ist der Garten bis heute die gedachte Folie nahezu jeder Gartenszene, von der ich in Büchern lese.« So begann Roger Fry das Fragment seiner Autobiographie. Vielleicht sollten wir einen Augenblick auf der Schwelle jenes kleinen Hauses in Highgate verweilen und uns fragen, was wir über Roger Fry in Erfahrung bringen können, bevor er sich sowohl der Schlange innewurde, die sich »von der Astgabel eines eigentümlich verkümmerten und rußbeschmutzten alten Apfelbaums« herabbog, als auch der »großen roten Feuermohnblumen, die durch einen gesegneten Zufall« in seinem »privaten und besonderen Garten« wuchsen.
Roger Fry wurde am 14. Dezember 1866 als zweiter Sohn von Edward Fry und Mariabella, der Tochter des Thomas Hodgkin, geboren. Beide waren Quäker. Hinter Roger standen väterlicherseits acht erfasste Generationen von Frys, beginnend mit Zephaniah, dem Ersten, der Quäker wurde und in dessen Haus in Wiltshire George Fox[1] »eine gesegnete und ruhige Versammlung abhielt, obwohl die Konstabler beabsichtigt hatten, diese aufzulösen, und zu diesem Zweck bereits unterwegs waren. Doch noch bevor sie eintrafen, wurde ihnen gemeldet, in ein Haus seien Diebe eingebrochen, und so mussten sie schleunigst kehrtmachen.« Das war 1663, und von da an hielten die Frys dem Quäkerglauben die Treue und befolgten in Meinung und Kleidung gewisse ausgeprägte Besonderheiten, für die sie anfangs Verfolgung erlitten. Der Erste von ihnen, Zephaniah, saß drei Monate im Gefängnis, weil er sich weigerte, den Treueid zu leisten. Im Laufe der Zeit wurden die Verfolgungen weniger; die Frys hatten nichts Schlimmeres zu ertragen als »Hohn und Kälte seitens ihrer eigenen Klasse«; doch was immer sie ertragen mussten, an ihren Überzeugungen hielten sie beharrlich fest. Das Gebot »Schwöre niemals« hatte zur Folge, dass sie keinerlei Eid ablegen durften, weswegen ihnen viele Berufe verschlossen blieben. Einige Frys fügten eigene Skrupel hinzu. Joseph, dem Enkel Zephaniahs, war sogar der Ärztestand zuwider, da »es ihm schwerfiel, Bezahlung für das Wasser anzunehmen, das die von ihm zubereiteten Arzneien enthielt«. Derartige Skrupel – »elende Fragen der Tracht und der Anrede«, wie Edward Fry es später nennen sollte – quälten die schwächeren Geister und setzten sie dem Gespött aus. Sie schwankten zwischen den beiden Welten. So wurde ein Familienwappen erst graviert und dann ausgekratzt; feines Linnen erst bestellt und dann zerschnitten; ein gewisser John Eliot verstieg sich zu der Überzeugung, dass er gegen die Konventionen des 18. Jahrhunderts verstoßen und sich einen Bart wachsen lassen sollte. Die Künste waren für die Quäker ebenso inakzeptabel wie die akademischen Berufe. Nicht nur Theaterbesuche waren ihnen untersagt, sondern auch Musik und Tanz; und obwohl »Zeichnen und Aquarellmalerei geduldet oder gefördert wurden«, fiel diese Förderung eher lauwarm aus, denn von einigen denkwürdigen Ausnahmen abgesehen war ein Kupferstich von Penns[2] Vertrag mit den Indianern – jenes »abscheuliche Bild«, wie Roger Fry es später nannte – noch im 19. Jahrhundert fast das einzige Bild, das sich überhaupt in einem Quäkerhaushalt fand.
Unzweifelhaft hatte die Gemeinschaft der Quäker, wie eines ihrer Mitglieder schreibt, »einen sehr engen Horizont und begrenzte Interessen; und war, was ihre Mitglieder betraf, sehr bürgerlich«. Doch die Kanalisierung so starker Energie in so engen Grenzen trug bemerkenswerte Früchte. Die Geschichte des Joseph Fry ist typisch für die Geschichte vieler Frys. Da er sich den Arztberuf aufgrund seiner Skrupel versagte, »verlegte er sich auf gewerbliche Berufe und wurde Gründer oder Mitgründer von fünf Firmen, die sich vermutlich als sehr viel einträglicher erwiesen denn der Berufsstand, auf den er aus Gewissensgründen verzichtet hatte«. So entstand eine eigentümliche Anomalie; die weltabgewandtesten Menschen waren überreich mit weltlichen Gütern gesegnet. Der Händler, der über seinem Geschäft in Bristol oder in der Bartholomew Close wohnte, war zugleich ein Gutsherr, dem in Cornwall oder Wiltshire viele Morgen Land gehörten. Aber er war ein Gutsherr der besonderen Art. Er war ein Junker, der sich weigerte, den Zehnten zu entrichten; der sich weigerte, zu jagen oder zu schießen; der sich anders kleidete als seine Nachbarn und, falls überhaupt, nur eine Quäkerin heiratete. Die Frys und die Eliots, die Howards und die Hodgkins lebten, sprachen und kleideten sich nicht nur anders als andere Leute, vielmehr wurden diese Unterschiede durch die zahlreichen Verwandtenehen noch verstärkt. Jeder Quäker, der »außerhalb der Gemeinschaft« heiratete, wurde verstoßen. So ehelichten die Söhne der einen Quäkerfamilie Generation um Generation die Töchter einer anderen. Mariabella Hodgkin, Roger Frys Mutter, hatte physisch und geistig genau dieselbe Abstammung wie ihr Mann Edward Fry. Sie stammte von den Eliots ab, die, wie die Frys, seit dem 17. Jahrhundert Quäker waren. Auch sie hielten sich vom öffentlichen Leben fern und hatten beträchtlichen Wohlstand angehäuft, zunächst als Kaufleute in Falmouth, die »Sardinen und Blech nach Venedig exportierten«, und später in London, wo die Familie in der Bartholomew Close eine große Villa besaß. Die Eliots heirateten die Howards, die Weißblech herstellten und ebenfalls Quäker waren. Und dank der Ehe Luke Howards, Sohn von Robert, dem Weißblechhersteller in der Old Street, mit Mariabella Eliot tauchen in der umfassenden Familienchronik die beiden einzigen Namen auf, an denen ihr Abkömmling Roger Fry Interesse zeigte. Sein Urgroßvater Luke Howard[3] (1772–1864) war ein Mann von »glänzendem, doch eher sprunghaftem Genie«, der, da ihm wie so vielen Angehörigen der ›Religiösen Gesellschaft der Freunde‹ andere Betätigungsfelder verwehrt waren, seine Aufmerksamkeit der Wissenschaft zuwandte. Mit einem Essay, in dem er eine »Klassifikation und Nomenklatur der Wolken« vorschlug, zog er die Aufmerksamkeit Goethes auf sich, der nicht nur ein Gedicht zu dem Thema verfasste, sondern mit dem Autor auch in Briefkontakt trat. Mariabella Hodgkin konnte sich an ihren Großvater noch erinnern. Wie sie schreibt, schien er »stets an etwas weit Entferntes zu denken. … Oft stand er lange am Fenster und blickte mit seinen sanften, träumerischen Augen in den Himmel.« Wie einige seiner Nachkommen »war er geschickt im Gebrauch von Werkzeugen« und brachte seinen Enkeln in der eigenen Werkstatt den Umgang mit Luftpumpen und elektrischen Apparaturen bei. Roger Fry ließ sein Exemplar der Familiengeschichte unaufgeschnitten, bekannte jedoch, dass er gern mehr über diesen erfinderischen Ahnen in Erfahrung gebracht hätte, dessen Gabe, die Phantasie anderer Menschen durch Spekulationen in Gang zu setzen, die »durch nachfolgende Beobachtung nicht vollständig erhärtet« wurden, nicht nur eine Verwandtschaft des Blutes, sondern auch eine des Temperaments nahelegt. Der zweite Name, an dem Roger Fry Geschmack fand, wenn auch aus anderen Gründen, war der seiner Mutter – Mariabella. Er taucht erstmals im 17. Jahrhundert auf. So wurde die Tochter eines gewissen Blake genannt, der eine Farnborough heiratete, deren Tochter einen Briggins heiratete, dessen Tochter einen Eliot heiratete. Es war ein Name, dem ein gewisses Geheimnis anhaftete, war er doch »offensichtlich italienischen oder spanischen Ursprungs«, und Roger Fry, der nicht das geringste Interesse an den Eliots und ihren möglichen Verbindungen mit den Eliots von Port St Germans oder an den Westons und ihrer möglichen, wenn auch eher unwahrscheinlichen Abkunft von Lord Weston, Earl of Portland[4], verspürte, ging davon aus, dass seine Vorfahrin, die erste Mariabella, ihren Namen einer Verbindung mit dem Süden verdankte. Er hegte die Hoffnung, dass das ruhige und ehrbare Blut seiner unzähligen Quäker-Vorfahren mit dem eines feurigeren Volkes vermischt war. Aber es war nur eine Hoffnung. Seit mehr als zwei Jahrhunderten war in der Familie der Eliots kein Skandal vorgekommen. Seine Mutter Mariabella Hodgkin, die siebente Frau, die diesen Namen trug, war wie all die anderen eine waschechte Quäkerin; und es geschah im Versammlungshaus der Freunde in Lewes, dass Edward Fry sie an einem wolkenlosen Frühlingstag im April 1859 heiratete und mit ihr in das kleine Haus in Highgate zog.
Dieses Haus[5], schrieb Edward Fry, »blickte über Miss Burdett-Coutts’[6] Garten von Holly Lodge bis hin zu den Dächern von London. … Ein kleiner Garten mit einer Blutbuche in einer Ecke fiel vom Haus zu den Bäumen unserer großen Nachbarin ab und bedeutete uns damals sehr viel. Es war ein kleines Grundstück ›Nicht ganz in der betriebsamen Welt und auch nicht ganz / Außerhalb.‹ Und oft drang das Germurmel der großen Stadt den Hügel herauf und erinnerte uns daran, wie nahe wir dem großen Herzen der Dinge waren.« In diesem Haus wurden seine neun Kinder geboren, und in diesem Garten entdeckte sein Sohn Roger seine erste Leidenschaft und erlebte seine erste große Ernüchterung. Er schrieb:
Für mich ist der Garten bis heute die gedachte Folie nahezu jeder Gartenszene, von der ich in Büchern lese. Von der Astgabel eines eigentümlich verkümmerten und rußbeschmutzten alten Apfelbaums, der aus dem Rasen emporwuchs, biegt sich noch immer die Schlange zu Eva herab. Und es kam mir vor, als hätten sich in seiner bescheidenen vorstädtischen Einfriedung auch noch verschiedene andere Verführungsszenen ereignet. Aber der Garten war auch Schauplatz zweier großer emotionaler Erfahrungen, meiner ersten Leidenschaft und meiner ersten großen Ernüchterung. Meine erste Leidenschaft galt einem großen buschigen roten Feuermohn, der durch einen gesegneten Zufall in dem quadratmetergroßen Beet wuchs, das mir als mein privater Garten zugeteilt worden war. Die Pflanzen, die ich kaufte und mit etwas Schlamm, den ich mithilfe von Gießkanne und Gartenerde hergestellt hatte, in den Boden drückte, die Samen, die ich säte, wurden meinen Erwartungen nie gerecht, meist weigerten sie sich sogar, überhaupt zu wachsen, nur der Feuermohn war schöner als meine wildesten Träume. Sein Rot war röter als alles, was ich mir vorstellen konnte, wenn ich den Blick abwandte. Ich hatte eine große Leidenschaft für Rot, die mir, als ich auch noch eine romantische Anhänglichkeit gegenüber Lokomotiven entwickelte, einmal sogar vorgaukelte, ich hätte eine »reinrote Lokomotive« gesehen. Jedenfalls empfand ich für die Mohnblume weit aufrichtigere Verehrung als für den »sanften Jesus«, und fast möchte ich meinen, größere Zuneigung, als ich sie irgendjemandem mit Ausnahme meines Vaters entgegengebrachte. Ich weiß noch, wie dieser Feuermohn einmal voll dicker grüner Blütenknospen stand und durch die Ritzen zwischen den Kelchblättern so etwas wie kleine zerdrückte scharlachrote Seide schimmerte. Einige wenige blühten bereits. Ich konnte mir nichts Aufregenderes auf der Welt vorstellen, als mitzuerleben, wie die Blüte plötzlich ihre grüne Hülle durchbricht und ihren ungeheuren Kelch Rot entfaltet. Ich vermutete, dass dies jäh geschehen würde und ich nur Geduld brauchte, um Zeuge des Vorgangs zu werden. Eines Morgens stand ich stundenlang da und beobachtete eine verheißungsvolle Knospe, aber es geschah nichts, und ich ermüdete, und so rannte ich voller Angst, zu spät zu kommen, wieder ins Haus und besorgte mir einen Schemel, um weiter Wache zu halten. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit, aber ich könnte mir vorstellen, dass es nur eine halbe Stunde war. Schließlich wurde ich von einer älteren Schwester entdeckt und gehörig ausgelacht und, als die Geschichte sich herumsprach, desgleichen von sämtlichen Erwachsenen, denn alle Leidenschaft, selbst die für rote Mohnblumen, gibt uns der Lächerlichkeit preis.
Das andere Ereignis war tragischer. Es war die schreckliche Entdeckung, dass Gerechtigkeit nicht das höchste Gut ist, dass Unschuld keinen Schutz bietet. Wieder war es ein Sommermorgen, und ich lehnte am Knie meiner Mutter, die auf einem niedrigen Korbstuhl saß und mich in den Anfangsgründen der Botanik unterwies. Um etwas zu illustrieren, beauftragte sie mich, ihr eine der Knospen meiner heißgeliebten Mohnpflanze zu bringen, zumindest verstand ich sie so. Ich war längst auf stillschweigenden Gehorsam abgerichtet worden, und obwohl mir die Tat wie ein Frevel vorkam, führte ich sie aus. Offenbar –
An dieser Stelle bricht das Fragment ab. Doch das Nachspiel ist bekannt – er pflückte die Mohnblume und wurde von seiner Mutter streng dafür getadelt. Die Ernüchterung war groß. Denn so gutgläubig und leidenschaftlich er auch sein mochte, so war er doch »längst auf stillschweigenden Gehorsam abgerichtet«, und der Mensch, der ihm zuerst Gehorsam abverlangt und ihn dann dafür bestraft hatte, war seine Mutter. Der Schock dieser verwirrenden Erfahrung hallte noch fünfzig Jahre später nach. Viele ähnliche Erfahrungen sollten folgen; doch die Tatsache, dass seine »erste große Ernüchterung« mit seiner Mutter zu tun hatte, mag Schärfe und Dauer des Eindrucks erklären. Lady Fry hatte auf diesen sehr empfänglichen und empfindlichen, aber auch sehr logisch denkenden und selbstständigen Jungen großen Einfluss, der noch anhielt, lange nachdem ihre Unterweisungen in Botanik geendet hatten. Wie Fotos zeigen, war sie eine imposante Erscheinung; mit schönen Gesichtszügen, festen Lippen und einem kräftigen Körper. Der Überlieferung zufolge war sie ein ausgelassenes, fröhliches Mädchen, das Bewunderung auf sich zu ziehen vermochte – dies trotz des nüchternen Quäkerlebens und der Quäkertracht, die in ihrer Jugend noch immer die übliche Kleidung der Hodgkins darstellte. Gegen Ende ihres Lebens – sie wurde siebenundneunzig – erstellte sie eine Liste von »Dingen, die es nicht gab / Dingen, die es gab, als ich ein kleines Kind war«. Es ist eine aufschlussreiche Liste. Zu den Dingen, die es nicht gab, zählte sie: Zündhölzer, Wärmflaschen, Nachtlichter, Weihnachtsbäume, Anschlagtafeln, Japanische Anemonen, Sprungfedermatratzen und Lachgas bei Zahnextraktionen. Zu den Dingen, die es gab: Feuerstein und -stahl; Binsenlichter; Dörrpflaumen und Gewürzrinde; Hausschuhe und Holzpantinen; Büttel und Pferdewagen; Pelerinen und Ärmel (in einem); Schnupftabakdosen und Chartisten. Sie wertet nicht, aber wir können annehmen, dass es im Leben des Quäkermädchens mehr Entzug als Entzücken gab, mehr Einschränkung als Schwelgerei. Eine Anekdote, die sie aus ihrer Kindheit erzählt, unterstreicht diesen Eindruck: »Bei dieser Gelegenheit [einer Erkrankung im Alter von vier Jahren] kaufte mir ein gütiger Onkel eine Schachtel mit wunderbarem Puppengeschirr (ich besitze sie noch heute) und brachte sie mir nach oben, wo ich in meinem Kinderbett saß. Obwohl ich sie mir bestimmt sehnlichst wünschte, schloss ich entschieden und fest die Augen und weigerte mich allen Schmeicheleien und Aufforderungen zum Trotz, sie wieder zu öffnen. Mein Onkel ging, das Puppengeschirr wurde zweifellos weggeschafft, und ich blieb voller Missvergnügen zurück. Dies war eine jener heimlichen Befangenheiten, die Teil der Kindheit sind und ihren Ursprung vermutlich in heftiger Schüchternheit haben.« Und noch andere Verklemmtheiten gehörten zur Kindheit einer Quäkerin. Bis ans Ende ihres Lebens erinnerte sie sich, wie ihr Vater befohlen hatte, die engen Ärmel an ihrem Kleid, die damals modern waren, abzuschneiden und unmodisch weite Ärmel einzusetzen, und wie die Gassenjungen sie mit »Quack! Quack!« verhöhnt hatten, als sie die Straße entlangging. Bei einer sehr schüchternen und empfindsamen Person hinterließ eine solche Erziehung bleibende Spuren. Stets schien sie zwischen zwei Welten zu leben und keiner von beiden anzugehören. So war es denn auch kein Wunder, dass sie, als ihr zweiter Sohn noch ein Kind war, vor vielen Dingen, für die er »weit aufrichtigere Verehrung« empfand »als für den ›sanften Jesus‹«, fest und doch ängstlich die Augen verschloss – vor roten Mohnblumen, roten Feuerwehrwagen und grünen Blütenknospen voll scharlachroter Seide, die durch die Ritzen zwischen den Kelchblättern schimmerte. Und doch respektierte er sie und war »auf stillschweigenden Gehorsam abgerichtet«.
Der Garten, in dem er diese Lektion in den Grundlagen der Botanik erhielt, war von anderen Gärten umgeben. Unterhalb erstreckte sich Kenwood, damals im Besitz Lord Mansfields[7]; und Kenwood verschmolz mit den Höhen von Hampstead. Highgate selbst war ein Dorf; und obwohl, wie Sir Edward Fry schrieb, das Gemurmel Londons den Hügel heraufdrang, gestaltete sich der Zugang zu der großen Stadt schwierig. Nur »vereinzelte Omnibusse« verbanden beide. Noch waren die »Dörfler« abgeschottet und von höherem Rang. Noch hielten sie sich für etwas Besonderes. Als Roger Kind war, schnitt der alte Friseur, der schon Coleridge die Haare geschnitten hatten, noch immer Haare und erinnerte sich an des Dichters Schwatzhaftigkeit – »Was hat er nicht alles dahergeredet!«, sagte er, konnte sich aber nicht erinnern, worüber der Dichter gesprochen hatte. Es entstanden örtliche Vereine. Es gab einen Schachverein und eine Gesellschaft für literarische und naturwissenschaftliche Debatten. Eine Lesegesellschaft traf sich »einmal alle drei Wochen, um ausgewählte Passagen aus Standardwerken zu lesen. … Tee wird um sieben gereicht und Sandwiches und Obst um zehn …, und wenn eine bedauernswerte Dame aus Unwissenheit oder Gedankenlosigkeit Götterspeise oder Sahne auf den Abendbrottisch stellte, konnte sie sicher sein, wegen ihrer Gesetzwidrigkeit sanft gerügt zu werden.« Manchmal traf sich die Gesellschaft im Hause der Frys, und an einem Sonntagabend schaute der führende Kopf vorbei – Charles Tomlinson, Fellow of the Royal Society[8], ein rastloser, aber hochgelehrter Gentleman, dessen veröffentlichte Werke von The Natural History of Common Salt bis zu Übersetzungen Dantes und Goethes reichten, dazu noch Bände über Schach, Pneumatik, Akustik und Winter in the Arctic Regions – und hörte zu, wie Sir Edward den Kindern aus Das verlorene Paradies, George Fox’ Tagebuch oder einem von Dean Stanleys[9] Büchern vorlas. Wenn die Lesung beendet war, sprach Mr Tomlinson begeistert, wenn auch unverständlich zu den Kindern. Dann lud er sie zum Tee zu sich nach Hause ein. Er zeigte ihnen alle Wunder seiner »Höhle«. Entsprechend der Vielfältigkeit seiner Interessen war das kleine Zimmer mit faszinierenden Gegenständen vollgestopft. Es gab eine elektrische Apparatur, eine Glasharfe und Chladni-Platten[10] – eine Erfindung, dank derer sich Sand bei Geigenspiel zu herrlichen Mustern fügt. Rogers lebenslange Freude an wissenschaftlichen Experimenten dürfte hiervon angeregt worden sein. Aber Wissenschaft war Teil der häuslichen Atmosphäre; »Kunst« dagegen wurde »an ihren Platz verwiesen«; will sagen: pflichtbewusst wurde die Akademie aufgesucht; pflichtbewusst eine Landschaft erworben, wenn sie getreulich eine Sommerurlaubsszene festhielt. Vielleicht ist es also Charles Tomlinson zu verdanken, dass Roger erstmals auf jene ästhetischen Probleme aufmerksam wurde, die ihm später so vertraut werden sollten. Als Verfasser einer Cyclopaedia of Useful Arts hatte Mr Tomlinson Zugang zu bestimmten Fabriken, und bei seinen Besuchen in Price’ Kerzenfabrik, Powells Glasbläserei und einer Diamantschleiferei in Clerkenwell nahm er die kleinen Frys mit. »Und diese Fabrikbesuche«, schrieb Rogers Schwester Agnes, »warfen Fragen ganz neuer Art auf; was gute Kunst ausmachte, was schlechte Kunst; welches Ornament berechtigt war; und ob Diamanten nicht eher für Werkzeuge verwendet werden sollten als für Colliers. Er sprach sich dafür aus – eine Brosche, sagte er uns, mochte nützlich sein, Medaillons dagegen waren ihm ein Gräuel.« Leider ist Rogers Auffassung, was gute Kunst ausmachte und was schlechte Kunst, nicht überliefert. Mr Tomlinson, der sich mit dem Obergärtner gut verstand, war es zu verdanken, dass man jedes Frühjahr einen Spaziergang in Lord Mansfields privatem Wald unternahm – jenem »irdischen Paradies, das wir das ganze Jahr über von unserem eigenen Garten aus sehen konnten, an dem wir fast täglich auf unseren Spaziergängen vorbeikamen und das zur Maienzeit einen köstlichen Vormittag lang allein uns zu gehören schien«. So beschrieb Agnes Fry Kenwood Park; und auch in Rogers Erinnerung hatte Kenwood, wie aus einem weiteren autobiographischen Fragment hervorgeht, einen festen Platz. Seine Erinnerung galt jedoch nicht den Waldspaziergängen im Frühling, sondern dem winterlichen Eislaufen.
Eines Tages im Januar 1929, schreibt er, habe er vor sich hin gedöst, als
plötzlich das lebhafte Bild meines Vaters auf Schlittschuhen vor meinen Augen stand. Es muss irgendwann in den Siebzigern gewesen sein, ich schätze, um 1874, und Schauplatz war einer der Teiche in Lord Mansfields Park in Kenwood, mittlerweile öffentlich zugänglich, damals aber in Privatbesitz. Nur wenn die Teiche zugefroren waren, hatten die privilegierten Familien von Highgate, zu denen auch wir gehörten, Zutritt – mit Einlasskarten. Es war ein herrlicher Ort, Buchenwäldchen standen etwas zurückgesetzt vom Teich und waren in jenem Jahr mit langen Raureifnadeln beblümt, die in der niedrig stehenden Wintersonne rosig glitzerten. Und da war mein Vater mit einem Paar Schlittschuhe, die schon damals altmodisch waren. Flache hölzerne Schlittschuhe mit langen Kufen, die sich vorn zu einem eleganten Horn bogen, Schlittschuhe, wie man sie auf niederländischen Gemälden sieht. Halb verachteten wir sie, weil sie so altmodisch waren, halb bewunderten wir sie, weil sie meinem Vater gehörten. Er hatte eine Leidenschaft fürs Eislaufen – die einzige Sportart, aus der er sich etwas machte. Es war eine Leidenschaft, obwohl er ziemlich schlecht lief; seine Art, mit fuchtelnden Armen und Beinen, fliegenden langen schwarzen Rockschößen und dem obligatorischen Zylinder als Krönung dahinzugleiten, zeugte von seltsamem oder gar keinem Stil. Tatsächlich lief er so gern Schlittschuh, dass er sich, obwohl Kronanwalt in einer großen Kanzlei, mitten in der Woche bisweilen einen ganzen Nachmittag freinahm, aus Furcht, das Eis könnte noch vor Samstag tauen. Es war die einzige Unterbrechung seiner Arbeit, die er sich je gestattete. Da waren wir also, meine Schwestern, ich und Porty, mein sechs Jahre älterer Bruder, für uns ein großes Vorbild, und rutschten auf unseren Schlittschuhen unbeholfen umher oder gewannen bereits an Sicherheit. Nach zwei, drei Runden auf dem Teich kehrte mein Vater zurück und half uns; gut gelaunt reichte er uns die Hand und begleitete uns über den Teich zu jenen, die hinreichend fortgeschritten waren, denn wenn er Schlittschuh fahren konnte, war er stets guter Laune und noch freundlicher als sonst, jedenfalls lebhafter, gesprächiger und weniger einschüchternd. Als wir älter wurden, eine eigene Persönlichkeit entwickelten und nicht länger bereit waren, uns der strengen Routine viktorianischer Häuslichkeit zu fügen, trat er zunehmend einschüchternder auf. An jenen Tagen aber war er voller Lachen und guter Laune, und es schien keine Gefahr zu bestehen, dass man sich unversehens einer moralischen Verfehlung schuldig gemacht hatte, wie es zu anderen Zeiten der Fall sein konnte, ohne dass man genau wusste, weshalb oder wie es dazu gekommen war, denn der Moralkodex war schrecklich kompliziert, und man sah nicht immer voraus, wann ein vermeintlich unerhebliches oder unschuldiges Wort oder eine Tat einen zu Fall brachte. Und wenn es dazu kam, war die Stimme meines Vater von so entsetzlichem Ernst, dass man in hilfloser Selbstverdammung und überwältigender Scham auf der Stelle in sich zusammenschrumpfte.
In diesem Erinnerungsbild gab es einen düsteren oder zweifelhaften Fleck – die Schlittschuhe. Wir waren eine große Familie, und meist mussten sich die mittleren Kinder, wie ich eines war, mit den abgelegten Schlittschuhen der älteren Geschwister begnügen. Diese waren in Holz eingelassene Kufen aus ausrangiertem Stahl, die mittels einer kleinen Schraube am Stiefelabsatz befestigt wurden. Das Gewinde der Schrauben war fast immer ausgeleiert, und mitten in einem aufregenden Wettlauf oder wenn man gerade eine Acht fahren wollte, lösten sie sich plötzlich von den Füßen. Das Schlimmste an diesen unvollkommenen Schlittschuhen war, dass sie einen, wenn nichts anderes mehr half, den Händen der elenden Männer auslieferten, die Stühle vermieteten und Schlittschuhe anpassten. Unsere Beziehung zu diesen Männern war schwierig und schmerzhaft.
Zunächst einmal wurden wir in der unbedingten Überzeugung großgezogen, alle Männer, die keiner geregelten Tätigkeit nachgingen und kein hinreichend hohes Gehalt bezogen, seien moralisch zu verurteilen, ja, die Welt sei so eingerichtet, dass Wohlstand und Tugend einander fast genau entsprächen, auch wenn wir hin und wieder einen Parvenü verachten durften, dessen Vermögen so plötzlich gewachsen war, dass die Theorie fragwürdig erschien. Einer von ihnen war der neureiche Eigentümer von Kenwood Castle, einem Schloss, das uns mit seinem protzigen gotischen Backsteinturm die Aussicht von unserem Garten versperrte und die Pracht von Kenwood House übertrumpfen zu wollen schien, das Lord Mansfield mit seiner ererbten und angestammten Würde füllte und wo uns gestattet war, Schlittschuh zu laufen.
So ließ die Theorie, Geld sei ein Beiwert der Tugend, die Nichtstuer am Teich, die mit ihren großen roten Nasen und ihren großen roten Halstüchern umherstapften und sich in die hässlichen Hände bliesen, als ganz und gar fremde Wesen erscheinen, unendlich fern wie eine andere Spezies, fast wie die kriminelle Spezies Mensch, von der wir hin und wieder hörten.
Es ist unmöglich, den Mangel an schlichter Menschlichkeit zu übertreiben, in dem wir erzogen wurden, oder zu erklären, wie dieser Mangel sich mit der Verpflichtung zur Philanthropie vertrug. Diese armen Schlucker – die schließlich nur ihre Arbeit verrichten wollten – zu bezahlen, ihnen ein anständiges Trinkgeld zu spendieren hieß, vor der Unsittlichkeit zu kapitulieren, denn wer sich beiläufig unsittlich verhielt, half der Unsittlichkeit. Mein älterer Bruder war ganz besonders streng, und manch eine schmerzliche Szene, vor der wir unter einer gut gezielten Salve von Beschimpfungen flohen, war die Folge unserer heroischen Versuche, seinen Prinzipien gerecht zu werden.
Wieder bricht das Fragment ab. Offensichtlich hat der Mann, der auf seine Vergangenheit zurückblickt, dem Eindruck, den er als siebenjähriges Kind empfing, etwas hinzugefügt, und der Tatsache, dass sie für Freunde gedacht war, die bedeutenden Viktorianern gegenüber eine eher heitere als ehrfürchtige Haltung an den Tag legten, verdankte die Autobiograohie zweifellos einiges. Und doch ist klar, dass das Kind einen Eindruck empfangen hatte, der äußerst lebhaft und zugleich verwirrend war. Er hatte den Gegensatz empfunden zwischen dem Vater, der »voller Lachen und guter Laune« mit fliegenden Rockschößen »dahinglitt«, und dem strengen Mann, der ihm einer moralischen Verfehlung wegen, der er sich schuldig gemacht hatte, ohne genau zu wissen, worin sie bestand, von einem Augenblick auf den anderen mit einer Stimme von entsetzlichem Ernst überwältigende Scham einflößen konnte.
Nach dem zu urteilen, was Sir Edward in seiner Autobiographie über sich selbst schreibt, waren diese frühen Eindrücke berechtigt. Es gab gute Gründe, weshalb er seinen Sohn mit einer Mischung aus Zuneigung, Furcht und Verwirrung erfüllte. Er war ein Mann tiefer Gefühle und zahlreicher Konflikte. »Ich habe oft gedacht, dass die beiden widerstreitenden Elemente unserer Natur – die niedereren und die höheren – in keinem Menschen in stärkerem Gegensatz nebeneinanderher bestanden oder erbitterter um Vorherrschaft rangen«, schrieb er. »Zweifel und Schwierigkeiten bezüglich Gottes und der anderen Welt, Aspirationen, die oft vage und ziellos waren und zwangsläufig unbefriedigt blieben, Angst vor der Zukunft – sowohl vor geistigen wie vor körperlichen Dingen, das Mysterium der Welt, das Gefühl, dass das gewöhnliche Leben belanglos ist, ein Widerwille gegen Wesen und Gewohnheiten vieler Menschen, Bedauern über unstatthaft Gesagtes und Getanes, besonders über die Ausbrüche eines stets eher herrischen Temperaments – all diese und mannigfache andere Dinge bescherten mir oft traurige und schmerzhafte Gedanken« – so beschrieb er sich als junger Mann. Zu den Sehnsüchten, die »zwangsläufig unbefriedigt blieben«, gehörte auch die Sehnsucht nach einem Leben als Naturwissenschaftler. Seine Neigung galt eindeutig der Naturwissenschaft. Als Junge in Bristol gab er sein Taschengeld im Zoologischen Garten aus – für Tierleichen, die er zu Hause sezierte. Seine erste veröffentlichte Arbeit war mit Osteology of the Active Gibbon überschrieben; seine zweite trug den Titel On the Relation of the Edentata to the Reptiles. Knochen und Steine, Pflanzen und Moose sagten ihm weit mehr zu als seine Angestelltentätigkeit im Kontor eines Zuckermaklers. Das Leben eines Professors der Naturwissenschaften an einer der großen Universitäten hätte perfekt zu ihm gepasst. Doch sowohl Oxford als auch Cambridge waren ihm als Quäker »so gut wie verschlossen«; und er wählte die Rechtswissenschaften, für die er »keinerlei Vorliebe« empfand, die ihm aber »die Rechtfertigung lieferten, sich fürs College zu bewerben«. Das College – University College, London – war zwar nicht Oxford oder Cambridge, aber besser als gar kein College. So war es nur natürlich, dass er, der als Quäker geboren und erzogen worden war und sein ganzes Leben lang Quäker blieb, der Sekte dennoch höchst kritisch gegenüberstand. Er war einer der Ersten, die gegen die »Eigenheiten« der Quäker aufbegehrten, und im hohen Alter schrieb er, dass »elende Fragen der Tracht und der Anrede und die Dispute über den rechten Glauben in meiner Gefühlswelt eine Kluft zwischen mir und dem konsequenten Quäkertum aufrissen, die ich nie überwunden habe«. Seiner Veranlagung nach war er schüchtern und niedergeschlagen und hatte »sehr wenig Interesse am gewöhnlichen Leben der Menschheit«. Aber er besaß einen lebhaften und kritischen Geist; verachtete alles »Morbide, Sentimentale oder Überschwängliche«; war unerbittlich jeder Ungenauigkeit gegenüber; und konnte Fakten so gut speichern, dass er noch in sehr hohem Alter – bis zu seinen letzten Lebensjahren war er kaum einen Tag krank gewesen, und er wurde über neunzig – präzise Angaben machen konnte, »sei es über die exakten Grenzen des Ärmelkanals, die geographische Verteilung von Tieren oder die Schreibung eines Wortes«. Natürlich verhalf ihm diese Begabung zu hohem Ansehen, auch wenn der Beruf des Juristen nicht seine erste Wahl gewesen war. Nach eintöniger Zeit des Wartens, in der er »auf dem Platz unter mir einen Strom von Mandaten vorbeifluten« sah, sich nach »mehr Gesellschaft und mehr Liebe« sehnte, sich auch nach dem Land sehnte, manchmal den Duft von Heu roch und über Lincoln’s Inn die fernen Hügel Hampsteads sah, fielen ihm Mandate zu, und seine Kanzlei wuchs und wuchs. Doch das Leben eines erfolgreichen Anwalts befriedigte ihn nicht. Kaum war er Richter geworden, sagte er seinem Schreiber, sobald er pensionsberechtigt sei, werde er in den Ruhestand treten; und zum großen Erstaunen und Bedauern seiner Kollegen hielt er Wort. In der Blüte seiner Jahre, wenn auch bereits zu alt, um noch Naturwissenschaftler zu werden, zog er sich aufs Land zurück, um jene »Verbindung von einfachem Leben und nützlicher Landarbeit« zu genießen, die von jeher sein Ideal gewesen war. Doch wie seine Vorfahren war er ein Gutsherr der besonderen Art. Er rauchte nicht; Rasenbowling und Halma waren die einzigen Spiele, die er tolerierte; und er besaß kein handwerkliches Geschick. Er las seinen Kindern vor, bestellte seinen Garten und diente seinem Land in Den Haag und auf der Richterbank. Seine Bücherregale waren gut ausgestattet, und die Hausbibliothek war mit den Büsten bedeutender Männer geschmückt; doch für Kunstwerke hatte er nicht das geringste Gespür. Die einzige Beurteilung eines Gemäldes, die erhalten geblieben ist, fiel ungünstig aus, da »der Charakter der schönen Dame [auf dem Porträt] … nicht über jeden Vorwurf erhaben« war. Moose dagegen – Hypnum, Tortula und Bryum – verschafften ihm eine Befriedigung, die Menschen ihm nicht schenken konnten. Und wenn es ihm, wie er selbst sagte, an Vertrauen in die eigenen Kräfte mangelte und er »eher verzweifelt in die Zukunft blickte«, so fehlte es den Schiedssprüchen, die er auf der Richterbank oder in seinem eigenen Haushalt fällte, doch nicht an Entschlossenheit. Die »Routine viktorianischer Häuslichkeit«, die er entwarf, war streng. Einem kleinen Jungen mochte der Moralkodex »schrecklich kompliziert« erscheinen, doch er war eindeutig. Obwohl seine Kinder, namentlich seine Töchter, tiefe Zuneigung für ihn empfanden, begriffen sie doch stets, »dass es Grenzen gab, die nicht überschritten werden durften«. Vielleicht hätte er es begrüßt, wenn sie diese Grenzen einfach ignoriert hätten. Vielleicht bedauerte er ebenso wie sein Sohn die »Einschüchterung«, die ihn den Kindern, je älter sie wurden und je mehr der Sohn eine eigene Persönlichkeit entwickelte, zunehmend entfremdete. Jedenfalls war sich Sir Edward seiner Einsamkeit zutiefst bewusst. Er habe viel Glück erfahren, schrieb er in hohem Alter, und viele Freunde gehabt. »Doch trotz alledem gibt es ein Gefühl der Einsamkeit – der Distanz zu meinen Mitmenschen, die zeit meines Lebens an mir gehaftet und, wie ich zurückblickend empfinde, den Umgang mit meinen Mitmenschen als Ganzes getrübt hat. Wie wenige von denen, mit denen ich verkehrte, haben mich wirklich verstanden! Der eine mag an mich als Anwalt, der andere an mich als Botaniker, ein Dritter an dies oder jenes denken, aber wie wenige ahnen mein wahres Ich. … Ich wurde allein geboren; ich muss allein sterben; und trotz der süßen Bande von Heim und Liebe (für deren Überfülle ich Gott danke) muss ich in gewissem Sinne auch allein leben.«
Natürlich konnte ein siebenjähriges Kind in diese Einsamkeit nicht eindringen; doch es konnte, wie Rogers Erinnerung an jenen Wintertag auf dem Teich in Kenwood beweist, den Gegensatz empfinden zwischen dem Vater, der, wenn er einmal seiner Leidenschaft für das Eislaufen nachgab, »voller Lachen und guter Laune« war; und dem Vater, dessen helle Miene sich plötzlich verfinsterte; und dessen Stimme schrecklich scharf wurde, wenn er dem Sohn Sünden vorwarf, die dieser nicht begreifen konnte. Zudem gab es noch einen weiteren Gegensatz, der Roger schon als Kind verstörte. Ganz gleich, welchen moralischen Überzeugungen sein Vaters anhing, in dem kleinen Haus in Highgate führte man ein höchst komfortables Leben. Unaufhörlich wurden Kompromisse mit der Welt der Wohlanständigkeit und der Konvention geschlossen. Ein Zweispänner brachte seinen Vater zum Lincoln’s Inn. Eigentumsrechte wurden respektiert; Klassenunterschiede akzeptiert; und die Nichtstuer mit ihren roten Halstüchern, die sich am Teich in die hässlichen Hände bliesen, wurden nicht etwa bemitleidet, sondern getadelt. In ihrer Erziehung, empfand er, herrschte ein »Mangel an schlichter Menschlichkeit«. Roger verehrte seine Eltern, besonders seinen Vater; doch sie schüchterten ihn ein; und vieles an ihrer Lebensweise fand er rätselhaft.
Derlei Eindrücke waren natürlich nur vorübergehend und stellten eine Ausnahme dar, auch wenn sie sich tief genug einprägten, um ein Leben lang bestehen zu bleiben und ihm innere Konflikte zu bereiten. Meist gab es nichts, was ihn verwirrte oder ängstigte. »Die schwarze Henne brütet noch. Heute Morgen kam Mr Carpenters Kleine, um das weiße Kätzchen mitzunehmen. Am Samstag hat Porty mich, Mab und Kizzy im Einmaleins, in Geographie und in Latein geprüft und Mab und Kizzy einige Rechenaufgaben gestellt, während er mich in Französisch abgefragt hat« – das ist ein typisches Beispiel für seinen Alltag in Highgate in den siebziger Jahren. Der Garten mit den Treibhäusern und dem Gärtner spielte in Rogers Leben eine große Rolle. Er hatte seinen eigenen Garten, wo eine Lilie wuchs, von der er für seinen Großvater in Lewes eine Bleistiftzeichnung anfertigte. Er hatte Schwestern zum Spielen; über sie herrschte er despotisch und weigerte sich, ihnen sein Spielzeug zu leihen. Es gab einen großen Kreis Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen, die sich an Geburtstage erinnerten und häufig Geschenke mineralischer oder pflanzlicher Art schickten, denn es handelte sich um eine naturwissenschaftlich sehr interessierte Familie. Er ging nicht etwa mit einem Spielzeug zu Bett, sondern mit einem Kristall, den seine Großmutter ihm geschenkt hatte. »Möchtest Du im Gegenzug für die Stendelwurzen ein Exemplar der Oxalis corniculata?«, schrieb sein Cousin R.M. Fry. Und der Neunjährige achtete stets darauf, in seinen Antworten die richtigen wissenschaftlichen Bezeichnungen zu verwenden. Sein älterer Bruder Portsmouth, der bereits in Clifton zur Schule ging, unterrichtete ihn in anderen Dingen: »Auf dem Umschlag ist der falkenköpfige Gott abgebildet, ich habe seinen Namen vergessen, und in der linken Hand hält er die crux ansata oder das Symbol der Zeugung, d.h. des Lebens. Er ist nicht gerade das, was man einen ansehnlichen Gott nennen würde, aber vielleicht war er sehr mächtig, und das ist viel glorreicher. … Ich füge den Entwurf einer weiteren Rede gegen die Auffassung bei, dass die Griechen der Welt mehr Gutes getan hätten als die Römer. … Großvater … hat wieder einmal eine Bemerkung über meine dicke Hand gemacht und gesagt, es sei eine gute Hand zum Arbeiten; seine seien so dünn und verschrumpelt.«[11]
Auch sein Vater vergaß nicht, ihm zu schreiben, wenn er auf Amtsreisen war. Zwar moralisierte er: »Ich freue mich zu hören, dass Du artig bist. Man fühlt sich glücklich, wenn man artig ist, und unglücklich, wenn man unartig ist«, aber das hielt ihn nicht davon ab, Roger das Bild eines Löwen zu schicken; auch einen Enzian pflückte er und schickte ihn, und als er in den walisischen Wäldern ein Eichhörnchen sah, wünschte er, Roger in Highgate hätte bei ihm sein und es ebenfalls sehen können.
II
Doch im Garten von Highgate bahnte sich eine Ver-änderung an, und wie der Zufall es wollte, hatte sie mit einem bedeutenden familiären Ereignis zu tun – der Ernennung seines Vaters zum Richter. Roger Fry hat sie selbst geschildert:
Ich muss etwa zehn oder elf Jahre alt gewesen sein, als unser Unterricht plötzlich von der Nachricht meiner Mutter unterbrochen wurde, wir alle sollten zu ihr herunterkommen. Von banger Neugier erfüllt, rannten wir nach unten ins Esszimmer. Wenn der Unterricht unterbrochen wurde, musste etwas Ernstes vorgefallen sein, vielleicht – nein, höchstwahrscheinlich – ein Verbrechen; so eigenartig waren die Feinheiten des Moralkodex – bestimmt hatte jemand eine Tat begangen, deren ungeheurer Tragweite er sich noch gar nicht bewusst war. Meine Mutter saß ernst mit unergründlicher Miene da – nein, es war kein Verbrechen – die Miene war zwar streng, doch wir waren nicht in Ungnade gefallen – wie schnell und sicher hatten wir gelernt, in einem Gesicht zu lesen, von dem so vieles abhing! Die Miene war streng, doch allem Anschein nach nicht unwirsch. Dann erfuhren wir, unser Vater sei zum Richter berufen worden. Es sei eine große Ehre, wir sollten stolz auf ihn sein – allerdings werde er nicht mehr so wohlhabend sein wie bisher – wir müssten bereit sein, viele Annehmlichkeiten und Bequemlichkeiten zu opfern, die wir bislang freudig genossen hätten, da das Opfer seiner hohen Stellung geschuldet sei. Außerdem werde er in den Ritterstand erhoben – Sir Edward Fry heißen – das sei eine große Ehre, aber wir dürften uns nichts darauf einbilden – obwohl wir den Eindruck hatten, über den weit bedeutsameren, aber rätselhafteren Titel eines Mr Justice heimlich eine gewisse Genugtuung verspüren zu dürfen. Zu alledem wussten wir nichts Rechtes zu sagen, verstanden es aber, allgemein Bewunderndes und Botmäßiges daherzumurmeln, mehr wurde bei diesem Anlass von uns nicht erwartet. Wir gingen fort und ermutigten uns gegenseitig, die Entbehrungen, die uns angedroht worden waren, mit der Seelenstärke eines Spartaners zu ertragen. Da mein Vater um die 10000 Pfund pro Jahr verdient haben muss und wir für schätzungsweise 50 Pfund Jahresmiete in einem recht kleinen Vorstadthaus wohnten, da sich Vergnügungen außerdem auf seltene Abendgesellschaften beschränkten, deren jede das Budget für Gastlichkeit auf Monate verschlang, und da mein Vater keine Laster und keine teuren Vorlieben hatte, zweifle ich nicht daran, dass selbst die kläglichen 5000 Pfund im Jahr, auf die sein Gehalt jetzt reduziert werden sollte, unsere Ausgaben mehr als decken würde – und Gott sei Dank, das taten sie auch, denn ich wäre wohl kaum hier, hätte mein Vater nicht dem großen viktorianischen Laster der Sparsamkeit gefrönt.
Allerdings bemerkten wir keine größeren Veränderungen in unserem Lebensstil. Nach wie vor kam der Sonntagsbraten auf den Tisch, nach wie vor gab es zum Sonntagstee Rosinenbrötchen, und tatsächlich wäre es uns schwergefallen, irgendwelche Luxusartikel zu benennen, die sich auf unserem Wochenspeisezettel hätten einsparen lassen. Als der Sommer nahte, wurden wir dann doch zu einem Opfer aufgefordert. Als Gerichtsassessor fungierte mein Vater als Richter für die Zeit zwischen den Sitzungsperioden. So war unsere jährliche Reise ans Meer nicht länger möglich oder wurde zumindest für unmöglich gehalten, da mein Vater nicht täglich pendeln konnte. Meine Eltern mieteten ein Haus nahe Leith Hill, das zwei alten Misses Wedgwood gehörte. Von dort konnte mein Vater zum Bahnhof in Abinger fahren und rechtzeitig zur Arbeit in seinem Richterzimmer erscheinen, spätnachmittags kam er zurück. Das Haus war um einiges geschmackvoller möbliert als unser eigenes, und ich nehme an, dass ich auf vage, noch unbewusste Weise für derlei empfänglich war, denn dieses Intermezzo in meinem Leben ist mir in besonders glücklicher Erinnerung. Außerdem war der Garten weitläufig und erstreckte sich bis in ein bewaldetes Tal, das zum Haus gehörte und in dem wir uns frei bewegen konnten. Das Opfer zu Ehren unseres Vaters kostete uns also nichts, und ich glaube, wir genossen diesen Urlaub weit mehr als unsere üblichen Ferien in einer langweiligen Pension am Meer. Mein Vater hatte angefangen, sich für mich zu interessieren. Ich war alt genug, dass er sich ohne allzu große Herablassung mit mir unterhalten konnte, und oft unternahmen wir lange Spaziergänge in Leith Hill und Umgegend. Es war das Jahr 1877, der Russisch-Türkische Krieg war in vollem Gange, und ich weiß noch, wie mein Vater mir erzählte, er hoffe nicht nur, dass die Russen gewinnen, vielmehr glaube er fest daran, denn Gott werde nicht zulassen, dass ein mohammedanisches Land ein christliches besiege. Viele Jahre vergingen, bis mir die Ungeheuerlichkeit einer solchen Behauptung eines Mannes mit dem umfassenden geschichtlichen und naturwissenschaftlichen Wissen meines Vaters klar wurde. Damals erschien sie mir vollkommen natürlich und machte mich, ohne dass ich die geringsten Kenntnisse über das Für und Wider des Konflikts gehabt hätte, zu einem begeisterten Russophilen. Ein oder zwei Monate später, als ich mich an der privaten Sunninghill Preparatory School wiederfand, machte ich mich mit dieser Überzeugung, die ich stets mit rasch improvisierten Argumenten zu verteidigen bereit war, ziemlich unbeliebt, denn aus irgendeinem Grunde standen alle vernünftig denkenden Leute auf der anderen Seite. Ich glaube, der eigentliche Streitpunkt für alle, sogar für meinen Vater, war der Kampf zwischen Dizzy[12] und Gladstone[13].
Glücklicherweise hatte ich während unseres schönen Sommers in Leith Hill keine Ahnung von dem Schicksal, das mich erwartete. Als eines Tages ein Geistlicher namens Mr Sneyd-Kynnersley[14] zum Mittagessen erschien, fragte ich mich daher nicht einmal, weshalb dieses neue Gesicht aufgetaucht war, wo doch Besucher nur selten zu uns fanden. Nach dem Mittagessen wollte er einen bestimmten Aussichtspunkt in der näheren Umgebung besuchen, und ich wurde beauftragt, ihm den Weg zu zeigen. Ich vermute, dass er mich während des Spaziergangs aus der Reserve zu locken versuchte, nahm aber kaum Notiz von ihm oder von dem, was er sagte, glaubte ich doch in meiner grenzenlosen Unkenntnis der Welt, er sei nur ein zufälliger Bekannter, dem gegenüber meine Familie höflich sein wollte. Bald darauf verabschiedete er sich, danach wurde ich von meinen Eltern zu einer privaten Unterredung beordert, und der Blitz schlug ein – würde ich gern auf Mr Sneyd-Kynnersleys Schule gehen? Er eröffne eine neue Schule in Ascot, in einem schönen, von meinem Onkel Alfred Waterhouse[15] erbauten Landhaus – bei diesem Thema verweilten sie des Längeren, da sie glaubten, ich würde mich dort eher heimisch fühlen als in einem Haus, das von einem nicht mit uns verwandten Architekten erbaut sei. Ich, der ich so oft im Landhaus meines Onkels übernachtet hätte, würde mich freuen, überall die gleichen heiligen Kiefernbretter und im WC die gleichen gotischen Buntglasfenster vorzufinden. Mr Sneyd-Kyn-nersley sei den Jungen sehr zugetan, und es gebe keine Strafen. Ich verspürte nicht den leisesten Wunsch, auf diese Schule zu gehen, antwortete aber, wie es von mir erwartet wurde: dass es sehr nett wäre, bei dem fremden Geistlichen zur Schule zu gehen.
Und so zog ich denn im September tatsächlich um, bewaffnet mit einer silbernen Uhr, die mir mein Vater, und einer in schwarzes Leder gebundenen Bibel, die mir meine Mutter geschenkt hatte, und versehen mit vielen feierlichen Warnungen vor der Sünde und der Versicherung, dass mich die Bibel stets sicher durch die Widrigkeiten des Lebens geleiten werde.
Von nun an erhielt Lady Fry die ersten von vielen Schuljungenbriefen, die sie, zu kleinen Bündeln geschnürt, sorgsam verwahrte. Viele sind mit dem Saft wilder Blumen befleckt und enthalten heute noch verwelkte Knospen, die Roger auf seinen Spaziergängen pflückte und seinen botanisch interessierten Eltern schickte. Den Berichten über Schnitzeljagden und Schulkonzerte (bei einem Konzert sang Roger »The Tar’s Farewell«), über Kricket und Fußballspiele, Predigten und Besuche von Missionaren – »Wir werden an der Bishop Steer’s School einen Schwarzen aufnehmen. Ich glaube, es wird 60 Pfund per annum kosten. … Bei den meisten Dingen scheint er mithalten zu können, aber sein Charakter ist eher mittelmäßig« –, diesen Berichten lässt sich entnehmen, dass er in der Schule einigermaßen glücklich war und nicht nur einen eigenen Garten hatte, sondern auch Tiere halten durfte – darunter zwei neugierige und abenteuerlustige Schlangen. Was die Schularbeiten betrifft, so war er erfolgreich. Fast von Anfang an war er Schulprimus. Und doch enthalten die Briefe gewisse Sätze, die bei seinen Eltern Unbehagen ausgelöst haben dürften. Natürlich gab es Schultyrannen. Ein gewisser Harrison und ein gewisser Ferguson »schikanieren mich, sooft sie können, manchmal hänseln sie mich, manchmal schlagen sie mich …, aber ihr Lieblingstrick besteht darin, mich, wenn wir schwimmen gehen, unter Wasser zu drücken und zu ärgern«. Ansonsten aber kam er mit den Jungen gut aus und mochte die Spiele und die Schularbeiten. Die beunruhigenden Sätze betreffen die Lehrer. Mr Sneyd-Kynnersley hatte den Frys versichert, es werde keine Strafen geben. Und doch »wurden zwei Burschen gestern Stockschläge verabreicht, und morgen soll ein weiterer an die Reihe kommen. Dabei hat er nur beim Mittagessen mit einem anderen Jungen gespielt.« Der »mondgesichtige Junge« wiederum war gezüchtigt worden, weil er etwas Wasser an die Mauer geschüttet hatte. »Gestern Abend ist Ferguson in Kynnersleys Zimmer gegangen, ich weiß nicht, warum, aber er wurde erwischt, und ich musste mich anziehen und zum Rektorzimmer gehen. … Ferguson setzte sich so zur Wehr, dass Mr Holmes ihn festhalten musste.« Als Schulbester musste Roger bei der Verabreichung der Prügelstrafe anwesend sein. Das missfiel ihm sehr. »Ich habe vor, um Erlaubnis zu bitten, dass ich die Jungen nicht zum Prügeln hinaufbringen muss, denn es behagt mir nicht«, schrieb er seiner Mutter; doch der Rektor habe gesagt, das sei nun einmal »Aufgabe des Schulkapitäns; er hoffe aber, niemanden zu prügeln«. Ungeachtet dieser unzweideutigen Hinweise, dass Mr Sneyd-Kynnersley sein Versprechen nicht hielt, legten die Eltern keinen wirksamen Protest ein. Die Briefe berichten weiterhin von Leckerbissen und Schnitzeljagden und Masern und Frostbeulen und langen Botanisierausflügen in Chobham Common, als sei das Leben in Sunninghill House eine recht passable Erfahrung gewesen. Jahre später allerdings ergänzte Roger die Version des Schullebens, die er seinen Eltern gegeben hatte, um etliche Details. Er beginnt mit einem Porträt von Mr Sneyd-Kynnersley:
Mr Sneyd-Kynnersley hatte Verbindungen zur Aristokratie, und dank einem kunstvollen Wappen mit doppelter Helmzier, eine für Sneyd, die andere für Kynnersley, wurde sein Doppelname noch beeindruckender. Das Wappen tauchte an allen möglichen Stellen im Haus auf und wurde in Gold auf die Einbände der Bücher für die besten Schüler geprägt. Er war ein hochgewachsener, schlaksiger Mann mit Adlernase und kantigen Gesichtszügen. Er hatte etwas von einem Dandy. Nur die weiße Krawatte und das schwarze Tuch wiesen ihn als Geistlichen aus – er scheute Kollar und Soutane. Doch sein größter Stolz und seine größte Pracht war sein wehender roter Backenbart à la Dundreary[16], der wie Fledermausflügel zu beiden Seiten seiner schlaffen Wangen flatterte. Wie viel Befriedigung ihm dieser bereitete, war daraus ersichtlich, dass er ihn geistesabwesend während des Unterrichts unaufhörlich streichelte. Er war so hochkirchlich, wie es sich mit seinem Selbstbild als Gentleman, ja fast als Mann von Welt vertrug. Aber er sprach salbungsvoll von der Achtung vor der Geistlichkeit und war zutiefst überzeugt von der Überlegenheit, die sein Priesterstand ihm verlieh. Er war ausgesprochen eitel. Seine Bildung beschränkte sich weitgehend darauf, dass er als Student in Cambridge einer Dickens-Gesellschaft angehört hatte, die äußerste Bewunderung für den großen Mann hegte und die Kenntnis seiner Romane mithilfe von Klausuren prüfte, aus denen er häufig zitierte. Jeden Abend vor dem Schlafengehen las er der gesamten Schule Dickens vor, aber meiner Erinnerung nach sind wir über Die Pickwickier und Oliver Twist nie hinausgekommen. Dickens und Kebles[17]Christian Year waren, glaube ich, die einzigen Bücher, auf die er mich in den Jahren, da ich unter ihm lernte, aufmerksam machte. Ich bezweifle, dass er jemals etwas anderes gelesen hat, jedenfalls nichts, was ihn daran gehindert hätte, ein bigotter und ignoranter hochkirchlicher Tory zu sein.
Den Jungen allerdings war er aufrichtig zugetan und genoss ihre Gesellschaft. Ständig organisierte er Ausflüge – während eines kalten Winters brachte er die Oberstufenschüler für ausgedehnte Nachmittage zum Eislaufen auf dem Basingstoke Canal – im Sommer fuhren wir nach Eton und wurden stets großzügig mit Tee und Kuchen, Erdbeeren und Schlagsahne bewirtet. Die Schule war, glaube ich, sehr teuer, aber alles sehr geschmackvoll gehalten und das Essen viel besser, als ich es gewohnt war.
Da die Jungen meist aus eher aristokratischen Familien stammten, fiel mir der Umgang mit ihnen viel leichter als mit denen, die ich später an einer weiterführenden Privatschule kennenlernte. Sie hingen nicht in demselben Maße der Idee der »guten Form« an, waren viel natürlicher und bereit, Dinge zu akzeptieren. Insgesamt wäre meine Zeit in Sunninghill House mehr als erträglich gewesen, hätte es nicht eine Sache gegeben, die mein ganzes Leben dort vergiftete.
Wenn meine Eltern mir sagten, es werde keine Strafen geben, so stimmte daran eines: dass die Lehrer niemals Strafarbeiten aufgaben oder Jungen nachsitzen ließen. Doch wie Mr Sneyd-Kynnersley uns gleich am ersten Morgen, als wir alle versammelt waren, mit feierlicher Begeisterung erklärte, behielt er sich das Recht vor, mit der Birkenrute eine tüchtige Tracht Prügel zu verabreichen. Wie meine Eltern, die, was sprachliche Ungenauigkeiten anging, äußerst pingelig waren, es mit ihrem Gewissen vereinbarten, mir diesen Sachverhalt zu verschweigen, habe ich nie herausgefunden, aber ich bezweifle nicht, dass sie Bescheid wussten, andernfalls hätten sie sich, als ich ihnen den schrecklichen Umstand offenbarte, überraschter gezeigt.
Für mich jedenfalls war die Birkenrute eine ernste Angelegenheit. Nicht, dass ich sonderliche Angst davor hatte, denn ich war von einer so widerlich gesetzestreuen Gesinnung, dass ich diese Strafe kaum je auf mich selbst gezogen hätte. Doch die gesamte erste oder zweite Klasse hindurch war ich von Amts wegen verpflichtet, bei Prügelstrafen anwesend zu sein und den Missetäter festzuhalten. Das Ritual war sehr präzise und feierlich – jeden Montagmorgen wurde die ganze Schule in der Aula zusammengerufen und der Verhaltensbericht eines jeden Schülers vorgelesen.
Hatte ein Klassenlehrer einen schlechten Bericht verlesen, unterbrach ihn Mr Sneyd-Kynnersley und sagte nach einem Augenblick schrecklichen Schweigens: »Harrison, du wirst nachher in mein Arbeitszimmer kommen.« Und so wurde der Missetäter anschließend von den beiden Schulsprechern hinaufgeführt. In der Mitte des Zimmers stand eine große, mit schwarzem Stoff verhängte Kiste, und der Missetäter wurde mit strenger Stimme angewiesen, seine Hose herunterzulassen und sich vor den Block zu knien, wo ich und der andere Junge ihn festhielten. Der Rektor verabreichte die Prügel mit ganzer Kraft, und es brauchte nur zwei oder drei Hiebe, bis die ersten Tropfen Blut hervorquollen. So ging es fünfzehn bis zwanzig Hiebe weiter, bis das Hinterteil des armen Jungen voller Blut war. Natürlich ertrugen es die Jungen im Allgemeinen mit Fassung, mitunter aber gab es Szenen mit Geschrei, Geheul und Gestrampel, bei denen mir vor Abscheu fast schlecht wurde. Außerdem hatte der Schrecken noch längst kein Ende. Es gab einen wilden rothaarigen irischen Jungen, selber ein ziemlich grausamer Rohling, der, ob mit Absicht, infolge der Schmerzen oder weil er Durchfall hatte, Exkremente ausschied. Statt sofort innezuhalten, fuhr der erzürnte Geistliche mit gesteigerter Wut fort, bis Decke und Wände seines Arbeitszimmers mit Unrat bespritzt waren. Ich vermute, dass er sich dessen hinterher schämte, denn er rief nicht etwa die Bediensteten herbei, um sein Zimmer von diesen säubern zu lassen, sondern verbrachte Stunden damit, es selbst zu tun – mithilfe eines Jungen, der sein besonderer Liebling war.
Ich glaube, allein diese Tatsache beweist, dass er bei den Züchtigungen ein heftiges sadistisches Vergnügen empfand und dass dieses Gefühl durch die Haltung des armen Opfers noch verstärkt wurde, ansonsten hätte er die Strafe gewiss auf einen geeigneteren Zeitpunkt verschoben.
Daher war der Montagmorgen stets eine furchtbare Zeit für uns. Fast immer kam es zu ein oder zwei Züchtigungen, manchmal jedoch ließ sich den Wochenberichten kein hinreichender Vorwand entnehmen. Trotz Muße und Amüsement war mir der Sonntag durch die ängstliche Erwartung der Sitzung am folgenden Morgen verdorben, und oft lag ich wach und betete fieberhaft und fast immer vergebens, niemand möge verprügelt werden. Aber man konnte nie sicher sein, dass man nicht doch geholt wurde. Eines Abends, als ich eben am Einschlafen war, ließ mich der Rex, wie wir Mr Sneyd-Kynnersley nannten, in sein Arbeitszimmer kommen. Wir schliefen in Kubikeln, manchmal zu dritt oder zu viert in einem einzigen großen Schlafzimmer, und der Rex hatte einen Jungen zum anderen sagen hören: »Wie ärgerlich, ich hab vergessen zu strullen: Ich muss aufstehen.« Diese unanständige Ausdrucksweise verdiente natürlich eine brutale Züchtigung, und wegen der Aufregung, in die ich versetzt wurde, war meine Nachtruhe dahin. Ich will nicht leugnen, dass meine Reaktion auf all das krankhaft war. Ich weiß nicht, was für Komplikationen und Verdrängungen dahinterstanden, aber ihre Verbindung mit Sex wurde mir eines Tages plötzlich klar, als ich, nachdem ich bei einer Prügelstrafe assistiert hatte, wieder auf mein Zimmer ging … in meiner unerinnerten Vergangenheit war mir aller Sex verborgen geblieben. Einen Beweis dafür finde ich darin, dass ich in den Jahren der Vorbereitungsschule die Bibel von vorn bis hinten durchgelesen hatte, ohne auch nur die leiseste Aufklärung zu erfahren, nicht einmal bei den zotigsten Stellen des Alten Testaments. Wie, werden Sie sich fragen, hatte ich dieses Kunststück vollbracht? Meine Mutter hatte mir die höchste Tugendhaftigkeit und die unvergleichliche prophylaktische Kraft der Bibellektüre dermaßen eingeschärft, dass ich mich bei den unvermeidlichen Schwierigkeiten und Ängsten des Schullebens unweigerlich auf ihre Hilfe verließ. Dies gelang mir, indem ich jeden Morgen früh erwachte und, bevor die Ankleideglocke ertönte, ein oder zwei Kapitel las. Es war der reinste Fetischismus: je länger die gelesenen Passagen, desto besser die Aussichten für den Tag. Ich wandte weder mein Denk- noch mein Vorstellungsvermögen auf das Gelesene an, und tatsächlich waren mir die Geschichten aus unserem sonntäglichen Bibelunterricht vor langer Zeit fast alle vertraut. Dennoch war ich kein dummer Junge, es mangelte mir auch nicht an Neugier auf gewisse Dinge, und meine völlige Unempfänglichkeit für jedes Verständnis von Sex zu erklären fällt mir schwer.
Aber was immer die Ursache, mein Grauen vor der Prügelstrafe war gewiss krankhaft, und mein ganzes Leben hindurch ist mir ein krankhaftes Grauen vor jeglicher Gewalt zwischen Menschen geblieben, sodass ich selbst ihre Simulation auf der Bühne kaum ertragen kann. …
Zweifelsohne werden Sie längst zu der Schlussfolgerung gelangt sein, dass Mr Sneyd-Kynnersley zumindest unbewusst Sodomit war, doch wenn ich zurückblicke, bin ich nahezu davon überzeugt, dass er es nicht war und dass seine unbestrittene Zuneigung zu Jungen auf seiner eigenen gehemmten Entwicklung beruhte. Er war gewiss sehr eitel, und ich vermute, wenn er sich unter Erwachsenen bewegte, hinterließ seine äußerst dürftige geistige Ausstattung bei ihm ein Gefühl leichter Unterlegenheit. So erkläre ich mir auch die Sorgfalt, mit der er sich aller intelligenten Lehrer entledigte und sie durch Schwachköpfe ersetzte. Insofern war es nur natürlich, dass er sich unter Knaben, denen gegenüber er sich mehr als behaupten konnte und deren elementare Art Humor seiner eigenen entsprach, am wohlsten fühlte.
Dies ist Roger Frys eigene Darstellung der Vorgänge, die sich hinter der Fassade seiner Briefe aus der Schule abspielten. Er glaubt, dass sie sein Leben lang nachgewirkt haben. Und doch scheint er Mr Sneyd-Kynnersley gegenüber nicht nachtragend gewesen zu sein. »Es tut mir sehr leid«, schrieb er ein paar Jahre später, als sein alter Lehrer starb, »denn obwohl er mir nie viel Respekt einflößte, so war er doch, glaube ich, alles in allem herzensgut.« Und Mr Sneyd-Kynnersley muss eine gewisse Zuneigung zu seinem ehemaligen Schüler empfunden haben; denn als er starb, hinterließ er Roger Fry in seinem Testament »ein hübsches kleines Exemplar von Arnolds[18] Predigten«.
III
Von Sunninghill mit seinen verkrüppelten Kiefern undseiner zerzausten Heide wechselte er 1881 ans Clifton College. Der Rektor von Clifton, Kanonikus Wilson[19], war von anderem Schlage als Mr Sneyd-Kynnersley. »Man sieht ihn dort stehen«, schrieb ein Alumnus, »an dem Katheder aus schlichtem Kiefernholz, wo vor ihm Percival[20] unterrichtet hatte, eine groß gewachsene, hagere Gestalt mit mächtigem Bart und buschigen Augenbrauen wie ein alttestamentlicher Prophet.« Und der innere Unterschied zwischen beiden war nicht weniger ausgeprägt als der äußere. Er war ein Mann von höchstem akademischem Rang, Senior Wrangler (bester Mathematikstudent seines Jahrgangs) und Fellow (Mitglied des Lehrkörpers) von St John’s, Cambridge. Mr Sneyd-Kynnersleys Gewohnheit, »sich jedes intelligenten Lehrers zu entledigen«, war ihm nicht zu eigen, vielmehr waren seine Kollegen in Clifton »Männer von ungewöhnlicher Fähigkeit und Individualität« – Männer wie Wollaston und Irwin, Norman Moor und W.W. Asquith[21]. Clifton College war »eine Privatschule neuen Typs«. In siebzehn Jahren hatte sie in nicht geringem Umfang John Percivals Vision einer Privatschule verwirklicht, die »eine Pflanzenschule oder ein Saatbeet für hochgesinnte Männer sein sollte, die sich dem höchsten Dienst am Land verschreiben, eine neue christliche Ritterschaft patriotischen Dienstes«. Und Percivals Ideal – ein Ideal »nicht nur der Schlichtheit, Ernsthaftigkeit, Bescheidenheit und Emsigkeit, sondern auch der Hingabe an den öffentlichen Dienst« – war das Ideal, dem nunmehr auch Kanonikus Wilson seine immense Fähigkeit und Begeisterungskraft widmete. Insofern war Clifton eine ganz andere Lehranstalt als Sunninghill. Es gab keine Prügelstrafe mehr. Die Schultyrannen Harrison und Ferguson mit ihren roten Knollennasen und ihren kleinen rotgeränderten Augen wurden durch ruhige und gewissenhafte Jungen abgelöst, deren einziger Fehler den Briefen nach Hause zufolge darin bestand, dass sie allzu sehr darauf bedacht waren, die Privatschulkonvention der »guten Form« zu befolgen. In Rogers neuem Studierzimmer waren keine Schlangen erlaubt. Der Junge, mit dem er das Zimmer teilte, nahm Anstoß an seinem Durcheinander – mit einem Gerät eigener Erfindung versuchte Roger erfolglos, Omelettes zuzubereiten. »Man kann fast nichts tun«, beklagte er sich, »aus Angst, das Zimmer könnte, wie Wotherspon immer sagt, ›auf jeden, der hereinkommt‹, weniger prächtig wirken.« Verglichen mit den eher kindlichen Mitschülern in Sunninghill war die Gemeinschaft von sechshundert Knaben hoch organisiert. Vielleicht lebte das Clifton College seine Tugenden deswegen aus, weil es neu war; die Schule musste die neuen Standards durchsetzen und versuchte beinah aggressiv, ihnen Genüge zu tun. Die Maschinerie war effizient, und Roger Fry scheint von ihr völlig zermürbt worden zu sein. Eher pflichtbewusst und der Form halber notierte er: »Ein Bursche namens Reed hat den Short-Penpole-Wettlauf gewonnen, der am Donnerstag in einem dieser eiskalten Ostwinde stattfand«; »Clifton College hat in Wimbledon den Schießwettbewerb Ashburton Shield gewonnen. … Der Achter kam gestern Abend zurück …, begleitet von den Gloucestershire Engineer Volunteers, bei denen wir einen Kompanie bilden. … Vom Obmann des Achters bekam Wilson den Schild überreicht und hielt eine Rede, auf die Colonel Plank, der Colonel des Regiments, antwortete. … Danach wurden die acht auf den Schultern in ihre Häuser getragen.« Es gab die üblichen Spiele und Prüfungen – »Ach, gäb’s doch bloß diese Examen nicht. Ich bin überzeugt, dass sie für eine Erziehung der höchsten Art nicht von Vorteil sind!«, ruft er aus – und die üblichen ansteckenden Krankheiten, von denen er mehr als genug abbekam. Missionare baten um Geldspenden; und »dank einer ernsten, wenn auch zusammenhanglosen und weitschweifigen Rede erhielt ein gewisser Mr Johnson 70 Pfund für ein Dampfschiff auf dem Victoriasee«. Gelegentlich fesselte ein Lehrer seine Aufmerksamkeit: »Ein gewisser Mr Upcott[22] hielt einen Vortrag über griechische Kunst, und auf den Fotos vom Fries des Parthenon fiel mir etwas Merkwürdiges auf, nämlich ein Reiter, der offenbar mit dem Rücken zum Kopf des Pferdes reitet.« Auch Miss Jane Harrison[23] hielt einen Vortrag über griechische Kunst, der ihm ausgesprochen gut gefiel. Was seine schulischen Leistungen betrifft, so machte er seine Sache so gut, dass er 1882 zu den zwanzig besten Schülern gehörte, auch wenn seine Leistungen in den Fächern Griechisch, Latein und Englisch nur durchschnittlich waren, und er fand, dass »in der fünften Klasse zu sein sehr viel schöner war, denn ein ›Diener‹ zu sein«.
Sein stärkstes Interesse jedoch galt den Naturwissenschaften; und die größte Freude bereitete ihm das Labor. Es machte ihm »ungeheuren Spaß«. Dort konnte er eigene Experimente durchführen. Meistenteils berichten seine Briefe nach Hause von diesen Experimenten, an denen seine Eltern sehr interessiert waren – »eines bestand darin, zu untersuchen, wie schnell Körper fallen; ein anderes betraf das spezifische Gewicht von Kerzenfett. … Von den Fischhändlern bekam ich einen Eisblock, anhand dessen ich seine Regelation demonstrieren konnte, indem ich ihn mit einem Draht entzweischnitt.« Außerdem malte er, bescheiden, sparsam. Mit Feuchtöl für einen Penny, Zinkweiß für zwei Pence und Pinseln für einen Penny verzierte er »zwei hübsche kleine Terracotta-Teller« mit Blumenmustern. Blumen, die er an halben freien Tagen auf den Hügeln pflückte und überaus korrekt mit ihren langen lateinischen Namen versah, füllen einen großen Teil der Wochenchronik – einen größeren als die Spiele. In Portishead, wo sein Vater in seiner Kindheit botanisiert hatte, fand er »Lithospermum purpureocaeruleum. Ich muss Euch alles darüber erzählen, denn das ist fast das einzig Wichtige, das sich diese Woche ereignet hat.« Oft gab es »keine Neuigkeiten, seit ich zuletzt geschrieben habe«, und der Brief nach Hause enthält eine leere Seite. Einmal allerdings ereignete sich eine Sensation: Ein Junge namens Brown, der »wegen gewisser Wettgeschäfte ins Büro geschickt« worden war, zog »ein großes Messer aus dem Ärmel und stach auf den Schulleiter ein. … Offenbar zielte er auf sein Herz, traf ihn aber nur in die rechte Schulter und verfehlte die Arterie um drei, vier Zentimeter« – ein Verbrechen, das zum Teil auf die Werke Miss Braddons[24] zurückgeführt wurde, »an denen er eine Art grausiges Vergnügen fand«.
Doch abgesehen von dieser Sensation scheinen die Schultrimester sich hingezogen zu haben: schwerfällig, achtbar, eintönig. Die Wochen, die Tage, die ihn von den Ferien trennen, werden akribisch gezählt und durchgekreuzt. Ob die Schuld nun bei Roger selbst oder beim Privatschulsystem lag, es ist sonderbar, wie wenig so bemerkenswerte Männer wie Wollaston und Irwin und Norman Moor und Wilson seine Schale aufbrachen; wie hilflos er eine Routine über sich ergehen ließ, die nichtsdestotrotz eine »mürrische Revolte« gegen das »gesamte Privatschulsystem … und all die imperialistischen und patriotischen Gefühle, die es nährte«, in ihm auslöste. Die blitzsaubere Hässlichkeit der neuen Kalksteingebäude deprimierte ihn nur noch mehr.
Die Schale wurde schließlich nicht von einem Lehrer aufgebrochen, sondern von einem Mitschüler. Eines Tages im Jahre 1882





























