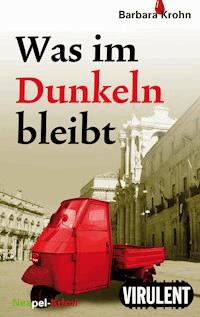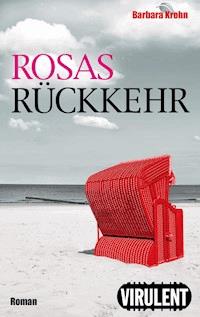
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Juni 1991. Rosa Liebmann, jüngste von fünf Geschwistern, steckt in der ersten großen Krise ihres Lebens. Ihr Freund hat sie verlassen, nun kehrt sie, nach fast zwanzig Jahren in San Francisco, zurück nach Deutschland, ins Ostseebad Scharbeutz. Als sie in Hamburg den Zug nehmen will, entdeckt sie auf dem Bahnsteig ihre fast siebzigjährige Mutter – in den Armen eines fremden Mannes. Am nächsten Morgen, beim ersten Strandspaziergang, spürt Rosa, wie sehr sie sich nach ihrer Heimat gesehnt hat. Doch die Idylle trügt. In einem Strandkorb findet Rosa ihren Vater, den wohlhabenden Ladenbesitzer, Patriarchen und Herzensbrecher Friedrich Liebmann – aus nächster Nähe erschossen. Abgründe tun sich auf, als jedes Mitglied der Familie in Verdacht gerät und die Vergangenheit wieder einmal nicht vergangen ist. Zumal Rosas Jugendfreund Hanno Finn die Ermittlungen leitet … INGRID NOLL ÜBER ROSAS RÜCKKEHR "Barbara Krohns neuer Roman 'Rosas Rückkehr' schildert äußerst subtil die Gefühle einer jungen Frau, die nach langem Aufenthalt zurück in ihre Heimat kommt und dort bereits am ersten Morgen mit einem Mord konfrontiert wird. Nach und nach lernt man eine vielköpfige Familie kennen, in der es nicht nur brodelt, sondern richtig kocht. Fünf Geschwister, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, die in Liebe entbrannte siebzigjährige Mutter, ein gutaussehender Polizist und die Ostsee spielen die Hauptrollen. Ich habe dieses Buch nur zum Essen und Schlafen aus der Hand gelegt."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2007
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Ruth, Eberhard und Phil
»You can go your own way go your own way ...«(Fleetwood Mac)
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Impressum
E-Books von Barbara Krohn
Neapel-Krimis
1
Der Mann links neben ihr, der in New York zugestiegen war, benutzte dasselbe After Shave wie Steven – und Steven war das allerletzte, woran Rosa erinnert werden wollte. Seit ihrem Abflug ging das so: Seit sie morgens in San Francisco ins Flugzeug gestiegen war, schlich die Vergangenheit sich an, überfiel sie ohne Vorwarnung, geradezu hinterhältig. Und ohne zu differenzieren, zu gewichten: die einen ins Kröpfchen, die andern ins Töpfchen. Hier oben in der Luft schienen sämtliche Abwehrmechanismen außer Kraft gesetzt zu sein. Freie Bahn für Erinnerungen jeder Art.
Eine Zumutung, dachte Rosa. Wenn sie das geahnt hätte, hätte sie gleich da bleiben können. Nach Stevens unrühmlichem Verschwinden aus ihrem Leben war sie lange genug ziellos in dieser trüben Brühe aus Gestrigem und Vorgestrigem getrieben, ohne Land in Sicht, geschweige denn festen Boden unter den Füßen. Überall, wohin sie auch ging, hatte die Rosa-und-Steven-Vergangenheit gelauert: bedrohlich, fratzenhaft, manchmal verzerrt wie die unkenntlich gemachten Stimmen und Gesichter geständiger Verbrecher in irgendeinem Fernsehsender. Stevens Verbrechen war anderer Natur und vor allem nicht strafbar. Steven hatte Rosa verlassen. Wegen einer anderen Frau. Nach acht gemeinsamen Jahren. So etwas passierte wirklich. Nicht nur auf dem Bildschirm. Und nicht nur den anderen.
Alles halb so wild, sagten Rosas Freundinnen, just forget it. Jede von ihnen kannte mindestens zwei andere hundsgemeine Fälle, neben denen sich Rosas Misere wie eine leichte Verkühlung ausnahm: Bei ihr waren schließlich keine Kinder mit im Spiel. Steven hatte sie nicht geschlagen, ihr nicht die letzten Ersparnisse aus den Rippen geleiert. Er war doch nur gegangen. Nur. Damit würde sie schon klarkommen. Ein paar Tage Auszeit, Schwamm drüber, neue Liebe, neues Glück, und bald würde die Welt wieder rosiger aussehen.
Aus den Tagen aber waren Wochen und Monate geworden, und ein Tag war so trüb gewesen wie der andere. Rosa hatte gar nicht klarkommen wollen mit der neuen Situation. Sie war nicht aus dem Haus gegangen, hatte die alten Freunde nicht mehr getroffen, die alten Wege gemieden, vor allem das For Roses. Sie hatte sich eingeigelt, das Essen per Telefon bestellt, im Bett gelegen, gegessen, geheult, geschlafen, auf den Bildschirm gestarrt, ohne etwas zu sehen. Eines Morgens hatte sie im Spiegel die ersten weißen Haare an den Schläfen entdeckt. Sie war zum Friseur gegangen, um die Haare tönen zu lassen. Ein erster Schritt hinaus, zurück in die Welt. Und welch ein Genuß, die sanft auf der Kopfhaut kreisenden Fingerspitzen der Friseurin, das lauwarme Wasser, dieses einmalige Gefühl, den eigenen Kopf in die Hände eines anderen Menschen zu legen. Von da an war sie zweimal pro Woche zu Jane gegangen, hatte sich auf dem blauem Diwan ausgestreckt und sich professionell die Wunden lecken lassen. Seelenmassage. Das Leben geht weiter. Die Zeit arbeitet für dich. Die Zeit heilt alle Wunden, hatte Jane gesagt. Rosa solle nach vorn blicken, nicht zurück.
Sie hatte es versucht, sie hatte es wirklich versucht – aber es war so verdammt schwer in einer Stadt, in der man seit über zehn Jahren lebte, in der in allen Himmelsrichtungen genau jene Erlebnisse auf Rosa lauerten, die sich nach Janes weisem Ratschluß in Vergangenheit verwandeln würden: Steven im Golden Gate Park, Steven am Pazifik, Steven in der J-Church, Steven im Delikatessenladen in der Haight Street. Überall Steven. Wie eine gigantische Werbekampagne, die exklusiv für Rosa lanciert worden war. Ganz von selbst war Rosa also zu einem, wie sie fand, mindestens ebenso weisen Ratschluß gekommen: Wenn sie nach vorn blicken und alles hinter sich lassen sollte, dann mußte sie San Francisco völlig den Rücken kehren. San Francisco war die Vergangenheit, und die neue Gegenwart würde, für einige Zeit zumindest, Deutschland heißen, genauer gesagt Scharbeutz an der Ostsee. Vor sechzehn Jahren war es genau umgekehrt gewesen. Damals hatte Rosa es kaum erwarten können, endlich wegzukommen von zu Hause, aus der Enge von Familie und Dreitausendseelengemeinde, und zwar so weit weg wie möglich. Damals war Scharbeutz die Vergangenheit gewesen, der sie den Rücken kehrte, und die Gegenwart hieß Amerika. Und nun retour das Ganze. Back to the roots. Der Weg zurück als Weg voran? Es klang zumindest vielversprechend.
Doch schon beim Abheben des Flugzeugs erste flash backs, die wie Wolkenfetzen an Rosa vorbeitrieben. Kurz blitzten Bilder früherer Flüge, Abflüge, Ankünfte auf: Wer sie wann wo zum Flughafen gebracht und wer sie wann wo abgeholt hatte, in welchem Jahr das jeweils gewesen war, welchen Job sie hatte, wo sie wohnte. Rosa war machtlos: Die Situationen blätterten sich in wilder Reihenfolge vor ihrem inneren Auge auf, sie konnte gar nicht anders, sie mußte hinschauen, und natürlich landete sie dabei automatisch doch wieder bei Steven. Bei ihrer gemeinsamen Wohnung, der gemeinsamen Kneipe, bei seinen Rosen, seinen Küssen ...
Sie versuchte sich abzulenken, blätterte in der Bordzeitschrift, sah dann dem Film zu, einer Liebeskomödie, die an der Ostküste spielte. Die Frau war reich und sympathisch, der Mann arm und attraktiv, die Geschichte harmlos und absehbar. Gegenwart, pure Gegenwart. Rosa vergaß sogar, darauf zu achten, auf keinen Fall das After Shave des Nachbarn einzuatmen.
Sie bestellte einen Wodka Tonic mit Eis. Der junge Steward, der Rosas Sitzreihe bediente, ähnelte auf verblüffende Weise ihrem Ex-Mann: Gesichtsschnitt, Haarfarbe, Augen, auch Alans Lächeln, seine ganze Art, sich zu bewegen – und schon war die Vergangenheit wieder am Zug. Rosa fühlte sich um anderthalb Jahrzehnte zurückversetzt, in die Zeit, als sie sich noch von rauchig riechenden Karohemden, rauhen, zupackenden Händen, James-Taylor-Look und Straßenkreuzern hatte betören lassen.
Wie jung sie damals gewesen war, unerschrocken, unerfahren, naiv. Damals war sie mit dem Geld, das sie auf Long Island beim Tellerwaschen verdient hatte, eine Zeitlang die Ostküste entlanggereist und war schließlich mit zehn Dollar in der Tasche in Pittsburgh gelandet. Den nächsten Job fand sie in einem Drive-in, zuerst in der Küche, dann an den Tischen, nur die Bezahlung war lausig, besser als gar nichts zwar, aber schlechter als auf Long Island. Da kam Alan wie gerufen und gleich an drei Tagen in Folge. Er setzte sich stets an denselben Tisch, wo sie ihm Bacon and Eggs servierte, und am dritten Tag ließ sie alles stehen und liegen, verzichtete sogar auf den noch ausstehenden Wochenlohn, holte ihre Siebensachen aus dem dunklen Loch, das sie mit noch zwei anderen Mädchen teilte, und stieg erhobenen Hauptes in Alans staubigen dunkelblauen Cadillac, der direkt vor der Eingangstür hielt, einen Fleetwood »Sedan«, Baujahr 1956 – Rosas Geburtsjahr, das mußte einfach Glück bringen. Auf dem langen Weg nach Westen mit ihrem Fleetwood Mac, wie Rosa Alan eine Zeitlang zärtlich nannte, liebten sie sich auf allen sieben Sitzen, ließen nonstop die Songs der gleichnamigen Popgruppe laufen, rauchten Marihuana. Ein paar Kilometer vor Las Vegas gab der Fleetwood den Geist auf – kaputter Kühler. Sie mußten über Nacht in der Stadt bleiben und beschlossen kurzerhand zu heiraten. Was war schon dabei? Abends gingen sie dann ins Casino, um die letzten hundert Dollar zu setzen, Rosa fünfzig, Alan fünfzig, les jeux sontfaits. Alan gewann, Rosa verlor, den Spaß war es allemal wert, außerdem konnte die Kühlerreparatur bezahlt werden.
Auch die Ehe war den Spaß wert gewesen, und der hielt immerhin ein ganzes Jahr lang an. Dann verlief sich die Geschichte ebenso leichtfüßig, wie sie begonnen hatte. Wie man beschloß, sich ein neues Paar Joggingschuhe zuzulegen. Das Spiel war aus – undramatisch und ohne wesentliche Konsequenzen. Man vollzog schlicht eine minimale Kurskorrektur und ging ebenso freundschaftlich auseinander, wie man sich begegnet war, zufällig und unbeschwert, neuen Abenteuern entgegen. Rosa hatte nur selten an ihren ersten Mann gedacht, und als sie es jetzt tat, wußte sie nicht einmal mehr, warum sie Alan damals geheiratet hatte, vom Spaß, dem Geruch des Karohemds und dem dunkelblauen Fleetwood einmal abgesehen. Sie waren sich seither nie wieder begegnet. Alan lebte irgendwo in Oregon. Weshalb sollte man auch die rissigen, abgewetzten Joggingschuhe Jahr für Jahr aufs neue hervorholen und begutachten und womöglich obendrein erwarten, daß sie sich in der hintersten Ecke des Schrankes ganz von allein rundum erneuert hatten?
Damals war alles so einfach gewesen. Jedenfalls stellte es sich rückblickend so dar. Mit achtzehneinhalb war Rosa in New York gelandet – in der Tasche vierhundert Dollar, die sie sich in den Sommerferien in Vaters Bernsteinladen verdient hatte. Zukunft? Es gab nichts, das ihr damals gleichgültiger gewesen wäre. Das Abenteuer lockte überall und hatte ein lachendes Gesicht. Eine Zeitlang hatte es ausgesehen wie der Fleetwood Mac, nach der Scheidung wechselten Landschaften und Gesichter. Rosa war kreuz und quer durch den Kontinent getrampt, ohne jemals in eine Leib und Seele gefährdende Situation zu geraten. Kein Autounfall, kein Erdbeben, kein neugieriger Nationalparkbär, kein handgreiflicher Wüstling. Ein Lastwagenfahrer hatte sie statt in Denver, wo sie einen Erntejob auf einer Farm antreten sollte, in Salt Lake City abgesetzt. Ein attraktiver Mittdreißiger in einem ebenso attraktiven Thunderbird hatte sie über Hunderte von Meilen mit seinen Impotenzproblemen vollgesülzt, zum Abschied dann ein feuchter Händedruck, thanks for listening, good luck. Sie hatte einfach Glück gehabt. Auch was Jobs betraf: Irgend etwas fand sich immer. Popcorn verkaufen im Baseballstadion. Deutschstunden für die Enkel einer noch rechtzeitig ausgewanderten Wiener Jüdin. Büroarbeiten in einem Ein-Mann-Betrieb für Leuchtreklamen, Kühlschrankputzen inbegriffen. Diverse Putz- und Kneipenjobs, Ausführen von Hunden und Kindern, Stapeln von Weißbroten und Bohnendosen in Supermarktregalen, Aushilfe in der Theaterrequisite, Kartenabreißerin und dann war sie Steven über den Weg gelaufen. Oder er ihr. Entscheidend daran war, daß sie zusammen weitergegangen waren. Bis zu diesem schrecklichen Tag, der nun schon fast ein Jahr zurücklag ...
Der Mann neben Rosa unternahm einen Versuch, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Sein Englisch klang verdächtig deutsch, seine Stimme war angenehm, sein Äußeres auch, leider benutzte er Stevens After Shave. Keine Chance. Rosa antwortete knapp, wandte sich demonstrativ ab und griff nach dem Krimi, den sie bereits zwischen San Francisco und New York durchgelesen hatte.
Nach einer halben Seite verschwammen ihr die Buchstaben vor Augen – statt dessen tauchte zu allem Überfluß vor dem Einschlafen ungefragt die Familie auf: ihre Mutter, ihr Vater, ihre vier älteren Geschwister ... Köpfe aus Holz, die wie auf dem Jahrmarkt an einem unsichtbaren Band vor dem innerem Auge vorüberzogen, ganz nach Bedarf und Laune. Wer will noch mal, wer hat noch nicht, drei Wurf ’ne Mark: Volltreffer! Ein Kopf nach dem anderen verschwindet in der Versenkung, bei einigen ist schon der Lack ab, doch heute ist das einerlei, heute ist Familientag, meine Damen und Herren, versuchen Sie Ihr Glück, drei Köpfe – eine Stange saure Drops, vier Köpfe – eine Spielzeugpistole, fünf Köpfe – die freie Auswahl!
Werfen war nie Rosas Stärke gewesen. Es hätte garantiert nur für den Trostpreis gereicht. Auch ein Grund, weshalb sie damals nicht einfach nur von zu Hause weggegangen war, sondern gleich möglichst weit weg – ein großer Wurf ganz anderer Art namens Amerika, dabei hatte sie gar nichts gewonnen, nur etwas entschieden, und zwar über die zahlreichen Köpfe der Familie hinweg. Und das als Jüngste: Ich gehe. Plötzlich hörte sie ganz leise, aber deutlich, eine ihr wohlbekannte Stimme – als würde sie am Senderknopf des großen alten Radios drehen, das früher das Wohnzimmer der Familie schmückte, und nach einigem Knacken und Rauschen einen Sender hereinbekommen. Es war die Stimme ihres Vaters, sie klang zornig: Wenn du gehst, dann ...
Rosa warf den Kopf herum. In all den Jahren im Ausland hatte sie nie das Bedürfnis verspürt, Kindheit und Jugend wachzuhalten und sorgfältig zu pflegen, sich aus den lang vergangenen achtzehneinhalb Jahren in Deutschland ein weiches Emigrantenpolster zu weben, für den Fall akuter Sehnsucht. Sie hatte sich nicht regelmäßig einmal im Monat Schwarzbrot gekauft, sich nicht um Kontakt zu einer der deutschen Cliquen bemüht. Die Gegenwart war immer stärker und dringlicher gewesen. In dieser Gegenwart gab es durchaus auch deutsche Bücher und deutsche Bekannte, aber gleichrangig mit allen anderen, den Latinos, den Schwarzen, Filippinos, Indianern, Iren, Italienern, den Schwulen, Lesben, Heteros – die Welt war bunt und das Leben für niemand ein Zuckerschlecken.
Draußen wurde es dunkel, nur noch die Notbeleuchtung gab ein wenig Licht. Wie alle anderen Passagiere versuchte Rosa, der inneren Uhr zum Trotz, zu schlafen, aber sie war müde und hellwach zugleich. Ihre Gedanken ratterten kreuz und quer durch den Kopf wie eine außer Kontrolle geratene Nähmaschine. Sie wollte nicht daran denken, aber sie konnte nicht anders, es lag in der Luft, und die Luft brauchte sie zum Atmen. Vor ihrem inneren Auge entstand die rosafarbene Leuchtschrift. Sie sah die Tür mit den beiden auf das Glas gemalten Rosen, die Tische, am Anfang noch aus Holz, später gußeisern mit Marmorplatte, hinten die rosalackierte Bar, hinter der sie stand. Die Kongruenz von Name und Farbe war Stevens Idee gewesen, auch, daß als Hommage an die Liebe stets eine einzelne Edelrose auf dem Tresen stehen mußte. Es gab einen Cocktail, den sie nach Gertrude Stein benannt hatten, a rose is a rose is a rose is a rose. Einen anderen tauften sie Sleeping Beauty, sprich Dornröschen, einen dritten Bed ofRoses. Schon war Rosa wieder mittendrin in diesen guten Tagen des For Roses: Da waren viele Leute, da war Steven, dicht an ihrer Seite, sein ganz spezieller Geruch, der Druck seines Beins gegen das ihre und Jazzmusik, Stimmengewirr und Gelächter und immer wieder ein vielversprechender Kuß und ein sehr klares Gefühl von Glück. So lebten sie glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende, und wenn sie nicht gestorben sind ...
Rosa fuhr hoch. Ihr Nachbar unternahm im Schlaf die Annäherungsversuche, die im Wachzustand nicht geklappt hatten. Der Druck seines Beins gegen das ihre ... Sie schob es weg, doch es rutschte immer wieder zurück. Rosa glitt zur anderen Seite, machte sich auf dem engen Raum, der den Passagieren in der Economy-Class zur Verfügung stand, noch kleiner und versetzte dem Bein schließlich einen unsanften Stoß. Das wirkte. Wenigstens ein paar Minuten lang.
Sie atmete tief durch, wie sie es mit Jane geübt hatte, schloß die Augen, versuchte, nicht immer nur an Steven zu denken. Denk an etwas Schönes, hatte Jane ihr Woche für Woche auf dem blauen Diwan suggeriert – aber es war gar nicht einfach, an etwas Schönes zu denken, wenn man nichts als einen undurchdringlichen Nebel aus Leid und Selbstmitleid um sich herum spürte und alles Schöne außerdem untrennbar mit Steven verknüpft war. Rosa hatte lange gebraucht, bis sie sich so weit in ihrem Tief zurechtgefunden hatte, daß sie wieder erste Umrisse, Schemen, Farben erkennen konnte. Wie jemand, der sich in tiefschwarzer Nacht unbeholfen durch ein ihm völlig unbekanntes Zimmer tastet.
Es war schon nach Mitternacht gewesen, als sie das For Roses betrat. Außerplanmäßig, denn es war ihr freier Abend. Sie hatte sich eine Show der San Francisco Mime Troupe angesehen und plötzlich Lust verspürt, sich an die Bar zu stellen und von Steven einen Drink mixen zu lassen. Die Tür mit den beiden Rosen war weit geöffnet, Kneipenlärm, Rauch, Musik drangen ihr entgegen. Im Eingang blieb sie stehen. Steven sah sie nicht, sah nicht zu ihr herüber. Zwischen ihr und ihm war die Bar, drängten sich jede Menge Nachtschwärmer. Zwischen ihr und ihm stand eine Frau namens Cindy, die erst seit einer Woche im For Roses arbeitete. Dann sah Rosa Stevens Lächeln, sein ganz spezielles Lächeln.
Sie hatte sich gesagt, es ist nichts, reg dich ab, das bildest du dir nur ein, warum soll er nicht mit einer anderen Frau reden, geh nach Hause, morgen früh sieht alles anders aus. Er hat doch mich, wir gehören doch zusammen. Steven redete ständig mit anderen Frauen, ohne daß Rosa auch nur einen einzigen Gedanken daran verschwendet hätte. Er lächelte andere Frauen an. Aber diesmal war es anders, das wußte Rosa mit einem Blick. Dieses Lächeln gehörte sonst ihr. Und nun schenkte er es einer anderen Frau.
Manchmal versuchte sie sich an einem dieser schlappen, nachträglich eingereichten Wenn-Dann-Sätze, die spurlos an den Tatsachen abperlten: Wenn sie nicht nach Amerika gegangen wäre, dann wäre sie Steven nie über den Weg gelaufen. Wenn sie keine Vertretung gebraucht hätten, dann wäre Cindy nie im For Roses aufgetaucht. Wenn Rosa nicht nach dem Theater ausgerechnet im For Roses hereingeschneit wäre, dann hätte sie Stevens Lächeln nicht gesehen, das längst fremdgegangen war. Kausalsätze dieser Art ließen sich beliebig weiterspinnen. Wenn Rosa und Steven nicht am Morgen desselben Tages einen handfesten Streit gehabt hätten – worüber, hatte sie längst vergessen, Ausgangspunkt war wie immer irgendeine Kleinigkeit gewesen, wer dran war mit Müllraustragen oder daß sie das Telefon nicht leise gestellt hatte, als sie morgens joggen ging und er noch schlief –, dann wäre Steven gar nicht empfänglich gewesen für den Charme einer anderen Frau. Und wenn Rosa nicht dunkelhaarig, sondern blond wäre und noch dazu über einsachtzig statt ihrer mittelmäßigen einsachtundsechzig und wenn sie und Steven sich in den letzten Monaten mehr Zeit füreinander genommen hätten, dann.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, dachte Rosa mit einem Kloß im Hals. Das Märchen von den nachgetragenen Versäumnissen ließ sich beliebig variieren und war, wie Rosa selbst wußte, ausgemachter Blödsinn. Denn wenn es drauf ankam, dann konnte kein noch so promptes, gehorsames Müllausleeren die Liebe aufhalten, dann lief man sich auch in der größten Großstadt über den Weg, so wie es damals Rosa und Steven passiert war. Amors Pfeile kannten keine Hindernisse. Und es war alles nicht Rosas Schuld, sondern Schicksal. Irgendwann passierte das jedem. Irgendwann war immer das erste Mal. Oder es war von Anfang an das falsche Land, der falsche Job, der falsche Mann gewesen. So ein falscher Gedanke half wenigstens kurzfristig.
Zur Verstärkung dachte Rosa zusätzlich an etwas verläßlich Schönes, eine in monatelanger Kleinarbeit auf Janes Diwan zusammengepuzzelte Ablenkungsidylle: Sandstrand, Sandkörner, Sand, der durch die Finger rieselt, Sand unter den nackten Fußsohlen, Sand bis zum Hals. Es klappte sogar hier oben über den Wolken: Steven verschwand aus ihrem Kopf, als würde er für immer im Treibsand versinken.
2
Rosa wachte auf, weil alle anderen Passagiere aufwachten und zu reden begannen und die Sonne durch die kleinen Fenster der Boeing hereinschien. Ein Frühstück wurde serviert. Ihr Magen rebellierte. Um Mitternacht trank sie normalerweise keinen Kaffee, sondern einen Tequila oder ein Glas Sekt, um noch ein paar Stunden wach zu bleiben. Aber um Mitternacht schien gewöhnlich auch nicht die Sonne. Womit endgültig alle Gewohnheiten außer Kraft gesetzt waren. Und alle Gewißheiten offenbar auch, dachte Rosa und stellte endlich ihre Armbanduhr nach. Ortszeit neun Uhr morgens, hatte der Flugkapitän soeben durchgegeben. Auch das Wetter in Hamburg: heiter, zwanzig Grad, Temperaturen steigend. Das war doch immerhin etwas.
Als sie durch den Zoll war, stellte sie erst einmal die Koffer ab, sah sich aufmerksam und ein wenig angespannt um. Ringsum lautstarkes Wiedersehen mit Umarmungen, Händeschütteln, Schulterklopfen. Die meisten Passagiere wurden von Verwandten oder Bekannten erwartet. Glück gehabt – auf Rosa wartete kein familiäres Empfangskomitee. Sie hatte niemanden benachrichtigt. Aber man konnte ja nie wissen. Einige Leute hatten womöglich ausgerechnet gestern ihren siebten Sinn aktiviert und in San Francisco angerufen, und Samantha, die Rosas Wohnung übernommen hatte, hatte gesagt: Rosa? Die ist doch auf dem Weg nach Deutschland.
»Na, wieder im Lande, altes Haus?!«, dröhnte eine ihr vage bekannt klingende, sonore Männerstimme hinter ihrem Rükken. Sie fuhr herum, in der Erwartung, Ole gegenüberzustehen, dem Mann ihrer ältesten Schwester, einem Schaumschläger mit Feingefühl für maximal fünf Cent. Aber da war niemand, den sie kannte. Nur ein älterer Mann und eine ältere Frau, die sich umarmten, als würden sie es schon seit Jahrzehnten auf immer dieselbe Weise tun.
Zum zweiten Mal atmete Rosa erleichtert auf. Gelandet. Angekommen. Sie konnte, wie geplant, ihr Tempo selbst bestimmen. Und auch die Koffer alleine schleppen, denn einen Gepäckwagen hatte sie nicht mehr erwischt. Jemand fuhr ihr mit einem dieser Wagen von hinten gegen den Knöchel und schickte, als wäre das nicht genug, gleich noch ein »Können Sie denn nicht aufpassen?«, hinterher. Schimpfend entfernte sich ein weiteres Ehepaar; der Mann lenkte den Wagen, die Frau zeterte ihm den Weg frei.
Back to Germany, Rose, sagte Rosa sich spöttisch. Back to good old Germany. Gut und alt? Oder eher neu? Seit der Maueröffnung war das Land ein ganzes Stück größer geworden, aber von Amerika aus wirkte Deutschland immer noch verschwindend klein. Ob Hamburg im Osten oder im Westen liege, hatten manche Leute wissen wollen, ob sie aus Scharbeutz habe fliehen müssen – in gewissem Sinne ja, hatte Rosa dann gesagt und versucht, zu erklären, was für eine Flucht sie meinte, die Flucht aus der Provinz, aus der Familie. Lebensgefährlich war das nicht gewesen, sie hatte keine Mauer überwinden müssen – höchstens die Mauer im eigenen Kopf, die internen Gebote und Verbote. Back home, dachte sie und fühlte sich dabei gleichermaßen vertraut wie fremd. Ihr fiel auf, daß es nicht nach Desinfektionsmitteln roch wie auf dem San Francisco International Airport, eher nach Metall und Glas, nach trockener Luft und einer Prise Staub, die dem Ganzen erst das glaubwürdige Aroma authentischer Sauberkeit verlieh. Noch etwas fiel ins Auge: Wie bleich die Leute trotz ihrer Sonnenbräune hier waren. Keine Schwarzen, Chinesen, Chicanos, Indianer und all die Mischformen aus den Völkern, die die Menschen im Laufe der Jahrhunderte zuwege gebracht hatten. Hier waren die Bleichgesichter an den Schaltern, hinter der Sperre, auf den Gängen in der überwältigenden Mehrzahl. Weiter vorn erblickte sie ihren Sitznachbarn: Zwei Kinder hingen an seinen Armen, eine Frau an seinem Hals. Schnell wandte Rosa sich ab.
In einer Ecke der Ankunftshalle entdeckte sie Barhocker vor einer Art Tresen. In einer Vitrine lagen unter einer Plexiglashaube belegte Brötchen, Bratklopse, saure Gurken, winzige Portionen Blechkuchen, der vermutlich nicht nur trocken aussah. Es roch nach deutschem Kaffee, heißem Würstchenwasser und Senf. Rosa bestellte, um etwas wacher zu werden, einen Tequila.
»Ham wer hier nich. Da müssen Se schon rüber in die Bar. Halle A.«
Die Bedienung hinter dem Tresen – rotweißgestreiftes Häubchen, rotweißgestreifte Schürze – sprach ein breites Hamburgisch. Sie deutete in die Richtung, aus der Rosa soeben gekommen war.
»Und was kann ich bei Ihnen bekommen?«
»An Alkoholischem? Bier, Korn, Wodka.«
»Dann bitte einen Wodka.«
»Na, na, so früh am Morgen!«
Ein Biertrinker am anderen Ende des Tresens musterte sie interessiert. »Urlaub vorbei? Schnell noch einen kippen, bevor die Mühle wieder losgeht, was?«
Er machte Anstalten, die Distanz von drei Hockern zu verringern.
Den Gegner durch Blicke zu töten war eine mögliche Kampfart. Eiskalt durch ihn hindurch zu sehen eine zweite. Rosa konnte beides. Alles eine Frage der Übung. Ein Relikt aus den Zeiten des For Roses. Laserblick gegen aufdringliche Leute. Nur bei Cindy hatte es nicht geklappt. Aber da hatte Rosa sich auch eher gefühlt wie das Kaninchen vor der Schlange.
Der Mann mußte immerhin einen Teil der Botschaft verstanden haben, denn er blieb brav auf seinem Hocker sitzen. Aber das bedeutete nicht, daß er sich so schnell geschlagen gab.
»Starke Dröhnung, was?«, setzte er nach. »Hilde, gib mir auch einen von diesem Russenzeugs. Damit die hübsche junge Dame nicht so alleine trinken muß.«
Starke Dröhnung, in der Tat, dachte Rosa: dieses plumpe Auf-den-Leib-Rücken, bis man den schlechten Geruch von Atem, Achselschweiß und chronischem Stumpfsinn tagelang nicht mehr aus dem Sinn bekam. Aber solche Typen gab es auch in San Francisco, notfalls hatte Steven sie an die frische Luft befördert – schon wieder Steven, immer wieder Steven ...
»Ach so, die Lädi redet nicht mit jedem!« Zunehmend aggressiver, anzüglicher Tonfall.
Rosa kippte den Wodka runter, legte wortlos einen Zehnmarkschein auf den Tresen, nahm ihre Koffer auf und ging in Richtung Taxistand. Bei großer Müdigkeit wurde sie zunehmend dünnhäutig. Empfindsam und empfindlich. Eine gefährliche Stimmung, besonders dann, wenn ihr eigenes Bett nicht in einer Reichweite von maximal drei Häuserblocks zu haben war. Außerdem hatte sie gar kein eigenes Bett mehr. Ihr Bett gehörte jetzt Samantha. Das For Roses gehörte jetzt Steven und Cindy. Aber das war Vergangenheit, die Zukunft gehörte Scharbeutz. Und in Scharbeutz würde sie im besten Hotel am Ort absteigen und den Rest des Tages nur noch schlafen, nichts als schlafen.
Die Polster im Taxi waren fast so hart wie die Parkbänke in San Francisco. Wie gern hätte sie sich auf einer dieser Parkbänke ausgestreckt und alles um sich herum vergessen, umnebelt vom Rhododendronduft und Insektengeschwirr und dem leisen Rauschen des Verkehrs – bitte einmal Golden Gate Park, einmal andere Seite des Globus ...
»Wohin soll’s denn gehen, junge Frau?«
»Zum Hauptbahnhof.«
3
Seit Jahren hatte Rosa keinen Bahnhof mehr betreten. Der nächste von San Francisco aus erreichbare Bahnhof befand sich in Oakland, auf der anderen Seite der Bay, aber Rosa war nie von dort irgendwohin gereist und hatte auch nie jemanden dort abgeholt. Der Gedanke an Fortbewegung war in Amerika untrennbar verbunden mit Flugzeugen, Autos, Greyhoundbussen. Der Idee, in einem Eisenbahnwaggon zu sitzen und Stunde um Stunde durch eine sich nur langsam verändernde Landschaft zu rollen, haftete zwar eine gewisse Aura von Pioniergeist und Wildwestmentalität an, viel mehr aber noch der Fluch der Langsamkeit. Die Eisenbahn war ein unverzichtbarer Baustein der Geschichte, aber kein ernst zu nehmendes Verkehrsmittel. Etwas für Märchen und Anekdoten. Als Kontrast dazu der Hamburger Hauptbahnhof: eine Mischung aus Einkaufszentrum und Markthalle, Treffpunkt für Geschäfte aller Art.
Als Rosa ein Kind gewesen war, hatte es hier nur Fahrkartenschalter und Toiletten gegeben, einen schmucklosen Wartesaal, ein Bahnhofsrestaurant, an Läden höchstens einen Zeitungskiosk und einen kleinen Tabakladen. Zwischen diesen Koordinaten bewegten sich die Reisenden, und zwischen diesen Koordinaten bewegte sich auch der zugehörige Begriff: »Wandelhalle«. Dazu die Farben Ockergelb und Staubgrau sowie der beißende Geruch einer Zigarre, schwere Lederkoffer ohne Rollen. Rosa staunte. Wie war es nur möglich gewesen, daß sie das Zugfahren so komplett aus ihrer Gedankenwelt hatte streichen können ... Was nicht zum Alltag gehörte, geriet offenbar schnell in Vergessenheit. Was sie wohl sonst noch alles vergessen hatte?
Den Weg zu den Gleisen fand sie allerdings mit beinahe schlafwandlerischer Sicherheit: rechts um die Ecke und an den Schließfächern entlang. Schon gelangte man wie früher zu einer Art Galerie und stand oberhalb von Gleis dreizehn und vierzehn, denn die Züge fuhren eine Ebene tiefer unter der Wandelhalle hindurch. Man konnte auf das Reisegeschehen hinabschauen wie von einer Brücke auf einen dahinströmenden Fluß. Das hatte noch immer etwas: die wartenden Züge und die Reisenden mit ihren Koffern und Taschen, die Atmosphäre von Abschied und Ankunft, die Lautsprecherdurchsagen, die wie früher bis zur Unverständlichkeit verzerrt durch die riesige Bahnhofshalle dröhnten.
Der Hamburger Hauptbahnhof war für Rosa immer ein Versprechen gewesen: das Tor zur großen weiten Welt. Eines Tages würde sie dieses Versprechen einlösen – das hatte sie schon als Kind mit jener inneren Gewißheit gewußt, die Kindern so selbstverständlich ist und die sich nur schwer allen Widrigkeiten zum Trotz bis ins Erwachsenenalter hinüberretten läßt: Wenn ich groß bin, fahre ich weit weg. Und die Erwachsenen hören zu und nicken und lächeln ein wenig verkniffen und vielleicht auch traurig, weil sie daran denken müssen, wie lange sich ihre eigenen Träume schon verflüchtigt haben.
Zu Hause in Scharbeutz in der Pension Seerose hatte Rosa das Wegsein geprobt. Stunde um Stunde hatte sie im Keller verbracht und mit der elektrischen Eisenbahn gespielt, die Robert, der sieben Jahre älter war, ihr großzügig überlassen hatte. Sie hatte Züge fahren und rangieren lassen, Tiere aus Knetmasse geformt, Häuser auf Pappe gemalt und ausgeschnitten und in die Landschaft hineingestellt, einen Südsee-Vulkan, eine chinesische Mauer aus Pappmaché. Ein zerschnittenes Laken verwandelte sich in eine Gletscherlandschaft, eine hellblaue Tupperschüssel in einen Gebirgssee. Jeden Tag war Rosa in ein anderes Land ihrer Phantasie gereist, meistens allein. Robert hatte noch nie mit der Eisenbahn gespielt, Marina interessierte sich für Rock ’n’ Roll und Jungens, Regina ließ sich nicht bis in den Keller herab, es sei denn, um nach den Vorräten zu schauen, und Achim war allenfalls aus nostalgischen Gründen an der Spielzeugeisenbahn interessiert, die er selbst sich jahrelang vergeblich gewünscht hatte.
Manchmal allerdings war Rosa mit der Mutter, mit Robert, Marina und manchmal auch Regina in eine richtige Eisenbahn gestiegen, um Tante Elsa in Hamburg zu besuchen, die ältere Schwester der Mutter. In Scharbeutz war die Strecke eingleisig, in Lübeck mußte man in einen größeren Zug umsteigen, und im Hauptbahnhof in Hamburg ging es zu wie auf dem Rummelplatz, weshalb die Kinder ständig ermahnt wurden, nicht verlorenzugehen. Doch welches Kind geht schon gern verloren? Jedenfalls nicht Robert, den sie bei der Bahnhofspolizei abholen mußten: Er war vor einem Süßigkeitenautomaten stehengeblieben und hatte nachgezählt, ob sein Taschengeld für ein Rolo reichte. Währenddessen waren die Mutter und die Geschwister im Gedrängel verschwunden, und Robert hatte es mit der Angst zu tun bekommen, als er die vielen fremden Menschen sah. Auch die uniformierten Polizisten hatten seine Panik nicht gelindert, im Gegenteil, dabei war er schon vierzehn.
Bald darauf hatte Rosa ihrerseits versucht, auf ähnliche Weise verlorenzugehen. Natürlich mußte es unter anderen Bedingungen ablaufen als beim großen Bruder, ohne Heulen und Zähneklappern, sondern als Abenteuer. Beim nächsten Besuch in Hamburg war also Rosa einfach irgendwo vor einem Fahrplan stehengeblieben, der sie mindestens genauso faszinierte wie Robert der Süßigkeitenautomat. Sie war in der zweiten Klasse, konnte lesen und ausrechnen, wie lange ein Zug von Hamburg nach Kiel brauchte, wenn er um acht Uhr achtzehn losfuhr und um neun Uhr dreiunddreißig in Kiel ankam. Sie sah nach, in welchen Zügen es einen Speisewagen gab, welche der Endstationen sie kannte, welche sie zu Hause auf der Landkarte würde nachschlagen müssen – doch schon bei Abschnitt zehn Uhr soundsoviel wurde sie unsanft von Marina am Arm gepackt und wieder eingesammelt. Sie verstand die Aufregung nicht. Sie kannte ihre Heimatadresse auswendig und wußte, bei welcher U-Bahn-Station sie aussteigen mußte, wenn sie zu Tante Elsa in die Uferstraße wollte – leicht zu merken, ein reines Kinderspiel. Angst hatte sie auch keine gehabt. Nicht einmal verlorengehen durfte man!
Nach diesem Erlebnis war das Sich-Verlieren in der Großstadt für Rosa zum unverzichtbaren Teil des großen Versprechens geworden. Zugfahren, reisen, weit weg, als Fremde unter Fremden weitergehen, ohne die Hand der Mutter, ohne den Schutz der Geschwister – für diese Art von Abenteuer war das Ostseebad Scharbeutz eindeutig zu klein. Nicht einmal Rolltreppen gab es dort. Auch Lübeck kam in puncto Weltläufigkeit von vornherein nicht in Frage.
Die große weite Welt fing erst in Hamburg an. Die Rolltreppen hatten etwas Magisches: das Aufspringen und mühelose Fortrollen und am Ende wieder der Übergang auf festen Boden, während in den Füßen noch die Erwartung steckte, sie würden weitergerollt werden ...
Als sie mit achtzehn auf und davon war, mußte daher die Reise über den großen Teich auf dem Hamburger Hauptbahnhof beginnen. Nicht auf dem Flughafen Fuhlsbüttel, nicht an der Überseebrücke im Hamburger Hafen, sondern auf Gleis vierzehn. Von dort ging es nach Frankfurt und erst ab Frankfurt mit dem Flugzeug weiter.
Begleitet hatte sie jedoch niemand. Nicht einmal die Mutter. Kein Abschiedskomitee, das Rosa hinterhergewinkt und ihr selbstverständlich nur gute Wünsche mit auf die Reise gegeben hatte, das zurückblieb, damit sie es in Gedanken mitnehmen konnte. Damals hatte Rosa keinen einzigen Gedanken daran verschwendet, reisefiebrig am Fenster gestanden, erwartungsvoll all den fremden Leuten auf dem Bahnsteig zum Abschied zugewinkt und ausschließlich nach vorn geblickt, nicht zurück.
Eine ganze Weile stand Rosa versunken an das Geländer gelehnt, starrte hinunter auf die Gleise, sah einen Zug abfahren, einen anderen einfahren, horchte auf die Lautsprecherdurchsagen und sah, wie die Menschen ausstiegen, einstiegen, vorbeihasteten, sich anrempelten, sich umarmten, winkten. Sie verspürte Fernweh. Ein längst vergessenes Ziehen unter der Haut. Oder war es eher Heimweh?
Ein paar Schritte weiter stand die Tafel mit den Ankunfts- und den Abfahrtszeiten der Züge. Wie damals als Kind begann Rosa, den Fahrplan zu studieren, Zeile für Zeile, Zug für Zug. Sie konnte sich gar nicht satt sehen an all den bekannten Namen, die sie im Laufe der Jahre nur vorübergehend vergessen hatte: Tostedt, Reinfeld, Husum, Federica, Puttgarden. Dazwischen alte neue Namen: Stralsund, Praha Holešovice, Dresden. Sie entdeckte einen Zug nach Lübeck, er ging in zehn Minuten, Gleis sieben b. Sie hatte keine Fahrkarte und war auf einmal unsicher, ob man Fahrkarten hierzulande im Zug oder an einem Automaten lösen mußte und ob es möglich war, mit Kreditkarte zu zahlen. Sie sah sich suchend um, stutzte.
Hinten am anderen Ende der Galerie war eine Frau aufgetaucht, die ihr bekannt vorkam. Die Art zu gehen, der dunkle Haartupfer, auch die Farbe des Kostüms, hellgelb, Mutters Lieblingsfarbe. Verblüffende Ähnlichkeit, dachte Rosa, auch wenn die Frau viel zu weit weg war und mitunter von anderen Reisenden verdeckt wurde. Die Figur und die Körpergröße kamen in etwa hin – nur der Mann im dunklen Jackett nicht, bei dem die Frau sich eingehakt hatte. Der Mann paßte ganz und gar nicht ins Bild. Auf gar keinen Fall war er der Vater, der die Mutter um über einen Kopf überragte, was auffiel, wenn die beiden nebeneinander gingen. Das Paar bog ab, verschwand auf der Treppe und damit aus der Sicht.
Rosa hatte sich sicherlich getäuscht. Ein wildfremdes älteres Paar. Was für Streiche einem doch die Augen spielen konnten. Sie nahm ihre Koffer auf und machte sich auf den Weg zum vorderen Teil der Bahnhofshalle. Irgendwo mußte es einen Fahrkartenschalter oder einen Automaten geben. Als sie an der Stelle vorbeiging, wo die Frau und der Mann vor wenigen Augenblicken verschwunden waren, hielt sie inne, trat erneut ans Geländer und suchte mit Blicken den Bahnsteig ab. Gleis sieben b. Netter Zufall. Der Zug nach Lübeck stand schon da. Wenn Rosa sich beeilte, würde sie ihn noch bekommen. Oder sollte sie einfach ohne Fahrkarte einsteigen? Sie zögerte. Dann sah sie das Pärchen erneut. Da! Auf der Höhe des Fahrplans! Die Frau im hellen gelben Kostüm und der Mann im dunklen Jackett. Gleich würde einer von beiden einsteigen und wegfahren. Und vorher würden sie sich zum Abschied die Hände schütteln, sich vielleicht umarmen, wie man Freunde oder Verwandte umarmte, dann gute Reise, bis bald, ruf mal an. Der Mann breitete seine Arme aus. Die Frau tauchte in seine Umarmung hinein und ließ sich ganz umfangen. Sie küßten sich, leidenschaftlich und vollkommen ungeniert. Ein junges Pärchen drehte sich im Vorbeigehen nach den betagten Verliebten um. Das Mädchen machte eine Bemerkung, die vom Bahnhofslärm verschluckt wurde, der Junge lachte.
Rosa wurde flau in den Knien, was aber nicht am Wodka lag, nicht an der trunkenen Müdigkeit und der im Flug verbrachten Nacht. Es lag an dem Kuß, den sie wiedererkannt hatte, diese Art Kuß, der sie an Steven erinnerte, an die ersten trunkenen, unvergleichlichen, wie im Flug vergangenen gemeinsamen Wochen und Monate; ein Kuß unter Verliebten, gierig, selbstvergessen, zeitlos, ein Kuß, der nicht an den Lippen endete und auch nicht auf dem Höhepunkt der Lust, ein Kuß, der da war und einen begleitete und vorauseilte und schützte, auf daß kein Wasser zu tief wäre und kein Ozean zu breit. Wenn Rosa in den letzten Monaten einem verliebten Paar begegnet war, das seine Verliebtheit offen zur Schau trug, hatte sie sich stets verärgert abgewandt. Und nun das! Eine Frau in einem gelben Kostüm, ein Mann in einem dunklen Jackett, die einander umarmten – und eine übernächtigte Rosa, die fasziniert zuschaute, den Blick einfach nicht lösen konnte. Gleich mußten die beiden sich voneinander lösen – noch zwei Minuten bis zur Abfahrt des Zuges. Vielleicht konnte sie dann endlich das Gesicht der Frau sehen.
In wenigen Augenblicken würde sie Gewißheit haben: War es ihre Mutter, oder war sie es nicht? Was würde dich mehr erleichtern, Rosa, fragte sie sich mit klopfendem Herzen, oder andersherum: Was würde dich weniger verwirren? Daß die Frau dort unten auf dem Bahnsteig deine fast siebzigjährige Mutter ist, in den Armen eines Mannes, der nicht dein Vater ist? Daß du dich getäuscht hast und das beobachtete Glück zwei wildfremden Menschen gehört? Daß deine Mutter in Wirklichkeit gerade dabei ist, die gebrauchte Bettwäsche der Pensionsgäste abzuziehen?
Instinktiv kannte Rosa die Antwort schon, noch bevor die Frau im gelben Kostüm in den Zug stieg, dann im Abteil das Fenster herunterschob, sich herauslehnte und Rosa endlich ihr Gesicht zuwandte. Die Frau war ihre Mutter. Rosa spürte die Unruhe, die diese Antwort in ihr auslöste. Der Mann, der nicht Rosas Vater war, sondern offensichtlich der Liebhaber ihrer Mutter – oder wie sollte man ihn nennen, Freund, Gefährte, Ehebrecher, Lüstling, Dritter im Bunde oder, noch schlimmer: ihr Bekannter – drückte einen Kuß auf die Hand der Mutter. Eine Lautsprecherdurchsage erklang, der Pfiff mit der Trillerpfeife, die Türen klappten zu, der Zug setzte sich in Bewegung. Die Mutter lachte, warf dem Mann eine Kußhand zu und winkte mit einem weißen Taschentuch. So, wie sie ihrer Tochter nie zugewinkt hatte. Jedenfalls nicht am Hamburger Hauptbahnhof. Aber es war ja auch das erste Mal, daß Rosa ihre Mutter abfahren sah.
4
Irgendwann wurde Rosa wach. Um sie herum war es stockfinster. Ihr fehlte völlig die Orientierung. Sie spürte zwar, daß sich ihr Körper in einem Bett in der Horizontalen befand, aber sie konnte auf Anhieb weder die Richtung bestimmen, in der sich Tür und Fenster befinden mußten, noch die Lage des Bettes im Raum. Auch was das Zeitgefühl betraf, tappte sie völlig im Dunkeln.
Mit ausgestrecktem Arm tastete sie nach dem Schalter der Lampe, die sich, wenn sie blindlings auf die Erfahrung unzähliger Nächte vertraute, links neben ihrem Futon befand und prallte mit dem Handgelenk gegen eine Wand. Sie richtete sich halbwegs auf, versuchte es auf der anderen Seite und stieß mit dem Ellbogen gegen eine Art Kasten. Ein deutlicher Hinweis darauf, daß sie nicht zu Hause war. Bei ihr zu Hause gab es keine Nachttischschränkchen. In ihrer Wohnung stand das Bett mitten im Raum. Beinahe hätte sie auch noch ein Glas umgestoßen, das auf dem Nachttisch stand. Dann fand sie endlich die Armbanduhr: vier Uhr siebenundzwanzig. Als hätten die Leuchtziffern dem Schattenreich der Nacht, der Träume, des Vergessens auch den Ort des Geschehens entrissen, wußte Rosa im gleichen Moment wieder, wo sie sich befand: Hotel Augustusbad, Scharbeutz, Deutschland.
Hotel Augustusbad, hatte sie am Bahnhof zum Taxifahrer gesagt und gehofft, daß er nicht die Augenbrauen hochzog, weil das Augustusbad schon vor Jahren abgerissen worden war. Doch er hatte den Taxameter eingeschaltet und sie zwei Minuten später im oberen Teil der Seestraße vor dem ehrwürdigen alten Hotel abgesetzt. Auf die Frage nach einem Zimmer mit Seeblick hatte der Mann an der Rezeption geantwortet, da hätten sie leider nur noch eins mit Naßzelle. Natürlich wollte Rosa keine Zelle mieten, schon gar keine nasse. Geduldig hatte der Portier wiederholt, nach hinten hinaus könne er ihr ein Doppelzimmer mit Badewanne und WC anbieten, nach vorne hinaus, also mit Seeblick, nur eins mit eingebauter Naßzelle. Damit hatte er anscheinend das bis unter die Zimmerdecke reichende Gebilde in der Ecke neben der Tür gemeint, das schattenhaft zu erkennen war.
Rosa schwang sich aus dem Bett, lief zum Waschbecken und ließ kaltes Wasser über ihr Gesicht laufen. Dann tappte sie in Richtung Fenster, stieß erwartungsvoll die hölzernen Läden zurück. Sternenklarer Himmel. Eine laue Nacht. Stille. Nur der gerühmte Seeblick war ein Witz: ein Traum aus alten Zeiten. Klotzige Appartementhäuser schoben sich vor die einst ungebrochene Wasserlinie am Horizont. Da hatte sich mal wieder jemand in der ersten Reihe plaziert und einen Dreck geschert um alles, was hinter ihm stand. In den schmalen Zwischenräumen zwischen den Hausklötzen glitzerte es allerdings verdächtig im Mondlicht – das mußte es sein, das Baltische Meer, von dem Rosa in San Francisco immer geschwärmt hatte. Seeblick, in Streifen. Gab es dafür vielleicht auch einen neonkalten Begriff, ein Pendant zu »Naßzelle«? Rosa spürte nun plötzlich die Sehnsucht, zum Strand hinunterzulaufen, endlich, nach so vielen Jahren – gerade weil es nur ein Ausschnitt war, den sie von der Ostsee erhaschen konnte.
Es war inzwischen Viertel vor fünf. Sie schlüpfte in die auf dem Boden verstreuten Kleider, steckte den Rest der Schokolade ein, die sie am Bahnhofskiosk gekauft hatte, und schlich sich aus dem Zimmer. Auf dem Flur und auf der Treppe hingen Schwarzweißfotos, offenbar eine Ausstellung über die Geschichte des Badeortes. Im Vorbeigehen erkannte Rosa in der schwachen Nachtbeleuchtung den Strand, der noch bis zur Straße reichte, alte Ostseehäuser, Fischerboote, Schiffe auf dem Meer, Rauch über den Schiffen, sinkende Schiffe. Rosa blieb kurz stehen, entzifferte zwei der Bildunterschriften, dritter Mai 1945, Luftangriff auf die Cap Arcona, die Engländer kommen, Panzerfahrzeuge in der Strandallee. Irritiert wandte sie sich ab. Vergangenheit. Leise verließ sie das Hotel.
Auf dem Weg die Seestraße hinunter ignorierte sie die aufflackernde Versuchung, im Schutz der Nacht einen Umweg zur Pension Seerose zu machen. Das konnte bis morgen warten. Das Meerwasserbad hob sich eckig und ungestalt gegen die Dünen und den nächtlichen Himmel ab. Links davon führte die Strandallee nach Haffkrug, rechts war sie in eine Fußgängerzone umgewandelt worden. Weit und breit war keine Menschenseele unterwegs. Im Schein der Straßenlaternen erkannte Rosa befremdet rote Klinkerbauten und ein rötliches Straßenpflaster, das so gar nicht in ihre Erinnerung passen wollte. Die Szenerie wirkte hart, glatt, unsinnlich und billig und hatte trotzdem vermutlich Millionen gekostet. Der Bernsteinladen ihres Vaters lag nur hundert Meter entfernt, gleich neben dem Kurhaus. Rosa verzichtete darauf nachzuschauen, ob das Häuschen, in dem der Laden sich befand, seit sie zurückdenken konnte, ebenfalls der Renovierung erlegen war. Sie würde es noch früh genug erfahren. Sechzehn Jahre waren eine lange Zeit, um Schneisen zu schlagen, alte Lücken zu füllen, zu planieren, zu asphaltieren, neu zu bauen. Zum Glück konnten die Einwohner nicht auch noch den Strand abreißen und unter Stein begraben. Am Meer war immer Schluß.
An den Holzbuden der Strandkorbvermieter begannen die Bohlenwege. Die Bretter vibrierten unter ihren Schritten, ein dumpfes und vertrautes Geräusch. Die Strandkörbe standen in Reih und Glied. So ist es schon immer gewesen, dachte Rosa in einem plötzlichen Schauer von Glück. Mochte der Ort sich auch unvorteilhaft verändert haben – der Strand war gleichgeblieben. Niemand war auf die Idee gekommen, die Strandkörbe mit den gestreiften Innenbezügen, den ausziehbaren Fußstützen, den ausklappbaren Holztischchen durch irgend eine neumodischere Variante zu ersetzen oder gar völlig abzuschaffen. Rosa zog die Schuhe aus, spürte das mit feinem Sand bedeckte Holz unter den Fußsohlen, dann nur noch den weichen, etwas feuchten Sand, in den sie ein paar Zentimeter tief einsackte. Sie stapfte weiter bis zur Wasserkante und freute sich wie ein Kind. Ein einziger, durch nichts behinderter Blick auf die unspektakuläre Ostsee, die träge in ihrem riesigen Becken hin und her schwappte, und schon war Rosa erneut dem Charme der See verfallen wie einem Geliebten aus alten Tagen. Einem weiblichen Geliebten, dachte sie übermütig, die Ostsee war nicht der Atlantik oder der Pazifik und auch nicht das Mittelmeer.
Sie lief am Strand entlang bis zur Seebrücke in Timmendorfer Strand. Mit jedem Schritt über den harten, feuchten Sand gleich hinter der Wasserlinie, manchmal auch über ein weiches Bett aus Seetang und Algen, schlich sich ein Gefühl von Vertrautheit ein. Rosa kannte diesen Teil der Küste zu jeder Tages-, Nacht- und Jahreszeit: im Winter, wenn die Ostsee zuweilen bis an die Ufer zufror und man auf den knackenden Eisschollen hinausgehen konnte bis zum offenen Meer, was verdammt gefährlich war, besonders wenn es geschneit hatte und die brüchigen Nahtstellen zwischen den Eisschollen nicht mehr zu erkennen waren; oder bei Sturmflut im Herbst, wenn die Dünen überschwemmt und die nicht rechtzeitig abtransportierten Strandkörbe umgeworfen, manchmal sogar von der See mitgerissen wurden; natürlich auch im Sommer, am frühen Abend, wenn die Feriengäste, die sich tagsüber in Horden durch das seichte Wasser schoben, schon wieder in ihre Pensionen zurückgekehrt waren oder in den Restaurants beim Essen saßen. Es gab die Ostsee bei Nacht, wenn man heimlich zu zweit am Strand flanierte, mit Blick auf das Wasser und die Sterne und die vereinzelten roten Punkte in den Strandkörben, die wie Drachenaugen glühten, und in manchen Sommernächten konnte es einem passieren, daß am Strandabschnitt am Kammerwald, wo die Strandkörbe weniger dicht beieinander standen, schon jeder Korb von einem knutschenden Pärchen besetzt war. Der Ostseestrand war immer für Rosa da gewesen, verläßlich und verschwiegen. Ihm hatte sie die Empfindungen der Siebenjährigen wie die der Siebzehnjährigen anvertraut, er fing alles auf, Gedanken, Träume, Tränen. Wenn sie überhaupt irgend etwas mit dem wohligen und zugleich klebrigen Begriff »Heimat« verband, dann diese Millionen von Sandkörnern und Wassertropfen, diese völlig unspektakuläre Strandlinie ohne großartige Ausblicke oder Einsichten, die sie all die Jahre in sich getragen hatte, irgendwo unter der Haut.
Froh ging sie weiter. So unbeschwert war sie zuletzt in den guten Tagen mit Steven gewesen, aber die lagen eine Ewigkeit zurück. Steven kannte Scharbeutz nicht, er hatte die Vereinigten Staaten nie verlassen. Sein Bühnenhintergrund war immer die Großstadt gewesen: Menschengewimmel, Häuser, Straßenschluchten, Autos, Müll, Cafés, das For Roses ... Wunderbar! Die Ostsee war eine stevenfreie Zone. Um so besser würde auch das Vergessen klappen.
5
Rosa streifte die Kleider ab. Sie befand sich auf dem Rückweg, auf der Höhe des Kammerwaldes. Bisher war ihr keine Menschenseele begegnet. Der erste Schein der Morgendämmerung färbte den Himmel in einem blassen Blaulila. Bald würde die Sonne aufgehen. Draußen auf dem Meer waren die Schattenumrisse zweier Fischkutter zu erkennen.
Während sie das kühle, seidige Wasser vor sich mit ruhigen Schwimmzügen teilte, kehrten ihre Gedanken zu der Szene auf dem Hauptbahnhof zurück. Die Mutter küßte einen fremden Mann. Rosas Gefühle dazu waren höchst ambivalent. Sie registrierte Staunen, Ungläubigkeit – das hätte ich ihr nie zugetraut! Da war ein gewisses Maß an Fürsorge – hoffentlich macht sie keine Dummheiten. Dann stieg Empörung hoch, die sich ausnahm wie Adelsklatsch beim Friseur unter der Trockenhaube: Wie kann sie nur in ihrem Alter! Rosa spürte auch eine Portion Neid, gepaart mit Verlangen – das will ich auch! Und eine Welle von Melancholie, die über sie herschwappte – genau so war es am Anfang mit mir und Steven ...
Halt! Die Ostsee war eine stevenfreie Zone! Rosa tauchte den Kopf unter Wasser, schwamm ein paar Meter weit. Die Welt war nichts als ein gedämpftes Glucksen und Gurgeln und Rauschen, und als Rosa wieder auftauchte, war der Gedanke an Steven auf den Meeresboden gesunken. Was sich aber hartnäckig hielt, waren die Fragen, die sich aus ihrer zufälligen Entdeckung ergaben: Wer war dieser Mann? Wie lange kannte die Mutter ihn schon und woher? Wußte der Vater Bescheid? In keinem der Briefe, in denen die Mutter Rosa regelmäßig mit Neuigkeiten und lieben Grüßen versorgte, war in den letzten Monaten die Rede gewesen von Veränderungen im Leben der Eltern. Gar von einer möglichen Scheidung. Nach über vierzig Jahren Ehe.
Rosa hatte beträchtliche Schwierigkeiten, die beobachtete Abschiedsszene mit den Bildern in Verbindung zu bringen, die sie von ihrer Mutter parat hatte. Die patente, umsichtige Hausfrau vor dem Bügelbrett, beim Abwaschen des Frühstücksgeschirrs, beim Kochen. Die leidenschaftliche Gärtnerin. Beim Zurückschneiden der Rosen im Garten, beim Unkrautjäten. Die tröstende, fürsorgliche Mutter, die das Schulbrot streicht, dem Bruder die Haare kämmt, der Schwester das Kleid für den Abtanzball absteckt, Rosa fünfzig Pfennig zusteckt, damit sie sich nach dem Schwimmen mit den Freundinnen Süßkram kaufen kann – etwas »zum Schnoopen«, fiel Rosa der lang brachgelegene Begriff wieder ein. Die aufmerksame Pensionswirtin, die sich bei den Sommergästen der Pension Seerose nach den Frühstückswünschen erkundigt – das Ei, lieber fünf Minuten oder hartgekocht? Die Mutter, am Gartenzaun bei einem Schwatz mit der Nachbarin ...
Nichts als Abziehbilder. Nicht von grundauf falsch oder gefälscht, aber auch nicht richtig und schon gar nicht vollständig. Zweidimensional. Die Mutter – von außen. Geboren am, in, Mädchenname, Haarfarbe, Augenfarbe, Körpergröße, Unterschrift. Angaben aus dem Personalausweis. Wenn jemand sich erlaubt hätte, Rosa mit solchen Worten oder Bildern zu beschreiben, wäre sie fuchsteufelswild geworden. Was, und das ist alles? Mehr fällt dir nicht ein? Das Nachdenken über die Mutter war wie ein angestrengter Versuch, gegen die starke Strömung anzuschwimmen, ein Einsacken in den Verwehungen der Erinnerung.
Da mußt du dich schon ein bißchen mehr anstrengen, Rosa, sagte sie sich. Denk zurück an deine Kindheit in Scharbeutz, denk dir konkrete Situationen. Also gut. Noch drei, vier lange Schwimmzüge, dann hatte sie die hellrote Boje erreicht. Am Horizont schob sich die Sonne gemächlich aus dem Wasser. Es wurde hell. Rosa überlegte.
Kindergeburtstag für das Nesthäkchen: die Mutter mit Schürze beim Kuchenbacken in der Küche, Rosa half mit, schüttete das Mehl in die Schüssel, versuchte sich dann an den Eiern. Ein Ei zerbrach, floß über die Tischkante – macht nichts, die Mutter war geduldig. Rosa rührte eifrig den Teig, durfte dann die Schüssel ausschlecken. Nachmittags kamen die Gäste, sechs Mädchen und zwei Jungen saßen um den Tisch unter dem Apfelbaum. Es gab Limonade und Kuchen, dann die Spiele, Schokoladenessen mit Mütze, Schal, Handschuhe an einem warmen Junitag, da gerieten alle mächtig ins Schwitzen, und Eierlaufen mit hartgekochten Eiern, die unversehrt blieben und am nächsten Tag aufs Schulbrot gelegt wurden. Am frühen Abend, kurz vor dem Abholen, gab es meistens Streit, die Geburtstage endeten mit Tränen und Bauchweh.
Und wo war die Mutter in diesem Erinnerungsbild? Na ja, dachte Rosa beklommen, sie hat die Lampions aufgehängt, Spiele mit uns gespielt, Streit geschlichtet und zur Besänftigung Geschichten vorgelesen. Am Abend war sie mit Sicherheit genauso erschöpft wie ich, aber man hat es ihr nicht angemerkt. Ich habe es ihr nicht angemerkt. Ich habe nicht darauf geachtet.