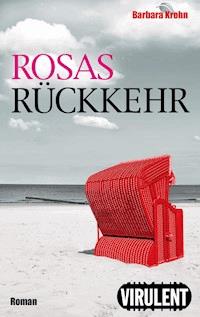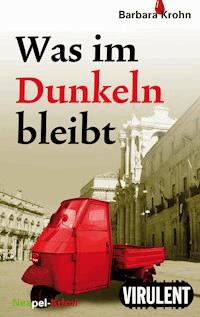
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Virulent
- Kategorie: Krimi
- Serie: Neapel-Krimi
- Sprache: Deutsch
Endlich ein Wiedersehen für zwei frisch Verliebte: Die Journalistin Sonja Zorn und Commissario Gennaro Gentilini würden zu gern den Spätsommer in den verwinkelten Gassen und den lauschigen Buchten am Golf von Neapel genießen. Aber dann wird in den antiken Ruinen Pompejis die Leiche einer unbekleideten Afrikanerin gefunden. Ein Wachmann verschwindet ebenso spurlos wie wertvolle Gegenstände pompejischer Kunst. Gennaro ist rund um die Uhr gefordert und hat keine Zeit mehr für Sonja, die selbst zu recherchieren beginnt. Das Schicksal der illegal in Neapel lebenden schwarzen Frauen lässt sie nicht mehr los. Im deutschen Konsulat knüpft sie Kontakte, die sich schnell als hintergründiger erweisen als geahnt…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2007
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diese Augen! Sie haben alles gesehen.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Dank
1
Es gab nur die Gegenwart, hier und jetzt, im halb abgedunkelten Schlafzimmer, nackte Gegenwart, die neben ihm lag. Ihr Atem ging ruhig und regelmäßig, ihr Mund war leicht geöffnet, die Haare fielen wirr aufs Laken, auf die braungebrannte Schulter. Sie hatte sich auf die Seite gedreht, ein Bein angewinkelt. Es zeigte in seine Richtung, es meinte ihn.
Gennaro Gentilini war glücklich. Er hatte Sonja morgens um kurz nach zehn vom Flughafen abgeholt. Bevor sie sich in seine Wohnung zurückzogen, waren sie auf Sonjas Wunsch in einer kleinen Bar in den Quartieri Spagnoli eingekehrt, um ihre Ankunft zu feiern: mit einem frischen Cornetto und einem caffé mit Blick auf die engen Gassen, den Gemüsestand an der Ecke, im Ohr die Geräusche des neapolitanischen Alltags, Vespagelärme, die gutturalen Rufe der Händler. Um bei einem Glas Prosecco den Übergang leichter zu machen, den Übergang zwischen dem Norden und dem Süden in ihnen. Zwischen Sehnsucht und Wunscherfüllung, stundenlangen Telefonaten und dem Wiedersehen, Auge in Auge. Zwischen dem quirligen, alle Sinne beanspruchenden Leben draußen und der Stille drinnen, in seiner Wohnung. Wo es nur noch sie beide gab. Sie beide, Haut an Haut, ihren Atem, ihr Verlangen, gesprenkelt von Momenten der Fremdheit.
Ja, er war glücklich. Er lag auf dem Bett, die Arme unter dem Kopf verschränkt. Ihm fehlte nichts. Nicht einmal die Zigarette, die er früher in dieser Situation geraucht hätte. Er hatte keinen Termin. Er war entspannt. Er würde nicht plötzlich wie von der Tarantel gestochen aufspringen, um ins Wohnzimmer zu laufen und schnell eine überfällige Mail zu schreiben. Er würde nicht einmal im Geiste die Stichpunkte für den längst fälligen Halbjahresbericht notieren, den der Polizeipräsident wieder einmal ihm aufs Auge gedrückt hatte.
»Sie machen das einfach am besten, Gentilini, und im August ist doch sonst nichts los. Wenn sogar das organisierte Verbrechen Ferien macht, hahaha!«, klang ihm Dottore Paganos Stimme noch in den Ohren.
Gentilini hatte es nichts ausgemacht, zu den wenigen Kollegen zu gehören, die der Questura im August ein wenig Leben einhauchten. Er hatte die Ruhe im Büro und in der Stadt genossen, abends lange auf der Terrasse gesessen, Musik gehört, gelesen, mit Sonja telefoniert. Den Bericht hatte er nicht geschrieben. Er hatte eine Art Allergie gegen das Schreiben von Berichten. Außerdem gab es auch sonst genug zu erledigen. Alles, was in den restlichen elf Monaten des Jahres liegen blieb. Typisch Pagano, so zu tun, als wäre der Kriminalerjob im August eine Art Heilkur. Als würden die übrig gebliebenen Kollegen eine ganz ruhige Kugel schieben und in den Gängen des Polizeipräsidiums Boccia spielen. Oder pokern, auf wie durch einen Zauber leergefegten Schreibtischen.
Gleich nach Ferragosto, als sein Freund und Kollege Stefano di Maio, Vater von fünf Kindern, vom Strandurlaub in Kalabrien zurückkam, war Gentilini zehn Tage mit seinen Kindern nach Sardinien gefahren. Giorgio hatte sich im Internet einen Tauchkurs ausgesucht, der extrem teuer war, aber Gentilini war froh gewesen, dass sein vierzehnjähriger Sohn, seit ein paar Monaten fest in den Klauen der Pubertät, überhaupt die Initiative zu irgendetwas ergriff. Also hatte er sich überreden lassen und sich ebenfalls in einen engen Taucheranzug gezwängt. Hatte Erinnerungen an missglückte Schnorchelversuche in der eigenen Kindheit, an den Gummigeschmack im Mund und die Angst zu ertrinken verdrängt. Was tat man nicht alles für seinen Sohn. Für eine positive Bilanz der Vater-Sohn-Erlebnisse.
Es war überwältigend gewesen. Nicht die Enge, sondern die so völlig andere Welt unter Wasser. Die gedämpften, gluckernden Geräusche, die wie in Zeitlupe zu den Strömungen des Wassers tanzenden bizarren Unterwasserpflanzen, die schwarzen Seeigel auf den Felsen, die dunkelroten Seeanemonen. Die Fische, die vereinzelt und in Schwärmen vorbeizogen, bunt, leuchtend oder ganz unscheinbar, lang, dick, winzig klein, wie sie in scheinbarer Ruhe vor sich hin schwammen, dann mit jähen, unvorhersehbaren Bewegungen davonschossen. Kein Lärm, niemand, der einen vollquatschte.
Durch das Tauchen war zwischen Giorgio und ihm eine neue Gemeinsamkeit entstanden, die Gentilini froh machte. Wehmütig dachte er daran, dass gleichzeitig die Kluft zu Isabella größer geworden war. Sie hatte von Anfang an nicht mit Vater und Bruder verreisen wollen, sondern mit fünf Mädchen aus ihrer Clique. Gentilini hätte nichts einzuwenden gehabt, aber seine Exfrau Rosaria war strikt dagegen gewesen. Isabella sei erst sechzehn, und Gennaro solle ja nicht glauben, dass er sich drücken könne. Wovor? Vor seiner Verantwortung. Vor dem zehn Tage lang beleidigten, gequälten Gesicht seiner Tochter. Die Nummer hatte sie, zumindest in seiner Gegenwart, konsequent durchgezogen, das musste er ihr lassen. Aber einmal hatte er sie im Vorbeigehen in einer Eisdiele gesehen, in Gesellschaft anderer Jugendlicher, ausgelassen und bester Stimmung – das hatte ihn mächtig beruhigt.
Jetzt war der August vorbei und alle vorübergehenden Meeres- und Strandbewohner zurückgekehrt in die Stadt. Und wie auf Termin hatte sich auch das organisierte Verbrechen aus der Sommerpause zurückgemeldet – mit einer Autobombe und einer Schießerei in Secondigliano. Vier Tote. Dazu kam die Frauenleiche, die vorgestern in einer Bucht in Trentaremi angespült worden war, vermutlich ein Flüchtling aus Afrika, eine der vielen unglücklichen Seelen, die über den Seeweg versuchten nach Europa zu gelangen.
Gentilini wollte nicht darüber nachdenken. Nicht jetzt. Jetzt war hier und heute. Jetzt ist Sonja, dachte er in stiller Übereinkunft mit dem Glück der letzten Stunden.
Sonja … Dieses Wort hatte nicht nur einen besonderen Klang, sondern auch einen Körper und eine Seele, es war ein Wort mit Flügeln und einer Geschichte, von der er nur einen winzigen Ausschnitt kannte, ein Wort aus einem Land, in das er noch nie einen Fuß gesetzt hatte. Aber das konnte ja noch kommen. Sonnnn-jaa… Er versuchte ihren Namen in Gedanken so auszusprechen, wie sie es in ihrer Sprache tat. »Doch nicht wie eine Tochtergesellschaft von Sony«, hatte sie am Anfang ihrer Bekanntschaft protestiert. »Zuerst Sonne mit zwei n, Sonne heißt sole, und danach ja, also sì, und nicht I-Ah wie der Esel!«
Ihr Haar war gewachsen, seit er sie das letzte Mal so betrachtet hatte. Das war auf den Tag genau sechs Wochen her, aber es kam ihm vor wie Monate, ach was, Jahre – und zugleich schien nicht einmal eine Sekunde vergangen zu sein, so selbstverständlich war Sonjas Gegenwart. Sie lag neben ihm auf dem Bett, als wäre sie nie fort gewesen. Ihr Haar war das Indiz für die Zeit, die er ohne sie verbracht hatte. Zwei bis drei Zentimeter, schätzte er und folgte dabei mit den Augen einer dunklen Strähne, die quer über ihrem Gesicht lag.
Gegenwart: Er brauchte nur den Arm auszustrecken und mit dem Finger über Sonjas Haut zu streichen, sonnengebräunte Haut auf einem weißen Laken, doch etwas hielt ihn zurück, vielleicht die Vorfreude, die man immer noch ein paar Augenblicke länger auskosten konnte, vielleicht ihr Körper, der so uneingeschränkt dem Schlaf hingegeben dalag, samtig, selbstvergessen, dass es ihm wie ein Akt der Gewalt vorgekommen wäre, jetzt zuzugreifen und sie aus diesem Zustand zu vertreiben.
Er hatte frei. Heute, morgen und übermorgen auch. Drei Tage große Freiheit.
Seit der Scheidung von Rosaria hatte Gentilini sich nicht mehr mit einer Frau eingelassen. Er konnte nicht oder wollte nicht, was auf dasselbe hinauslief. Alle Versuche seiner Freunde, ihn auf plumpe oder subtile Weise zu verkuppeln, waren schon im Vorfeld gescheitert. Die Frauen, die sie ihm bei allen möglichen Gelegenheiten vorgestellt hatten, waren alle irgendwie okay gewesen, hübsch, attraktiv, nett, sympathisch, klug, interessant, manchmal etwas schrill, manchmal etwas dominant oder eine Spur zu eindeutig auf der Suche nach einem Mann. Was er ihnen nicht zum Vorwurf machte. Dass es nicht gefunkt hatte, lag nicht an den Frauen, sondern an ihm selbst, dessen war er sich bewusst. Frauen hatten ihn über einen längeren Zeitraum ganz einfach nicht interessiert. Sendepause. Auszeit. Ersatzlos gestrichen. Eine Phase, die ihn viel weniger beunruhigt hatte als seine unmittelbare Umgebung.
»Du hast eine Wahrnehmungsstörung«, hatte Stefano di Maio diagnostiziert und Gentilini unermüdlich mit Frauen zusammenzubringen versucht, zumeist Freundinnen seiner Frau Stefania. »Was sagst du zu der von gestern Abend?«
»Ja, sie war ganz nett«, hatte Gentilini gemurmelt und sich nicht einmal daran erinnert, wie die Frau aussah. War es die Blonde oder die Brünette gewesen? Die kleine Mollige oder die sportliche Schlanke?
»Ganz nett?«, schrie daraufhin Stefano, als ginge es um seine eigene Schwester, als habe Gentilini den Ehrenkodex der Familie verletzt. »Die war nun wirklich top. Bellissima! Intelligente! Sexy! Un amore! Wo zum Teufel hast du deine Augen?!«
»Man muss sich doch nicht gleich in jede nette Frau verlieben …«
»Verlieben, wer redet denn von verlieben?? Dann eben nicht, du Blindgänger, du Kostverächter… Was ist nur los mit deinem Schwanz, Mann?«
»Was soll damit los sein?«, hatte Gentilini nur geknurrt. Er mochte zwar vorübergehend gegen weibliche Reize unempfindlich sein, aber das hieß noch lange nicht, dass er zum geschlechtslosen Neutrum mutiert war.
»Ma, che ne so … Was weiß ich …? Also, ich an deiner Stelle hätte sie noch am selben Abend…«
»Bitte sehr, nur zu, ich steh dir nicht im Weg!«
»Basta, Gennaro! Krieg endlich deinen Arsch hoch, geh zu einem Psychologen, und lass dir diese Eiterbeule von gescheiterter Ehe aufbohren. Das stinkt doch zum Himmel! Ein Mann wie du, nicht einmal unansehnlich, in den besten Jahren! Die muss doch irgendwohin, deine Manneskraft! Das ist doch die reinste Vergeudung!!«
So durfte nur einer mit ihm reden, und dieser eine war sein Freund und Kollege Stefano, was nicht bedeutete, dass Stefano Recht hatte. Gentilini kam sich nicht vor wie ein Mann, der nach einer gescheiterten Ehe verstärkt Wundpflege oder Seelenbalsamierung betreiben musste. Er war nicht verstört, gekränkt, über alle Maßen verletzt oder vor den Kopf gestoßen. Nein, er und Rosaria hatten sich schon lange vor ihrer Trennung auseinandergelebt. Die Wahrheit war, dass sie nie wirklich zusammengepasst hatten. Das war alles. Sie hatten zwar beide ziemlich lange gebraucht, um das zu kapieren, aber andere Leute brauchten dazu ein ganzes Leben. Dass Rosaria die Wut auf ihn immer noch auf kleiner Flamme hielt, dafür konnte er nun wirklich nichts. Er hatte nichts gegen sie. Es brachte ihn nur auf, wenn sie die Wochenenden mit den Kindern zu hintertreiben versuchte. Oder wenn er mitbekam, dass sie ihn vor den Kindern schlechtmachte. Aber es hatte ihn überhaupt nicht gestört, dass sie bald nach der Trennung wieder geheiratet hatte. Im Gegenteil!
Wahrnehmungsstörung, so ein Quatsch! Er hatte in dieser frauenlosen Phase nichts gegen Frauen gehabt. Er sah und hörte, was die anderen Männer auch sahen und hörten, aber es löste nichts in ihm aus. Kein Verlangen. Keinen Funkenflug. Nirgendwo hockte auf irgendeinem Mauervorsprung ein Amor mit gespanntem Bogen. Auch kein Eros. Nichts. Gentilini hatte eine Zeitlang schlicht und überhaupt nicht ergreifend in einer Art totem Winkel verbracht. Und in diesem toten Winkel passierten nun mal keine aufregenden Dinge. Nicht einmal aufregende Gedanken, geschweige denn Phantasien erotischer oder sexueller Natur.
Was in dieser liebesarmen Zeit alles nicht passiert war, wurde Gentilini erst klar, als die Vorsehung oder der Zufall in Gestalt seines deutschen Kollegen Lion Lichtenberg, den er vor Jahren auf einer Fortbildung in den USA kennengelernt hatte, ihm diese Frau geschickt hatte. Auf einen Schlag hatte sich alles verändert. Plötzlich war es wieder da, das Vibrieren im ganzen Körper, dieses Kribbeln unter der Haut, dieses Pulsieren von Verlangen. Herzklopfen bei jedem Gedanken an Sonja. Sie hatte ihn aus dem Schattendasein des toten Winkels hervorgelockt. Es war ganz einfach passiert und hatte Gentilini komplett überrumpelt.
Das war im Mai gewesen. Mitte Juni war Sonja nach Hamburg zurückgeflogen. Ende Juli hatten sie sich für ein verlängertes Wochenende am Gardasee getroffen, eine Begegnung zwischen den Welten, quasi auf halber Strecke zwischen Hamburg und Neapel.
Diesmal würde Sonja länger bleiben. Ein paar Wochen.
»Mal sehen, wie es läuft«, hatte sie gesagt.
»Wie was läuft?«
»Mit Neapel. Mit uns.«
»Natürlich gut«, hatte er sorglos erwidert.
Aber er wusste, dass es keine Garantie darauf gab. Er selbst hatte eine langjährige, gescheiterte Ehe hinter sich. Sonja hatte in ihrem Leben offenbar viele wechselnde Beziehungen gehabt und ansonsten ihre Tochter großgezogen. Sie mussten behutsam sein. Behutsam und draufgängerisch zugleich. Die gemeinsamen Momente auskosten. Nichts überstürzen und doch alles wagen.
Er beugte sich zu ihr hinüber, strich ganz sacht mit den Fingerkuppen über ihre nackte Schulter. Dabei fragte er sich, an welchem Strand, auf welcher Wiese, welchem Balkon und überhaupt unter welchen Umständen Sonja so braun geworden war. Jedenfalls nicht in seiner Gegenwart. Es gab ihm einen Stich. Er war, verdammt noch mal, eifersüchtig auf die Zeit ohne sie. Auf jede einzelne Minute.
Er küsste sie auf den Hals. Er spürte, wie ihre Haut reagierte, Härchen sich aufstellten. Ein kaum wahrnehmbarer Gegendruck. Er richtete sich auf und sah sie unverwandt an. Er wartete. Er fragte sich, ob sie seinen Blick spürte, durch die geschlossenen Augen hindurch. Als hätte sie seine Frage gehört, begann sie zu lächeln, schlug die Augen auf und erwiderte seinen Blick.
»Ich habe dich vermisst.«
»Ich dich auch«, murmelte sie.
Behutsam und draufgängerisch. Nichts überstürzen und alles wagen.
Dann passierte das, was Gentilini aus tiefster Seele hasste. Was ihm schon Dutzende Kinobesuche und diverse Kinderwochenenden vermasselt hatte: Sein Diensthandy begann zu plärren. Hysterisch. Lustfeindlich. Unerbittlich.
Es klang nach einem Ernstfall, und dieser Ernstfall, das wusste Gentilini schon, bevor er nach einem kurzen Blick auf die Uhr – es war kurz vor zwei – abnahm, würde diesen ersten gemeinsamen Tag mit Sonja in Stücke reißen wie ein hungriger Wolf.
Er begann zu fluchen. Er setzte alles an unflätigen Sprüchen, Beleidigungen und Hurensohnvarianten ein, was ihm in diesem Moment in den Sinn kam. Aber er wusste, es würde nichts nützen.
2
Typisch Mann, dachte Sonja nachsichtig. Beim sexuellen Stelldichein gestört zu werden, war für das andere Geschlecht schon immer Anlass zu empfindlichsten Reaktionen gewesen, vom Ausbruch heftiger Schlechte-Laune-Lava bis hin zum kompletten Rückzug in die männliche Einigelei. Das war nichts Neues. Was die Fixierung auf sexuelle Befriedigung anging, waren Frauen doch wesentlich flexibler. Seit Anbeginn der Geschichte waren sie keineswegs mit Orgasmen verwöhnt worden. Einer mehr oder weniger fiel nicht groß ins Gewicht. Auch auf diesem Gebiet galt: Nicht die Masse war entscheidend, sondern die Intensität, nicht das Ergebnis, sondern der Weg …
»Das Leben ist ungerecht«, knurrte Gentilini, als sie an der Ausfahrt Pompeji Scavi auf die Zahlstation zurollten. Seine gesamte körperliche Präsenz signalisierte Verstimmung, Anspannung.
So hatte Sonja ihn bisher noch nicht erlebt. Es befremdete sie jedoch nicht. Ihr gefiel einfach alles an Gentilini, na ja, fast alles, aber in diesem fast alles waren höchstens Winzigkeiten nicht inbegriffen. Sie hätte sie nicht einmal konkret benennen können.
Sie bedachte ihn mit einem liebevollen und spöttischen Seitenblick.
»Du hast noch gar nicht gesungen, Gennaro. Singen beruhigt. Ich zitiere einen berühmten neapolitanischen Kommissar. Du kennst ihn nicht zufällig?«
»Die Jukebox ist heute außer Betrieb.«
Ihm auf dem Höhepunkt seiner Lust eine Leiche vorzusetzen! Das war zweifelsohne ein Akt von ausgefeiltem Sadismus. Gentilini fühlte sich gleichzeitig gequält und angestachelt, seine Peiniger zu vernichten.
Als da waren: an erster Stelle der Überbringer der schlechten Botschaft via Telefon, Ispettore Nicola Cava. Dessen aufgeregtes Plappern sich auf unangenehmste Weise unter das hitzig-erregte Geschehen gemischt und die ineinander verknäulten Körper voneinander getrennt hatte. Zwei Jahre zwangsweise Enthaltsamkeit wäre die Mindeststrafe. Plus drei Monate Praktikum beim Leichenschnippeln, phantasierte Gentilini.
Dabei standen er und Cava neuerdings gar nicht mehr auf Kriegsfuß, im Gegenteil, sie hatten sich beide um ein besseres Einvernehmen bemüht: Cava, indem er, offenbar nicht nur in Gentilinis Gegenwart, weniger derbe Sprüche klopfte als früher, und der Commissario durch Verzicht auf arrogante Kommentare. Cava war es sogar gewesen, der Gentilini trotz ausverkauftem Haus die beiden Karten für das Cecilia-Bartoli-Konzert in Pompeji besorgt hatte – auf welchem Wege er solche kleinen Wunder immer wieder zustande brachte, wollten seine Kollegen lieber nicht allzu genau erforschen. Wissen machte nicht immer und in jedem Fall glücklich.
Klar, Nicola Cava konnte im Grunde nichts für die heutige Störung. Aber mit einem Untergebenen vor Augen tobte es sich lustvoller. Der Urheber der Verstimmung war eigentlich Stefano, der Gennaro hoch und heilig versprochen hatte, ihn in den Tagen nach Sonjas Ankunft zu vertreten. Ihn ausschließlich dann anzurufen, wenn es wirklich brannte. Wenn Gentilini richtig verstanden hatte, war Stefano jedoch letzte Nacht ins Krankenhaus eingeliefert worden, und man konnte nur hoffen, dass es nichts Schlimmes war. Also hatte Cava entscheiden müssen, was zu tun war, und den Commissario angerufen …
Drei Personen erwarteten sie an einem Nebeneingang der Ausgrabungsstätte, im schmalen Schattenwurf der Pinien. Cava redete gerade auf seine unangenehm intensive Art auf eine jüngere Frau ein, die, wie sich herausstellte, für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stätte zuständig war. Vielleicht versuchte er bei ihr Freikarten für das nächste Open-Air-Konzert in Pompeji lockerzumachen, um sie dann im Präsidium meistbietend zu verschachern, dachte Gentilini. Währenddessen blaffte der Museumsdirektor, Vittorio Almirante, irgendetwas Barsches in sein Mobiltelefon. Als er den Commissario mitsamt Begleitung auf sich zukommen sah, warf er einen unmissverständlichen Blick auf seine Rolex, der Gentilini nicht entging.
Er kannte das. Leute in dieser Position hatten entweder alle Zeit der Welt oder waren furchtbar in Eile. Es kam immer darauf an, worum es ging. Und vor allem um, wen.
In diesem Fall ging es um eine schwarze Frau, wahrscheinlich eine Illegale aus Afrika. Damit war zumindest klar, dass nicht die Gattin irgendeines weltbewegenden italienischen Politikers ermordet worden war.
Vielleicht war damit für den Direktor eine Viertelstunde Aufmerksamkeit bereits eine halbe Stunde zu viel. Hätte sie nicht irgendwo am Straßenrand liegen können wie letzte Woche die Nigerianerin an der Ausfallstraße von Casoria? Aber nein, ausgerechnet in den Ruinen von Pompeji. Da musste selbst Direktor Almirante eine vergleichsweise größere Portion seiner knapp bemessenen Zeit opfern.
»Es befinden sich Tausende von Touristen auf dem Gelände. Jedes Aufsehen ist unbedingt zu vermeiden!«, schnarrte er statt einer Begrüßung.
Man sieht es immer an den Augen, dachte Sonja. Er kann so überlegen tun, wie er will, aber seine Augen verraten ihn. Er ist aufgewühlt, er hat Angst, sein pompejianisches Reich könnte in Unordnung geraten und schlimmer noch: in die Schlagzeilen. Da ist versteckte Panik, unterfüttert mit dem dringlichen Wunsch, schnell auf einen Knopf drücken zu können – der Vorhang schließt sich wieder und macht alles ungeschehen …
Eine Leiche in Pompeji, das war ungeheuerlich, zumal es keine antike Leiche war, auf die sich Wissenschaftler und Medien voller Neugier und Forscherdrang stürzen würden. Keine archäologische Sensation wie vor Jahren der Ötzi. Einfach nur ein toter Gegenwartsmensch. Noch dazu vom Schwarzen Kontinent. So jemand machte Arbeit und vor allem Ärger. So jemand wirbelte nur unnötig Staub auf, noch bevor er selbst zu Staub geworden war.
»Wir werden sehen, was sich machen lässt«, erwiderte Gentilini. Was er nicht aussprach, aber jeder hören konnte, der solche Frequenzen wahrnahm, lautete in etwa: Bei den Ermittlungen entscheide immer noch ich, was wann wie passiert – und auf indirekte Befehle reagiere ich von Haus aus allergisch.
»Als ich von diesem höchst unerfreulichen … äh … Fund informiert wurde, habe ich mich sofort mit Dottore Pagano in Verbindung gesetzt. Er sagte mir die größtmögliche Diskretion zu. Und dass er seine allerbesten Leute schicken würde …«
Mit diesen Worten warf der Direktor Gentilini und Sonja ein ausgedünntes Lächeln zu, das besagen mochte: Wehe, wenn Sie Ihre Sache nicht besser als gut machen… Soviel, um klarzustellen, wer am längeren Hebel saß.
Abwarten, dachte Gentilini unbestimmt lächelnd. Er nickte Cava zu, stellte Sonja vor und fügte mit Seitenblick auf die Pressefrau hinzu: »Una collega tedesca…«
Kollegin aus Deutschland – so gesehen war das nicht einmal gelogen. Pressekollegin mit Schwerpunkt Schöner Wohnen und Toller Leben und Cooler Sterben, dachte Sonja, die den Schlagabtausch zwischen den zwei süditalienischen Platzhirschen amüsiert verfolgt hatte.
Almirantes Blick sprang hektisch zwischen Sonja und Gentilini hin und her. Da war irgendetwas, das sich ihm entzog. Europol? Sein Blick streifte Elena Milo, die keine Miene verzog, und kehrte dann zum Commissario zurück.
»Soll das heißen, hier liegt ein internationales Verbrechen vor?«
Gentilini überlegte eine Sekunde lang. Er würde einen Teufel tun und das Missverständnis klarstellen. »Europäische Zusammenarbeit«, erklärte er ungerührt. »Ein Pilotprojekt der EU zwischen Deutschland und Italien.«
»Pilotprojekt. Ma certo. Natürlich.« Augenblicklich hatte Almirante sich und seine verirrten Blicke wieder eingefangen. Und damit sofortige Rückkehr zum Direktorenhabitus: »Das ist ja eine sehr begrüßenswerte Sache.«
»La collega parla italiano«, schob Gentilini entgegenkommend nach.
Cava wirkte beeindruckt, und Almirante schenkte Sonja ein gewinnendes Lächeln. Allerdings lächelte nur sein Mund, und von Gewinn war keine Rede. »Benvenuta a Napoli. Nur schade, dass es unter diesen Umständen…«
Sonjas Mund lächelte formvollendet zurück, als würde sie jemandem einen Korb geben, der sie noch gar nicht zum Tanzen aufgefordert hatte. »Piacere.«
»Das trifft sich aber gut!«, ließ sich in dem Moment die klare Stimme der Pressefrau vernehmen. »Sie kommen uns wie gerufen.«
Elena Milo hatte dunkle, kurze Haare, war ziemlich klein und wirkte auf den ersten Blick sehr jung, eher wie eine Ballettschülerin. Sie hielt sich kerzengerade und hatte einen wachen Blick.
»Zwei Ihrer Landsleute haben nämlich die Leiche entdeckt«, fuhr sie fort, »zwei deutsche Touristinnen. Sie haben einen Mann vom Wachdienst zu Hilfe geholt und …«
»Wo sind die Frauen jetzt?«, unterbrach Gentilini.
»Im Verwaltungsgebäude. Eine Sekretärin kümmert sich um sie. Die beiden sind ziemlich durcheinander. Kein Wunder. Leider versteht keiner, was sie sagen …«
»Natürlich haben wir deutsch sprechende Touristenführer hier, aber ich möchte so wenig Mitarbeiter wie möglich mit dieser Sache … äh … behelligen«, fiel der Direktor ihr ins Wort. »Sie können nachher mit den Damen sprechen«, sagte er zu Sonja gewandt.
So eine nett formulierte Bitte konnte man schlecht ablehnen. Sonja verkniff sich einen Kommentar. »Certo.«
»Wo ist der Wachmann?«, fragte Gentilini ungehalten.
»Er bewacht selbstverständlich die Leiche …«
»Und wo liegt sie?«
Cava machte eine Kopfbewegung in Richtung der Ausgrabungsstätte. »Irgendwo da in den Ruinen …«
3
Hinter dem mit Stacheldraht bewehrten Tor begann eine breite, mit riesigen Basaltsteinen gepflasterte Straße, die schnurgerade aus dem Schatten der Bäume herausführte – und in die im Jahre 79 untergegangene, von Lava verschüttete Stadt hinein, die seit Mitte des achtzehnten Jahrhunderts wieder ausgegraben wurde. Die Hitze hatte sich im Verlauf der Mittagsstunden immer weiter verdichtet. Die Sonne brannte gnadenlos auf mehr oder weniger intakte pompejianische Häuser herab, auf Mauerteile, Steinsockel, Steinquader, Steinbögen, als wollte sie den letzten Rest an organischem Leben austrocknen, ersticken, die Steine mit ihrer Glut verschweißen, bis nichts übrig blieb als Stein, Stein und Staub und Erde.
Eine Gruppe sonnenkäppibewehrter asiatischer Touristen tauchte aus einem Ruinengeviert auf, die meisten mit Kameras vor dem Bauch, und allen voran schritt ein nichtasiatischer Fremdenführer mit rotem Sonnenschirm. Sie überquerten die Straße und bogen in einen Säulengang ein, der laut einem Hinweisschild zu den Amphitheatern führte. Teatro Piccolo. Teatro Grande.
»Und – wie war das Konzert, Gennà?«, fragte Cava auf dem Weg zum Tatort.
»Was weiß denn ich?« Gentilini brummte, er habe den Abend leider im Büro zugebracht. Was der Wahrheit entsprach. Bis kurz vor Mitternacht hatte er in der menschenleeren Questura am Schreibtisch gesessen und so viel Papierkram wie möglich erledigt, damit er den Rücken frei hatte. Für Sonja.
»Wie jammerschade!«, klagte Cava. »Das ist doch nicht möglich! Überstunden, obwohl du Konzertkarten hattest, was für eine Verschwendung! Hat es sich denn wenigstens gelohnt? Gibt es neue Informationen zu der Wasserleiche von letzter Woche? Weiß man endlich, wer sie ist? Wo sie herkommt? Vielleicht gibt es da eine Verbindung …?«
Ispettore Cava reihte gern eine größere Anzahl von Fragen oder Aussagen aneinander, als würde sich eine einzige gar nicht lohnen. Sein Gegenüber konnte sich aussuchen, worauf er antworten wollte.
Gentilini wollte in diesem Fall gar nicht. Er ärgerte sich ja selbst darüber, dass er das Konzert versäumt hatte.
»Was für ein Konzert?«, fragte Sonja.
»Ich hatte zwei Karten. Gestern Abend, hier im Teatro Grande. L’opera proibita. Cecilia Bartoli.« Er sagte nicht: für uns.
»Das wusste ich gar nicht.«
Hätte ja auch eine Überraschung sein sollen, dachte Gentilini verdrossen, sprach es aber nicht aus. Cava musste schließlich nicht mehr als nötig über sein Verhältnis zur deutschen Kollegin erfahren. »Hätte das etwas geändert?«, murmelte er kaum hörbar.
Sie zuckte die Achseln. Was sollte sie darauf sagen. Die Tage vor ihrer Abreise waren hektisch gewesen. In letzter Minute war dieser lukrative Auftrag für die Cosmopolitan eingetrudelt, ein Text über Wohnen in der Hafencity, das konnte man nicht ablehnen. Sie hatte den Flugtermin verschoben und fast zwei Tage und Nächte durchgearbeitet. Hätte Gentilini ihr von dem Konzert erzählt, hätte sie sich nur geärgert. Aber das tat sie jetzt auch, ein bisschen wenigstens: ein Freiluftkonzert in einer mediterranen Nacht, sternenklarer Himmel, laue Luft, im Halbrund eines echten antiken Amphitheaters, im Hintergrund echte Pinien, Bartolis unvergleichliches Spiel mit barocken Rezitativen…
Schweigend gingen sie weiter.
Cava musterte Sonja neugierig: eine Kripofrau aus Deutschland, die Italienisch konnte und auch noch ziemlich gut aussah … War der Commissario etwa so schlecht gelaunt, weil man ihm die deutsche Kollegin aufs Auge gedrückt hatte? Nun, Cava würde das im Blick behalten. Wenn Gentilini keine Lust hatte, würde er sich mit Freuden um sie kümmern.
Er begann ein Gespräch mit Sonja, stellte ihr ein paar Fragen aus dem üblichen Repertoire, das zwischen dem Einheimischen und der Fremden abgewickelt wurde, allerdings mit der gebotenen Vorsicht gegenüber einer Kollegin. Sie antwortete einsilbig und stellte keine Gegenfragen. Das Gespräch blieb irgendwann stecken.
Sie kreuzten die Via dell’Abbondanza, ließen die Terme Stabiane links liegen. Trotz der Hitze waren viele Touristen unterwegs. Einzeln, in kleineren und größeren Gruppen stapften sie, bewaffnet mit Tagesrucksäcken, Wasserflaschen, Sonnenhüten, zwischen den antiken Gemäuern umher. Die Sache war strapaziös, aber man nahm sie auf sich. Wortfetzen aus dem europäischen und slawischen Sprachraum schwirrten, vom mediterranen Klima gegeißelt, durch die Luft.
Irgendwann bog Direktor Almirante, der zusammen mit Elena Milo voranging, nach rechts ab. Via degli Augustali, las Sonja. Kurze Zeit später überquerten sie eine Gasse namens Vicolo di Tesmo. Und dann war eigentlich Schluss, jedenfalls für x-beliebige Pompeji-Touristen. Denn quer über die Straße war eine Eisenkette gespannt. Dieser Teil der Ausgrabungen war für Besucher gesperrt: L'ingresso vietato, besagte ein Schild. Zutritt verboten.
Darüber konnte man sich hinwegsetzen. Einfach über die Kette steigen. Auf bestimmte Leute, zu denen im Übrigen auch Sonja zählte, übten Verbotsschilder eine nicht zu unterschätzende Wirkung aus – die Herausforderung, eine Grenze zu überschreiten. Der natürliche Entdeckerdrang des Menschen kam hier zu seinem Recht. Der ganz spezielle Reiz des Verbotenen.
Verbote waren doch dazu da, missachtet zu werden – in Ruinengrundstücken zu stöbern, leerstehende Fabrikgebäude zu erkunden, über Zäune in fremdes Terrain zu klettern, die Kirschen aus Nachbars Garten zu stibitzen, Tempolimits zu ignorieren. Den eigenen Weg auf eigene Faust weiterzugehen und sich dabei nicht von einem banalen Bis-hierher-und-nicht-weiter-Schild abhalten zu lassen.
Eine kleine Regelverletzung? Das war es doch, was insbesondere dem Urlaub erst die richtige Würze verlieh. Und natürlich war es für jeden durchschnittlich mobilen Pompejibesucher ein Leichtes, mit einem größeren Schritt über eine Kette wie diese hinwegzusteigen. Hätte Sonja vermutlich auch gemacht. Mit einer Leiche rechnete man selbstverständlich nicht …
4
Die Frau lag am Boden, mitten in einem Trümmergeviert, das vor über zweitausend Jahren ein größeres Haus gewesen sein musste. Jetzt stand nur noch ein Bruchteil der Außen- und Innenmauern, es gab nicht einmal mehr Andeutungen von Zimmeraufteilungen. Wucherndes Grün zwischen antiken Gesteinsbrocken. Geröll, Steine, Tonscherben, Lavaboden. Dazwischen die Frauenleiche, die von zwei Leuten des Aufsichtspersonals bewacht wurde. Sie hockten rauchend auf einem Mauerrest, von dem sie wie ertappt aufsprangen, als der Direktor und sein Gefolge um die Ecke bogen wie bei der Chefvisite im Krankenhaus. Der jüngere der beiden trat schnell noch seine Zigarette aus.
Was Sonja dann sah: dunkle Beine, dunkle Arme, überhaupt dunkle Haut, viel Haut und wenig Verhüllendes, schwarz die offenen Haare, kraus und dicht. Eher zierlich der Körper, schlank und jung. Die Frau trug nichts als einen weißen, knapp bemessenen Slip mit einem mittigen rosa Schleifchen und einen ehemals weißen BH. Entweder wirkte die Haut durch den weißen Stoff dunkler oder das Weiß durch die dunkle Haut noch weißer, jedenfalls fiel der Kontrast ins Auge. Und die Schönheit der Frau. Es gab viele Afrikanerinnen mit ausdrucksvollen, einprägsamen Gesichtern, aber diese war besonders schön, fand Sonja, obwohl es eine Tote war, auf die sie hinabblickte. Die Frau war keine Schwarzafrikanerin, ihre Haut war heller, wie nannte man dieses Braun? Kaffeebraun, Goldbraun, Messingbraun? Sie lag mit geballten Fäusten auf dem Rücken und starrte hoch in den blauen Himmel Kampaniens, als sei der Tod direkt von dort gekommen, ein herabschwebender Racheengel … Was Sonja am liebsten ausgeblendet hätte, war das Blut. Der Schuss ins Herz. Sie blickte weg.
Almirante hatte auf dem Weg fast ununterbrochen telefoniert und tat es auch jetzt wieder. Elena Milo kritzelte etwas in ein Notizbuch, vermutlich Versatzstücke einer Presseerklärung. Gentilini sagte etwas zu Cava, woraufhin dieser hinter einem Mauerrest verschwand. Dann wandte der Commissario sich den beiden Wachmännern zu.
»Wer von euch hat die Leiche als Erster gesehen?«
»Ich, Signor Commissario, aber nicht als Erster …«
»Erzählen Sie. Der Reihe nach.«
»Sagen wir mal so, Signor Commissario«, begann der ältere der beiden Wachmänner, »ich war gerade bei den Thermen, weil … da muss immer einer stehen, da geht es zu, das glauben Sie nicht … ja, und plötzlich kommen diese Frauen angelaufen und sind ganz aufgeregt und reden auf mich ein, beide gleichzeitig, ich verstehe kein Wort, wie auch, ich kann nur danke und bitte und schumaackerr und gutten tag …« Er lachte kurz, wurde aber sofort wieder ernst. »Danach haben wir es mit Englisch versucht, das ging besser. Das heißt, zuerst hielt ich das Ganze für einen schlechten Witz, dead african lady, wie denn, wo denn, deshalb sag ich, immer mit der Ruhe, pian piano, no problem, da hält jemand ein Mittagsschläfchen, lady sleeping …, aber die Frauen ließen einfach nicht locker, ich sollte unbedingt mitkommen. Irgendwas ist passiert, denk ich also, jemand hat einen Kreislaufkollaps oder einen Herzinfarkt, bei der Hitze, das hatten wir schon oft, wissen Sie …«
»Kommen Sie endlich zur Sache«, fuhr der Direktor den Mann ungehalten an.
Der Wachmann hatte offenbar den Faden verloren. Hilfesuchend sah er zu Gentilini, der aufmunternd nickte.
»Sie sind den beiden Touristinnen also gefolgt …«
»Esatto.«
Der Wachmann nahm seinen weitschweifigen, in neapolitanischem Dialekt vorgetragenen Bericht wieder auf, dem Sonja nur mit Mühe folgen konnte.
»… und wie ich sie da liegen seh, denk ich auf den ersten Blick, aus der Entfernung, Commissario, als wir um die Ecke biegen, dass sie schläft oder sich sonnt, auch wenn sie das natürlich gar nicht braucht, um braun zu werden, meine ich … Und es wäre ja nicht das erste Mal, dass jemand die Absperrungen ignoriert, Sie glauben nicht, auf was für Ideen die Leute kommen, nicht nur, dass sie in den Ruinen ihr Zeug liegen lassen, als wär das ein riesiger Abfallhaufen, Chipstüten und Coladosen und Taschentücher, weil … manchmal erledigen sie hinter irgendeiner Ecke sogar ihr Geschäft … wie viele Leute wir da immer wieder rausscheuchen müssen, da könnte man jede Menge extra Personal einstellen … als wäre der ganze Rest, den man sich hier ansehen kann, nicht groß genug, das ist doch an einem Tag kaum zu schaffen, sag ich immer, aber die Leute sind so, die Leute wollen immer mehr, und wir müssen die Augen aufhalten und aufpassen, dass sich keiner ein kleines Souvenir mitnimmt, mal kurz mit dem Taschenmesser ein Steinchen aus einem Mosaikboden löst oder einfach eine alte Scherbe einsteckt, das glauben Sie nicht, auf was für Ideen die Leute …«
In dem Moment kam Cava aufgeregt zurück. Er fuchtelte mit den Händen und zeigte in die Richtung, aus der er gekommen war: »Da hinten hab ich Blutspuren entdeckt, ungefähr zwanzig Meter weiter, aber das ist das Einzige …«
Gentilini nickte kurz. »Danke. Das überlassen wir der Spurensicherung.«
Almirante nahm die Unterbrechung zum Anlass, sich vom Leichenfundort zu verabschieden. Er habe einen dringenden Termin mit dem Präsidenten der Region, und hier werde er sicherlich nicht mehr gebraucht. »Ich sehe, Sie haben die Sache im Griff.«
Gentilini antwortete nicht sofort, aber er hielt den Direktor mit den Augen fest. »Nur zwei Fragen.«
»Bitte. Wenn’s schnell geht.« Ungeduldiger Blick auf die Rolex.
»Was können Sie mir zum Sicherheitssystem sagen?«
Almirante hatte die Frage erwartet, aber sie war ihm sichtlich unangenehm. »Nun, etwa die Hälfte der Überwachungskameras ist seit Kurzem außer Funktion.«
»Seit über zwei Monaten«, konkretisierte Elena Milo und fing sich einen kalten Blick ein. »Das ist allgemein bekannt«, fügte sie als Selbstverteidigung hinzu.
Gentilini nickte. Es gab also vermutlich keine Kameraaufzeichnungen. Warum das so war, wollte er im Moment außer Acht lassen. Früher hätte er sich an solchen Fragen aufgerieben. Warum etwas nicht funktionierte. Wer dies verhinderte. Früher, als er noch dachte, man könne etwas verändern, man könne der Welt einen minimal anderen Dreh geben, wenn man nur die richtigen Fragen stellte.
»Haben Sie diese Frau schon einmal gesehen?«
Almirante erstarrte. Man sah ihm an, dass er dem Commissario am liebsten ins Gesicht gesprungen wäre. »Wieso sollte ich?! Eine Neg … eine Afrikanerin …?« Er verkniff sich den Zusatz, dass er in solchen Kreisen nicht verkehre.
»Nur eine Routinefrage. In meinem Beruf ist alles möglich«, erwiderte Gentilini ungerührt.
»In meinem glücklicherweise nicht!«, blafft Almirante.
»Wo erreiche ich Sie später?«
»Dottoressa Milo kann Ihnen alle weiteren Fragen beantworten. Sie kennt auch meinen Terminkalender.«
Bevor er sich von der am Boden liegenden Afrikanerin abwandte und zu seinen Geschäften zurückkehrte, schickte er noch ein wohldosiertes Lächeln in Richtung der anwesenden Damenwelt. »Arrivederci.«
»Die Frau schlief also nicht«, fuhr Gentilini, ohne den Direktor weiter zu beachten, fort. »Sie war tot. Oder lebte sie noch?«
Der ältere Wachmann wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Aber nein, Commissario, wo denken Sie hin! Als ich dann näher ran bin, war das gleich sonnenklar, mit dem Blut und wie sie da liegt, auf dem harten Boden, das ist doch keine bequeme Lage, die man sich freiwillig aussucht … Und dass sie nicht ohnmächtig war, wegen der Hitze, das war ja auch nicht zu übersehen, insomma, auch wenn ich auf diesem Gebiet kein Fachmann bin …«
»Haben Sie sie angefasst?«
»Um Himmels willen, Commissario, per l’amor di Dio, natürlich nicht!« Er hob wie zum Beweis der Unschuld beide Hände in die Höhe.
Gentilini wandte sich an den jungen Wachmann, der höchstens zwanzig war und ihn, was die Körperhaltung und das Auftreten betraf, ein wenig an seinen Sohn erinnerte. Wer weiß, vielleicht würde Giorgio in fünf Jahren ganz ähnlich aussehen. »Und Sie?«
»Ob ich die Leiche angefasst habe …? Niemals, Ehrenwort, Commissario, bei den Haaren meiner Großmutter.«
»Waren Sie von Anfang an mit dabei?«
»Nein, ich kam erst später dazu. Gino« – er zeigte auf den älteren Wachmann – »rief mich an, ich war in der Nähe, bei der Casa del Fauno, und da bin ich sofort los, um mir die Sache mit eigenen Augen anzusehen …«
»Wie spät war es da?«
Achselzucken. »Ungefähr eins oder halb zwei. Dann haben wir in der Direktion angerufen, damit jemand kommt und die Polizei verständigt, aber es war ständig besetzt, also bin ich selbst höchstpersönlich los.« Er lachte etwas unbehaglich. »Bei der Hitze.«
Einer musste ja dableiben und aufpassen«, ergänzte der Wachmann namens Gino. »Dass nicht womöglich noch mehr Leute über die Absperrung steigen, um hier ein Picknick zu machen, so wie die beiden deutschen Ladys, und auf dem Gelände rumtrampeln und wichtige Spuren vernichten« – ein kurzer Blick in Richtung Cava -, »das weiß man ja aus dem Fernsehen, ich meine, was sollte ich sonst tun … Uffa! So was erlebt man schließlich nicht jeden Tag, eine echte Leiche! Und dann noch so eine…« Er fasste sich an die Hose und rückte kurz zurecht, was sich während seines Berichts verschoben hatte.
»Was meinen Sie mit so eine?«, fragte Elena Milos klare Stimme.
»Na ja … Dass sie nackt war.« Er lachte nervös. »Una bella negrona.«
Die Art, wie er es sagte, verriet, was er über die tote Frau dachte. Aber weil Gino ein aufmerksamer Wachmann war, dem das daraufhin eintretende eisige Schweigen nicht entging, fügte er schnell hinzu: »Das weiß man doch. Dass die Frauen aus Afrika hier großenteils als Nutten arbeiten, ich meine …«
»Hier um die Ecke ist gleich der Straßenstrich«, bemerkte Cava.
»Vielleicht ist sie eine amerikanische Touristin«, schnitt Gentilini beiden das Wort ab.
In dem Moment bog ein Trupp der Spurensicherung um die Ecke. Auch ein Arzt war dabei. Gentilini kannte ihn nicht, aber bei der Begrüßung hörte er, dass Manganelli die Obduktion vornehmen würde. Der Commissario sprach kurz mit den Neuankömmlingen, wies auf das Gelände ringsum, während Cava einem Kollegen die Stelle zeigte, wo er die Blutspuren entdeckt hatte. Danach gab es nichts mehr, was sie hier tun konnten. Im Hauptgebäude warteten die beiden deutschen Touristinnen. Sie wandten sich zum Gehen, doch der jüngere Wachmann hielt Gentilini zurück.
»Commissà, kann ich Sie etwas fragen?«
»Certo.«
»Also, ich weiß schon, das ist nicht die wirklich passende Situation, aber man muss die Gelegenheit beim Schopfe packen, deshalb …« Er räusperte sich kurz. »Die Sache ist die, ich würde gern zur Polizei gehen, das wär schon eine andere Nummer, und … Vielleicht könnten Sie, also, wenn wir hier fertig sind, ein Wort für mich …«
Gentilini lächelte und dachte wieder an Giorgio. Sollte man nicht an jedem Ort eines Verbrechens eine Prise Hoffnung ausstreuen?
»Rufen Sie mich in der Questura an, dann erzähle ich Ihnen, welche Wege es gibt. Aber gehen müssen Sie ihn dann allein, ohne fremde Hilfe. Va bene?«
Der junge Wachmann nickte zögernd. Vielleicht hatte er sich einen Atemzug lang mehr versprochen. Aber auch so klang es nach einem brauchbaren Anfang.
5
In einer Dreiviertelstunde würde die Ausgrabungsstätte schließen. Obwohl die Sonne niedriger stand, hatte die Hitze nicht nachgelassen. Zumal inmitten dieser steinernen Welt. Scharen von Touristen schleppten sich nach einem langen Pompejitag in Richtung Ausgang. Manch einer, krebsrot auf Schultern, Armen, Nacken, würde sich heute Nacht quälen, dachte Sonja, die im Schatten an der Außenwand eines über zweitausend Jahre alten Hauses hockte. Und dann, dass es ihr egal war. Dass es sie nichts anging. Sie fühlte sich auf einmal ziemlich elend.
Sie war den Anblick von Leichen nicht gewohnt und wollte sich auch nicht daran gewöhnen. Als Luzie ihre Abende noch zu Hause verbrachte, hatten sie häufiger zusammen vor der Glotze gesessen, es wurden ja immer mehr Krimis gezeigt, also auch immer mehr Tote, in zunehmend ausgedehnten, genussvoll ausgekosteten Einstellungen, immer indiskreter, farbenfroher, vermeintlich echter. Wenn die Leichen gezeigt wurden, am Tatort, im Leichenschauhaus, beim Identifizieren durch Angehörige, hatte Sonja meistens den Kopf weggedreht, bis ihre Tochter Entwarnung gab. Vielleicht eine Frage der Generationen. Der Abhärtung. Der Sentimentalität. Egal. Seit Luzie ausgezogen war, hatte Sonja sich keine Krimis mehr angesehen. Und nun diese Leiche. Eine echte Frauenleiche.
Eine gute Journalistin hätte die Situation sofort für sich genutzt, schoss es Sonja durch den Kopf. Hätte ruckzuck einen Artikel in den Laptop gehämmert und an alle möglichen Presseagenturen und Redaktionen geschickt.
MORD IN POMPEJI.Deutsche Touristinnen stolpern über Leiche.
In den Mittagsstunden des gestrigen Tages entdeckten zwei deutsche Touristinnen während eines Rundgangs durch das antike Pompeji die Leiche einer spärlich bekleideten jungen Frau vermutlich afrikanischer Herkunft. Nach ersten Erkenntnissen der Mordkommission wurde auf das Opfer geschossen, das noch am Tatort verblutete.
Die Identität der toten Schwarzen liegt bisher im Dunkeln. Die Bürofachfrau Marita Wieseking und Boutiquebesitzerin Sara Schmitt, beide aus Hannover, sind schockiert. »Wir suchten nach einem lauschigen Platz für ein Picknick und entdeckten stattdessen eine nackte Tote.«
Dies ist bereits das dritte Opfer schwarzer Hautfarbe innerhalb eines Monats. Erst letzte Woche wurde in einer Bucht unweit des Stadtzentrums eine tote Afrikanerin gefunden, Anfang August ein Opfer aus Nigeria in einem Straßengraben. Ob die drei Verbrechen in einem Zusammenhang stehen, ist noch ungeklärt. Von den Tätern fehlt jede Spur.
Die Mordstatistik in der Stadt am Vesuv spricht eine deutliche Sprache: Die Zahl der Gewaltverbrechen hat auch in diesem Jahr wieder deutlich zugenommen. Die beiden Deutschen wollen ihren lang ersehnten Urlaub am Golf von Neapel dennoch nicht abbrechen. »Es ist einfach zu schön hier.«
Aus Neapel Sonja Zorn.
Und morgen wäre ein ausführlicher Bericht gefolgt. Sie hätte ganz professionell Interviews gemacht, mit den beiden Touristinnen, mit Elena Milo, mit Gennaro, vielleicht sogar seinem eifrigen Kollegen Cava … Was scherte sie die Angst des Direktors, der Leichenfund könnte sich negativ auf die Touristenströme aus wirken? Schlechte Publicity? Im Gegenteil. Sonja war davon überzeugt, dass die Leute nun erst recht kommen würden. Jeder Pompejibesucher in spe wäre insgeheim begierig darauf, eine eigene Leiche zu entdecken. Wie besessen würden sie sich über das Gelände, hermachen, in sämtliche noch so versteckten Winkel der antiken Stadt eindringen …
Nachdem sie die Aussagen der beiden Deutschen übersetzt hatte, hatten Sonjas und Gentilinis Wege sich getrennt. Die Kripo hatte vor Ort genug zu tun, und Sonja wollte nicht im Weg stehen. Und die Rolle als deutsche Ermittlerin war für heute ausgereizt. Was für Ziegen, die Damen Wieseking und Schmitt! Natürlich war man nach einem Leichenfund aufgeregt und ein bisschen neben der Spur – aber diese forsch-dreiste Art hatte Sonja noch nie ausstehen können. Immer mit der Nase (oder dem Käppi) vorn, sofort die richtige Meinung zur Hand und speziell im Ausland genau wissen, wo es langgeht.
Sonja war eine gute Stunde lang ziellos durch die Straßen und Gassen gelaufen. Mit dem festen Vorsatz, in die Atmosphäre der Ausgrabungsstätte einzutauchen und dabei jeden Gedanken an die sterblichen Überreste der toten Frau und alles, was sie in den letzten Stunden erlebt hatte, auszublenden. Sie hatte mehrere einfache Wohnhäuser betreten, unterschiedlich gut erhalten und restauriert, auch Wohnkomplexe reicherer Bürger Pompejis mit Kammern, Nebenkammern, Atrien, Säulengängen. Sie hatte Graffiti an den Hauswänden gesehen, Wagenspuren in den Straßen, öffentliche Brunnen, die unter dem Schutz irgendwelcher Gottheiten standen, deren Namen und göttliche Befugnisse Sonja nicht kannte. Sie hätte einen Führer gebraucht, einen lebenden Reiseführer oder einen in Wort und Schrift, der ihr erklärte, was sie sah, der Geschichte und Geschichten auf Lager hatte.
Römische Geschichte war nie Sonjas Stärke gewesen. Ihr Kopf bot ihr nichts als Versatzstücke an: Römer, Gladiatorenkämpfe, Limes, Lorbeerkranz, Cäsar, Sklaven, Toga, Trinkgelage, Schwerter, Ketten – Begriffshülsen, die wie schwerelos und aus jedem Zusammenhang herausgerissen durch die Galaxie ihres Gedankenuniversums trieben und sich jedem Zugriff entzogen.
Vielleicht fehlte ihr die Phantasie, vielleicht war es einfach der falsche Tag. Sie konnte diese Häuser, diese Straßen, diese Plätze an den Brunnen einfach nicht mit Leben füllen. Mit römischen Hausherren und ihren Gemahlinnen, mit rufenden, spielenden Kindern, mit Bürgern, die trockenen Fußes die unratverschmutzten Straßen überquerten, indem sie die Trittsteine benutzten, die zwischen einer Straßenseite und der anderen eingesetzt waren, mit Sklaven, die auf dem Forum um Preise feilschten, Esel durch die Gassen trieben, Sklavinnen, die Krüge voll Wein heranschleppten, Körbe, die mit Feigen, Datteln, Trauben beladen waren. Es ging einfach nicht. Vielleicht hatten Hitze, Staub und Menschenmassen Pompeji endgültig in eine tote Stadt verwandelt, deren Steine nicht mehr zu den Nachgeborenen sprachen.
Sonja sah nichts als Gegenwart, echte Touristen mit Fotoapparaten, Rucksäcken, Plastikflaschen, Sonnenbränden, viel Stein und im Hintergrund dunkel, beinahe drohend als Kulisse den Vesuv. In ihren Ohren aber klang, viel deutlicher als das babylonische Stimmengewirr um sie herum, der schleppende Tonfall des Wachmanns nach, seine ausgeprägte neapolitanische Diktion. Vor dem inneren Auge tauchte ab und zu die tote Frau auf, dann wieder Gentilini: beim Abholen am Flughafen, beim kurzen Intermezzo in seinem Schlafzimmer, bei der Fahrt nach Pompeji, am Fundort der Leiche. Eine Verwandlung war in ihm vorgegangen, der Kommissar war wie auf ein Fingerschnippen zum Vorschein gekommen. Sein Beruf hatte ihn wieder an der Angel. Statt dass sie sich mit Haut und Haaren in ihre Verliebtheit stürzten, arbeitete er daran, eine weitere Leichenakte zu füllen. Und was tat sie? Sie saß erschöpft im Schatten und starrte in die Gegend.
Im Haus schräg gegenüber verkündeten in Stein gehauene Großbuchstaben auf einem antiken Hinweisschild, in dessen Zentrum ein Phallusrelief prangte: HIC HABITAT FELICITAS. Hier wohnt das Glück. Oder eine Frau mit Namen Felicitas? Sonjas Lateinkenntnisse waren dank konsequenter Nichtanwendung auf ein klägliches Häuflein geschrumpft, aber die Tatsache, dass sie fließend Italienisch sprach, rettete sie hin und wieder, wenn sie an Kirchen oder Palästen eine Inschrift entziffern wollte. Wenngleich oft gerade die entscheidende Vokabel fehlte, von grammatikalischen Zusammenhängen ganz zu schweigen. Als in der Schule im Lateinunterricht die Lektüre von De bello Gallico auf dem Programm stand, war Sonja zunächst davon überzeugt gewesen, dass die Hauptperson des Textes ein schöner Gallier sein müsse. Schulstunde für Schulstunde hatte sie auf ihn gewartet, auf das Auftauchen dieses Mannes, vergeblich natürlich. Was für eine Enttäuschung herauszufinden, dass es in dem Buch nicht um schöne Männer ging, sondern um einen Krieg, Kriegsführung, strategisches männliches Denken.
Drei Worte und ein Symbol. Hier wohnt das Glück … Aber wie war das zu verstehen? Als Hinweis auf blühende Geschäfte, die in dem Haus getätigt wurden? Glück in Form von Reichtum? Oder anders, Glück in Form eines zeugungsfähigen Mannes und vieler Kinder? Oder hatte sich in dem Gebäude schlichtweg ein Bordell befunden? Hatte hier vor fast zweitausend Jahren eine Prostituierte gelebt, die aus beruflichen Gründen das Pseudonym Felicitas gewählt hatte?
Ein paar Jugendliche zogen an Sonja vorbei, in mehreren Grüppchen, Mädchen und Jungen im Alter von fünfzehn, sechzehn Jahren, auf dem Zenit der Teenagerei also, viel Gekicher, Gefrotzel, Geplapper auf deutsch, die Stimmung war gut.
Ihr fiel plötzlich die verpasste Klassenreise an den Golf von Neapel ein, der Film mit den Leichen. Wie hatte sie das nur vergessen können? In der neunten Klasse stand damals eine Fahrt an den Golf von Neapel auf dem Programm. Schon Wochen vorher schmiedete man Pläne, die weniger die Besichtigungsziele zum Inhalt hatten als die Fragen, wer mit wem in einem Zimmer schlafen würde, wer es überhaupt derzeit auf wen abgesehen hatte, wer mit wem ging oder gehen wollte, welche Partys sie feiern würden, wenn die Lehrer schliefen.
Zwei Tage vor Beginn der Reise hatte Sonja sich beim Kastenturnen das Bein gebrochen und nicht mitfahren können. Ihr stand lebhaft vor Augen, wie mies sie sich gefühlt hatte, einem Weltuntergang nahe: Alle anderen, alle Freundinnen, einfach alle aus der Klasse stiegen in einen Zug namens Abenteuer und ließen Sonja mit ihrem Gipsbein zurück. Die nur warten konnte, bis der echte Zug Lichtjahre später wieder einrollte und Teil zwei ihrer Niederlage, ihres Nicht-dabei-Seins begann, nämlich das Erzählen, Berichten, Schwärmen von all den tollen Erlebnissen, die sie verpasst hatte, diesen vielen begehrenswerten Weißt-du-noch-Momenten, die, von vielsagenden Blicken untermalt, wie nebenbei in die Gespräche einflossen, von denen sie ausgeschlossen war …
Sie erinnerte sich an den schalen Trost der Mutter am Krankenbett, Sonja sei noch jung und habe daher später genug Zeit, die Welt zu entdecken. Und außerdem, was das alles gekostet hätte.
Unkosten, wieso denn Un-Kosten, hatte die Mutter nach dem Elternabend geschimpft, das sei Augenwischerei, schließlich seien es Kosten, ganz konkrete, enorme Kosten, die auf sie zukämen und die sie als Witwe mit Kind nur mit großer Anstrengung bewältigen könne; die Vorsilbe un- bedeute schließlich das Gegenteil der Dinge, man sagte angenehm und unangenehm, freiwillig und unfreiwillig, ehrenhaft und unehrenhaft, Mensch und Unmensch, unter Unkosten müsse man sich folgerichtig das Gegenteil vorstellen, nämlich keine Kosten, und genau so hatte der Lehrer die Sache heruntergespielt, als sei er eine Kleinigkeit, dieser Unkostenbeitrag …; in dieser Denkschleife verhakt, hatte die Mutter nicht auf den möglichen Zuschuss durch den Schulverein zurückgreifen wollen, denn das waren Almosen, wie sie es nannte, wir brauchen keine Almosen, das ist unehrenhaft, entweder wir schaffen es allein oder wir schaffen es gar nicht. In diesem Fall, dank Sonjas gebrochenem Bein, also gar nicht. Was der Mutter im Grunde nicht unrecht gewesen war … Sonja hörte ihre Stimme so deutlich, als wäre das alles gestern passiert, in der kleinen Küche der Barmbeker Wohnung, nicht hier und jetzt in Pompeji.
Eine Reise durch Zeit und Raum – vielleicht war das der geheime Nebenzauber dieser untergegangenen, wieder ausgegrabenen Stadt. Die Erinnerung an die eigene Geschichte, an lang zurückliegende Erlebnisse. An den Film, den der Klassenlehrer nach der Reise im Unterricht gezeigt hatte. Die Leichen, die Bewohner der antiken Stadt. Männer, Frauen, Kinder waren nach dem Ausbruch des Vulkans von einer Wolke giftiger Gase überrascht worden und in Sekundenschnelle erstickt. Nach der Entdeckung Pompejis hatten Forscher die Hohlräume, die ihre von den Lavamassen eingeschlossenen, verwesenden Körper hinterlassen hatten, mit Gips aufgefüllt. Sonja erinnerte sich an Großaufnahmen der mitten in der Bewegung erstarrten Körper, Füße mitsamt der Konturen von Sandalen, Hände, die in einer verzweifelten letzten Bewegung ein Gesicht zu schützen versuchten, auf gerissene Münder im Todeskampf. Damals, im abgedunkelten Klassenzimmer, war sie stumm in Tränen ausgebrochen, was zum Glück niemand bemerkt hatte, eine lautlose Tränenflut aus Erschrecken, Schmerz, Mitleid und Selbstmitleid, einem letzten Rest an Bedauern, dass sie auf dieser Klassenfahrt nicht dabei gewesen war. Die Gipskörper auf der Leinwand hatten so lebendig gewirkt, völlig echt und doch künstlich, beides zugleich, eine Art Schnittpunkt von Leben und Tod und Tod und Leben.
In dem Moment wusste Sonja, was sie sich in Pompeji ansehen musste. Sie stand auf und sah sich nach einer Aufsichtsperson um, die sie wegen der Gipsleichen befragen konnte, falls diese nicht längst in einem Museum gelandet waren.
6
Als Commissario Gentilini am frühen Abend zusammen mit Ispettore Cava auf den Hintereingang des Polizeipräsidiums zusteuerte, brummte ihm der Schädel. Daran war nicht nur Cava mit seinem unablässigen, rasanten Palaver schuld, aber auch. Es tat gut, einen Schuldigen zu haben. Wenigstens im Kleinen. Gleich mehrere: Cava, die dumpfe Spätsommerhitze – und dann stieg ihm auch noch der Geruch in die Nase. Der Geruch setzte allem die Krone auf.