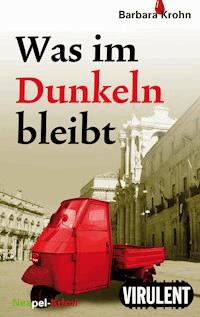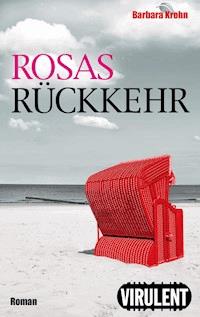Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Als Ines Klövenstrüpp ihren zwei Monate jungen Sohn im Kinderwagen durch die Regensburger Altstadt schiebt, wird sie in einer der mittelalterlich engen Gassen Zeugin eines Mordes. Leibhaftig weg vom Fenster ist Literaturprofessor und Frauenheld Paul Breitkreuz. Wer hat ihn aus dem Weg geräumt? Eine Frau, ein Kollege, ein Schulfreund? Spielt sein Plan für ein Literaturhaus in der Provinz eine Rolle? Ines, kurze Zeit selbst unter Verdacht, beginnt der Geschichte nachzugehen (und nachzuschieben). Auch Freya Jansen von der Kripo ist an dem Fall dran. Mit weiblicher Logik und entsprechendem Spürsinn ermitteln die beiden Frauen parallel – bis auch ihre Wege sich kreuzen: in einem verhängnisvolles Geflecht von allzu Menschlichem.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BARBARA KROHN
Weg vom Fenster
> bei Facebook
IMPRESSUM
Virulent ist ein Imprintwww.facebook.de/virulenz
ABW Wissenschaftsverlag GmbHAltensteinstraße 4214195 BerlinDeutschland
www.abw-verlag.de
© E-Book: 2014 ABW Wissenschaftsverlag GmbH
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
ISBN 978-3-86474-084-8
Produced in Germany
E-Book-Produktion: ABW Wissenschaftsverlag mit bookformer, BerlinUmschlaggestaltung: brandnewdesign, HamburgTitelabbildung: Barbara Krohn
P140001
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Meinen drei Männern
„Lesefrüchte, anhand derer wir frei phantasieren“Peter Weiss, Notizbücher 1971-1980
1
Das gleichmäßige Rauschen der beiden Springbrunnen hatte etwas Prickelndes und zugleich Beruhigendes. Johnny jedenfalls schlief. Auf dem Bismarckplatz gab es etwas umsonst: einen Hochsommerabend, der leicht bekleidet zelebriert wurde. Das Geräusch des Wassers dämpfte die Gespräche. Alle Stühle und Bänke waren belegt, man stand und hockte auf den Stufen, saß dicht an dicht auf der steinernen Umrandung des Brunnens. Ein paar jüngere Leute tauchten die Füße hinein, die meisten aber drehten dem Geplätscher den Rücken zu.
Getränke musste sich jeder selbst besorgen. Schlechte Karten für Ines, die unmöglich mit dem Kinderwagen bis zum Tresen vordringen, geschweige denn Johnny mutterseelenallein inmitten der von was auch immer trunkenen Menge zurücklassen konnte. Außerdem musste der Wagen in Bewegung gehalten werden, sonst wachte der Kleine auf. Aber Ines hatte Durst. Sie wollte auch dabei sein, wollte teilhaben an diesem Sommerabend, sich an den Brunnen setzen, schauen, Gedanken freilassen und andere dafür einfangen. Sie sprach eine Frau an, die soeben mit einem leeren Bierglas in der Hand auf den Kneipeneingang zusteuerte. Ob sie ihr ein Alsterwasser mitbringen könne?
„A wos?“
„Ein Alsterwasser“, wiederholte Ines, korrigierte sich dann selbst: „Ein Radler.“
„Ah so. Passt scho.“
Ines drückte ihr ein Fünfmarkstück in die Hand. Sie hatte dazugelernt. Inzwischen wusste sie, dass es sich bei Donauwellen nicht um ein bräunliches Getränk handelte, sondern um Gebäck, dass ein Blödmann ein Depp war und der Schnuller Dutzel hieß, dass Rundstücke als Semmeln verkauft wurden, Wurzeln als gelbe Rüben und Bratklopse als Fleischpflanzerl. Kleinigkeiten. Zumal das Ding an sich gleich blieb. Manchmal fühlte Ines sich mit ihrer klaren, unschnörkeligen norddeutschen Aussprache wie eine Fremde. Wie eine, die hörbar nicht dazugehört. Eine Zugereiste, wie es hier hieß. Ein Fischkopf, wie Toms Mutter bei der ersten Begegnung festgestellt hatte. Ohne es böse zu meinen: Sie denkt sich nichts dabei, hatte Tom, nur halb überzeugt, später richtigzustellen versucht.
Ein Pärchen am Springbrunnen stand auf. Schnell schob Ines den Kinderwagen wie eine Barrikade an den Brunnenrand, um zu verhindern, dass jemand ihr den Platz wegschnappte. In den meisten Situationen stellte der Kinderwagen eine Behinderung dar. Also galt es, Nachteile in Vorteile zu verwandeln. Schon saß sie zufrieden auf der Steinumrandung und wippte den gut gefederten Wagen mit dem Fuß auf und ab. Sie kam sich dabei ein wenig vor wie an der altmodischen, pedalbetriebenen Nähmaschine, die ihre Mutter im Herbst und im Frühjahr hervorgeholt hatte, um zu große Mädchenkleider zu kürzen und enger zu nähen, bei zu klein gewordenen Kleidern den Saum herauszulassen und so viele Stoffzentimeter wie möglich aus der Naht herauszuholen. Ines hatte fast alle Kleider von Marlen geerbt, der älteren Schwester. Ines war die zweite. Die dritte und jüngste, Karolin, hatte Glück gehabt: Nach zwei Vorbenutzerinnen waren die Kragen der Kleider meist durchgescheuert, die Farben verblasst, die Ellbogen dünn geworden, sodass die Mutter bei bestem Geschick kein >hübsches Kleidchen< mehr daraus zaubern konnte - Karolin bekam etwas Neues, Gnade der späten Geburt. Und ein Grund, weshalb Ines trotz chronisch leeren Bankkontos um Second-Hand-Läden einen Bogen machte. So hatte jeder seine Delle weg. Oder wie sagte man hierzulande?
Die Frau brachte ihr das Radler und den Rest von den fünf Mark. Ines bedankte sich. Und wieder: „Passt scho.“
Passt scho - der erste, zugegebenermaßen kurze Satz der ersten Lektion eines imaginären Sprachlehrbuchs, in dem Ines seit ihrer Ankunft im Freistaat zu blättern gezwungen war. Passt scho, mit weichem P oder hartem B, konnte, je nach Situation, so viel heißen wie: Ist schon in Ordnung oder: Danke, gut oder Macht nichts und wurde vor allem dann aktiviert, wenn jemand keine Lust hatte, ausführlicher zu antworten.
„Wie geht’s?“ - „Passt scho!“
Ein verblüffend oft benutzter Kurzsatz, um jemanden formvollendet abzubügeln.
„Wie sind die Nächte mit dem Kleinen?“
„Passt scho!“
Von wegen: eine Katastrophe! Da passte aber auch rein gar nichts. Die Nächte waren immer zu kurz, zerrissen, die Nerven blank gelegt, der Kraftvorrat allmählich erschöpft. Auch deshalb war Ines jetzt unterwegs. Um die Katastrophe in andere Bahnen zu lenken, Schlaflosigkeit umzumünzen in Stadtansichten. Johnny war vor Kurzem zweieinhalb Monate alt geworden und litt nach wie vor unter den Dreimonatskoliken. Fehlten demnach ein halber Monat, genau genommen nur noch elf Tage und morgen nur noch zehn. Läppische zehn Tage, bis die Tortur für Kind und Eltern ausgestanden sein dürfte. Aber diese konkrete Zeitvorgabe war nur ein schwacher Trost, denn es hatte auch geheißen, nach drei Schwangerschaftsmonaten sei es mit der Übelkeit schlagartig vorbei. Ines hatte sich satte fünf Monate damit herumgequält, und ihr wurde ganz anders bei der Vorstellung, mit den Blähungen ihres Sohnes könnte es sich ähnlich verhalten.
Zum Glück war Sommer. Ines mochte sich gar nicht ausmalen, wie es gewesen wäre, wenn sie ihr Kind durch Novembernebelschwaden oder eiskalte Winternächte hätte schieben müssen. Denn zuverlässig schlief Johnny nur, wenn er im Kinderwagen geschoben wurde. Er wurde ruhig, wenn er in Bewegung war. Was umgekehrt zur Folge hatte, dass Ines oder Tom wach sein mussten, wenn der Nachwuchs schlafen sollte. Tom fand es eine Zumutung, aber als noch größere Zumutung sah er den Vorschlag seiner Mutter an, das Baby nachts schreien zu lassen, um ihm auf diese brutale Weise von Anfang an einzutrichtern, wie es zuging im Leben. So war es früher üblich gewesen - „und aus dir ist doch auch ein Mensch geworden.“
Mit diesem Vorschlag hatte sich die Hilfsbereitschaft der Oma diesbezüglich leider erschöpft, denn wer nicht auf ihren Rat hörte, musste alleine klarkommen und „in den sauren Apfel beißen“. „Geschenkt“ werde einem im Leben nichts, es sei an der Zeit, dass ihr Sohn diese Erfahrung auch mache, alt genug sei er ja. Leider gehörte auch Toms Vater nicht zu der potenziell einsatzfreudigen Sorte von Großvätern, die die eigenen Versäumnisse in späten Jahren, eine Generation später, nachholen wollten. Zumal Johnny das dritte Enkelkind war. Ohne den Reiz des Neuen also. Alles schon mal dagewesen. Ihr schafft das schon. Das haben schon andere vor euch geschafft. Wir doch auch.
Aber wann schliefen die frischgebackenen, trotz allem natürlich überglücklichen Eltern? Was vorher eine Selbstverständlichkeit gewesen war, eine Nebensache, der mehr oder weniger intensive nächtliche Schlaf, den man, zumindest am Wochenende, nach Belieben verkürzen oder verlängern konnte, wurde zum Mittelpunkt des Begehrens. Zum Dauermangel. Mit Mitte zwanzig, der Ansicht war zumindest Tom, hätte er das lässig weggesteckt, aber mit Ende dreißig?
So anstrengend hatten beide sich die Sache nicht vorgestellt. Genau genommen hatten sie sich gar nichts vorgestellt. Und wenn man den bereits erfahrenen Elternpaaren Glauben schenkte, dann konnte man sich das Elterndasein auch gar nicht vorstellen: Es sei eine Erfahrung, die sich nicht einmal annäherungsweise vermitteln lasse. Recht hatten sie. Und Tom und Ines hatten sich in dieser Unvorstellbarkeit eingerichtet.
Wenn Tom abends im Oblomow hinter der Theke stand, kam er zwischen eins und halb zwei nach Hause, schlief eine Runde, übernahm gegen halb sieben Uhr den Wach- und Schiebedienst für seinen Sohn, drehte eine Runde durch den Dörnbergpark, ging Semmeln kaufen. Nach bewegter Nacht konnte Ines wenigstens von sieben bis halb elf ungestört schlafen. Das machte für jeden von ihnen rund vier Stunden Schlaf am Stück. Früher, in Berlin, waren sie Nachtschwärmer gewesen und oft erst ins Bett gegangen, wenn die Vögel frühmorgens erwachten. Jetzt träumten sie bereits davon, abends mit den Vögeln zu Bett gehen zu können. Auszuschlafen. Wenigstens einmal. Solange Johnny Blähungen hatte: undenkbar.
An fünf Abenden und an einem Nachmittag stand Tom hinter der Theke und mindestens an einem der beiden freien Abende in der Dunkelkammer, zu der das kleine Badezimmer jedes Mal eigens umgebaut wurde. Fotografieren war seine alte Leidenschaft. Und das Zillefahren seine neue. Ines hingegen hatte alle Leidenschaften über Bord geworfen. Aber war nicht Johnny ihre neue Liebe?
Ines ging jeden Abend mit Johnny in die Altstadt, abgrundtief müde und hellwach zugleich, um nicht zu Hause mit ihm im Arm immer wieder dieselben Wände abzulaufen, immer im Kreis, zum Durchdrehen. Sie war froh, dass es die Altstadt gab und nicht nur Hauptverkehrsachsen und öde Wohnviertel und den Slalom durch die diversen Häufchen Hundescheiße. Sie erlief sich Schritt um Schritt die fremden Straßen, studierte Speisekarten, Inschriften an Häusern, Schaufenster, Plakate, sie blieb vor den Auslagen der Geschäfte stehen, las Straßennamen, vergaß sie gleich wieder.
Das sei auf das Stillen und den Schlafentzug zurückzuführen, hatte eine mit dieser Art von Gedächtnisschwund erfahrene Mitmutter berichtet, das gehe wieder vorbei. Was nur zu hoffen war! Ines schätzte diese abendlichen Spaziergänge sehr. Es tat nichts zur Sache, dass sie sich Straßennamen nicht merken konnte. Sie hatte noch keine eigene Geschichte in und mit dieser Stadt, an der ihr Gedächtnis hätte anknüpfen können. Hier gab es keine Alster, auf der sie im Winter als Kind zusammen mit den Schwestern Schlittschuh gelaufen war, keine Elbe mit tutenden Nebelhörnern und Docks und Containerschiffen. Die Donau war ein dunkler Fluss, auf dem man nach Wien fahren konnte, was Tom sich mit besagter Zille, seinem kürzlich von einem Donaufischer erworbenen, an die acht Meter langen Holzkahn, fest vorgenommen hatte. Die Donau war ein Kindheitsecho aus Toms Leben, nicht aus dem von Ines. Die Häuser in der Altstadt waren wirklich alt, mittelalterlich, romanisch, frühgotisch, hochgotisch, spätgotisch, barock, und somit waren sie für Ines neu. Hier gab es nicht diese flächendeckenden Backsteinbauten, die für den Wiederaufbau in der zerstörten Hansestadt standen, auch nicht die dunkelroten Wohnblocks aus den zwanziger Jahren, Quartiere für Seeleute, Arbeiter, Handwerker, jedenfalls nicht in der Altstadt. Keine Erinnerungen auf Schritt und Tritt. Ines genoss dieses erinnerungslose Gehen und Schauen an einem Ort, der Geschichte geradezu sinnlich wahrnehmbar ausdünstete, sodass man selbst automatisch Teil davon wurde, selbst wenn man sich wie Ines nicht auskannte, weder mit dem Fürstenwesen noch mit Standfiguren wie beispielsweise dem Don Juan d’Austria vor dem Rathaus. Es überstieg auch ihren Erfahrungshorizont, dass eine Stadt am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts außer Privatleuten und Wohnungsgesellschaften zu zwei Dritteln dem Bischof, also der Kirche, und dem ortsansässigen Fürstenhaus gehören konnte. Für Tom, der bei der Wohnungssuche beide Großgrundbesitzer angeschrieben hatte, eine Selbstverständlichkeit.
Und nun hockt er, dachte Ines, während sich letzte Spuren von Bedauern und gleichzeitig aufsteigendem Ärger verflüchtigten, an diesem herrlichen Sommerabend in der Dunkelkammer und zieht sich Chemikalien rein, statt sich an der lauen Luft zu berauschen, wenigstens einen der beiden kneipenfreien Abende hätte sie gern mit ihm zusammen verbracht. Aber Tom hatte Angst, sein früheres, freieres Leben liefe ihm davon. Er arbeitete wie besessen daran, möglichst nichts von all den Dingen aufgeben zu müssen, die sein Leben vor Johnny geprägt hatten. Keinen Verzicht, wenn sonst schon alles anders wurde. Und sie und er? Es ging doch nicht an, dass die bloße Existenz eines Fünfeinhalb-Kilo-Zwergs sie jetzt bereits voneinander entfernte - oder war das etwa auch eine der berühmten neuen Erfahrungen, die sich nicht vermitteln ließen? Das Ende der Zweisamkeit mit Beginn der Dreisamkeit?
Wie aus heiterem Himmel sackte die Fontäne des Springbrunnens in sich zusammen. Eine seltsame Stille trat ein, in der Gelächter und Gesprächsfetzen nun deutlicher in den Vordergrund rückten, als hätte jemand einen Verstärker angeschaltet. Die schützende Intimität war vorbei. Und wie von einem jähen Geräusch aufgeschreckt, regte sich Johnny mit leisem Gewimmer. In einem Zug leerte Ines ihr Glas und machte sich auf den Weg.
Bis vor zwei Monaten hatte sie keinen Gedanken an die Beschaffenheit einer Straßenoberfläche verschwendet - nun im wahrsten Sinne des Wortes die Grundlage ihres Wohlbefindens. Die neugepflasterte Gesandtenstraße bewährte sich bisher als verlässliches Beruhigungsmittel für ihren Sprössling: kein grobes Kopfsteinpflaster, das den Kinderwagen zu heftig rumpeln ließ und den Transportierten eher wachrüttelte, als ihn sanft in den Schlaf zu gondeln. Und auch nicht diese glatten, jeden Widerstand einebnenden Steinplatten der Einkaufszonen, Markenzeichen der modernen Republik, die schon einem Säugling das Gefühl vermitteln mussten, in einer Art ICE zum Shoppen auf den Mond zu fliegen. In der Regensburger Altstadt gab es sie noch, die alten, mit schwarzgrauem Granitgestein gepflasterten Gassen: optimaler Bodenbelag, um ein Kind in den Schlaf zu schaukeln. Und Anlass zu allerlei Tagträumen, Nachtträumen vielmehr, getragen vom Rhythmus der gleichmäßigen Schritte des leise ratternden Kinderwagens.
Tagsüber steuerte Ines die Parks an. Der knirschende Sand unter den Gummireifen hatte ebenfalls eine beruhigende Wirkung. Doch nach Einbruch der Dunkelheit mied sie die Parks. Ines war ein Großstadtkind, das im Dunkeln hinter jedem dicken Baum und in jedem raschelnden Busch Übelgesinnte vermutete. Ines erinnerte sich gut an die Strecke von der Hochbahnhaltestelle Wagnerstraße zum Klinikweg, die sie als Kind auch im Dunkeln oft zurücklegen musste. Zusammen mit den Schwestern alberte man sich zu zweit oder zu dritt Mut zu. Furchtbar war es, wenn eine von ihnen allein unterwegs war, mit betont locker baumelndem Turnbeutel und gespitzten Ohren, inmitten einer Phalanx aus dichtem Gebüsch, dahinter auf der rechten Seite eine Autowerkstatt und links die Hochbahnmauer. War diese erste Hürde genommen, unterquerte man die nach Pisse, Staub, feuchtem Gemäuer stinkende Brücke, auf deren Eisenverstrebungen Tauben nisteten - und wenn sich im Bereich der Brückenpfeiler kein Mann verbarg (natürlich waren es Männer, die einem auflauerten), dann war man bereits halb gerettet. Denn die Hochbahnmauer, in der ein Altmetallhändler und ein Sattler ihr Gewerbe trieben, verlief nun rechter Hand weiter, und links das rostige Rautengitter des Sportplatzes, der, wenn Ines Glück hatte, vom Flutlicht hell erleuchtet war, was allerdings ebenfalls ein wenig gespenstisch wirkte, unwirklich. Und dennoch: Die heiseren Ausrufe der Fußballspieler, das Getrappel der Füße, das Pfeifen des Schiedsrichters strahlten Sicherheit aus, da waren Menschen, wenn auch weit weg, wenn auch mit etwas ganz anderem beschäftigt, aber: Menschen. Gleich darauf war der schützende dunkelrote Häuserblock erreicht. Wieder einmal umsonst gefürchtet.
Bäume und Gebüsch gab es in der Regensburger Altstadt kaum. Stattdessen jede Menge Häuser, Torwege, Hauseingänge, versteckte Ecken, Gassen, in denen sich wie in einer Schlucht jedes Geräusch verstärkte, das Geruckel des Kinderwagens machte da keine Ausnahme. Doch solange Ines von Häusern umgeben war, nicht von Bäumen und Gebüsch, hatte sie keine Angst.
Tom fand das bescheuert. Irrational. Unvernünftig. Die Wahrscheinlichkeit, im nächtlichen Wald überfallen zu werden, sei mit Sicherheit geringer als irgendwo in der Stadt. Ines hielt ihm dann vor, es gehe nicht um Statistik und logische Argumente. Und überhaupt, was war denn schon vernünftig? Etwa sein übertriebener Abgrenzungsdrang an einem der herrlichsten Sommerabende des Jahrhunderts? Hier, mitten in der Altstadt, hatte sie keine Angst, auch wenn in der Zeitung immer wieder kleinere Überfälle erwähnt wurden. Verglichen mit der geschäftigen Millionenmetropole Hamburg kam ihr diese mittelgroße Stadt geradezu paradiesisch friedlich vor. Und noch etwas: Seit sie Mutter geworden war, fühlte Ines sich zwar verletzlicher, aber auch stärker und kampfbereiter als zuvor. Als sei der Kinderwagen eine Art Panzer, den sie vor sich herschob, und der kleine Mensch darin ihre allerbeste Waffe. Wer würde schon eine Frau mit einem Kinderwagen belästigen? Wirkte nicht eine Frau mit Kinderwagen als Mischung aus Heiligkeit, Strenge und löwenhafter Kampfbereitschaft automatisch abschreckend? So ausgerüstet, würde sie heute sogar den dunklen Kindheitsweg an der Hochbahn erneut auf sich nehmen. Außerdem trug sie ohnehin weder eine Handtasche noch viel Bargeld bei sich. Und schließlich war sie sicher, dass Johnny so nervenzerreißend brüllen würde, dass selbst abgebrühte Kerle das Messer fallen lassen und die Beine in die Hand nehmen würden.
Sie überquerte den Kohlenmarkt und schob den Kinderwagen am Rathaus entlang zum Haidplatz: ein Idyll aus Cafétischen, Kerzen, flanierenden Menschen, in der Mitte des Platzes der Marktbrunnen, über dem monumental die Justitia thronte, und auf den Steinstufen zu ihren Füßen eine Gruppe grölender, betrunkener Jugendlicher. Eine Bierflasche kullerte über die Stufen zu Boden und zerbrach. Ines drehte eine Runde über den Platz, bog in eine der dunklen Seitengassen ein. Lautes Geschepper in einem Hauseingang ließ sie aufhorchen. Ein schwarzes Etwas huschte blitzschnell um die Ecke davon. Eine Ratte? Sie blieb stehen. Das schwarze Etwas traute sich wieder hervor - eine Katze, die sich an eine umgekippte, halbvolle Dose heranpirschte. Ines ging weiter. Der Wagen ratterte.
An einem Abend wie diesem waren die meisten Fenster halb oder ganz geöffnet. Aus einigen drang Licht, die meisten lagen im Dunkeln. Oft kam Ines sich vor wie eine Späherin, die en passant Ausschau hielt nach irgendeinem alltäglichen, völlig banalen Augenblick aus dem Leben anderer Menschen, der sich nach Belieben deuten ließ.
Beugte sich der Mann dort im ersten Stock über die Frau, um sie zu küssen, oder befand er sich in Wirklichkeit einen Meter weiter vorn auf der anderen Seite des Wohnzimmertisches und schenkte sich ein Bier ein, während die Frau auf dem Sofa saß und auf den flimmernden Bildschirm starrte?
Sie hörte Stimmen, laute Stimmen, die aus einem der Häuser kamen, es klang nach Streit, Wut, Eskalation, dann ein gellender Schrei. Diesmal zuckte Ines trotz aller Großstadterfahrung zusammen. Sie blieb erneut stehen, ihr Herz klopfte. Was war dort oben los? Ein Ehestreit? Verprügelte ein Mann seine Frau? Sollte sie vielleicht vorsichtshalber die Polizei ... Einsetzendes Sirenengeheul beendete diesen Gedanken. Die Sirene klang eindeutig amerikanisch: Entwarnung. Ohne Bilder konnte sich so ein Fernsehfilm verdammt echt anhören. Erleichtert setzte Ines das Rattern des Kinderwagens dagegen, bevor Johnny aufwachen, protestieren und seinerseits einen gellenden Schrei in die Nacht entlassen würde, der wiederum die Fernsehzuschauer vom Bildschirm weg zum wirklichen Leben ans Fenster riefe.
Sie schob den Kinderwagen die Gasse hinunter bis zur Keplerstraße. Vor ihr lag jetzt nur noch die Donau mit einem Uferweg aus grob behauenen, von Gebüsch gesäumten Steinplatten. Sollte sie bis zur Steinernen Brücke schieben und wieder zurück? Plötzlich fühlte Ines sich erschöpft, verzagt. Die Müdigkeit gewann die Oberhand. Jäher Stimmungswechsel. Das passierte ihr in letzter Zeit häufiger. Tom schob es auf die Hormone. Und was war, wenn sie einfach die Nase voll davon hatte, jeden Abend allein loszuziehen? Sie kniff die Augen zusammen und beschloss, ihn anzurufen: dass er ihr entgegenkäme, gleich im zweifachen Sinne, sie könnten irgendwo, nur nicht im Oblomow, draußen sitzen und zusammen etwas trinken. Betonung auf zusammen. Aber wo war die nächste Telefonzelle? Seit die Telekom die gelben, weit in die Nacht leuchtenden Telefonhäuschen großteils abmontiert und durch diese hellgrau-pink verstylten Zellen für postmoderne Kommunikation ersetzt hatte, war es wie verhext: Ines fand einfach kein Telefon mehr, wenn sie eines suchte.
Ein Pärchen kam vorbei. Ines fragte um Rat.
„Karten- oder Münztelefon?“
„Münztelefon.“
„Auf dem Haidplatz, gegenüber von der Arch.“
Also die nächste Quergasse wieder hinauf. Ines machte sich, den Kinderwagen vor dem Bauch, an den Aufstieg, vielmehr an den Aufschub. Nach einem Drittel der Strecke blieb sie erschöpft stehen.
Wieder hörte sie eine Stimme, eine Männerstimme. Wieder aus einem Fernsehfilm? Im ersten Stock eines gelb getünchten Hauses war ein Raum hell erleuchtet, das Fenster sperrangelweit geöffnet. Die Stimme musste von dort kommen. Der Mann, zu dem die Stimme gehörte, sprach gleichmäßig, wie gedruckt. Ein Vortrag? Eher ein Buch, dachte Ines. Der Mann sprach wie ein Buch. Er las. Er las vor. Seiner Frau, seiner Freundin, seinem Freund, seiner Mutter, seinem Vater, seinen Kindern? Womöglich las er einfach für sich oder sprach einen Text auf Band? Ines trat so weit von dem gelb getünchten Haus zurück, bis sie mit dem Rücken an die gegenüberliegende Häuserwand stieß. Jetzt konnte sie ihn sehen. Seinen Hinterkopf, die Schultern.
Der Mann drehte dem Fenster den Rücken zu, und Ines stand unten, an die Hauswand gelehnt, die noch die Wärme des Tages gespeichert hatte, schuckelte sachte den Kinderwagen und hörte zu, nicht mehr Späherin, sondern heimliche Lauscherin, die städtische Variante des Zaungasts. Das hatte sie lange nicht mehr gemacht, einfach zuhören und die Bilder innen entstehen lassen. In den Zeiten vor dem ersten Fernseher, auf dessen Bildschirm man gemeinsam die erste Mondlandung verfolgt hatte, war das Zuhören noch üblich gewesen: das Hocken vor dem Radioapparat, das Suchen nach einem anderen Sender und das Einfangen fremder Stimmen, das Lauschen, ein Hörspiel, das Wunschkonzert, Zwischen Hamburg und Haiti. Natürlich stand es jedermann frei, nach wie vor Radio zu hören, aber es war nicht mehr üblich, sich auf nur ein Sinnesorgan zu konzentrieren. Jetzt verteilte man die Aufmerksamkeit auf Augen und Ohren, auch den Geschmackssinn bezog man ein: Glotze, Abendbrot, Chips, Bier, Cola. Ob die einzelnen Sinne dabei außer Übung kamen?
Diesen Gedanken sprunghaft folgend, merkte Ines, wie schwer es ihr selbst fiel zuzuhören. Wann war das Vorlesen eingestellt worden, das Vorlesen abends am Bett? Als sie selbst lesen gelernt hatte? Warum las man den Kindern nicht weiter vor, auch wenn sie ohne fremde Hilfe durch eine Geschichte fanden? Musste wachsende Eigenständigkeit denn auf allen Gebieten mit Verzicht verbunden sein - man lernte allein zu essen, sich allein die Schuhe zu binden, allein zu Hause zu bleiben, allein zu lesen. Mit siebzehn oder achtzehn hatte Ines zu einer Clique von Freunden gehört, die, auch aus Protest gegen die Fernsehriten in den elterlichen Wohnungen, abends zusammengekommen waren, um zu lesen, zu diskutieren. Zwei von ihnen studierten schon und schüttelten lässig das Flair der Universität aus dem Parka, sie waren es auch, die Bücher mitbrachten, von denen am backsteinernen Gymnasium, das Ines besuchte, nie die Rede war: Toller, Mühsam, Koeppen, Weiss, Bachmann, Johnson, dazu wurde viel Rotwein getrunken, der Kopfschmerzen machte. Ines hatte nicht immer zugehört und noch viel weniger alles verstanden, zuweilen war sie sogar eingeschlafen, aber die Stimmung von damals hatte, auch in der Erinnerung, etwas Magisches. Und selbst wenn die Männerstimme dort oben am Fenster nicht ihr galt, so weckte sie doch eine Sehnsucht. Ines schloss die Augen, um in dieser unerwarteten Gute-Nacht-Geschichte zu versinken.
„... Wieder blickten wir hinauf zu ihr, die sich aus dem Boden streckte. Die Wellen des aufgelösten Haars umflossen sie ...“
Tagte dort oben ein Club für schöngeistige Erotikfreunde? Es wurden Granatäpfel genannt, Weintrauben ... Nein, denn nun sprach die Stimme von einer Wunde, einem zersplitterten Bein, von Rippen, Schilden, Schuppenpanzern, Kriegern, Todesschmerz, es ging um die Medusa, die Nachtgöttin Nyx, Zeus, Eos, Helios - las der Mann aus einer griechischen Tragödie? Übte er für eine Theateraufführung?
„... wandten wir uns dem Relief zu, das in seinen Bändern überall die Sekunde aufzeigte, in der gewaltsame Veränderung bevorstand ...“
Auch kein Theaterstück also. Die Worte kamen Ines bekannt vor, aber letztlich waren alle Worte schon einmal, nein, mehrfach ausgesprochen worden, es ging um die Kombination, wie bei einem Safe, nur dass sich, kaum hatte man die Kombination erraten, dahinter ein weiterer Safe verbarg, und die Zahlen gerieten Ines im Kunterbunt des Halbschlafs restlos durcheinander. Vielleicht sollten sie und Tom die Tradition des Vorlesens wieder beleben, dachte sie benommen, was bei ihrem Erschöpfungszustand wahrscheinlich eher die Wirkung eines Schlaftrunks haben würde ...
Sie schrak zusammen. Da hatte doch etwas geknallt. Eine Fehlzündung? Automatisch schuckelte sie den Kinderwagen, ein fast schon zur zweiten Natur gewordenes Zucken der Hand, doch Johnny schlief so friedlich wie schon lange nicht mehr. Gleichzeitig blickte sie zum erleuchteten Fenster hoch, sah, wie der Vorleser in die Knie ging, noch ein Stück in sich zusammensackte und dann mit einem Ruck aus der Sicht verschwand. Ein Paternoster, dachte sie augenblicklich und erwartete beinahe, den Mann nach einer verlängerten Fahrt durch den Keller ein Stück weiter rechts wieder auftauchen zu sehen, zuerst den Kopf, dann den Oberkörper, die Beine, die Füße, bis er gen Himmel entschwinden würde. Zugleich spürte sie deutlich, dass etwas geschehen war. Dass der Mann nicht mehr auftauchen würde. Nie mehr.
In dem Raum hinter dem Fenster wurden jetzt Stimmen laut. Eine Frau begann hysterisch zu schreien. Ines blieb zunächst wie angewurzelt stehen, rieb sich die Augen. War das alles ein Traum? Dann setzte sie sich fast automatisch in Bewegung, langsam, fort aus dem Lichtkreis des geöffneten Fensters, konnte aber den Blick nicht abwenden. Die Gasse lag wie ausgestorben da. Nichts rührte sich. In der Ferne ertönte die Sirene eines Krankenwagens. War sie echt oder gehörte sie in einen Fernsehfilm? Hatte der Mann einen Herzinfarkt erlitten? Aber da war dieser Knall gewesen, nicht nur im Traum oder auf dem Bildschirm, sondern tatsächlich, und zwar sehr laut, ein Schuss vielleicht.
Etwas war geschehen, womit sie nichts zu tun hatte. Nichts zu tun haben wollte. Alle Neugier war wie fortgeblasen, das Vorlesen wieder ein Genuss aus anderen Zeiten. Die Sirene kam näher, vervielfachtes Lalüla, das für Johnnys Schlaf dann doch zu laut war. Er wachte auf, brüllte los. Ines ergriff panikartig die Flucht und rannte, dass Johnny auf dem holprigen Pflaster nur so durchgerüttelt wurde, um die nächste Ecke, bog in eine enge, noch dunklere Gasse. Aus dem Augenwinkel sah sie noch das Blaulicht, das von der Keplerstraße aus näher kam. Kein Gedanke mehr daran, Tom in dieser lauen Nacht aus dem Haus zu locken. Im Laufschritt schob Ines den Kinderwagen mit dem brüllenden Baby, dem diese rasante Fahrweise ganz und gar nicht behagte, durch dunkle Gassen um diese und die nächste Ecke, bis sie schließlich hinter dem Garbo herauskam, dann an der Bushaltestelle und an den besoffenen, röhrenden Männern vor dem Kneitinger vorbeihetzte. Sie passierte die Polizeiwache am Jakobstor und war völlig außer Atem, als sie in die Dechbettener Straße einbog. Als sie endlich, nach Luft schnappend, in der Wohnungstür stand und ihrem Lebensgefährten, der sie mit dunkelkammermüden Augen ansah, als habe sie ihn aus dem Tiefschlaf gerissen, das schreiende Kind in den Arm drücken konnte, war sie heilfroh.
2
Ungefähr zur gleichen Zeit klingelte bei Hauptkommissarin Freya Jansen das Handy. Aber konnte man da überhaupt noch von „Klingeln“ sprechen? Der elektronische Signalton, der soeben aus ihrer Handtasche drang, hatte keinerlei Ähnlichkeit mehr mit dem unheilverkündenden, gleichwohl sinnlichen Schrillen der schwarzen Telefonapparate in alten amerikanischen Krimis, fand Freya. Ein Handy piepte höchstens, aber das nicht minder penetrant und obendrein in den unpassendsten Situationen: auf der Rolltreppe, im Supermarkt in der Schlange vor der Kasse, beim Flirt in der Kneipe. Erreichbarkeit hieß das Zauberwort. Warum jedoch Leute, die nicht im Krankenhaus, an der Börse oder bei der Kripo arbeiteten, unbedingt rund um die Uhr abrufbereit sein wollten - im Zug, in der Bahn, sogar im Wald und auf der Haid, ja, mitten im Konzertsaal -, war Freya schlichtweg ein Rätsel. Es musste etwas mit vermeintlichem Fortschritt zu tun haben. Und natürlich mit Wichtigkeit. Ein Piepen in der Jacketttasche - die Markenjacketts waren neuerdings mit Innentaschen in Handyformat bestückt -, und schon verwandelte sich der nichtssagende buchstäblich in einen viel gefragten Mann. Der schlenderte dann über den Haidplatz, ließ sich informieren, erteilte Anweisungen, gestikulierte und war an vielen Orten gleichzeitig präsent. Da waren ihr Leute, die Selbstgespräche führten, längst nicht so unheimlich. Freya nahm das Handy nur mit, wenn sie Rufbereitschaft hatte.
Es hatte sie in letzter Zeit aber auch allzu oft getroffen. Als ob die Messer immer dann gewetzt würden, wenn Hauptkommissarin Jansen Rufbereitschaft hatte, vorzugsweise am Wochenende, abends, mitten in der Nacht. Außerdem schoben kinderlose Leute wie Freya, Wegener und Popp oft zu unbeliebten Zeiten Dienst: im August, zu Ostern, Silvester, über Weihnachten. Beim Fest der Liebe ging es besonders hoch her, da schmorte nicht nur die Gans im Backofen, sondern in den Familien ein Sud aus unguten Gefühlen, und immer wieder kam es vor, dass sie überkochten - weil die Gans im Ofen angebrannt oder der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer abgebrannt war, weil die Geschenke auf dem Gabentisch eben doch nicht alle unerfüllten Wünsche abdeckten oder zudeckten. Und überhaupt: weil man so eng zusammenhockte. Von wegen stille Nacht, heilige Nacht.
Jetzt aber war Sommer. Und was die kriminelle Energie betraf, herrschte normalerweise Flaute. Es war viel zu heiß, um Verbrechen auszubrüten oder in die Tat umzusetzen; trotzdem blieb für Freya mehr als genug Papierkram auf dem Schreibtisch. Was hingegen Hochsaison hatte, waren die sinnlichen Seiten des Lebens. Als das Handy piepte, saßen Freya und Viktor im Eiscafé am Neupfarrplatz - natürlich nicht wegen der Shopping-Kulisse, sondern weil das Eis phantastisch war. Und weil Viktor am nächsten Morgen auf Radtour gehen würde: Begegnung mit Böhmen, eine Woche durchs Moldautal mit einer alternativen Reisegruppe. Es sollte ein Abend ohne Zwischenfälle werden, wie früher oder wenigstens fast so wie früher. Denn seit Freya vor vier Wochen das größte ihrer drei Zimmer für Viktor frei geräumt hatte und er mit Sack und Pack bei ihr eingezogen war - zunächst auf Probe, wie sie einander viel zu oft versicherten -, standen die Zeichen auf Sturm. Sie waren einander ständig im Weg, und das galt auch für die Dinge, die jeder von ihnen im Laufe der Jahre angeschafft hatte. Dabei waren alle doppelten Gegenstände sowieso im Keller gelandet, eine Art Gebrauchtwarenlager für den Fall, dass der CD-Player, der Videorecorder, die Joghurtmaschine, die Halogenstehlampe den Geist aufgeben sollten. Ein materieller Reichtum, der jedoch in keiner Weise als Bereicherung für ihre neue Art von Zweisamkeit fungierte. Es war in jeder Hinsicht enger geworden. Jeder von ihnen hatte seine eigene Art abzuwaschen, Knoblauch zu schälen, Zahnpastatuben auszudrücken oder das Klingeln des Telefons zu ignorieren, und beide hatten sich über Jahre hinweg in ihren Eigenheiten eingerichtet. Es war keine böse Absicht gewesen, dass Viktor Freyas neues Seidenkleid zusammen mit seinen Jeans in die Waschmaschine gesteckt oder dass Freya einen Stapel alter, mit Staubflusen bedeckter Zeitungen entsorgt hatte, die sich als unschätzbare Sammlung von Regensburg-Artikeln entpuppten. Es war eher Gedankenlosigkeit. Die Schwierigkeit, sich daran zu gewöhnen, dass man nicht nur auf sich selbst Rücksicht nehmen musste.
Wahrscheinlich wären Freya und Viktor auch im siebten Jahr ihrer Beziehung von sich aus nicht auf die Idee gekommen, dass sie ja auch zusammenwohnen könnten. Aber dann war das alte, zugige, baufällige, aber sympathische ehemalige Mauthaus in der Keplerstraße verkauft worden, nach jahrzehntelangem Dornröschenschlaf hatte ein Investor den Wert der Immobilie begriffen, deren Rückseite zur Donau hin lag. Jetzt wurde das Gebäude saniert. Viktor hätte sich rechtzeitig eine neue Wohnung suchen können, es gab kleine Abfindungen und Umzugsbeihilfen für die ehemaligen Mieter, aber er hatte die drohende Veränderung stur ignoriert. Er hatte seine Wohnung erst einen Tag vor Beginn der Sanierungsarbeiten geräumt und war zu Freya gezogen. Als sich auch dort die Lage zuzuspitzen begann, hatte er sich kurzerhand für die Radtour angemeldet, um eine Weile aus der Schusslinie zu sein. Freya und er konnten Luft schnappen, bevor ihnen beiden die Luft ausging. Und vorher noch ein süßes Eis zum kurzen Abschied, ein Abend wie früher, und als krönenden Abschluss eine Nacht wie früher, als man sich leidenschaftlich lieben und hinterher ebenso leidenschaftlich gerne in die eigenen vier Wände zurückziehen konnte. So der Plan. Doch Freya tauchte gerade die Waffel in die Sahnehaube ihres Surabaya-Eisbechers, als sich ihr Handy leise, aber unerbittlich zu Gehör meldete.
„Bei dir piept’s“, witzelte Viktor, doch ihm schwante schon, dass ihre Pläne wieder einmal gründlich durchkreuzt würden.
Freya drückte auf den Empfangsknopf des schwarzen, länglichen, handlichen Kastens. „Jansen ...“
Viktor sah, wie sie die Stirn runzelte. Ihre Augen beschlugen, wie er das nannte. Kein gutes Zeichen.
„Und Popp? ... Wegener? Habt ihr die Spurensicherung ...? Bin in fünf Minuten da ... Lasst alles so, wie es ist, und - lasst niemanden weg.“
Überflüssige Maßregel, dachte sie, als sie das Handy ausschaltete, denn die Kollegen von der Streife wussten selbst am allerbesten, was zu tun und, vor allem, was zu lassen war. Sie kam sich vor wie eine Mutter, die ihrem Kind zum x-ten Male einbläut, es solle vorsichtig sein, wenn es über die Straße geht. Dennoch, laut Statistik wurde die Hälfte aller Spuren von den eigenen Leuten verwischt, unabsichtlich natürlich, aber: Was weg war, war weg und Vorsicht war nach wie vor die Mutter der Porzellankiste.
„Du musst fort?“
Sie nickte. „Leider. Mist. Aber das ist nun mal mein Beruf.“
Er sah entnervt zur Neupfarrkirche hinüber.
„Was ist es diesmal?“
„Worauf tippst du?“
„Einbruch mit tödlicher Gewaltanwendung“, sagte Viktor aufs Geratewohl, ohne rechte Begeisterung. „Die Leute sind unterwegs, die Fenster sperrangelweit geöffnet, der Einbrecher braucht nur reinzuklettern, der Hausherr kommt überraschend zurück, weil er die Präser vergessen hat und ...“ Er gähnte.
„Fünf Mark ins Schweinderl!“ grinste sie.
„Du hast ja gar keine Handbewegung gemacht“, protestierte er.
Dass Viktor den abrupten Abbruch solch eines Abends nicht zum ersten Mal erlebte, hieß nicht, dass er sich daran gewöhnt hätte. Einmal - aber das lag ein paar Monate zurück - hatte es sie beide sogar im Bett erwischt, ein doppelter Selbstmord, wie sich später herausstellte. Und Anfang Juli im Kino. Er hatte Freya am nächsten Tag bis ins letzte Detail berichten müssen, wie Die Mutter des Killers ausgegangen war. Er fand es anstrengend, eine Kommissarin als Freundin zu haben. Wenn Viktor sich extrem ärgerte, wünschte er sich sogar eine radikal andere Freundin. Eine, die verfügbarer war, berechenbarer, weniger eigensinnig. Die sich mehr auf ihn einstellte. Er mochte es nicht, wenn die Dinge anders liefen, als er sie sich ausgedacht hatte. Als Taxifahrer und -besitzer war er sein eigener Herr und Meister. Nur Leute wie Freya machten ihm dann und wann einen Strich durch die Rechnung. Was ihm andererseits so schlecht nicht gefiel. Das war ja das Unerträgliche. Dass eine weniger eigensinnige Frau ihn tödlich gelangweilt hätte.
Freya hatte den Eisbecher inzwischen zu Dreiviertel ausgelöffelt. „Was fällt dir noch ein?“
„Ein Drogentoter?“
Sie schüttelte den Kopf. „Weiter.“
„Was weiß ich ... Einer ist in die Donau gehüpft, um sich kurz mal abzukühlen, und in den Strudeln unter der Brücke ist er dann abgesoffen“, sagte er. „Einer hat seine Freundin mit seinem besten Freund erwischt und ist durchgedreht. Die Tochter ermordet die Mutter, um ihre Bratpfannen zu erben. Der Sohn erschießt den Geliebten der Mutter, ein kombiniertes Kindheitstrauma und Eifersuchtsdrama. Oder was hältst du davon: Einer hat eine Kommissarin zur Freundin, und als sie ihn zum x-ten Mal sitzenlässt, kriegt er mords Mordgedanken.“
Sie lächelte ihn milde an. „Würde garantiert nur als Totschlag geahndet.“
Er verzog maliziös das Gesicht: „Wie findest du das hier: Einer ist zu seiner Freundin gezogen, er mag Fünfminuteneier, sie mag Viereinhalbminuteneier, ein Wort gibt das andere, die Geschichte endet schlecht ...“
Freya grinste. „Er stapelt das dreckige Geschirr, bis alle Teller schmutzig sind, sie macht sich ans Abwaschen, er schleicht sich von hinten an, will sie umarmen, sie hält ein Messer in der Hand, das rutscht ihr aus ...“
„Bei mir in der Keplerstraße hast du nie abgewaschen ...“, begann Viktor zu klagen. „Ich dachte immer, du magst meine Unordnung. Und dass ich so anders bin als dein gestriegelter, gebügelter Vater.“
„Dachte ich ja auch“, sagte sie missmutig. „Aber vielleicht lieber doch nur aus der Entfernung.“
„Deshalb fahre ich ja jetzt eine ganze Woche weg.“
Sie schlürfte mit dem Strohhalm das geschmolzene Eis aus dem schmalen Becher.
Er hielt sich die Ohren zu. Er hatte noch gar nicht gewusst, dass ihm das Schlürfen von flüssigem Eis auf die Nerven ging. Er freute sich immer mehr auf die Radtour.
„Vor zwei komme ich sicherlich nicht nach Hause. Bist du dann noch wach?“
Viktor machte schmale Lippen. „Kaum. Um sechs wollen wir los, damit wir um acht an der Grenze sind.“
„Klar.“ Sie stand auf, suchte nach Worten für einen zumindest freundschaftlichen Abschied, wenn es an diesem Abend schon keinen leidenschaftlichen geben würde. „Tut mir wirklich leid, Viktor. Ein Mann ist erschossen worden. Du weißt ja, wie das läuft. Ich kann’s nicht ändern. Wenn wir uns nicht mehr sehen sollten, wünsch ich dir eine gute Tour.“ Dann fügte sie hinzu: „Genieß es.“
„Kannst du Gift drauf nehmen“, erwiderte er spöttisch.
Sie ging um den Tisch herum und flüsterte ihm eine Zärtlichkeit ins Ohr. Viktor musste nun doch ansatzweise lächeln, bemühte sich aber, es nicht zu zeigen. Und sie bemühte sich, das nicht zu sehen.
Den Helm ans Lenkrad gehängt, als wolle sie die Kollegen von der Streife herausfordern, knatterte sie auf der gelben Vespa mit den schwarzen Streifen durch die Untere Bachgasse zum Tatort in der Weingasse. Auch sie war enttäuscht über diese unerwartete Wendung des Abends.
Zugleich war sie aber auch erleichtert, sich Viktor eine Weile entziehen zu können. Oft verspürte sie nach einem nächtlichen Einsatz keinerlei Lust auf körperliche Nähe, und sei es nur das trauliche Anschmiegen an ein anderes, schlafwarmes Wesen. Und in anderen Fällen war es wiederum genau das, was sie suchte und brauchte; jemanden zum Festhalten, zum Verkriechen, zum Reden, zum Stillen sexueller Gelüste - zur Ablenkung, als Trost, um die Bilder zu vergessen, die sie in ihrem kriminellen Alltag unvermeidlich zu Gesicht bekam. Denn Tote sahen selten rosig aus. Aber sie hatte gern die Wahl. Fahren wir zu dir oder zu mir? Das war jetzt identisch. Und sollten sie und Viktor weiterhin zusammenwohnen wollen, würden beide von der Pike auf lernen müssen, wie man zu zweit allein blieb.
3
Nicht zu übersehen, dass etwas Dramatisches passiert war: Zwei Streifenwagen, ein Krankenwagen, das Auto des Notarztes und zwei weitere Zivilfahrzeuge versperrten den unteren Teil der Weingasse. Vor dem Haus Nummer sechzehn hatte sich rund ein Dutzend Leute versammelt, Schaulustige aus der Nachbarschaft, man rauchte, redete, warf neugierige Blicke hinauf zum Fenster im ersten Stock. Ein Polizeibeamter bewachte die Haustür. Als Freya von der Vespa stieg, hörte sie, wie der Streifenpolizist einen jungen Mann nach seinem Ausweis fragte und wie dieser die Stimme hob und insistierte, er wohne hier und sein Wort müsse ihnen genügen, woraufhin drei der Umstehenden in schallendes Gelächter ausbrachen.
„Gib’s auf, Max, die sind zäher als du“, rief einer, und ein anderer stachelte ihn an: „Lass dich von denen nicht unterkriegen.“
„Bitte entschuldigen Sie“, sagte Freya freundlich, aber bestimmt und bahnte sich einen Weg zum Hauseingang.
„He, Sie dürfen da nicht rein!“ Der junge Mann, knallgelb gefärbte Haare, Ohrring, Jeans mit Schlitzen an den Knien, hatte spaßeshalber die Fronten gewechselt und baute sich neben dem Polizeibeamten auf.
Freya ignorierte ihn. Sie wandte sich den Schaulustigen zu. „Hat jemand von Ihnen etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört?“ Ihr Tonfall war verbindlich und zugleich so unpersönlich wie eine Durchsage auf dem Flughafen. „Wenn das der Fall sein sollte, dann wenden Sie sich doch bitte an meinen Kollegen. Er wird alles notieren, und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung, wenn die Ermittlungen angelaufen sind. Vielen Dank im Voraus.“
Dann fasste sie den jungen Mann ins Auge, der jetzt unsicher geworden war, was für ein Spielchen hier eigentlich gespielt wurde. Jedenfalls nicht mehr das seine, dessen Witz darin bestand, sich auf Kosten anderer zu amüsieren.
„Wohnen Sie in diesem Haus?“ fragte sie.
„Er wohnt zwei Häuser weiter“, kommentierte mit sonorer Stimme ein älterer Mann, der sich im Nebenhaus aus dem Fenster beugte und von dort aus das Geschehen verfolgte. „Ist völlig harmlos. Und wer sind Sie?“
„Jansen“, sagte Freya schlicht. „Hauptkommissarin Jansen.“ Sie warf dem Kollegen von der Streife, der ein wenig ratlos dreinschaute, einen amüsierten Blick zu. Der junge Mann machte umstandslos den Weg frei. Alle Blicke folgten der mittelgroßen, vollschlanken Frau mit der lindgrünen Hose, der ebenfalls lindgrünen Leinenbluse und den mahagonifarbenen, schulterlangen, gelockten Haaren. Man hätte ein Streichholz fallen hören können, und Freya überlegte kurz, was die Leute in diesem Moment mehr beschäftigte: die Tatsache, dass in dem Haus ein Mord geschehen war, oder das Phänomen einer leibhaftigen weiblichen Kommissarin.
Sie fand es ohnehin erstaunlich, welche Macht ein Titel besaß, ob Doktor, Professor, Kommissar, Direktor oder Bürgermeister, aber noch erstaunlicher fand sie die Macht der weiblichen Form eines Titels. Die Leute ließen sich davon noch immer beeindrucken. Entwaffnen. Dass eine Frau sich mit so was schmückte, zumal sie so unstandesgemäß angezogen war.
Unter ihren bayerischen Kollegen hatte Freya vor allem in den ersten Monaten einen schweren Stand gehabt. Eine Frau in der Mordkommission. Im Fernsehen waren Kommissarinnen der letzte Renner, aber in der Wirklichkeit ...
„Weiber in diesem Geschäft - der letzte Heuler“, hatte Wegener seinerzeit zu Popp gesagt, als Freya gerade aus dem Zimmer gegangen war, aber sie hatte es gehört, und Wegener hatte es ja auch darauf angelegt. Im ersten Moment hätte sie ihm am liebsten eine reingehauen, aber das war auch bei der Kripo nicht erlaubt und wäre natürlich höchst unklug gewesen. Frauen wurden von der Mehrzahl der Beamten für „nicht leichenfest“ gehalten und deshalb in andere Kommissariate verfrachtet: Sitte, Raub, Betrug, Brand - Delikte, die für Frauen als zumutbar galten. Tote waren da ausgenommen. Leichensachen seien keine Frauenarbeit, lautete lange Zeit die Devise, die Freya scheinheilig fand. Denn dann dürfte man auch keine Frauen in die Operationssäle lassen. Und keine Klageweiber ans Totenbett, fand Freya. Typische Doppelmoral: Bei Trauer und Tränen waren Frauen willkommen, bei knallharten Mordfällen nicht. Eine reine Machtfrage. Es passierte, davon abgesehen, immer wieder, dass man mit Leuten von Anfang an nicht klarkam. Bei Wegener und Freya beruhte das auf Gegenseitigkeit. Sie gingen einander, wenn möglich, aus dem Weg. Nur in der Ferienzeit, wenn sämtliche Kollegen mit schulpflichtigen Kindern im Urlaub waren, war das nicht möglich.
Am oberen Ende der knarrenden, halbkreisförmigen Treppe stand Popp und grinste ihr entgegen. Wie gut, dass Popp heute Abend Dienst hat und nicht Wegener, dachte Freya erleichtert. Im Gegensatz zu Wegener war der jungenhafte Wolfgang Popp meistens gut gelaunt und steckte voller Ideen - was die Lösung der Fälle nicht immer auf dem direktesten Weg vorantrieb, die Ermittlungen aber wenigstens amüsant gestaltete.
„Na“, feixte er von oben herab, „mal wieder ein Stelldichein verpatzt?“
Sie lächelte säuerlich. „Wie kommst du denn darauf?“
„Du bist heute Abend mal wieder todschick ...“
„Ich habe mich für dich schick gemacht“, säuselte sie ironisch.
„Für den Toten lohnt es sich auch nicht mehr ...“
„Wer ist es?“
„Paul Breitkreuz, Professor für Literatur an der Uni. Ein Schuss durchs offene Fenster. Hat ihn von hinten erwischt.“ Popp wies mit dem Kopf in Richtung Wohnungstür. „Drinnen warten jede Menge Zeuginnen. Wird wohl ’ne lange Nacht werden ...“
„Zeuginnen, sagst du? Nur Frauen?“
„Kein einziger Mann. Tut mir für dich wirklich leid.“
Das alte Haus war perfekt restauriert. Abgeschliffene alte Türen und Türstöcke, freigelegte Balken, weiß getünchte, krumm und schief belassene Wände. Freya betrat den Vorraum der Wohnung, registrierte im Vorbeigehen den goldumrandeten Spiegel, den orientalischen Läufer, das Ikebana-Gesteck auf der Jugendstilkommode. An den Vorraum schloss sich ein lang gestrecktes, ebenfalls weiß getünchtes Zimmer an, gediegene alte, knarrende Holzdielen, darauf weitere orientalische Läufer, eine Bücherwand, die sich über die gesamte Länge des Raumes erstreckte - offenbar das Wohnzimmer. Links waren drei zweisitzige Sofas um einen niedrigen Tisch gruppiert. Zwei Streifenbeamte waren damit beschäftigt, ein Grüppchen Frauen von der Leiche fernzuhalten und die Personalien aufzunehmen. In der rechten Hälfte des Raumes standen Stühle in einem Halbkreis und bildeten gewissermaßen die Arena für ein Stehpult. Und am Rande dieser Arena lag der Tote.
Der Notarzt hatte die Untersuchung bereits beendet. Er sah Freya und Popp über seine Brille hinweg an. „Der Schuss ist offenbar direkt ins Herz gegangen“, sagte er sachlich. „Als ich eintraf, war schon nichts mehr zu machen.“
„Wann war das?“
Ein Beamter namens Zirngibl reichte Freya einen handgeschriebenen Notizzettel.
„Der Zeitpunkt des Schusses liegt nach den Aussagen der Damen zwischen 22.25 Uhr und 22.30 Uhr. Um 22.32 Uhr ging der Notruf bei uns ein. Eintreffen des Notarztwagens 22.36 Uhr, Eintreffen der Beamten 22.40 Uhr.“ Er räusperte sich. „Jetzt ist es …“
„Eintreffen von Hauptkommissarin Jansen um 22.52 Uhr. Tragen Sie das ruhig nach. Damit alles seine Richtigkeit hat.“
Sie zwinkerte Popp zu. Eine ihrer Gemeinsamkeiten bestand in einer Aversion gegen streng formgerechte Protokolle und sonstigen bürokratischen Spießrutenlauf. Die Berichte, die Hauptkommissarin Jansen ablieferte, waren des Öfteren Stein des Anstoßes, weil sie sich nicht an die vorgefertigten Formulierungen hielt, weil sie nicht nur sachlich die Fakten zusammenstellte, sondern Wahrnehmungen, Eindrücke, Überlegungen hinzufügte. Was das mit dem objektiven Tatbestand zu tun habe, wurde sie dann missbilligend gefragt - woraufhin sie auszuholen pflegte und darauf hinwies, dass es vor allem in der Kriminalistik keine objektiven Tatbestände gebe, nur Raster unzusammenhängender Fakten, dass subjektive Faktoren nicht nur Ausgangspunkt von kriminellen Handlungen seien, sondern auch zu ihrer Aufklärung beitrugen, zum Verknüpfen der Fakten, vom Zufall, auf den die Ermittler geradezu angewiesen waren, einmal ganz zu schweigen, und ob denn das Bürokratentum sämtliche Entwicklungen der letzten fünfzig Jahre unverbesserlich an sich abgleiten lasse wolle?
Mit einem entsprechend subjektiven Blick - wie auch anders? - sah Freya sich den Toten jetzt genauer an. Der Mann war nicht leichenblass, sondern braungebrannt. Mindestens eins achtzig groß. Durchtrainiert. Dafür sprachen jedenfalls die Arme, die unter dem kurzärmeligen Leinenhemd hervorschauten. Das Hemd selbst war dunkelrot, sodass der Blutfleck in Herzhöhe auf den ersten Blick nicht auffiel. Mund sinnlich, etwas schmal, Nase leicht gebogen, dunkelbraune Augen, die starr die Decke fixierten.
Freya musste ihr vorgefasstes Bild von einem Geisteswissenschaftler - blass, mager, hohe Stirn, vielleicht Halbglatze, Brille - revidieren. Mit seinen kurzgeschnittenen, graubraunen Haaren und den Lachfalten um die Augen hätte Professor Breitkreuz bestens in eine Stuyvesant-Reklame gepasst: Segeltörn in Jeans und Windjacke, Freundin im Arm, Fluppe zwischen den Fingern, Weltgefälligkeit auf den Lippen, der ultimative Genusstrip - nur nicht als Leiche, versteht sich.
Freya richtete sich auf. „Gut aussehender Mann.“
„Kommt ganz drauf an“, sagte Popp leicht indigniert.
„Worauf denn?“
„Auf die Sichtweise: Alles ist subjektiv, wie unsere hoch geschätzte Kollegin Jansen so schön zu sagen pflegt.“
„Ich habe ja nicht gesagt, dass er mein Geschmack gewesen wäre.“
„Dann hab ich ja noch ’ne Chance.“
Freya sah ihn herausfordernd an. „Gut möglich.“
Hoppla, was war denn heute Abend mit ihnen los? Es kam zwar oft vor, dass Freya und Popp irgendein lockeres Spruchgeplänkel vom Stapel ließen, das jedoch immer ironisch ausfiel. Jetzt aber war diese Ironie einen Augenblick lang ausgefallen - wie manchmal der Strom in einer stürmischen Nacht. Und plötzlich wurde alles möglich. Sie merkten, dass Zirngibl sie irritiert anstarrte. Der Notarzt räusperte sich. Er hatte den Tod des Opfers festgestellt. Mehr war für ihn nicht zu tun, und situationsferne Kommentare von Kriminalbeamten fielen zum Glück nicht in sein Ressort.
Freya deutete mit dem Kopf zu den Frauen im hinteren Teil des Raumes. „Was war hier überhaupt los?“
„Eine Art Lesekränzchen“, sagte Zirngibl.
„Ein Literaturkreis“, verbesserte ihn Rilke, ein Polizist um die fünfzig, der soeben zu Freya, Popp und Zirngibl getreten war, um seine Informationen weiterzugeben. „Mit dem Professor waren sie insgesamt zu acht. Er war der einzige Mann.“
„War er verheiratet?“ fragte Freya.
„Geschieden“, sagte Rilke. „Zwei erwachsene Kinder, ein Kind im Grundschulalter. Es lebt bei der Mutter. Sie heißt Vera Bach.“
Freyas Blick fiel auf die langen, schlanken Hände des Professors. „Was ist das zwischen seinen Fingern?“
„Ein Stück Papier“, sagte Zirngibl, froh, etwas Konkretes beisteuern zu können.
Sie bückte sich und versuchte, den Papierfetzen, der dem Toten zwischen Daumen und Zeigefinger steckte, herauszuziehen. Dabei wäre der Zettel beinahe zerrissen, so energisch umklammerte der Professor das Papier. Als wäre es sein letzter Wille. Oder sein einziger Halt. Ein Stück Buch.
Der Papierfetzen war beidseitig bedruckt. Es handelte sich offensichtlich um ein Stück einer herausgerissenen Seite. Freya entzifferte: Aufhebung des Unrechts, Beendigung der Verarmung, Übergangszustand, gemeinsamen Besitz und auf der Rückseite: Peitschenschläge, Ausgeplünderten, Herrschsucht, Erniedrigung, Kunst. „War das etwa ein subversiver Polittreff?“
Popp hielt ihr ein graues Buch hin. „Lag auf dem Stehpult. PETER WEISS DIE ÄSTHETIK DES WIDERSTANDS ROMAN SUHRKAMP“, las er laut vor. „Aufgeschlagen auf Seite 14, 15. Die linke Ecke von Seite 14 fehlt.“
„Hier ist sie“, sagte Freya. „Wahrscheinlich hat er sie im Fallen herausgerissen.“
„Vielleicht hat er versucht, sich an dem Buch festzuhalten.“
„Sehr tiefsinnig ...“
„Ein bekannter Schriftsteller“, wusste Rilke.
„Nie gehört“, sagte Popp.
Auch Freya zuckte die Achseln. „Lebt der noch?“
Rilke schüttelte den Kopf. „Er ist Anfang der achtziger Jahre gestorben.“
„Woher wissen Sie das?“
„Ich lese leidenschaftlich gern“, sagte Rilke und errötete ein wenig, als sei ihm dieses Eingeständnis peinlich, vor allem das Wort „leidenschaftlich“, das ihm herausgerutscht war.
„Ein Polizist, der gern liest?“ frotzelte Popp. „Dein Freund und Helfer, das unbekannte Wesen ...“
Rilke ließ sich nicht beeindrucken. „Lesen ist mein Hobby.“
„Kennen Sie diesen Schmöker hier etwa auch?“
Rilke schüttelte den Kopf. „Leider nicht. Aber das ist kein Schmöker. Wenn Sie Peter Weiss kennen würden, dann wüssten Sie, dass er keine Unterhaltungsliteratur geschrieben hat.“
„Und wenn Sie mich kennen würden, dann wüssten Sie, dass ich lieber Schach spiele oder Formel-Eins ansehe“, ulkte Popp. „Nein, Witz beiseite. Vielleicht könnten Sie das Buch mal lesen und uns sagen, was drinsteht.“
„In der Freizeit oder in der Dienstzeit?“
„Sie werden schon ein ruhiges Plätzchen finden“, grinste Popp.
Freya wurde ungeduldig. Buch hin, Buch her, Rilke hatte ihnen anderes mitteilen wollen als seine Kenntnisse in Sachen Literatur. Was hatte die erste Befragung der Zeuginnen ergeben?
Keine der sieben Frauen habe etwas Auffälliges gehört oder gesehen, berichtete Rilke. Der Literaturkreis komme vierzehntägig zusammen. Früher habe man sich reihum bei den Mitgliedern zu Hause getroffen, seit einem halben Jahr sei man dazu übergegangen, sich regelmäßig in dieser Wohnung zu versammeln.
„Die Mieterin heißt Susanne Riepl, sie ist Psychologin. Die Treffen beginnen um halb acht, man isst eine Kleinigkeit, danach stellen drei Teilnehmer jeweils ein Buch vor, das sie gelesen haben. Dann wird diskutiert. Zum Abschluss des Abends liest Professor Breitkreuz aus einem Buch vor. Heute Abend aus dem Werk von Peter Weiss.“ Er zeigte auf das Buch, das auf dem Stehpult lag. „Zum Tatverlauf: Der Professor stand also an diesem Stehpult, mit dem Rücken zum Fenster. Er hatte ungefähr zehn Minuten gelesen, als die Damen einen lauten Knall hörten. Der Professor ist nach vorn auf das Stehpult gesackt, dann leblos zu Boden gestürzt. Die sechs Damen saßen zu dem Zeitpunkt dort.“ Er wies auf den Halbkreis aus Stühlen. „Zuerst hat sich keine von ihnen vom Fleck gerührt. Schock, Angst vor weiteren Schüssen, das Übliche. Dann hat eine von ihnen die Polizei informiert.“
„Sie sprechen immer von sechs Frauen“, sagte Popp stirnrunzelnd. „Ich sehe aber eindeutig sieben. Oder habe ich etwa Halluzinationen?“
„Die siebte ist die Freundin des Ermordeten“, erklärte Rilke. „Sie wohnt in der Engelburgergasse. Sie ist ebenfalls Mitglied im Literaturkreis. Heute Abend war sie aber nicht dabei.“
„Wieso ist sie dann jetzt hier?“ fragte Freya.
„Eine der Damen hat sie benachrichtigt. Sie traf zeitgleich mit dem Notarzt ein. Sie steht offensichtlich unter Schock.“
„Welche ist es?“
„Die im gelben Kleid.“
„Nicht schlecht“, sagte Popp. „Hatte einen guten Geschmack, dieser Professor.“
„Wer sagt denn, dass er ihr das Kleid gekauft hat“, funkelte Freya ihn mit gespielter Entrüstung an.
Dann wandte sie sich an Zirngibl. „Ist schon geklärt, wer die Obduktion durchführt?“
„Schmidt ist im Urlaub.“
„Wir können die Kollegen aus Erlangen anrufen“, sagte Popp. „Oder die Angelegenheit an die Pathologie Ritzinger weitergeben. Die arbeiten zuverlässig und gut. Auch mitten in der Nacht.“
„Rufen Sie bitte dort an und veranlassen sie alles Nötige“, wies Freya Zirngibl an. „Sobald die Spurensicherung fertig ist, wird die Leiche hingebracht. Vermutlich gegen zwei oder drei.“
Sie trat ans Fenster. Professor Breitkreuz hatte vor dem Stehpult gestanden, also mit dem Rücken zu dem noch immer offenen Fenster. Sie beugte sich hinaus. Die Gruppe Schaulustiger vor dem Haus hatte sich aufgelöst. Im gegenüberliegenden Haus waren alle Fenster geschlossen und dunkel, bis auf die Wohnung im - sie zählte nach - dritten Stock, wo zwei Männer und zwei Frauen sich am Fenster drängelten und versuchten, etwas von dem Geschehen hier drüben zu erhaschen. Ein kleiner, dunkler Gegenstand wurde herumgereicht, vermutlich ein Opernglas. Wegener, der mit Vorliebe Sachinformationen am Tatort sammelte, würde allen Hausbewohnern am nächsten Tag mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. Sonst war auf der Straße niemand mehr zu sehen. Um Genaueres über den Einschusswinkel zu erfahren, mussten sie die Untersuchungen der Ballistiker sowie die Obduktion abwarten. Der Schuss musste nicht unbedingt vom Haus gegenüber abgegeben worden sein. Die beiden Häuser rechts und links davon kamen ebenso in Betracht. Genauso gut konnte jemand auf der Straße gestanden haben oder mit dem Fahrrad oder dem Moped vorbeigefahren sein. Außerdem war die Frage zu klären, ob der Professor zufällig oder absichtlich in der Schusslinie gestanden hatte.
Popp trat neben sie. „Nehmen wir uns einmal die Frauen vor.“
„Aber ich nehme die im gelben Kleid“, lächelte Freya.
„Ich nehme lieber dich“, murmelte Popp, aber so leise, dass sie es nicht hörte.
4
Das Kind hat eine blühende Phantasie, hatte der Deutschlehrer vermerkt und wie als logische Konsequenz eine Fünf unter ihren Aufsatz gesetzt. Bedauernd oder mit Genugtuung? War eine blühende Phantasie auf Gedeih und Verderb verknüpft mit dem unteren Drittel der Notenskala? Galt eine welke Phantasie entsprechend als primusverdächtig? Wäre der Deutschlehrer womöglich insgeheim gern über den eigenen Schatten gesprungen und hatte nur aufgrund der Vorschriften und Regeln die schlechte Note vergeben?
Nein, nein, es hatte alles seine Richtigkeit. Ines hatte alles noch genau in Erinnerung: sechste Klasse, der allererste freie Aufsatz. Frei. Die Vorgabe klang vielversprechend. Hatte sie es allzu wörtlich genommen? Die Schulstunde war nur so verflogen - eine ihrer ersten bewussten Erfahrungen mit der Relativität von Zeitgefühl, fünfundvierzig Minuten konnten sich zu unendlich langen Stunden ausdehnen oder zusammenziehen zu einem Atemzug. Sie stand noch im Bann dieses einen Atemzugs, war tief über das Heft gebeugt, als man es ihr beim Klingeln der Schulglocke mitten im Satz unter der Hand weggezogen hatte. Eine hässliche, krakelige Tintenspur, die vom zuletzt geschriebenen Buchstaben bis zur rechten unteren Ecke der Heftseite führte.
Sie habe kein Ende finden können. Sei außer Rand und Band geraten. Überhaupt gehe der Geschichte jegliche Ordnung ab, fehle ein roter Faden. Immerhin, eine blühende Phantasie. Aber. Und daher. Leider: eine glatte Fünf.
Der rote Faden? Wieso ein roter Faden? Wieso kein gelber, grüner, blauer? Die Tintenpatrone hinterließ blaue Spuren im Heft, an Zeigefinger, Mittelfinger. Einen Rotstift benutzte doch nur der Lehrer, um sein besseres Wissen unter die Schülerproduktionen zu setzen. Die elfjährige Ines war ratlos gewesen. Beleidigt. In Tränen aufgelöst. Wie sollte sie in nur fünfundvierzig Minuten all das zu Papier bringen, was sich logischerweise ergab, wenn man den Worten freien Lauf ließ? Sie hatte einfach angefangen, und schon waren die Figuren drauflos galoppiert in dieser Welt aus blauer Tinte, aus der der Schulaufsatz entstand, und sie selbst war hinterher gerannt und hatte dabei im Heft Spuren hinterlassen.
Aber offensichtlich ging es nicht um den freien Lauf. Man musste sich zügeln. Figuren, Worte, Gedanken, Geschichten - gezügelt, gestriegelt, mit rotem Faden aufgezäumt: So war es richtig. Die vorgegebene Dreiviertelstunde war das Zaumzeug und die schlechte Note die Gerte.
Fortan hing die „blühende Phantasie“ wie ein drohendes Schwert über ihrem Kopf, wenn Ines sich über das Schulheft beugte. Sie gab sich eine Zeitlang aufrichtig Mühe, die Worte zu zügeln, der Geschichte eine Struktur zu geben, eine Ordnung mit Anfang, Höhepunkt, Ende und rotem Faden. Was dabei herauskam, war eher farblos. Alle Höhen- und Tiefflüge eingeebnet, alle Abweichungen verhindert. Es musste in den Rahmen passen, in das Schulheft, in die fünfundvierzig Minuten, und zwar nach allgemeinverbindlichem Schulmaß. Der Anpassung erster Schritt. Und zur Belohnung gab es eine Drei minus, manchmal sogar eine Drei plus. Ist doch eine schöne Note: befriedigend, oder?
„Du bist übermüdet, schlaf dich mal richtig aus ... Deine Phantasie geht mit dir durch ... Das mit dem Schuss hast du dir doch nur eingebildet ... War garantiert eine Fehlzündung ... Im Sommer knattern haufenweise Motorräder durch die Gegend ... Komm, ich mach dir einen Kamillentee ...“
Sie fuhr aus dem Dämmerschlaf hoch. Träum ich oder wach ich? Sie rieb sich die Augen. Sollte Tom etwa ...? Neben dem Bett - oder besser gesagt, neben der Matratze, denn zu einem richtigen Bettgestell hatten sie es noch nicht gebracht - stand der Becher mit dem Porträtfoto von Diana und Charles, den Karolin ihr von einer Londonreise mitgebracht hatte. Ines schnupperte an dem Rest der grünlichen Lösung, stellte den Becher angewidert weg. Kamillentee war eine Sache und Träume bekanntlich ein unberechenbares Stückwerk aus Wirklichkeitsfragmenten, Sehnsüchten, Ängsten. Aber sollten diese Gasse, diese unerwartete Vorlesestunde, diese Männerstimme, dieser Knall, dieser Mann im Paternoster nichts als ein Traum gewesen sein, ein in die Nacht herübergeschlüpfter Auswuchs ihrer nach wie vor blühenden Phantasie? Nein! Noch einmal würde sie sich nicht auf ein befriedigendes Mittelmaß zurechtstutzen lassen. Lieber eine wutschäumende Fünf als eine lächerliche, hohlwangige Drei. Der lesende Mann vor dem offenen Fenster war kein Produkt ihrer Einbildungskraft gewesen, ebenso wenig wie der Schuss, die überhastete Flucht durch die dunklen Gassen, Johnnys Gebrüll.
In der Wohnung war es verdächtig still. Entweder schliefen Tom und Johnny auf der Matratze in Toms Zimmer, oder sie waren beim Einkaufen. Auf dem Küchentisch stand noch das benutzte Frühstücksgeschirr, die Butter mittlerweile in der prallen Sonne. Auf dem Brotkorb fand Ines einen Zettel mit folgender Nachricht:
Sind unterwegs. Genug abgepumpte Milch dabei. Schlaf dich aus und mach dir einen schönen Tag. Wie anno dunnemals. Kuss - Tom (und Johnny).
Unter dem Zettel lagen zwei - na, was, Ines, Brötchen oder Semmeln? Zwei Schrippen, dachte sie, enttäuscht, dass niemand da war. Sie sah aus dem Küchenfenster. Der alte Benz war weg. Entweder war Tom mit Johnny zu seinen Eltern gefahren, oder er machte einen richtigen Ausflug, vielleicht in den Bayerischen Wald. Na dann, gute Fahrt, dachte Ines, plötzlich niedergeschlagen, auch ein wenig eifersüchtig. Sie ging ins Bad, warf einen kurzen Blick in den Spiegel, erkannte, dass sie so aussah, wie sie sich fühlte, sah schnell wieder weg. Sie setzte sich auf den Klodeckel, starrte vergrätzt auf Toms Dunkelkammerausrüstung im Regal zwischen Badewanne und Waschmaschine. Das Zeug hatte er wenigstens weggeräumt. Dafür hatte er die volle Waschmaschine vergessen. Nach dieser überraschend ungestörten, langen Nacht hatte Ines jede Menge Milch, die abgesaugt werden wollte. Ein weicher Kindermund hätte ihr besser gefallen als eine manuelle Milchpumpe. Wenn Ines die Milchpumpe sah, musste sie immer an eine Kuh an der Melkmaschine denken: Sie, Ines, war die Mutterkuh und pumpte auf Vorrat Milch ab - was ihr umgekehrt diesen unerwartet freien Tag beschert hatte, denn ohne abgepumpte Milch könnte Tom höchstens zwei Stunden wegbleiben. Ines verspürte eine grenzenlose Sehnsucht nach dem Winzling Johnny. Da waren sie also, die ambivalenten Mutterfreuden: Wenn die Kinder da sind, sehnst du dich danach, wieder einmal allein zu sein, und wenn du allein bist, hältst du es vor Sehnsucht kaum aus. Ersatzweise nahm sie die getrockneten Hemdchen, Bodys und Strampelanzüge vom Wäscheständer und hob sogar Toms Socken vom Fußboden auf. Dehnte sich diese Sehnsucht etwa auch auf den Kindsvater aus, der seine Klamotten aus eingeübter Junggesellenfaulheit dort fallen ließ, wo er gerade ging und stand?