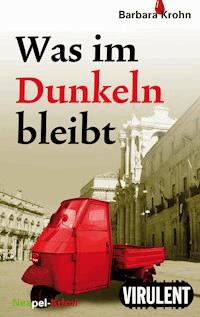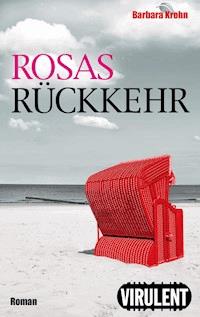Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Virulent
- Kategorie: Krimi
- Serie: Neapel-Krimi
- Sprache: Deutsch
Pizza, Pasta, Dolce Vita – Marlen freut sich auf Erholung in der Stadt am Vesuv. Doch mit der erhofften Ruhe ist es schon bald vorbei. Salvatore, der attraktive Taxifahrer, legt sich mächtig ins Zeug, um Marlen zu erobern. Als Highlight seiner speziellen Stadtführung zeigt er ihr das Labyrinth unterirdischer Gänge. Und hier, im Bauch Neapels, stoßen die beiden auf einen grausamen Fund: die Leiche eines nicht ganz Unbekannten. Während die Polizei noch im Dunkeln tappt, ist die Neugier der beiden Frauen (wer ist die zweite Frau, es ist von einem Taxifahrer die Rede?) längst entfacht. Mit Raffinesse und weiblicher Intuition recherchieren sie im undurchsichtigen Milieu der Kunstraubmafia, aber bald steht auch Salvatores Leben auf dem Spiel. Und welche Rolle spielt die Tabakfrau von gegenüber, die den Frauen wichtige Tipps zukommen lässt, sich aber in der Unterwelt gut auszukennen scheint …?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2007
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Danksagung
Impressum
E-Books von Barbara Krohn
Weitere Neapel-Krimis
Roman
1
Sie war pünktlich.
Während mit lautem Scheppern Rolläden heruntergelassen wurden wie tonnenschwere Augenlider und Vespafahrer über den nassen Basalt bretterten, um rechtzeitig nach Hause zu kommen, schob die Tabakfrau ihren Zeigefinger einem gußeisernen Löwenkopf ins Maul. Es klingelte.
Livia, die Malerin, öffnete und staunte nicht schlecht. Ganz in Schwarz. Sie kannte die Tabakfrau nur umgeben von den Blümchen und Karos der Kittelkleider, die sie im Laden trug, über Rock und Bluse, und Rock und Bluse wiederum über einem umfangreichen Körper. Heute abend stand hingegen eine attraktive Frau in der Tür, die ihren fülligen Körper ansehnlich verhüllt hatte: weite schwarze Seidenhose, darüber ein ebenfalls weiter schwarzer Feinstrickpullover, über der Brust eine Kette aus dunkelroten Holzperlen. Farblich Ton in Ton der Lippenstift, der Nagellack. Die Haare offen, schwarz mit grauen Strähnen.
Livia kam aus dem Staunen nicht heraus. »Mamma mia! Toll sehen Sie aus. Kommen Sie herein.«
Die Tabakfrau war weder Lob noch Komplimente gewöhnt. Sie lächelte, eine Spur verunsichert.
»Finden Sie wirklich?« Sie sah sich um, wußte nicht recht, ob sie sich auf den einzigen Stuhl im Raum oder auf den Diwan setzen oder vorläufig stehen bleiben sollte.
Von den Wänden des nicht gerade geräumigen Ateliers schweiften Blicke durch den Raum, kreuz und quer, einige Blicke blieben darin gefangen, so schien es, während andere durch die gegenüberliegende Wand nach außen drangen. Es waren suchende Blicke, offene, verschlossene, rundum befriedigte, abschätzige oder in sich versunkene, eine kleine Auswahl aus der Palette der Stimmungen und Charaktere. Die Malerin hatte überwiegend Porträts gemalt – die Tabakfrau nahm jedenfalls an, daß die Bilder an den Wänden von ihr stammten – nur Gesichter mit Hals, der Oberkörper, der ganze Körper, Menschen mit Leib und Seele, mit Haut und Haaren, bekleidet, nackt, gerahmt, ungerahmt, Zeichnungen, Ölgemälde, Aquarelle. Es waren sehr eigene, nicht gerade schmeichelhaft zu nennende Bilder, auf denen nichts an- oder ausgeglichen wurde – Falten, die zu lange Nase, der breite Mund, die ersten grauen Strähnen im Haar. Es hatte im Gegenteil den Anschein, als habe die Malerin bestimmte Wesenszüge der Porträtierten besonders hervorgehoben, ohne jedoch zu karikieren – eine Kunst für sich, wie die Tabakfrau befand.
Als sie die Malerin zum ersten Mal auf gesucht hatte, war sie zunächst erschrocken gewesen, um nicht zu sagen schockiert. Und hätte fast einen Rückzieher gemacht. Doch nach einer Weile begann sie sich wohler zu fühlen in Gesellschaft dieser Leute an den Wänden, die in keinster Weise so aussahen, als hätten sie sich makelarm bis makellos zurechtgemacht. Im Gegenteil, eine kleine Last fiel von ihr ab, der Zwang zur Schönheit, der allerorten geschürt wurde, die Angst vor dem häßlichen Bild. Wenn die anderen genug Mut hatten, sich malen zu lassen, dann hatte sie ihn auch. Und damit basta.
»Sie sehen wirklich toll aus«, wiederholte Livia. »Ganz anders als tagsüber im Laden.«
Die Tabakfrau lächelte erneut. »Sieht man es schon?«
»Was denn?« Livia war bekannt für ihre Argusaugen und kannte derlei Fragen nur von Frauen, die im zweiten Monat schwanger waren.
»Ich nehme ab«, sagte die Tabakfrau mit bescheidenem Triumph in der Stimme.
Livia kniff die Augen zusammen, musterte ihr Gegenüber. Dann nickte sie. »Natürlich.«
In der Tat, das war es. Ihr war zuallererst die Farbe ins Auge gefallen, der schwarze Grundton, und sie hatte überlegt, ob ein Mitglied aus der Familie der Tabakfrau gestorben sei, wogegen jedoch die roten Accessoires sprachen. Oder vielleicht lag es am Feierabend, am Wechsel von Rollen und Klamotten, da schlüpften so allerlei Leute in andere Gewänder und oft genug sogar in eine andere Haut. Es stimmte: die Tabakfrau war ein wenig dünner geworden. Man könnte auch sagen: ein wenig weniger dick. Es tat ihr sichtlich gut, den eigenen Körper aus den Fettmassen herauszuschälen, sich in Bewegung zu setzen, wohin auch immer.
Livia hatte noch nie eine buchstäblich so leibhaftige Frau gemalt. »Hauptsache, das Abnehmen geht nicht so schnell, daß ich jede Woche ein neues Bild anfangen muß.«
Die Tabakfrau schüttelte den Kopf. »Leider nicht. Das wird eine ganze Weile dauern. Seit Januar sind es erst, ich meine: schon zwanzig Kilo.« Sie musterte die Malerin. »Bei Ihnen würde das ins Gewicht fallen.«
»Bei Ihnen tut es das auch«, sagte Livia.
»Obwohl die Idee nicht schlecht ist«, nahm die Tabakfrau den Gedanken wieder auf. »Sie malen jede Woche ein Bild von mir und bezeugen so meine Verwandlung. Gegen Ende des Jahres hätte ich dann rund vierzig Bilder zusammen und müßte mir eine neue Wohnung suchen. Auch ein Grund, um aus Neapel wegzuziehen.«
»Wie machen Sie das, zwei Kilo pro Woche?« erkundigte sich Livia.
»Ein Geheimnis«, schmunzelte die Tabakfrau und wurde ein wenig rot. Sie platzte heraus: »ein Kinderspiel«, und kicherte dazu wie eine Fünfzehnjährige.
Wie um ein Gegengewicht zu schaffen, sich selbst Einhalt zu gebieten, hob sie die rechte Hand.
»Sehen Sie ihn, diesen Ehering? Ich muß es ablegen, mein dickes Mutterfell, damit ich endlich den Ehering ablegen kann.« Sie holte tief Luft. »Vor über zwanzig Jahren hat er ihn mir aufgesteckt, und ich bekomme ihn nicht mehr runter vom Finger, ist es nicht unglaublich? Nicht mit Seife, nicht mit Olivenöl. Dabei ist er längst auf und davon, mein Ehemann, nur dieser Ring ist mir geblieben.« Sie schluckte, ihre Stimme klang zornig. »Ein Fluch, den ich an mir trage, jeden Abend, jeden Morgen, dieser Ring. Mit wem soll ich denn verbunden sein? Wissen Sie, die Sklaven, die trugen ihn am Ohr, wie das die jungen Leute heutzutage wieder machen, ich aber, ich will ihn loswerden. Nur mein Fleisch drumherum beschützt ihn noch, verstehen Sie?«
Livia konnte gut nach vollziehen, was die Tabakfrau sagte, denn sie selbst hatte sich bisher standhaft geweigert, einen solchen Ring aufzusetzen, und würde es auch weiterhin tun.
Die Tabakfrau seufzte. »Es ist so viel leichter dick zu werden als abzunehmen.« Da wurde so manches hochgeschwemmt, Erinnerungen, gute und schlimme Tage, Sehnsucht, geballte Wut. Keine Trennung, keine Geburt ohne Schmerzen.
Dann dachte sie, daß es nicht stimmte, was sie gesagt hatte, daß auch das Gegenteil richtig war. Eigentlich war es ein ganzes Stück lustvoller abzunehmen und zu entdecken, was alles in ihr verborgen war, um nicht zu sagen: begraben, tief unter der Haut: Abgründe. Erotik. Wer konnte schon ahnen, was sich noch alles an verstaubtem Glitzern in ihr entdecken ließ. Jedenfalls war sie eines Morgens auf die Idee gekommen, sich malen zu lassen, und zwar von einer Frau. Frauenblicke würden etwas anderes hervorkitzeln. Höchste Zeit, daß die Frau in ihr zum Zuge kam.
Livia hatte die beiden mobilen, mit einer Gasflasche ausgestatteten Heizöfen angezündet und so plaziert, daß es im ganzen Raum angenehm warm war. Die erste Sitzung würde ungefähr anderthalb Stunden dauern. Eine dreiviertel Stunde lang stillzusitzen, war für die meisten Leute bereits eine Qual. Zumal nichts passierte, zumindest nichts, was von außen kam: keine Werbung, kein Film auf der Leinwand, keine Schauspieler, keine Musiker, kein Lehrer, einfach nichts. Nur die Leinwand, und dahinter die Malerin, deren Blick sich völlig verändert zu haben schien. Sobald sie den Pinsel in der Hand hielt, wurden die Leute für sie zum Objekt. Ein spannendes Objekt, aber ein Objekt. Als würde ich einen Apfel malen, hatte sie der Tabakfrau erklärt, so ungefähr.
Livia malte am liebsten Leute, die auf irgendeine Weise in Bewegung waren, bei denen sich etwas tat. Irgendwo, sei es im stillen Kämmerlein, davon war sie überzeugt, tat sich bei den meisten Leuten etwas, auch wenn sie es selbst noch nicht wahrhaben wollten. Stillstand war eine Fiktion, Stillstand trat erst mit dem Tod ein, und auch in der Hinsicht ließen sich Zweifel erheben. Selbst wenn man deprimiert oder krank war, bewegte sich etwas, wurde etwas vorbereitet, das einem selbst noch nicht bewußt war. Nicht zufällig führten Kinderkrankheiten stets zu einem Wachstumsschub, und bei Erwachsenen war das ähnlich, nur daß das Wachstum nicht mehr so sichtbar war. Außerdem hing natürlich alles davon ab, ob jemand sich überhaupt bewegen wollte. Falls dem so war, reizte es sie ungemein, diese Spannung in einem Menschen aufzuspüren und auf die Leinwand zu transponieren, die Spannung zwischen einem Zustand und dem nächsten, das Abwarten, die Ambivalenz von Gefühlen, diese Aufbruchslandschaft der Körper und Gesichter, die sich an so unterschiedlichen Stellen verriet wie den Augen oder dem Mundwinkel, einer bestimmten Kopfhaltung, den Schultern, der Haut. Manchmal drückte das Gesicht Stagnation aus, während der Körper schon auf dem Sprung war, längst die Lust an Veränderungen signalisierte, egal in welcher Richtung, aus welchem Grund – Motive, Moral, so etwas interessierte sie auch vor der Leinwand kaum
»Möchten Sie etwas trinken? Bier? Wein? Wasser?«
Während Livia zwei Gläser füllte, eins mit Wasser für die Tabakfrau, eins mit Terpentin für die Pinsel, erklärte sie, daß sie sich beim Malen nicht unterhalte. Zwar würde sie ab und zu etwas sagen, doch nur zu sich selbst, wie ein Musiker, der beim Spielen mitsummt. »Apropos, möchten Sie, daß ich Musik auflege? Oder ist Ihnen die Stille lieber?«
»Eine stille Musik vielleicht«, sagte die Tabakfrau, die hinter dem Paravent ihre Kleider ablegte. »Eine, die zum Regen paßt.«
Die Tabakfrau rutschte verkrampft auf dem Stuhl hin und her, schlang das rechte Bein um das Stuhlbein, verschränkte die Arme zu einer Barrikade, merkte dann, daß sie sich dahinter versteckte. Doch wohin mit den Armen? Sie legte sie in den Schoß, versuchte, die Hände zu falten, kam sich merkwürdig vor dabei, wie ihre eigene Großmutter in der Abendsonne vor dem Haus, sie ertastete den Ring, zog die Hände auseinander, legte sie schließlich auf den Oberschenkeln ab.
Bei der Vorstellung, sich auszuziehen, war ihr anfangs nicht wohl gewesen. Noch nie hatte eine andere Frau – außer Anna, ihrer Tochter – sie nackt gesehen. Am Strand verbarg sie ihren Körper in einem altmodischen Badeanzug, im Kaufhaus verschwand sie in der Kabine, und beim Arzt war sie seit vielen Jahren nicht mehr gewesen. Ihr kamen die Entbindungen in den Sinn, die Hebammen und Krankenschwestern, die Ärzte – bei allen vier Kindern ein Mann. Das zählte nicht. Sobald sie ein Krankenhaus betrat, verlor sie jegliches Zugehörigkeitsgefühl zu ihrem Körper, in einer Arztpraxis war das ähnlich, als würde sie einen Teil des Körpers an der Garderobe ablegen. Natürlich hätte sie sich hier nicht ausziehen müssen, niemand hatte sie dazu gezwungen, sie konnte sich ebensogut in Rock und Pullover malen lassen. Doch wenn sie die Absicht gehabt hätte, sich weiterhin zu verstecken, hätte sie ebensogut in ihrem Laden hinter dem Tresen hocken bleiben können, das Kittelkleid um Brust und Bauch geknöpft wie eine Schwimmweste. Also, bis auf den Unterrock runter mit Blümchenstoff, Bluse, Pullover – der sprichwörtliche Sprung ins kalte Wasser. Es war ja ihr Anliegen, gesehen zu werden, und später mit eigenen Augen und nicht in einem Spiegel zu sehen: was es an Assunta Maria Balzano zu sehen gab.
Soweit war es noch lange nicht. Am liebsten hätte sie mit Röntgenaugen die Leinwand durchbohrt oder der Malerin über die Schulter geguckt. Was da wohl entstand? Die Vorstellung, ein Objekt zu werden, wie zum Beispiel ein Apfel oder ein Regenschirm oder eine Flasche, war nur eine Möglichkeit unter vielen … Der Gedanke amüsierte sie. Womöglich entstand dort soeben ein Körper aus Äpfeln, Bananen, Birnen, Orangen, mit einem Kopf aus einer Melone und Pflaumen als Augen … Andererseits: Wieso die Begrenzung auf harte Materie, wie wäre es mit gepreßtem Apfelsaft, einer Sauce aus geschmolzener Schokolade und Cognac, einem kleinen Amaretto oder ganz einfach frischer Milch … Ach, diese Gelüste. Sie kam ins Schwärmen. Mein Körper ist im Fluß, dachte sie, ein Lavakörper, erstarrt ist er noch lange nicht. Ich bin wieder gefragt. Nein, dachte sie dann, mach dir nichts vor, dein Körper ist es, der wieder gefragt ist. Schluß mit der Träumerei.
Wieviel Zeit wohl schon vergangen war. Sie sah zu Livia hinüber, die nur noch für die Leinwand zu existieren schien, ihrem Objekt nur kurze abschätzende Blicke zuwarf. Der Blick der Tabakfrau wanderte zum Paravent, der ein Stückchen weiter links neben der Staffelei stand, ein dreiteiliger Wandschirm mit allerlei Figuren, Frauen in Kimonos, Männer in langen, weiten Gewändern, Berge mit schneebedeckter Kuppe, orientalische Vögel mit langem Gefieder, Ruderboote auf Häkchenwellen.
Diese schlanken, asiatischen Boote – wenn sie nur solch ein Boot hätte. Die Tabakfrau sah Lichter in der Dunkelheit flimmern, dort, wo die Boote auf dem Wasser schunkelten und sich leise an den hölzernen Bohlen rieben. Das sanfte Geräusch wurde vom Lärm des sechsspurigen Lungomare aufgesogen – es sei denn, man saß selbst auf solch einem Steg und ließ die Beine baumeln und aß Taralli oder Kartoffelchips, dazu Bier oder Cola aus der Bude vorn an der Straße. In Gedanken sah die Tabakfrau zum Yachthafen von Mergellina hinüber. Wenn ich solch ein Boot hätte, dachte sie wieder, was heißt hier Boot, ein Schiff, Segelschiff, eine Yacht mit Motor und Kajüte und allem drum und dran, ich würde mir Anna schnappen und das Weite suchen…
Das Boot war ein Schiff, war die Caremar auf dem Weg nach Capri, Ischia, Procida. An Deck der Fähre, sie konnte ihn genau erkennen, stand ein junger Mann in dunkelblauer Hose und dunkelblauem T-Shirt mit der roten Caremar-Aufschrift auf der Brust. Sie winkte. Es war Massimo, ihr ältester Sohn. Hinter seinem Rücken tauchten auch Paolo und Giuseppe auf. Was taten sie dort? Vielleicht hatte Massimo sie alle zu einer Kreuzfahrt eingeladen? Natürlich, der Berg mit der Kuppe aus Schnee oder Puderzucker im Hintergrund war der Vesuv, das Schiff kreuzte durch den Golf von Neapel. Doch warum hatten diese Schlawiner Anna nicht mitgenommen, die vergötterte kleine Schwester? Die Tabakfrau drohte ihnen im Geiste mit dem Zeigefinger, die Söhne lachten und machten obszöne Gesten. Das ging aber zu weit! Die eigenen Söhne, wo gab es denn so was! Sie wollte schimpfen, mußte stattdessen aber lachen, und je länger sie lachte, desto leichter wurde sie, bis sie sanft abhob von der Erde und dem Schiff entgegenflog, ein Paradiesvogel, arrivederci, geliebte Kinder…
»… einen Espresso?« sagte eine sanfte Stimme.
Die Tabakfrau zuckte zusammen. »Wie bitte?«
»Möchten Sie auch einen Espresso?«
»Ja, bitte.« Die Tabakfrau war so benommen, als sei sie soeben aus dem Tief schlaf erwacht. Während sie versuchte, ihren Tagtraum einzufangen, verschwand Livia in der Küche.
»Sie haben sich richtig entspannt«, sagte sie, als sie mit dem Tablett und einer breiten Stola wiederkam, die sie der Tabakfrau über die Schultern legte. »Die meisten Leute versuchen, Haltung zu bewahren, sich zu kontrollieren – oder zumindest das Bild, das sie von sich abgeben wollen. Aber irgendwann ist die Ruhe stärker. Das ist der Moment, in dem ich wirklich zu malen beginne. Bei Ihnen hat es höchstens fünf Minuten gedauert, Kompliment. Nehmen Sie Zucker?«
Die Tabakfrau hob lachend die Hände. »Um Himmels willen, nein.« Sie zog die Stola über der Brust zusammen, nippte am Espresso, zeigte auf die Bilder an den Wänden. »Alles von Ihnen?«
»Bis auf zwei«, sagte Livia nicht ohne Stolz.
»Malen Sie schon lange? Wie sind Sie zur Malerei gekommen?« fragte die Tabakfrau. »Oder die Malerei zu Ihnen?«
»Ich habe an der Accademia di Belle Arti studiert«, wollte Livia sagen, hielt aber inne. Wenn die Tabakfrau es über sich gebracht hatte, sich auszuziehen, konnte auch sie, die Malerin, ein Stück mehr von sich zeigen als die offizielle Visage. Also erzählte sie von dem Tag im Frühling: Sie war zwölf und hatte gemeinsam mit den Spielgefährten diese Frau entdeckt: zwischen Schutt und Unkraut hinter einer Steinmauer, der Rock zerrissen, die Beine angewinkelt, die Arme weit von sich gestreckt, Schmutz im Gesicht, ein blauer Fleck unter dem linken Auge, sie wollte nicht weiter ins Detail gehen, jeder konnte sieh ein Bild machen. Zum Glück war die Frau nicht tot – das aufgeregte Geschrei der Kinder rief sie ins Leben zurück. »Wir dachten, die Sonne hätte sie aufgetaut«, sagte Livia,
Das Bild ließ sie nicht mehr los, bis heute war es ihr im Gedächtnis, im Hintergrund, zuweilen verstellt von anderen Bildern, doch immer abrufbereit, präsent. Jeden Tag war sie damals zu der Stelle gelaufen, wo die Frau gelegen hatte, als hätte sie einen Abdruck hinterlassen. »Zu Hause habe ich sie dann gemalt«, fuhr sie fort, »mit Bleistift, Wachsstiften, sogar mit Tusche, Nacht für Nacht, im Bett, im Licht der Taschenlampe. Immer wieder. Wie sie am Boden lag, wie sie wieder aufstand, müde, beinahe automatisch, wie ein Boxer im Ring, der nur noch taumeln kann und ohne Widerstand dem nächsten Kinnhaken entgegenläuft.« Livia stand auf, reckte sich. »Dann hatte ich es irgendwann satt, diese Opfermalerei. Meine nächsten Frauen wurden stark und kampflustig, bekamen geballte Fäuste, hatten Messer in der Hand, sogar Pistolen.« Sie mußte lachen. »Ein wenig sahen sie aus wie diese realsozialistischen Heidinnen, muskulös, optimistisch, Kopf hoch, wir schaffen es! Ich wollte, daß die Frauen nicht mehr geschlagen werden, sondern im Zweifelsfall lieber selbst Zurückschlagen. Frommer Wunsch. Macht und Ohnmacht hocken fest auf ihren Plätzen. Selten, daß mal jemand ausbricht.« So wie Sie, wollte sie sagen, schwieg dann aber. »Zwischen Opfern und Heldinnen habe ich dann irgendwann wirklich angefangen zu malen. So war das.«
»Und was ist mit der wirklichen Frau geschehen?«
»Ich habe sie nie wieder gesehen, sie war offenbar nicht aus unserem Viertel.«
Die Tabakfrau erkundigte sich, ob man mit der Malerei überhaupt genug Geld verdienen könne.
Sie verdiene sich ihren Lebensunterhalt nicht mit der Malerei, sondern in einem Büro, antwortete Livia, und das sei schon fast ein Privileg. Sie arbeite seit einem Jahr in der Dokumentation Kunstdieb stahl in der Kulturbehörde der Region. Livia saß zwar hauptsächlich vor dem Computer, telefonierte oder forschte in Bibliotheken nach Fotos oder Abbildungen der gestohlenen Werke, hatte aber wenigstens mit Kunstobjekten verschiedenster Art zu tun, vom Weihwasserbecken über den silbernen Kandelaber bis zum Ölgemälde, auch wenn diese Objekte für sie paradoxerweise erst dadurch lebendig wurden, daß sie nicht mehr aufzufinden waren. Der Job war nicht allzu schlecht bezahlt, immer wieder interessant, mittlerweile wurde ihr immer mehr Verantwortung und Eigeninitiative zugestanden, und schließlich blieb genug Zeit für die Arbeit an der Staffelei.
Sie schwiegen.
»Machen wir weiter?«
Die Tabakfrau nickte. »Sie haben es gut«, seufzte sie dann.
»Wieso?«
»Weil Sie malen«, erwiderte sie schlicht.
»Und Sie, was würden Sie lieber machen?« fragte Livia.
»Lieber als im Tabakladen stehen?«
Eine schwierige Frage. Während die Malerin wieder hinter der Leinwand verschwand, dachte die Tabakfrau darüber nach. Es war eine Frage, die so klang, als sei nur sie allein angesprochen, Assunta Maria Balzano, nicht das Drumherum, dieses abgestandene Leben: das Geldverdienenmüssen, der Tabakladen, den sie von den Eltern übernommen hatte, die Kinder, die sich bis auf Anna selbst versorgten, vom Wäschewaschen für Paolo mal abgesehen. Sie wußte keine Antwort, auch wenn sie genau wußte, daß die Frage schon im Raum gestanden hatte, bevor sie das Atelier betrat, und daß die Malerin im Grunde nur das ausgesprochen hatte, was sie sich selbst nicht zu fragen getraute. Der Tabakladen jedenfalls war nicht ihr inneres Zuhause.
Vielleicht, dachte sie, als ihr Blick wieder zum Paravent schweifte, würde ich reisen, weit weg, nach Sibirien, nach China, Indonesien, Australien, und auf der anderen Seite vom Erdball wieder zurück, oder zum Nordpol oder nach Afrika, schon eine Fahrt nach Monte Carlo oder nach Venedig wäre nicht übel. Wenn ich die Wahl hätte. Wenn ich noch einmal von vorne anfangen könnte.
Vor ihr tauchte ein zierliches, dünnes Mädchen auf, mit Strohhut und einem langen schwarzen Zopf, der bis zu den Knien reichte. Das Mädchen stand an einem Gewässer und sah den rosafarbenen Kranichen auf dem Paravent zu, oder waren es Flamingos, es watete durch das seichte Wasser, unten, an der Riviera di Chiaia, in der Hand einen Plastikeimer, schon halb mit Miesmuscheln gefüllt. Dann und wann warf es einen verstohlenen Blick hinüber zur Kaimauer, wo sich bei niedrigem Wasserstand ein schmaler Streifen Sand aus dem Wasser löste. Dort standen ein junger Mann und ein junges Mädchen, der junge Mann drückte mit seinem Körper den des jungen Mädchens, das ihre ältere Schwester war, an die Steinwand, die zwei knutschten, das wußte das Mädchen bereits und auch, daß die Schwester mit ihren fünfzehn Jahren sich die Knutscherei gern gefallen ließ. Das Mädchen war erst neun und sah sich alles ganz genau an. Leicht sah es aus. Verlockend. Wenn sie nur auch erst fünfzehn wäre und sich von so einem jungen Kerl gegen die Mauer drücken ließe.
Und schon war es soweit, denn manchmal, in Träumen, in der Erinnerung, folgt die Zeit ihren eigenen Gesetzen – schon ging das Mädchen in die Breite wie ein Luftballon, der endlich aufgeblasen wird, die erste Schwangerschaft, das Geknutsche an der Mauer lag weit zurück, die Folgen rührten sich in ihrem Bauch.
Am Anfang war die mamma, welch ein Glück, wenn die Kinder es zum ersten Mal sagten, die Belohnung für all das Warten, Entbehren und Entsagen, das Wort Mutter: mamma – auch wenn sie eigentlich etwas zu essen damit meinten, die lieben kleinen Menschenfresser, mammam, die zu verspeisende mamma womöglich… Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier: Massimo nach dem Ehemann, Paolo nach dem Vater, Giuseppe nach dem Schwiegervater – und dann kam noch Anna. Anna nach niemandem. Einfach: Anna. Derweil wurde die mamma dick und ihrer Aufgabe voll gerecht, den Kindern Schutz zu bieten, in einem geblümten, mütterlichen Kattunkittel, doch auch, um sich zur Wehr zu setzen gegen den Mann, der sie – da war es noch ein Spiel gewesen und beide knappe sechzehn – auf die Kieselsteine gedrückt hatte, unten, am Strand, der sie – Macht des Geschlechts – nun auf das Ehebett drückte, das zum Glück weich gefedert nachgab.
Bald würde der Ehemann völlig hinter dem Riesenkörper seiner Frau verschwinden, schon war er fort, einen Monat nach der Geburt von Anna, fort aus dem Leben der Kinder und aus dem Leib der mamma, hinein ins Leben einer neuen, jungen, schlanken Frau. Wie man es jeden Tag in der Zeitung nachlesen konnte. Von dem Tag an, als der Ehemann auf und davon war – wie lange war das her? mehr als siebzehn Jahre – war wenigstens das wöchentliche Gerammel weggefallen, dieses Herumgerüttel und -gezerre, das sie für Liebe gehalten hatte, diese immergleiche Folge aus Reinschieben, Rütteln, Stöhnen – dann ein Aufbäumen, wie eine satte Zecke fiel er ab, und sie selbst lag plattgedrückt da, eine zweidimensionale Frau.
Es blieben die vier Kinder Und Zeit zum Nachdenken, Stunde um Stunde, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Da hatte sich Wut zusammengerottet, bis sie zu einem ansehnlichen Berg angewachsen war, einem Menschenvesuv, der sich irgendwo entladen mußte, explodieren, oder ganz allmählich Luft ablassen.
Kurz vor Weihnachten hatte es begonnen, am einundzwanzigsten Dezember, Stichtag. Es war ein milder Abend, unten am Lungomare, sie hatte den Bus verpaßt und keine Lust zu warten, war zu Fuß los in Richtung Fuorigrotta, als einer dieser Kerle, die regelmäßig dort standen, den Rücken zum Meer, oder eher: lungerten, sie angesprochen hatte. Und was hatte sie getan? Mitgegangen war sie, ganz einfach, einfach so, vielleicht gab es für solche Momente keine Gründe, jedenfalls hatte sie keinen finden können, außer Neugier oder einer Laune des Augenblicks.
Am wichtigsten war: Es hatte ihr gefallen. Zum ersten Mal seit Jahren, nein, seit sie es überhaupt mit Männern machte, hatte sie so etwas wie Lust verspürt. Verrückte Welt! Raus aus dem Kittelkleid, runter das zweite Gesicht aus Tabakladen, Haushalt, Mutterfreuden. Es tat gut zu entdecken, daß dieser Körper die Männer reizte und nicht nur einen, nein, viele, auch wenn sie sich kaum an die Namen erinnerte, sicherlich hieß einer von ihnen Massimo, ein anderer Ciro, Salvatore, Ignazio, Gennaro, wie die Männer in Neapel eben hießen. Jedem das Seine, dachte sie, nein: jeder das Ihre. Und eine erste Prise Selbstachtung. Es ging eben auch anders und war, trotz oft unbequemer Lage, ein Triumph, ein Hochgefühl, wiederholt, tagelang. Nie traf sie sich mit dem gleichen Mann, oft wechselte sie Lage und Umgebung. Sie begann, auf ihre wirkliche Stimmung zu achten, die Körperstimmung, die Seelenstimme, sagte schon mal nein, wurde wählerischer. Ein Nebeneffekt: das Abnehmen klappte wie von selbst. Keine Reis-, Saft-, Körnerkuren, keine Schlankheitstees oder -pillen, kein Fitneßprogramm, keine Sitzungen bei Spezialisten für Leib und Seele. Und nirgendwo ein schlechtes Gewissen in Sicht. Pro Orgasmus nahm sie ein Pfund ab, zum Beispiel, ja, so ließ es sich rechnen. Sie begann zu ahnen, daß ihre Fleischmassen etwas verbargen, dessen Existenz sie seit langer Zeit vergessen hatte, eine antike, mit Rissen durchzogene Vase, einen Schwan wie in der Geschichte vom häßlichen Entlein. Sie mußte es darauf ankommen lassen. Etwas brach auf. Etwas heilte.
Dann war dieser Kerl in ihr Leben getreten. Sie spürte seine Hände auf ihrer Haut, hörte seine Stimme, sah ihn vor sich, begann zu schwitzen. Unhörbar flüsterte sie seinen Namen. Aus, aus und vorbei. Bleich sah er aus, wie er dort lag, schneeweiß geradezu, kaum eine Falte, helle Haut, schwarzes Haar, ein Prinz. Das Goldkettchen im Brusthaar glitzernd, wie ein Sonnenstrahl frühmorgens auf dem Meer, kalt war es, das Wasser, es stand ihm bis zum Hals, sie wartete auf ein Prusten, auf tausend Wassertröpfchen, zusammenklebende Wimpern, verführerisch, lockend, salzig auch die Lippen. Aber nein, das waren andere Bilder, andere Zeiten, wie hatten sie sich nur dazwischengedrängelt, da konnte man ja ganz durcheinanderkommen. Seine Augen waren dunkel, schwarz und unergründlich, schwarz wie die Nacht, ein Totenfluß, gern hätte sie auf den Grund geblickt, vielleicht wuchsen dort Korallen oder zarte Gräser … Irrtum, nur keine sentimentalen Reisen, da gab es nichts zu sehen, der Grund war steinig, der Mann ein Dreckskerl mit Seidenhänden. Vier Wochen lang hatte er sie getragen, auf Händen, das wollte schon etwas heißen. Jeder Tag zählte tausendfach, eine kleine Ewigkeit, diese Begegnungen zwischen acht und Mitternacht. Wieso hatte sie sich nur in ihn verliebt? Wieso hatte sie nicht bemerkt, daß die Bedingungen sich änderten, die Streichelbedingungen, die Hingabe, daß der Reiz längst verklungen war – die große Täuschung, es sei nicht nur ihr Körper, es sei mehr…
Und jetzt? Jetzt schwitzte sie nicht mehr, sie fröstelte, sackte ein wenig in sich zusammen, ballte dann innerlich die Fäuste, richtete sich auf. Und zugleich schrumpfte und verblaßte auch dieser Mann, alle Farbe wich von ihm, Grautöne breiteten sich aus, lösten die Konturen auf, bis nur noch Staub blieb, grauer Staub und Stille. Und ein kleines rotes Loch in der Brust, das ihn getötet hatte.
2
Eintauchen in ein Gefunkel nächtlicher Lichter, am Himmel die Sterne, links die dunkle Silhouette des Vesuv, dann das Gelände der AGIP; heruntergeschobene Zugfenster, im Schneckentempo in die Bahnhofshalle, und dort steht Livia, rufend, winkend, lachend – so in etwa hatte Marlen sich ihre Ankunft vorgestellt.
Wie der Mensch sieh täuschen kann. Lektion Nummer soundsoviel: Hier ist alles anders als du denkst, und wenn du denkst, du hast dich darauf eingestellt, läuft es wieder anders, oder: ein Hoch auf die Improvisation. Marlen starrte durch das Busfenster, innen beschlagen, außen mit Regentropfen besprenkelt, und wischte mit der Handkante über die Scheibe. Neapel sehen und sterben. Eine hauchdünne Schicht aus kondensiertem Atem bedeckte das soeben freigewischte Loch. Vorbei Goethes Zeiten, in denen man Neapel sah und sich selig zur allerletzten Ruhe begab. Zum Glück. Leider. Noch eine Lektion: Die Extreme liegen näher beieinander, als man glaubt, oder: ein Hoch auf die leibhaftigen Gegensätze. Für heute reichte es. Nach knapp zwanzig Stunden Fahrt hatte sie sich etwas anderes gewünscht als ausgerechnet einen Stromausfall. Ab Formia war nichts mehr vorangegangen wegen des Unwetters. Keiner der Mitreisenden hatte eine Ahnung, wie oder wann es weitergehen würde, man arrangierte sich, redete, las, aß, strickte, schimpfte, schwieg, schlief. Dann ein Aufschrei, »a carreggrazia!«, ein Wunder: Die Eisenbahngesellschaft hatte in kürzester Zeit zwei Sonderbusse bereitgestellt, die alle Fahrgäste nach Neapel bringen würden, gleichgültig, ob das ihr Fahrziel war oder nicht.
Kurz nach Mitternacht stand Marlen also auf dem Platz vor der Stazione Centrale. Es regnete noch immer. Längst fuhren keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Die Taxischlange vor dem Bahnhofsgebäude saugte gierig einen Reisenden nach dem anderen auf, während Marlen die Vorhalle betrat, in der vereinzelt Penner auf plattgetretenen Kartons lagen und schliefen. Von Livia keine Spur, sie mußte wieder nach Hause gefahren sein. Was wiederum kein Wunder war, denn Marlens Zug hätte laut Fahrplan bereits vor über drei Stunden eintreffen sollen. Die Bar war bereits geschlossen, und von den drei Telefonen in der Vorhalle funktionierte nicht ein einziges, herausgerissene Schnüre, tote Leitung. Großartig, dachte Marlen halb grimmig, halb amüsiert, und: Livia, ich komme, auch ohne Zug, ohne Telefon, ohne Bus, aber ich komme.
Draußen ließ soeben das letzte gelbe Vehikel den Motor an und verschwand in die Nacht.
»Da kommt heute kein Taxi mehr, Signorina«, nuschelte ein älterer Mann hinter ihrem Rücken, die erloschene Zigarette zwischen den Zähnen. »Kommt kein Zug an, fährt auch keiner ab. Un tempo della madonna!« Er deutete ein Lachen an und wies mit der Hand auf eins der heruntergekommenen Bahnhofshotels.
Währenddessen ging von der Seite ein weiteres Angebot ein. »Vuoi un passaggio? Dove devi andare, ti ci porto io, davvero, no problem!« Der Eifer in der Stimme verriet die Absicht. Marlen sah sich nicht danach um, wie das männliche Wesen aussah, das sich da so großzügig gab. Grazie, lieber ging sie zu Fuß.
Nicht daß sie etwas gegen Männer hatte. Im Gegenteil. Aber sie suchte sich Ort, Zeit und Mann doch lieber selbst aus. Vielleicht konnte sie von einem der Hotels aus telefonieren. Also, hinaus, vom Regen in die Traufe. Sie nahm die Reisetasche, kam vielleicht zehn Meter weit. Wieder ein Hupen. Unbeirrt ging sie weiter. Per la madonna, wie aufdringlich! Und wenn es Livia war? Sie zögerte, wollte sich umdrehen, sah dann aus dem Augenwinkel etwas Gelbes heranrollen und direkt neben ihr halten. Eine Tür ging auf: »Taxi?« Sesam, öffne dich, ein Taxi. Ein Retter in Blech.
Die Stadt wirkte wie eine einzige schwarze Pfütze. Rechts und links spritzte das Wasser hoch, das sich auf dem Basaltpflaster staute und nur unter Schwierigkeiten abfloß. Die Straßen waren menschenleer, alle Fensterläden zugeklappt, die meisten Bars geschlossen. Das Taxi brauste den Corso Umberto I. entlang wie ein Motorboot. Marlen wurde in die leicht ramponierten Polster gedrückt. Einen Schirm hatte sie nicht dabei, wozu auch. Wenn sie sich allerdings ihre letzten Besuche in Neapel in Erinnerung rief, mußte sie zugeben, daß es jedesmal geregnet hatte. Wie gut das Vergessen in mancher Hinsicht klappte. Sie legte den Kopf zur Seite, lächelte vor sich hin, nickte den Häuserfassaden, den geschlossenen Fensterläden, der abblätternden Farbe zu wie alten Bekannten. Zwei Jahre lang war sie nicht hier gewesen – ein Sprung in der Ewigkeit. Ob sich viel verändert hatte? Idiotisch, dachte sie, warum sollte sich etwas verändern, nur weil ich weg bin?
Der Taxifahrer, er war Mitte bis Ende dreißig, musterte sie von der Seite. »Zum ersten Mal hier?«
»Nein.«
»Ah.« Er schwieg. »Sie kennen die Stadt?«
»Ein wenig«, sagte Marlen wortkarg.
Der Mann stieg auf die Bremse und brachte das Taxi an einer roten Ampel zum Stehen, obwohl gar kein Verkehr war.
»Nicht zu fassen«, entfuhr es Marlen.
»Was?«
»Daß Sie bei Rot halten.«
»Warum? Hält man etwa bei Ihnen zu Hause an einer roten Ampel nicht?«
»Doch.«
»Na sehen Sie.«
Der Regen trommelte aufs Autodach, der Taxifahrer trommelte auf das Lenkrad. Kräftige Hände, lange Finger. »Wir sind hier mitten in Europa, in einer zivilisierten Welt, Neapel war einmal die Hauptstadt Europas, hier gab es schon Straßenlaternen, noch bevor im Norden die Petroleumlampe erfunden wurde, und wo fuhr die erste Eisenbahn? Von Neapel nach Portici.« Der Taxifahrer legte richtig los: »In den letzten hundert Jahren aber ging es bergab mit der Stadt und der Moral, hinein in den Morast, ins Chaos, viele meinen, daß Regeln extra für sie außer Kraft treten oder daß es Spaß macht, sie zu überschreiten, bei Rot über die Ampel, Autofahren ohne Führerschein, Arbeit nur nach Bestechung, den Müll vor die Tür des Nachbarn kehren, Statuen den Kopf abschlagen, und nach mir die Sintflut.« Es klang auf gebracht, zornig, dann zuckte er mit den Schultern. »C’aggie ‘a fa’.«
»Eine wahre Sintflut«, stimmte Marlen zu.
»Schlechte Karten für Touristen.« Ironischer Unterton, eine Prise Schadenfreude.
»Ich bin ja nicht wegen des Wetters hier«, sagte Marlen, was nur die halbe Wahrheit war.
»Das kann man nur hoffen«, brummte der Taxifahrer. »Sie fahren vermutlich weiter auf die Inseln, Capri, Ischia.«
»Ich bin auch nicht hier, um Urlaub zu machen«, stellte Marlen klar. Was ebenfalls nicht unbedingt der Wahrheit entsprach. Doch wer kannte schon die Wahrheit… Klar, sie wollte an einigen Artikeln arbeiten, recherchieren, sich umtun, aber Urlaub vom Alltag in Deutschland und von Luzie, ihrer Tochter, war eine Fahrt nach Neapel allemal. Ganz abgesehen davon, daß die Trennung von Fritz verdaut werden wollte, zehn zähe und auch zärtliche Jahre, abgelaufen, aus und vorbei.
»Nein?« Die Stimme des Taxifahrers klang bedauernd, erstaunt. Dann, als sei endlich der Groschen gefallen: »Sie haben einen Freund. Un amico.«
»Genau«, sagte Marlen, mit dieser Art von Mißverständnis vertraut. »Sogar mehrere. Sie etwa nicht?«
Der Taxifahrer warf ihr einen belustigten Blick zu, der besagte, daß er den kleinen Seitenhieb wohlwollend registriert hatte. Er hatte ein offenes, waches Gesicht, in dem jetzt erstmalig eine Spur von Begehren aufblitzte. Marlen verspürte ein wohlbekanntes Ziehen auf der Haut. Attenzione!
»Sie sprechen ausgezeichnet Italienisch.«
»Bisher habe ich noch nicht viel gesagt.«
»Aber Komplimente kommen immer gut an«, konterte der Taxifahrer lachend.
»Kommt drauf an, wer sie macht«, sagte Marlen.
»Sehen Sie, ich habe es ja gesagt.«
»Was?«
»Daß Sie ausgezeichnet Italienisch sprechen. Mit dem harten R, das so erotisch klingt.«
Marlen runzelte die Stirn. Das war nun doch ein wenig zu viel des Guten: »das erotische harte R«. Wie oft wurde aus ihrem rollenden ein stolperndes R, das sie verärgert lieber gleich dort ließ, wo die meisten Deutschen ihr R nun einmal sprechen: im Rrrrrachen. Um das Thema zu wechseln, fragte sie den Taxifahrer, ob er immer nachts mit dem Taxi unterwegs sei.
»Nicht immer.« Jetzt war er es, der einsilbig antwortete.
»Machen Sie das schon lange?«
Als Antwort wiegte er bloß den Kopf.
»Und Sie?«
»Wie, ich?«
»Was machen Sie?«
»Ich bin Journalistin.«
»Und schreiben über Neapel?« Wieder der leicht spöttische Tonfall. »Über das schöne oder über das häßliche Neapel? Camorra, Drogen, Gewalt, Verkehrschaos und die malerischen Wäscheleinen hoch oben unter einem azurblauen Himmel? Verwitterte Häuser, heruntergekommene Kirchen, Blumen unter dem Heiligenaltar an der Straßenecke?«
»Genau«, sagte Marlen in einem Anflug von Trotz. »Und über den Regen, leere Straßen und freche Taxifahrer, die bei Rot halten.«
Er lachte auf. »Schon mal von dem Schriftsteller Malaparte gehört? La pelle?«
Sie nickte.
»Eine Art Vorbild«, sagte er. »Nicht einzuordnen. Geht unter die Haut. Sarkastisch, humorvoll, geistreich, im richtigen Moment böse, dann wieder weich wie Büffelmozzarella. Wußten Sie, daß er seine rote Villa auf Capri den roten Chinesen vermacht hat? Ein Liebhaber Neapels, ein Liebhaber der Kunst. – Und der Frauen«, ergänzte er nach einer Pause.
Sie fuhren am Castel Nuovo vorbei in Richtung San Carlo. Der Taxifahrer wies mit der Hand nach rechts und streifte dabei wie zufällig ihren Arm. »Hier in der Via Santa Brigida spielt auch eine Szene aus dem Buch, ganz am Anfang, wo er den Amerikaner trifft.«
»Oktober 1943«, sagte Marlen. »Die Stadt hatte sich selbst von den Deutschen befreit, ohne jede Hilfe der Alliierten.«
Der Taxifahrer pfiff anerkennend durch die Zähne. »Sie haben ja echt was drauf.«
»Ich schreibe über die quattro giornate di Napoli.«
»Und so was lesen Ihre Landsleute?«
»Manche schon.«
»Ich würde es lesen«, sagte er im Ton vollster Überzeugung. »Das heißt, wenn ich Deutsch könnte.«
»Schöne Versprechung«, lachte Marlen.
Sie fuhren in die Quartieri Spagnoli hinein. Der Taxifahrer fragte sie noch einmal nach der Adresse. Marlen kramte erneut den Zettel aus ihrer Jackentasche. Livia war vor ein paar Monaten umgezogen und wohnte jetzt im Vicoletto Conte Cedronio. Der Taxifahrer hatte keine Ahnung, wo das war, und Marlen noch weniger. Nur ein paar Ecken von der alten Wohnung entfernt, hatte Livia kurz nach dem Umzug geschrieben. Der Taxifahrer trommelte wieder mit den Fingern auf das Lenkrad, fuhr langsam, konzentriert, und hielt Ausschau nach jemandem, den er fragen konnte. Bei dem Wetter hatten sich sogar die Katzen verkrochen, die sonst in den Müllsäcken wühlten. Das Taxi fuhr dicht zwischen den zu beiden Seiten der Gasse abgestellten Autos den Hang hinauf. An der Ecke mußte mehrfach rangiert werden, dann ging es im ersten Gang weiter. Ein Licht war zu sehen, eine Straßenpizzeria, ein Mann wischte gerade den Tresen ab. Der Taxifahrer kurbelte das Fenster herunter, fragte nach dem Weg. Als Antwort fuchtelte der Pizzabäcker mit der Hand und gab konfuse Wegbeschreibungen von sich, auch er kannte sich offenbar nicht aus, kannte jedenfalls nicht die Namen der Gassen in seinem Viertel, wozu auch, er wohnte ja mittendrin. Seine Frau trat neben ihn, schüttelte den Kopf, gab die Frage schreiend in die Küche weiter, von dort wurde vage eine Richtung angegeben, an der Ecke rechts, dann links, dann eine der Querstraßen, so ungefähr. Marlen schlug vor zu telefonieren. Aber das Telefon funktionierte nicht. »Mi dispiace, Signorina, è guasto.«
Der Taxifahrer schlug mit der flachen Hand aufs Lenkrad, »Das wäre doch gelacht.« Der Ehrgeiz hatte ihn gepackt, er wendete, bog mal nach rechts ab, dann nach links, schrappte an der Stoßstange eines abgestellten Vehikels entlang, fuhr über einen bereits zerplatzten Müllbeutel und nahm dann hupend eine Einbahnstraße in entgegengesetzter Richtung.
»Alle Achtung«, sagte Marlen.
»Im richtigen Moment muß man sich über Regeln hinwegsetzen können«, erläuterte er seelenruhig. Sie mußte ihm recht geben, war ihm geradezu dankbar dafür, denn nun hielt er an, beugte sich vor, zeigte triumphierend auf das Straßenschild an der Hauswand: Vicoletto Conte Cedronio. Marlen und der Taxifahrer sahen einander zufrieden an und lächelten.
»Angekommen.«
»Ja.«
»Vielleicht haben Sie einmal Lust, sich die Villa Malaparte auf Capri anzusehen.«
»Auf jeden Fall.«
»In meiner Begleitung, meine ich.«
»Durchaus möglich.« Marlen war hellwach und todmüde zugleich, offen und ohne Schutzhaut. In diesem Zustand traf sie erfahrungsgemäß lieber keine Verabredungen mit Männern, deren Blick ihr unter die Haut ging. Sie zahlte, gab ein großzügiges Trinkgeld. »Für das Kompliment.«
Der Taxifahrer grinste. »War mir ein Vergnügen. Ich warte noch, bis Sie im Haus sind.«
»Sehr aufmerksam. Grazie.« Sie begegnete seinem eindringlichen, wenngleich zurückhaltenden Blick und wünschte ihm eine angenehme Nacht.
»Ich heiße übrigens Salvatore«, rief er hinterher.
Natürlich, dachte sie spöttisch, Salvatore, der Retter, nicht in Blech, sondern aus Fleisch und Blut.
Sie warf die Reisetasche über die Schulter und rannte los, so gut es ging. Nach zwei Metern war sie patschnaß. Nummer 17. Sie suchte die Hauseingänge ab, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Nichts. Das war doch nicht möglich! Sie mußte den Eingang übersehen haben. Oder war es doch die falsche Straße? Oder etwa die falsche Hausnummer? Wo war der verdammte Zettel? In dem Moment tat sich weiter vorn ein Tor auf: Licht. Ein Auto kam herausgefahren. Marlen lief in die Einfahrt, zwei schwarzgewandete Frauen hasteten ihr entgegen.
»Schnell, poverina, Sie werden ja ganz naß, Sie Ärmste! Grazie a Dio!«
Grazie a Dio sei sie nun endlich da, den ganzen Abend habe man auf sie gewartet, so eine lange Reise, sie müsse ja völlig ausgehungert sein. Marlen versuchte, gegen den wortreichen Empfang anzureden, doch die Nonnen waren von der eigenen Fürsorge so absorbiert, daß sie gar nicht zuhörten.
Eine andere Frau in einer Wolljacke, die das Mißverständnis im hellerleuchteten Portal des Klosters intuitiv erfaßte, kam Marlen zu Hilfe. Im Kloster erwartete man, wie Marlen nun erfuhr, seit Stunden die Ankunft einer Dominikanerin aus Österreich. Kaum war die Verwechslung aufgeklärt, ließen die Nonnen von Marlen ab, die erneut nach dem Vicoletto Conte Cedronio fragte, Nummer 17. Die Frau in der Wolljacke lachte breit. »Da sind Sie hier ganz richtig. Aber die Siebzehn? À disgrazia!« rief die Frau. Die Siebzehn bringe Unglück! Die gebe es hier nicht. Wen sie suche. Livia Picone? Sie dachte nach.
»Mitte dreißig, relativ klein, dunkle Haare, Locken, Malerin. Sie lebt allein, hat keine Kinder…« Der Versuch einer Beschreibung.
»… ma certo, natürlich, ho capito, kommen Sie…«
Die Zauberformel »alleinstehend, keine Kinder« mußte mal wieder gewirkt haben. So etwas fiel hier auf. Die Frau öffnete einen großen Regenschirm und hakte Marlen unter. Sie gingen die Gasse hinunter, an einer langen, hohen Steinmauer entlang, bis sie zu einer schweren Eisentür kamen. Die Frau drückte auf einen verrosteten Klingelknopf. Nichts, kein Ton zu hören, jedenfalls nicht hier draußen. Sie wartete, klingelte erneut. Pochen war sinnlos.
Das konnte ja heiter werden, Marlen sah sich schon im Kloster übernachten. Vielleicht hätte sie sich lieber die ganze Nacht lang durch die Stadt fahren lassen sollen, von diesem Taxifahrer, wie hieß er noch…
»Kommen Sie, gehen wir zu Salvatore.« Wie bitte, noch ein Retter? Dieser Salvatore allerdings entpuppte sich als älterer Mann, der im Haus gegenüber in der Pförtnerloge vor dem Fernseher saß und schlief. Er schreckte hoch, brummte etwas in sich hinein, was Marlen nicht verstand, stand auf, schlurfte aus dem Raum und kehrte mit einem Schlüssel in der Hand zurück.
Dann war alles nur noch eine Frage von Sekunden. Der Schlüssel paßte, die Tür ging auf, die Frau in der Wolljacke wünschte ihr eine gute Nacht und verschwand in der Dunkelheit. Marlen stand inmitten von regennassen, tropfenden Orangenbäumen, Palmen und Oleanderbüschen in einem Garten. Rechts parkte unter einem Wellblechdach ein abgewrackter, ehemals weißer Fiat, daneben eine rote Vespa: Livias Fuhrpark. Und die dunkle Silhouette, die soeben aus der erleuchteten Tür auf die Terrasse trat, war keine Nonne und auch keine nächtliche Erscheinung, sondern, nicht zu verkennen, ihre Freundin Livia und sonst niemand.
3
Neben der Tür stapelten sich Ereignisse, Nachrichten, Kommentare, in Druckerschwärze gekleidet und aufs Papier gepreßt – Livias alte Zeitungen. Marlen klemmte sich einen Packen unter den Arm und machte sich auf den Weg.
Der Vicoletto Conte Cedronio sah bei Tage wie verwandelt aus. Kaum ließen die Geschäfte ihre schweren Rolläden hoch, klappte die Stadt ihre zigtausend Augen auf – die Nacht war vorbei, das Leben begann aufs neue. Schräg gegenüber befand sich das Lager eines Stühlevermieters, der soeben von der offenen Ladefläche eines alten, stinkenden Lastwagens – millimetergenaue Rangiermanöver durch die Einfahrt – Tische und Stühle, die zu festlichen Gelegenheiten wie Hochzeiten oder Kommunionen vermietet wurden, in einen garagenähnlichen Lagerraum transportierte. In der Tür des Ladens nebenan stand der Schuster und inspizierte die Sohlen von einem Paar Schuhe: Zigarette im Mundwinkel, lange dunkelblaue Schürze, skeptischer Blick. Vor einem Metzgerladen hingen halbe Schafe und Kalbsköpfe mit weißen Zungen. Gleich daneben ein Basso, eine ebenerdige Wohnung, deren Fenster mit Süßwaren und Kinderkrimskrams aus Plastik behängt war, davor ein Wäscheständer, darüber hinter Glas, in Fernsehergröße, ein schäbiges Fegefeuer: verstaubte Teufelchen, angeschmutzte Feuerzungen, eine abgeknickte, ehemals blaue Plastikblume. In der Vineria an der Ecke hockten vier Männer um ein Faß und spielten Karten.
Als sie den Zeitungsladen betrat, mußte Marlen den Kopf einziehen, so tief hingen die Illustrierten. Sie kaufte den Mattino und eine neue Monatszeitschrift mit Namen Tuttifrutti, an der ein doppelt verpackter Präser baumelte. Wer weiß, wozu der gut sein würde. Marlen steuerte die nächste Bar an, bestellte einen Cappuccino und ein Cornetto. Sie war in Hochstimmung. Sollte sie noch am Abend zuvor die verregnete Stadt verflucht haben? Längst vergessen und vorbei. Betörend das Zischen der Espressomaschine, berauschend der Geruch nach gebrannten Kaffeebohnen. Die Leute redeten laut durcheinander, alles war in Ordnung.
Obwohl Marlen für Zeitungen schrieb, war sie keine leidenschaftliche Zeitungsleserin. Meistens überflog sie die Schlagzeilen, warf einen Blick auf die Sportseite, um zu sehen, ob Boris Becker in irgendeinem Turnier mitmischte, las dann höchstens einen oder zwei längere Berichte und das Feuilleton, sofern es nicht wie ein dicker Klacks Wörterspeise die xte Inszenierung eines Stückes von Ypsilon endgültig unter sich begrub. Wenn sie ins Ausland fuhr, war das anders. In Italien war Zeitunglesen wie ein Gang über den Markt, ein Schlendern durch die Straßen. Sie verstand nur die Hälfte, weil die Zusammenhänge fehlten, konnte gleichzeitig eintauchen und fremd bleiben – vielleicht war es deshalb so erholsam zu reisen.
Sie begann mit der Berichterstattung über alte und neue Verdächtigungen im landesweiten Korruptionsskandal, ein Schurkenstück der übelsten Sorte, an dem kaum ein Politiker nicht mitgewirkt hatte. Marlen war jedoch nicht auf dem neuesten Stand, die Berichterstattung kam ihr vor wie ein schlechter Fortsetzungsroman, dessen bisherige Folgen sie leider versäumt hatte. Sie blätterte weiter zur Cronaca, dem täglichen Sud aus Unfällen, Überfällen, Drogentoten, Gewalt, Armut, Hoffnungslosigkeit, las Überschriften: Säugling gestohlen und Mutter erstochen, um den Geliebten mit Kind zu ködern – Tochter von Maden zerfressen. Niemand rief den Arzt – Nach der Disco mit 160 in den Tod. Eine Frau beschwor, sie sei der Madonna begegnet, auf der nächsten Seite prangten die Fotos von einem ermordeten Barbesitzer und dessen potentiellem Mörder. Und sonst? Der Fußballclub SSC Napoli – neben San Gennaro und einigen weniger eminenten Heiligen vielleicht der wichtigste Hoffnungsträger der Bevölkerung – plädierte für eine umfassende Abstinenz der Spieler vor wichtigen Begegnungen. Probenberichte von Donizettis Elisir d’amore am San Carlo. Die Filmseite. Das Wetter. Marlen klappte die Zeitung zu. Der für die Tabakfrau bestimmte Stapel war um anderthalb Zentimeter gewachsen.
Sie trat auf die Straße. Immerhin war der Himmel wieder blau und spiegelte sich in den letzten Pfützen. Marlen ließ sich vom unaufhörlichen Gestank und Geknatter der Vespas umfluten, als schwimme sie in einem warmen Tümpel. Hohe Häuserschluchten, zusammengehalten von unzähligen Wäscheleinen, dicke, beschürzte Frauen, die auf Holzstühlen auf der Straße saßen, Kinder jeden Alters, die auf knatternden, stinkenden Mofas im Slalom die Gassen entlangrasten, Anhäufungen gemischten Mülls, dazwischen weggeworfene Spritzen, Katzen, Tauben, streunende Hunde und immer wieder Autos, die lautstark hineindrängten in diese Enge.
Auf der Türschwelle des Tabakladens lagen durchweichte Pappkartons zum Abtreten der Füße. Marlen blieb in der Tür stehen. Rückstau bis nach draußen. Es herrschte ein Gedränge wie beim Ausverkauf, ein einziges Geschiebe und Gewoge von Körpern. Eine lautstarke Diskussion war im Gange, irgend etwas mußte passiert sein. Marlen schnappte Wortfetzen auf, aus denen sie nicht schlau wurde: schon wieder – Banditen – ihnen auch – immer die Armen und Alten – einfach weggerissen – ecco – ecco – aufgeschlitzt – ich sage ja immer wieder–die Handtasche – den Ehering – ein Skandal – und die Politiker die Oberschurken – mannaggia la miseria!
Die versammelten Frauenkörper erinnerten Marlen an einen immensen Wackelpudding, der sanft hin- und herwankte, ohne auseinanderzubrechen. Mit ihren einsdreiundsiebzig war Marlen mindestens zehn Zentimeter größer als die meisten der anwesenden Frauen und blickte trotzdem nicht durch. Sie ließ sich einfach mit hineinrühren und verschwand in der teigigen Masse dicker und dünner Frauenkörper, um bis zur Tabakfrau vorzudringen. Die saß mit bleichem Gesicht wie eine Sphinx hinter dem Holztresen, nickte, schüttelte den Kopf, öffnete den Mund und sagte etwas, das vom Lärm der Stimmen so vollständig auf gesogen wurde wie Fettspritzer von einem Blatt Löschpapier.
Seit Marlen die Tabakfrau kannte, war diese ungemein dick gewesen, dicker noch als andere dicke Menschen, doch nur vom Hals abwärts. Der massige Leib verschwand zwar gewöhnlich hinter dem Tresen, der ihn gut schützte, aber an Armen, Händen, Fingern ließ sich der Umfang des Körpers ablesen. Immer wenn Marlen der Tabakfrau gegenüberstand, wanderte ihr Blick wie zufällig zu diesen Fingern, die ein Paket Toilettenpapier oder ein paar lose Kerzen sorgfältig in Zeitungspapier wickelten und das Päckchen zusätzlich mit einem Bindfaden verschnürten, als handele es sich um ein wertvolles Geschenk. Einen Finger hielt ein Ehering umschlossen, für immer und ewig, als wäre das Fleisch Unkraut und der Ring ein von Unkraut überwuchertes Schloß im Wald, das Dornengeschenk, und darin, schlafend, die Tabakprinzessin. Einst, als die Tabakfrau noch schlank gewesen war, hatte ihr jemand den Ring an den Finger gesteckt – das mußte in einem anderen Leben gewesen sein.
Das Gesicht der Tabakfrau jedoch bildete ein bizarres Gegengewicht zum Rest des Körpers, nein, Gewicht konnte man es nicht nennen, es entstand eher der Eindruck von Schwerelosigkeit. Ihr Gesicht war schmal, länglich und sah federleicht aus. Grüne, verletzliche Augen, aus denen dann und wann Abenteuerlust hervorsprühte, weiche, weiße Haut, ein erster Faltenwurf von Lachen, Weinen, Zorn und Kummer, eine hohe Stirn, rundherum zurückgekämmte, schwarze Haare, die in einem Knoten am Hinterkopf verschwanden. Schwarze Haare, mittlerweile mit Grau durchsetzt. Zwei Jahre waren vergangen, seit sie sich zuletzt begegnet waren.
Jetzt winkte sie. Die Tabakfrau hatte Marlen im Gemenge entdeckt und erhob sich. Als sei das ein Zeichen, die allgemeine Versammlung zu beenden und sich wieder den eigenen Sorgen zuzuwenden, begann der Kreis von Frauen von den Rändern her abzubröckeln, der Laden leerte sich.
Was zum Vorschein kam, waren gähnend leere Regale. Platzte der Laden gewöhnlich aus allen Nähten mit seinen Zahnpastatuben, Monatsbinden, Haarsprays, Deodorants, Rasiercremes, Waschmitteln, Putzeimern, Lippenstiften, Nagellackfläschchen, Schokoladenriegeln, Plastikspielzeug, Postkarten, Papiertaschentüchern, Präservativen und vielem mehr, so sah es dort jetzt aus wie nach einer Plünderung, nach einem Räumungsverkauf zum Nulltarif.
»So ist das Leben«, sagte die Tabakfrau, die den Einbruch morgens entdeckt hatte. »Man schiebt den Rolladen hoch, und alles ist weg. Nichts mehr da. Wie in einem Alptraum. Man baut sich etwas auf, dann kommt jemand und macht alles wieder kaputt. Einfach so. Wie kleine Kinder einen Turm aus Bauklötzen. Und man hockt sich hin, sammelt die Steine wieder zusammen und baut einen anderen, ähnlichen Turm. Batsch! Das war’s schon wieder. Und so fort. Was bleibt einem anderes übrig?« Sie klagte jedoch eher beiläufig, als unterhielte sie sich mit dem Schicksal, das ohnehin völlig ungerührt bleiben würde.
»Haben Sie eine Ahnung, wer es war?«
»Wenn ich das wüßte«, begann die Tabakfrau, dann duckte sie mit den Achseln. »Und selbst wenn ich es wüßte, würde das auch nichts helfen. Irgendwelche Jugendlichen. Drogenabhängige. Irgendwer braucht immer Geld. Die kommen immer wieder. Die Typen ändern sich, die Gesichter, auch wenn sie sich alle ähnlich sehen…«
Marlen war empört. »Hat denn keiner etwas bemerkt? Das muß doch jemand gehört haben! Ein Rolladen läßt sich doch nicht so leise öffnen wie ein Vorhang im Theater! Dazu die Glasscherben! Hier wohnen doch Leute! Und die Vespafahrer nachts!«
Die Tabakfrau lächelte nachsichtig. »Hier mischt sich niemand gern ein, das wissen Sie doch. Und selbst wenn … Bis die Polizei da ist, wenn sie überhaupt kommt, sind die Räuber längst über alle Berge. Und wenn sie geschnappt werden … Dann landen die Kerle hinter Gittern, und da lernt man alles mögliche, aber kein anständiges Leben. Dann kriegen sie einen Prozeß oder auch nicht, weil die Zeiten mal wieder überschritten wurden, und wenn sie wieder rauskommen, geht alles weiter wie vorher. Was soll man machen? In den letzten zehn Jahren hat sich das Leben hier sehr verändert, zum Schlechten. Seit ich den Laden von meinen Eltern übernommen habe, gibt es jedes Jahr ein oder zwei Einbrüche. Vorher kaum. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern.«
Marlen wußte nicht, was sie sagen sollte. Besser gesagt: Sie hatte nichts zu sagen zu dieser Aussichtslosigkeit, die sich in den Worten der Tabakfrau über sie ergoß. Aber es machte sie wütend: aus dem täglichen Leben, Cronaca, mit einem anderen Beigeschmack als auf Zeitungspapier.
»Vielleicht sollte ich lieber über Kleinkriminalität schreiben«, murmelte sie verdrossen. »Einbrüche in Tabakläden, Handtaschendiebstahl, kleine Überfälle mit Pfeil und Bogen…«
»Das ist doch nur die Spitze des Eisbergs«, erwiderte die Tabakfrau. »Was heißt Eisberg. Drogen, das ist es, was dahintersteckt. Geld. Wer an der Spritze hängt, dem ist es egal, wer sonst noch auf der Strecke bleibt. Das eigene Leben, das Leben anderer …« Sie starrte auf ihre Finger, die sich am Tresen festklammerten. »Eine beschissene Stadt«, zischte sie, und ihre anfängliche Gleichmut zerbrach wie eine Eierschale. Heraus schlüpften, ein Trupp kleiner Krokodile, all die Gefühle, die sich üblicherweise in resignativen Kommentaren versteckten. Oder – wie im Fall der Tabakfrau – direkt in den Bäuchen der Leute verschwanden, in Form von Fett, als Magengeschwür.
»Seit dem Erdbeben ist das so«, sagte sie. Ihre Stimme zitterte vor Zorn und Ohnmacht. »Seitdem hat die Stadt Risse bekommen. So viele Häuser wurden zerstört und nie wieder aufgebaut. Als würden sich die jungen Leute das zum Vorbild nehmen, ein Leben als Provisorium. In Ewigkeit. Ganz ohne jedes Amen. Oder sogar mit. Es ist völlig egal. So ist das.« Sie lachte bitter. »Und wer kann ihnen schon einen Vorwurf daraus machen. Andere Vorbilder haben wir eben nicht mehr zu bieten. Politiker? Die Kirche? Eine ehrbare Familie? Jeder schlägt sich durch, auf mehr oder weniger krummen Pfaden.« Ihre Augen funkelten, ihre Faust sauste auf das Holz. »Willkommen in dieser beschissenen Stadt! Bentornata, cara!« Dann atmete sie tief durch.
Marlen legte den Stapel Zeitungen, den sie die ganze Zeit unter den Arm geklemmt hielt, auf dem Tresen ab. »Vielleicht können Sie die ja irgendwann wieder brauchen…«
Die Tabakfrau starrte auf die Zeitungen, brach dann in ein herzhaftes Gelächter aus. »Großartig! Sie haben den nötigen Galgenhumor! Zeitungen! Verpackungsmaterial für nichts, ein schöner Gedanke! Ich danke Ihnen!« Sie stand ein wenig schwerfällig auf. »Kommen Sie. Gehen wir nach hinten, für einen Espresso ist immer Zeit. Hier ist es zu ungemütlich, zwischen all den leeren Regalen. Außerdem«, setzte sie mit einem spitzbübischen Lächeln hinzu, »muß ich mir jetzt keine Sorgen darum machen, daß was geklaut wird. Praktisch, was?«.
Marlen fand, daß es eher die Tabakfrau war, die über Galgenhumor verfügte.
Die Gespräche zwischen ihnen waren mit jedem von Marlens Neapel-Besuchen herzlicher geworden, intensiver. Früher, als Marlen Luft und Lungen täglich an die vierzig Glimmstengel hatte zukommen lassen, war sie zum Zigarettenkaufen immer zur Tabakfrau gegangen, auch wenn die Schmuggelware an der Via Roma billiger war. In der Zeit danach hatte sie statt dessen Schokolade, Seife, Postkarten gekauft, irgendetwas, wofür sie irgendwann Verwendung haben würde. Aus den sporadischen, oft wortlosen Dialogen über den Holztresen hinweg wurden im Lauf der Zeit Gespräche über Kinder und Mütter, Krankheiten, Schule, Arbeit, das Leben in Germania, das Leben in Napoli. Die Tabakfrau hatte eine Tochter im gleichen Alter wie Luzie, Marlens Tochter, die früher auf Reisen immer mit von der Partie gewesen war.
Im Rahmen einer Serie über Mütter in Italien hatte Marlen zwei Jahre zuvor ein Porträt über die Tabakfrau geschrieben. Sie waren zusammen in eine Trattoria gegangen, hatten gut gegessen, viel getrunken, ausgiebig geplaudert. Zur Abrundung der Begegnung wurde Marlen am späten Abend in die Geheimnisse des Archivs der Tabakfrau eingeweiht – ähnlich wie früher in die Schallplattensammlungen der Lover in spe, mit dem Unterschied, daß in diesem Fall ausschließlich freundschaftliche Absichten dahintersteckten.