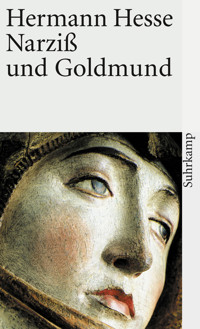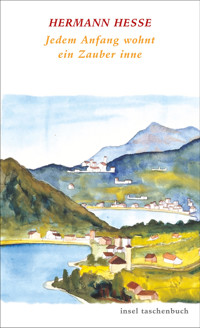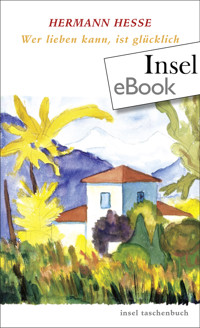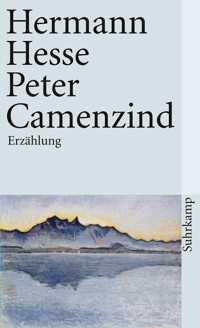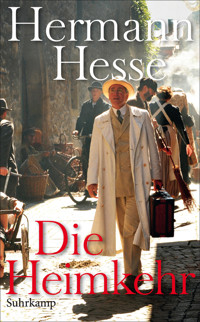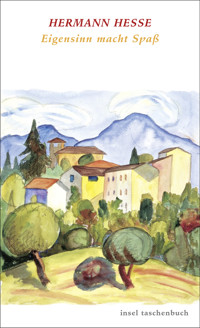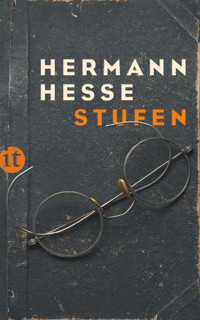2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Interactive Media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Rosshalde
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Hermann Hesse
Rosshalde
German Language Edition
New Edition
Published by Urban Romantics
This Edition
First published in 2021
Copyright © 2021 Urban Romantics
All Rights Reserved.
ISBN: 9781787362611
Contents
ERSTES KAPITEL
ZWEITES KAPITEL
DRITTES KAPITEL
VIERTES KAPITEL
FÜNFTES KAPITEL
SECHSTES KAPITEL
SIEBENTES KAPITEL
ACHTES KAPITEL
NEUNTES KAPITEL
ZEHNTES KAPITEL
ELFTES KAPITEL
ZWÖLFTES KAPITEL
DREIZEHNTES KAPITEL
VIERZEHNTES KAPITEL
FÜNFZEHNTES KAPITEL
SECHZEHNTES KAPITEL
SIEBZEHNTES KAPITEL
ACHTZEHNTES KAPITEL
ERSTES KAPITEL
Als vor zehn Jahren Johann Veraguth Roßhalde gekauft und bezogen hatte, war sie ein verwahrloster alter Herrensitz mit zugewachsenen Gartenwegen, vermoosten Bänken, brüchigen Treppenstufen und undurchdringlich verwildertem Park gewesen, und es standen damals auf dem wohl acht Morgen großen Grundstück keine anderen Gebäude als das schöne, etwas verkommene Herrenhaus mit dem Stall und ein kleines tempelartiges Lusthäuschen im Park, dessen Portal schief in verbogenen Angeln hing und an dessen einst mit blauer Seide tapezierten Wänden Moos und Schimmel wuchs.
Sofort nach dem Kauf des Gutes hatte der neue Besitzer das baufällige Tempelchen niedergerissen und nur die zehn alten Steinstufen stehen lassen, die von der Schwelle dieses Liebeswinkels an den Rand des Weihers hinabführten. An Stelle des Parkhäuschens wurde damals Veraguths Atelier erbaut, und sieben Jahre lang hatte er hier gemalt und den größeren Teil seiner Tage zugebracht, seine Wohnung aber drüben im Herrenhaus gehabt, bis die zunehmenden Zerwürfnisse in seiner Familie ihn dazu gebracht hatten, seinen älteren Sohn zu entfernen und auf auswärtige Schulen zu schicken, das Herrenhaus der Frau und Dienerschaft zu überlassen und für seinen eigenen Bedarf zwei Zimmer an das Atelier anzubauen, wo er nun seither wie ein Junggeselle wohnte. Es war schade um das schöne herrschaftliche Haus; Frau Veraguth brauchte mit dem siebenjährigen Pierre nur das obere Geschoß, sie empfing wohl Besuche und Gäste, aber niemals größere Gesellschaft, und so stand eine Reihe von Räumen jahraus jahrein leer.
Der kleine Pierre war nicht nur der Liebling beider Eltern und das einzige Band zwischen Vater und Mutter, das eine Art von Verkehr zwischen Herrenhaus und Atelierhaus aufrechterhielt; er war eigentlich auch der einzige Herr und Besitzer der Roßhalde. Herr Veraguth bewohnte ausschließlich sein Atelier und die Gegend um den Waldsee sowie den ehemaligen Wildpark, seine Frau herrschte drüben im Haus, ihr gehörte der Rasenplan, der Lindengarten und der Kastaniengarten, und jedes sprach im Gebiete des anderen nur selten und gastweise vor, von den Mahlzeiten abgesehen, die der Maler meistens im Herrenhause einnahm. Der kleine Pierre war der einzige, der diese Trennung des Lebens und Teilung der Gebiete nicht anerkannte und kaum von ihr wußte. Er lief im alten wie im neuen Hause gleich sorglos aus und ein, er war im Atelier und in des Vaters Bibliothek ebenso heimisch wie im Korridor und Bildersaal drüben oder in den Zimmern der Mutter, ihm gehörten die Erdbeeren im Kastaniengarten, die Blumen im Lindengarten, die Fische im Waldsee, die Badehütte, die Gondel. Er fühlte sich als Herr und als Schützling bei den Mädchen der Mutter wie bei Papas Diener Robert, er war der Sohn der Hausfrau für die Besuche und Gäste der Mutter, und war der Sohn des Malers für die Herren, die zuweilen in Papas Atelier kamen und französisch sprachen, und Bildnisse des Knaben, Gemälde und Photographien, hingen im Schlafzimmer des Vaters wie im alten Hause in den hellfarbig tapezierten Stuben der Mutter. Pierre hatte es sehr gut, es ging ihm sogar besser als solchen Kindern, deren Eltern in gutem Einvernehmen leben; es herrschte kein Programm über seine Erziehung, und wenn ihm je einmal auf mütterlichem Gebiete der Boden heiß wurde, so bot die Gegend um den Waldsee ihm eine sichere Zuflucht.
Er war längst zu Bette und seit elf Uhr war im Herrenhaus das letzte helle Fenster erloschen. Da kam, spät nach Mitternacht, Johann Veraguth allein zu Fuße aus der Stadt zurück, wo er mit Bekannten den Abend im Wirtshaus zugebracht hatte. Beim Gang durch die laue, wolkige Frühsommernacht war die Atmosphäre von Wein und Rauch, von erhitztem Gelächter und verwegenen Witzen von ihm abgefallen, er atmete bewußt die leicht gespannte, feuchtwarme Nachtluft und schritt aufmerksam auf der Straße zwischen schon hochstehenden, dunkeln Getreidefeldern der Roßhalde entgegen, deren hohe Wipfelmassen groß und still im bleichen nächtlichen Himmel standen.
Er ging am Eingang des Gutes vorbei, ohne einzutreten, sah einen Augenblick nach dem Herrenhaus hinüber, dessen lichte Fassade edel und lockend vor der schwarzen Baumfinsternis schimmerte, und betrachtete das schöne Bild minutenlang mit dem Genuß und mit der Fremdheit eines vorüberkommenden Wanderers; dann ging er noch ein paar hundert Schritte die hohe Hecke entlang bis zu der Stelle, wo er sich einen Durchschlupf und heimlichen Waldweg zum Atelier bereitet hatte. Mit wachen Sinnen schritt der kräftige, kleine Mann durch den finsteren, waldig verwilderten Park seiner Wohnstätte zu, die plötzlich vor ihm lag, da, wo die Wipfelfinsternis über dem See auseinandergezogen erschien und im weiten Rund der matte graue Himmel sichtbar wurde.
Der kleine See stand fast schwarz in vollkommener Stille, nur wie eine unendlich dünne Haut oder ein feiner Staub lag das schwache Licht über dem Wasser. Veraguth sah auf die Uhr, es war bald eins. Er schloß eine Seitentür des kleinen Gebäudes auf, die in seinen Wohnraum führte. Hier zündete er eine Kerze an und legte rasch die Kleider ab, trat nackt ins Freie hinaus und stieg langsam die breiten flachen Steinstufen hinab in das Wasser, das vor seinen Knien in kleinen, weichen Ringen flüchtig aufblinkte. Er tauchte unter, schwamm eine kleine Strecke weit in den See, fühlte plötzlich die Müdigkeit nach einem ungewohnt verbrachten Abend, kehrte um und trat triefend ins Haus. Er warf einen zottigen Bademantel um, strich das Wasser aus seinen kurz geschorenen Haaren und ging barfuß über einige Stufen zum Atelier hinauf, einem ungeheuren fast leeren Raum, wo er alsbald mit einigen ungeduldigen Bewegungen alle elektrischen Lichter andrehte.
Hastig lief er zu einer Staffelei, wo eine kleine Leinwand stand, seine Arbeit der letzten Tage. Mit auf die Knie gestützten Händen stellte er sich gebückt vor dem Bilde auf und starrte mit weit aufgerissenen Augen auf die Fläche, deren frische Farben das grelle Licht spiegelten. So verharrte er zwei, drei Minuten, schweigend und starrend, daß die Arbeit bis zum letzten Pinselstrich ihm wieder lebendig in den Augen stand; es war seit Jahren seine Gewohnheit, vor Arbeitstagen keine andere Vorstellung mit ins Bett und in den Schlaf zu nehmen, als die des Bildes, an dem er malte. Er löschte die Lichter, griff nach der Kerze und ging zum Schlafzimmer, an dessen Türe eine kleine Schreibtafel und Kreide angehängt war. „Sieben Uhr wecken, Kaffee neun Uhr“ schrieb er mit starken römischen Buchstaben darauf; schloß die Türe hinter sich und legte sich ins Bett. Mit offenen Augen lag er noch eine kurze Weile bewegungslos und zwang mit Anstrengung das Bild seiner Arbeit vor seine Sinne. Damit gesättigt schloß er die klaren grauen Augen, seufzte leise auf und fiel rasch in den Schlaf.
Am Morgen weckte ihn Robert zur bestimmten Zeit, er erhob sich sofort, wusch sich in einem kleinen Nebenraum im fließenden kalten Wasser, schlüpfte in einen groben, stark verwaschenen Anzug von grauem Leinen und ging ins Atelier hinüber, dessen mächtige Rolladen der Diener schon aufgezogen hatte. Auf einem kleinen Tischchen stand ein Teller voll Obst, eine Wasserkaraffe und ein Stück Roggenbrot, das er nachdenklich in die Hand nahm und anbiß, während er sich vor die Staffelei stellte und sein Bild betrachtete. Er aß im Auf- und Abschreiten ein paar Bissen Brot, fischte ein paar Kirschen aus dem Glasteller, sah einige Briefe und Zeitungen daliegen, die er nicht beachtete, und saß gleich darauf gebannt im Feldstuhl vor der Arbeit.
Das kleine Bild in Breitformat stellte eine Morgenfrühe dar, wie sie der Maler vor einigen Wochen auf einer Reise gesehen und in mehreren Skizzen notiert hatte. Er war in einem kleinen Landwirtshause am Oberrhein abgestiegen, hatte den Kollegen, den er am Ort besuchen wollte, nicht angetroffen, einen unerfreulichen Regenabend in der qualmigen Wirtsstube und eine schlechte Nacht in einem kalkig-modrig riechenden feuchten Gastzimmerchen verbracht. Noch vor Sonnenaufgang aus seichtem Schlummer heiß und übellaunig erwacht, hatte er die Haustüre noch verschlossen gefunden, war durch ein Fenster der Wirtsstube ins Freie gestiegen, hatte nebenan am Rheinufer einen Kahn losgemacht und war in den schwach strömenden, noch dämmerigen Fluß hinausgerudert. Eben als er umkehren wollte, sah er vom jenseitigen Ufer her einen Ruderer sich entgegenkommen, das schwach zuckende kalte Licht des milchig regnerischen Tagesanbruchs umfloß den dunkeln Umriß und ließ das Fischerboot übermäßig groß erscheinen. Von dem Anblick und dem eigentümlichen Licht plötzlich getroffen und innerlichst gefesselt, hatte er halt gemacht und den Mann näherkommen lassen, der bei einem schwimmenden Netzzeichen anhielt und eine Reuse aus dem kühlen Wasser emporzog. Zwei breite mattsilbrige Fische kamen zum Vorschein, naßglänzend schimmerten sie einen Augenblick über dem grauen Strome und fielen mit einem schnalzenden Klang in des Fischers Boot. Veraguth hatte alsbald den Mann warten heißen, das notdürftigste Malzeug geholt und eine Skizze in Wasserfarben gemacht, war einen Tag am Ort geblieben, zeichnend und lesend, und hatte andern Tages in der Frühe nochmals draußen gemalt, war weiter gereist und hatte sich seither immer wieder in Gedanken von dem Bilde beschäftigt und gequält gesehen, bis es Form gewann, und nun saß er seit Tagen daran und war nahezu fertig geworden.
Ihm, der am liebsten bei voller Sonne oder auch im warmen, gebrochenen Wald- und Parklicht malte, hatte die flutende Silberkühle des Bildes viel zu schaffen gemacht, aber sie hatte ihm einen neuen Klang gegeben, gestern war die Lösung vollends geglückt und nun fühlte er, daß er vor einer guten, ungewöhnlichen Arbeit saß, bei der es nicht im Festhalten und löblichen Abschildern sein Bewenden hatte, sondern wo ein Augenblick aus dem gleichgültigen rätselhaften Sein und Geschehen der Natur die gläserne Oberfläche durchbrach und den wilden großen Atem der Wirklichkeit spüren ließ.
Mit aufmerksamen Augen hing der Maler an dem Bilde und wog die Töne auf der Palette, die seiner gewohnten kaum mehr glich und fast alle roten und gelben Farben verloren hatte. Das Wasser und die Luft war fertig, es rann ein fröstelnd kaltes, unwilliges Licht über die Fläche, schattenhaft schwammen Gebüsche und Pfähle des Ufers in der feuchten, fahlen Dämmerung, unwirklich und aufgelöst stand der grobe Kahn im Wasser, auch das Gesicht des Fischers war ohne Wesen und Sprache, nur seine ruhig nach den Fischen greifende Hand war voll unerbittlicher Wirklichkeit. Das eine von den Tieren sprang glitzernd über den Rand des Bootes, das andere lag flach und still, und sein geöffnetes rundes Maul und erschrocken starres Auge war voll vom Weh der Kreatur. Das Ganze war kalt und beinahe bis zur Grausamkeit traurig, aber still und unangreifbar und ohne eine andere Symbolik als jene einfache, ohne die kein Kunstwerk sein kann und die uns die bedrückende Unbegreiflichkeit der ganzen Natur nicht nur fühlen, sondern mit einem gewissen süßen Erstaunen lieben läßt.
Als der Maler wohl zwei Stunden an der Arbeit gesessen hatte, klopfte der Diener und trat auf den zerstreuten Anruf seines Herrn mit dem Frühstück herein. Er trug leise die Kannen, Tasse und Teller auf, rückte einen Stuhl zurecht, wartete eine Weile schweigend und mahnte dann vorsichtig: „Es ist eingeschenkt, Herr Veraguth.“
„Ich komme,“ rief der Maler und rieb einen Pinselstrich, den er soeben am Schwanz des springenden Fisches gemacht hatte, mit dem Daumen wieder weg. „Ist warmes Wasser da?“
Er wusch seine Hände und setzte sich zum Kaffee.
„Sie könnten mir eine Pfeife stopfen, Robert,“ sagte er munter. „Die kleine ohne Deckel, sie muß im Schlafzimmer liegen.“
Der Diener lief. Veraguth trank mit Inbrunst den starken Kaffee und fühlte die leise Ahnung von Schwindel und Zusammenbruch, die ihn neuerdings nach angestrengter Arbeit zuweilen anflog, zergehen wie Morgennebel.
Er nahm dem Diener die Pfeife ab, ließ sich Feuer geben und sog mit Gier den aromatischen Rauch ein, der die Wirkung des Kaffees verstärkte und verfeinerte. Er deutete auf sein Bild und sagte: „Sie haben als Junge geangelt, Robert, nicht wahr?“
„Wohl, Herr Veraguth.“
„Sehen Sie sich einmal den Fisch dort an, nicht den in der Luft, den andern unten mit dem offenen Maul. Ist das Maul richtig?“
„Es ist schon richtig,“ sagte Robert mißtrauisch. „Aber das wissen Sie besser als ich,“ fügte er mit einem Ton von Vorwurf hinzu, als fühle er einen Spott in der Frage.
„Nein, Verehrter, das stimmt nicht. Der Mensch erlebt das, was ihm zukommt, nur in der ersten Jugend in der ganzen Schärfe und Frische, so bis zum dreizehnten, vierzehnten Jahr, und von dem zehrt er sein Leben lang. Ich habe als Junge nie mit Fischen zu tun gehabt, darum frage ich. Also, ist die Schnauze recht so?“
„Sie ist gut, da fehlt nichts,“ urteilte Robert geschmeichelt.
Veraguth war schon wieder aufgestanden und prüfte seine Palette. Robert sah ihn an. Er kannte diese beginnende Konzentriertheit des Blickes, die ihn beinahe glasig erscheinen ließ, und wußte, daß jetzt er und der Kaffee, die kleine Unterhaltung von vorhin und alles das in dem Manne untersinke, und wenn er in einigen Minuten ihn anriefe, würde er wie aus einem tiefen Schlaf erwachen. Aber das war gefährlich. Robert räumte ab, da sah er die Post unberührt liegen.
„Herr Veraguth!“ rief er halblaut.
Der Maler war noch erreichbar. Feindselig fragend blickte er über die Schulter zurück, genau wie ein Ermüdeter, der dem Einschlummern nahe war und nochmals angerufen wird.
„Es sind Briefe da.“
Damit ging Robert hinaus. Veraguth drückte nervös ein Häufchen Kobaltblau auf die Palette, warf die Tube auf den kleinen blechbeschlagenen Maltisch, begann zu mischen, fühlte sich aber durch die Mahnung des Dieners gestört, so daß er ärgerlich die Palette weglegte und die Briefe an sich nahm.
Es waren die üblichen Geschäftssachen, die Aufforderung, sich an einer Ausstellung zu beteiligen, die Bitte einer Zeitungsredaktion um Mitteilung von Daten aus seinem Leben, eine Rechnung – aber da fuhr der Anblick einer wohlbekannten Handschrift ihm wie ein süßer Schauder in die Seele, er nahm den Brief an sich und las mit Genuß seinen eigenen Namen und jedes Wort der Adresse, wohlig in die Beobachtung der freien, eigenwillig charaktervollen Schriftzüge vertieft. Dann bemühte er sich, den Poststempel zu lesen. Die Briefmarke war italienisch, es konnte nur Neapel oder Genua sein, und dann war also der Freund schon in Europa, schon ganz nahe, und konnte in wenigen Tagen hier sein.
Mit Rührung öffnete er den Brief und sah mit Befriedigung die kleinen schnurgeraden Zeilen in ihrer strengen Ordnung stehen. Wenn er sich recht besann, so waren seit fünf, sechs Jahren diese seltenen Briefe des ausländischen Freundes die einzigen reinen Freuden gewesen, die er gehabt hatte, die einzigen außer der Arbeit und außer den Stunden des Umgangs mit dem kleinen Pierre. Und wie jedesmal, so befiel ihn auch jetzt mitten in der frohen Erwartung ein unklares, peinliches Gefühl von Beschämung, indem die Verarmung und Lieblosigkeit seines Lebens ihm ins Bewußtsein trat. Langsam las er:
Neapel, 2. Juni nachts.
Lieber Johann!
Wie gewöhnlich sind ein Mundvoll Chianti mit fetten Makkaroni und das Gebrüll einiger Hausierer vor der Schenke die ersten Zeichen der europäischen Kultur, der ich mich wieder nähere. Hier in Neapel ist seit fünf Jahren nichts verändert, weit weniger als in Singapore oder Schanghai, und ich nehme es als ein gutes Zeichen dafür, daß ich auch daheim alles in Ordnung finden soll. Übermorgen kommen wir nach Genua, da holt mein Neffe mich ab und ich fahre mit ihm zu den Verwandten, wo mich diesmal keine überwallenden Sympathien erwarten, denn ich habe in den letzten vier Jahren, ehrlich gerechnet, keine zehn Taler verdient. Ich rechne für die ersten Ansprüche der Familie vier, fünf Tage, dann Geschäftliches in Holland, sagen wir wieder fünf, sechs Tage, so daß ich etwa am 16. oder so zu Dir kommen könnte. Das wirst Du telegraphisch erfahren. Ich möchte mindestens zehn oder vierzehn Tage bei Dir bleiben, weißt Du, und Dich in der Arbeit stören. Du bist schauderhaft berühmt geworden und wenn das, was Du vor etwa zwanzig Jahren über Erfolg und Berühmtheiten zu sagen pflegtest, nur halbwegs richtig war, mußt Du inzwischen bedeutend verkalkt und vertrottelt sein. Ich will Dir auch Bilder abkaufen, und meine obige Klage über die schlechten Geschäfte ist ein Versuch, auf Deine Preise zu drücken.
Man wird älter, Johann. Es war meine zwölfte Fahrt durchs Rote Meer, und zum erstenmal habe ich unter der Hitze gelitten. Wir hatten 46 Grad.
Herrgott, Alter, noch vierzehn Tage! Es wird Dich einige Dutzend Flaschen Mosel kosten. Es sind mehr als vier Jahre seit dem letztenmal.
Brieflich bin ich zwischen dem 9. und 14. in Antwerpen, Hotel de l’Europe, zu erreichen. Falls Du irgendwo, wo ich durchreise, Bilder ausgestellt hast, laß mich’s wissen!
Dein Otto.
Vergnügt überlas er den kurzen Brief mit den gesunden, strammen Buchstaben und temperamentvollen Satzzeichen noch einmal, suchte aus der Lade des kleinen Schreibtisches in der Ecke einen Kalender heraus und nickte, darin lesend, mit Befriedigung vor sich hin. Es würden noch bis zur Mitte des Monats über zwanzig Bilder von ihm in Brüssel ausgestellt sein, das traf sich glücklich. So würde der Freund, dessen scharfen Blick er ein wenig fürchtete und dem die Zerrüttung seines Lebens in den letzten Jahren nicht verborgen bleiben konnte, wenigstens einen ersten Eindruck von ihm haben, auf den er stolz sein konnte. Das erleichterte alles. Er stellte sich Otto vor, wie er in seiner ein wenig massiven Überseeereleganz durch den Brüsseler Saal ging und seine Bilder betrachtete, seine besten Bilder, und für einen Augenblick freute er sich herzlich, daß er sie zu jener Ausstellung hergegeben hatte, obwohl nur wenige davon noch verkäuflich waren. Und er schrieb sofort ein Billett nach Antwerpen.
„Er weiß noch alles,“ dachte er dankbar, „es stimmt, wir haben das letztemal fast nur Mosel getrunken, und einen Abend haben wir sogar richtig gezecht.“
Er dachte nach und fand, es sei gewiß kein Moselwein mehr im Keller, den er selbst sehr selten besuchte, und er beschloß, noch heute eine Sendung zu bestellen.
Nun setzte er sich aufs neue vor die Arbeit, fand sich aber zerstreut und innerlich unruhig und kam nicht wieder zur reinen Konzentration, bei welcher die guten Einfälle ungerufen dastehen. So stellte er die Pinsel in einen Becher, steckte den Brief seines Freundes zu sich und schlenderte mit unentschlossenen Schritten ins Freie hinaus. Der See blitzte ihm mit heftiger Spiegelung entgegen, es war ein wolkenloser Sommertag aufgegangen und der durchsonnte Park hallte von vielen Vogelstimmen wider.
Er sah auf die Uhr. Pierres Morgenlektionen mußten vorüber sein. Und er strich ziellos durch den Park, blickte zerstreut die braunen, mit Sonnenflecken bedeckten Wege entlang, horchte nach dem Hause hinüber, ging an Pierres Spielplatz mit der Schaukel und dem Sandhaufen vorbei. Schließlich kam er in die Nähe des Küchengartens und schaute mit flüchtigem Interesse in die hohen Kronen der Roßkastanien hinauf, auf deren schattentiefen Blättermassen die letzten freudig hellen Blütenkerzen standen. Bienen schwärmten mit wellig leisem Geläute um die vielen halboffenen Rosenknospen der Gartenhecke, durch das dunkle Laub der Bäume her tat die frohe kleine Turmuhr des Herrschaftshauses ein paar Schläge. Sie schlug falsch, und Veraguth dachte wieder an Pierre, dessen höchster Wunsch und Ehrgeiz es war, später einmal, wenn er größer wäre, das alte Schlagwerk wieder in Ordnung zu bringen.
Da hörte er jenseits der Hecke Stimmen und Schritte, die in der sonnigen Gartenluft mit Bienensummen und Vogelrufen, mit dem träge hinziehenden Duft der Buschnelkenrabatte und der Bohnenblüten gedämpft und zart zusammenklangen. Es war seine Frau mit Pierre, und er blieb stehen und lauschte aufmerksam hinüber.
„Sie sind noch nicht reif, du mußt noch ein paar Tage warten,“ hörte er die Mutter sagen.
Ein lachendes Gezwitscher der Knabenstimme gab Antwort, und die friedevolle grüne Gartenwelt und das sanft tönende verwehte Kindergespräch in der erwartungsvollen Sommerstille klang dem Manne einen flüchtig zarten Augenblick lang wie aus dem fernen Garten der eigenen Kindheit herüber. Er trat an die Hecke und spähte zwischen den Ranken hindurch in den Garten, wo seine Frau im Morgenkleid auf dem sonnigen Wege stand, eine Blumenschere in der Hand und einen braunen leichten Korb am Arm. Sie war kaum zwanzig Schritte von der Hecke entfernt.
Der Maler betrachtete sie einen Augenblick. Die große Gestalt mit dem ernsthaften und enttäuschten Frauengesicht bückte sich über die Blumen, der große schlaffe Strohhut beschattete das ganze Gesicht.
„Wie heißen die Blumen da?“ fragte Pierre. In seinen braunen Haaren spielte das Licht, die nackten Beine standen mager und sonnenbraun in der Helle, und wenn er sich bückte, sah man im weiten Ausschnitt seiner Bluse unter dem braungebrannten Nacken die weiße Haut des Rückens hervorschimmern.
„Buschnelken,“ sagte die Mutter.
„Ja, das weiß ich,“ fuhr Pierre fort, „aber ich muß wissen, wie die Bienen zu ihnen sagen. In der Bienensprache müssen sie doch auch einen Namen haben.“
„Gewiß, aber den kann man nicht wissen, den wissen nur die Bienen selber. Vielleicht heißen sie sie Honigblumen.“
Pierre dachte nach.
„Das ist nichts,“ entschied er dann. „Im Klee finden sie gerade soviel Honig, und in den Kapuzinern auch, und sie können doch nicht für alle Blumen den gleichen Namen haben.“
Aufmerksam sah der Knabe einer Biene zu, die einen Nelkenkelch umflog, mit surrenden Flügeln davor in der Luft stillhielt und dann begierig in die rosige Höhlung eindrang.
„Honigblumen!“ dachte er geringschätzig und schwieg. Er hatte es längst erfahren, daß man gerade die hübschesten und interessantesten Dinge nicht wissen und erklären kann.
Veraguth stand hinter der Hecke und hörte zu, er betrachtete das ruhige, ernsthafte Gesicht seiner Frau und das schöne, frühreif zarte seines Lieblings, und sein Herz versteinerte sich bei dem Gedanken an die Sommer, in denen sein erster Sohn noch solch ein Kind gewesen war. Den hatte er verloren, und die Mutter auch. Aber diesen Kleinen wollte er nicht verlieren, ihn nicht. Er wollte ihn als Dieb hinterm Zaun belauschen, er wollte ihn locken und an sich ziehen, und wenn auch dieser Knabe sich von ihm abwenden würde, dann wollte er nicht mehr leben.
Leise zog er sich über den grasigen Weg zurück und ging unter den Bäumen davon.
„Das Bummeln ist nichts für mich,“ dachte er ärgerlich und machte sich hart. Er ging an seine Arbeit zurück und fand denn auch, die Unlust überwindend und einer jahrelang gepflegten Übung gehorchend, die gespannte Arbeitsstimmung wieder, die sich keine Nebenwege erlaubt und alle Kräfte nur auf das augenblicklich Gewollte richtet.
Er war drüben zu Tische erwartet und kleidete sich gegen Mittag sorgfältig um. Rasiert, gebürstet und im blauen Sommeranzug sah er zwar nicht jünger, doch frischer und elastischer aus als im verwahrlosten Atelierkleid. Er griff nach dem Strohhut und wollte eben die Türe öffnen, als sie ihm entgegen sich auftat und Pierre hereinkam.
Veraguth bückte sich zu dem Knabenkopf hinab und küßte ihn auf die Stirn.
„Wie geht’s, Pierre? War der Lehrer brav?“
„O ja, er ist nur so langweilig. Wenn er eine Geschichte erzählt, ist es gar nicht zum Lustigsein, sondern auch bloß eine Lektion, und am Schluß kommt immer, daß gute Kinder sich soundso benehmen müssen. – Hast du gemalt, Papa?“
„Ja, an den Fischen, weißt du. Das ist bald fertig, und morgen darfst du es sehen.“
Er nahm des Knaben Hand und ging mit ihm hinaus. Nichts in der Welt tat ihm so wohl und rührte alle versunkene Güte und hilflose Zartheit so in ihm auf wie das Gefühl, neben dem Jungen zu gehen, den Schritt seinen kleinen Schritten anzupassen und die leichte, zutrauliche Kinderhand in seiner zu fühlen.