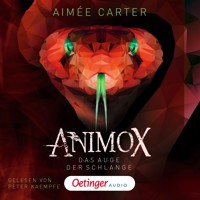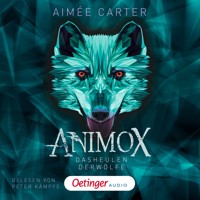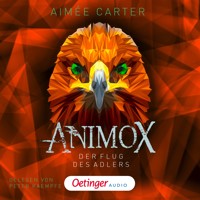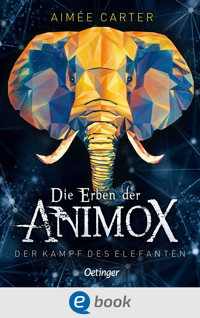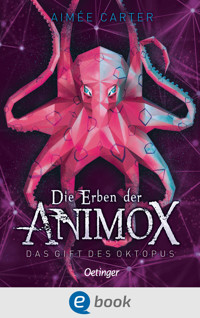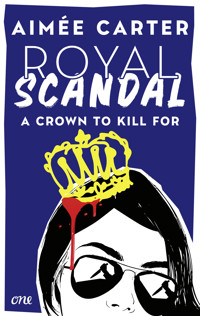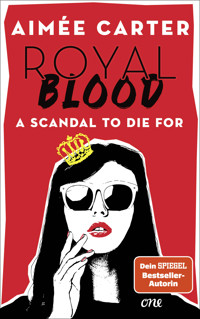
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Royal Blood
- Sprache: Deutsch
Evangeline ist 17, Amerikanerin - und die illegitime Tochter des britischen Königs. Als sie vom Internat fliegt, muss Evan nach Schloss Windsor, wo sie die Zeit bis zu ihrem achtzehnten Geburtstag möglichst skandalfrei verbringen soll. Ihr Empfang fällt alles andere als herzlich aus. Als nach einer Party auch noch ein junger Adeliger tot aufgefunden wird und man Evan verdächtigt, ihn ermordet zu haben, steht das Königshaus vor einer Zerreißprobe. Zusammen mit dem gleichaltrigen Kit versucht sie herauszufinden, was wirklich passiert ist - und stößt dabei auf Geheimnisse, die skandalöser sind, als sie sich je hätte ausmalen können. Geheimnisse, die die Monarchie für immer verändern könnten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
INHALT
ÜBER DAS BUCH
Evangeline ist 17, Amerikanerin – und die illegitime Tochter des britischen Königs. Als sie vom Internat fliegt, muss Evan nach Schloss Windsor, wo sie die Zeit bis zu ihrem achtzehnten Geburtstag möglichst skandalfrei verbringen soll. Ihr Empfang fällt alles andere als herzlich aus. Als nach einer Party auch noch ein junger Adeliger tot aufgefunden wird und man Evan verdächtigt, ihn ermordet zu haben, steht das Königshaus vor einer Zerreißprobe. Zusammen mit dem gleichaltrigen Kit versucht sie herauszufinden, was wirklich passiert ist – und stößt dabei auf Geheimnisse, die skandalöser sind, als sie sich je hätte ausmalen können. Geheimnisse, die die Monarchie für immer verändern könnten …
ÜBER DIE AUTORIN
Aimée Carter ist preisgekrönte Autorin von mehr als einem Dutzend Büchern. Mit der Kinderbuchreihe ANIMOX eroberte sie die Bestsellerlisten im Sturm. ROYAL BLOOD ist der Auftakt einer königlichen YA-Reihe, die in deutscher Übersetzung bei ONE erscheint.
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Royal Blood«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2023 by Aimée Carter
Published by arrangement with Aimée Carter
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2023 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln
Textredaktion: Kerstin Ostendorf
Umschlaggestaltung: Kristin Pang
Umschlagmotiv: © Usborne Publishing Limited, 2023
Titelbilder: © Shutterstock/Dean Drobot; Shutterstock/
Subbotina Anna; Shutterstock/AVS-Images
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-4835-3
one-verlag.de
luebbe.de
lesejury.de
FÜR RO UND ALLISON
1. KAPITEL
König zu sein und eine Krone zu tragen ist herrlicher für die, die sie sehen, als angenehm für die, die sie tragen.
– Queen Elizabeth (geb. 1533, reg. 1558–1603)
In den Lehrertrakt der St. Edith’s Akademie für Mädchen einzubrechen ist vielleicht nicht das Leichtsinnigste, was ich je getan habe, aber es ist ziemlich nah dran.
Was das Ganze so außerordentlich verantwortungslos macht, ist, dass ich in einer Woche meinen Abschluss habe. Nur noch eine Woche, und dann ist dieser Albtraum, den ich die letzten sechs Jahre meines Lebens durchstehen musste, endlich vorbei, und ich muss nie wieder einen Fuß in ein Internat setzen. Wenn ich klug wäre, wäre ich in meinem Zimmer geblieben, in dem meine Zimmergenossin leise in ihr Kissen heult und offenbar denkt, ich könne sie nicht hören. Aber mir eilt nun einmal nicht der Ruf voraus, dass ich klug bin, und ich kann jetzt doch nicht auf einmal alle Erwartungen über den Haufen werfen.
Und so kommt es, dass ich um zehn Uhr am Montagabend in rabenschwarzer Nacht den fensterlosen Flur entlangschleiche, während ich mit den Fingern jeden Türgriff abtaste, an dem ich vorbeikomme. Die Dunkelheit macht es mir zwar schwer, mich fortzubewegen, ohne ständig an Wände und Türen zu stoßen, aber sie hilft mir auch dabei, versteckt zu bleiben. Die uralte Überwachungskamera – das einzige technische Gerät, das in St. Edith’s heiligen Hallen erlaubt ist – habe ich bereits ausgestöpselt, aber es besteht immer noch die Möglichkeit, dass ein Hausmeister in irgendeinem leeren Klassenzimmer herumlungert. Egal, wie gut mein Plan ist, manchmal haben andere Leute einfach mehr Glück.
Vor der fünften Tür links bleibe ich stehen und krame in meiner Tasche. Die Dietriche waren letztes Jahr ein Weihnachtsgeschenk an mich selbst; bis jetzt hatte ich allerdings noch keine Gelegenheit, sie an einer Tür auszuprobieren, die nicht zu meinem eigenen Schlafzimmer führt. Während ich den Schließmechanismus mit dem Spanner festhalte und jeden der kleinen Stifte mit dem Dietrich anhebe, durchfährt mich vor Aufregung ein Schauer. Wenn Rektorin Thompson wüsste, was ich in meinen kleinen Privatstunden alles gelernt habe, während die anderen Schülerinnen sich um ihre Aufnahme bei Harvard und Yale bemühten, würde sie vermutlich spontan in Flammen aufgehen – aber das hier ist definitiv das Wichtigste, was ich gelernt habe, seit ich im Januar auf St. Edith’s angekommen bin.
Unerwartet schnell schnappt das Schloss auf, und vor Überraschung lasse ich beinahe mein Werkzeug fallen. Ich hab’s geschafft – ich habe ein echtes Schloss geknackt. Zwar werde ich dafür keinen Preis gewinnen, aber ich fühle mich wie eine Superheldin, als ich im Adrenalinrausch die Tür aufdrücke.
Knarz.
Die Türangeln beschweren sich lautstark, und ich erstarre. Über meinen donnernden Herzschlag hinweg versuche ich zu hören, ob irgendwer das Geräusch bemerkt hat und auf dem Weg ist, um nach dem Rechten zu sehen.
Stille.
Schweißgebadet schlüpfe ich in das Klassenzimmer. Mathe, das war noch nie mein Lieblingsfach. Wenn man versucht, ausgedachten Zahlen oder unendlich kleinen und großen Werten mit Logik zu begegnen, werden die Regeln schnell unklar – und ich mag es lieber, wenn ich die Regeln genau kenne. Ich habe mir die Schulregeln von St. Edith’s – und auch die der acht anderen Internate, auf denen ich war, seit ich elf war – genaustens durchgelesen, und im Notfall kann ich ganze Paragrafen auswendig herunterleiern. Wenn man die Regeln kennt, ist es nämlich einfacher, sie zurechtzubiegen. Und sie so spektakulär wie möglich zu brechen.
Der Mond scheint durch die Farbglasfenster und zeichnet ein buntes Mandala auf den dunklen Boden, während ich auf das Lehrerpult zu schleiche. Mr. Clark ist kein schlechter Mensch. Er gehört einfach nur einem veralteten System an, in dem Testergebnisse über tatsächlichem Lernerfolg stehen, genauso wie ich einem System angehöre, das mich die letzten fünf Monate im hintersten Vermont festgesetzt hat, weil es Presse-Image über Familie stellt. Wir sind beide nur Opfer unserer Umstände, und ich fühle mich jetzt schon schuldig für das, was ich gleich tun werde. Wenn es einen besseren Ausweg gäbe, würde ich ihn nehmen, aber den gibt es nun mal nicht.
Die Schublade im Pult ist auch abgeschlossen, aber ich knacke das Schloss in unter dreißig Sekunden. Und da, halb begraben unter Bleistiftstummeln und einzelnen Büroklammern, liegt der dunkelgrüne Schatz, nach dem ich gesucht habe.
Das Notenbuch.
Ich brauche nicht lange, um die richtige Seite zu finden, und reiße sie mit einem befriedigenden Geräusch aus dem Buch, bevor ich ein Feuerzeug zücke. Die fast schon furchtsame Verachtung von Technologie, die auf St. Edith’s herrscht, hat mir zwar oft das Leben schwergemacht, aber in diesem Moment kommt sie mir zugute.
Das Papier verfärbt und kringelt sich in der Flamme und lässt nur graue Ascheflocken zurück. Ich bin zwar normalerweise keine Brandstifterin, aber ich kann nicht leugnen, dass es ziemlich poetisch ist, wie die ganze harte Arbeit eines Semesters sich in Sekundenschnelle einfach in Rauch auflöst. Nichts ist für immer. Noch nicht einmal Abschlussnoten.
»Evangeline Bright! Was im Himmel tust du da gerade?«
Summend schalten sich die Neonröhren an der Decke an, und ich zucke schuldbewusst zusammen. Rektorin Thompson steht im Türrahmen, mit Lockenwicklern im Haar und puterrotem Gesicht. Ich habe sie noch nie etwas anderes als einen Tweedrock mit passender Jacke tragen gesehen, und eine Sekunde lang bin ich so fasziniert von ihrem abgetragenen rosa Bademantel, dass ich ganz vergesse, was gerade passiert.
»Mach das aus«, verlangt sie mit zitternder Stimme. »Mach sofort das Feuer aus, Evangeline!«
»Das würde ich ja«, antworte ich langsam. »Aber jetzt bin ich eh schon dabei, wissen Sie? Und es ist ja nur eine Seite, die wird Mr. Clark ja wohl kaum … Autsch!«
Die Flammen haben meine Fingerspitzen erreicht, und mit einem Schmerzensschrei lasse ich den Rest der brennenden Seite fallen. Rektorin Thompson und ich sehen ihr dabei zu, wie sie auf den Schreibtisch hinunterschwebt – und direkt auf dem offenen Notenbuch landet.
In Sekundenschnelle gehen die Mathenoten der gesamten Schule in Flammen auf.
Rektorin Thompson ringt nach Luft, und hektische Flecken breiten sich auf ihrem Gesicht aus. »Der Feuerlöscher! Wo …«
Doch während sie in den Flur stürzt und dabei ihre Lockenwickler festhält, bleibe ich wie angewurzelt vor dem Pult stehen. Keine Ahnung, ob das der Schock ist oder ob mein Unterbewusstsein versucht, sich von dem, was gerade passiert, abzugrenzen. So oder so stehe ich nur da und sehe zu, wie die Flammen immer höher tanzen, bis sie schließlich auf das trockene Holz von Mr. Clarks Pult überspringen.
Mist. Verdammter Mist.
Panisch reiße ich mir die Strickjacke vom Leib und versuche, damit die Flammen zu ersticken, aber ich erreiche nur, dass die Jacke Feuer fängt. Ein Funke fällt auf meinen Rock, und mit hämmerndem Herzen schlage ich ihn gerade noch rechtzeitig aus.
Ich wollte doch nur die eine Seite verbrennen.
»Evangeline!«, bellt Rektorin Thompson vom Türrahmen aus. »Komm da sofort weg!«
»Aber …«, setze ich an und bin mir selbst nicht ganz sicher, ob ich mich entschuldigen oder darauf bestehen will, das Feuer mit meiner Strickjacke zu bändigen, aber es ist bereits zu spät. Rektorin Thompson hetzt durch den immer dichter werdenden Rauch, packt mich am Ellbogen und zieht mich in den Flur.
Das laute Rauschen in meinen Ohren übertönt das, was sie mir zuruft, und als sie mich den dunklen Flur entlang zum Treppenhaus zerrt, werfe ich über die Schulter einen letzten Blick ins Klassenzimmer. Das Feuer breitet sich jetzt so schnell aus, dass auch ein Feuerlöscher keine große Hilfe mehr wäre. Mir fällt auf, dass der steinalte Feueralarm genauso klingt wie die Schulglocke. Ich weiß zwar nicht viel über Gebäudesicherheit, aber das scheint mir nicht besonders gut durchdacht zu sein.
Endlich schiebt Rektorin Thompson mich durch den Seitenausgang in die kühle Nacht hinaus. Ich ringe nach Luft und stolpere mit brennender Lunge und tränenden Augen über den Rasen. Wir drehen uns gleichzeitig zum Gebäude um und sehen mit offenen Mündern dabei zu, wie das Farbglasfenster in Mr. Clarks Klassenzimmer in einem regenbogenbunten Hagel zersplittert.
Na, wenigstens ist es spektakulär.
2. KAPITEL
Aufgepasst, Großbritannien! In weniger als einem Monat wird Prinzessin Mary achtzehn, und damit sind auch die Presseeinschränkungen, die für noch nicht volljährige Mitglieder der Königsfamilie gelten, aufgehoben. Die Welt brennt auf Neuigkeiten: Was für Geschichten und Gerüchte werden wir wohl aufstöbern? Ist unsere mysteriöse zukünftige Königin dafür bereit, von allen Seiten beäugt und beobachtet zu werden, nachdem sie ihr bisheriges Leben lang vor den gierigen Augen der Medien beschützt wurde?
In den kommenden Wochen werden wir sicherlich viel von ihr hören, da Ihre Majestät wohl bereits ihre Schulabschlussprüfungen hinter sich hat. Damit steht ihrem großen Auftritt auf der sozialen Bühne dieser Saison nichts mehr im Weg. Events wie Trooping the Colour (der Geburtstagsumzug für den König), das Royal-Ascot-Pferderennen und das Tennisturnier in Wimbledon – laut unseren Quellen wird sie sich bei allen zeigen.
Was wird sie anhaben? Ist ein Date im Spiel? Und, was am wichtigsten ist: Wie lange wird es wohl dauern, bis unsere geliebte Prinzessin ihren ersten königlichen Skandal verursacht?
– The Regal Record, 6. Juni 2023
Als die Tür des Befragungszimmers sich zum ersten Mal seit Stunden öffnet, reiße ich den Blick nur mit Mühe von meinem übermüdeten Spiegelbild los, das von der anderen Seite des Einwegspiegels vermutlich auch nicht viel besser aussieht.
Ein bulliger Polizeibeamter steht im Türrahmen, seine ohnehin schon knittrige Stirn in tiefe Falten gelegt. Unsere Blicke treffen sich, und obwohl mir vor Müdigkeit und Angst schon ganz schlecht ist, bleibt mein Gesichtsausdruck betont neutral. Natürlich habe ich ohne die Gegenwart eines Anwalts kein Wort gesagt, aber das bedeutet auch, dass die gesamte winzige Polizeistation des Dorfes, neben dem St. Edith’s liegt, Rektorin Thompsons extrem dramatische Version dessen glaubt, was in Mr. Clarks Klassenzimmer vorgefallen ist. Ich bin zwar noch nicht in den Genuss der zweifellos spannenden Geschichte gekommen, aber wenn ich die Lautstärke der Jammerlaute bedenke, die gestern Nacht aus dem Befragungszimmer erklangen, in dem Rektorin Thompson ihre Aussage abgab, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich darin glimpflich davonkomme.
Ich bereite mich mental auf eine weitere Salve von Fragen vor, die ich nicht beantworten werde, aber stattdessen verschränkt der Polizist die Arme vor der breiten Brust. »Evangeline Bright«, knurrt er. »Sie dürfen gehen.«
Mit offenem Mund starre ich ihn an und frage mich, ob mit meinen Ohren irgendwas nicht stimmt. Nachdem ich fast zehn Stunden in diesem Raum verbracht habe, mit nichts als einem Wasserbecher aus Plastik und einer tickenden Uhr neben mir, habe ich eher Handschellen und einen Gerichtsbescheid erwartet. Aber bevor ich mich von meinem Schock erholen und dumme Fragen stellen kann, tritt der Polizist einen Schritt zur Seite. Hinter ihm steht ein englischer Herr mit Halbglatze und einem kurzen, grauen Bart. Auf einmal ergibt alles einen Sinn.
»Jenkins!« Ich springe auf, obwohl jeder Muskel meines Körpers nach der Nacht auf dem unbequemen Plastikstuhl dagegen protestiert. »Die Beamten haben gesagt, dass sie dich nicht erreichen konnten …«
»Deine Schulleiterin war schneller«, antwortet er und läuft an dem Polizisten vorbei, als existiere er überhaupt nicht. »Als sie mich angerufen haben, war ich schon im Flugzeug. Geht es dir gut? Wann hast du das letzte Mal etwas gegessen oder getrunken?«
Ich schüttele den Kopf, und mir wird plötzlich bewusst, dass mein Mund wie eine alte Socke schmeckt. »Keine Ahnung. Egal. Was ist …«
»Sie haben eine Minderjährige die ganze Nacht lang ohne Verpflegung in einem Befragungszimmer sitzen lassen?«, fährt Jenkins den Polizisten an. »Wurde sie ärztlich behandelt? Oder ist Ihnen nicht in den Sinn gekommen, dass sie durch die Rauchinhalation zu Schaden hätte kommen können?«
Jenkins’ Statur ist zwar ungefähr so einschüchternd wie die eines neugeborenen Kätzchens, aber trotzdem hätte ich schwören können, dass der Polizist zusammenzuckt. »War nicht meine Schicht«, grunzt er. »Da müssen Sie den Kommissar fragen.«
Jenkins wirft ihm einen so vernichtenden Blick zu, dass ich trotz allem, was passiert ist, ein Grinsen unterdrücken muss. »Das werde ich sofort tun«, antwortet er hoheitsvoll. »Im Gegensatz zu Ihnen und Ihren Kollegen nehme ich meine Pflichten ernst.«
Jetzt, da es nicht mehr mitten in der Nacht ist, ist auf der Polizeistation die Hölle los, aber Jenkins befördert mich mit einem Tempo zum Ausgang, das andeutet, dass jeder, der es wagt, uns im Weg zu stehen, kurzerhand umgerannt wird. Ich kann spüren, wie alle Blicke auf uns landen. Auf mir. Und ich weiß genau, was sich alle fragen.
Wer zum Teufel ist sie?
Vor der Polizeistation steht ein schwarzer Jeep, und ein Fahrer mit einem Pistolenholster und einem Walkie-Talkie nickt uns zu, als wir ins Sonnenlicht hinaustreten. Sobald wir uns in der mittleren Sitzreihe niedergelassen haben, schließt er fest die Tür hinter uns, und Jenkins seufzt.
»Eine richtige Straftat diesmal. Ich bin beeindruckt, Evan.«
»Ich versuche doch immer, deine Erwartungen zu übertreffen«, entgegne ich, doch ein strenger Blick von Jenkins lässt mich verstummen. »Tut mir leid. Eigentlich sollte es nur die eine Seite aus dem Notenbuch sein, aber Rektorin Thompson …«
»Ist dir klar, was passiert, sollte die Polizei Anklage gegen dich erheben?«, unterbricht Jenkins mich, und obwohl seine Stimme ruhig bleibt, lässt mich sein Tonfall schaudern. »Fünf Jahre. So viel kann man hier für Brandstiftung bekommen. Fünf Jahre deines Lebens, einfach weg, nur, weil du eine unbedachte Entscheidung getroffen hast.«
»Aber … das war doch alles ein Versehen«, flüstere ich kleinlaut. »Ich wollte nicht …«
»Vor Gericht sind deine Beweggründe egal, da geht es nur um die Konsequenzen deiner Handlungen.« Jenkins schüttelt den Kopf. »Ich habe mich immer vor dem Tag gefürchtet, an dem du in Schwierigkeiten gerätst, aus denen ich dir nicht einfach heraushelfen kann. Und jetzt ist es so weit.«
Der Motor springt an, und ich starre auf meine gebleichten Haarspitzen, die trotz aller Anstrengungen auch ein Jahr später noch leicht grünlich schimmern. »Wenn ich Mary wäre, würde kein Gericht der Welt mich verurteilen«, murmele ich.
»Das stimmt vielleicht«, antwortet Jenkins etwas sanfter. »Aber du bist nun einmal nicht Ihre Majestät. Du bist du, und damit musst du dich abfinden.«
»Aber … Ich bin auch seine Tochter«, entgegne ich. Ich hasse es, wie meine Stimme bei dem Satz zittert. »Nicht, dass ihn das kümmert.«
Kurz herrscht Stille, und ich spüre Jenkins’ Blick auf mir, während ich weiter an meinen Haarspitzen herumspiele. »Ich habe dein Gepäck von St. Edith’s abholen lassen«, sagt er schließlich. »Deine Zimmergenossin war offenbar äußerst hilfreich.«
»Prisha ist eine der Guten«, murmele ich. Sie hat es mir nie übel genommen, dass ich die Distanz zwischen uns aufrechterhalten habe.
»Der Kurier hat uns am Flughafen abgefangen«, sagt Jenkins und holt etwas aus seiner Innentasche. »Miss Kapoor bestand offenbar darauf, dass ich dir das hier persönlich übergebe.«
Er hält mir einen Umschlag hin, auf dem in Prishas schnörkeliger Schreibschrift (die auf St. Edith’s Pflicht ist) mein Name steht. Misstrauisch nehme ich ihn entgegen und stelle fest, dass er nicht nur Papier enthält.
Mit gerunzelter Stirn öffne ich den Umschlag, und ein Armband aus Platin mit einem einzelnen Anhänger in Form einer Musiknote gleitet heraus. Ich erkenne es sofort. Die ganzen fünf Monate, die wir Zimmergenossinnen waren, habe ich Prisha nie ohne dieses Armband gesehen.
»Das gehört mir nicht«, sage ich verwirrt und fische ein gefaltetes Blatt aus dem Umschlag. Ich erwarte einen Brief, aber Prisha hat nur ein Wort geschrieben.
Danke.
Das war’s. Kein Gruß, keine Unterschrift, gar nichts. Nur ihr Dank.
Ich starre das einzelne Wort an, und meine Brust fühlt sich plötzlich eng an. Prisha und ich waren uns nie besonders nahe. Wir kommen miteinander zurecht – ich habe schon vor Jahren gelernt, dass man sich besser nicht mit Menschen anlegt, mit denen man sich ein Zimmer teilen muss –, und ab und zu helfen wir uns gegenseitig bei den Hausaufgaben. Aber wir sitzen nicht beim Essen nebeneinander oder verbringen unsere Freizeit zusammen und haben nie unsere Social-Media-Adressen oder -Nutzernamen ausgetauscht (nicht, dass ich überhaupt irgendwelche sozialen Medien benutzen würde), weil wir nie wirklich befreundet waren. Wir existieren einfach nur am selben Ort, denn so muss es sein. So muss es immer sein.
Aber als ich das Blatt wieder zusammenfalte und in den Umschlag stecke, frage ich mich, wie es wohl wäre, wenn die Dinge anders lägen. Wenn ich Prishas Einladungen angenommen und Zeit mit ihr und ihren Freunden verbracht hätte oder wenn wir über mehr als nur Essays und Hausaufgaben geredet hätten. Aber das ändert nichts an der Realität, und ich zwinge mich, dem Gedanken nicht weiter nachzugehen. Besser, gar nicht erst zu fantasieren. Das bringt eh nichts.
Stattdessen konzentriere ich mich darauf, das Armband an meinem Handgelenk zu befestigen. Ich kann mich kaum daran erinnern, wann ich das letzte Mal ein Geschenk bekommen habe – ein richtiges Geschenk, nicht nur etwas, das irgendein Angestellter ausgesucht hat. Mein Vater schickt mir ab und zu teuren Schmuck oder Kaschmirpullover, und zu meinem zwölften Geburtstag hat er mir sogar einen Tiger gekauft, der im Londoner Zoo lebt. Aber wenn man bedenkt, dass ich Seine Majestät noch nie zu Gesicht bekommen habe, fühlt sich das Ganze eher nach Bestechung an. Bestechung dafür, dass ich den Mund halte. Dass ich mich benehme. Dass ich ihn nicht noch mehr blamiere, als es meine bloße Existenz eh schon tut.
»Ich habe heute Morgen mit deinem Mathematiklehrer Mr. Clark gesprochen«, bemerkt Jenkins, als wir auf den Highway fahren. »Er sagte mir, dass du in deiner Abschlussprüfung nur einen einzigen Fehler gemacht hast und dass du eine seiner besten Schülerinnen warst.«
»Natürlich war ich das, dafür habe ich teuer Geld bezahlt«, witzele ich.
Jenkins ignoriert mich. »Er erwähnte auch, dass deine Zimmergenossin die Prüfung nicht bestanden hat und sie Gefahr lief, ihren Platz an der Dartmouth-Universität zu verlieren.«
Ich zucke mit den Schultern und lasse einen Finger über den Notenanhänger gleiten. »Das erklärt wohl, warum sie ständig geweint hat.«
Jenkins tätschelt mir das Knie, wie es ein liebevoller Großvater tun würde. Oder zumindest so, wie ich mir einen liebevollen Großvater vorstelle. »Du bist ein guter Mensch, Evan. Schade, dass du das von dir selbst nicht glaubst.«
»Du bist der Einzige, der das glaubt«, flüstere ich so leise, dass ich mir nicht sicher bin, ob er mich überhaupt hört.
Eine Weile lang schweigen wir beide. Er versucht nicht, die Stille zu durchbrechen, und ich genauso wenig, aber seine Gegenwart ist trotzdem beruhigend. Trotz allem, was gestern Nacht passiert ist, habe ich zum ersten Mal seit meiner Ankunft auf St. Edith’s das Gefühl, wieder durchatmen zu können. Ich glaube, ihm ist bewusst, dass er diese Wirkung auf mich hat. Er hätte einfach jemand anderen schicken können, um mich abzuholen, vielleicht jemanden, der nicht auf der anderen Seite des Atlantiks wohnt, aber egal, wie viel Chaos ich stifte – oder, in diesem Fall, wie teuer die Kaution ist –, er ist immer da.
»Ich muss mein letztes Schuljahr jetzt nicht wiederholen, oder?«, frage ich, obwohl ich Angst vor der Antwort habe.
Jenkins zieht eine Augenbraue hoch. »Wenn man bedenkt, dass du gerade die Nacht in einem Verhörzimmer verbracht hast, solltest du dir um ganz andere Dinge Sorgen machen. Aber …« – er zieht das Wort in die Länge – »da du ansonsten eine tadellose Schülerin warst, bin ich optimistisch, dass ich mit etwas Erpressung und finanziellem Anreiz deine Schulleiterin davon überzeugen kann, dir ein Abschlusszeugnis auszustellen.«
»Erpressung?«, wiederhole ich argwöhnisch. Jenkins mag zwar dazu bereit sein, fast alles für seinen geliebten König zu tun, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich meinetwegen strafbar machen würde.
»Oder so ähnlich«, antwortet er. »Soweit ich weiß, hat nur ein einziges Klassenzimmer größere Schäden davongetragen. Und die hätten verhindert werden können, wenn im Flur ein Feuerlöscher vorhanden gewesen wäre. Außerdem sind da natürlich die potenziellen Langzeitfolgen der Rauchinhalation. Ich habe bereits eine Ärztin zum Flughafen bestellt, nur zur Sicherheit.«
»Mir geht’s gut«, protestiere ich, aber er wedelt nur mit der Hand.
»Verletzungen würden uns nur helfen, sowohl mit der Schule als auch mit diesen inkompetenten Idioten, die sich Polizeibeamte schimpfen.«
Wenn ich an Rektorin Thompsons Gesichtsausdruck denke, als wir hilflos dabei zusahen, wie das Feuer sich in Mr. Clarks Klassenzimmer ausbreitete, bezweifle ich stark, dass sie sich von so etwas umstimmen lassen würde. »Ich gehe nie wieder auf ein Internat, ganz egal, wie sie sich entscheidet«, verkünde ich. »Zur Not hole ich meinen Abschluss später nach, aber im Moment habe ich einfach genug.«
»Darling, du hast gerade eine Straftat begangen«, antwortet Jenkins spitz. »Selbst ich würde vermutlich kein Internat im ganzen Land finden, das dich noch aufnehmen würde.«
Erleichterung durchflutet mich, und endlich entspannen sich meine Muskeln. Ich lasse den Kopf an die Rücksitzlehne sinken. »Heißt das, dass ich endlich nach Hause darf?«
Jenkins zögert einen Augenblick zu lang, und der Funken Hoffnung, der in mir erglüht ist, stirbt sofort wieder. Die Antwort lautet immer »Nein«, egal, wie die Umstände sind. In den sechseinhalb Jahren, seitdem Seiner Majestät das Sorgerecht für mich übertragen wurde, hat er mir nie auch nur eine Sekunde lang die Kontrolle über mein eigenes Leben gegönnt. Wie naiv von mir, zu glauben, dass es diesmal anders wäre.
Ich seufze resigniert. »Darf ich wenigstens wissen, wo Alexander mich diesmal hinschickt?«
»Es wird auf jeden Fall besser sein, als ins Gefängnis zu gehen«, antwortet Jenkins.
»Na ja«, murmele ich genervt. »Ich kann mir schlimmere Orte vorstellen.«
Er dreht sich zu mir, und kurz denke ich, dass er seine Hand nach mir ausstrecken will, aber dann lässt er es doch sein. »Evan, ich weiß, wie schwer die letzten Jahre für dich waren, aber ich kann dir versichern, dass Seine Majestät nur das Beste für dich im Sinn hat.«
Gestern hätte ich die Aussage mit einem bitteren Lachen quittiert, aber nach der vergangenen Nacht kann ich mir nur ein müdes Seufzen abringen. »Woher soll er wissen, was am besten für mich ist, wenn er mich gar nicht kennt? Selbst wenn ich direkt an ihm vorbeispazieren würde, würde er mich nicht erkennen. Ich bedeute ihm gar nichts, Jenkins. Für ihn bin ich nur jemand, dem er ab und zu einen Scheck schicken muss, und den Scheck schreibt er noch nicht einmal selbst.«
»Evan …«, beginnt Jenkins, und ich erkenne an seiner Stimme, dass er mir widersprechen will.
»Lass es gut sein, Jenkins«, unterbreche ich ihn leise. »Bitte. Er hatte tausend Gelegenheiten, mir zu zeigen, dass ich ihm wichtig bin, und er hat keine davon genutzt. Ich bin nicht Mary. Ich bin nicht seine Erbin. Er will mich nicht, und ich habe keine Lust, ständig daran erinnert zu werden. Sobald ich achtzehn bin, mache ich mich aus dem Staub, und dann muss er nicht mehr so tun, als wäre er mein Vater.« Und vielleicht kann ich dann auch endlich aufhören zu hoffen, er würde eines Tages doch beschließen, dass ich ihm wichtig bin. »So ist es besser.«
»Für wen soll das besser sein?«, fragt Jenkins. »Sollte die Polizei Anklage einreichen, haben wir genug Ressourcen, um dich zu beschützen.«
»Aber damit beschützt du nicht mich«, widerspreche ich. »Du beschützt ihn, falls irgendwer je rausfindet, wer ich wirklich bin. Damit ich ihn und die Königsfamilie nicht blamiere.«
Jenkins schaut mich lange an, und statt ihm in die Augen zu sehen, starre ich auf meinen abgesplitterten lila Nagellack. »Würdest du wirklich lieber ins Gefängnis gehen, als unsere Hilfe anzunehmen?«, fragt er schließlich.
Ich nicke. »Im Gegensatz zu ihm habe ich keine Angst, mich den Konsequenzen meiner Handlungen zu stellen.«
»Verstanden«, sagt Jenkins so leise, dass ich ihn kaum höre. Dann schweigen wir beide. Ich schließe die Augen und lehne den Kopf ans Fenster, während ich mit dem Notenanhänger herumspiele.
Fünfundzwanzig Tage. So lange hat Seine Majestät noch die Kontrolle über mein Leben, und egal, in welchen goldenen Käfig er mich diesmal steckt, am Ende dieser fünfundzwanzig Tage ist er mich endlich los.
3. KAPITEL
Alexander II.
Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Weitere Bedeutungen sind unter Alexander II. (Begriffsklärung) aufgeführt.
König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie der als Commonwealth Realms bezeichneten souveränen Staaten.
Herrschaft: 14. Mai 2001 – heute
Krönung: 7. Juni 2002
Vorgänger: Edward IX.
Erbin: Prinzessin Mary
Geboren: 18. Februar 1979, Windsor, Vereinigtes Königreich
Ehepartnerin: Königin Helene (verh. 2003)
Abkömmlinge: Prinzessin Mary Victoria Alexandra Elizabeth
Vollständiger
Name: Alexander Edward George Henry
Haus: Windsor
Vater: Edward IX.
Mutter: Constance Harington
Alexander II. (Alexander Edward George Henry, geboren am 18. Februar 1979) ist der König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie von 14 weiteren, als Commonwealth Realms bezeichneten souveränen Staaten.
Alexander wurde als erstes Kind des Prinzen und der Prinzessin von Wales (später König Edward IX. und Königin Constance) auf Schloss Windsor in Windsor geboren. Sein Großvater, Alexander I., bestieg sieben Jahre zuvor den Thron; somit war der junge Alexander Zweiter in der Thronfolge. Er besuchte das traditionsreiche Internat Eton und stellte eine Militärkarriere zurück, um einen Platz an der University of Oxford anzunehmen. Nach dem plötzlichen und unerwarteten Tod von Edward IX. im Jahre 2001 bestieg Alexander II. mit zweiundzwanzig Jahren den Thron. 2003 heiratete er Lady Helene Abbott-Montgomery, mit der er eine Tochter hat (Prinzessin Mary, geb. 1. Juli 2005).
Als Jenkins und ich an dem winzigen Privatflughafen ankommen, wartet der majestätisch glänzende Privatjet der Königsfamilie bereits auf dem Rollfeld. Ich lasse eine glücklicherweise kurze medizinische Untersuchung über mich ergehen, und sobald die Ärztin verkündet, dass mir außer ein bisschen Heiserkeit nichts fehlt, führt Jenkins mich zur Gangway, ohne eine Sekunde zu verlieren.
An Bord steuere ich sofort auf meinen Lieblingsplatz zu: einen von vier Ledersesseln mit verstellbarer Rückenlehne, auf deren Kopfteil das königliche Insigne AIIR prangt und die um einen üppigen Holztisch gruppiert sind. Als ich näher komme, entdecke ich auf der hochpolierten Tischplatte ein schmales, in silbernes Papier eingewickeltes Paket.
»Was ist das?«, frage ich. Schon vor Jahren habe gelernt, nie zu erwarten, dass irgendetwas in diesem Flugzeug für mich ist, aber das Paket sticht ziemlich hervor.
»Ein Geschenk zum Schulabschluss, das du dir eigentlich gar nicht verdient hast«, antwortet Jenkins streng, aber in seinen Augenwinkeln funkelt ein Lächeln. »Ich dachte, du könntest es vielleicht gebrauchen.«
Gespannt lasse ich mich auf meinem Stammplatz nieder und nehme das Paket in die Hand, um das Gewicht zu erspüren. Es ist überraschend schwer und trotz fehlender Schleife liebevoll verpackt. Etwas verwirrt ziehe ich das Klebeband ab, und als ich die Verpackung unter dem Papier erkenne, lasse ich das Geschenk beinahe fallen.
»Ein Laptop?«, keuche ich. »Aber ich dachte …«
»Jetzt, da St. Edith’s dir hoffentlich ein wenig Zurückhaltung im Thema internetfähige Geräte beigebracht hat, hoffe ich, dass du ihn im September für Universitätsarbeit gebrauchst, statt dich in Columbias internes Netzwerk einzuklinken«, sagt Jenkins, der immer noch im Gang steht. »Falls du bis dahin nicht längst in einer Gefängniszelle schmachtest.«
Ich lasse den Finger über die Verpackung gleiten. Nach monatelangem Internetentzug kann ich mein Glück kaum fassen. »Danke«, bringe ich heraus. »Ich habe dir schon fast verziehen, dass du mich auf dieses Internat geschickt hast. Fast.«
»Das hast du dir selbst eingebrockt, Darling«, antwortet Jenkins sanft. »Sei bitte so freundlich und belass es an der Universität bei Aufsätzen und Recherche. Wenigstens für meine Nerven.«
Das erinnert mich an etwas. »Ähm, ich … Ich habe den Platz an der Columbia abgelehnt.«
Normalerweise lässt sich Jenkins durch nichts aus der Ruhe bringen, aber das scheint ihn kalt zu erwischen. »Ach ja? Hast du dich doch für einen Auslandsaufenthalt entschieden?«
»Nein«, antworte ich. »Wenn ich achtzehn bin, will ich zu meiner Mom ziehen.«
Trotz meines Versuchs, Jenkins’ durchdringendem Blick auszuweichen, erwischt er mich doch für den Bruchteil einer Sekunde, und ich schaue schnell weg. Ich kann sein Mitleid gerade nicht ertragen, vor allem, weil er der Einzige ist, der weiß, wer ich wirklich bin – und wer ich nicht bin.
»Du bist intelligent, Evan«, sagt er schließlich. »Du solltest deine Bildung nicht vernachlässigen.«
»Dort gibt es auch eine Uni, und das Informatikprogramm soll gut sein.«
Jenkins’ Gesichtsausdruck ist angespannt, und ich weiß genau, was er gerade denkt. Dass eine Königstochter an irgendeiner drittrangigen Uni studieren will, ist fast lächerlich genug, um die Grundlage für eine Sitcom zu sein. »Evan«, seufzt Jenkins. »Dein Vater …«
»Hatte sechs Jahre Zeit, alles in meinem Leben zu zerstören, was mich glücklich gemacht hat, und das hat er auch gut hinbekommen. Aber jetzt bin ich dran. Und keine Sorge«, füge ich hinzu, als ich den Laptop beiseitelege, »ich bezahle die Uni auch selbst. Er muss keinen Cent für mich ausgeben.«
Statt mir noch weiter zu widersprechen, nickt Jenkins nur und geht zur Flugzeugküche, in der es immer genug Verpflegung gibt, um ein mittelgroßes Land eine ganze Woche lang zu versorgen. Während er sich Tee kocht – oder vielleicht auch Kaffee, wenn man die Nacht bedenkt, die wir gerade durchgestanden haben –, packe ich den Laptop aus und schalte ihn an. Jenkins hat bereits alles für mich eingestellt, und statt nachzusehen, was ich die letzten Monate bei Netflix verpasst habe, öffne ich VidChat.
Sofort begrüßt mich das Profilbild meiner Mutter, ein kreisrund ausgeschnittenes Foto, auf dem sie lächelt und das sie schon seit Jahren benutzt. Dank des Technikverbots auf St. Edith’s und Moms Abneigung gegen das Telefonieren habe ich seit Januar nicht mit ihr gesprochen. Ich atme tief durch und klicke auf den Anrufknopf. Mein Magen zieht sich bei dem Gedanken, ihr von meiner Verhaftung zu erzählen, schmerzhaft zusammen, und ich habe bereits beschlossen, einfach nichts zu sagen, als eine Fehlermeldung erscheint.
Keine Internetverbindung.
Mist. Während das Flugzeug auf dem Rollfeld an Geschwindigkeit aufnimmt, versuche ich es noch mal, aber es passiert immer noch nichts. Nach fünftausend Höhenmetern und mehreren gescheiterten Versuchen, eine Verbindung herzustellen, gebe ich schließlich auf und rolle mich stattdessen auf dem Sitz zusammen. Meine Enttäuschung wird zu Müdigkeit, und ich sage mir, dass Mom auch später noch da sein wird. Wir haben immerhin seit fünf Monaten nicht mehr gesprochen, da machen ein paar Stunden mehr auch nichts aus.
Als ich benommen und mit trockenem Mund aufwache, sind wir immer noch in der Luft. Blinzelnd reibe ich mir die Augen. »Wie spät ist es?«
»Kurz nach neun«, antwortet Jenkins, ohne von seinem Kreuzworträtsel aufzusehen. Er sitzt mir direkt gegenüber, obwohl es mindestens ein Dutzend freier Sitze und Sofas im Flugzeug gibt.
»Neun?«, wiederhole ich verwirrt und werfe einen Blick aus dem Fenster. Gerade geht die Sonne auf. Oder unter, keine Ahnung. Plötzlich wird mir vor Angst ganz flau. »Moment … Fliehen wir gerade echt über die Grenze?«
»Das müssen wir beide noch besprechen«, sagt Jenkins, und mein Magen zieht sich so schmerzhaft zusammen, dass mir übel wird.
»Ich kann meine Mutter nicht einfach zurücklassen«, bricht es aus mir heraus. »Bitte, Jenkins – es tut mir wirklich leid, aber mir ist es egal, ob ich angeklagt werde, okay? Ich will nicht so weit weg von meiner Mom sein. Bring mich bitte nicht nach Neuseeland oder … oder Malaysia oder …«
»Evan, Darling, glaubst du wirklich, dass dein Vater dich auf die andere Seite der Welt schicken würde?«, unterbricht Jenkins mich schockiert.
»Keine Ahnung«, murmele ich. Ich habe schließlich noch nie mit ihm gesprochen.
Jenkins lässt sein Kreuzworträtsel sinken. »Wie viele enge Freunde hast du?«
»Was hat das denn mit …«
»Antworte mir«, sagt er sanft. »Du hast in den letzten sechs Jahren neun Internate besucht. Wie viele Freunde hast du gefunden?«
»Ziemlich viele«, lüge ich. Jenkins schaut mich still an, und ich lasse den Zeigefinger über das Muster auf dem Holztisch gleiten. »Du bist mein Freund, oder? Und Prisha hasst mich offenbar doch nicht. Das macht zwei.«
Statt des vernichtenden Blicks, den ich erwartet hatte, setzt Jenkins einen grimmigen Gesichtsausdruck auf. »Ich muss mich bei dir entschuldigen«, sagt er. »Das ist alles meine Schuld.«
»Hä, was? Nein, ist es nicht.« Manchmal denke ich, dass er der Einzige ist, der an dieser Situation keine Schuld hat. »Aber … Was dachtest du denn, was ich sage? Dass ich bei jedem Schulverweis untröstliche Klassenkameradinnen hinterlassen habe? Ich war nirgendwo lange genug, um irgendwen gut kennenzulernen. Und wie soll ich denn Freundschaften schließen, echte Freundschaften, wenn ich niemandem sagen kann, wer ich bin? Wenn ich alles geheim halten muss, damit niemand je herausfindet, dass Seine Majestät doch nicht der Inbegriff der Tugend ist, für den ihn alle halten?«
»So einfach ist das nicht«, antwortet Jenkins. »Wenn die Situation anders wäre …«
»Ist sie aber nicht«, fauche ich, während sich in meiner Kehle ein Kloß bildet. »Und das wird sie auch nie sein. Das weiß ich, und ich will ja auch nicht, dass Alexander sie ändert oder mich beschützt. Alles, was ich will, ist …«
»Nach Hause zu gehen«, beendet er den Satz. »Ja, ich weiß. Und dahin bringe ich dich jetzt.«
Mein Mund steht offen, aber ich bringe keinen Ton heraus. Ich war nicht mehr zu Hause – richtig zu Hause, mit meiner Mom in unserem blauen Haus etwas außerhalb von Arlington in Virginia – seit ich vier war. Danach habe ich sieben Jahre lang ein paar Kilometer weiter weg bei meiner Großmutter gewohnt, bis sie an einem Schlaganfall starb und Seine Majestät, mein abwesender Vater, das Sorgerecht für mich erhielt. Seitdem konnte ich nur davon träumen, wieder zu Hause zu sein – bis jetzt.
»Ich darf meine Mom sehen?« Ich springe auf und werfe mich Jenkins an den Hals. Das letzte Mal, dass ich jemanden umarmt habe, ist schon so lange her, dass ich mich kaum daran erinnern kann. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, aber das ist mir egal. Ich darf endlich nach Hause.
Nach ein paar Sekunden bemerke ich, dass Jenkins die Umarmung nicht erwidert. Er sitzt steif und mit gerunzelter Stirn da und weicht meinem Blick aus.
»Also darf ich doch nicht nach Hause«, stelle ich fest. All die Aufregung und Freude verlassen schlagartig meinen Körper, und ich sinke wieder auf meinen Sitz.
»Doch«, sagt er, und zum ersten Mal in all den Jahren, die ich ihn jetzt schon kenne, klingt er unsicher. »Aber … vielleicht nicht in das Zuhause, das du im Sinn hast.«
»Nicht das …?« Und dann verstehe ich ihn plötzlich. Ich drehe mich zum Fenster um. Die Sonne verschwindet gerade hinter dem Horizont. Also müssten wir den ganzen Tag geflogen sein – doch das stimmt nicht, wir sind seit höchstens sechs Stunden in der Luft, und ein Blick auf die digitale Uhr über der Tür zum Cockpit bestätigt meine Theorie. In Vermont ist es erst vier Uhr nachmittags.
Aber wir fliegen gerade übers Meer. Über ein ziemlich großes Meer.
»Nein.« Ich stehe so plötzlich wieder auf, dass ich mir das Knie am Tisch stoße. »Jenkins …«
»Evan, setz dich bitte wieder hin«, sagt er. Das kann ich aber nicht, also laufe ich auf dem Gang auf und ab. Mein Herz schlägt so schnell, dass ich Angst habe, es könnte mir die Rippen brechen.
»Das kann er nicht machen«, platze ich heraus, während mich Panik durchflutet. »Das … Ich … Er kann das nicht machen, Jenkins. Bitte. Ich will …«
»Evangeline.« Seine Stimme klingt scharf, und er hält mich am Arm fest, als ich an ihm vorbeilaufen will. Er legt mir die Hände auf die Schultern und sieht mir ins Gesicht, seine Nase nur Zentimeter von meiner entfernt. »Du weißt genauso gut wie ich, wie die Dinge liegen. Wenn du in den Staaten bleibst und angeklagt wirst, bist du auf dich allein gestellt. Du hast keine Freunde, keine engen Verwandten …«
»Ich habe meine Mom«, erwidere ich, aber meine Stimme versagt. »Er kann mich nicht für immer von ihr fernhalten.«
»Er will dich auch gar nicht von ihr fernhalten«, sagt Jenkins. »Ihr ärztliches Team ist dabei, ihre Medikamente anzupassen, und sie kann sich gerade einfach nicht um dich kümmern, besonders, wenn man deine rechtliche Lage bedenkt. Der Stress wäre zu viel für sie.«
Tränen treten mir in die Augen. Alexander hat immer eine Ausrede. »Er hat ihr nie eine Chance gegeben«, bringe ich heraus. »Sie ist eine gute Mom. Sie war immer eine gute Mom, und ich bin alt genug, um mich um mich selbst zu kümmern. Sie müsste sich gar keine Sorgen machen.«
»Sie ist eine großartige Mutter«, stimmt Jenkins mir zu. »Und genau deswegen würde sie sich Sorgen machen. Und selbst wenn du nicht verhaftet worden wärst, würde deine Gegenwart …«
Er beendet den Satz nicht, aber ich weiß genau, was er sagen wollte. Meine Gegenwart würde sie aus dem Gleichgewicht bringen. Ich bin schon nicht mehr Teil ihres alltäglichen Lebens, seit meine Großmutter das Sorgerecht für mich bekommen hat, und ich würde sie nur daran erinnern, was sie verloren hat.
»Es tut mir so leid«, sagt Jenkins leise. »Sosehr ich auch wünschte, ich könnte dich zu ihr bringen, es ist jetzt gerade die falsche Zeit dafür. Und du hast keinen anderen Ort, an den du gehen kannst.«
Der letzte Satz wirft mich fast um, und die Worte scheinen endlos nachzuhallen. Er hat recht, und das weiß ich auch. Aber ich will nicht, dass er recht hat.
»Dann bring mich auf die Malediven. Oder … oder nach Neuseeland oder Malaysia, mir egal. Nur nicht dahin, Jenkins. Okay? Er kann mich an jeden Ort der Welt schicken, und ich gehe freiwillig. Nur nicht dahin.«
»Das ist für dich im Moment der beste Ort«, sagt er. »Du glaubst mir vielleicht nicht, aber dort gibt es Menschen, die dich lieben, wenn du sie nur lässt.«
»Wen?«, presse ich hervor. »Ihn? Er liebt mich nicht, Jenkins. Das weißt du. Er war nicht für mich da, als Mom krank wurde. Er war nicht für mich da, als meine Großmutter gestorben ist. Alles, was er jemals getan hat, ist, mich so weit wie möglich von seinem Leben fernzuhalten, und … ich kann das einfach nicht. Bitte.«
Jenkins fährt mir mit dem Daumen über die nasse Wange. »Du musst nicht für immer dortbleiben, Darling. Sobald wir deine rechtlichen Stolpersteine aus dem Weg geräumt haben, gebe ich dir deine Pässe, eine Kreditkarte und ein Flugticket, mit dem du an einen beliebigen Ort fliegen kannst – auch nach Arlington, wenn du das möchtest. Wenn du achtzehn bist, kannst du leben, wo du willst, wie du willst, und du musst nie wieder auch nur einen Fuß auf englischen Boden setzen. Aber du warst lange genug allein, und es ist Zeit, dass du deine Familie kennenlernst.«
»Das ist nicht meine Familie«, widerspreche ich mit belegter Stimme. »Glaubst du, die Königin backt mir zur Ankunft Kekse? Oder dass Mary mir die Haare flicht und mir davon erzählt, wie es war, in einem Schloss aufzuwachsen?«
»Ich glaube, dass du ein wenig Stabilität brauchst«, sagt Jenkins. »Und ich fürchte, dass das hier deine letzte Gelegenheit ist.«
Er lässt mich los, und ich stolpere zur Toilette und schließe die Tür ab. Ich sinke auf den Fliesenboden und vergrabe das Gesicht in den Händen, und als meine Selbstkontrolle schwindet und ich aufschluchze, beginnen wir unseren Anflug auf den Ort, von dem ich dachte, dass ich ihn nie sehen würde:
London.
4. KAPITEL
Niemand stellt ein Outfit zusammen wie Königin Helene.
Ich sitze im Sapphire, einem teuren Café an einer stillen Straßenecke in Mayfair, einem der exklusivsten Stadtteile von London, als sich plötzlich jeder Blick zur Tür wendet. Sie denken jetzt vielleicht, das sei eine stilistische Übertreibung, aber wenn es um Helene geht, die Königin des Vereinten Königreiches und die bekannteste Frau der Welt, ist eine Übertreibung gar nicht möglich.
Das Erste, was mir ins Auge fällt, ist ihr berühmtes rosa Sommerkleid aus der Sommerkollektion 2021 von Alexander McQueen, das sie heute mit einer cremefarbenen Jacke von Whistles kombiniert, von der Ihre Majestät bestätigt, dass sie aus dem Kaufhaus Selfridges stammt.
»Ich finde es unmöglich, ein Outfit nur einmal zu tragen und es dann wegzuwerfen«, antwortet sie mit ihrer sanften Stimme, als ich sie nach ihrem Ensemble frage – dasselbe, das sie vor zwei Jahren zum Royal-Ascot-Pferderennen trug. »Der negative Effekt der Modeindustrie auf die Umwelt ist nicht zu leugnen, und in den letzten Jahren hat unsere Familie einige Anstrengungen unternommen, unseren CO2-Fußabdruck zu verringern. Wir haben schließlich nur diese eine Erde«, fügt sie hinzu und richtet sich dabei auf, als wäre sie daran gewöhnt, für ihre humanitäre Arbeit auf Gegenwind zu stoßen. »Egal, wie groß unsere Privilegien sind, wir müssen ihr alle den gleichen Respekt erweisen.«
Ihre Ernsthaftigkeit ist fast schon magnetisch anziehend, und ich spüre die Blicke der anderen Besucher auf uns. Vier Bodyguards stehen unauffällig im Hintergrund – seit dem berüchtigten Paparazzi-Angriff, von dem Ihre Majestät während ihrer Schwangerschaft mit Prinzessin Mary eine gebrochene Nase davontrug, sind sie in der Öffentlichkeit immer an ihrer Seite. Doch die Königin lässt sich von ihnen nicht aus dem Konzept bringen. Sie ist schon lange nicht mehr die schüchterne Einundzwanzigjährige, die sich vor ihrer Hochzeit mit König Alexander in einem Tierheim engagierte, und als ich sie nach der bevorstehenden sozialen Saison in London frage, leuchtet ihr Gesicht auf.
»Wir haben alle Designerinnen und Designer nach ihrem Einsatz für nachhaltige Mode ausgewählt«, erzählt sie und wischt sich dabei den neuen (und seitdem oft nachgeahmten) Pony aus den Augen. »Ich freue mich sehr darüber, aufstrebende Modehäuser aus dem Königreich und des Commonwealth präsentieren zu dürfen. Jedes Design wird für nur vierundzwanzig Stunden bei den jeweiligen Labels verfügbar sein, und der Erlös geht an einen guten Zweck.«
Helene mag zwar die Königin des Vereinigten Königreichs sein, doch auch außerhalb der Landesgrenzen lässt sie es sich nicht nehmen, Gutes zu tun, was nur zu ihrer Popularität beiträgt, die seit ihrer spektakulären Hochzeit vor zwanzig Jahren stetig wächst.
– »Die Königin der Mode«, Vanity Fair, Juni 2023
Als unser Auto sich fünfzehn Minuten vom Flughafen Heathrow entfernt durch ein Dorf schlängelt, fühle ich mich, als müsste ich mich gleich übergeben.
Es würde Jenkins nur recht geschehen, wenn ich ihm die Schuhe ruinieren würde, aber trotzdem halte ich den Mund energisch geschlossen. Seit der Landung habe ich kein Wort mit ihm gesprochen. Zum ersten Mal in meinem Leben möchte ich nicht mit ihm reden, und egal, wie oft er betont, dass ich nur einen Monat lang bleiben müsse, dass es schon nicht so schlimm werde oder dass er mir, wenn es vorbei ist, alles geben werde, was ich wollte – am liebsten würde ich schreien, bis mir der Hals wehtut und die Stimme versagt.
Die Details, wie genau ich auf die Welt gekommen bin, hat mir niemand je erzählt, aber ich weiß, dass ich kein bedauernswerter Unfall war, der passierte, bevor Alexander seine absurd beliebte Königin Helene kennenlernte. Ich wurde zwei Jahre nach ihrer Hochzeit geboren, und es ist nicht besonders schwer, von da aus zurückzurechnen. Meine Mom hatte eine Affäre mit dem König des Vereinigten Königreichs, und neun Monate später kam ich zur Welt – am selben Tag wie die Thronerbin und meine einzige Halbschwester, Prinzessin Mary.
Ich weiß, dass das nicht meine Schuld ist. Vermutlich ist noch nicht einmal Mom daran schuld, wenn man das Machtverhältnis zwischen ihr und Alexander bedenkt. Aber trotzdem bin ich diejenige, die die Konsequenzen tragen muss. Außer Jenkins und meinen Eltern weiß niemand, wer ich wirklich bin, und obwohl ich nicht in der Königsfamilie aufgewachsen bin, habe ich bei Google genug gelernt, um zu wissen, was für ein Problem meine Existenz für die Monarchie darstellt. Alle lieben Helene. Sie war schon auf dem Cover von so ziemlich jeder Zeitschrift in Europa, und sie wird häufig als »das Herz von Großbritannien« bezeichnet. Wenn die Welt wüsste, dass Alexander ihr fremdgegangen ist, wäre das der Skandal des Jahrhunderts.
Und genau deswegen ist mir, als das Auto das Tor von Schloss Windsor passiert, immer noch vollkommen unklar, warum Jenkins mich unbedingt hierherbringen muss.
»Hier residiert die Königsfamilie normalerweise den Großteil des Jahres«, erklärt Jenkins, als würde ich ihn nicht gerade ignorieren. »Im Spätsommer zieht sie natürlich nach Balmoral, und während der Feiertage hält sie sich auf Sandringham auf. Seine Majestät ist während der Werktage der Einfachheit halber oft im Buckingham Palace, doch Schloss Windsor ist das wahre Zuhause der Familie.«
Der Fahrer öffnet mir die Tür, und widerwillig steige ich aus. Jenkins folgt mir, und nachdem er ein kurzes Wort mit den Bediensteten gewechselt hat, die gerade mein Gepäck aus dem Kofferraum holen, führt er mich durch eine Seitentür in einen hellen Flur.
Innen sieht es viel einfacher aus, als ich angenommen hatte, und als ich mir die weißen Wände und den abgetretenen Teppich ansehe, runzele ich die Stirn. Ich bin immer noch sauer auf Jenkins, aber manchmal funktioniert das mit dem Ignorieren nicht so gut.
»Das soll das Schloss sein?«, frage ich schließlich. »Sieht eher aus wie einer meiner alten Schlafsäle.«
»Das hier ist ein Diensteingang«, erklärt er, als wir am Ende des Flurs abbiegen. »Der Prunk konzentriert sich hauptsächlich auf den Trakt der Königsfamilie.«
»Moment … Also schmuggelst du mich heimlich durch den Hintereingang?« Warum überrascht mich das so gar nicht?
»Du bist schließlich eine gewöhnliche Verbrecherin«, sagt er mit einem Anflug seines üblichen Humors. Amüsiert schnaube ich.
Ohne auch nur einmal die Orientierung zu verlieren, führt er mich durch das Labyrinth aus Fluren und Korridoren. Die meisten Türen, an denen wir vorbeikommen, sind geschlossen, aber die wenigen, die offen stehen, scheinen in Lagerräume oder Büros zu führen. Alles sieht normal aus, aber als wir tiefer ins Schloss vordringen, wird mir wieder übel.
Das ist nur ein Ort von vielen, an dem ich eine Weile bleiben muss, versuche ich mir einzureden. Er unterscheidet sich auch nicht von den gefühlt Hunderten Internaten und Sommercamps, in denen ich die letzten Jahre verbracht habe. Wenn ich Glück habe, hat der König eh zu viel zu tun, um sich mit mir abzugeben, und wenn ich mich unauffällig verhalte, muss niemand überhaupt wissen, dass ich hier bin. Ich kann das schaffen – ich muss das schaffen. Und solange niemand versucht, mich wieder festzunehmen, mache ich mich in fünfundzwanzig Tagen aus dem Staub.
Als wir gerade an einem Raum voller Stoffservietten in allen erdenklichen Farben vorbeigekommen sind, hält uns ein mittelalter Mann mit blonden Haaren und einer großen Nase auf. »Jenkins«, sagt er und senkt dabei respektvoll den Kopf. »Louis wartet in seinem Büro auf Sie.«
»Wundervoll«, antwortet Jenkins, und er klingt dabei tatsächlich erfreut. »Mir, äh, ist die königliche Standarte aufgefallen, als wir herkamen. Ist Seine Majestät in der Residenz?«
»Er ist erst vor einer Stunde wiedergekommen. Offenbar hat Seine Majestät beschlossen, den Rest der Woche auf Schloss Windsor zu verbringen.« Der blonde Mann wirft mir einen Blick zu und sieht dann hastig wieder weg. Er weiß es. Keine Ahnung, wie oder warum, aber er weiß es. »Soll ich ihn von Ihrer Ankunft unterrichten?«
Ich könnte schwören, dass ich Jenkins schlucken sehe. »Wenn es keine Umstände macht«, antwortet er, und nachdem der Mann abermals den Kopf gesenkt hat, gehen wir weiter.
»Wer war das?«, frage ich und werfe einen Blick über die Schulter. Der Mann ist bereits in einem anderen Flur verschwunden.
»Ein diskretes Mitglied des Personals Seiner Majestät und jemand, den du vermutlich nie wiedersehen wirst«, sagt Jenkins. »Komm – wir haben keine Zeit zu verschwenden.«
Ich folge ihm langsam, weil ich es wirklich nicht eilig habe, die Königsfamilie kennenzulernen. »Wo schlafe ich denn? Neben der Faulgrube oder hinter dem Müllcontainer?«
Jenkins schmunzelt. »Ich bin froh, dass dein Sinn für Humor zurückzukehren scheint.«
Aber er beantwortet meine Frage nicht, und als er mich eine schmale Treppe hinaufführt, steigt in mir der plötzliche Drang auf, einfach wegzulaufen. Es ist nichts Neues für mich, an einem unbekannten Ort zu sein, aber ich habe trotzdem ein ungutes Gefühl dabei, durch ein tausend Jahre altes Schloss zu laufen, in dem irgendwo mein Vater lauert. Mein mir unbekannter Vater, der zufällig auch der König eines gesamten Königreichs und des britischen Commonwealth ist.
Zwei Stockwerke später treten wir in einen spärlich dekorierten Flur, und ich will Jenkins gerade fragen, ob die Königsfamilie immer noch Gefangene in den Tower of London wirft, als ein schlanker Schwarzer Mann in einem dunkelblauen Anzug aus einer Tür tritt. Bevor ich den Mund aufmachen kann, kommt er auf uns zu.
»Harry! Da bist du ja.« Trotz seines tadelnden Tonfalls küsst er Jenkins zur Begrüßung auf die Wange. »Du hast nicht Bescheid gesagt.«
»Es war dringend«, sagt Jenkins entschuldigend. »Diesmal war die Polizei involviert.«
»Ah«, macht der Mann, und mein Gesicht läuft rot an, als sein Blick auf mich fällt. »Du musst Evan sein. Ich bin Louis Jenkins.«
In seinen dunklen Augen funkelt eine Zuneigung, die ich nicht erwartet habe. »Es gibt noch einen zweiten Jenkins?«, frage ich, und Louis lächelt.
»Es gibt nur einen Jenkins«, sagt er liebevoll. »Aber er hat mir netterweise erlaubt, seinen Namen anzunehmen.«
Oh. Oh. »Du hast nie erwähnt, dass du verheiratet bist, Jenkins.«
»Du hast mich nie gefragt«, antwortet er, aber seine Stimme klingt nachsichtig, und seine Mundwinkel zucken, als er auf eine nahe gelegene Tür weist. »Sollen wir?«
Louis führt uns in sein Büro. Es ist größer, als ich erwartet habe. In einer Ecke steht ein langer Schreibtisch, in der anderen mehrere volle Kleiderstangen, und in der Mitte sind einige Sessel gruppiert. Als ich mich umsehe, wandert Louis’ Blick unverhohlen an mir auf und ab, als würde er jedes Detail analysieren.
»Besonders kräftig bist du nicht, oder? Und deine Haare sind bunter, als mir zugetragen wurde.«
»Ich gehe davon aus, dass du das beheben kannst«, sagt Jenkins, der mich jetzt auch kritisch beäugt. »Wir müssen sie ein wenig aufpolieren, bevor wir sie Seiner Majestät vorstellen können.«
»Aufpolieren?« Louis zieht die Augenbraue hoch. »Das ist eine ziemliche Untertreibung.«
»Hallo, ich kann euch hören«, beschwere ich mich und lasse mich auf ein Sofa neben der Tür fallen. »Und die Haarfarbe sollte nur vorübergehend sein. Mir war nicht klar, dass sie so lange grün bleiben würden.«
»Es geht nicht nur um die Haare, Darling, obwohl die natürlich oberste Priorität haben«, erklärt Louis. »Der Stil der Königsfamilie ist sehr … besonders. Es gibt Regeln, geschriebene und ungeschriebene, und wenn du mit von Partie sein willst …«
»Will ich nicht«, unterbreche ich ihn. »Ich bin nur einen Monat lang hier, das war’s.«
Jenkins’ Gesichtsausdruck verdunkelt sich. »Und während dieses Monats müssen wir sicherstellen, dass du präsentabel bist. Louis ist der persönliche Stylist Ihrer Majestät, und er kann dir die angemessenen …«
Plötzlich erklingen auf dem Gang schwere Schritte, und ein Mann mit sandfarbenem Haar stürmt in Louis’ Büro. Er bleibt mit dem Rücken zu mir stehen und sieht mich daher nicht, aber von meinem Platz aus kann ich erkennen, dass er vor Wut schäumt.
»Jenkins«, zischt er leise, trotz seines offensichtlichen Zorns. »Was genau haben Sie hier vor?«
Jenkins und Louis richten sich kerzengerade auf. »Eure Majestät«, sagt Jenkins und senkt den Kopf, und mir steigt sofort die Galle in die Kehle. »Vielleicht könnten wir unter vier Augen …«
»Sie erklären mir jetzt, warum Sie dachten, dass es angemessen oder sogar notwendig wäre, sie hierherzubringen«, schnaubt der Mann mit dem sandfarbenen Haar. Alexander. König Alexander II., Herrscher des Vereinigten Königreichs und der Commonwealth Realms – und mein Vater. Der, wie mir gerade klar wird, keinen blassen Schimmer davon hatte, dass ich herkommen würde.
Ich ziehe die Knie an die Brust und öffne den Mund, aber ich bringe keinen Ton heraus. Natürlich weiß ich, wie er aussieht – ich lebe schließlich nicht auf dem Mond. Aber es ist seltsam verunsichernd, in einem Raum mit jemandem zu sein, den ich mein ganzes Leben lang nur auf Fotos und in Zeitungsartikeln gesehen habe. Als ich seinen Hinterkopf anstarre, kann ich nur daran denken, dass er kleiner ist, als ich dachte. Nicht viel kleiner, nur ein paar Zentimeter, aber er ist nicht der gewaltige Riese, den ich mir seit fast sieben Jahren ausgemalt habe. Er ist einfach nur ein normal großer Mann. Und er bekommt sogar langsam eine Glatze.
»Sir«, sagt Jenkins flehentlich, und sein Blick huscht zu mir, aber Alexander fällt das nicht auf. »Vielleicht können wir an einem anderen Ort …«
»Antworten Sie mir, Jenkins«, schnappt Alexander, und an der Autorität in seiner Stimme kann ich erkennen, dass er nicht oft das Wort »Nein« hört.
Jenkins’ Lippen werden schmal. »Es gab keinen anderen Ort, an den sie hätte gehen können, Sir«, sagt er schließlich und lässt damit offenbar alle Diskretion fahren. »Und nach dem, äh, Vorfall heute Morgen ist es nicht unwahrscheinlich, dass Anklage gegen sie erhoben wird. Hier ist es einfacher, sie zu beschützen, und …« Er zögert. »Wenn ich ehrlich sein darf, ist es meine entschiedene Meinung, dass das hier der beste Ort für sie ist.«
»Ihre Meinung hat hier nichts zu bedeuten«, blafft Alexander. »Ich bin ihr Vater. Ich entscheide, wo der beste Ort für sie ist, und der ist ganz bestimmt nicht in der Nähe von Helene und Maisie.«
Maisie. Erst nach einem Moment begreife ich, dass er von Prinzessin Mary spricht, seiner richtigen Tochter, und die Übelkeit in meinem Magen wird zu heißer Scham und Verzweiflung, als irgendetwas in mir zerbricht. Vielleicht war es die Hoffnung, die ich all diese Jahre gehegt habe, dass er mich vielleicht heimlich doch liebt, oder das, was ich mir selbst über Geschichten mit Happy-End eingeflüstert habe. Egal, was es war, es ist jetzt in tausend Stücke zersprungen, die schmerzhaft in meiner Brust stecken.
Bevor ich es mir anders überlegen kann, setze ich mich auf, die Hände so fest um meine Schienbeine geklammert, dass es mich nicht überraschen würde, wenn ich morgen blaue Flecken hätte. »Wenn du mich nicht hier haben willst, dann schick mich nach Hause«, unterbreche ich Jenkins, als er gerade antworten will. »Damit würdest du ganz offensichtlich uns beiden einen großen Gefallen tun.«
Der König dreht sich ruckartig um, und zum ersten Mal sehe ich das Gesicht meines Vaters in Wirklichkeit. Er hat blaue Augen und buschige Augenbrauen, und als seine ansonsten unauffälligen Gesichtszüge sich bei meinem Anblick verzerren, fühle ich mich, als hätte mir gerade jemand ein Messer in den Bauch gerammt. Als ich noch kleiner war, bevor meine Großmutter gestorben ist, wollte ich ihn unbedingt kennenlernen – mit ihm sprechen, seine Stimme hören, wissen, dass ich ihm trotz der Distanz zwischen uns irgendwie wichtig war. Aber jetzt gerade würde ich alles geben, um sein Gesicht nie wiedersehen zu müssen.
»Eure Majestät«, durchbricht Jenkins die Stille, und diesmal höre ich das Zittern in seiner Stimme. »Darf ich Ihnen Miss Evangeline Bright vorstellen. Evangeline …«
»Ich weiß, wer er ist«, unterbreche ich Jenkins. »Ich meine es ernst. Schick mich nach Hause. Du willst nicht, dass ich hier bin, und ich will nicht hier sein, also lass uns die ganze Sache einfach vergessen. Wir wissen beide, wie gut du darin bist.«
Im Raum herrscht angespanntes Schweigen, aber nach ein paar Sekunden schafft es Alexander doch, es zu durchbrechen. »E-Evangeline.« Er klingt, als hätte er noch nie meinen Namen gesagt. »Ich … Natürlich will ich, dass du hier bist …«
»Nein, das willst du nicht. Das hast du gerade eben gesagt«, entgegne ich und ignoriere das Brennen in meinen Augen. Ich will nicht, dass er mich weinen sieht. »Bitte. Lass mich nach Hause gehen.«
Alexander sieht wie vom Donner gerührt aus, und Jenkins macht einen halben Schritt nach vorne. »Sir, wenn Sie wirklich glauben, dass es das Beste ist, eskortiere ich Evangeline morgen früh persönlich zurück in die Vereinigten Staaten«, sagt er leise. »Aber … falls Sie doch wünschen, dass sie hierbleibt, haben Louis und ich Zimmer im Bedienstetenbereich für sie organisiert. Sie wird Sie nicht stören, und wir können uns um sie kümmern, bis Sie … Zeit haben, sich ihrer anzunehmen.«
Er zögert bei dem Wort »Zeit«, und ich weiß, dass er eigentlich etwas anderes sagen wollte. Bis Sie Mut haben, vielleicht. Ich werde dazu vermutlich nie den Mut haben, aber Jenkins redet nicht mit mir. Ich starre Alexander an, und er starrt schwer schluckend zurück.
»Nein«, antwortet er schließlich. Ich halte den Atem an und warte auf den letzten Schwung der Axt, der unsere nicht vorhandene Beziehung endgültig durchtrennen wird.
Gut so. Alles, was er will, ist seine richtige Familie, und ich will bloß nach Hause. Wenigstens sind wir dann beide glücklich.
»Ihre Gegenwart könnte die Bediensteten verstören«, fährt er fort. »Sie wird bei uns im privaten Trakt untergebracht werden.«
Auf einmal scheint alle Luft aus dem Büro entwichen zu sein, und meine Selbstkontrolle hat sie wohl mitgenommen. »Moment – was?«, bringe ich heraus. Louis fällt die Kinnlade herunter, und selbst Jenkins sieht schockiert aus. »Ich habe kein Interesse daran, in deiner Nähe zu sein. Oder in der Nähe deiner richtigen Familie.«
Eine Nanosekunde lang sieht Alexander verletzt aus, aber der Ausdruck verschwindet so schnell, dass ich ihn mir auch hätte einbilden können. »Dein Besuch ist zwar … unerwartet, aber du bist trotzdem ein willkommener Gast, und Gäste schlafen im privaten Trakt. Solltest du nicht jeden Morgen um fünf Uhr mit den Bediensteten zusammen aufstehen wollen«, fügt er hinzu, »dann schlage ich vor, dass du mein großzügiges Angebot annimmst.«
Ich kneife argwöhnisch die Augen zusammen und lasse die Beine mit einem dumpfen Knall auf den Boden fallen. »Dein großzügiges Angebot? Machst du dir überhaupt eine Vorstellung davon, was ich wegen deiner Großzügigkeit alles durchstehen musste?«
»Danke, Sir«, wirft Jenkins schnell ein. »Ich werde dafür sorgen, dass sie gut untergebracht ist.«
»Ja, bitte«, antwortet Alexander. »Und stellen Sie bitte auch sicher, dass sie keinen Skandal verursacht. Allein ihre Haare …«
»Wir sind bereits dabei, Sir«, sagt Louis.
Unter dem Blick des Königs fühle ich mich eher wie ein Tiger im Zoo als wie ein Mensch. Aber auf einmal sieht er weg, und als er sich wieder zur Tür umdreht, habe ich den plötzlichen Drang, etwas zu sagen – irgendwas, damit Alexander und sein ablehnender Blick nicht das letzte Wort behalten.
»Wenn du mich dazu zwingst, hierzubleiben, solltest du wenigstens meiner Mutter Bescheid sagen«, bricht es aus mir hervor, und zu meiner Genugtuung stockt der König. »Du erinnerst dich doch an sie, oder? Laura Bright? Sie erinnert sich nämlich an dich.«
Sein Mund verzerrt sich zu einer Grimasse, aber sein Blick bleibt auf den Boden geheftet, und er schreitet ohne ein weiteres Wort aus dem Raum.
5. KAPITEL
Maisie:Mummy hat mir gerade geschrieben. Auf Schloss Windsor ist irgendetwas im Gange.
Kit:Ist wieder irgendwer eingebrochen?
Maisie:Sie hat nichts weiter gesagt.
Kit:Ich rufe einen Wagen.
Ben:Bis jetzt ist noch keine Security gekommen, um uns zu retten, also kann es nicht so dringend sein. Ich trinke noch zu Ende.
Maisie:Du hast dreißig Sekunden.
Ben:Du bist heute ganz schön reizbar.
Maisie:Das letzte Mal, dass ich eine Nachricht von Mummy persönlich und nicht von ihrer Sekretärin bekommen habe, war 2019. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es muss dringend sein.
– Nachrichten zwischen Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Mary, Seiner Königlichen Hoheit Prinz Benedict of York und Christopher Abbott-Montgomery, Earl of Clarence