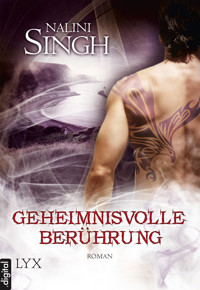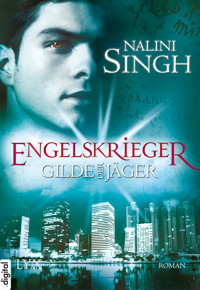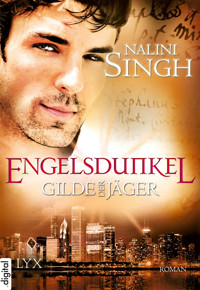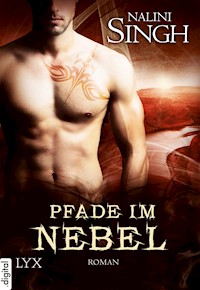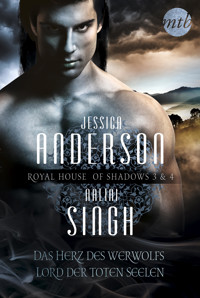
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MIRA Taschenbuch
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Royal House of Shadows
- Sprache: Deutsch
Einst lebten Gestaltwandler, Werwölfe und Vampire Seite an Seite im magischen Elden. Als der Blutzauberer das Königspaar stürzte, begann die Zeit einer dunklen Herrschaft. Nur die vier rechtmäßigen Thronerben können Elden retten …
Das Herz des Werwolfs
Als Reda durch ihr antikes Märchenbuch blättert, wird sie plötzlich in ein fernes magisches Land katapultiert. Unter dem Blutmond begegnet sie Dayn, dem verbannten Prinzen von Elden. Der furchteinflößende Herr über die Werwölfe weckt Redas tiefstes Verlangen. Doch wenn Dayn sein Ziel erreicht und nach Elden zurückkehrt, muss er sie verlassen. Für immer?
Lord der toten Seelen
Er ist ein Monster, das die Seelen gnadenlos in das Reich der Toten verbannt. Aber Liliana weiß, dass sich hinter der dunklen Rüstung aus Grausamkeit ein Herz aus Gold verbirgt. Wenn ihre Liebe ihn von seinem dunklen Fluch befreit, wird er mit seinen Geschwistern gegen Lilianas Vater, den mächtigen Blutzauberer, um Elden kämpfen.
"Magische Chemie, fantastische Abenteuer, märchenhafte Spannung…" Goodreads
"Die Botschaft: Erkenne das Gute hinter der Maske des Hässlichen - fantastisch! - Goodreads zu Lord der toten Seelen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 732
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch:
Jessica Andersen
Das Herz des Werwolfs
Als Dayn die schöne Reda hilflos im Wald findet, weiß er: Sie ist die Frau, die er in seinen Träumen sah und die ihn zur Vollendung seines Schicksals führen wird. Seit ein dunkler Zauber ihn in das Land der Wolfyn verbannte, lebt Dayn verborgen unter den Werwölfen, die niemals von seiner wahren Herkunft erfahren dürfen. Doch Redas Ankunft bedeutet, dass Dayn nach Elden zurückkehren muss, um zusammen mit seinen Geschwistern unter dem Blutmond um ihr Königreich zu kämpfen. Zusammen mit Reda macht er sich auf den Weg und verfällt dem Bann seiner atemberaubenden Begleiterin. Kann ihre Liebe die Dunkelheit des Blutmagiers besiegen?
Nalini Singh
Lord der toten Seelen
Mit letzter Kraft gelingt es Liliana, sich aus den Fängen ihres grausamen Vaters, des Blutmagiers, zu befreien. Doch der Zauber, der sie in Sicherheit bringen sollte, katapultiert sie mitten in das Schloss des dunklen Lords. Liliana weiß, wer der kaltblütige Herrscher wirklich ist: Einst kannte man ihn als stolzen Königssohn Micah, der Freude und Sonne in die Herzen aller Bewohner von Elden brachte. Seit Lilianas Vater ihn mit einem Fluch belegte, ist es sein Schicksal, als gefürchteter Herr über die Unterwelt zu wachen. Liliana muss es gelingen, sein Herz zu berühren, bevor das Böse seine Seele unwiderruflich vernichtet. Denn eine Vision hat ihr gezeigt, dass Micah der Schlüssel zur Rettung Eldens ist.
»Die Botschaft: Erkenne das Gute hinter der Maske des Hässlichen – fantastisch!«
Goodreads zu Lord der toten Seelen
Zu den Autorinnen:
Jessica Andersen, geboren und aufgewachsen in New England, hat ihr Studium mit einem Doktor in Genetik abgeschlossen. Ihre Romane, in denen sie wissenschaftliche Erkenntnisse ebenso wie Paranormales verarbeitet, landen regelmäßig auf den amerikanischen Bestsellerlisten. Die Autorin lebt in Connecticut. Nalini Singh wurde auf den Fidschi-Inseln geboren und wuchs in Neuseeland auf. Drei Jahre lebte und arbeitete sie auch in Japan und bereiste den Fernen Osten. Als Autorin von zeitgenössischen Romances hat sie sich ebenso einen Namen gemacht wie mit paranormalen Romanen, die den Leser in das Reich des Übersinnlichen entführen.
MIRA® TASCHENBUCH
Copyright © 2018 by MIRA Taschenbuch in der HarperCollins Germany GmbH
Titel der amerikanischen Originalausgaben: Lord of the Wolfyn Copyright © 2011 by Dr. Jessica S. Andersen erschienen bei: Harlequin Books,Toronto Lord Of The Abyss Copyright © 2011 by Nalini Singh erschienen bei: Harlequin Books, Toronto
Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V. / S. à r. l Covergestaltung: büropecher, Köln Coverabbildung: LStockStudi, Mingkwan Doilom / Shutterstock Redaktion: Anne Schünemann
ISBN E-Book 9783955767334
www.harpercollins.de Werden Sie Fan von MIRA Taschenbuch auf Facebook!
E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
Das Herz des Werwolfs
Prolog
Es war einmal, in einem magischen Land, ein dunkler Magier – der Blutmagier –, und er begehrte die einzige Macht, die ihm verwehrt war: Er wollte das Land regieren. Also führte er seine Armee zu einem hinterhältigen Angriff auf die königliche Burg von Elden und schwor, die königliche Familie auszulöschen und den Thron für sich zu beanspruchen. Aber er hatte nicht mit der Liebe gerechnet, die König und Königin für ihre Kinder empfanden, besonders für den rebellischen und störrischen Prinzen Dayn …
Zweige schlugen Dayn ins Gesicht und hieben nach dem blutroten Hengst, auf dem er ritt, aber keiner von beiden zuckte zusammen. Sie waren dazu ausgebildet, waren dazu geboren: Dayn war der zweite Sohn des Königs, Hart ein königliches Streitross, Nachfahr mehrerer Generationen von Biestjägern. Zusammen bewachten sie die Burginsel und die Dörfer um den Blutsee und sorgten dafür, dass die widerlichen Monster der Zauberei im Toten Wald blieben.
Es war eine edle Rolle, eine gefährliche Bestimmung – und es machte unglaublich viel Spaß. Meistens jedenfalls. Heute Nacht allerdings ritt er voller Wut, die Zügel in einer fest geballten Faust, die geladene Armbrust in der anderen. Seine Gedanken waren nicht bei der Burg oder der Landbevölkerung, sie galten allein dem Töten.
Von der Laune seines Herrn angesteckt, schnaubte Hart, biss fest auf sein Zaumzeug und sprang über einen Dornenbusch, den sie normalerweise umrundet hätten. Dayn brüllte und packte die fließende Mähne des robusten Biestjägers. Gemeinsam landeten sie auf festem Boden und preschten weiter. Sie hatten jetzt freie Sicht auf das Monster, auf dessen Fährte sie waren.
Die zottelige graue Kreatur, etwa so groß wie ein Pony, hätte einer der riesigen Wölfe sein können, die im Hochland hinter Elden jagten, wäre nicht der Rückenfleck aus rotem Pelz in ihrem Nacken und der goldene Streifen, der ihre Wirbelsäule entlanglief, gewesen. Diese Merkmale zeichneten sie als etwas anderes aus: einen Wolfyn.
Die älteren Jäger erzählten davon, dass die Wolfyn Menschengestalt annahmen und die schönsten Frauen verführten, die sie finden konnten – um sie dann zu töten und zu fressen. Aber das waren nur Geschichten. Und die Legende vom Formwandeln war ein Versuch, zu erklären, warum die blutrünstigen Kreaturen damals, als man sie zum ersten Mal hatte ausrotten wollen, zurückgeschlagen hatten, indem sie direkt den schwächsten Punkt des Dorfes angegriffen und die mächtigsten Krieger und die schönsten Frauen gerissen hatten, als wären sie im Krieg, nicht auf der Jagd.
Diese Tage waren lange vorbei und die Wolfyn in den Königreichen fast ausgerottet. Die wenigen, die noch blieben, waren allerdings tödlich und mussten zum Wohl der Allgemeinheit umgebracht werden.
Im Augenblick jedoch wollte Dayn nur schnell genug reiten, um alles hinter sich zu lassen – die Wut seines Vaters, die Enttäuschung seiner Mutter … und den Ausdruck auf Twillas Gesicht, als er sie hatte verlassen müssen, obwohl sie schon von Hochzeit gesprochen hatten.
Die Worte seines Vaters hallten in seinem Kopf. Du musst eine anständige Prinzessin heiraten. Du bist der Hüter des königlichen Waldes und die rechte Hand deines Bruders. Und die Götter wussten, dass der dunkle und verführerische Nicolai nicht vorhatte, sich in naher Zukunft zu binden, deswegen setzten König und Königin – und ihre Berater – ihre Hoffnungen für eine gewinnbringende Verbindung auf Dayn und seine Schwester, Breena. Der Gedanke daran und der Streit, den er deswegen mit seinen Eltern gehabt hatte, ließen Dayn, so schnell er konnte, von der Burg und ihrer Politik davonreiten. Er war sechsundzwanzig Jahre alt, und seine Art lebte Hunderte, manchmal Tausende von Jahren. Und doch wollten seine Eltern sein Leben an das meistbietende Königshaus verscherbeln. Bei allen Göttern und dem Abgrund, er wünschte, er wäre aus dem einfachen Volk.
Aber das war er nicht. Deswegen trieb er den Hengst weiter, bis ihm der Wind ins Gesicht peitschte und der Boden unter Harts Hufen dahinflog.
Sein Gefährte Malachai, der weit hinter ihm auf seinem stämmigen grauen Wallach zurückblieb, umrundete den Dornbusch, über den Dayn und Hart gerade gesegelt waren, und brüllte: »Wartet, verdammt!«
Dayns ehemaliger Tutor, der jetzt sein treuer Begleiter war, sagte noch mehr, aber Harts lautes Schnauben übertönte die Worte. Als die Bäume sich lichteten, konnten sie noch einen Blick auf den Wolfyn werfen. Der Hengst preschte hinter der Bestie her, die sich mit intelligenten bernsteinfarbenen Augen nach ihnen umsah. Dayn presste die Knie fest an die Flanken des Pferdes und hob die Armbrust, als sie langsam aufholten. Die Bäume lichteten sich um ihn herum, aber er konzentrierte sich auf den roten Fleck, der anzeigte, wo sein tödlicher Treffer landen musste.
Der Wolfyn setzte zu einem letzten Sprint an, und …
Plötzlich war Dayn von Gefühlen erfüllt, die nicht seine eigenen waren: Wut, Trotz, Angst, Verrat. Kaum war er überrascht hochgeschreckt, da erhob sich auch schon ein starker Wind um ihn, schloss ihn wie eine riesige Faust aus Zauberkraft ein, riss ihn aus dem Sattel und hinauf in einen Wirbelsturm, der sich mit einem Mal über ihm drehte.
»Hinterhalt!«, rief Malachai, seine Stimme verwehte im Wind und wurde immer schwächer, als der Tornado Dayn mit sich riss und die Luft an ihm vorbeipeitschte.
Er kämpfte gegen die Magie, die ihn festhielt, aber sie war zu stark, zu allumfassend. Wie eine spürbare Kraft, die aufbrauste und dann abflachte, hallte sie in seiner Seele wider, als er das Auge des Wirbelsturms erreichte. Dort hing er in der Luft, sah nichts als die wabernde Wand aus Grau und Braun, die ihn umschloss, fühlte nichts als Magie. Sein Puls hämmerte, und seine Muskeln brannten förmlich danach, zu kämpfen oder zu fliehen. Aber es gab nichts zu bekämpfen, und es gab keinen Fluchtweg. Bei allen Göttern, was ging hier vor? Gedankenübertragung bestand normalerweise aus wenigen Worten, die Blut trinkende Verwandte miteinander austauschten. Er und sein Vater waren am stärksten miteinander verbunden, aber auch zu Nicolai spürte er diese Bindung. Das hier hingegen war etwas vollkommen anderes.
»Hallo?«, rief er. »Vater? Bist du das?« Vielleicht wollte sein Vater ihn dafür bestrafen, dass er sich weigerte …
Das Chaos einer Schlacht erklang plötzlich in seinen Ohren: furchtbare Schreie, ein Brüllen, das ihm das Blut in den Adern gerinnen ließ und das er doch nicht einordnen konnte, das Scheppern von Stahl auf Stahl, schwirrende Bogensehnen und gebellte Befehle zum Angriff. Ihm wurde eiskalt, als ihm aufging, dass es sich nicht um eine Strafe handelte. Es war eine Warnung.
»Alvina!«, hörte er seinen Vater nach seiner Mutter rufen. »Zurück, verdammt!« Dann folgte ein reißender Sog der Magie, und Dayn war plötzlich im Kopf seines Vaters, sah, was er sah, fühlte, was er fühlte.
Entsetzen und grimmige Entschlossenheit hämmerten in Aelfrics Adern, als er mit seinem Schwert auf die Kreatur einschlug, die ihm auf der schmalen Freitreppe gegenüberstand. Er wusste nicht, wie der Blutmagier seine Armee ungesehen auf die Insel gebracht hatte, aber die Burg war überwältigt.
Monströse Kreaturen drängten sich in der großen Halle am Fuß der geschwungenen Treppe. Sie schlugen erfahrene Wachsoldaten mit ihren vergifteten Schwanzstacheln aus dem Weg und zerfetzten mit rasiermesserscharfen Klauen die Rüstungen der Wächter. Blut spritzte, Männer schrien und starben, und der König schleuderte einen magischen Blitz die Treppe hinab, der die Ettine zurücktrieb, die riesigen dreiköpfigen Oger, die versuchten, über die Treppe die obere Etage der Burg zu erreichen. Sie stolperten benommen zurück, aber nicht lange.
Aelfric wirbelte herum, um die Treppe hinaufzurennen, und sah seine Frau, die ebenfalls hinaufeilte. Er war nicht überrascht. Seine bezaubernde Alvina war eine Kriegerin, wild und leidenschaftlich in der Liebe und im Krieg. Was ihn überraschte, war der panische Schmerz, den er spürte, als er sie vor sich sah, das innere Flüstern: Bitte, Götter, nein, ich bin noch nicht bereit.
Schlimmer noch, er sah die gleichen Gefühle in ihren Augen gespiegelt, als sie sich in eine Nische nahe ihren Gemächern duckte, ihn ansah und ihm die Hand entgegenstreckte. »Wir müssen schnell handeln«, flüsterte sie, während die Schlacht die Steine unter ihren Füßen zum Beben brachte. »Wir können die Kinder noch retten.«
Er wollte etwas einwenden, aber tief in seinem Herzen wusste er, es wäre nur verschwendete Zeit.
Er legte seine Hände um ihre, trat dicht zu ihr und legte seine Wange an ihre Stirn. »Ah, meine Königin. Meine Geliebte. Es tut mir leid.« Leid, dass er zu lange damit gewartet hatte, dem Blutmagier nachzustellen. Leid, dass er ihr keine Hoffnung mehr bieten konnte. Leid, dass der Tag, an dem sie den fünften Geburtstag des kleinen Micah gefeiert hatten, so endete.
Ihr nächster Atemzug war ein Schluchzen, aber sie sagte nur: »Wir müssen uns beeilen.«
Er wich langsam zurück, behielt ihre zitternden Hände aber in seinen. »Sag mir, was ich tun muss.«
»Nein!«, brüllte Dayn. Schmerz brannte in seiner Brust, als die Vision schwand. »Bei allen Göttern, nein!« Mehr noch. Als die Gedankensprache verklang, hörte er das eindeutige Rauschen, das eine Erinnerung auszeichnete. Was er gesehen hatte, war bereits geschehen. Er wehrte sich gegen die unsichtbare Kraft, die ihn im Zentrum des Wirbelsturms festhielt, schlug nach ihr, verfluchte sie. »Malachai!«, brüllte er. »Zur Burg!« Aber es kam keine Antwort, und der Wald schien plötzlich unendlich weit entfernt.
Dayn. Das Wort wurde in seinem Kopf gesprochen, von einer vertrauten tiefen und grollenden Stimme.
»Vater?« Hoffnung keimte in ihm auf. »Den Göttern sei Dank. Hol mich hier raus. Ich rufe die Dorfbewohner zusammen und …«
Es ist zu spät. Die Burg ist gefallen und wir mit ihr.
»Sag das nicht.« Seine Stimme wurde unsicher, sein Atem abgehackt. »Halt durch. Halt einfach durch. Ich hole Nicolai. Wenn wir zusammenarbeiten …«
Der Zauber ist gesprochen, unser Lebensblut vergossen. Ich weiß nicht einmal, wie lange ich dich noch erreichen kann, du musst also zuhören.
»Nein!« Dayn schüttelte wild den Kopf. Er weigerte sich, das zu glauben, und hörte auch nicht auf die flüsternden Echos, die sagten, dass sein Vater schon auf der Schwelle zwischen Leben und Tod stand. »Vater … Mutter … bei allen Göttern …« Er schämte sich nicht für das Schluchzen, das aus seiner Kehle kam, als schreckliche Schuldgefühle seine Wörter verzerrten. »Ich hätte meine Geduld nicht verlieren dürfen, ich hätte nie wegreiten dürfen. Wenn ich bei euch gewesen wäre …«
Schweig! fuhr Aelfric ihn an, so wie er es mit seinen Männern auf dem Schlachtfeld tat.
Dayn kam wieder zu sich, aber seine Stimme bebte, als er sagte: »Ich erwarte Euren Befehl.« Er hatte die Worte schon so oft gesagt, wenn auch in letzter Zeit meistens voller Unmut. Jetzt bekamen sie eine neue tiefere Bedeutung, weil er nicht wusste, was als Nächstes zu tun war. Nicolai finden? Eine Armee aufstellen? Ein magischer Angriff? Rückzug? Nicht in seinen wildesten Träumen hätte er sich vorgestellt, dass die Burg erobert werden könnte und seine Eltern nicht mehr leben würden. Aber er durfte die wenige Zeit, die seinem Vater noch auf der Schwelle des Lebens blieb, nicht verschwenden, also flüsterte er: »Sprich, Vater. Ich werde tun, was immer du befiehlst.«
Gut, dann hör mir zu. Unsere Verletzungen und die Macht des Magiers haben den Zauber verändert, den deine Mutter und ich gesprochen haben. Die Magie hat dich und deine Brüder und deine Schwester weit fortgeschickt, wie wir geplant hatten, aber sie hat euch auch an die Burg gebunden und einen Countdown in Gang gesetzt. Vier Nächte, bevor diese Zeitspanne endet – und nicht vorher –, müsst ihr alle auf die Insel zurückkehren, die Burg zurückerobern und den Blutmagier umbringen. Wenn ihr es nicht tut, müsst ihr sterben, und Elden ist verloren. Aber ihr müsst warten, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist.
Dayns Atem rasselte in seinen Lungen, und seine Gedanken rasten. »Woher weiß ich, wann die Zeit gekommen ist?« Bei den Göttern, passierte das alles wirklich?
Eine Frau wird kommen und dich nach Hause führen. Der Countdown beginnt, wenn sie ankommt, und endet mit der vierten Nacht. Du musst dich von ihr führen lassen, aber denk daran: Bleib dir selbst treu, und denk an deine Prioritäten. Versprich mir das.
Ein Schluchzen steckte in seiner Kehle fest. »Ich verspreche es. Bei allen Göttern, Vater …« Er wurde unterbrochen, als der Tornado plötzlich mit einem Brüllen beschleunigte. Sekunden später wurde er aus dem ruhigen Auge des Sturms wieder in Richtung der wirbelnden Wand aus Wind geschleudert. »Nein!«, heulte er, als der Sturm ihn packte und mitriss. Sofort wurde er vom Wirbelsturm davongetragen, überschlug sich wieder und wieder, und er konnte nur noch in den Wind brüllen: »Es tut mir leid, dass ich euch nicht im Kampf beistehen konnte!«
Donner grollte, und in ihm explodierte eine Energie, die sein Fleisch versengte und ihm die Luft aus den Lungen trieb. Schmerz überwältigte ihn, er bäumte sich auf, sein Körper schien auf einmal von innen her zu zerreißen. Fleisch und Muskeln rissen, Sehnen schnappten von einer Stelle an eine andere, und seine Knochen verbogen sich. Ein weiterer Blitz, und wieder durchfuhr ihn Schmerz, so schrecklich, dass er schrie und für einige Augenblicke das Bewusstsein verlor.
Dann, von einer Sekunde zur nächsten, verstummte das Heulen, und der Tornado verschwand, als wäre er nie gewesen. Dayn hing einen Moment lang mit dem Gesicht nach unten in der Luft, etwa zwei Meter über einer grasbewachsenen Lichtung, umgeben von merkwürdigen Steinsäulen. Dann kehrte die Schwerkraft zurück, und er fiel.
»Verdammte …« Er traf hart auf, der Aufprall ließ seine Augen tränen, seine Ohren klingeln und schüttelte sein Gehirn durch. Das erklärte vielleicht, warum die Welt um ihn herum, als er sich auf Hände und Knie aufrappelte, zu hell erschien, der Himmel zu blass, die Bäume zu groß. Aber keine Kopfverletzung erklärte die Kälte, die plötzlich durch seine Tunika drang, oder dass er seinen Atem in der Luft sehen konnte. Oder warum der Himmel diese seltsame Farbe hatte und der Steinkreis und die hohen dürren Bäume anders aussahen als alles, was er bisher gesehen hatte.
Wo war er? Hatte der Zauber ihn ins Hochgebirge gebracht? Noch weiter fort? Bei den Göttern, was, wenn er im Ödland gelandet war? Es würde Monate dauern, nach Hause zurückzukehren. Sein Vater hatte gesagt, er müsse auf eine Frau warten, die ihn nach Hause brachte, und dass an dem Tag eine Frist von vier Nächten begann, aber er wurde schon beim Gedanken daran ungeduldig.
Und wenn er nicht wartete? Wenn er von sich aus zurückkehrte? Er war ein Jäger, ein Forstwächter. Wenn es irgendjemandem gelang, die Königreiche allein zu durchqueren, dann ihm. Was, wenn …
Er schreckte auf, als sich am Rand seines Sichtfelds etwas bewegte, und sein Puls schlug laut in seinen Ohren, als er sich umdrehte. Er hoffte, die Frau zu sehen, die ihn nach Hause führen würde.
Stattdessen traten zwei Männer aus dem Wald. Der eine war ein schlaksiger Junge, noch keine zwanzig, während der andere mindestens wie Mitte dreißig aussah. Ihre langnasigen abweisenden Gesichtszüge ließen vermuten, dass sie miteinander verwandt waren, und sie trugen leuchtend bunte Kleidung, die aus einem Leder oder Stoff gemacht war, den Dayn nie zuvor gesehen hatte. Das seltsame Material knitterte wie Pergament, als sie auf ihn zukamen.
Dayn versuchte aufzustehen, und erst jetzt merkte er, dass die Magie ihm alles genommen hatte außer seiner Kleidung. Er war unbewaffnet und trug nur die grob gewebte Arbeitskluft, die er bevorzugte. Wenn er sich allerdings auf feindlichem Gebiet befand, war es wahrscheinlich besser so. Er musste sich unauffällig verhalten und seine wahre Identität verschweigen, bis er wusste, ob es für ihn ungefährlich war, sich als Prinz von Elden zu erkennen zu geben.
»Ho, da drüben«, rief der ältere Mann. »Keine Angst. Wir sind hier, um dir zu helfen.« Er wendete sich an den jüngeren Mann. »Okay, Quizfrage. Was kannst du mir über ihn sagen?«
Dayn runzelte die Stirn. Er verstand den harten, kehlig klingenden Akzent des Mannes, aber was sollte eine »Quizfrage« sein?
»Na ja, nach dem Outfit zu urteilen, kommt er aus der Welt der Königreiche.« Der Junge ließ seine Zähne aufblitzen. »Oder von einem Mittelaltermarkt der Menschen. Aber ich schätze, eher Königreiche. Handgewebt, nichts Ausgefallenes, keine Waffen … Wahrscheinlich ein gewöhnlicher Typ, der in einen Vortex gestolpert ist, ohne einen Schimmer zu haben, was mit ihm passiert. Ich sage, wir betäuben ihn und schicken ihn nach Hause, als wäre nichts gewesen.«
»Ich bin mir da nicht so sicher. Da ist etwas in seinen Augen.«
»Du weißt doch, wie die meisten sind, wenn sie durchkommen. Die Hälfte von denen ist allein durch den Trip so daneben, dass sie gar nicht mehr betäubt werden müssen. Bei dem ist es so, jede Wette. Ich meine, die Königreicher glauben nicht einmal an Wissenschaft, schon gar nicht an verschiedene Welten oder daran, dass man dazwischen reisen kann, es ist also nicht so, als hätte er einen Anhaltspunkt.«
»Vielleicht.« Der ältere Mann blieb am Rand des Steinkreises stehen. »Du da drüben. Wie heißt du, und wer ist dein König?«
»König …« Dayn brach ab, weil seine Kehle sich zusammenzog. Ihm wurde klar, dass die Antwort nicht mehr »Aelfric« war. Sein älterer Bruder war jetzt rechtmäßig König. Bei allen Göttern, Nicolai. Wo bist du? Was ist mit uns allen geschehen?
»Siehst du?«, sagte der Jüngling. »Er erinnert sich einen Scheiß.«
»Was sind denn das für Ausdrücke?«, rügte der Ältere. »Du hast schon wieder zu viel Zeit mit unseren menschlichen Gästen verbracht.«
»Lieber mit den Menschen als mit den Königreichern. Die sind doch zurückgeblieben, schleudern überall ihre Magie rum, und die Hälfte wird von blutsaugenden Parasiten regiert.« Der Junge machte eine Geste über seinem Herzen, als wolle er das Böse abwehren.
Dayn war auf einmal sehr froh, den Namen seines Königs nicht genannt zu haben. Wo war er, wo Bluttrinker so verabscheut wurden?
Ehe er es herausfinden oder auch nur eine Frage stellen konnte, raste eine Gestalt aus den Wäldern auf die Männer zu: eine schlaksige Kreatur, die wie ein Welpe mit sandsteinfarbenem Fell aussah. Erst als sie zum Stehen kam und zur Begrüßung wild mit dem Schwanz wedelte, sah Dayn den hellroten Fleck auf dem Rücken und den goldenen Streifen. Er konnte nicht verhindern, dass er zusammenzuckte. Und er keuchte auf, als der junge Wolfyn sich auf die Hinterbeine stellte, die länger wurden, während seine ganze Statur sich gerade und groß aufrichtete, und sein Fell am ganzen Leib zu schimmern begann … und dann zu seltsam glänzendem Stoff wurde, zu polierten schwarzen Stiefeln und Handschuhen und zu einem blassen Jungengesicht.
Dayn starrte ihn fassungslos an. Bei allen Göttern, es stimmte. Die Wolfyn waren wirklich Formwandler. Hieß das etwa, dass auch die anderen Geschichten wahr waren? War er in ihrer Heimat?
Die Augen des Kindes leuchteten von Neugier. Seine Gesichtszüge waren eine jüngere Version der Gesichter der beiden anderen. »Ach, schade, habe ich einen Vortex verpasst? So ein Mist. Wo ist er her? Bleibt er bei uns?«
Der jüngere Mann zauste dem Jungen die rotblonden Haare. »Wir arbeiten daran. Wobei, nach seiner Reaktion gerade eben können wir jetzt wohl eindeutig sagen, dass er aus den Königreichen kommt.«
Der ältere Mann kniff die Augen zusammen. »Die Frage ist, ob er einer dieser mordlüsternen blutsaugenden Bastarde ist oder nicht.« Er und die andern betraten den Kreis, den die hohen Steine beschrieben.
Dayns Herz klopfte wild, aber er blieb ruhig und zwang sich, seine Fangzähne gut zu verbergen, sodass die Männer nicht die geringste Beule spüren konnten, als sie sein Zahnfleisch untersuchten. Denn wenn sie je herausfanden, was und wer er wirklich war, würde er nicht lange genug leben, um nach Hause zurückzukehren.
1. Kapitel
Zwanzig Jahre später
Welt der Menschen
Reda Weston stand zögernd auf dem Gehsteig vor dem Cat-Black-Kuriositätenladen, eine Hand auf dem Türgriff und den Magen voller Schmetterlinge.
Das Spiegelbild mit den großen Augen, das ihr von der getönten Glasscheibe in der Tür entgegenstarrte, kam ihr nicht bekannt vor. Ja, die Fremde hatte einen lockigen roten Pferdeschwanz, genau wie sie selbst, und sie trug die zerfetzte Jeans und die abgewetzte Lederjacke, die Reda am Morgen aus ihrem Schrank gezogen hatte, weil es keinen Grund mehr gab, sich wie ein Cop anzuziehen. Und ja, das waren ihre blauen Augen in den tiefen Höhlen, die sich in ihrem Gesicht gebildet hatten. Aber wenn sie das war, was tat sie dann hier?
Normalerweise wäre sie nicht einmal in die Nähe der kitschigen Läden für Magie, Hexerei und so weiter gekommen, die die Uferstraße von Salem säumten, es sei denn, jemand hätte die Polizei gerufen … aber normal war seit sechs Wochen ohnehin nichts mehr. Und sie hatte MacEvoy, den Besitzer von Cat Black, nun einmal gebeten, das Buch für sie zu finden.
»Es ist da«, hatte er ihr auf den Anrufbeantworter gesprochen, »und wenn Ihnen das Bild gefallen hat, das Sie gekauft haben, werden Sie den Rest davon lieben.«
Gefallen? Sie hatte die letzten vier Tage mit nichts anderem verbracht als damit, den gerahmten Holzschnitt von einem düsteren gruseligen Wald aus knorrigen und verwachsenen Bäumen anzustarren, in deren Schatten sich Augen zu verbergen schienen. Mehr noch, sie hatte von dem Bild geträumt … und von anderen, ähnlichen Bildern.
Ein Scheppern ließ sie zusammenfahren. Sie griff nach der Waffe, die sie nicht trug, und hielt dann beschämt inne, als sie merkte, dass sie selbst so sehr zitterte, dass der Türknauf schepperte. Schlimmer noch, sie wusste nicht, wie lange sie so dagestanden hatte.
»Sie sollten mit Schlafstörungen rechnen, Panikattacken, Verhaltensänderungen, sogar Zwängen«, hatte ihr der Polizeipsychologe gesagt. Und ja, das hatte sie alles durchgemacht … bis auf das Letzte. Das hier war ihr erster wirklicher Zwang. Oder vielmehr der seltsame Drang, der sie vor ein paar Tagen in diesen abartig gruseligen Laden getrieben hatte, war der erste gewesen. Das hier war der zweite. Und er war viel heftiger.
Es ist nicht das gleiche Buch, redete sie sich ein. Es ist nur eine andere Ausgabe. Nur hatte ihre maman gesagt, es gäbe nur ein einziges Exemplar. Du verlagerst nur, versuchst, ein Problem zu lösen, das lösbar ist, weil man das echte nicht lösen kann. Es war der praktische Teil von ihr, der da sprach, die Stimme ihres Vaters. Und plötzlich konnte sie den Major in den blauen Augen erkennen, die sie anstarrten, und in der aufrechten Haltung, die sie größer wirken ließ als ihre ein Meter achtundsechzig. Innerlich allerdings flüsterte die Stimme ihrer Mutter: Sieh es dir wenigstens an. Was hast du zu verlieren?
»Meinen Verstand«, murmelte sie und ignorierte dabei den Schmerz, der sich um ihr Herz legte. Sie zögerte noch einen Augenblick, schüttelte den Kopf und trat festen Schrittes durch die Tür, die eine Glocke weit im Inneren des vollgestopften Ladens zum Läuten brachte.
Wie bei ihren früheren Besuchen roch es verwirrenderweise nach Fußpuder – krümeliges Talkum mit einer betäubend parfümierten Note, die sie an Beerdigungen erinnerte. In den Ständern an der Tür standen die üblichen Verdächtigen: Kunstpostkarten, Bücher über Hexenprozesse, Ausgaben von »Der Hexer von Salem« und so weiter. Aber die Ständer selbst waren nicht wie üblich aus Draht, sondern aus Holz und mit seltsam verschlungenen Ornamenten und stilisierten Schuppen und Zähnen beschnitzt. Die Wände waren schwarz gestrichen und mit einem blassgrünen Muster verziert. Sie war sicher, dass es im Dunkeln leuchtete, wenn MacEvoy das Licht ausschaltete. Es wäre der perfekte Hintergrund, wenn er die riesige Statue von Gevatter Tod hervorholte, die in einem Glaskasten hinter der Kasse eingeschlossen war. Sie würde hundert Dollar darauf verwetten, dass die Statue wie ein Transformer in eine riesige Bong verwandelt werden konnte.
Jepp. Das hier war einfach nicht ihre Welt. Sie sollte lieber wieder gehen.
»Miss Weston!« MacEvoy trat aus einer Tür, auf der »Zutritt nur für Mitarbeiter« stand. Er streckte ihr die Hand entgegen, und in seinen blutunterlaufenen Augen stand ein Ausdruck der Freude, der falsch sein konnte oder auch aufrichtig.
Der mittelgroße, schlaksige Mann mittleren Alters schien nur aus Armen und eckigen Gelenken zu bestehen. Er wirkte ein wenig wie ein Insekt, das jemand in einen abgetragenen schwarzen Anzug gesteckt hatte. Der Anzug sah aus, als hätte er einmal einem viktorianischen Leichenbestatter gehört; wahrscheinlich hatte er ihn im Ausverkauf bei dem Kostümverleih ein paar Häuser weiter bekommen.
Sei nicht so gemein, sagte sie sich, als sie ihm die Hand schüttelte und seinen Gruß erwiderte. Es ist ja nicht so, als hätte er sich aufgedrängt. Und es war nicht seine Schuld, dass sie sich vollkommen fehl am Platz vorkam. Es lag nicht an seinem Laden oder an ihm.
»Hier entlang.« Er trat in den Kassenbereich, wo in einer Glasvitrine beeindruckend hässlicher Schmuck aus Silber und Mondstein lag und daneben ein silberner Frosch, dessen Granataugen Reda überallhin zu folgen schienen. Aber das war nur Einbildung.
Oder nicht?
Sie unterdrückte ein Schaudern und erinnerte sich selbst daran, dass sie nicht an Magie glaubte und das Ganze sowieso nur eine Show für die Touristen war. Dass die Atmosphäre auf sie wirkte, bedeutete nur, dass MacEvoy besser war, als sie vermutet hatte.
Er verschwand hinter der Vitrine, kramte dort einen Augenblick herum und gab dann ein zufriedenes Geräusch von sich. Als er sich aufrichtete, hielt er einen schwarzen Karton mit Metallbeschlägen in der Hand, auf dessen Seite »säurefrei, Archivbestand« gedruckt war.
Bei dem Anblick erklang in Redas Kopf das Klingeln einer Registrierkasse, und sie fragte sich, ob sie einfach »Danke, ich habe es mir anderes überlegt« sagen und stattdessen noch eine Sitzung bei ihrem Seelenklempner buchen sollte. Billiger wäre es. Oder sie konnte nach Hause gehen und den Papierkram auf ihrem Schreibtisch erledigen – Bewerbungen in den forensischen Instituten von Colby College und der University of New Haven. Das hieß nicht, dass sie den Schwanz einzog. Sie sah sich nur nach anderen Möglichkeiten um.
Aber all diese praktischen Überlegungen waren sofort vergessen, als MacEvoy den Karton auf den Tresen legte und ihn öffnete … Eine Welle der Hitze rollte über sie hinweg und bereitete ihr eine Gänsehaut. Sie fühlte sich plötzlich wach, obwohl sie vorher keinesfalls schläfrig gewesen war.
Der Ladenbesitzer grinste. »Gefällt es Ihnen?«
»Oh, ja«, hauchte sie. »Ja, das tut es.« Weil es nicht nur irgendein Buch war. Es war das Buch. Es musste es einfach sein.
Auf dem Titel sah sie eine fein geschnitzte Szene, wieder im Wald, und dieses Mal lief ein unglaublich niedliches Mädchen einen schmalen Pfad entlang. Sie trug einen langen bauschigen Umhang über einem einfachen Kleid und sah über ihre Schulter zurück. Ihr Blick drückte zu gleichen Teilen Angst und Aufregung aus. Es gab keinen Autorennamen, nur einen Titel, der ein wenig erhabener war als die Schnitzerei. »Rutakoppchen«.
»Rotkäppchen«, flüsterte sie und hörte das Wort in der Stimme ihrer Mutter. Nicht nur einzigartig, hatte sie an jenem lange vergangenen Geburtstag gesagt, sondern nur für dich bestimmt. Man hat es mir geschickt, mein Schatz, damit ich es dir gebe, wenn die Zeit gekommen ist.
MacEvoy sah überrascht aus. »Sie verstehen die Sprache? In den Papieren steht, es ist ein seltener west-europäischer Dialekt, und es gibt nicht viel Hoffnung auf eine Übersetzung.«
»Ich brauche keine Übersetzung.« Sie kannte die Geschichte bereits auswendig. Mit klopfendem Herzen griff sie nach dem Buch.
Der Ladeninhaber hakte einen knochigen Finger in die Schachtel und zog sie ein Stück zu sich. »Wollen Sie es kaufen?«
Ihre Kreditkarte lag auf dem Tresen, ehe sie sich ihrer Entscheidung überhaupt bewusst war. Mehr noch, sie riss sie nicht wieder an sich, als MacEvoy danach griff, auch wenn die Stimme der Vernunft in ihr kreischte, dass sie nicht einmal nach dem Preis gefragt hatte.
Es war ihr egal. Sie musste es haben, egal, ob es wirklich das Exemplar war oder nicht, egal, ob es wirklich einzigartig war. Nicht wegen der seltsamen bruchstückhaften Träume, die sie jede Nacht heimsuchten, seit sie den Holzschnitt gekauft hatte – ein Steinkreis, wie Stonehenge, nur anders, ein Gefühl der Dringlichkeit, ein Aufblitzen von grünen Augen, das sie erregte und dann mit einem Gefühl schmerzlicher Leere aufwachen ließ –, sondern weil es ein fehlender Teil ihrer Vergangenheit war. Und wenn das Übertragung war, war es ihr gerade mehr als egal.
Als er ihre Karte durch das Gerät zog, berührte sie mit den Fingerspitzen das geschnitzte Holz und verspürte eine seltsame Erregung. Ihre Nerven kribbelten, und ein klügerer Teil von ihr fragte sich, was zum Teufel hier los war und warum sie sich so verhielt.
»Stimmt es, dass der Wolf Rotkäppchen in dieser Version nicht nur auffrisst?«, fragte MacEvoy, während er auf den Kassenbeleg wartete. Er sah zu ihr auf, und seine blutunterlaufenen Augen schienen zu leuchten. »In den Papieren stand, er verführt sie zuerst, versklavt sie, spielt mit ihr, bis es ihn langweilt … und dann frisst er sie.«
»So in der Art«, sagte sie. Sie konnte es nicht abwarten, in dem Buch zu blättern, aber sie wollte es nicht vor ihm tun, auch wenn sie nicht hätte sagen können, warum. Genauso wenig konnte sie das plötzliche Klopfen ihres Herzens erklären oder ihre feuchten Handflächen oder das flatternde Gefühl in ihrem Bauch. Sie wusste nur, dass ihre Hände zitterten, als sie den Beleg unterschrieb, die Schachtel schloss und sie sich unter den Arm klemmte. »Danke. Man sieht sich.« Oder auch nicht.
»Warten Sie«, sagte er, als sie schon auf dem Weg zum Ausgang war. »Ich wollte Sie noch fragen … sind Sie nicht diese Polizistin? Sie wissen schon, die …«
Sie neigte den Kopf, drückte die Schachtel fester an sich und verließ das Geschäft, so schnell sie konnte.
Der kurze Weg zu ihrem Apartment am Rand des Szenebezirks, wo die alten Häuser wieder hergerichtet wurden, schien sich ewig hinzuziehen. Die beiden Nachbarn, denen sie unterwegs begegnete, taten so, als würden sie sie nicht sehen. Reda spürte einen schuldbewussten Stich. Trotzdem tat sie, was der Psychiater ihr geraten hatte: Sie sagte sich selbst, dass die Leute ihr nicht die Schuld daran gaben, dass ihr Partner bei dem Versuch, einen Überfall auf ein Spirituosengeschäft zu verhindern, erschossen worden war. Ihre Nachbarn, genau wie der Großteil ihrer Freunde und ihrer Familie, wussten einfach nicht mehr, was sie noch sagen sollten, immerhin war Benz schon mehrere Monate tot, und sie geisterte immer noch herum, als wäre ihr bester Freund gestorben.
Und genauso war es ja auch. Durch ihre Schuld. Nicht, weil sie etwas falsch gemacht hatte, sondern weil sie nichts gemacht hatte. Sie war wie erstarrt gewesen. Hatte einfach dagestanden, während ein dreckiger Meth-Junkie auf Bewährung das Feuer eröffnet hatte.
In den Nachrichten hatten sie gesagt, sie hätte Glück gehabt. Die anderen Cops hatten eigentlich nichts gesagt. Genau wie ihre Nachbarn jetzt schwiegen, wenn sie an ihnen vorbeieilte. Aber zur Abwechslung hatte ihr Herzklopfen nichts mit den schrägen Blicken und dem Getuschel zu tun. Auch nicht mit ihrem Vater und ihren Brüdern, die ihr ja gleich gesagt hatten, dass sie nicht der Typ war, der die Welt rettete. Stattdessen war es die schwere Schachtel, die sie an ihre Brust drückte und so fest umklammerte, dass ihre Finger taub wurden, die ihr Herz heftiger schlagen ließ.
Sie atmete so schnell, dass ihr schwindelig war, als sie ihr kleines gemütliches Apartment aufschloss. Sie blieb nicht einmal stehen, um die Lederjacke auszuziehen, ließ die Handtasche einfach neben der Tür fallen und ging zur Küchenzeile. Der hohle Klang der Schachtel, als sie auf der Holzanrichte landete, erinnerte sie daran, dass sie nicht auf den Kreditkartenbeleg gesehen hatte und nicht wusste, wie viel sie für das Ding überhaupt ausgegeben hatte. Es war ihr egal.
»Mach es jetzt auf«, sagte sie zu sich selbst. Die Worte klangen viel zu laut in der Stille, die um sie herum herrschte, als würde die Welt den Atem anhalten. Oder vielleicht – wahrscheinlich – lag es an ihr. Sie bauschte die Sache viel mehr auf, als nötig war. Trotzdem zitterten ihre Finger, als sie die Schachtel öffnete, hineinfasste und den hölzernen Buchdeckel berührte. Sie sagte sich selbst, dass sie sich das leise Kribbeln nur einbildete. Genau wie die heißen Träume, die sie seit ein paar Nächten hatte, nicht mehr waren als Erinnerungen an ihre Kleinmädchenfantasien vom strahlenden Retter, aufgeheizt von ihren erwachsenen Erfahrungen.
Sie fuhr die erhabenen Buchstaben mit dem Finger nach. Rutakoppchen. Eine Version von Rotkäppchen, in der der Wolf Sünder und Verführer war und der Förster der Held, der das Mädchen rettete und aus ihrem alten Leben in ein neues führte, ein besseres. Das Buch zu sehen, es zu berühren, brachte sie ihrer Mutter näher, als sie es seit Jahren gewesen war. Selbst wenn das Buch sich als Kopie herausstellen sollte, war es doch wert, was immer sie bezahlt hatte.
Aber sie musste es wissen, deshalb schlug sie es auf. Der Einband quietschte wie eine schlecht geölte Tür, ihre Kehle wurde auf einmal trocken und eng … und dann traten ihr Tränen in die Augen, als sie die handgeschriebenen Zeilen auf der ansonsten leeren Seite vor sich sah, blaue Tinte, die in den letzten zwei Jahrzehnten verblasst war.
Für meine süße Alfreda zu ihrem achten Geburtstag. Den Rest der Geschichte erfährst Du mit sechzehn.
Deine Maman
Redas Herz überschlug sich schier in ihrer Brust, als sie mit den Fingern über das letzte Wort fuhr. Maman. Ihre älteren Brüder hatten sie immer gehänselt, dass sie sich »aufspielte«, sie Prinzessin genannt und sie aufgezogen, weil an ihnen nichts auch nur annähernd Königliches war. Sie waren Soldatenkinder und stolz darauf.
Du kommst nie voran, wenn du immer zurückblickst. Die Stimme des Majors erklang auf einmal so deutlich, als stünde er direkt hinter ihr. Was nicht sein konnte, denn er war gerade in Übersee. Es waren nur die Worte, die so vertraut klangen: Augen geradeaus; ein Fuß vor den anderen; sieh nach vorn, nicht zurück. Lebensweisheiten.
»Du hast recht«, sagte sie leise. »Ich weiß, du hast recht.« Sie sollte das Buch zurück in die Schachtel legen, es vielleicht sogar in den Safe einschließen, wo sie ihren unbenutzten Reisepass aufbewahrte. Sie sollte Trost darin finden, eine lieb gewonnene Erinnerung wiederzuhaben, und sich dann auf Wichtigeres konzentrieren – zum Beispiel auf die Bewerbungen.
Aber sie blätterte trotzdem um und konnte nicht anders, als das Bild des jungen unschuldigen Mädchens mit ihrem Korb zu betrachten. Dann eines von einem riesigen Wolf – ihre Maman hatte Wolfyn dazu gesagt –, der ihr auf dem Pfad hinterherschlich und ihr mit viel zu menschlichen Augen dabei zusah, wie sie das Häuschen ihrer Großmutter betrat, es aber leer vorfand. Die nächsten Seiten zeigten Wolfyn und Mädchen gemeinsam, und die Geschichte stand eher im Text als in den Bildern. Doch dann verwandelte sich das riesige Biest in einen Mann mit zerzausten Haaren und heißen wilden Augen, und das Mädchen sah mit leuchtender Miene und aufgeregt zu ihm auf, als würde sie einen schönen Prinzen vor sich sehen und nicht einen lüsternen Wolfyn. Doch dieses Mal sah Reda noch etwas, das ihr vorher nicht aufgefallen war: Das Mädchen sah abwesend aus und lächelte fast an dem Wolfyn vorbei, statt ihn anzusehen.
Reda zog sich der Magen zusammen. Sie hatte diesen Ausdruck schon bei Opfern von K.-o.-Tropfen gesehen.
Sie überflog die nächsten paar Bilder und bemerkte, dass ihre Mutter einige Seiten ausgelassen haben musste. Oder hatte sie die Bilder als Kind gesehen und nur nicht gewusst, was sie bedeuteten? Denn jetzt, aus der Perspektive einer Erwachsenen – einer Polizistin, die schon mit Vergewaltigungen zu tun gehabt hatte, wenn auch glücklicherweise nicht so oft, wie es in einer größeren und härteren Stadt der Fall gewesen wäre –, sahen der leere glasige Blick des Mädchens und der blinde Gehorsam auf die jugendfreien, aber doch anzüglichen Befehle des Wolfyn ganz nach Drogen oder Gehirnwäsche aus. Oder beidem.
Sie war nicht verführt worden. Man hatte sie gezwungen.
Reda schauderte. »Den Teil habe ich ganz anders in Erinnerung.« Andererseits hatten die meisten Märchen einen dunklen und blutigen Ursprung und wurden erst für den Mainstream verniedlicht, wenn Disney sie in die Finger bekam.
In ihrem Kopf begann ein Gedanke zu summen wie eine gefangene Hummel, doch sie bekam ihn nicht lange genug zu fassen, um zu verstehen, was das alles zu bedeuten hatte.
»Armes Mädchen«, murmelte sie und berührte ein Bild der jungen Frau, auf dem sie mit schweren Lidern neben dem Herd lag, in dem ein niedriges Feuer brannte. Der Wolfyn war in Verwandlung begriffen und sah aus dem Fenster, das Fell in seinem Nacken aufgerichtet, als würde er in den Schatten nach Gefahr suchen. Es war schwer zu sagen, ob er sie beschützte oder gefangen hielt. Wahrscheinlich beides, je nachdem, wen man fragte.
Reda merkte, dass sie sich viel zu sehr darin verstrickte, einen zweidimensionalen Charakter zu bedauern, der für sie auf einmal stellvertretend für die vielen Opfer stand, mit denen sie gearbeitet hatte. Sie war so darin vertieft, dass sie den Förster, der auf der nächsten Seite abgebildet war, einfach einige Herzschläge lang anstarrte.
Dann flüsterte sie: »Da bist du ja.« Was albern war, denn genau wie das Mädchen war der Förster nicht mehr als ein Bild in einem Märchenbuch.
Nur war er mehr als das. Er war der Held.
Wie er im Türrahmen stand, mit der langstieligen Axt vor seinem Körper, hätte er wie das Klischee eines Holzfällers aussehen sollen. Stattdessen wirkte er merkwürdig fehl am Platze, als wäre ein fahrender Ritter aus einer anderen Geschichte in diese versetzt worden. Die hochgerollten Ärmel legten muskulöse Unterarme frei, die sich von seinem festen Griff um die Axt spannten. Die Spannung setzte sich im Rest seines großen hochgewachsenen Körpers fort bis hinauf in sein Gesicht, auf dem Ekel und Entschlossenheit standen, als er sah, was sich in der Hütte abspielte.
Reda konzentrierte sich auf jedes Detail: die zerzausten schwarzen Haare über seiner edlen Stirn, die breiten Wangenknochen, die schmale aristokratische Nase, die vollen Lippen und den kantigen Kiefer und seine Augen … lieber Gott, seine Augen. Sie starrten von der Seite direkt in ihre Seele und schienen lebendig, obwohl es nur eine Illustration war und noch dazu eine schwarz-weiße.
Doch sie kannte diese Augen. »Grün«, flüsterte sie und sehnte sich plötzlich unsinnigerweise nach einem Mann, der nicht wirklich existierte. »Seine Augen sind grün.«
Hilf ihm. Die Worte erklangen in ihrem Kopf in einer fremden Stimme, als hätte ihr eigener Atem sich in Worte verwandelt, die nicht aus ihr selbst kamen.
Ein Schauer durchfuhr ihren Körper.
»Super, jetzt bildest du dir schon Dinge ein, wenn du hellwach bist«, sagte sie laut und versuchte, mithilfe der Worte die plötzliche Spannung zu vertreiben, die in der Luft hing.
Es funktionierte nicht. Die Luft blieb schwül, und Donner grollte. Ihr Magen fühlte sich hohl an, und ihr blieb die Luft weg.
Dieses Mal hörte sie die Worte im Pfeifen des Windes vor ihrem Fenster: Hilf ihm. Rette ihn.
Ihr Herz raste, als sie draußen den Himmel sah, genauso klar und hell wie vorhin, als sie MacEvoys Laden verlassen hatte. Und doch grollte wieder ein Donner, vibrierte durch die Sohlen ihrer Stiefel ihren ganzen Körper hinauf. Sie fühlte sich plötzlich leer und allein.
Er ist auch allein. Hilf ihm. Sie hörte den Wind, aber die Bäume in der Nachbarschaft bewegten sich nicht, und auch die kleinen Schönwetterwolken hingen bewegungslos am Himmel.
Ein Wimmern stieg in ihrer Kehle auf. Sie unterdrückte es, aber die Panik blieb und brachte eine Erinnerung mit sich, die sie lange Zeit tief vergraben geglaubt hatte, bis sie jetzt plötzlich vollkommen klar in ihrem Kopf auftauchte.
»Also, was meinen Sie – ist sie verrückt?«, fragte ihr Vater den Arzt. Sie konnte die beiden vom Wartezimmer aus durch die halb offene Sprechzimmertür sehen, konnte sie deutlich hören, obwohl sie leise sprachen.
»Solche Ausdrücke benutzen wir nicht«, sagte der Arzt mit ernstem Gesicht, aber ihr Vater nickte nur, als hätte er die Antwort bekommen, die er erwartet hatte. Der Arzt seufzte. »Hören Sie. Die menschliche Psyche benutzt eine Art Schutzmechanismus, um mit Trauma und Verlust umzugehen. Wir rationalisieren solche Ereignisse, die Ursachen und Folgen. In diesem Fall hat Redas Psyche einen eher ungewöhnlichen Schutzmechanismus gewählt, der sie glauben lässt, ihre Mutter wäre nicht tot, sondern gefangen in einem magischen Land, in einer anderen Welt. So etwas kann nach dem Verlust eines Elternteils geschehen, besonders bei Kindern ihres Alters. Normalerweise gibt sich das von selbst.«
»Wie lange?«
»Ein paar Monate, vielleicht noch länger. Aber es ist im Grunde harmlos.«
»Sie nennen es harmlos, dass sie schlafwandelt, zur Hintertür hinaus und in den Wald? Was, wenn sie sich verlaufen hätte? Oder noch schlimmer, was, wenn der Falsche sie gefunden hätte?« Die Stimme des Majors wurde zum Ende hin immer lauter, aber dann sah er zu ihr nach draußen und senkte die Stimme wieder: »Helfen Sie mir, Doc. Das muss aufhören. Für die Jungs. Wir alle müssen die Sache endlich hinter uns lassen.«
Der Arzt sagte nichts, und Redas Herz schlug wild bei dem Gedanken, dass er dem Major erzählen könnte, dass sie recht hatte, dass es die Königreiche wirklich gab und dass manchmal Besucher aus Versehen durch die Tore zwischen den Welten fielen. Sie beugte sich aufgeregt in ihrem Stuhl vor.
»Wir können ein paar Sachen versuchen«, sagte der Arzt schließlich. »Zuerst würde ich empfehlen, das Buch loszuwerden.«
Die Erinnerung verschwamm und löste sich auf, aber der Schmerz in ihrem Herzen blieb und mit ihm Redas Überraschung über diese verdrängte Kindheitserinnerung. Nicht, weil der Major ihr so lange etwas vorgemacht hatte, sondern weil die monatelange Therapie so wirkungsvoll gewesen war. Sie hatte seitdem nicht mehr an das Buch, an Magie oder Monster gedacht.
Oder an ihre Mutter.
Der Polizeipsychologe hatte natürlich gewollt, dass sie über den Tod ihrer Mutter sprach, aber Reda hatte nur mit den Schultern gezuckt und gesagt: »Das ist lange her.« Und dabei wäre es auch geblieben … wenn sie nicht das Buch gefunden hätte. Oder vielmehr, wenn das Buch nicht sie gefunden hätte.
Donner grollte wieder, er hörte sich jetzt näher an, auch wenn die Sonne noch immer schien. Ohne es zu wollen, wanderte ihr Blick zurück zu der Seite mit dem Bild des Försters, der im Türrahmen stand, sie anstarrte und in ihr eine Sehnsucht weckte. »Verdrängte Erinnerungen«, sagte sie leise. »Darum geht es hier, richtig?«
Der Tod von Benz hatte die Mauern geschwächt, und der seltsame Zufall, den Holzschnitt in MacEvoys Geschäft zu entdecken, hatte das Fundament fortgespült. Jetzt war der ganze Schutzmechanismus dabei zusammenzubrechen. Wenn man bedachte, wie stolz sie auf ihre Selbstkontrolle und Disziplin war, war es seltsam, wie wenig ihr das ausmachte. Seit der Schießerei hatte sie sich gefühlt, als würde sie auf der Stelle rennen oder sich in sich selbst zurückziehen, als wartete sie auf etwas. Und das hier war es.
Oder nicht? Was, wenn das alles nur in ihrem Kopf passierte? Was dann?
Der rationale logische Teil von ihr sagte, sie sollte den Psychologen anrufen und sich irgendwo einweisen lassen. Stattdessen streckte sie eine Hand aus, die plötzlich überhaupt nicht mehr zitterte, berührte die Buchseite und legte die Finger auf die Brust des Jägers.
Mühelos erinnerte sie sich an die magischen Worte, die ihre Maman ihr beigebracht hatte. Sie hatten zusammen auf einem moosbewachsenen Ufer am Ententeich gesessen, die Beine verschränkt und so nah beieinander, dass ihre Knie sich berührt hatten. »Konzentrier dich«, hatte ihre Maman gesagt, immer und immer wieder, auch wenn es ihr irgendwie nie wie eine Lektion vorgekommen war, nie wie Arbeit. »Schließ die Augen, stell dir eine Tür vor, und sag den Zauberspruch, und wenn du deine Augen wieder öffnest, bist du dort, wo du sein sollst.«
Die Worte waren natürlich nicht magisch und würden keinen geheimen Gang in ein magisches Reich vor ihr öffnen. Aber sie waren genau das, was ihr Verstand brauchte, um diese verdammten Mauern ein für alle Mal einzureißen.
Also dachte sie sich Was soll’s? und sagte die Worte.
Ein krachender Blitz zerriss die Luft um sie herum, und Wind erhob sich, so unmöglich das war. Er wirbelte um sie herum, obwohl sie mitten in ihrer Wohnung stand. Panik stieg in ihr auf, und sie erstarrte, gelähmt vor Angst. Ihr Puls hämmerte in ihren Ohren, aber dieser schnelle Herzschlag war die einzige Bewegung, zu der sie noch in der Lage war.
Sie versuchte, nach Hilfe zu rufen, aber sie konnte nicht, versuchte, ihren Blick von dem Buch loszureißen, konnte aber auch das nicht. Sie war kurz davor durchzudrehen. Sie schrie, doch kein Laut war zu hören; sie kämpfte, doch sie konnte sich nicht bewegen. Die Augen des Försters wurden größer und größer, bis sie nichts mehr sehen konnte als das Tintenschwarz, nur noch den Wind hörte, und sie spürte …
Nichts.
Welt der Königreiche
Moragh fuhr aus ihrer Trance, als ihre Hellseherei von einer anderen Magie unterbrochen wurde – einer blutgebundenen Macht. Seit vielen Jahren hatte sie desgleichen nicht mehr gespürt.
»Der Prinz!«, zischte sie aufgeregt, als sie die Quelle des Signals erkannte. Endlich – endlich – nach all dieser Zeit konnte sie den Zauber spüren, der ihr damals die Beute entrissen hatte. Mehr noch, sie konnte ihm folgen. Auch jetzt noch, da das erste Aufflackern der Macht abgeklungen war, spürte sie die Verbindung in sich, pochend wie ein Herzschlag. Einer, der signalisierte: Hier entlang. Ich kann dich zu ihm führen.
Der Zauber war wieder aktiv. Den dunklen Lords sei Dank.
Ihre Lippen bogen sich zu einem Lächeln, das in dem reich verzierten und vergoldeten Zauberspiegel wild aussah. Kurz blitzten Fangzähne hinter den Lippen einer braunhaarigen kühlen Schönheit von etwa vierzig Jahren auf. Als es ihr damals nicht gelungen war, Prinz Dayn umzubringen, hatte sie den Zorn des Blutmagiers nur mit Mühe überlebt, und es hatte lange gedauert, seine Gunst zurückzugewinnen. Und ihr Versagen hing ihr immer noch nach. Doch jetzt … »Genugtuung«, sagte sie, und das Wort hallte von den kalten Steinmauern der Burg wider.
Neben dem Herd blickte Nasri, ihr Diener, von seinem Wischmopp auf. Der alte Gnom mit den krummen Fingern – jetzt nur noch sieben, weil man ihn vor Kurzem beim Stehlen einer Fleischpastete erwischt hatte, für die er mehr als genug bare Münze gehabt hätte – entfernte die Blutflecken der letzten Nacht von den Steinen. Das Wasser in seinem Eimer war dunkel, der graue Mopp blutbeschmiert. »Herrin?«
»Schick nach dem Bestiarium. Ich will die zwei größten Ettine in einer Stunde zur Jagd bereit.« Die dreiköpfigen Riesen waren reine Wut gepaart mit Hunger; Tötungsmaschinen, die man nur auf ihr Ziel loslassen musste. »Und sag dem Aufseher, er soll ihre Halsbänder noch einmal mit einem Zauber verstärken. Ich werde sie selbst führen, und du kommst mit, um dich um sie zu kümmern.«
Er zuckte zusammen und wimmerte angstvoll. »Solltet Ihr nicht lieber …«
»Geh«, fuhr sie ihn so energisch an, dass er quietschend zur Tür hinausstolperte. Als er verschwunden war, lächelte sie noch einmal den verzauberten Spiegel an. »Bei meinem Leben und meinem Blut, diesmal erwische ich ihn.«
Sie hatte einmal versagt. Sie würde es nicht wieder tun.
2. Kapitel
Welt der Wolfyn
Der Blutmond hob sich wie ein perfekter weißblauer Kreis über die dunklen Baumwipfel und schien durch die große Fensterfront ins Schlafzimmer. Dayn schloss den letzten Knopf an seinem karierten Hemd und zog seine fleecegefütterte Bomberjacke an.
»Du könntest auch bleiben, weißt du. Da sein, wenn ich zurückkomme.«
Er sah zu ihr hin. Eine Lampe aus geschliffenem Glas leuchtete auf dem Nachttisch – eine nachgemachte Tiffany-Lampe, die man aus der Welt der Menschen importiert und so verändert hatte, dass sie mit der quasi-magischen Energie betrieben werden konnte, mit der alle Geräte der Wolfyn liefen. Das bleiche Licht beleuchtete die erdbraunen Wände und die fein geschnitzten Möbel, beides subtil verziert mit dem Siegel des Augenkratzer-Rudels: vier parallele blutrote Linien über einem bernsteinfarbenen Wolfsauge. Das Bett war mit luxuriösen purpurrot gefärbten Fellen bedeckt, aber der wahre Mittelpunkt des Raumes war Keely. Die Alpha-Wölfin des Rudels lag lang ausgestreckt da, geschmeidig und befriedigt. Vor Erregung duftete sie nach Moschus und nach der Magie des Blutmondes. Sie war gesegnet mit dem durchtrainierten Körper einer Jägerin und dem vollen Haar einer Wolfshündin in ihren besten Jahren; ungebunden und unabhängig war sie, genau wie er.
Nur dass sie überhaupt nicht wie er war. Nicht wirklich.
Sie trafen und paarten sich nur diese eine Nacht im Jahr, wenn der Sex die stärkste Verwandlung auslöste und die Wolfyn die nächsten drei Tage hauptsächlich in Wolfgestalt verbrachten, gemeinsam rannten, ihre Magie erneuerten, alte Verbindungen lösten und neue schufen. Keely wagte es nicht, sich während des Blutmondes mit einem Mann ihrer Art zu paaren, da er dann das Recht beanspruchen könnte, sie um die Führung des Rudels herauszufordern. Diese Führung war an ihren Bruder Kenar gegangen statt an sie, wie die Tradition es verlangt hätte. Als »Gast« des Augenkratzer-Rudels – so nannte man die wenigen Reisenden zwischen den Welten, die durch eine Laune der Magie nicht durch den Steinkreis nach Hause zurückkehren konnten – war Dayn zu Keelys erster Wahl geworden. Sie hatte es ihm mit dem Pragmatismus der Wolfyn dargelegt: Sex, einmal im Jahr, nicht mehr, nicht weniger. Und das passte ihm gut aus verschiedenen Gründen.
Ihre Beziehung hatte rein geschäftlich begonnen, aber mit der Zeit hatte sie sich zu einer Freundschaft entwickelt. Oder wie nannte man es bei den Menschen? »Freundschaft plus«. Aber Freunde oder nicht, er sagte ihr nicht, dass sie heute mit ziemlicher Sicherheit zum letzten Mal zusammen gewesen waren. Er wagte es nicht. Stattdessen sagte er: »Danke, aber nein danke. Und du hättest nicht gefragt, wenn du nicht gewusst hättest, dass das meine Antwort ist.«
»Du kennst mich zu gut. Also … nächstes Jahr zur gleichen Zeit, in einem Jahr?«
»Natürlich«, sagte er und fügte dann wie immer dazu, »es sei denn, du hast bis dahin jemanden gefunden.«
Ihre Augen blitzten auf. »Kenar ist ein guter Alpha.«
Darüber ließ sich streiten, aber Dayn würde Keely und die anderen Rudel-Mitglieder nie dazu bringen zuzugeben, dass ihr Alpha sich mehr für sich selbst als das Rudel und seine Traditionen interessierte. Oder dass es falsch von ihm gewesen war, sich gegen die Traditionen zu stellen und den Mann, den Keelys Vater als seinen Nachfolger und Partner seiner Tochter aus einem anderen Rudel ausgesucht hatte, zu verjagen. Zugegeben, der Mann – Roloff – hätte nicht gehen dürfen. Aber dadurch wurde Kenars Verhalten noch lange nicht richtig.
Aber es brachte nichts, sich darüber zu streiten – »alles schon versucht«, sagten die Menschen passenderweise in so einem Fall. Also warf er ihr nur eine Kusshand zu. »Dann bis nächstes Jahr.« Eine Lüge, aber eine notwendige. Im ganzen Reich der Wolfyn wusste nur die Weise Wolfyn, Candida, wer und was er wirklich war und dass die Zeit für ihn bald gekommen war, nach Hause zurückzukehren.
»Natürlich«, stimmte Keely ihm zu. »Es sei denn, du findest in der Zwischenzeit jemanden.«
Er hatte die Hand schon an der Tür, drehte sich aber noch einmal überrascht um. »Ich? Nein. Auf keinen Fall.«
»Der neue Gast des Steindreher-Rudels ist hübsch.«
»Ich habe nicht vor, mir eine Partnerin zu nehmen.« Außerdem war der Neuankömmling nicht die Frau, auf die er wartete; die Frau, die er in der letzten Woche jede Nacht deutlicher im Traum gesehen hatte. Jeden Morgen war er mit dem Bild eines herzförmigen Gesichts vor Augen aufgewacht. Es hatte ein Grübchen im Kinn und einen »Ihr könnt mich alle mal«-Ausdruck in den Augen, dazu lockige rote Strähnen. Beeil dich, wollte er ihr sagen. Bitte beeil dich.
Keely sah ihn fragend an. »Wenn es nicht das ist, was liegt dir dann auf der Seele?« Bei den Wolfyn ließen sich alle Probleme immer auf Politik oder Familie zurückführen. Da er mit der Politik des Rudels nichts zu tun hatte, blieb noch die Familie – oder in seinem Fall die Tatsache, dass er keine hatte.
»Es geht mir gut. Wirklich.« Er winkte ihr zum Abschied kurz zu und sagte leise: »Guten Lauf.« Hinter ihren Augen konnte er schon das bernsteinfarbene Feuer erkennen. Und als er ihr Haus verließ, spürte er, wie die Magie der Verwandlung die Luft vibrieren ließ. Sie strich über seine Haut und verstärkte die Ruhelosigkeit in ihm, die ihn mehr und mehr plagte, während die Tage verstrichen und seine Führerin immer noch nicht kam. Die Frustration nagte an ihm, er fühlte sich kribbelig, unruhig. Er wollte durch die Dunkelheit rasen, Streit anfangen, den Mond anheulen …
Stattdessen machte er sich auf den Weg zurück zu der kleinen Blockhütte, die er in der Nähe des Steinkreises gebaut hatte. Er schloss den Reißverschluss seiner Jacke und steckte die Hände in die Taschen, als er den zwei Meilen langen Pfad entlangwanderte. Der Blutmond erleuchtete die Nacht mit seinem gespenstischen weißblauen Licht, das fast so hell war wie der Tag, nur farbloser. Als er seine Hütte erblickte, hing in der Luft bereits ein Chor aus aufgeregtem Jaulen und tiefem Heulen, das ihm Schauer über den Rücken jagte.
Seine Blockhütte bestand nur aus einem einzigen langen Raum mit einem Kamin in der Mitte und einem großen Herd. Auf die anderen Mitglieder des Rudels wirkte sie lachhaft altmodisch. Er hatte immerhin isolierte Fenster nach Art der Menschen und einen Energiegenerator nach Wolfyn-Technologie eingebaut. Heute allerdings hatte er das Licht ausgelassen, und durch das Mondlicht, das die Kabine blauweiß erleuchtete, sah es fast so aus, als würde sie …
Oh, Mist. Glühen. Dayns Puls beschleunigte sich, denn er wusste aus Erfahrung, dass es nicht die Hütte war, die glühte. Ein Vortex bildete sich im Steinkreis!
Er rannte los. Als er um die Ecke bog, grollte Donner und ließ die Sohlen seiner Stiefel vibrieren, obwohl der Himmel sternenklar war. Er jubelte fast, als er das blauweiße Licht zwischen den Steinen Funken schlagen sah. Die Elektrizität ließ die Luft aufleuchten, reicherte sie mit Ozon an und stellte seine Haare auf, als ob auch er sich verwandelte.
Magie umgab ihn, als er den Hügel hinaufrannte, hüllte ihn ein und überzog ihn mit Lichtblitzen, als er kurz vor dem Steinkreis zum Stehen kam. Elektrizität strömte von einem Stein zum nächsten und wieder zum nächsten, bis der ganze Kreis vor blauweißer Energie aufleuchtete. Und dann, plötzlich, verschwammen das Gras und die Luft innerhalb des Kreises und fingen an, sich zu bewegen. Zuerst formten sie eine langsame, nach innen gerichtete Spirale, wurden dann immer schneller und schneller, bis sie innerhalb von Sekunden zu einem grauen Tornado aus allem und nichts geworden waren.
Die Magie zerrte an ihm und lockte. Komm, schien der Vortex zu sagen. Sprich die Worte und komm.
Doch Dayn zögerte. Bisher hatte der Vortex ihm nicht geholfen, auch nicht, wenn er den Zauber sprach, der ihn zurück nach Elden bringen sollte. Aber was, wenn die Zeit jetzt endlich gekommen war? Vielleicht sollte seine Führerin gar nicht zu ihm kommen, sondern er zu ihr. Bitte, Götter.
Donner grollte, und Magie peitschte, als er sich den Wald vorstellte, aus dem er fortgetragen worden war, und den Zauber sprach. Dann, auf alles vorbereitet, trat er in den Steinkreis.
Der Wind hüllte ihn sofort ein, hob ihn hoch und sog ihn Hals über Kopf in den wirbelnden Malstrom der Magie. Aufregung erfasste ihn. Es funktionierte! Donner brüllte, und Blitze stoben umher, das ganze Universum schien einen Augenblick den Atem anzuhalten. In diesem Moment sah er eine moderne Küche im Stil der Menschen vor sich und zuckte vor Entsetzen zusammen. Nein, nicht die Welt der Menschen! Bring mich nach Elden!
Noch bevor er den Gedanken beenden konnte, flammte hinter seiner Stirn ein Schmerz auf und peitschte durch seinen Schädel … und alles verlosch.
Eine Sekunde lang nahm er nur Dunkelheit wahr. Ruhe. Stille. Er konnte nicht einmal seinen eigenen Herzschlag hören.
Dann kam mit einem Ruck alles um ihn zurück, blauweißes Licht traf seine Augen, und er spürte weiche grasbewachsene Erde unter seinen Füßen. Er blinzelte ins Licht und ballte vor Enttäuschung die Hände zu Fäusten, als er die Welt um ihn herum wieder klar erkennen konnte und den vollen Mond sah, der den vertrauten Steinkreis beleuchtete.
»Verdammter Mist.« Er war nicht gereist. Er war immer noch in der Welt der Wolfyn. »So ein stinkender …«
Ein leises Stöhnen unterbrach ihn. Ein leises, sehr weibliches Stöhnen.
Sein Herz hämmerte in seiner Brust, als er sich dem Geräusch zuwandte. Er wollte nicht hoffen, aber er hoffte.
Und da war sie. Endlich, nach all dieser Zeit war sie da.
Sie lag zusammengekrümmt im Gras. Die Wange hatte sie auf den Händen abgelegt, aber er erkannte das herzförmige Gesicht, das sture Grübchen im Kinn und die starken, aber doch sanft gerundeten Kurven ihres Körpers. Und auch ohne dass er sie bei Tageslicht gesehen hatte, wusste er, dass ihr welliges Haar von Rot durchzogen war und ihre Augen klar und blau wie der dunkle Himmel über Elden nach einem Gewitterregen. Nicht dass es wichtig wäre, ob sie schön war oder nicht – sie war seine Führerin, und nur darauf kam es an.
Ihre Kleider wiesen sie als Menschen aus, was ihn überraschte. Von den drei bekannten Welten war die menschliche am fortschrittlichsten, was Technik anging, benutzte aber die wenigste Magie, wodurch sie sich am weitesten von der reinen Magie der Königreiche unterschied. Wie sollte eine Menschenfrau ihn da führen können?
Hab Vertrauen, sagte er sich. Sein Vater hatte ihm Führung versprochen, und hier war sie.
Es bedeutete auch, dass die letzten vier Nächte angebrochen waren und sie sich beeilen mussten. Dabei gab es allerdings ein Problem: Sie war bewusstlos, und das Augenkratzer-Rudel bereitete sich auf seinen Lauf vor, zu dem eine Stunde Heulen an den Steinen gehörte. Auch wenn die Wolfyn im alltäglichen Leben relativ zivilisiert waren – zumindest wenn sie sich in ihrer eigenen Welt aufhielten –, der Blutmond brachte andere Aspekte ihrer Persönlichkeit zum Vorschein. Keely hätte wahrscheinlich keine Schwierigkeiten damit, ihn während des Blutmonds mit einer anderen Frau zu sehen, aber die anderen wären wohl nicht so nachsichtig.
Er traf eine spontane Entscheidung, auch wenn er lieber geblieben wäre und sofort einen neuen Vortex gerufen hätte. Dayn nahm die Frau in seine Arme. Sie war zierlicher und kleiner als Keely und schien sich ihm ganz selbstverständlich anzupassen, als er sie aus dem Kreis trug. Ihr Kopf lag gegen seinen Hals geschmiegt, ihr lockiges Haar kitzelte an seiner Wange.