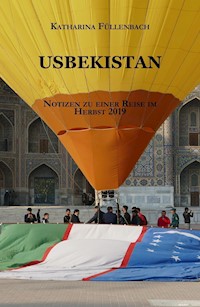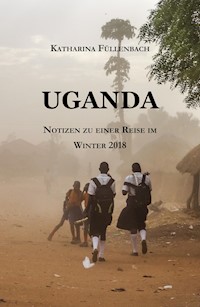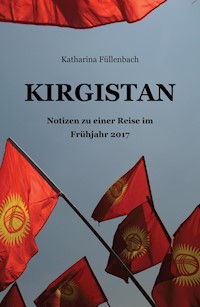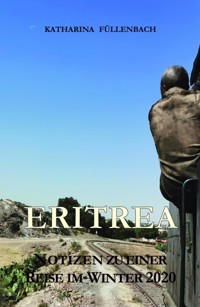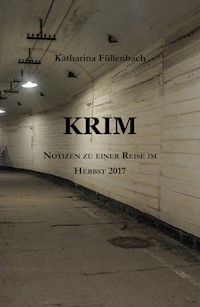9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Reisepostillen
- Sprache: Deutsch
Füllenbach ist seit Jahren als alleinreisende Frau auch immer wieder in Afrika unterwegs. Sie lässt sich in der Regel von den kulturellen Eigenheiten ihrer Umgebung überraschen und berichtet in ihren Büchern vom Alltag der Menschen. In Ruanda aber war diesmal alles anders. Keine dreißig Jahre nach dem verheerenden Genozid, der viele hunderttausend Menschen das Leben kostete, sind Staat und Gesellschaft heute wieder befriedet, aber durch die Ereignisse von 1994 in hohem Maße geprägt. Füllenbach zeichnet die Historie nach und beschreibt ausführlich die immensen Anstrengungen, um aus einer traumatisierten Bevölkerung wieder eine Gemeinschaft und zugleich das Land zukunftsfähig zu machen. Daneben berichtet sie von ihren Alltagserfahrungen und beschreibt mit einer gehörigen Portion Selbstironie die Patzer der Muzungu in einer Schwarzen Gesellschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
KATHARINA FÜLLENBACH
RUANDA
NOTIZEN ZU EINER REISE IM HERBST 2022
Reisepostillen Band 13
© 2023 Katharina Füllenbach
Umschlag, Illustration, Photos: Katharina Füllenbach
Titelfoto: Baustelle in Kigali
Lektorat: Dr. H. Bodendieck-Engels, H.H. Becker, M.T. Füllenbach
Softcover
ISBN 978-3-347-84573-2
Hardcover
ISBN 978-3-347-84573-9
E-Book
ISBN 978-3-347-84575-6
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany.Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
Inhalt
Vorbemerkung
Die Ankunft
Der deutsche Kolonialismus
Richard Kandt
Die Rolle Belgiens in der ruandischen Geschichte
1994
Und danach ?
Der Wiederaufbau: Vision 2020
Die Gedenkarbeit
Die Murambi Gedenkstätte
Kigali
Wasserversorgung
The Campaign Against Genocide Museum
Sprachen
Read-Learn-Discover: The Kigali Public Library
Religionen und Glaubensbekenntnisse
Muhanga/ Gitarama
Der letzte Samstag im Monat: Umuganda
Die Badoo-App
Ein Sonntag in Kigali: The Rwandan Patriotic Front
Huyé/ Butare
Nyabisindi/Nyanza
Rwandas Home Grown Initiatives (HGI)
Rückfahrt nach Kigali: Ndi Umunyarwanda
The Rwanda Art Museum
Kunst und KünstlerInnen: Carol
Fahrt nach Norden
Karongi/ Kibuye
Noch einmal Kigali
Rubavu/ Gisenyi
Letzte Tage
Lektürehinweise/Links
Photos
Dank
Vorbemerkung
Ruanda, das Land der tausend Hügel, hat eine bewegte Ver-gangenheit. Bis Ende des neunzehnten Jahrhunderts ein hochent-wickeltes und unabhängiges Königreich, nahm seine Geschichte mit der Ankunft der deutschen und belgischen Kolonialherren und deren rassistischen Gesellschaftsmodellen einen drastisch anderen Verlauf, der in den vergangenen Neunzigerjahren in einem der erschütternd-sten Völkermorde des an Genoziden wahrlich nicht armen Jahr-hunderts mündete. Nach diesen einhundert Tagen des bestialischen Mordens stand das Land vor den Trümmern einer zerstörten Zivil-gesellschaft: Geschätzte achthunderttausend bis eine Million Tote waren zu beklagen und Überlebende entweder traumatisiert, körperlich und seelisch verstümmelt, entwurzelt und vielleicht auch auf der Flucht oder hatten sich als Genocidaire, also Täter, mit einer Schuld beladen, die für den Rest eines Lebens nicht zu tilgen ist.
Kann man die Folgen einer solch flächendeckenden, alle menschlichen Lebensbereiche vergiftenden Katastrophe reparieren? Kann man ein derart verwundetes Land wieder aufrichten und ihm eine Perspektive geben? Und wenn ja, mit welchen Mitteln und Methoden mag das eventuell gelingen? Diese Fragen habe ich mir vor Beginn meiner Reise gestellt und wollte ihnen während meines Aufenthaltes versuchen nachzugehen. Nach sechs Wochen im Land, vielen Beobachtungen und Unterhaltungen habe ich keine abschließenden Antworten. Ein Stück weit gescheitert fühle ich mich im Nachhinein allein schon durch das Fledermausprinzip, mit welchem Thomas Nagel uns vor fünfzig Jahren so prägnant vor Augen führte, dass, egal wie viele Informationen wir sammeln und wie sehr wir uns bemühen, eine Situation, ein Gefühl, eine Erfahrung nachzuvollziehen, wir am Ende nicht wirklich wissen, wie und was der andere fühlt und denkt, respektive wie und was er ist.
Möglich geworden ist aber zumindest eine Beschreibung der augenscheinlich immensen Anstrengungen, welche sowohl die politisch Verantwortlichen als auch große Teile der Bevölkerung in den letzten achtundzwanzig Jahren unternommen haben und immer noch weiter unternehmen, um die Folgen der erlittenen Traumata zu überwinden und damit eine Grundlage für die Zukunft des Landes zu schaffen.
Jenseits solcher großen Linien wird in vielen Lebensbereichen die Entwicklung des Alltags vorangetrieben. Beobachtungen hierzu und Beschreibungen alltäglicher Dinge, mit denen sich zu beschäftigen manchmal ganz zufällig zustande kam, sind in dem vorliegenden Buch ohne Anspruch auf Vollständigkeit mit aufgenommen. Es sind vereinzelte Versatzstücke, deren bloße Existenz für einen Fortschritt stehen und die Entwicklungen im Land auf eigene Art illustrieren.
Diese Aufzeichnungen sind insgesamt durchweg subjektiv und stehen in keinem Zusammenhang zu mancher wissenschaftlichen Diskussion, die ökonomisch, völkerrechtlich, politisch, historisch oder soziologisch in den vergangenen Jahren – und das vor allem außerhalb der Landesgrenzen – zu Ruanda geführt wurden. Sie erheben keinen Anspruch auf akademische Relevanz, sondern geben ausschließlich meine Wahrnehmungen während dieser Reise wieder.
Werden die Bemühungen der ruandischen Menschen, die eigene Geschichte zu überwinden in den folgenden Jahrzehnten Früchte tragen und wird das Land auf dieser Grundlage allen seinen Bewohnern in einer absehbaren Zukunft eine sichere und friedliche Perspektive bieten können? Das kann man von heute aus nicht sicher sagen. Die Anstrengungen, genau dieses Ziel zu erreichen, sind aber in jedem Falle darauf ausgerichtet und - wie ich finde - beeindruckend groß.
Katharina Füllenbach, im Winter 2023
Die Ankunft
Eine überaus unspektakuläre Anreise von Köln über Istanbul nach Kigali endet morgens um halb drei auf dem Flughafen der ruandischen Hauptstadt. Die Maschine von Turkish Airlines - eine Flugverbindung, die aufgrund von standardmäßigem vierzig Kilo Reisegepäck für einen sechswöchigen Aufenthalt sehr zu empfehlen ist - scheint um diese Uhrzeit das einzige ankommende Flugzeug. Entsprechend schnell gehen Einreisekontrolle und Gepäckausgabe vonstatten, denn auch die in einigen Reiseführern angedrohte Kofferkontrolle wegen des generellen Plastiktütenverbots im Land findet um diese Uhrzeit nicht statt.
Meine Unterkunft hatte sich bei der Buchung als im Zentrum von Kigali liegend beschrieben und unzählige Photos hochgeladen, die allesamt eine sehr einladende und angenehme Anmutung vermittelten. Dieser Eindruck findet sich bei dem nachts vorgefundenen tatsächlichen Zimmer leider so nicht wieder. Meine Enttäuschung zu diskutieren, macht allerdings angesichts der Uhrzeit und des kaum englisch sprechenden jungen Mannes, dessen Aufgabe einzig darin bestanden hatte, das Tor zum Grundstück zu öffnen und mir die Zimmerschlüssel zu geben, überhaupt keinen Sinn. Ich habe mich also ins Unausweichliche gefügt, mich aber zumindest per E-Mail um vier Uhr morgens noch bei demjenigen klar geäußert, der meine Reservierung ursprünglich bestätigt hatte. Diese nächtliche Intervention zeigt im Laufe des folgenden Vormittags Erfolg. Das Zimmer wird gewechselt und ich lebe ab da in einem sehr großen Raum, welcher - hurra! - sogar über einen Ventilator verfügt, aber dafür auch nur über eine einzige Steckdose. Und wie häufig im außereuropäischen Ausland wird das Zimmer mit einer einzigen Deckenlampe in geringer bis mittlerer Luxstärke beleuchtet. Ich musste aufgrund dieser Umstände den vormittags auftauchenden Inhaber des Inns über den Zimmerwechsel hinaus also noch einen Moment auf Trab halten und schaue nun auf eine abenteuerliche Mehrfachsteckerverlängerung, die an der lose aus der Wand hängenden einzigen Steckdose ihren energe-tischen Ausgangspunkt hat. Auch mein Wunsch nach einer Nachtischlampe wurde erfüllt. Seitdem beleuchtet abends eine Reklamebarlampe für Heineken-Bier von einem improvisierten Nachtisch, bestehend aus zwei marokkanischen Sitzkissen und einem mausetoten Videorekorder, die linke Seite meines Bettes. Die in dem Reklameobjekt verbauten LED-Leuchten funktionieren wunderbar und das Lesen im Bett ist nun kein Problem mehr. Den toten Videorekorder zwischen Sitzkissen und Bier-Reklame zu schieben, bedeutet zudem nicht den geringsten Verlust beim Abendprogramm. Zwar ist prominent ein Flachbildfernseher mit allerlei zusätzlichem Technikschnickschnack (wie beispielsweise dem besagten Videorekorder) im Zimmer aufgebaut, aber das Ganze dient ausschließlich der Dekoration für die im Internet veröffentlichten Hotelfotos. In der Realität ist selbst mit einer Verlängerungsschnur auf dieser Seite des Raumes keine Elektrifizierung möglich und ein hässliches, metallisches Scheppern beim Bewegen des Rekorders lässt zudem vermuten, dass ein paar Schrauben darin herumfliegen, die irgendwo in der Konstruktion fehlen und damit jede Funktion unmöglich machen.
Das nach Außen vermittelte Bild der Unterkunft muss insgesamt als vielteiliges Puzzlespiel verstanden werden. Während in einem Zimmer eine komplette Küchenzeile angeboten wird, steht in einem anderen ein Kühlschrank. Auch die im Netz hochgeladenen Photos von einigermaßen schicken Badzimmern geben nur eine Teilrealität wieder. Mit meinem Zimmertausch habe ich beispielsweise den Durchlauferhitzer für die Dusche eingebüßt und dusche nun kalt. Das ist nicht weiter schlimm, denn klimabedingt verlangt der europäische, alte und verweichlichte Körper hier nicht unbedingt nach heißem Wasser. Aber der insinuierte Eindruck eines grundsätzlichen Standards ist nur dann korrekt, wenn mal alle Gästezimmer zusammennimmt und sich der Illusion hingibt, es handele sich um ein und denselben Raum.
Der aktuelle Betreiber ist, wie so oft in diesem Hotelsegment, kein Profi. Vielmehr hatte er in Eritrea eine Lehrerausbildung absolviert und danach - und das bereits vor siebzehn Jahren - das Land verlassen. Nicht weil er besonderen Repressalien ausgesetzt gewesen wäre, sondern weil er sich - wie so viele eritreische Flüchtlinge dieser Generation - um seine Jugend und eventuelle Möglichkeiten betrogen fühlte. Sein Weg führte ihn nach Europa, erst nach Deutschland und dann für zehn Jahre nach Norwegen. (Warum? Cherchez la femme!) Als die Beziehung zerbrach, trat er den Rückweg nach Afrika an und landete mit einem Dolmetscher-Zeitvertrag bei einer UN-Organisation in Kigali. Weil dieser Vertrag wiederum in einem knappen Jahr enden wird, hatte er vor einigen Monaten die Herberge angemietet, in der ich jetzt wohne und versucht seitdem, mit allerlei Aktivitäten das Geschäft anzukurbeln. Dazu gehört eben auch, auf den internationalen Buchungsportalen alle möglichen Ausstattungsmerkmale anzubieten, die zwar alle irgendwo auf dem Gelände vorhanden sind, sich aber, wie oben bereits wortreich beschrieben, für einen einzelnen Gast nie alle zusammen und gleichzeitig erleben lassen. Wenn ich Migrationsgeschichten wie seine höre, werde ich in der Regel butterweich und lasse schnell alle Primzahlen gerade sein. Hinter solchen Biographien stecken so viele Neuanfänge, so viel Anstrengung und so viel Entwurzelung, ich mag mich dann einfach nicht wegen ein paar Komfortdetails zanken, die den meisten Menschen nicht als fehlend auffallen, weil sie sie in ihrem persönlichen Leben zumeist auch nicht erleben. Oder anders ausgedrückt: Wenn in deiner eigenen Unterkunft die Elektrifizierung aus einer einzigen Improvisation mit losen Kabeln, Steckern und unsauber zusammengefügten Kontakten besteht, wie sollst du dann auf die Idee kommen, dass ein Auswärtiger so etwas in seinem Hotelzimmer als mangelhaft wahrnimmt? Immerhin ist meine hiesige Situation mit den hinzu organisierten Hilfsmitteln für den Moment gut gelöst und was die nächsten Wochen noch bringen, wird sich eh weisen.
Spannend ist auch die unmittelbare Umgebung der Unterkunft. Sie liegt in einem prosperierenden Stadtviertel namens Kamutwa, welches sich zum Zeitpunkt meiner Reise mitten im Übergang zu befinden scheint. Moderne Wohnkomplexe sind im Bau befindlich oder vor nicht allzu langer Zeit fertiggestellt. Daneben stehen hügel-abwärts viele ältere Unterkünfte mit Wellblechdächern, die von einer ärmeren und einfacheren jüngeren Vergangenheit und Gegenwart zeugen. Direkt neben der Herberge liegt die Ausbildungsstätte eines privaten Sicherheitsdienstes. Abgesehen von zwei großen, weißen Unterrichtszelten verfügt dieses Areal über einen Trainingsplatz, auf welchem ab halb acht Uhr morgens Dutzende junger Menschen, viele Männer, einige Frauen, körperlich ertüchtigt werden. Alle tragen dabei eine schwarze Uniform, bestehend aus kurzärmeligem Hemd und langer Hose mit dem Abzeichen ihrer Firma. Das Training beginnt jeden Morgen mit einem Lauf über das Grundstück, bei welchem die jungen Leute etwas singen, was an die Ausbildung amerikanischer GIs gemahnt. Danach prasseln für die nächsten Stunden die Anforderungen etlicher Kraft- und Schnelligkeitsübungen auf die Auszubildenden nieder, denen beileibe nicht alle gleichermaßen gut gewachsen sind. Ihr Ausbilder verfügt über einen Stock, der manchmal auf dem Rücken eines Schülers niedergeht. Keine schweren Schläge, aber doch als Zeichen heftiger Missbilligung deutlich erkennbar.
Das Training findet unabhängig von den tagesaktuellen Wetterverhältnissen statt. Ich bin während der kleinen Regenzeit im Land, eine Phase, in der immer wieder kurze heftige Schauer den Alltag unterbrechen. Das tut der Ausbildung der zukünftigen Sicherheitsleute ebenso wenig Abbruch wie die ansonsten heftig herunterbrennende Sonne. Trainiert wird an fünf Tagen in der Woche mit je einer Einheit am Vor- und Nachmittag. Dazwischen kann man die Auszubildenden in den beiden großen weißen Zelten sitzen sehen, in welchen wohl ein theoretischer Unterricht stattfindet. Im Laufe meines Aufenthaltes habe ich Gelegenheit, mit dem einen oder anderen der jungen Leute zu plaudern. So erfahre ich unter anderem, dass ihre Ausbildung insgesamt drei Monate dauert. Danach werden sie von der Firma als Wachleute übernommen und an einem der zahlreichen Eingänge von öffentlichen Gebäuden, Firmenniederlassungen oder wohlhabenden Privathäusern eingesetzt, wo sie sich dann sterbensgelangweilt den ganzen Tag auf billigen Plastikstühlen lümmeln und bestenfalls dann und wann einen Besucher in Empfang nehmen.
Was allerdings nicht so ganz zu dieser rein privatwirtschaftlichen Sicherheitsfirma passen will, ist der Umstand, dass in einem anderen Bereich des Areals auch militärische Exerzierübungen stattfinden. Immer und immer wieder werden hierfür von einem Ausbilder Befehle in Kinyarwanda gebrüllt. Die Aspiranten marschieren dann entsprechend fünf Schritte auf der Stelle, machen mit lautem Hackenknall eine viertel Umdrehung und kommen mit einem weiteren Hackenknall wieder zum Stehen. Es mangelt dabei die allermeiste Zeit an hundertprozentiger choreographischer Präzision, was einen zweiten - ebenfalls stockbewehrten - Ausbilder in Zivil ziemlich zu verdrießen scheint. Jedenfalls fährt er mit besagtem Knüppel häufig in die exerzierenden Reihen und knufft den ein oder anderen und das, wie ich finde, ziemlich unsanft. Was dieses Ausbildungselement mit einer privatwirtschaftlichen Sicherheitsfirma zu tun hat, erschließt sich mir bei meinen Beobachtungen von jenseits der Mauer leider gar nicht.
Sobald der tägliche Unterricht beendet ist, übernehmen die Kinder und Jugendlichen der Nachbarschaft das Sportfeld der Firma und spielen dort bis weit nach Sonnenuntergang vor allem Basketball und zuweilen auch Fußball. Samstag und Sonntag gehört der Platz komplett ihnen und wird von den frühen Morgenstunden bis spät abends für alle Facetten der freizeitlichen Körperertüchtigung genutzt. Auch hierbei spielt das jeweilige Wetter keine Rolle. Es ist brüllend heiß? Tja, ist halt so. Es regnet in Strömen? Das ist bloß Wasser und macht gar nichts.
Ebenso resilient gegenüber den klimatischen Verhältnissen scheinen die Bauarbeiter zu sein, die auf der anderen Seite der Herberge während meines Aufenthaltes einen Neubau hochziehen. Bei meiner Ankunft stand bereits im Rohbau das Erdgeschoss des offensichtlich als Privathaus geplanten Gebäudes. Die Arbeiter fangen sechs Tage in der Woche noch eine Stunde früher an als die zukünftigen Sicherheitsleute und begleiten ihren Arbeitsbeginn gerne mit vielstimmigem Gesang, der zusammen mit den Geräuschen, die eine Baustelle nun einmal von sich gibt, dafür sorgt, dass man als direkter Nachbar nicht zu viel vom Vormittag verschläft.
Es hatte nur wenige Tage gedauert, bis meine gesamte hiesige Nachbarschaft mich kennt und genau weiß, wo ich wohne und wann ich gewöhnlich das Grundstück der Herberge verlasse. Dazu habe ich insofern beigetragen, als ich schnell ein/zwei Verkaufsbuden ausgedeutet habe, die für täglich notwendige Verbrauchsgüter wie Wasser oder Joghurt notwendig sind. Ich habe also Lebensgewohnheiten und tägliche Wege entwickelt, die für die nächsten Wochen von meiner Umgebung aufmerksam beobachtet, wiedererkannt und offensichtlich auch untereinander kommentiert werden.
Gegenwart und Realitäten eines Land zu verstehen fällt immer deutlich schwerer, wenn man sich nicht auch mit seiner Vergangenheit beschäftigt. In Ruanda kommt man aufgrund der extremen Ereignisse vor knapp dreißig Jahren an einem solchen Rückblick überhaupt nicht vorbei und er beginnt sinnvollerweise Ende des neunzehnten Jahrhunderts, ohne dessen koloniales Geschehen die Geschichte Ruandas eventuell ganz anders verlaufen wäre.
Der deutsche Kolonialismus
Auf der Kongo Konferenz 1884/ 1885 in Berlin hatten die europäischen Mächte Afrika unter sich aufgeteilt und Einflusszonen definiert, innerhalb derer sie zukünftig den Kontinent ausbeuten würden.
Dieser Konferenz folgte im Jahr 1897 eine trilaterale Expedition nach Ostafrika, bestehend aus Vertretern Deutschlands, Großbritanniens und Belgiens. Dabei wurden verbindliche Grenzen zwischen den drei Kolonialterritorien festgelegt, die allerdings erst 1910, nach dem Tod Leopold II, bei der Konferenz von Brüssel vertraglich festgeschrieben wurden. Fixiert wurde dabei unter anderem auch, dass der Kivu-See fortan zwischen Ruanda und dem Kongo der Länge nach geteilt sei und ansonsten der Rusizi-Fluss die Grenze zwischen den beiden Gebieten darstellte.
Bei der Berliner Kuchenschlacht waren Deutschland Teile von Ostafrika zugefallen. Es konzentrierte sich bei seinen afrikanischen Aktivitäten in den Folgejahren auf das Gebiet des heutigen Tansania, während es die ihm ebenfalls zugeteilten Königreiche Banyarwanda (Ruanda) und Urundi (Burundi) einstweilen außer Acht ließ.
Erst in den Achtzehnhundertneunzigerjahren wandte das Deutsche Kaiserreich seine Aufmerksamkeit der Region des heutigen Ruanda zu, beschränkte sich aber in der Ausübung seiner kolonialen Macht auf eine indirekte Residenturherrschaft. Dies geschah vor allem aus der Erkenntnis heraus, dass das Territorium bei Ankunft der Deutschen bereits hervorragend organisiert war. Es gab im vorhandenen Königreich klar definierte hierarchische Machstrukturen, ebenso klar definierte administrative Abläufe und eine funktionierende Landwirtschaft. Die ankommenden Deutschen brauchten diese vorgefundene Gesellschaftsorganisation also nur anzunehmen und die vorhandenen Abläufe in das koloniale System einzubinden, was sie mittels entsprechender Abkommen mit dem herrschenden König Yuhi V Musinga, einem Batutsi, taten. Die Landnahme erfolgte damit ohne größere Konflikte und Auseinandersetzungen und der damals mit der Missionierung befasste deutsche Bischof Hirth beschrieb in der im Februar 1900 erschienenen Ausgabe des Afrika Boten die koloniale Situation wie folgt: „ In dem verflossenen Jahre ist es … gelungen, Ruanda ohne … einen Flintenschusse zu unterwerfen und … das Vertrauen des Häuptlings (gemeint ist hier König Yuhi V Musinga) und des ganzen Volkes zu erwerben.“
Vor dem Hintergrund dieser grundsätzlich ruhigen Situation im Land und der angestrebten indirekten Herrschaft wurde der Arzt und Afrikaforscher Dr. Richard Kandt im Jahr 1907 zum kaiserlichen Repräsentanten für das Gebiet ernannt, um im Namen des Deutschen Reiches eine Infrastruktur für Handel und Besiedlung aufzubauen. Kandt hatte sich bereits zwischen 1897 und 1906 zu Forschungszwecken im Nordwesten von Deutsch-Ostafrika aufgehalten und bis 1900 in einer Hütte in Shangi gelebt, einem Ort im Westen Ruandas, in welchem 1898 auch das erste deutsche Militärcamp errichtet worden war. Mit seiner Berufung siedelte er in das damals zweitausend Bewohner große Kigali um, veranlasste die winzige deutsche Kolonialadministration, es ihm gleich zu tun und legte damit den Grundstein für die heutige Hauptstadt. Von den besagten zweitausend Bewohnern des Ortes waren zu diesem Zeitpunkt vierhundertzwanzig Ausländer (überwiegend Inder und Europäer) und davon neun Deutsche. Um die Ansprüche des Deutschen Reiches auch in diesem Teil des Kontinents zu untermauern, hatte der damalige Gouverneur von Deutsch-Ostafrika Hermann von Wissmann bereits 1894 den Schutztruppen-Hauptmann Max Wintgens an den Hof des ruandischen Königs geschickt. Dieser war dabei vermeintlich bei dem ruandischen König Yuhi V. Musinga vorstellig geworden, um ihm mit der Übergabe eines Schutzbriefes die Tatsache zu vermitteln, dass sein Königreich von nun an unter der Herrschaft eines europäischen Landes stünde und ihm zur Bekräftigung dieser Information eine Flagge eben jenes Deutschen Reiches zu überreichen. Was Wintgens wie viele vor und nach ihm nicht wusste, war der Umstand, dass die Ruander keineswegs so ohne weiteres einen ausländischen Gast mit ihrem König zusammenbrachten und für solche Anlässe einen sogenannten Pseudo-König namens Pambuarugamba vorhielten, der in die Rolle des Königs schlüpfte, den Gast statt seiner empfing und damit ein Stück weit zum Narren hielt. Auch Richard Kandt war dies bei seinem ersten Besuch 1898 passiert. Eine verbindliche Absprache zwischen dem Deutschen Reich und der ruandischen Monarchie war also erst einmal nicht getroffen, wovon aber einstweilen nur die eine Seite Kenntnis hatte.
Später verzichtete Yuhi V Musinga auf solche Spielereien. Zu wichtig war die deutsche Unterstützung im Laufe der Jahre geworden, die er gegen innenpolitische Gegner erhielt und die ihm sowohl mit Militärbasen in aufständischen Regionen als auch bei der Verfolgung einzelner „Rädelsführer“ half. So waren es die Deutschen, die 1912 den Anführer einer Rebellenbewegung mit Namen Basebuya verhafteten und exekutierten. Auch hatten sie zuvor schon eingegriffen, als Muhamuza, die Witwe des 1895 unter unklaren Umständen gestürzten König KigeriRwanugiri, für ihren Sohn Biregeya die Thronfolge beansprucht hatte - ein Begehren, welches die Rechtmäßigkeit von Yuhi V Musingas Herrschaft in Frage stellte. Die Deutschen verhafteten die Frau und deportierten sie nach Bakoba am Victoriasee. Dem Vernehmen nach starb sie später in Kampala. Über den Verbleib ihres Sohnes ist hingegen nichts bekannt.
Das nutznießende Verhältnis von Kolonialmacht und Kolonisierten war, zumindest was die herrschende einheimische Klasse anging, also ein Geschäft auf Gegenseitigkeit und damit Grundlage für einen ruhigen Verlauf der Kolonialherrschaft. Die Deutschen sicherten die Macht Yuhis und er hielt ihnen im Gegenzug jedes Aufbegehren der einheimischen Bevölkerung vom Leib, welches dazu angetan gewesen wäre, mit größerem Aufwand und härteren Bandagen auftreten zu müssen. Entsprechend kamen sie mit sehr wenig Personal aus. Zu Beginn der Residentschaft Kandts stand ihm einzig ein Polizeiwachtmeister zu Seite. In den Folgejahren wurde das Kolonialverwaltungspersonal dann geringfügig auf sechs Personen aufgestockt: Kandt selbst, seinen Stellvertreter, einen Sekretär, einen Kanzleibeamten, einen Polizeiwachtmeister und einen Sanitätsfeldwebel. Entsprechend dieser wahrlich überschaubaren Anzahl von Kolonialkräften war das Verwaltungszentrum auf dem Hügel von Nyarugenge sehr bescheiden. Es bestand aus einem Wohnhaus für den Residenten, wenigen weiteren Wohnhäusern für die genannten Mitarbeiter, einer Polizeistube, einem Hospital (mit getrennten Bereichen für Afrikaner und Weiße), einem Gefängnis, Lagerräumen und Pferdeställen. Ab 1912 war das gesamte Areal von einer hohen Mauer mit einem breiten Toreingang umfasst.
Neben der Ausführung der praktischen Kolonialarbeiten bestand eine weitere Gegenleistung des ruandischen Königs für die deutsche Hilfe zu seinem Machterhalt in der Bereitstellung von Schwarzen Soldaten zur Unterstützung der Deutschen. Insbesondere nach Beginn des ersten Weltkrieges, als deutsche Kolonialsoldaten im Kampf gegen Belgien nach Nord-Tansania verlegt wurde, griff Yuhi V dem inzwischen zum Major avancierten Max Wintgens unter die Arme und stellte der deutschen Armee mehrere tausend einheimische Männer zu Verfügung. Diese Schwarzen deutschen Soldaten - Indugaruga genannt - verließen 1916, als der Weltkrieg für das Deutsche Reich in Afrika bereits verloren war, zusammen mit der deutschen Armee das Land Richtung Burundi und Tansania. Nicht alle kehrten später nach Ruanda zurück.
Das Wirken der Deutschen in Ruanda währte nicht sonderlich lange und war - im Gegensatz zu anderen afrikanischen Gefilden - aufgrund der beschriebenen Geschäftsgrundlage von keinerlei Kolonialskandalen geprägt. Dies ist umso bemerkenswerter, als ungefähr zur gleichen Zeit Lothar von Trotha in Namibia sein Unwesen trieb und sich neben vieler anderer Verbrechen auch des Völkermords an den Herero und Nama schuldig machte. Im Vergleich dazu hinterließen die Deutschen aufgrund der beschriebenen Umstände in Ruanda keine tiefen machtpolitischen Spuren. Wohl aber hatten die offiziellen Vertreter des Deutschen Reiches jede Menge Missionare im Schlepp, protestantische ebenso wie katholische, die sich anheischig machten, den wahren Glauben zu verbreiten. Missionsstationen mit zum Teil riesigen Kirchen wurden errichtet ( z.B. in Rwaza), aber auch Schulen und Krankenstationen. Diese Missionsstationen dienten zugleich als Anlaufpunkte für das deutsche Militär. So war beispielsweise die Station Rubengera, am Kivu-See gelegen, während des ersten Weltkriegs ein zentraler Logistikpunkt für die deutsche Armee. Auch wurde über sie Material requiriert. Eindrucksvoll in diesem Zusammenhang ist die Geschichte des Bodelschwingh Bootes. Es war in Hamburg gebaut und in Teile zerlegt, über Mombasa und Bakoba nach Rubengera gebracht worden, um dem dortigen Pastor Roehl die Möglichkeit zu geben, den Kivu-See auf und ab fahrend zu predigen und zu missionieren. Das Schiff wurde 1914 requiriert, mit Maschinengewehren ausgestattet und diente fürderhin als Patrouillenboot. Beim Rückzug der Deutschen wurde es im Mai 1916 von ihnen im Musaho-Golf versenkt, um zu verhindern, dass es dem Feind in die Hände fiele.
Und auch städtebaulich hinterließen die Deutschen aufgrund ihres geringen Verwaltungs- und Siedlungsaufwands wenig Spuren. Das auf dem Nyarugenge Hügel in Kigali errichtete kleine Verwaltungszentrum - von den Einheimischen ‚Boma‘ genannt - bestand aus den bereits beschriebenen Gebäuden, von ihnen blieb im Laufe der Jahrzehnte lediglich das Wohnhaus von Kandt übrig.
Neben der Christianisierung ist ein weiteres Erbe der Deutschen die durch sie initiierte Einführung der Geldwirtschaft. War bis zu ihrer Ankunft der Handel der ursprünglich ansässigen Menschen durch den Tausch von Waren bestimmt worden, so bezahlten die Deutschen Askari, Träger, Hausangestellte und sonstige Dienstleister sowie alle Warenkäufe mit Geld.