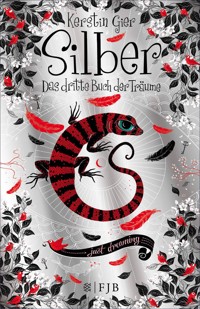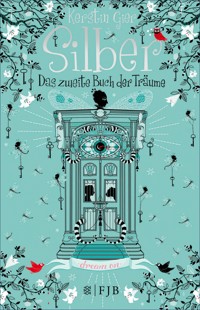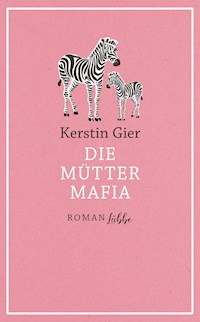12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Liebe geht durch alle Zeiten
- Sprache: Deutsch
Manchmal ist es ein echtes Kreuz, in einer Familie zu leben, die jede Menge Geheimnisse hat. Der Überzeugung ist zumindest die 16-jährige Gwendolyn. Bis sie sich eines Tages aus heiterem Himmel im London um die letzte Jahrhundertwende wiederfindet. Ihr wird schnell klar, dass sie selbst das größte Geheimnis ihrer Familie ist und dass man niemandem raten sollte, sich zwischen den Zeiten zu verlieben!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Kerstin Gier
Rubinrot. Liebe geht durch alle Zeiten
Mit Bonusszene und Grußwort von Kerstin Gier
Kerstin Gier im Arena Verlag: Saphirblau – Liebe geht durch alle Zeiten Smaragdgrün – Liebe geht durch alle Zeiten Jungs sind wie Kaugummi. Süß und leicht um den Finger zu wickeln
Alle Titel sind auch als Hörbuch erhältlich.
CONCORDE FILM zeigt eine Produktion der Lieblingsfilm und der mem-film in Koproduktion mit gff und Tele München. Ein Film von Felix Fuchssteiner & Katharina Schöde
RUBINROT mit Maria Ehrich, Jannis Niewöhner, Veronica Ferres, Uwe Kockisch, Katharina Thalbach, Gottfried John, Gerlinde Locker, Rüdiger Vogler, Florian Bartholomäi, Jennifer Lotsi, Josefine Preuss, Laura Berlin, Sibylle Canonica, Justine del Corte, Kostja Ullmann, Peter Simonischeck, Axel Milberg u.v.a. Casting: Daniela Tolkien · Ton: Magnus Pflüger · Sound Design: Daniel Iribarren Mischung: Olaf Mehl · Maske: Anette Keiser · Kostümbild: Janne Birck Szenenbild: Matthias Müsse · Produktionsleitung: Dirk Engelhard Herstellungsleitung: Thomas Blieninger · Kamera: Sonja Rom Schnitt: Wolfgang Weigl · Musik: Philipp F. Kölmel · Drehbuch: Katharina Schöde Nach dem Roman von Kerstin Gier · Produzenten: Thomas Blieninger, Philipp Budweg, Felix Fuchssteiner, Hans W. Geissendörfer, Robert Marciniak, Katharina Schöde, Markus Zimmer · Regie: Felix Fuchssteiner
Limitierte Sonderausgabe mit Filmbildern 2012 © 2009 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Covergestaltung: Frauke Schneider unter Verwendung des Filmplakats © 2012/13 Concorde Filmverleih und Illustrationen von Eva Schöffmann-Davidov © der Filmbilder: 2012/13 Concorde Filmverleih (Meike Birck) ISBN 978-3-401-80637-2
www.arena-verlag.de Mitreden unter www.rubinrotlesen.de
Inhaltsverzeichnis
Prolog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Epilog
Verzeichnis der wichtigsten Personen
Liebe Leserinnen und Leser
Filmfotos
Für Elch, Delphin und Eule, die mich beim Schreiben so treu begleitet haben, und für einen kleinen roten Doppeldeckerbus, der mich genau im richtigen Augenblick glücklich gemacht hat
Prolog
Hyde Park, London 8. April 1912
Während sie sich auf die Knie fallen ließ und anfing zu weinen, schaute er sich nach allen Seiten um. Wie er vermutet hatte, war der Park um diese Uhrzeit menschenleer. Joggen war noch lange nicht in Mode und für Penner, die auf der Parkbank schliefen, nur zugedeckt mit einer Zeitung, war es zu kalt.
Er schlug den Chronografen vorsichtig in das Tuch ein und verstaute ihn in seinem Rucksack.
Sie kauerte neben einem der Bäume am Nordufer des Serpentine Lake in einem Teppich verblühter Krokusse.
Ihre Schultern zuckten und ihr Schluchzen hörte sich an wie die verzweifelten Laute eines verwundeten Tiers. Er konnte es kaum ertragen. Aber er wusste aus Erfahrung, dass es besser war, sie in Ruhe zu lassen, also setzte er sich neben sie ins taufeuchte Gras, starrte auf die spiegelglatte Wasserfläche und wartete.
Wartete darauf, dass der Schmerz abebbte, der sie wahrscheinlich nie ganz verlassen würde.
Ihm war ganz ähnlich zumute wie ihr, aber er versuchte sich zusammenzureißen. Sie sollte sich nicht auch noch Sorgen um ihn machen müssen.
»Sind die Papiertaschentücher eigentlich schon erfunden?«, schniefte sie schließlich und wandte ihm ihr tränennasses Gesicht zu.
»Keine Ahnung«, sagte er. »Aber ich hätte ein stilechtes Stofftaschentuch mit Monogramm anzubieten.«
»G.M. Hast du das etwa von Grace geklaut?«
»Sie hat es mir freiwillig gegeben. Du darfst es ruhig vollschniefen, Prinzessin.«
Sie verzog den Mund zu einem schiefen Lächeln, als sie ihm das Taschentuch zurückgab. »Jetzt ist es ruiniert. Tut mir leid.«
»Ach was! In diesen Zeiten hängt man es zum Trocknen in die Sonne und benutzt es noch einmal«, sagte er. »Hauptsache, du hast aufgehört zu weinen.«
Sofort traten ihr wieder die Tränen in die Augen. »Wir hätten sie nicht im Stich lassen dürfen. Sie braucht uns doch! Wir wissen gar nicht, ob unser Bluff funktioniert, und wir haben keine Chance, es je zu erfahren.«
Ihre Worte gaben ihm einen Stich. »Tot hätten wir ihr noch weniger genutzt.«
»Wenn wir uns nur mit ihr hätten verstecken können, irgendwo im Ausland, unter falschem Namen, nur bis sie alt genug wäre . . .«
Er unterbrach sie, indem er heftig den Kopf schüttelte. »Sie hätten uns überall gefunden, das haben wir doch schon tausendmal durchgesprochen. Wir haben sie nicht im Stich gelassen, wir haben das einzig Richtige getan: Wir haben ihr ein Leben in Sicherheit ermöglicht. Zumindest die nächsten sechzehn Jahre.«
Sie schwieg einen Moment. Irgendwo in der Ferne wieherte ein Pferd und vom West Carriage Drive hörte man Stimmen, obwohl es noch beinahe Nacht war.
»Ich weiß, dass du recht hast«, sagte sie schließlich. »Es tut nur so weh zu wissen, dass wir sie nie wiedersehen werden.« Sie fuhr sich mit der Hand über die verweinten Augen. »Wenigstens werden wir uns nicht langweilen. Früher oder später werden sie uns auch in dieser Zeit aufstöbern und uns die Wächter auf den Hals hetzen. Er wird weder den Chronografen noch seine Pläne kampflos aufgeben.«
Er grinste, weil er die Abenteuerlust in ihren Augen aufblitzen sah, und wusste, dass die Krise vorerst überstanden war. »Vielleicht waren wir ja doch schlauer als er oder das andere Ding funktioniert am Ende gar nicht. Dann sitzt er fest.«
»Ja, schön wär’s. Aber wenn doch, sind wir die Einzigen, die seine Pläne durchkreuzen können.«
»Schon deshalb haben wir das Richtige getan.« Er stand auf und klopfte sich den Dreck von seiner Jeans. »Komm jetzt! Das verdammte Gras ist nass und du sollst dich noch schonen.«
Sie ließ sich von ihm hochziehen und küssen. »Was machen wir jetzt? Ein Versteck für den Chronografen suchen?«
Unschlüssig sah sie zur Brücke hinüber, die den Hyde Park von den Kensington Gardens trennte.
»Ja. Aber erst mal plündern wir die Depots der Wächter und decken uns mit Geld ein. Und dann könnten wir den Zug nach Southampton nehmen. Dort geht am Mittwoch die Titanic auf ihre Jungfernfahrt.«
Sie lachte. »Das ist also deine Vorstellung von schonen! Aber ich bin dabei.«
Er war so glücklich darüber, dass sie wieder lachen konnte, dass er sie gleich noch einmal küsste. »Ich dachte eigentlich . . . Du weißt doch, dass Kapitäne auf hoher See die Berechtigung haben, Ehen zu schließen, nicht wahr, Prinzessin?«
»Du willst mich heiraten? Auf der Titanic? Bist du irre?«
»Das wäre doch sehr romantisch.«
»Bis auf die Sache mit dem Eisberg.« Sie legte ihren Kopf an seine Brust und vergrub ihr Gesicht in seiner Jacke. »Ich liebe dich so sehr«, murmelte sie.
»Willst du meine Frau werden?«
»Ja«, sagte sie, das Gesicht immer noch an seiner Brust vergraben. »Aber nur, wenn wir spätestens in Queenstown wieder aussteigen.«
»Bereit für das nächste Abenteuer, Prinzessin?«
»Bereit, wenn du es bist«, sagte sie leise.
Eine unkontrollierte Reise durch die Zeit kündigt sich in der Regel einige Minuten, manchmal auch Stunden oder sogar Tage vorher durch Schwindelgefühle in Kopf, Magen und/oder in den Beinen an. Viele Gen-Träger berichten auch von migräneähnlichen Kopfschmerzen.
Der erste Zeitsprung - auch Initiationssprung genannt - findet zwischen dem 16. und 17. Lebensjahr des Gen-Trägers statt.
Aus den Chroniken der Wächter, Band 2, Allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten
1.
Montagmittag in der Schul-Cafeteria spürte ich es zum ersten Mal. Für einen Moment hatte ich ein Gefühl im Bauch wie auf der Achterbahn, wenn man von der höchsten Stelle bergab rast. Es dauerte nur zwei Sekunden, aber es reichte, um mir einen Teller Kartoffelpüree mit Soße über die Schuluniform zu kippen. Das Besteck schepperte zu Boden, den Teller konnte ich gerade noch festhalten.
»Das Zeug schmeckt ohnehin wie schon mal vom Boden aufgewischt«, sagte meine Freundin Leslie, während ich die Schweinerei notdürftig beseitigte. Natürlich schauten alle zu mir herüber. »Wenn du willst, kannst du dir meine Portion gerne auch noch auf die Bluse schmieren.«
»Nein, danke.« Die Bluse der Schuluniform von Saint Lennox hatte zwar zufälligerweise die Farbe von Kartoffelpüree, trotzdem fiel der Fleck unangenehm ins Auge. Ich knöpfte die dunkelblaue Jacke darüber zu.
»Na, muss die kleine Gwenny wieder mal mit ihrem Essen spielen?«, sagte Cynthia Dale. »Setz dich bloß nicht neben mich, Schlabbertante.«
»Als ob ich mich freiwillig neben dich setzen würde, Cyn.« Leider passierte mir öfter ein kleines Missgeschick mit dem Schulessen. Erst letzte Woche war mir eine grüne Götterspeise aus ihrer Alu-Form gehüpft und zwei Meter weiter in den Spaghetti Carbonara eines Fünftklässlers gelandet. Die Woche davor war mir Kirschsaft umgekippt und alle am Tisch hatten ausgesehen, als hätten sie die Masern. Und wie oft ich die blöde Krawatte, die zur Schuluniform gehörte, schon in Soße, Saft oder Milch getunkt hatte, konnte ich gar nicht mehr zählen.
Nur schwindelig war mir dabei noch nie gewesen.
Aber wahrscheinlich hatte ich mir das nur eingebildet. In letzter Zeit war bei uns zu Hause einfach zu viel von Schwindelgefühlen die Rede gewesen.
Allerdings nicht von meinen, sondern denen meiner Cousine Charlotte, die, wunderschön und makellos wie immer, neben Cynthia saß und ihren Kartoffelbrei löffelte.
Die ganze Familie wartete darauf, dass Charlotte schwindelig wurde. An manchen Tagen erkundigte sich Lady Arista – meine Großmutter – alle zehn Minuten, ob sie etwas spüre. Die Pause dazwischen nutzte meine Tante Glenda, Charlottes Mutter, um haargenau das Gleiche zu fragen.
Und jedes Mal, wenn Charlotte verneinte, kniff Lady Arista die Lippen zusammen und Tante Glenda seufzte. Manchmal auch umgekehrt.
Wir anderen – meine Mum, meine Schwester Caroline, mein Bruder Nick und Großtante Maddy – verdrehten die Augen. Natürlich war es aufregend, jemanden mit einem Zeitreise-Gen in der Familie zu haben, aber mit den Jahren nutzte sich das doch merklich ab. Manchmal hatten wir das Theater, das um Charlotte veranstaltet wurde, einfach über.
Charlotte selber pflegte ihre Gefühle hinter einem geheimnisvollen Mona-Lisa-Lächeln zu verbergen. An ihrer Stelle hätte ich auch nicht gewusst, ob ich mich über fehlende Schwindelgefühle freuen oder ärgern sollte. Na ja, um ehrlich zu sein, ich hätte mich vermutlich gefreut. Ich war eher der ängstliche Typ. Ich hatte gern meine Ruhe.
»Früher oder später ist es so weit«, sagte Lady Arista jeden Tag. »Und dann müssen wir bereit sein.«
Tatsächlich war es nach dem Mittagessen so weit, im Geschichtsunterricht bei Mr Whitman. Ich war hungrig aus der Cafeteria aufgestanden. Zu allem Überfluss hatte ich nämlich ein schwarzes Haar im Nachtisch – Stachelbeerkompott mit Vanillepudding – gefunden und war mir nicht sicher gewesen, ob es sich um mein eigenes oder das einer Küchenhilfe gehandelt hatte. So oder so war mir der Appetit vergangen.
Mr Whitman gab uns den Geschichtstest zurück, den wir letzte Woche geschrieben hatten. »Offenbar habt ihr euch gut vorbereitet. Besonders Charlotte. Ein A plus für dich.«
Charlotte strich sich eine ihrer glänzenden roten Haarsträhnen aus dem Gesicht und sagte »Oh«, als ob das Ergebnis eine Überraschung für sie sei. Dabei hatte sie immer und überall die besten Noten.
Aber Leslie und ich konnten diesmal auch zufrieden sein. Wir hatten beide ein A minus, obwohl unsere »gute Vorbereitung« darin bestanden hatte, uns die Elizabeth-Filme mit Cate Blanchett auf DVD anzuschauen und dazu Chips und Eis zu futtern. Allerdings hatten wir im Unterricht immer gut aufgepasst, was in anderen Fächern leider weniger der Fall war.
Mr Whitmans Unterricht war einfach so interessant, dass man gar nicht anders konnte, als zuzuhören. Mr Whitman selber war auch sehr interessant. Die meisten Mädchen waren heimlich oder auch unheimlich in ihn verliebt. Und Mrs Counter, unsere Erdkundelehrerin, ebenfalls. Sie wurde jedes Mal knallrot, wenn Mr Whitman an ihr vorbeiging. Er sah aber auch verboten gut aus, da waren sich alle einig. Das heißt alle, außer Leslie. Sie fand, Mr Whitman sähe aus wie ein Eichhörnchen aus einem Trickfilm.
»Immer wenn er mich mit seinen großen braunen Augen anguckt, will ich ihm Nüsse geben«, sagte sie. Sie ging sogar so weit, die aufdringlichen Eichhörnchen im Park nicht mehr Eichhörnchen zu nennen, sondern nur noch »Mr Whitmans«. Dummerweise war das irgendwie ansteckend und mittlerweile sagte ich auch immer: »Ach guck doch mal da, ein dickes, kleines Mr Whitman, wie süß!«, wenn ein Eichhörnchen näher hüpfte.
Wegen dieser Eichhörnchensache waren Leslie und ich sicher die einzigen Mädchen in der Klasse, die nicht für Mr Whitman schwärmten. Ich versuchte es immer wieder mal (schon weil die Jungen in unserer Klasse irgendwie alle total kindisch waren), aber es half nichts, der Vergleich zu einem Eichhörnchen hatte sich unwiderruflich in meinem Gehirn eingenistet. Und niemand hegt romantische Gefühle für ein Eichhörnchen!
Cynthia hatte das Gerücht in die Welt gesetzt, Mr Whitman habe neben dem Studium als Model gearbeitet. Als Beweis hatte sie eine Reklame-Seite aus einem Hochglanzmagazin ausgeschnitten, in dem ein Mann, der Mr Whitman nicht unähnlich sah, sich mit einem Duschgel einseifte.
Außer Cynthia glaubte allerdings niemand, dass Mr Whitman der Duschgel-Mann sei. Der hatte nämlich ein Grübchen im Kinn und Mr Whitman nicht.
Die Jungen aus unserer Klasse fanden Mr Whitman nicht so toll. Vor allem Gordon Gelderman konnte ihn nicht ausstehen. Bevor Mr Whitman an unsere Schule gekommen war, waren die Mädchen aus unserer Klasse nämlich alle in Gordon verliebt gewesen. Ich auch, wie ich leider zugeben muss, aber da war ich elf Jahre alt gewesen und Gordon irgendwie noch ganz niedlich. Jetzt, mit sechzehn, war er nur noch doof. Und seit zwei Jahren in einer Art Dauer-Stimmbruch. Leider hielt ihn das abwechselnde Gekiekse und Gebrumme nicht davon ab, ständig blödes Zeug zu reden.
Er regte sich schrecklich über sein F im Geschichtstest auf. »Das ist diskriminierend, Mr Whitman. Ich habe mindestens ein B verdient. Nur weil ich ein Junge bin, können Sie mir keine schlechten Noten geben.«
Mr Whitman nahm Gordon den Test wieder aus der Hand und blätterte eine Seite um. »Elisabeth I. war so krass hässlich, dass sie keinen Mann abbekam. Sie wurde deshalb von allen die hässliche Jungfrau genannt«, las er vor.
Die Klasse kicherte.
»Ja und? Stimmt doch«, verteidigte sich Gordon. »Ey, die Glupschaugen, der verkniffene Mund und voll die bescheuerte Frisur.«
Wir hatten die Gemälde mit den Tudors darauf in der National Portrait Gallery gründlich studieren müssen und tatsächlich hatte die Elisabeth I. auf den Bildern wenig Ähnlichkeit mit Cate Blanchett. Aber erstens fand man damals vielleicht schmale Lippen und große Nasen total schick und zweitens waren die Klamotten wirklich super. Und drittens hatte Elisabeth I. zwar keinen Ehemann, aber jede Menge Affären – unter anderem eine mit Sir . . . wie hieß er noch gleich? Im Film wurde er von Clive Owen gespielt.
»Sie nannte sich selber die jungfräuliche Königin«, sagte Mr Whitman zu Gordon. »Weil . . .« Er unterbrach sich. »Ist dir nicht gut, Charlotte? Hast du Kopfschmerzen?«
Alle sahen zu Charlotte hinüber. Charlotte hielt sich den Kopf. »Mir ist nur . . . schwindelig«, sagte sie und sah mich an. »Alles dreht sich.«
Ich holte tief Luft. Es war also so weit. Unsere Großmutter würde entzückt sein. Und Tante Glenda erst.
»Oh, cool«, flüsterte Leslie neben mir. »Wird sie jetzt durchsichtig?« Obwohl Lady Arista uns von klein auf eingetrichtert hatte, dass wir unter gar keinen Umständen mit irgendjemandem über die Vorkommnisse in unserer Familie reden dürften, hatte ich für mich selber beschlossen, dieses Verbot bei Leslie zu ignorieren. Schließlich war sie meine allerbeste Freundin und allerbeste Freundinnen haben keine Geheimnisse voreinander.
Charlotte machte zum ersten Mal, seit ich sie kannte (was genau genommen mein ganzes Leben war), einen beinahe hilflosen Eindruck. Aber dafür wusste ich, was zu tun war. Tante Glenda hatte es mir oft genug eingeschärft.
»Ich bringe Charlotte nach Hause«, sagte ich zu Mr Whitman und stand auf. »Wenn das okay ist.«
Mr Whitmans Blick ruhte immer noch auf Charlotte. »Das halte ich für eine gute Idee, Gwendolyn«, sagte er. »Gute Besserung, Charlotte.«
»Danke«, sagte Charlotte. Auf dem Weg zur Tür taumelte sie leicht. »Kommst du, Gwenny?«
Ich beeilte mich, ihren Arm zu nehmen. Zum ersten Mal kam ich mir in Charlottes Gegenwart ein bisschen wichtig vor. Es war ein gutes Gefühl, zur Abwechslung mal gebraucht zu werden.
»Ruf mich unbedingt an und erzähl mir alles«, flüsterte Leslie mir noch zu.
Vor der Tür war Charlottes Hilflosigkeit schon wieder verflogen. Sie wollte tatsächlich noch ihre Sachen aus dem Spind holen.
Ich hielt sie am Ärmel fest. »Lass das doch, Charlotte! Wir müssen so schnell wie möglich nach Hause. Lady Arista hat gesagt . . .«
»Es ist schon wieder vorbei«, sagte Charlotte.
»Na und? Es kann trotzdem jeden Augenblick passieren.« Charlotte ließ sich von mir in die andere Richtung ziehen. »Wo habe ich nur die Kreide?« Ich kramte im Gehen in der Jackentasche. »Ach, hier ist sie ja. Und das Handy. Soll ich schon mal zu Hause anrufen? Hast du Angst? Oh, dumme Frage, tut mir leid. Ich bin aufgeregt.«
»Schon okay. Ich habe keine Angst.«
Ich sah sie von der Seite an, um zu überprüfen, ob sie die Wahrheit sagte. Sie hatte ihr kleines, überlegenes Mona-Lisa-Lächeln aufgesetzt, unmöglich zu erkennen, welche Gefühle sie dahinter verbarg.
»Soll ich zu Hause anrufen?«
»Was soll denn das bringen?«, fragte Charlotte zurück.
»Ich dachte nur . . .«
»Du kannst das Denken getrost mir überlassen«, sagte Charlotte.
Wir liefen nebeneinander die Steintreppen hinunter, auf die Nische zu, in der James immer saß. Er erhob sich sofort, als er uns sah, aber ich lächelte ihm nur zu. Das Problem mit James war, dass niemand außer mir ihn sehen und hören konnte.
James war ein Geist. Deshalb vermied ich es, mit ihm zu sprechen, wenn andere dabei waren. Nur bei Leslie machte ich eine Ausnahme. Sie hatte nie auch nur eine Sekunde an James’ Existenz gezweifelt. Leslie glaubte mir alles und das war einer der Gründe, warum sie meine beste Freundin war. Sie bedauerte zutiefst, dass sie James nicht sehen und hören konnte.
Ich war darüber eigentlich ganz froh, denn das Erste, was James sagte, als er Leslie sah, war: »Himmelherrgott! Das arme Kind hat ja mehr Sommersprossen, als Sterne am Himmel sind! Wenn sie nicht schleunigst anfängt, eine gute Bleichlotion aufzutragen, wird sich niemals ein Mann für sie finden!«
»Frag ihn, ob er vielleicht irgendwo einen Schatz vergraben hat«, war hingegen das Erste, was Leslie sagte, als ich die beiden einander vorstellte.
Leider hatte James nirgendwo einen Schatz vergraben. Er war ziemlich beleidigt, dass Leslie ihm das zutraute. Er war auch immer beleidigt, wenn ich so tat, als sähe ich ihn nicht. Er war überhaupt recht schnell beleidigt.
»Ist er durchsichtig?«, hatte Leslie sich bei diesem ersten Zusammentreffen erkundigt. »Oder so schwarz-weiß?«
Nein, James sah eigentlich ganz normal aus. Bis auf die Klamotten natürlich.
»Kannst du durch ihn hindurchgehen?«
»Ich weiß nicht, ich hab’s noch nie versucht.«
»Dann versuch es jetzt mal«, hatte Leslie vorgeschlagen.
Aber James wollte nicht zulassen, dass ich durch ihn hindurchging.
»Was soll das heißen – Geist? Ein James August Peregrin Pimplebottom, Erbe des vierzehnten Earls von Hardsdale, lässt sich nicht beleidigen, auch nicht von kleinen Mädchen.«
Wie so viele Geister wollte er einfach nicht wahrhaben, dass er kein Mensch mehr war. Er konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, gestorben zu sein. Wir kannten uns mittlerweile seit fünf Jahren, seit meinem ersten Schultag auf der Saint Lennox High School, aber für James schien es nur ein paar Tage her zu sein, dass er im Club mit seinen Freunden eine Runde Karten gespielt und über Pferde, Schönheitspflästerchen und Perücken gefachsimpelt hatte. (Er trug beides, Schönheitspflästerchen und Perücke, was aber besser aussah, als es sich jetzt anhören mag.) Dass ich seit Beginn unserer Bekanntschaft um zwanzig Zentimeter gewachsen, eine Zahnspange und einen Busen bekommen hatte sowie die Zahnspange wieder losgeworden war, ignorierte er geflissentlich. Ebenso wie die Tatsache, dass aus dem Stadtpalais seines Vaters längst eine Privatschule geworden war, mit fließendem Wasser, elektrischem Licht und Zentralheizung. Das Einzige, das er von Zeit zu Zeit zu registrieren schien, war die Länge der Röcke unserer Schuluniform. Offenbar war der Anblick weiblicher Waden und Knöchel zu seiner Zeit höchst selten gewesen.
»Es ist nicht besonders höflich von einer Dame, einen höhergestellten Herrn nicht zu grüßen, Miss Gwendolyn«, rief er jetzt, wieder mal total eingeschnappt, weil ich ihm keine Beachtung schenkte.
»Entschuldige. Wir haben es eilig«, sagte ich.
»Wenn ich irgendwie behilflich sein kann, stehe ich selbstverständlich zur Verfügung.« James zupfte sich die Spitzenbesätze an seinen Ärmeln zurecht.
»Nein, vielen Dank. Wir müssen nur schnell nach Hause.« Als ob James irgendwie behilflich hätte sein können! Er konnte nicht mal eine Tür öffnen. »Charlotte fühlt sich nicht gut.«
»Oh, das tut mir leid«, sagte James, der eine Schwäche für Charlotte hatte. Im Gegensatz zu »der Sommersprossigen ohne Manieren«, wie er Leslie zu nennen pflegte, fand er meine Cousine ausschließlich »liebreizend und von bezaubernder Anmut«. Auch heute gab er wieder schleimige Komplimente von sich. »Bitte entrichte ihr meine besten Wünsche. Und sag ihr, sie sieht heute wieder einmal entzückend aus. Ein bisschen blass, aber zauberhaft wie eine Elfe.«
»Ich werde es ihr ausrichten.«
»Hör auf, mit deinem imaginären Freund zu sprechen«, sagte Charlotte. »Sonst landest du irgendwann noch in der Irrenanstalt.«
Okay, ich würde es ihr nicht ausrichten. Sie war ohnehin schon eingebildet genug.
»James ist nicht imaginär, er ist unsichtbar. Das ist ja wohl ein großer Unterschied!«
»Wenn du meinst«, sagte Charlotte. Sie und Tante Glenda waren der Ansicht, dass ich James und die anderen Geister nur erfand, um mich wichtig zu machen. Ich bereute es, ihnen jemals davon erzählt zu haben. Als kleines Kind war es mir allerdings unmöglich gewesen, über lebendig gewordene Wasserspeier zu schweigen, die vor meinen Augen an den Fassaden herumturnten und mir Grimassen schnitten. Die Wasserspeier waren ja noch lustig, aber es gab auch gruselig aussehende dunkle Geistgestalten, vor denen ich mich gefürchtet hatte. Bis ich begriff, dass Geister einem gar nichts anhaben können, hatte es ein paar Jahre gedauert. Das Einzige, was Geister wirklich tun können, ist, einem Angst einzujagen.
James natürlich nicht. Der war völlig harmlos.
»Leslie meint, es ist vielleicht ganz gut, dass James jung gestorben ist. Er hätte mit dem Namen Pimplebottom sowieso keine Frau abgekriegt«, sagte ich, nicht ohne mich zu vergewissern, dass James uns nicht mehr hören konnte. »Ich meine, wer will schon freiwillig Pickelpo heißen?«
Charlotte verdrehte die Augen.
»Er sieht allerdings nicht schlecht aus«, fuhr ich fort. »Und stinkreich ist er auch, wenn man ihm glauben darf. Nur seine Angewohnheit, sich ständig ein parfümiertes Spitzentaschentuch an die Nase zu halten, ist ein wenig unmännlich.«
»Wie schade, dass niemand außer dir ihn bewundern kann«, sagte Charlotte.
Das fand ich allerdings auch.
»Und wie dumm, dass du außerhalb der Familie über deine Absonderlichkeiten sprichst«, setzte Charlotte hinzu.
Das war wieder einmal so ein typischer Charlotte-Seitenhieb. Es sollte mich kränken und das tat es leider auch.
»Ich bin nicht absonderlich!«
»Natürlich bist du das!«
»Das musst du gerade sagen, Gen-Trägerin!«
»Ich quatsche das schließlich nicht überall herum«, sagte Charlotte. »Du hingegen bist wie Großtante Mad-Maddy. Die erzählt sogar dem Milchmann von ihren Visionen.«
»Du bist gemein.«
»Und du bist naiv.«
Streitend liefen wir durch die Vorhalle, vorbei am gläsernen Kabuff unseres Hausmeisters, hinaus auf den Schulhof. Es war windig und der Himmel sah aus, als ob es jeden Augenblick zu regnen anfinge. Ich bereute, dass wir nicht doch unsere Sachen aus den Spinden geholt hatten. Ein Mantel wäre jetzt gut gewesen.
»Tut mir leid, der Vergleich mit Großtante Maddy«, sagte Charlotte etwas zerknirscht. »Ich bin wohl doch etwas aufgeregt.«
Ich war überrascht. Sie entschuldigte sich sonst nie.
»Kann ich verstehen«, sagte ich schnell. Sie sollte merken, dass ich ihre Entschuldigung zu würdigen wusste. In Wahrheit konnte von Verständnis natürlich keine Rede sein. Ich an ihrer Stelle hätte vor Angst geschlottert. Aufgeregt wäre ich zwar auch gewesen, aber ungefähr so aufgeregt wie bei einem Zahnarztbesuch. »Außerdem mag ich Großtante Maddy.« Das stimmte wirklich. Großtante Maddy war vielleicht ein bisschen redselig und neigte dazu, alles viermal zu sagen, aber das war mir tausendmal lieber als das geheimnisvolle Getue der anderen. Außerdem verteilte Großtante Maddy immer großzügig Zitronenbonbons an uns.
Aber klar, Charlotte machte sich natürlich nichts aus Bonbons.
Wir überquerten die Straße und hasteten auf dem Bürgersteig weiter.
»Starr mich nicht so von der Seite an«, sagte Charlotte. »Du wirst schon merken, wenn ich verschwinde. Dann machst du dein blödes Kreidekreuz und rennst weiter nach Hause. Aber es wird gar nicht passieren, nicht heute.«
»Das kannst du doch gar nicht wissen. Bist du gespannt, wo du landen wirst? Ich meine, wann?«
»Natürlich«, sagte Charlotte.
»Hoffentlich nicht mitten im großen Brand 1664.«
»Der große Brand von London war 1666«, sagte Charlotte. »Das kann man sich doch wirklich leicht merken. Außerdem war dieser Teil der Stadt damals noch gar nicht großartig bebaut, ergo hat hier auch nichts gebrannt.«
Sagte ich schon, dass Charlottes weitere Vornamen »Spielverderberin« und »Klugscheißerin« waren?
Doch ich ließ nicht locker. Es war vielleicht gemein, aber ich wollte das blöde Lächeln wenigstens für ein paar Sekunden von ihrem Gesicht radiert sehen. »Wahrscheinlich brennen diese Schuluniformen wie Zunder«, bemerkte ich angelegentlich.
»Ich wüsste, was ich zu tun hätte«, sagte Charlotte knapp und ohne das Lächeln einzustellen.
Ich konnte nicht anders, als sie für ihre Coolness zu bewundern. Für mich war die Vorstellung, plötzlich in der Vergangenheit zu landen, einfach nur Angst einflößend.
Egal zu welcher Zeit, früher war es doch immer fürchterlich gewesen. Ständig gab es Krieg, Pocken und Pest, und sagte man ein falsches Wort, wurde man als Hexe verbrannt. Außerdem gab es nur Plumpsklos und alle Leute hatten Flöhe und morgens kippten sie den Inhalt ihrer Nachttöpfe aus dem Fenster, ganz gleich, ob da unten gerade jemand langging.
Charlotte war ihr ganzes Leben lang darauf vorbereitet worden, sich in der Vergangenheit zurechtzufinden. Sie hatte nie Zeit zum Spielen gehabt, für Freundinnen, Shopping, Kino oder Jungs. Stattdessen hatte sie Unterricht erhalten im Tanzen, Fechten und Reiten, in Sprachen und Geschichte. Seit letztem Jahr fuhr sie überdies jeden Mittwochnachmittag mit Lady Arista und Tante Glenda fort und kam erst spätabends zurück. Sie nannten es »Mysterienunterricht«. Über die Art der Mysterien wollte uns allerdings niemand Auskunft geben, am wenigsten Charlotte selber.
»Das ist ein Geheimnis«, war wahrscheinlich der erste Satz gewesen, den sie fließend hatte sprechen können. Und gleich danach: »Das geht euch gar nichts an.«
Leslie sagte immer, unsere Familie habe vermutlich mehr Geheimnisse als Secret Service und MI 6 zusammen. Gut möglich, dass sie recht hatte.
Normalerweise nahmen wir den Bus von der Schule nach Hause, die Linie 8 hielt am Berkeley Square und von dort war es nicht mehr weit bis zu unserem Haus. Heute liefen wir die vier Stationen zu Fuß, wie Tante Glenda es angeordnet hatte. Ich hielt den ganzen Weg lang die Kreide gezückt, aber Charlotte blieb an meiner Seite.
Als wir die Stufen zur Haustür erklommen, war ich beinahe enttäuscht. Hier endete nämlich mein Part an der Geschichte schon wieder. Ab jetzt würde meine Großmutter die Sache übernehmen.
Ich zupfte Charlotte am Ärmel. »Sieh mal! Der schwarze Mann ist wieder da.«
»Na und?« Charlotte sah sich nicht mal um. Der Mann stand gegenüber im Hauseingang von Nummer 18. Er trug wie immer einen schwarzen Trenchcoat und einen tief ins Gesicht gezogenen Hut. Ich hatte ihn für einen Geist gehalten, bis ich bemerkt hatte, dass meine Geschwister und Leslie ihn auch sehen konnten.
Er beobachtete seit Monaten beinahe rund um die Uhr unser Haus. Möglicherweise waren es auch mehrere Männer, die sich abwechselten und genau gleich aussahen. Wir stritten uns darüber, ob es sich um spionierende Einbrecher, Privatdetektive oder einen bösen Zauberer handelte. Letzteres war die feste Überzeugung meiner Schwester Caroline. Sie war neun und liebte Geschichten mit bösen Zauberern und guten Feen. Mein Bruder Nick war zwölf und fand Geschichten mit Zauberern und Feen blöd, deshalb tippte er auf die spionierenden Einbrecher. Leslie und ich waren für die Privatdetektive.
Wenn wir aber auf die andere Straßenseite gingen, um uns den Mann näher anzuschauen, verschwand er entweder im Haus oder er stieg in einen schwarzen Bentley, der am Bordstein parkte, und fuhr davon.
»Das ist ein Zauberauto«, behauptete Caroline. »Wenn niemand hinschaut, verwandelt es sich in einen Raben. Und der Zauberer wird zu einem winzig kleinen Männlein und reitet auf seinem Rücken durch die Luft.«
Nick hatte sich das Nummernschild des Bentleys notiert, für alle Fälle. »Obwohl sie das Auto nach dem Einbruch sicher umlackieren und ein neues Nummernschild montieren werden«, sagte er.
Die Erwachsenen taten so, als ob sie nichts Verdächtiges daran finden konnten, Tag und Nacht von einem schwarz gekleideten Mann mit Hut beobachtet zu werden.
Charlotte ebenfalls. »Was ihr nur immer mit dem armen Mann habt! Er raucht dort eine Zigarette, das ist alles.«
»Na klar!« Da glaubte ich ja noch eher die Version mit dem verzauberten Raben.
Es hatte angefangen zu regnen, keine Minute zu früh.
»Ist dir wenigstens wieder schwindelig?«, fragte ich, während wir darauf warteten, dass uns die Tür geöffnet wurde. Einen Hausschlüssel besaßen wir nicht.
»Nerv nicht so rum«, sagte Charlotte. »Es passiert, wenn es passieren soll.«
Mr Bernhard öffnete uns die Tür. Leslie meinte, Mr Bernhard sei unser Butler und der endgültige Beweis dafür, dass wir beinahe so reich waren wie die Queen oder Madonna. Ich wusste nicht genau, wer oder was Mr Bernhard wirklich war. Für meine Mum war er »Großmutters Faktotum« und unsere Großmutter selber nannte ihn »einen alten Freund der Familie«. Für meine Geschwister und mich war er einfach »Lady Aristas unheimlicher Diener«.
Bei unserem Anblick zog er die Augenbrauen in die Höhe.
»Hallo, Mr Bernhard«, sagte ich. »Scheußliches Wetter, nicht wahr?«
»Absolut scheußlich.« Mit seiner Hakennase und den braunen Augen hinter seiner runden goldfarbenen Brille erinnerte mich Mr Bernhard immer an eine Eule, genauer gesagt an einen Uhu. »Man sollte unbedingt einen Mantel anziehen, wenn man das Haus verlässt.«
»Ähm, ja, das sollte man wohl«, sagte ich.
»Wo ist Lady Arista?«, fragte Charlotte. Sie war nie besonders höflich zu Mr Bernhard. Vielleicht, weil sie im Gegensatz zu uns anderen schon als Kind keinen Respekt vor ihm gehabt hatte. Dabei hatte er die wirklich Respekt einflößende Fähigkeit, überall im Haus scheinbar aus dem Nichts hinter einem aufzutauchen und sich dabei so leise zu bewegen wie eine Katze. Nichts schien ihm zu entgehen und egal um welche Uhrzeit: Mr Bernhard war immer präsent.
Mr Bernhard war schon im Haus gewesen, bevor ich geboren wurde, und meine Mum sagte, ihn hätte es auch schon gegeben, als sie noch ein kleines Mädchen gewesen war. Deshalb war Mr Bernhard vermutlich fast genauso alt wie Lady Arista, auch wenn er nicht so aussah. Er bewohnte ein Appartement im zweiten Stock, das über einen separaten Korridor und eine Treppe vom ersten Stock aus zu erreichen war. Es war uns verboten, den Korridor auch nur zu betreten.
Mein Bruder behauptete, dass Mr Bernhard dort Falltüren und Ähnliches eingebaut hatte, um unliebsame Besucher abzuhalten. Aber beweisen konnte er es nicht. Niemand von uns hatte sich jemals in diesen Korridor gewagt.
»Mr Bernhard braucht seine Privatsphäre«, sagte Lady Arista oft.
»Jaja«, sagte dann meine Mum. »Die bräuchten wir hier wohl alle.« Aber sie sagte es so leise, dass Lady Arista es nicht hörte.
»Ihre Großmutter ist im Musikzimmer«, informierte Mr Bernhard Charlotte.
»Danke.« Charlotte ließ uns im Eingang stehen und lief die Treppe hinauf. Das Musikzimmer lag im ersten Stock, und warum es so hieß, wusste kein Mensch. Es stand nicht mal ein Klavier darin.
Das Zimmer war der Lieblingsraum von Lady Arista und Großtante Maddy. Die Luft darin roch nach Veilchenparfüm und dem Qualm von Lady Aristas Zigarillos. Gelüftet wurde viel zu selten. Es wurde einem ganz schummrig, wenn man sich länger dort aufhielt.
Mr Bernhard schloss die Haustür. Ich warf noch einen schnellen Blick an ihm vorbei auf die andere Straßenseite. Der Mann mit dem Hut war immer noch da. Täuschte ich mich oder hob er gerade die Hand, beinahe so, als ob er jemandem zuwinkte? Mr Bernhard vielleicht oder am Ende sogar mir?
Die Tür fiel zu und ich konnte den Gedanken nicht zu Ende verfolgen, weil urplötzlich das Achterbahngefühl von vorhin in meinen Magen zurückkehrte. Alles vor meinen Augen verschwamm. Meine Knie gaben nach und ich musste mich an der Wand abstützen, um nicht zu fallen.
Im nächsten Moment war es auch schon wieder vorbei.
Mein Herz klopfte wie verrückt. Irgendwas stimmte nicht mit mir. Ohne Achterbahn wurde einem nicht zweimal innerhalb von zwei Stunden schwindelig.
Es sei denn . . . ach Unsinn! Wahrscheinlich wuchs ich zu schnell. Oder ich hatte . . . ähm . . . einen Gehirntumor? Oder vielleicht einfach nur Hunger.
Ja, das musste es sein. Ich hatte seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. Das Mittagessen war ja auf meiner Bluse gelandet. Erleichtert atmete ich auf.
Jetzt erst bemerkte ich, dass Mr Bernhards Eulenaugen mich aufmerksam musterten.
»Hoppla«, sagte er, reichlich spät.
Ich spürte, wie ich rot wurde. »Ich geh dann mal . . . Hausaufgaben machen«, murmelte ich.
Mr Bernhard nickte mit gleichgültiger Miene. Aber während ich die Treppe hinaufging, spürte ich seine Blicke in meinem Rücken.
Aus den Annalen der Wächter 10. Oktober 1994
Zurück aus Durham, wo ich Lord Montroses jüngste Tochter Grace Shepherd besucht habe, die überraschenderweise vorgestern schon von ihrer Tochter entbunden wurde. Wir freuen uns alle über die Geburt von
Gwendolyn Sophie Elizabeth Shepherd 2460 g, 52 cm.
Mutter und Kind sind wohlauf. Unserem Großmeister zum fünften Enkelkind unsere herzlichsten Glückwünsche.
Bericht: Thomas George, Innerer Kreis
2.
Leslie nannte unser Haus »einen vornehmen Palast« wegen der vielen Zimmer, Gemälde, Holzvertäfelungen und Antiquitäten. Sie vermutete hinter jeder Wand einen Geheimgang und in jedem Schrank mindestens ein Geheimfach. Als wir noch jünger waren, gingen wir bei jedem ihrer Besuche auf Entdeckungsreise durch das Haus. Dass uns das Herumschnüffeln streng verboten worden war, machte es erst recht spannend. Wir entwickelten immer ausgebufftere Strategien, um uns nicht erwischen zu lassen. Im Laufe der Zeit hatten wir wirklich einige Geheimfächer und sogar eine Geheimtür gefunden. Sie lag im Treppenhaus hinter einem Ölgemälde, auf dem ein dicker Mann mit Bart und gezücktem Degen auf einem Pferd saß und grimmig guckte.
Bei dem grimmigen Mann handelte es sich laut Auskunft von Großtante Maddy um meinen Urururururgroßonkel Hugh und seine Fuchsstute mit Namen Fat Annie. Die Tür hinter dem Bild führte zwar nur ein paar Stufen hinab in ein Badezimmer, aber geheim war sie deshalb irgendwie trotzdem.
»Du bist ja so ein Glückspilz, dass du hier wohnen darfst!«, sagte Leslie immer.
Ich fand eher, dass Leslie ein Glückspilz war. Sie wohnte mit ihrer Mutter, ihrem Vater und einem zotteligen Hund namens Bertie in einem gemütlichen Reihenhaus in North Kensington. Da gab es keine Geheimnisse, keine unheimlichen Diener und keine nervenden Verwandten.
Früher hatten wir auch mal in so einem Haus gewohnt, meine Mum, mein Dad, meine Geschwister und ich, in einem kleinen Haus in Durham, in Nordengland. Aber dann war mein Dad gestorben. Meine Schwester war gerade ein halbes Jahr alt gewesen und Mum war mit uns nach London gezogen, wahrscheinlich weil sie sich einsam gefühlt hatte. Vielleicht war sie auch mit dem Geld nicht hingekommen.
Mum war in diesem Haus hier groß geworden, zusammen mit ihren Geschwistern Glenda und Harry. Onkel Harry lebte als Einziger nicht in London, er wohnte mit seiner Frau in Gloucestershire.
Zuerst war mir das Haus auch wie ein Palast vorgekommen, genau wie Leslie. Aber wenn man einen Palast mit einer großen Familie teilen muss, kommt er einem nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr so groß vor. Zumal es jede Menge überflüssige Räume gab, wie den Ballsaal im Erdgeschoss, der sich über die gesamte Hausbreite erstreckte.
Hier hätte man toll skaten können, aber das war verboten. Der Raum war wunderschön mit seinen hohen Fenstern, den Stuckdecken und den Kronleuchtern, aber zu meinen Lebzeiten hatte es hier nicht einen einzigen Ball gegeben, kein großes Fest, keine Party.
Das Einzige, das im Ballsaal stattfand, waren Charlottes Tanzstunden und ihr Fechtunterricht. Die Orchesterempore, die man von der Vorhalle über die Treppe erreichen konnte, war überflüssig wie ein Kropf. Außer vielleicht für Caroline und ihre Freundinnen, die die dunklen Winkel unter den Treppen, die von hier hinauf in den ersten Stock führten, beim Versteckspielen in Beschlag nahmen.
Im ersten Stock gab es das bereits erwähnte Musikzimmer, außerdem Lady Aristas und Großtante Maddys Räume, ein Etagenbad (das mit der Geheimtür) sowie das Esszimmer, in dem sich die Familie jeden Abend um halb acht zum Essen zu versammeln hatte. Zwischen dem Esszimmer und der Küche, die genau darunterlag, gab es einen altmodischen Speisenaufzug, mit dem sich Nick und Caroline manchmal zum Spaß gegenseitig auf- und abkurbelten, obwohl es natürlich streng verboten war. Leslie und ich hatten das früher auch immer gemacht, jetzt passten wir leider nicht mehr hinein.
Im zweiten Stock lagen Mr Bernhards Wohnung, das Arbeitszimmer meines verstorbenen Großvaters – Lord Montrose – und eine riesige Bibliothek. In diesem Stockwerk hatte auch Charlotte ihr Zimmer, es ging über Eck und hatte einen Erker, mit dem Charlotte gerne angab. Ihre Mutter bewohnte einen Salon und ein Schlafzimmer mit Fenstern zur Straße hin.
Von Charlottes Vater war Tante Glenda geschieden, er lebte mit einer neuen Frau irgendwo in Kent. Deshalb gab es außer Mr Bernhard keinen Mann im Haus, es sei denn, man zählte meinen Bruder mit. Haustiere gab es auch nicht, egal wie sehr wir auch darum bettelten. Lady Arista mochte keine Tiere und Tante Glenda war allergisch gegen alles, was Fell hatte.
Meine Mum, meine Geschwister und ich wohnten im dritten Stock, direkt unter dem Dach, wo es viele schräge Wände, aber auch zwei kleine Balkone gab. Wir hatten jeder ein eigenes Zimmer und auf unser großes Bad war Charlotte neidisch, weil das Bad im zweiten Stock keine Fenster hatte, unseres aber gleich zwei. Aber ich mochte es auch deswegen in unserem Stockwerk, weil hier Mum, Nick, Caroline und ich für uns waren, was in diesem Irrenhaus manchmal ein Segen sein konnte.
Nachteil war nur, dass wir verdammt weit weg von der Küche waren, was mir wieder mal unangenehm auffiel, als ich jetzt oben ankam. Ich hätte mir wenigstens einen Apfel mitnehmen sollen. So musste ich mich mit den Butterkeksen aus dem Vorrat zufriedengeben, den meine Mum im Schrank angelegt hatte.
Aus lauter Angst, das Schwindelgefühl könnte zurückkehren, aß ich elf Butterkekse hintereinander. Ich zog meine Schuhe und die Jacke aus, ließ mich auf das Sofa im Nähzimmer plumpsen und streckte mich lang aus.
Heute war irgendwie alles seltsam. Ich meine, noch seltsamer als sonst.
Es war erst zwei Uhr. Bis ich Leslie anrufen und meine Probleme mit ihr erörtern konnte, dauerte es noch mindestens zweieinhalb Stunden. Auch meine Geschwister würden nicht vor vier Uhr aus der Schule kommen und meine Mum machte immer erst gegen fünf bei der Arbeit Schluss. Normalerweise liebte ich es, allein in der Wohnung zu sein. Ich konnte in Ruhe ein Bad nehmen, ohne dass jemand an die Tür klopfte, weil er dringend auf die Toilette musste. Ich konnte die Musik aufdrehen und laut mitsingen, ohne dass jemand lachte. Und ich konnte im Fernsehen anschauen, was ich wollte, ohne dass jemand »aber jetzt kommt gleich Sponge Bob« quengelte.
Aber heute hatte ich zu alldem keine Lust. Nicht mal nach einem Schläfchen war mir zumute. Im Gegenteil, das Sofa – sonst ein Platz unübertroffener Geborgenheit – kam mir vor wie ein wackliges Floß in einem reißenden Fluss. Ich hatte Angst, es könne mit mir davonschwimmen, sobald ich die Augen schließen würde.
Um auf andere Gedanken zu kommen, stand ich auf und fing an, das Nähzimmer ein bisschen aufzuräumen. Es war so etwas wie unser inoffizielles Wohnzimmer, denn glücklicherweise nähten weder die Tanten noch meine Großmutter, weshalb sie höchst selten in den dritten Stock hinaufkamen. Es gab auch keine Nähmaschine hier, dafür eine enge Stiege, die hinauf aufs Dach führte. Die Stiege war nur für den Schornsteinfeger bestimmt, aber Leslie und ich hatten das Dach zu einem unserer Lieblingsplätze erkoren. Man hatte einen wunderbaren Ausblick von da oben und es gab keinen besseren Ort für Mädchengespräche. (Zum Beispiel über Jungs und dass wir keine kannten, in die es sich zu verlieben lohnte.)
Natürlich war es ein bisschen gefährlich, weil es kein Geländer gab, nur eine kniehohe Firstverzierung aus galvanisiertem Eisen. Aber man musste ja da auch nicht gerade Weitsprung üben oder bis an den Abgrund tanzen. Der Schlüssel, der zu der Tür auf dem Dach gehörte, lag in einer Zuckerdose mit Rosenmuster im Schrank. In meiner Familie wusste niemand, dass ich das Versteck kannte, sonst wäre sicher die Hölle los gewesen. Deshalb passte ich immer sehr auf, dass niemand mitbekam, wenn ich mich aufs Dach schlich. Man konnte sich dort auch sonnen, picknicken oder sich einfach nur verstecken, wenn man mal seine Ruhe haben wollte. Was ich wie gesagt oft wollte, nur gerade jetzt nicht.
Ich faltete unsere Wolldecken zusammen, fegte Kekskrümel vom Sofa, klopfte Kissen in Form und räumte herumfliegende Schachfiguren zurück in ihre Schachtel. Ich goss sogar die Azalee, die in einem Topf auf dem Sekretär in der Ecke stand, und wischte mit einem feuchten Tuch über den Couchtisch. Dann sah ich mich unschlüssig in dem nun tadellos aufgeräumten Zimmer um. Es waren gerade mal zehn Minuten vergangen und ich sehnte mich noch mehr nach Gesellschaft als vorher.
Ob Charlotte unten im Musikzimmer wieder schwindelig war? Was passierte eigentlich, wenn man vom ersten Stock eines Hauses im Mayfair des 21. Jahrhunderts ins Mayfair des, sagen wir mal, 15. Jahrhunderts sprang, als es an diesem Ort noch gar keine oder nur wenige Häuser gegeben hatte? Landete man dann in der Luft und plumpste sieben Meter tief auf die Erde? In einen Ameisenhaufen vielleicht? Arme Charlotte. Aber vielleicht lehrte man sie ja in ihrem mysteriösen Mysterienunterricht das Fliegen.
Apropos Mysterien: Mit einem Mal fiel mir etwas ein, womit ich mich ablenken konnte. Ich ging in Mums Zimmer und schaute hinunter auf die Straße. Im Hauseingang von Nummer 18 stand immer noch der schwarze Mann. Ich konnte seine Beine und einen Teil seines Trenchcoats sehen. So tief wie heute waren mir die drei Stockwerke noch nie vorgekommen. Spaßeshalber rechnete ich aus, wie weit es von hier oben bis zum Erdboden war.
Konnte man einen Sturz aus vierzehn Metern Höhe überhaupt überleben? Na, vielleicht, wenn man Glück hatte und in sumpfigem Marschland landete. Angeblich war ganz London mal sumpfiges Marschland gewesen, sagte jedenfalls Mrs Counter, unsere Erdkundelehrerin. Sumpf war gut, da landete man wenigstens weich. Allerdings nur, um dann elend im Schlamm zu ertrinken.
Ich schluckte. Meine eigenen Gedanken waren mir unheimlich.
Um nicht länger allein sein zu müssen, beschloss ich, meiner Verwandtschaft im Musikzimmer einen Besuch abzustatten, auch auf die Gefahr hin, wegen streng geheimer Gespräche wieder hinausgeschickt zu werden.
Als ich eintrat, saß Großtante Maddy auf ihrem Lieblingssessel am Fenster und Charlotte stand am anderen Fenster, ihren Hintern gegen den Louis-quatorze-Schreibtisch gelehnt, dessen bunt lackierte und vergoldete Oberfläche zu berühren, uns streng verboten war, egal mit welchem Körperteil. (Nicht zu fassen, dass etwas so Grottenhässliches wie dieser Schreibtisch so wertvoll sein konnte, wie Lady Arista immer behauptete. Er hatte nicht mal Geheimfächer, das hatten Leslie und ich vor Jahren schon herausgefunden.) Charlotte hatte sich umgezogen und trug anstelle der Schuluniform ein dunkelblaues Kleid, das wie eine Mischung aus Nachthemd, Bademantel und Nonnenkluft aussah.
»Ich bin noch da, wie du siehst«, sagte sie.
»Das ist . . . schön«, sagte ich, während ich mich bemühte, das Kleid nicht allzu entsetzt anzustarren.
»Es ist unerträglich«, sagte Tante Glenda, die zwischen den beiden Fenstern auf und ab ging. Wie Charlotte war sie groß und schlank und hatte leuchtend rote Locken. Meine Mum hatte die gleichen Locken und auch meine Großmutter war mal rothaarig gewesen. Caroline und Nick hatten die Haarfarbe ebenfalls geerbt. Nur ich war dunkel- und glatthaarig wie mein Vater.
Früher hatte ich auch unbedingt rote Haare haben wollen, aber Leslie hatte mich davon überzeugt, dass meine schwarzen Haare einen reizvollen Kontrast zu meinen blauen Augen und der hellen Haut bildeten. Leslie redete mir auch erfolgreich ein, dass mein halbmondförmiges Muttermal an der Schläfe – das Tante Glenda immer »komische Banane« nannte – geheimnisvoll und apart aussähe. Mittlerweile fand ich mich selber ganz hübsch, nicht zuletzt dank der Zahnspange, die meine vorstehenden Vorderzähne gebändigt und mir das Häschenähnliche genommen hatte. Auch wenn ich natürlich längst nicht so »liebreizend und voll bezaubernder Anmut« war wie Charlotte, um mit James zu sprechen. Ha, ich wünschte, er könnte sie in diesem Sackkleid sehen.
»Gwendolyn, Engelchen, möchtest du ein Zitronenbonbon?« Großtante Maddy klopfte auf den Schemel neben sich. »Setz dich doch zu mir und lenk mich ein bisschen ab. Glenda macht mich schrecklich nervös mit ihrem Hin- und Hergerenne.«
»Du hast ja keine Ahnung von den Gefühlen einer Mutter, Tante Maddy«, sagte Tante Glenda.
»Nein, das habe ich wohl nicht«, seufzte Großtante Maddy. Sie war die Schwester meines Großvaters und sie war nie verheiratet gewesen. Sie war eine rundliche, kleine Person mit fröhlichen blauen Kinderaugen und goldblond gefärbten Haaren, in denen nicht selten ein vergessener Lockenwickler steckte.
»Wo ist denn Lady Arista?«, fragte ich, während ich mir ein Zitronenbonbon nahm.