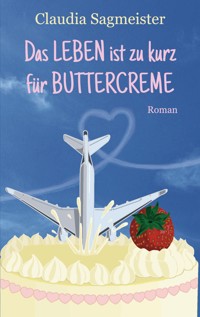Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: Meisinger Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Dass sich im Kühlfach des Krankenkauses eine Leiche befindet sollte eigentlich nicht ungewöhnlich sein, außer, es handelt sich dabei um den hauseigenen Physiotherapeuten, der ermordet wurde. Während Maxi und ihr Kollege Knogl diesmal unter erschwerten Bedingungen ermitteln müssen, fühlt sich die junge Kommissarin immer wieder von einem Motorradfahrer verfolgt. Und auch zu Hause ist Chaos vorprogrammiert, denn das Räum- und Renovierungskommando Mama und Tante Rosa hat seinen Besuch angekündigt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Claudia Sagmeister, geboren 1972, lebt mit ihrer Familie in Niederbayern. Ihr Erstlingswerk ‚Willkommen im Leben‘, sagte der Tod landete binnen weniger Wochen auf der BOD-Bestsellerliste. Ebenso der zweite Band Mit freundlichen Grüßen – Ihre Mafia!Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter.
Handlung und Personen dieses Romans sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht gewollt.
Für Celina
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapiel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 1
»Die haben da eine Leich’ im Kühlfach«, sagt der Knogl zur mir. Dabei macht er ein Gesicht, als wäre soeben ein Ufo in unserem Büro gelandet.
Den Telefonhörer hält er aber weiterhin fest an sein Ohr gepresst.
»Wir sollen sofort kommen«, ergänzt er und lässt, sichtlich überfordert mit der Information des Anrufers, langsam den Hörer sinken. Sein Blick schweift in die Ferne, als er schließlich auflegt.
»Aha. Und wer sind die?«, hake ich nach ein paar Sekunden notgedrungen nach, weil von seiner Seite her offensichtlich keine weitere Information mehr zu erwarten ist.
»’s Krankenhaus«, gibt er mir ungläubig zur Auskunft und nickt mit dem Kopf in die besagte Richtung, also dahin, wo seiner Meinung nach der Vogelsberg mit dem Krankenhaus auf der anderen Seite der Bergkuppe liegen soll.
»Dann wird das vermutlich nicht der einzige Tote sein, der bei denen im Kühlfach liegt, nehme ich mal an. Die haben da mit Sicherheit noch einige andere zwischengelagert«, kontere ich ironisch.
»Das schon …« Er schaut mich immer noch ziemlich kapierlos an, zögert einen kurzen Moment und setzt dann hinzu: »Aber den, den ich mein’, der g’hört da nicht hin.« Nachdenklich kaut er auf seiner Unterlippe. »Das ist nämlich ein Angestellter von denen und der sollt’ jetzt eigentlich bei der Arbeit sein.«
Einsatz! Wir informieren den Hafner über die spärlichen Einzelheiten, die uns bislang bekannt sind, und machen uns schnurstracks auf den Weg zum Krankenhaus.
Wie ich diesen Ort hasse. Ein Krankenhaus ist für mich immer das reinste Gruselkabinett. Schlimmer noch als Geisterbahnfahren. Aber das betrifft nicht nur das Krankenhaus von Schnaipfing, sondern jedes einzelne Krankenhaus auf der ganzen weiten Welt. Ich hasse praktisch alles daran. Angefangen von dem quietschenden Geräusch, das meine Schuhe auf dem meist vorsintflutlichen Linoleum- oder Steinfußboden erzeugen, sobald ich so ein Gebäude betrete, bis hin zu den langen, meist in kaltes Licht getauchten Fluren.
Kennen Sie das? Gefühlt überall piept oder surrt es von irgendwelchen lebensverlängernden Apparaten. Aber am allerschlimmsten ist der Geruch! Diese fiese Mischung aus Desinfektionsmittel, dahinwelkenden Blumen, Großküche und Tod. Die verursacht bei mir immer extremen Würgereiz. Und dabei hab’ ich gedacht, ich wäre dagegen mittlerweile immun geworden, denn vor etwa einem Jahr musste ich mit dem Knogl und einem weiteren Kollegen den Personenschutz für den Bauriesen Kainzbauer übernehmen. Und was soll ich sagen, je länger ich im Flur vor seinem Krankenzimmer Wache gesessen habe, umso weniger habe ich damals mit der Zeit dieses Krankenhausparfüm wahrgenommen. Es war fast wie eine Hyposensibilisierung gegen Heuschnupfen, bei mir halt gegen Krankenhaus, aber egal.
Leider hat dieser Effekt schon wieder nachgelassen, denn wir sind noch keine fünf Schritte im Gebäude, da fliegt es mich schon wieder regelrecht an. Am liebsten würde ich sofort wieder umdrehen und alles dem Knogl überlassen. Geht aber leider nicht.
Noch bevor wir an der Pforte nach dem Weg fragen können, winkt uns die freundliche Dame am Empfang bereits eilig weiter:
»Hier links und dann mit dem Aufzug ins zweite Untergeschoss. Die Chefin erwartet Sie bereits.«
»Gibt’s auch eine Treppe?«, erkundigt sich der Knogl.
»Das Treppenhaus ist gleich hinter der Glastür nach den Aufzügen. Nicht zu verfehlen.«
Erleichtert schnauft der Knogl auf: »Gott sei Dank.«
»Klaustrophobie?«, frage ich mitfühlend.
»Nein, ich hab’s bloß nicht so mit engen Räumen. Da wird’s mir immer ganz zweierlei. Und Aufzüge umgehe ich grundsätzlich, wo es geht.«
Statt einer Erklärung, dass ja genau das eine Klaustrophobie ist, verdrehe ich nur kopfschüttelnd die Augen. Hinter seinem Rücken, versteht sich. Das ist wieder mal typisch Knogl.
Wie erwähnt, werden wir bereits von der Chefin des Hauses, Frau Beer, im Flur des Untergeschosses erwartet.
»Herr Knogl, Frau Kommissarin.« Äußerst angespannt streckt sie uns ihre Hand entgegen und schüttelt sie mit einem kräftigen Händedruck. »Folgen Sie mir bitte.«
Sie legt gleich ein flottes Tempo vor. Stumm marschieren wir hinter ihr her. Nach wenigen Metern öffnet sie eine Tür und überlässt uns den Vortritt. Entgegen meiner Erwartung sind hier bereits einige Personen anwesend.
Eine junge Krankenschwester liegt mit geschlossenen Augen auf einer Liege. Im ersten Moment denke ich, es handele sich dabei um unser Opfer, doch das Mädchen scheint lediglich in Ohnmacht gefallen zu sein, denn eine Ärztin misst gerade Puls und Blutdruck bei ihr. Daneben steht eine weitere Krankenschwester, die ebenfalls sichtlich mitgenommen wirkt. Mit uns drei Neuankömmlingen ist der Raum nun gut gefüllt.
Überrascht stelle ich fest, dass es hier drinnen relativ neutral riecht. Also nicht so durchdringend, wie ich es auf den Stationsfluren empfinde. Damit weicht auch langsam die unprofessionelle Anspannung, unter der ich seit unserer Ankunft stehe.
Frau Beer übernimmt kurz die Vorstellung: »Frau Oberärztin Trampe-Tiersch, Herr Knogl von der örtlichen Polizei und seine Kollegin, Frau Kriminalkommissarin Meisinger.«
Ohne eine Miene zu verziehen, nickt uns die Ärztin kurz zu und widmet sich sofort wieder ihrer Patientin, die langsam zu Bewusstsein kommt.
»Das hier ist Schwester Ursula«, fährt Frau Beer fort, wobei sie die junge Schwester meint, die neben der Trage steht.
Ein schüchternes »Hallo« kommt von der Angesprochenen.
»Und auf der Trage haben wir noch Schwester Laura«, seufzt Frau Beer bedauernd und weist per Handzeichen in die besagte Richtung. Sie dreht sich zu uns und fügt im Flüsterton hinzu: »Schwester Laura ist die Tochter des Toten.«
»Knogl, du notierst dir bitte alle Namen«, weise ich den Kollegen an. Dann blicke ich mich im Raum um.
Die Leichenhalle ist ein kalter, kahler Raum, dessen Boden und Wände mit kleinen weißen Kacheln gefliest sind. Am Boden befindet sich ein kleiner Wasserablauf. Alles wirkt penibel sauber, ja fast schon steril. An der Wand längsseits zähle ich achtzehn Kühlfächer. Jeweils drei liegen übereinander. Achtzehn blitzblank polierte Edelstahlgriffe zeigen in dieselbe Richtung. Jedes Fach ist luftdicht verschlossen und von außen nicht einsehbar. Ich könnte nicht sagen, welches oder wie viele davon gerade belegt sind.
»Ja und, wo is’ er jetzt?«, reißt mich der Knogl unvermittelt aus meiner visuellen Bestandsaufnahme.
»Bitte wer?« Auch Frau Beer scheint kurzzeitig mit der Frage überrumpelt worden zu sein.
»Ja, der Tote halt. Wegen dem wir da sind.«
Ein leises Wimmern dringt von der Liege zu uns herüber.
»Psst! Ruhe!«, herrscht uns die Ärztin vorwurfsvoll an.
»Es wird wohl am besten sein, wenn wir uns draußen weiterunterhalten.« Frau Beer öffnet die Tür und zieht mich kurzerhand am Ellenbogen nach draußen.
Der Knogl trottet brav hinterher. Ehe ich mich’s versehe, stehen wir schon wieder auf dem düsteren Flur. Die Beer entfernt sich einige Schritte von der Leichenhalle und erwartet wohl, dass wir ihr folgen.
»So geht das nicht, Frau Beer!«, halte ich sie auf. »Wir müssen uns hier schon einen richtigen Überblick verschaffen können. Und das ist vom Flur aus ja schlecht möglich.«
Sie hebt beschwichtigend die Hände: »Das sollen Sie ja auch. Aber vielleicht warten wir noch, bis man Laura nach oben gebracht hat. Wie ich schon sagte, ist sie die Tochter des Toten und steht verständlicherweise unter Schock.«
»Das verstehe ich ja, aber was macht sie denn überhaupt hier unten? Wir haben noch keinerlei Informationen bekommen. Wir wissen weder etwas über die Tat noch über das Opfer, außer jetzt, dass es männlich ist, aber das war es dann auch schon. Die Leichenhalle könnte vielleicht sogar der Tatort gewesen sein. Jede Person, die sich hier nach der Tat aufhält, verwischt wichtige Spuren und macht es uns schwerer zu ermitteln. Die drei müssen raus, so schnell wie möglich. So können wir nicht arbeiten.«
Dieser Dilettantismus kotzt mich schon wieder an.
»Knogl, du lässt hier keinen mehr rein, verstanden! Sobald die drei draußen sind, wird die Leichenhalle abgeriegelt, bis die SpuSi mit allem durch ist.«
Den Knogl reißt es direkt, denn so einen Befehlston ist er von mir normalerweise nicht gewohnt. Mir fällt selbst auf, dass ich mich schon beinahe so anhöre wie der Hafner. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt gerade wurscht. So geht’s einfach nicht!
»Ja glauben Sie vielleicht, wir sind hier alle auf der Brennsuppe hergeschwommen?«, echauffiert sich jetzt die Beer. »Schwester Laura ist ja nicht zum Spaß im Leichenkammerl. Sie hat von ihrer Stationsleitung den Auftrag bekommen, gemeinsam mit Schwester Ursula einen verstorbenen Patienten in die Leichenhalle zu bringen. Laut unserem hausinternen Belegplan wäre Fach Nummer vier dafür vorgesehen gewesen. Es stellte sich jedoch heraus, dass sich in exakt diesem Fach bereits eine Leiche befand.«
»Und das war dann der Vater von dieser Schwester Laura? Krass!« Der Knogl bringt es mal wieder auf den Punkt. Ihm fällt regelrecht die Kinnlade nach unten.
Ich stoße ihn an.
»Kein Wunder, dass es die niederg’streckt hat«, sagt er überwältigt zu mir.
»Tja.« Frau Beer zuckt resignierend die Schultern.
Ein bisschen sehr empathielos, finde ich.
»Also. Der Tote heißt Robert Schütz und ist«, sie verbessert sich, »war Physiotherapeut bei uns im Haus.«
»Knogl, du notierst?«, erinnere ich meinen Kollegen an seine Aufgabe. »Alter? Familienstand?«, erkundige ich mich bei der Beer weiter.
»Herr Schütz müsste Mitte, Ende vierzig sein, dazu müsste ich aber erst in der Personalakte nachsehen, um es Ihnen genau sagen zu können. Er ist verheiratet. Seine Frau …« Die Beer stockt, weil sich just in diesem Moment der Fahrstuhl öffnet und eine Frau im blutverschmierten OP-Kittel auf uns zuhastet. Sie wirft der Krankenhauschefin nur einen gehetzten Blick zu und eilt grußlos an uns vorbei, um im nächsten Moment die Tür zum Leichenkammerl aufzureißen und darin zu verschwinden.
Ich habe das Gefühl, ich bin im falschen Film. Macht denn hier jeder, was er will? »Knogl, verdammt noch mal!«, herrsche ich meinen verdutzt dreinblickenden Kollegen an. »Du solltest doch aufpassen und keinen mehr da rein lassen!«
»Hast du die g’sehen? Die war voller Blut!«
»Ja, super. Und die ist jetzt auch da drinnen, am möglichen Tatort, und versaut uns womöglich die ganzen Spuren«, schimpfe ich laut los. Ich gebe dem Knogl einen Schubs. »Knogl, du gehst da jetzt rein und schmeißt die alle raus. Sofort! Sonst können wir das hier vergessen. Die von der SpuSi halten uns ja für blöd und was der Hafner zu dem ganzen Zirkus hier sagen wird, mag ich mir noch gar nicht vorstellen. Wer weiß, wer da noch alles auftaucht.«
Die Beer meldet sich wieder zu Wort. »Zur Erklärung, das war jetzt gerade die Frau des Toten, Viola Schütz. Sie ist bei uns Hebamme, was vielleicht ihren Aufzug etwas erklären mag. Es ist ja nur verständlich, dass sie sich um ihre Tochter sorgt und … vielleicht ihren Mann noch mal sehen will.«
»Scheiße!«, entfährt es mir, während ich entsetzt hochfahre. »Die darf auf gar keinen Fall ans Kühlfach. Ihre Empathie in allen Ehren, Frau Beer, aber Sie sorgen mir jetzt bitte unverzüglich dafür, dass dieser Raum auf der Stelle geräumt wird! Und du auch, Knogl.« Mein Ton lässt keinen Widerspruch zu. »Ist das klar?«, bekräftige ich noch einmal und sprinte los.
Zu meiner Erleichterung sehe ich sofort beim Eintreten, dass alle Kühlfächer noch fest verschlossen sind.
Frau Schütz steht an der Liege und wiegt ihre traumatisierte Tochter fest in den Armen.
Die junge Krankenschwester ist mit ihren Nerven völlig am Ende und wird immer wieder von heftigen Weinkrämpfen geschüttelt, wohingegen ihre Mutter relativ gefasst wirkt. Aber wahrscheinlich steht die noch unter Schock.
»Schwester Ursula, Sie können jetzt wieder zurück auf Ihre Station gehen, ich komme dann später noch mal zu Ihnen. Lassen Sie sich dort etwas zur Beruhigung geben.«
Während sich Schwester Ursula anschickt, den Raum zu verlassen, bemerkt die Beer meinen ungläubigen Blick. Erwartet die Frau allen Ernstes, dass diese Schwester nach so einem traumatisierenden Erlebnis gleich wieder ihre Arbeit aufnehmen kann?
»Sie können sich aber selbstverständlich auch für den restlichen Tag beurlauben lassen, wenn Sie möchten. Ich regle das mit ihrer Stationsleitung für Sie«, setzt sie darauf zögernd hinzu.
Schwester Ursula schüttelt den Kopf. »Danke, aber ich glaube, die Routine tut mir jetzt tatsächlich ganz gut. Zu Hause müsste ich immer daran denken, was passiert ist.« Sie strafft die Schultern. »Nein, Frau Beer, vielen Dank, aber ich bleibe hier.«
Man sieht der Beer die Erleichterung förmlich an.
Nachdem die Tür hinter Schwester Ursula ins Schloss gefallen ist, wendet Sie sich an mich: »Sie dürfen nicht glauben, dass mich das alles kalt lässt, Frau Kommissarin. Ganz gewiss nicht. Aber dieser verdammte Personalmangel. Wir laufen hier permanent auf Anschlag. Da fällt es einfach doppelt und dreifach ins Gewicht, wenn zusätzlich Personal ausfällt. Glauben Sie mir, ich würde das Mädchen liebend gerne nach Hause schicken, aber ich bin dankbar, wenn sie heute nach diesem schlimmen Erlebnis weiter für uns arbeiten kann.«
»Ich muss wieder hinauf zu meiner Entbindung.« Wir werden von der Frau des Toten unterbrochen. »Wäre es möglich …« Sie stockt. »Darf ich bitte vorher meinen Mann noch einmal sehen? Sie werden ihn ja sicher bald in die Gerichtsmedizin überführen lassen?«
»Wir haben ihn ja selbst noch nicht gesehen und können nicht sagen, in welchem Zustand sich der Leichnam befindet«, erwidere ich vorsichtig.
»Unversehrt«, kommt es von der Liege.
Schwester Laura blickt, den Oberkörper halb aufgerichtet, zu uns. »Man sieht ihm äußerlich nichts an.« Erneut fließen die Tränen. »Zumindest am Kopf nicht, soweit ich das sehen konnte.«
»Bitte. Nur einen kurzen letzten Blick«, bittet Frau Schütz erneut.
Ich nicke dem Knogl auffordernd zu, das Kühlfach zu öffnen.
»Ich mache das«, bietet sich die Oberärztin Trampe-Tiersch schnell an.
Nach einem zustimmenden Blick vom Knogl und mir kommt sie herüber und öffnet Kühlfach Nummer vier für uns. Ein dunkler Haarschopf kommt zum Vorschein. Bedächtig zieht sie das Metalltablett, auf dem der tote Körper liegt, ein wenig heraus. Nur so weit, dass Kopf und Oberkörper aus dem Kühlfach ragen. Für uns so weit erkennbar, trägt der Tote sportliche Bekleidung. Seine Berufsbekleidung, nehme ich an.
Frau Schütz betrachtet einen Moment lang stumm das bleiche Antlitz ihres Gatten. Sanft schimmern Tränen in ihren Augen, die sie tapfer versucht hinunterzuschlucken. Sie betrachtet ihn eine Weile stumm. Dann benetzt sie ihre Finger mit einem Kuss und will damit sein Haar berühren. Das geht nun allerdings doch nicht. Mit einem stummen Kopfschütteln halte ich sie davon ab.
»Es tut mir leid«, füge ich hinzu.
»Danke, dass ich ihn noch einmal sehen durfte.« Sie schnieft, strafft die Schultern und wendet sich der Ärztin zu. »Kümmern Sie sich bitte um Laura, ja? Ich muss noch diese eine Entbindung hinter mich bringen, und dann bringe ich sie selbst nach Hause.«
Nachdem die Ärztin eingewilligt hat, wendet sich die Hebamme erneut an uns: »Sie werden sicherlich einige Fragen an uns haben. Wäre es möglich, dass wir das bis auf morgen verschieben? Ich glaube, ich fühle mich heute noch nicht in der Lage dazu.«
»Ich denke, das ist machbar«, erwidere ich bereitwillig.
Der Knogl notiert sich die Adresse und wir vereinbaren ein Treffen für den Nachmittag des kommenden Tages. Dann eilt sie auch schon davon.
»Möchten Sie die Leiche jetzt genauer in Augenschein nehmen?« Oberärztin Trampe-Tiersch steht immer noch neben dem halb aus der Kühlung ragenden Toten. »Ich könnte Schwester Laura auf die Station bringen und Ihnen dann dabei behilflich sein. Sagen wir, so in etwa zehn bis fünfzehn Minuten?«
»Danke, aber wir warten damit, bis unser Forensiker hier ist«, lehne ich das Angebot ab.
»Wie Sie wollen. Ich dachte nur, Sie wollten sich so schnell wie möglich ein Bild von der Lage machen.«
»Genau. Und darum ist es wichtig, dass an der Leiche absolut nichts verändert wird.«
»Aber schlecht wär’s nicht, wenn wir schon mal einen klitzekleinen Blick darauf werfen könnten. Meinst’ nicht auch, Maxi?« Der Knogl stößt mich auffordernd an. »Nur mal so draufschauen. Wir müssen ihn ja nicht umdrehen.«
»Ich bringe Schwester Laura nach oben.« Frau Beer hakt die junge Frau unter. »Wird es denn gehen, oder soll ich einen Rollstuhl holen?«
»Nein, ich denke, ich schaffe es.«
»Während Sie hier unten Ihre Arbeit machen, suche ich in meinem Büro für Sie die Personalakte heraus. Sie können sich dann eine Kopie davon bei mir abholen.«
Eingehakt von der Oberärztin und der Krankenhauschefin, rutscht Laura langsam von der Liege. Ihre Beine zittern, als sie mit den Füßen den Boden berührt. Es dauert einen Moment, bis sie sie unter Kontrolle hat. Langsam verlässt sie am Arm der Beer das Leichenkammerl.
Nun sind wir nur noch zu dritt, abgesehen von den Toten unbekannter Zahl in den Kühlfächern. Die Vorstellung, hier bis zum Eintreffen der SpuSi mit dem überdrehten Knogl allein warten zu müssen, verursacht bei mir nun doch ein nervöses Magenkribbeln. Sie wissen ja, Krankenhäuser sind nicht so mein Ding und mit dem Leichenkammerl habe ich bisher noch keinerlei Bekanntschaft gemacht.
Der Knogl ist hibbelig wie ein kleines Kind an Weihnachten. Die Sensationslust blitzt nur so in seinen Augen. Ich würde ihm zutrauen, dass er ein Fach nach dem anderen aufreißt, sobald wir alleine sind, um nachzuschauen, ob wer drinnenliegt. Eine gruselige Vorstellung, aber völlig denkbar, denn er interessiert sich auffallend für die Kühlfächer und stellt der Ärztin jede Menge Fragen. Vielleicht sollte ich besser doch dem Vorschlag der Oberärztin zustimmen.
»Ach was soll’s«, willige ich ergeben ein. »Draufschauen können wir ja wirklich einmal. Aber nichts anfassen!«, ermahne ich die beiden streng.
Frau Trampe-Tiersch nickt und zieht vorsichtig das Metalltablett immer weiter bis zum Anschlag heraus.
»Als würde er schlafen, gell?«, spricht der Knogl meine Gedanken laut aus. Denn in der Tat wirkt die Leiche von Robert Schütz wie ein schlafender Mann, wäre da nicht diese wächserne Bleiche in seinem Gesicht. Auch das Heben und Senken des Brustkorbes beim Atmen fehlt logischerweise. Gelöst und zufrieden könnte man diesen entspannten Gesichtsausdruck nennen, den der Mann im Tod angenommen hat.
Ich ziehe mein Handy heraus und beginne, damit ein paar Fotos von der Leiche und der Umgebung zu machen.
Er trägt ein türkisfarbenes Poloshirt mit dem Logo des Klinikums auf der Brusttasche, eine weiße Hose und weiße Turnschuhe einer Marke mit schwarzen Streifen. Ich würde es als seine typische Berufskleidung bezeichnen.
Der Knogl und ich begutachten den Leichnam, so gut es geht von allen Seiten, ohne ihn jedoch anzufassen.
»Da sieht man nix, gell? Kein Blut, kein Garnix! Wie wenn er sich einfach mal so zum Schlafen hing’legt hätt’.«
»Ins Kühlfach?« Ich zeige ihm den Vogel.
»Ja das ist schon klar, dass man das nicht macht. Aber schau doch selber. Siehst du was?«
Es ist tatsächlich so, dass die Leiche rein äußerlich absolut unversehrt wirkt. Keine Einstich- oder Einschussstelle, keine Anzeichen eines Kampfes. Weder Blut noch Schmutz sind zu sehen. Aber das muss bei Mord ja nicht zwangsläufig der Fall sein.
»Ich könnte ihn gerne für Sie drehen.« Oberärztin Trampe-Tiersch steht dicht hinter mir und fixiert über meine Schulter den Toten.
»Auf keinen Fall. Wir warten auf unseren Forensiker.«
Sie schiebt mich unsanft beiseite und beugt sich leicht über das Gesicht des Toten. Frau Trampe-Tiersch schließt die Augen und es sieht fast so aus, als würde sie ihn gleich küssen. Dabei fallen ihre langen schwarzen Haare nach vorne. Geschickt nimmt sie diese mit einer Hand zurück, während sie den Kopf immer weiter nach unten neigt.
Was wird das jetzt, frage ich mich? Ehe ich einschreiten kann, stoppt sie und beginnt, sacht, aber konzentriert am Gesicht der Leiche zu schnuppern. Ruckartig erhebt sie sich wieder.
»Kein Bittermandelgeruch, keine Cyanid-Vergiftung«, stellt sie fest.
»Aha.« Ich bin zugegebenermaßen etwas verwirrt. »Wie viele Fächer sind eigentlich derzeit belegt?«, erkundige ich mich.
Mit einem der vielen Schlüssel an ihrem Bund öffnet sie ein kleines Fach, das neben der Tür in die Wand eingelassen ist, und entnimmt diesem ein Klemmbrett. »Das ist der Belegungsplan für die Fächer«, erklärt sie uns.
»Mal sehen. Fach eins, zwei und drei sind belegt. Nummer vier hätte eigentlich frei sein müssen, ist aber belegt, wie wir nun leider alle gesehen haben. Nummer fünf ist geleert worden, muss aber noch gereinigt und für die nächste Belegung vorbereitet werden. Nummer sechs wird heute abgeholt, in Nummer sieben liegt nun der Patient, den Laura und Ursula einlagern sollten, acht und neun sind frei und in Fach zehn liegt ein Dauergast. Elf und zwölf sind leer.«
»Was heißt das, zehn ist ein Dauergast?«, meldet sich der Knogl nun auch wieder einmal zu Wort.
Sie seufzt. »Ja, bei diesem Fall ist unglücklicherweise die Familie total zerstritten und es gibt noch niemanden, der sich für die Beerdigung zuständig fühlt. In diesem Fall bleibt die Leiche erst einmal bei uns. Wenn’s sein muss, auch mehrere Wochen.«
»Das ist ja gruselig. Da stirbst, und keiner will dich hab’n.« Der Knogl schüttelt fassungslos den Kopf.
»Ja, es gibt nichts, was es nicht gibt«, erwidert Frau Trampe-Tiersch ungerührt. »Dauergäste haben wir tatsächlich öfter mal. Das ist für uns nichts Ungewöhnliches. Allerdings bleiben die selten länger als ein bis zwei Wochen. Zum Beispiel, wenn die Familie in Urlaub ist und sich nicht sofort um die Bestattung kümmern kann, oder wenn Familienangehörige erst ausfindig gemacht werden müssen. Aber üblicherweise wird ein Verstorbener noch am selben Tag oder zumindest am nächsten vom jeweils beauftragten Bestattungsinstitut abgeholt.« Sie legt den Plan zurück ins Fach.
»Wie läuft so was in der Regel ab?«, erkundige ich mich interessiert.
Sie zieht eine Mappe mit verschiedenen Fächern heraus. »Hier drinnen ist für jedes Kühlfach ein Aktenfach, wenn man so sagen will. Für jeden Todesfall liegen hier ein Totenschein und das Übergabeprotokoll, für den Bestatter bereit. Tritt bei uns ein Sterbefall ein, beauftragen die Angehörigen ein Bestattungsunternehmen mit der Beerdigung. Dieses Unternehmen setzt sich dann mit uns in Verbindung und vereinbart einen Termin zur Abholung und der Leichenwärter übergibt den Toten an den Bestatter. Wie gesagt, die Leiche von Nummer sechs wird heute noch abgeholt. Vielleicht sind Sie ja noch da und können dabei zusehen. Dann sehen Sie selbst, wie das abläuft.«
»Das geht nicht!«, widerspreche ich ihr.
»Wie, das geht nicht?« Die Oberärztin blickt mich verständnislos an.
»Es wird hier niemand abgeholt, bis nicht alle Spuren von der SpuSi gesichert worden sind. Das dürfte Ihnen doch nun mittlerweile klar sein. Sie müssen das Bestattungsunternehmen informieren und die Abholung stoppen. Wir geben Bescheid, ab wann hier wieder jemand reindarf.«
»Und was machen wir, wenn der nächste Todesfall eintritt? Soll ich vielleicht auf den Stationen Bescheid geben, dass heute keiner mehr sterben darf, oder wie? Oder zumindest so lange nicht, bis hier die SpuSi durch ist«, blafft sie mich an.
»Dann muss eben dieser Tote so lange auf der Station bleiben, ich kann es auch nicht ändern«, schieße ich im gleichen Tonfall zurück. »Sie werden doch da irgendeinen Raum finden, wo man den so lange hineinschieben kann.«
»Bei dieser Hitze? Wissen Sie, was das heißt? Wie schnell die zu riechen beginnen?«
Es ist heute in der Tat sehr heiß. Eigentlich schon seit Wochen. Die Hitzewelle hat Schnaipfing fest im Griff. Doch hier im kühlen Kellerraum ist davon nichts zu spüren. Dass es auf den Stationen durchaus anders ist, glaube ich gerne, doch ich kann die Sache nun mal nicht ändern.
»Hören Sie, mir macht das auch keinen Spaß, aber es ist nun einmal, wie es ist. Unsere Jungs und Mädels von der Spurensicherung sind geübt und fix. Ich verspreche Ihnen, sobald sie durch sind und der Schütz auf dem Weg in die Gerichtsmedizin ist, geben wir Ihnen sofort Bescheid und Sie können wieder schalten und walten, wie Sie wollen.«
Sie schnaubt genervt. »Dann werde ich mal telefonieren gehen. Brauchen Sie den noch?« Sie nickt mit dem Kopf in Richtung des Toten, der noch immer aus dem Kühlfach ragt.
»Nein, vielen Dank. Jetzt gerade wird er nicht mehr benötigt.«
»Gut. Dann schiebe ich den Robert mal wieder zurück in die Kühlung. Nicht, dass es dem hier draußen noch zu warm wird.« Mit Schwung schiebt sie das Tablett wieder ins Fach und schlägt es zu. »Dann lasse ich Sie jetzt allein, bis Ihre Kollegen kommen«, verabschiedet sie sich bockig von uns und verlässt den Raum.
Es dauert Gott sei Dank nicht mehr lange, bis das Team da ist. Gemeinsam mit dem SpuSi-Fonsi, wie der Forensiker bei uns liebevoll genannt wird, übernehmen wir dann eine zweite äußerliche Leichenschau. Diesmal etwas genauer. Doch auch bei der zweiten Inaugenscheinnahme ist am Toten keine Verletzung zu sehen. Doch der Fonsi nimmt ihn ja sowieso mit in die Gerichtsmedizin, um ihn dort einer genaueren Untersuchung zu unterziehen. Danach wissen wir mehr.
Nachdem die letzten Details besprochen worden sind, verlassen auch der Knogl und ich fürs Erste das Leichenkammerl, nicht jedoch ohne die dringliche Bitte an die Kollegen, den Ort schnellstmöglich wieder freizugeben. Bevor wir das Krankenhaus verlassen können, müssen wir aber noch bei der Chefin, Frau Beer, vorbei, um uns eine Kopie der Personalakte von Robert Schütz aushändigen zu lassen.
»Ich frage mich bloß, wo ich auf die Schnelle einen Ersatz für die Frau Schütz hernehmen soll. Die wird ja jetzt auch einige Tage ausfallen, nach so einem tragischen Todesfall. Ganz abgesehen davon, hat sie ja auch Anspruch darauf.«
Sie wirkt fast ein wenig verzweifelt und erklärt uns auch gleich warum. »Hebammen sind in der heutigen Zeit fast noch dünner gesät als Krankenpfleger. Und wir haben in den nächsten Tagen Vollmond. Da kommen die Kinder in Scharen zu Welt. Fragen Sie mich nicht warum, aber es ist so. Davon zeugt jahrelange Erfahrung. Als wenn ich mit dem anderen Schmarrn nicht eh schon genug Sorgen hätte, kommt das auch noch dazu.«
Ich frage sie, was sie damit meint, doch sie winkt brüsk ab.
»Lassen wir das. Auf eine Stellenanzeige mehr oder weniger kommt es nicht mehr an. Der Verlust von Herrn Schütz ist so oder so ein herber Verlust für uns. – Ach herrje!«, fällt ihr auf einmal ein, »ich muss ja auch noch den Träger informieren. Sie haben ja jetzt alles, was Sie von mir brauchen, oder?«
»Ich habe da schon noch einige Fragen an Sie, Frau Beer.« Das gleicht ja fast einem Rauswurf. »Hatte Robert Schütz Probleme mit Patienten oder Kollegen?«
Die Beer wirkt etwas ungehalten. »Woher soll ich denn das wissen? Wissen Sie, wie viele Angestellte es in diesem Krankenhaus gibt?«
Ich verneine ihre Frage.
»Eben. Das weiß nicht einmal ich, ohne nachzusehen. Aber es sind sehr viele, kann ich Ihnen sagen. Und ich kenne nur die wenigsten davon persönlich. Herr Schütz war einer von denen, die mir bekannt waren, aber ob es Probleme gab und wenn ja, mit wem, das erfragen Sie bitte auf der Station, auf der er tätig war, und bei seiner Frau. Ich kann mich hier ja schließlich nicht um alles kümmern. Und nun bitte ich Sie, mich allein zu lassen. Ich habe noch allerhand zu tun und Sie ja sicherlich auch.«
Kapitel 2
»Die hat doch einen Knall!«, sag’ ich zum Knogl, als wir Sekunden später vor der Tür stehen. Doch der findet dieses Verhalten ganz normal und kommentiert es mit einem gemächlichen »Mhm«. Erst als wir bei unserem Dienstwagen angelangt sind, erwachen seine Lebensgeister wieder.
»Fahren wir noch zum Standl?«, fragt der mich eifrig.
»Dass du jetzt was essen kannst?« Ungläubig schüttle ich den Kopf.
»Warum denn nicht? Davon wird der Tote auch nicht mehr lebendig, aber mich hält’s am Leben. Mir ist eh schon ganz schlecht vor lauter Hunger.«
»Von mir aus«, willige ich ergeben ein. »Aber du fährst.«
Der Knogl grinst von einem Ohr zum anderen und fängt geschickt den Schlüssel auf, den ich ihm übers Autodach hinweg zugeworfen habe. Dann braust er mit einer Geschwindigkeit, die nicht ganz regelkonform ist, den Berg hinunter zum Stadtplatz und parkt wie immer mitten im Halteverbot.
»Stell dir mal vor, du stirbst und keiner will dich hab’n«, sagt der Knogl zum Heinz und zuzelt dabei genüsslich an seiner Weißwurst. Die Erzählungen der Oberärztin beschäftigen ihn scheinbar noch immer.
»Hä?«, entgegnet der Heinz verwirrt.
Durch die Ermittlungen im Krankenhaus sind wir heute relativ spät dran und die meisten Gäste haben ihr Mittagessen bereits eingenommen. Darum kann es sich der Besitzer vom Standl leisten, bei uns am Stehtisch selbst eine kleine Pause einzulegen.
»Ja, jetzt stell’s dir doch einfach mal vor. Du stirbst und keiner will für dich zuständig sein. Keins deiner Kinder. Das ist doch einfach nur traurig, oder? Allein schon, dass du tot bist und es keinen interessiert, aber dass es denen auch noch wurst ist, was mit dir passiert, das ist echt eine Sauerei«, empört sich der Knogl und setzt ohne Punkt und Komma hinzu: »Die Würstl sind übrigens echt super. Sind die vom Gerstl oder vom Summer?« Das irritiert den Heinz noch viel mehr.
»Äh, Gerstl. Sag einmal, Knogl, von welchen Kindern sprichst du denn überhaupt? Wir haben einen Sohn, der lebt aber in Australien und du hast, soviel ich weiß, überhaupt keine Kinder?«
Der Heinz kann dem Knogl überhaupt nicht folgen und ist sichtlich verwirrt.
»Beachte ihn gar nicht«, sag’ ich zum Heinz. »Die Hitze!«, füge ich als Erklärung hinzu. »Weißt’, es ist heute einfach wahnsinnig heiß!«, sag’ ich und deute dem Heinz damit an, dass der Knogl heute nicht mehr alle seine Sinne beisammenhat.
»Ich mein’ doch nur, rein hypothetisch.« Der Knogl beachtet mich gar nicht.
»Weißt du, was er meint?«, fragt mich der Heinz.
»Glaub schon. Aber mach dir keine Sorgen, das wird schon wieder«, beruhige ich ihn.
»Es ist wegen dem Krankenhaus.«
»Warum warst du denn im Krankenhaus? Karl, ist mit dir alles in Ordnung? Bist du krank, brauchst du Hilfe?«
Jetzt ist es dem Heinz sichtlich unwohl. Fürsorglich legt er bei seinen letzten Worten den Arm um den Knogl und schaut ihn mitleidig an.
Der Knogl mampft derweil ungehindert weiter seine Weißwürstl. Mittlerweile ist er bei Nummer vier angekommen. Ich musste bereits nach der ersten kapitulieren und die zweite liegen lassen, aber wie ich meinen verfressenen Kollegen kenne, packt er die auch noch.
Ich versteh’ sowieso nicht, wie man bei dieser Affenhitze heute etwas Warmes essen kann. Mir wären ein paar schöne kalte Wiener viel lieber gewesen, aber der Knogl hat einfach für mich mitbestellt. »Ich lad’ dich ein!«, hat er gesagt. Und jetzt hab’ ich den Salat oder besser gesagt die Weiße.
»Wir hab’n da einen Toten im Krankenhaus, wegen dem wir ermitteln müssen.«
»Knogl!« Ermahnend schüttle ich den Kopf, aber das hindert ihn nicht, munter weiterzuplappern.
»Und dabei hat uns die Ärztin erzählt, sie hätten noch eine andere Leiche im Kühlfach.«
»Knogl!!«, mahne ich ihn etwas schärfer. Umsonst.
»Die liegt da angeblich schon länger rum, weil die Verwandtschaft total zerstritten ist und sich keiner um die Beerdigung kümmern mag. Stell dir das einmal vor. Die werden jetzt erst einmal abwarten, wer bei der Erbschaft absahnt und der, der das meiste kriegt, der erbt dann auch die Leich’.«
»Hans-Karl Knogl!«, versuche ich entgeistert, ihn zur Raison zu bringen. Es ist bisher noch nie vorgekommen, dass ich ihn bei seinem vollen Namen anspreche, denn eigentlich kennt ihn jeder nur unter Karl oder Knogl. Nur die wenigsten wissen von seinem Doppelnamen, der ihm ein wenig peinlich ist, und selbst das kann ihn heute nicht stoppen. Es ist einfach unglaublich!
»Das ist so eine Sauerei, was da abläuft, da muss ich mich echt aufregen.«
»Man merkt’s!«, kommentiere ich machtlos.
»Im Kühlfach.« Der Heinz ist total verwirrt. »Ist er wirklich nicht krank?«, fragt er nun mich.
»Nicht mehr als sonst auch«, zwinkere ich ihm zu und deute mir verstohlen ans Hirn.
»Ja, wir haben da gerade einen neuen Fall reinbekommen und deswegen …«
»Und deswegen müssen wir jetzt auch schleunigst zurück ins Präsidium und unsere Arbeit aufnehmen. Mach’s gut, Heinz. Servus, Hilde!«, rufe ich und winke der Frau im hinteren Teil der Holzhütte beim Vorbeigehen zu. Den protestierenden Knogl ziehe ich untergehakt zum Auto, ehe der noch mehr ausplaudern kann.
»Sag einmal, spinnst du? Du kannst doch nicht über unseren Fall am Standl erzählen.«
»Geh zu, das war doch bloß der Heinz.«
»Trotzdem. Du weißt doch selber, wie das am Standl läuft. Wir haben mit den Ermittlungen noch nicht einmal richtig begonnen. Da wird nichts rumposaunt.«
Damit habe ich ihn beleidigt.
»Ich hab’ doch nichts rumposaunt«, empört er sich.
»Ach nein? Wir haben da einen Toten im Krankenhaus und die haben da noch einen Toten im Kühlfach liegen!«, äffe ich ihn nach. »Was ist das dann für dich, du Scherzkeks?«
Der Knogl schmollt.
»Du hättest denen wahrscheinlich auch noch den Namen des Opfers gesagt.«
»Schmarren.«
Scheinbar liege ich mit meiner Vermutung nicht ganz falsch, denn in den nächsten Minuten ist der Knogl ziemlich nachdenklich und wortkarg.
So liegt es an mir, den Dienststellenleiter Hafner über das Mordopfer in Kenntnis zu setzen.
»Robert Schütz?« Der Dienststellenleiter kratzt sich nachdenklich am Kopf. »Der Name sagt mir was. Lassen S’ mich überlegen, Meisinger. Robert Schütz – ja freilich, natürlich, selbstverständlich. Das war der Physiotherapeut, der mich damals nach meinem Bandscheibenvorfall wieder auf Vordermann gebracht hat, genau. Der Mann hat goldene Hände.«
»Hatte.«
»Wieso hatte?«
»Ja, weil er jetzt tot ist.«
»Ja richtig. Tragisch. Wirklich tragisch. Ein sehr angenehmer Mensch war das. Immer freundlich, immer korrekt. Schade drum. Was haben wir inzwischen zu diesem Fall?«
»Leider nicht viel. Der Tote wurde heute von seiner eigenen Tochter, die übrigens auch im Krankenhaus arbeitet, zusammen mit einer weiteren Krankenschwester in einem Kühlfach in der Leichenhalle aufgefunden.«
»Na sauber. Die arme Frau.«
»Unser Forensiker hat vor Ort noch eine äußerliche Leichenschau vorgenommen. Die war allerdings ergebnislos. Es gibt auch keinerlei Anhaltspunkte, dass der Fundort gleichzeitig der Tatort ist. Ich warte erst noch die Auswertungen der SpuSi und der Forensik ab, dann kann ich vielleicht mehr sagen. Morgen Nachmittag vernehme ich die Witwe des Mordopfers und die Tochter. Die steht natürlich unter Schock und kann heute nicht vernommen werden.«
»Gut so.«
Als ich die Tür zum Büro öffne, das sich der Knogl und ich teilen, höre ich gerade noch den Knogl telefonieren: »Und Sie schicken mir die Kopie dann bitte gleich an meine E-Mail-Adresse? Sehr gut. Vielen Dank. Auf Wiederhören.«
»Was für eine Kopie?«, hake ich skeptisch nach.
»Ach vom Belegplan.« Er winkt bedeutungslos ab. »Damit wir wissen, wer sozusagen die Nachbarn von unserem Opfer sind. Kann ja nicht schaden, oder?«
Dass der Knogl einmal Eigeninitiative zeigt, überrascht mich. »Gut gemacht, Knogl«, lobe ich ihn. Die nächste Stunde vertiefe ich mich in die Personalakte. Nach dieser zu urteilen, hat unser Opfer ein blütenweißes Hemd. Keine negativen Einträge, nichts. Auch sein polizeiliches Führungszeugnis ist tadellos. Ein unbeschriebenes Blatt, wie man so schön sagt. Und so lege ich mir zunächst eine Mindmap mit den Personen und spärlichen Daten an, die ich bis dato habe.
Kapitel 3
Der Briefkasten an meinem Gartentürchen quillt fast über. Weiß der Teufel, was in die Menschheit gefahren ist. Stapelweise Post, an mich adressiert, ziehe ich aus dem schmalen Schlitz. Leider ist nicht ein einziger bedeutsamer Brief für mich dabei. Nur Prospekte sämtlicher Möbelhäuser, Farbenhersteller und Bodenleger der näheren oder weiteren Umgebung, die mir ungefragt ihr Angebot unterbreiten wollen. Nachdem ich die ersten Umschläge geöffnet habe und mir vorstellen kann, was mich in den nächsten erwarten wird, werfe ich den ganzen Packen kurzentschlossen in den Papiermüll. Die haben es wohl alle zusammen auf mich abgesehen. Aber woher die alle meine Adresse haben, ist mir schleierhaft. An Gewinnspielen und Umfragen nehme ich grundsätzlich nicht teil, weil die nur an Adressen kommen wollen, um sie an dubiose Anbieter zu verkaufen. Schade um das schöne Geld, das mit dieser Werbeaktion an mich verplempert wurde. Noch bevor ich meine Haustür aufschließen kann, höre ich das Telefon klingeln. Ein Uraltkasten aus dem letzten Jahrtausend. Grau mit Schnur und Wählscheibe. Kennen Sie solche Geräte überhaupt noch? Ginge es nach mir, stünde dieses Relikt schon längst im Museum. Wir sind schließlich seit einigen Jahren im Zeitalter des Mobilfunks angekommen. Doch meine Mama besteht darauf, dass ich den Festanschluss behalte. Weil sie diese Nummer auswendig kennt! Ersparen Sie mir bitte jeden weiteren Kommentar. Sie ist allerdings auch die Einzige, die mich auf diesem Gerät anruft. Das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Ich bin total erledigt. Wie jeden Tag bin ich auch heute die Strecke vom Revier nach Haus zu Fuß gelaufen. Ist ja nicht weit. Und bei der ganzen Hockerei im Präsidium tut ein wenig Bewegung ganz gut. Aber heute bin ich echt ganz schön geschafft.
Ich hebe ab. »Servus, Mama.«
»Grüß dich, Mädi. Wie war dein Tag?«
»Wie immer.«
»So so. Gibt’s eine neue Leiche?«
»Ja«, erwidere ich kurz angebunden. Nicht, dass ich nicht gerne mit meiner Mama telefonieren würde, aber gerade wäre mir mehr nach einer Dusche und einem kühlen Pils auf der Treppe vorm Haus als nach Small Talk über meine Arbeit.
»Echt?« Die Mama ist begeistert. Wie immer, wenn es was zu ermitteln für mich gibt. »Erzähl!«, fordert sie mich euphorisch auf.
»Mama, du weißt doch ganz genau, dass ich dir darüber nichts erzählen darf. Erzähl du mir lieber, wie es euch geht. Was macht die Tante Rosa?«
»Ach die Rosa«, wiegelt die Mama ab. »Die trifft sich heute mit ein paar ehemaligen Kolleginnen. Alles ausrangierte Pfarrhaushälterinnen und Klosterschwestern. Sie kommt heute spät heim, hat sie g’sagt.«
Zu Ihrer Erklärung: Die Tante Rosa ist die Schwester meiner Mutter und war früher Haushälterin bei einem katholischen Pfarrer. Aber vielleicht wissen Sie das ja schon. Wir kennen uns ja nun schließlich schon eine geraume Zeit.
»Und was treibst du so?«, frage ich die Mama und werfe dabei einen wehmütigen Blick in Richtung Kühlschrank.
»Ich? Ach … ich habe heute ein bisserl im Internet rumgesurft, wie man so schön sagt.«
Rumgesurft – sie sagt es, wie man es schreibt. Ich lache. »Ja da schau her. Du wirst ja noch richtig modern auf deine alten Tage. Und? Bist du fündig geworden?«
»Ja … nein … Ich habe ja bloß ein bisserl so geschaut, was es alles gibt.«
Täusche ich mich, oder verheimlicht sie mir wieder etwas? Bei der Mama muss man immer auf der Hut sein. Sie tut immer ganz harmlos und dann – bäng! »Machst du das öfters?«
»Hin und wieder. Du, Mädi …« Sie zögert. »Es könnte sein, dass du in den nächsten Tagen ein bisserl mehr Post bekommst als sonst.«
»Aha. Und welche Art von Post kommt da auf mich zu?«, argwöhne ich.
»Nur ein bisserl Prospektmaterial, das ich für dich ang’fordert hab’.«
»Ach dir hab’ ich den ganzen Mist zu verdanken, der heute meinen Briefkasten verstopft hat«, rufe ich empört aus. Jetzt ist mir alles klar. »Sag einmal, was ist dir denn da wieder eingefallen? Wolltest du mich ärgern oder die Deutsche Post unterstützen?«
»Weder noch. Das ist alles wertvolles Informationsmaterial, das hab’ ich extra für dich b’stellt. Hast du dir die Prospekte schon ang’schaut?«
»Nein, weil ich gerade in dem Moment heimgekommen bin, als du angerufen hast. Und vorher musste ich noch den ganzen Mist aus dem Briefkasten fischen und entsorgen. Worüber soll ich mich denn überhaupt informieren?«
»Also hast es dir nicht ang’schaut?« Sie klingt empört.
»Nein, wie gesagt, ich hab’ alles in die Papiertonne geworfen.«
»Also wirklich. Tu nichts Gutes!«
Ist sie jetzt sauer? Zumindest klingt sie gerade so.
»Das holst du jetzt sofort alles wieder raus, hörst du? Die Prospekte sind wichtig, die werden noch gebraucht.« Jetzt hat sie wieder diesen Befehlston drauf, der mich echt auf die Palme bringt. Als wenn ich ein kleines Kind wäre.
Ich versuche zu widersprechen, doch sie lässt mich nicht zu Wort kommen.
»Die Rosa und ich kommen am Wochenende vorbei und dann schauen wir das alles zusammen mit dir durch.«
Ja freilich. An meinem hart verdienten Wochenende. Davon kann sie auch nur träumen. »Am Wochenende geht’s nicht. Da will ich mit dem Motorrad eine Tour machen. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit.« Ich hoffe, damit nehme ich ihr den Wind aus den Segeln.
»Zum Daniel nach Straubing?«, erkundigt sie sich hoffnungsvoll.
Daniel Freese ist ein Freund und Kollege, der für das Drogendezernat in Straubing arbeitet. Wir haben uns bei einer Gruppenreise an den Gardasee kennengelernt. Die Reise war mein Geburtstagsgeschenk für die Mama zu ihrem Siebzigsten. Ohne Vorwarnung hatte sich die Tante Rosa ebenfalls der Reisegruppe angeschlossen und war plötzlich wie vom Erdboden verschwunden. Aber das ist eine andere Geschichte. Dass sie wiedergefunden wurde, daran hatte Daniel einen nicht unerheblichen Anteil.
Die Mama und die Tante Rosa sähen es gerne, wenn aus uns ein Paar werden würde. Ich bin mir aber selbst noch nicht sicher, was ich will, denn von Männern hab’ ich eigentlich die Nase gestrichen voll. Mir reichen schon die zwei, mit denen ich zusammenarbeite. Der Knogl und der Hafner, mein Dienststellenleiter.
»Nein, ich habe eine Tour in den Bayerischen Wald geplant«, antworte ich wahrheitsgemäß und ernte damit natürlich die Missbilligung meiner Mama. War ja klar.
»Zz, zz, zz«, schnalzt es durch den Hörer. »Die wird ja nicht das ganze Wochenende dauern. Die Rosa und ich kommen am Samstag vorbei und bringen Kuchen mit. Dann schauen wir uns alle zusammen in Ruhe die Prospekte durch und am Sonntag hast du immer noch den ganzen Tag Zeit, um mit deiner Maschine durch die Gegend zu rasen.«
»Ich rase nicht. Und was hat das überhaupt mit diesen verflixten Prospekten auf sich? Kannst du mir das bitte erklären.«
»Na wegen der Renovierung. Wir müssen doch Farben für die Wände aussuchen und neue Möbel. Vielleicht lassen wir im Wohnzimmer einen Teppich verlegen, was meinst?«
»Was ich meine? Dass alles so bleibt, wie es ist. Das meine ich.« Langsam werde ich echt sauer. Jetzt geht diese Übergriffigkeit schon wieder los. Im letzten Jahr standen die Mama und die Tante Rosa völlig ohne Vorwarnung bei mir im Haus und haben »entrümpelt«, und ich war absolut machtlos dagegen. Damals drohten sie mir an, dieses Jahr zu renovieren. Ich hatte gehofft, sie hätten es bis dahin vergessen. Leider nicht.
Ich versuche, mich zu beruhigen, und zähle in Gedanken bis fünf. »Mama, ich fühle mich wirklich wohl in meinem Haus und das bisschen weißeln kann ich auch alleine machen«, schlage ich einen sanfteren Ton an. Irgendwann einmal, aber ganz bestimmt nicht jetzt, setze ich in Gedanken hinzu.
»Mädi, jetzt hör mir mal gut zu«, setzt die Mama an. »Du hast dieses schöne alte Haus von deiner Großtante vererbt bekommen. Das ist nun dein Haus und so soll es auch ausschauen. Dazu muss man aber was verändern. Neue Farben, eine gemütliche Einrichtung …«
»Ich habe es gemütlich«, werfe ich ein. Na ja, jedenfalls beinahe gemütlich. Aber ich bin ja sowieso die meiste Zeit außer Haus. In der Arbeit oder mit meinem Motorrad auf Tour. Für mich reicht es, wie es ist. Das sieht die Mama allerdings anders. »Ich mag die alten Möbel von der Tante Fanni. Die alten Schränke, die urige Küche …«, zähle ich auf.