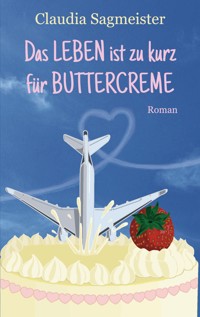Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
So hatte sich Maxi ihren Einstand in Niederbayern nicht vorgestellt. Ihre Siebensachen hängen in Frankfurt beim Döner-Ali fest und der neue Dienststellenleiter will sie gleich wieder loswerden, denn "Mord gibt es hier nicht!". Nichts-desto-trotz wird das Donauufer bald zu einem Leichenfundort und eine Reihe Mordversuche erschüttern das beschauliche Schnaipfing. Die Kriminalkommissarin mit den blonden Dreadlocks findet sich im Wettlauf mit der Zeit wieder. Und zu allem Überfluss ist da ja auch noch die Mama, die nicht akzeptieren will, dass ihr "Mädi" eine erwachsene Frau ist und ganz gut alleine klarkommt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Claudia Sagmeister lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Dorf in Niederbayern. Ihre Kurzgeschichte „Der Zettel“ wurde 2021 beim ersten Deggendorfer Literaturknödl mit dem zweiten Preis ausgezeichnet. „,Willkommen im Leben‘, sagte der Tod“ ist ihr Debütroman als Schriftstellerin.
Handlungen und Personen dieses Romans sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden und toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Für Maria
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Dankeschön!
Kapitel 1
Es ist der Geruch von Leichen, der gleichsam wie aufsteigender Nebel über den Kiesstrand wabert. Dieser fauligsüße Duft, der direkt in meine Nase zieht und von dort unaufhaltsam hinab bis zum Magen wandert, um als brennend-stechender Würgereiz wieder hervorzutreten. Ich kenne diesen Geruch nur allzu gut.
Das war es dann wohl mit der Ruhe. Eigentlich wollte ich hier am Donauufer nur einen kurzen Zwischenstopp einlegen, bevor ich mich auf den Weg in mein neues Zuhause mache. Daraus wird nun wohl so schnell nichts werden.
Im Westen färbt die untergehende Sonne den Himmel in leuchtend warme Farben. Bald setzt die Dunkelheit ein, darum ist Eile geboten, wenn ich fündig werden will.
So verlasse ich meinen Platz auf dem alten Baumstamm und suche mit wachsamen Blicken die nähere Umgebung ab.
Natürlich könnte ich meine neuen Kollegen von der PI Schnaipfing informieren, doch wenn es sich bei dem Fund um ein großes Tier handeln sollte und nicht um einen Menschen, wäre das ein peinlicher Einstand als Kriminalkommissarin.
Wenige Meter von meinem Sitzplatz entfernt, versteckt hinter einigem Gestrüpp, werde ich schließlich fündig. Zwischen leeren Flaschen und kalter Holzkohle liegt vor einer Steilwand aus Lehm der leblose Körper, das Gesicht von mir abgewandt.
Ich greife nach meinem Handy und setze den Notruf ab. Das geht ja schon gut los!
„Vom Zustand der Leiche her liegt die mindestens zwei bis drei Tage, wenn nicht länger hier“, diagnostiziert der Arzt. Er dreht den Leichnam auf den Rücken.
Kein schöner Anblick. Mir wird leicht übel.
Fliegen tummeln sich bereits auf dem leblosen Körper. Am Kopf klebt eingetrocknetes Blut. Er trägt schmutzige Kleidung und wirkt auch sonst ungepflegt, ein Penner, schließe ich daraus. Während der Arzt eine erste Leichenschau vornimmt, betrachte ich mir die Umgebung etwas näher.
Es sieht wie ein verborgener Lager- oder Grillplatz aus. Einzelne Felsbrocken dienen als Sitzfläche vor einem Rund aus großen Flusskieseln. In der Mitte eine dunkle Mischung aus erkalteter Asche und Resten von Grillkohle.
„Der Schachtner!“, vernehme ich einen der anwesenden Feuerwehrmänner. Mittlerweile ist es so dunkel geworden, dass die hiesige Feuerwehr das Ausleuchten des Fundortes übernehmen muss.
„Denen bleibt auch wirklich nix erspart“, raunt ein weiterer.
„Todesursache?“, erkundigt sich ein Kollege, den ich aufgrund seiner Abzeichen als einen der Ranghöheren erkenne.
„Vermutlich Genickbruch. Könnt mir vorstellen, dass er die Abkürzung über den Hang nehmen wollt und abgestürzt ist, aber genau lässt sich das erst nach der Obduktion sagen.“ Der Arzt unterschreibt den Totenschein und reicht ihn dann einem der Uniformierten. In gebührendem Abstand warten bereits die ‚schwarzen Herren‘ darauf, den Leichnam abtransportieren zu können.
„Gerichtsmedizin!“, lautet die knappe Ansage, dann verschwindet der Körper in einer Zinkwanne. Nachdem sich der Arzt verabschiedet hat, kommen die beiden Polizisten auf mich zu.
„Sie haben den Toten aufgefunden? Name, Anschrift?“
„Kriminalkommissarin Maximiliane Meisinger, also eigentlich werd ich Maxi genannt“, stelle ich mich vor und strecke dem, der mich angesprochen hat, die Hand entgegen.
Ja, Sie haben recht. Maximiliane ist wirklich ein bescheuerter Name. Aber dafür kann ich nichts, das haben meine Eltern verbrochen. Sie hatten sich einen Sohn gewünscht. Einen Maximilian. Da daraus leider nichts wurde, hängten sie kurzerhand ein „e“ an den Namen. Ich mache das Beste daraus und nenne mich Maxi.
Der Gruß bleibt unerwidert. Stattdessen sieht mich mein Gegenüber prüfend an.
„Ich bin Ihre neue Kollegin!“, füge ich daher erklärend hinzu, falls er das gerade nicht verstanden haben sollte.
Die dargebotene Hand ignoriert er weiterhin. „Das glaub ich nicht“, sagt er stattdessen. „Uns wurde ein Maximilian Meisinger angekündigt.“
„Da liegt dann wohl ein Missverständnis vor“, bemühe ich mich, immer noch freundlich, den Kollegen über den Irrtum aufzuklären. „Vielleicht haben Sie das ‚e‘ überlesen, ist ja nicht so schlimm. Jedenfalls freu ich mich drauf, übermorgen bei der PI Schnaipfing meinen Dienst anzutreten.“
Zornesröte steigt ihm ins Gesicht. „Das werden wir erst noch sehen. Das wäre ja absolut bodenlos, wenn die uns eine Frau schicken würden. Weiber haben in diesem Beruf nix verloren!“
„Entschuldigung, ich kann Sie hören!“, erinnere ich ihn an meine Anwesenheit. Aus der Innentasche meiner Jacke ziehe ich ein Schriftstück hervor. „Wenn Sie einen Beweis dafür brauchen, dass ich hierher versetzt wurde, bitte schön!“, sage ich, immer noch bemüht, ruhig zu bleiben, und reiche ihm das Papier.
Kopfschüttelnd liest er es. „Unglaublich! Aber machen wir uns nix vor, viel Arbeit gibt’s hier für Sie ohnehin nicht. Auch wenn Sie zum Einstand gleich eine Leiche gefunden haben. Das mit dem Schachtner war ein tragischer Unfall, mehr nicht. Wir sind eine beschauliche Kleinstadt. Mord und Totschlag gibt’s hier nicht. Am besten packen Sie Ihre Sachen erst gar nicht aus.“ Er wendet sich dem Kollegen zu. „Knogl, Sie fahren zur Familie und überbringen die Todesnachricht.“ Für mich hat er nicht mehr als ein knappes Kopfnicken übrig, dann dreht er sich wortlos um und verschwindet.
Was bitte schön war das gerade? Ich bin so perplex, dass mir fast die Kinnlade nach unten fällt.
„Mach dir nix draus.“
Um ein Haar hätte ich vergessen, dass ich nicht allein bin.
„Es scheißt ihn halt einfach gewaltig an, dass wir einen Kriminaler vor die Nase gesetzt bekommen. Und dann ist der auch noch eine Frau!“ Er schüttelt grinsend den Kopf. „Der Hafner ist der Meinung, so jemanden brauchen wir nicht. Dass er dann den Namen auch noch falsch gelesen hat, gibt ihm jetzt vermutlich den Rest. Eigentlich ist er ganz umgänglich.“
Das war also gerade mein Dienststellenleiter. Na herzlichen Glückwunsch! Das kann ja heiter werden.
Ganz im Gegensatz zu meinem Vorgesetzten drückt mir der Kollege jetzt kräftig die Hand. „Knogl Karl, aber jeder sagt nur Knogl zu mir.“
Wenigstens einer, der normal zu sein scheint. Ein Lichtblick!
Er lädt mich auch gleich großzügig ein, gemeinsam mit ihm den Hinterbliebenen die Todesnachricht zu überbringen, was ich jedoch dankend ablehne.
So nach und nach leert sich der Ort. Nachdem der Knogl und die Bestatter weg sind, baut auch die Feuerwehr ihr Equipment ab und verabschiedet sich.
Einen Moment lang bleibe ich allein in der Dunkelheit zurück. Und außer dem leisen Summen der Autobahn, die in kurzer Entfernung über die Donau führt und hier in Schnaipfing endet, ist wieder Ruhe eingekehrt am großen blauen Fluss, in dem sich jetzt das Mondlicht spiegelt, so als wäre nichts gewesen.
Kapitel 2
Rums! Ein lauter Knall weckt mich auf. Erschrocken springe ich hoch und greife reflexartig nach der Dienstwaffe in meiner Hose. Nach den Ereignissen des gestrigen Abends bin ich völlig übermüdet in meinen Klamotten auf der kurzen Couch im Wohnzimmer eingeschlafen. Es dauert einen Moment, bis ich mich zurechtfinde und weiß, wo ich bin. Es ist das Haus meiner verstorbenen Großtante Fanny. Der Knall stammt von der Stehlampe, die ich mit dem Fuß umgestoßen habe.
Während ich die Lampe wieder aufrichte, sehe ich mich in meinem neuen Zuhause um. Kleine Staubteilchen flirren im morgendlichen Sonnenlicht durchs Zimmer. Die Einrichtung ist alt, fast schon wieder antik, was mich jedoch nicht stört. Bis auf den Fernseher. Dieses uralte Röhrengerät werde ich sofort entsorgen, sobald meine eigenen Sachen geliefert werden. Auf dem Motorrad konnte ich nur das Allernötigste mitnehmen. Meinen Flachbildschirm, die Klamotten und einige bepackte Kartons bringt mir Ali in den nächsten Tagen vorbei.
Ali ist ein Türke aus Frankfurt, der Inhaber des besten Dönerstandes der Stadt. Ich war dort Stammkundin. Bei einem meiner letzten Besuche bot er mir an, meinen Umzug nach Niederbayern zu regeln und mir alles zu liefern, was ich selbst nicht transportieren konnte. Also nicht er selbst, sondern ein Schwager der Schwester seiner Frau oder so ähnlich. Egal, laut Alis Aussage jedenfalls alles „absolut korrekt“ und, was den Ausschlag gab, „supergünstisch!“
„Gibst du misch zweihundert Euro, ich bringe alles tipptopp zu deine Haus. Gibst du fünfhundert Euro Umzugsfirma, du brauchst alles neu!“ Originalton Ali. Überzeugende türkische Argumente, zumindest der Preis. Die einzige Frage war nur, wann? Wann bringt irgendjemand den restlichen Kram? Aber das konnte Ali mir dann leider auch nicht genau sagen. „Kann sein diese Woche, kann sein nächste Woche oder nächste Monat!“ Kommt Zeit, kommt Türke!
Das Telefon klingelt. Ein Uraltkasten aus dem letzten Jahrtausend. So was gibt es heute nur mehr in alten Filmen. Es ist grau, mit Stoffüberzug, Schnur und Wählscheibe und steht auf einem kleinen Tischchen neben dem Ohrensessel der Tante. Wenn man, so wie ich gerade, direkt danebensteht, ist das Klingeln ohrenbetäubend laut. Ich hebe ab.
„Grüß dich, Mädi!“, tönt es mir aus dem Hörer entgegen. Die Mama!
Ja, Sie lesen richtig, meine Mama nennt mich Mädi! Das ist mir auch total peinlich, besonders dann, wenn es jemand mitbekommt, nur leider kann ich ihr das beim besten Willen nicht abgewöhnen. Sie ignoriert jeden Einwand. Solange ich denken kann, bin und bleibe ich ihr „Mädi“. Wahrscheinlich selbst dann noch, wenn ich alt und grau bin und meine Zähne und ich getrennte Schlafzimmer haben. Maximiliane findet sie zu lang! Tja, selber schuld. Ich hätte mir auch einen schöneren Namen gewünscht. „Maxi“ ist für sie ein Bubenname, weshalb sie sich weigert, mich so zu nennen. Aber „Mädi“ macht es nicht wirklich besser, finden Sie nicht auch?
„Bist du gut in Schnaipfing angekommen?“
„Wäre ich sonst am Telefon?“
Sie lacht. „Da hast’ jetzt auch wieder recht.“
„Warum habt ihr denn das Telefon nicht abgemeldet? Die Tante ist tot, die kann man nicht mehr anrufen.“
„Wegen dir. Außerdem kenn‘ ich die Nummer auswendig. Eine neue kann ich mir in meinem Alter nicht mehr merken.“
„Ich habe ein Handy. Das ist viel praktischer, weil ich damit überall erreichbar bin.“
Es folgt ein schier endloser Vortrag über Handydiebstahl, Funklöcher etc. Ich lasse sie reden. Jahrelange Erfahrung hat mich gelehrt, dass Diskussionen mit der Mama ins Leere führen. Sie hat grundsätzlich das letzte Wort, unschlagbare Argumente und letztendlich mache ich doch immer das, was sie will. Wir plaudern ein wenig über dies und das. Dann erzähle ich ihr von meinem gestrigen Erlebnis. Sie ist derart begeistert über meine erste Leiche hier, dass man denken könnte, ich hätte den Mann selbst umgebracht. Schließlich verabschiede ich mich mit einem Gruß an die Tante Rosa.
Die Tante Rosa ist die Schwester meiner Mutter. Sie hat jahrzehntelang den Haushalt eines katholischen Pfarrers geführt. Leider hat der letztes Jahr das Zeitliche gesegnet. Da mein Vater auch nicht mehr lebt und nun beide Damen sozusagen verwitwet sind, haben sie auf ihre alten Tage eine Senioren-WG gegründet. Als Pfarrhaushälterin ist man ja quasi auch so etwas wie die Frau des Pfarrers, nur halt ohne Sex, also, in den meisten Fällen jedenfalls. Sie verstehen, was ich meine. Ich persönlich finde das mit dem gemeinsamen Haushalt eine geniale Idee, denn seit die Tante Rosa bei der Mama eingezogen ist, hat diese keine Langeweile mehr. Daher sind auch ihre Anrufe bei mir bedeutend weniger geworden. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich liebe meine Mama über alles, aber sie kann eben auch extrem anstrengend sein. Besonders dann, wenn sie anfängt, sich in mein Leben einzumischen. Vermutlich haben das alle Mütter so an sich.
Die Fanny ist die Tante meiner Mama und der Tante Rosa gewesen und somit meine Großtante. Im letzten Frühjahr ist sie hochbetagt und kinderlos im Alter von 95 Jahren verstorben. Da die Rosa keine Kinder hat und die Mama eine Eigentumswohnung besitzt, wurde ich mit ihrem Erbe bedacht, was auch der Grund war, weshalb ich mich zurück nach Niederbayern versetzen ließ. „Vergelt`s Gott, liebe Tante.“
Strumpfsockig erkunde ich nun den Rest des Hauses. Im Obergeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer. Überrascht stelle ich fest, dass sich in all den Jahren nichts verändert hat. Alles ist noch genauso, wie ich es aus Urlaubstagen meiner Kindheit in Erinnerung habe. Hinter der nächsten Tür befindet sich das Badezimmer. Das sollte ich aus mehreren Gründen dringend aufsuchen. Über die Ausstattung kann ich nur den Kopf schütteln. Der Klodeckel ist passend zu den Fliesen mit einem potthässlichen rosaroten Dekostoff überzogen. Er schaut aus wie in einem polnischen Puff. Nicht, dass ich da jemals gewesen wäre, aber eben so stelle ich es mir dort vor. Dieses Teil muss weg, sofort! Mir läuft direkt ein Schauer über den Rücken. Ich hasse es grundsätzlich, fremde Toiletten zu benutzen, und dieser Überzug lässt sie eher noch schmuddeliger erscheinen als sie aufzuhübschen.
In einer Stunde soll ich in der PI vorstellig werden, um einen ersten Einblick in mein neues Arbeitsumfeld zu bekommen. Vorher habe ich aber dringend eine Dusche nötig. Leider gibt es die hier nicht und so drehe ich wohl oder übel den Hahn der Badewanne auf, um mich dort mit der Handdusche abzubrausen. Bevor das Wasser jedoch eine Farbe annimmt, mit der ich mich waschen möchte, muss ich es einige Zeit laufen lassen. Die Handtücher sind kratzig und müffeln und nach Duschgel suche ich vergeblich. Dafür liegt ein eingetrocknetes Stück Seife in der Ablage. Sie hat feine Risse davongetragen und duftet ganz schwach nach Lavendel. Nachdem ich sie einige Zeit eingeweicht habe, schäumt sie sogar ein wenig.
Ich flitze halb nackt nach unten in die Küche, wo ich gestern Abend meine Reisetasche abgestellt habe. Für heute muss es mit dem kleinen Handtuch gehen, das ich eingepackt habe, denn meine Superflausch-Badetücher liegen wohlverpackt in einem der Kartons bei Ali - sehr ärgerlich!
Geduscht und frisch angezogen stehe ich wenig später im Erdgeschoss. Für ein Frühstück ist natürlich nichts im Haus. Mal sehen, ob es den alten Edeka-Laden noch gibt, bei dem ich mit der Fanny früher öfters war. Er müsste direkt auf dem Weg ins Polizeirevier liegen.
Auch heute wirkt der Leiter der Dienststelle nicht unbedingt sympathischer auf mich.
„Wie gesagt, Mord und Totschlag kennen wir hier nicht. Schnaipfing ist eine friedliche Kleinstadt. Darum wollte ich auch einen ganz normalen Polizisten haben, und was bekomme ich?“ Er schaut mich fast angewidert von unten bis oben an. Sein Blick bleibt an meinen langen blonden Dreadlocks hängen. „Eine Frau!“ Es fällt ihm offensichtlich schwer, es auszusprechen.
„Eine Kriminalkommissarin!“, betone ich. Die Frage, ob die nicht normal sind, verkneife ich mir.
„Wenn Sie darauf bestehen, wie eine Respektsperson behandelt zu werden, dann sollten Sie auch mehr Wert auf Ihr Äußeres legen.“ Er zeigt auf meinen Kopf.
„Bisher hat sich niemand an meiner Frisur gestört“, verteidige ich mich. „In erster Linie geht es ja wohl darum, wie ich meine Arbeit mache, oder nicht?“
„Hier stört es! Wie wollen Sie denn mit diesem Vogelnest eine Dienstkappe tragen?“
„Gar nicht, denn als Kommissarin bin ich, wie Sie sehr wohl wissen, zivil unterwegs“, erinnere ich ihn. „In Frankfurt war mein Aussehen nie ein Problem. Wenn Sie sich die Mühe machen und die Personalakte studieren, werden Sie feststellen, dass meine Aufklärungsrate überdurchschnittlich hoch ist. Ich denke, das ist alles, was zählt!“
„Ich warne Sie, junge Frau, treiben Sie es nicht zu bunt! Immerhin bin ich Ihr Vorgesetzter. Sobald Sie mir den geringsten Anlass geben, sind Sie schneller wieder weg, als Ihnen lieb ist. Mordfälle werden Sie in Schnaipfing jedenfalls keine zu lösen haben.“
„Das wird sich ja dann herausstellen, wenn die Obduktion vom …“
„Schachtner!“, springt mir der nette Kollege von gestern hilfreich zur Seite. Ich nicke ihm dankbar zu.
„… vom Schachtner durch ist.“
„Zum hundertsten Mal, das war ein Unfall!“, explodiert der Hafner.
„Willkommen im Leben, sagte der Tod“, sage ich mehr zu mir selbst und schüttle ungläubig den Kopf. Wo bin ich da nur hingeraten.
„Wie war das?“, raunzt der Hafner.
Ich wiegle ab: „Tschuldigung, ich habe nur laut gedacht.“
Er strafft sich und schlägt dann einen ruhigeren Ton an. „Sie sehen es ja selbst, wir sind eine kleine Dienststelle. Die Diensträume hier sind begrenzt, somit gibt’s auch kein separates Büro für Sie, sondern lediglich einen Schreibtisch im Zimmer vom Kollegen Knogl. Wie gesagt, ein Kriminaler wird hier nicht benötigt und erst recht kein weiblicher.“
Ich atme tief durch und zähle in Gedanken bis fünf, um mich wieder zu beruhigen. Langsam reicht es mir nämlich. „Das haben Sie mir ja jetzt hinlänglich erklärt.“
„Vorsicht!“ Der Hafner mustert mich scharf aus zusammengekniffenen Augen, ehe er fortfährt. „Ladendiebstahl, Geschwindigkeitsübertretungen, Verkehrsunfälle, das passiert bei uns, nicht Mord und nicht Totschlag. Die allgemeine Unterstützung der PI ist gefragt. Außerdem legen wir hier Wert auf ein gutes Betriebsklima.“
„Da darf er aber gewaltig an sich arbeiten!“, denke ich mir.
„Ich hoffe, ich habe mich da klar genug ausgedrückt. Irgendwelche Animositäten sind hier fehl am Platz. Wer diesen Beruf ergreift, darf nicht zimperlich sein, jeder wird gleichbehandelt, ob Männlein, ob Weiblein. Wenn Ihnen daran etwas nicht passt, können Sie sich ja woandershin versetzen lassen.“
Ich muss mich jetzt echt am Riemen reißen, um nicht zu explodieren. Hallo? Kann ich etwas dafür, dass der Hafner nicht lesen kann und übersehen hat, Einspruch einzulegen? Er benimmt sich wie ein verzogenes Gör an Weihnachten, dem man das verkehrte Geschenk hingelegt hat. Er wollte weder einen Kriminaler noch eine Frau? Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, sondern bei So ist es! Und die Ansage mit Animositäten, zimperlich sein etc. hätte er sich echt sparen können.
Der Wechsel von Frankfurt hierher war auf freiwilliger Basis und keine Strafversetzung, obwohl es sich gerade so anfühlt. Der Grund dafür war, dass ich mit meinem damaligen Vorgesetzten eine Beziehung hatte, von der keiner der Kollegen wissen durfte. Nachdem ich dann herausgefunden hatte, dass er neben mir noch eine weitere Sache am Laufen hatte, stellte ich ihn kurzerhand zur Rede. Er verteidigte sich damit, dass ich für ihn nicht das typische Bild einer Frau verkörpere. Bloß weil ich eine Jeans dem Minirock vorziehe und lieber Biker-Stiefel trage als High Heels. Fürs Bett hat es aber scheinbar gereicht. So ein Arsch! Eine harmonische Zusammenarbeit war damit ausgeschlossen. Nachdem ich hier das Haus geerbt hatte und zufälligerweise noch eine passende Stelle für einen Kommissar frei wurde, war der Ortswechsel für alle Beteiligten somit die beste Lösung. Außer für den Hafner, wie man sieht. Schnaipfing liegt nahe genug an Michlbach, wo meine Mama mit der Tante Rosa wohnt, und ist doch weit genug entfernt, dass sie nicht täglich bei mir aufkreuzt. Man muss die Sache pragmatisch sehen.
Ich schlucke den Kommentar, der mir auf der Zunge liegt, brav hinunter. Man will ja den ersten Arbeitstag nicht gleich mit Ärger beginnen. Den Kollegen Knogl fand ich am Vortag ganz in Ordnung.
Auch heute nickt er mir freundlich zu. „Servus!“
„Gibt’s irgendwas Neues zu dem Leichenfund von gestern?“, frage ich nach, nachdem ich meinen Schreibtisch besetzt habe.
„Bisher nicht. Der Tote liegt jetzt erst einmal in der Gerichtsmedizin. Aber da kommt eh nix dabei heraus.“
„Wieso denkst du das?“
„Ach der Schachtner!“, er macht eine wegwerfende Handbewegung. „Eine total verkommene Existenz. Das war abzuwarten, dass der einmal so draufgeht. Außer fürs Saufen hat der sich für nix mehr interessiert.“
Aha, wie vermutet, ein stadtbekannter Penner.
„Ich frag mich einfach, wie es sein kann, dass jemand tagelang unbemerkt tot an der Donau liegt. Den müsste doch schon lange jemand gefunden haben. Spaziergänger mit Hunden, was weiß ich?“
„Da, wo er lag, halten sich gerne mal Obdachlose auf, darum meidet das normale Fußvolk diese Gegend. Ein Stück weiter flussaufwärts gibt’s einen sehr schönen Badestrand mit Imbiss und Liegewiese. Da halten sich die Stadtleute eher auf, wenn sie Erholung wollen.“
„Aber hat ihn denn bisher niemand vermisst? Er hat doch anscheinend eine Familie. Zumindest habe ich gehört, wie gestern jemand sagte: ‚Denen bleibt nichts erspart.‘“
„Es gibt nur noch seine Mutter und einen Sohn. Der ist aber schon erwachsen und geht seine eigenen Wege. Außerdem war es nicht ungewöhnlich, dass der Schachtner hin und wieder mehrere Tage nicht nach Hause kam. Das waren die schon gewöhnt!“
Während der nächsten Stunden weist mich der Knogl in alle Arbeitsabläufe ein, und so vergeht die Zeit dann schneller als erwartet. Außerdem ist für mich bereits am Mittag Schluss. Erst ab morgen habe ich regulär Dienst.
Wieder daheim, bemerke ich, wie sehr das alte Gemäuer müffelt. Das war mir am gestrigen Abend gar nicht aufgefallen, nur der leichte Lavendelgeruch. Ich glaube, dafür war ich schlichtweg zu müde. Kein Wunder, dass es hier mieft. Das Haus ist ja seit Monaten unbewohnt. Ich öffne sämtliche Fenster. Dann inspiziere ich den Garten beziehungsweise den Dschungel, der sich Garten nennt.
Du lieber Herr Gesangsverein, da muss man sich ja mit einer Machete durcharbeiten. Wo früher einmal Rasen war, ist jetzt eine Wiese. Man erkennt weder Wege noch die Einteilung der Gemüsebeete, die die Fanny gewiss hatte, denn in ihrer Speisekammer lagern noch etliche gefüllte Einmachgläser. Direkt am Zaun zum Nachbargrundstück steht ein kleines windschiefes Gartenhäuschen. Die Tür hängt nur mehr an einem Haken.
Bei einigen Brettern kann ich durch die großen Ritzen sehen. Mit erheblicher Anstrengung lässt sich die Tür aufziehen, ohne dass sie mir gleich entgegenfliegt. Ein Spaten, eine Sense sowie diverse andere Geräte hängen an der Wand. Mehr brauche ich fürs Erste nicht.
Ich kann jetzt nicht unbedingt behaupten, dass ich den grünen Daumen habe. Auch nach einer Stunde harter Arbeit ist noch nicht wirklich viel zu sehen. Aber zumindest bekomme ich einen vorsichtigen Überblick über das nicht allzu große Grundstück.
In diesem Moment vermisse ich meine Studentenbude in Frankfurt ungemein. Klein, überschaubar pragmatisch eingerichtet mit allem, was man zum Leben braucht. Kein unnötiger Schnickschnack und vor allem, kein Garten! Für mich bisher das Sinnloseste überhaupt. Weder werde ich Gemüse anbauen noch Blumen, und so ein Rasen muss im Sommer wöchentlich gemäht werden. Wozu? Wenn ich gar nicht vorhabe, mich dort aufzuhalten? Dazu habe ich weder Zeit noch Lust. Durchgängiger Asphalt wäre meiner Ansicht nach die beste Lösung. Bei Kies kommt wieder das Unkraut durch und ich muss wieder zupfen. Doch leider fehlt mir für eine Asphaltierung das Geld. Darum werde ich wohl oder übel doch selbst Hand anlegen müssen, damit der Garten nicht verwildert, falls ich hier jemals Ordnung hineinbekomme.
Mit dem Arm wische ich mir den Schweiß von der Stirn. Ich finde, dass ich mir jetzt ein Pils redlich verdient habe. Vorhin, auf dem Rückweg aus der Stadt, habe ich mich im EDEKA-Laden vom Sedlmaier noch mit dem Nötigsten eingedeckt.
Als ich ums Haus in Richtung Eingang wandere, sehe ich einen kleinen Buben, der sich neugierig vor meiner Einfahrt postiert hat. Er sitzt auf einem blauen klapprigen Fahrrad, hat den Kopf auf seine Arme gestützt und mir, wie es scheint, bereits eine ganze Weile zugeschaut. Ausschauen tut er wie der „Michel aus Lönneberga“. Blonde Haare, blaue Augen, Sommersprossen. „Wohnst du da jetzt?“, fragt er Kaugummi kauend.
Weder ein „Grüß Gott!“ noch sonst was und per Du sind wir auch.
„Schaut so aus, oder?“, entgegne ich im selben Ton.
„Du könntest ja auch eine Einbrecherin sein.“
„Würde ich dann im Garten arbeiten?“ Schlaumeier!
„Stimmt. Und wo ist deine Familie?“
„Ich bin allein.“
„Wieso?“
„Was, wieso?“
„Na ja, du bist ja auch nicht mehr so jung. Warum hast du keinen Mann und keine Kinder?“
„Hallo, das ist doch meine Sache. Ich hab niemanden, weil ...“, ich komme kurz ins Zögern, „weil ich niemand brauche.“
Er lehnt weiter am Zaun und macht keinerlei Anstalten, seine Position zu verändern. „Schaut aber gerade nicht so aus.“Der Kaugummi wandert schmatzend von einer Backe zur anderen.
„Wie bitte?“ Ich glaube, ich spinne. Der kleine Hosenscheißer auf dem alten Radl hat ein ganz schön loses Mundwerk. Aber das gefällt mir. „Stehst du da schon länger rum?“
„Könnt’ schon sein.“ Er macht mit dem Kaugummi eine große Blase. „Du musst die Sense vorher dengeln, sonst schneidet sie nicht!“, gibt er altklug von sich.
„Aha. Davon hab ich aber keine Ahnung“, gebe ich zu.
„Ich schon.“
„Warum hilfst du mir dann nicht, wenn du so ein Schlaumeier bist?“
„Ich kenn dich ja nicht. Meine Mama sagt immer, mit fremden Leuten soll ich mich nicht unterhalten.“
„Eine kluge Frau, deine Mama. Aber du hast mich angesprochen, nicht ich dich.“ Eins zu null für mich.
Er wirkt betreten.
„Ich glaube, dieses Problem lässt sich lösen.“ Ich wische mir die Hände an der Jeans ab und strecke ihm meine rechte entgegen. „Ich bin die Maxi und jaaa ... ich wohne seit gestern hier. So, jetzt kennst du mich. Und wer bist du?“
„Ferdi“, er verdreht die Augen, „Ferdinand“, sagt er gedehnt und sichtlich genervt.
„Gibt’s da ein Problem? Magst du deinen Namen nicht?“
Er prustet. „Den kurzen Teil schon.“
Ein Leidensgenosse.
„Ich verrat dir was, eigentlich heiß ich Maximiliane.“
Damit habe ich sein vollstes Mitgefühl. „Auch nicht besser!“ Wir nicken uns verständnisvoll zu. Er deutet die Straße entlang. „Ich wohne dahinten.“
„Ich wollt mir vorhin was zu trinken holen, magst reinkommen?“
Er zögert. „Nein, ich wollt nur ein bisserl rumschauen.“ Scheinbar traut er mir noch nicht ganz über den Weg. Er wirft einen Blick auf das Motorrad, das etwas verdeckt in der Einfahrt steht. „Wem gehört das? Deinem Freund?“
„Nein, das ist meine Chopper“, sag ich stolz. Das schwarze Schmuckstück ist mein absolutes Heiligtum.
Der Bub schaut erst die Maschine, dann mich skeptisch an. Dann sagt er: „Wehe du lügst! Das mag ich nämlich nicht, wenn mich jemand für blöd verkaufen will.“
„Damit sind wir schon zu zweit. Ich kann das auch auf den Tod nicht leiden.“ Zum Beweis greife ich in meine Hosentasche und ziehe den Schlüssel hervor. Dann nehme ich die Abdeckung ab. Der Ferdi bekommt leuchtend große Augen, als ich mich aufs Motorrad setze, den Schlüssel drehe und den Motor so richtig schön aufheulen lasse.
Der Sound ist Musik in meinen Ohren.
Mit einem Mal öffnet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Fenster, aus dem eine aufgebrachte Frauenstimme ertönt: „Ruhe! Das ist eine Unverschämtheit, am helllichten Tag so einen Radau zu machen. Man sollte die Polizei holen.“
Ich frage mich zwar, ob ihr der Lärm bei Nacht lieber ist, stelle aber trotzdem den Motor ab.
Das Fenster knallt zu.
„Ach, die alte Friedl wieder“, kommentiert der Ferdi gleichgültig. „Die regt sich wegen jeder Kleinigkeit auf, und mit der Polizei droht sie auch ganz gern.“
„Dann wird es sie sicher freuen, dass die Polizei jetzt ganz in ihrer Nähe wohnt“, sage ich, während das Motorrad wieder unter der Abdeckung verschwindet. Weil der Bub jetzt ziemlich verständnislos dreinschaut, ziehe ich erklärend meinen Dienstausweis aus der Hosentasche. „Ich bin eine von den Guten“, sag ich mit einem Grinsen.
„Echt jetzt?“ Schwer beeindruckt fügt er hinzu: „Voll cool!“
Ich zucke grinsend die Achseln. Dann marschiere ich ins Haus, um mir endlich das verdiente Bier zu holen.
Der Ferdinand hockt mittlerweile entspannt auf der Treppe, als ich wieder herauskomme.
Ich setze mich dazu. „Du kannst mir gerne im Garten helfen, wenn du magst. Ich könnte Hilfe wirklich gebrauchen.“
Er schaut ein wenig skeptisch drein.
Also füge ich hinzu: „Ich zahl dir auch was dafür.“ Wir einigen uns auf einen Betrag und besiegeln das Geschäft per Handschlag. Bald merke ich, dass der Kleine sein Geld wert ist.
Er stapft erst einmal wie ein Großer über das Gelände, um sich ein Bild zu machen, und legt dann mit Feuereifer los. „Zuerst brauchen wir einen Platz für das Unkraut“, kommandiert er fachmännisch.
Da hat er absolut recht. Bisher habe ich einfach alles, was mir im Weg stand, umgemäht und an Ort und Stelle liegen lassen.
Gemeinsam suchen wir einen geeigneten Platz für den Kompost. Die Arbeit geht uns zügig von der Hand, ich mähe, der Ferdi recht das Gras zusammen und bringt es weg. Seit er mir gezeigt hat, wie man die Sense schärft, schneidet sie sogar einigermaßen. Erstaunlich, was der kleine Kerl alles weiß. Ich werde beim Lohn noch nachbessern, nehme ich mir vor.
„Brauchst du die noch?“, tönt es plötzlich völlig unvermittelt hinter mir.
Ich drehe mich um.
Der Ferdi lässt dicht vor meinen Augen eine Blindschleiche baumeln.
„Ja spinnst du?!“ Erschrocken mache ich einen Satz rückwärts. Mein Herz setzt einen Takt aus. Vor Schlangen und Ratten graust es mir unbändig. „Tu bloß das Viehzeug weg!“, fahre ich ihn an.
„Warum? Das ist doch nur eine harmlose Blindschleiche. Gell, Schleichi, du tust keinem was“, entgegnet er erstaunt auf meine überschießende Reaktion.
„Für mich ist das eine Schlange! Mit denen stehe ich auf Kriegsfuß. Die kann ich absolut nicht haben. Weder ihr Leder noch auf dem Teller, wie bei den Chinesen, und schon gar nicht lebendig in meinem Garten. Ist das klar?“
„Die ist so schön. Schau mal, wie die in der Sonne glitzert.“ Er streichelt vorsichtig, fast ehrfurchtsvoll über das Tier.
„Das ist mir völlig wurscht, was die in der Sonne macht. Die kann glitzern, so viel sie will, aber nicht in meinem Garten.“
„Darf ich sie haben?“
„Gern, nimm sie mit, und wenn du noch welche findest, bedien‘ dich, ohne zu fragen. Hauptsache, bei mir im Garten ist keine mehr.“ Ich fühle langsam den Angstschweiß aus meinen Poren fließen.
„Echt? Danke!“ Glücklich über meine großzügige Geste lässt er seine Beute kurzerhand in der Hosentasche verschwinden. „Dann bringe ich sie gleich heim.“ Sagt‘s, dreht sich um und radelt davon.
„Ich komm dann wieder!“, ruft er mir noch zu, bevor er weg ist.
Na hoffentlich freut sich seine Mutter mehr als ich über den tierischen Zuwachs.
Auf diesen Schreck hin könnte ich jetzt einen Schnaps vertragen. Die Gartenarbeit macht mir noch weniger Spaß als zuvor. Überall schaue ich erst vorsichtig nach, ob sich da was im Gras regt. Es könnte ja durchaus noch die Verwandtschaft der Schleichi unterwegs sein.
Eine halbe Stunde später ist der Ferdi noch immer nicht zurück. Sicher hat ihn seine Mutter nicht mehr weggelassen. Kein Wunder. Arbeitet bei einer wildfremden Frau im Garten und kommt verdreckt und mit einer Blindschleiche in der Hosentasche nach Hause. Wäre es mein Sohn, ließe ich den auch nicht mehr aus dem Haus. Die muss mich ja für eine Irre halten.
Lustlos räume ich das Werkzeug auf und gehe hinein. Nach diesen Strapazen gönne ich mir ein heißes Vollbad. Mit Lavendel! Badezusatz aus dem Nachlass der Tante Fanny. Scheint ihr Lieblingsduft gewesen zu sein.
Kapitel 3
Nach ein paar Tagen habe ich mich so einigermaßen eingelebt. Ich schiebe hier in Schnaipfing tatsächlich eine relativ ruhige Kugel. Ganz anders als früher in Frankfurt, aber man gewöhnt sich daran.
Der Hafner ist gar nicht so wild, wie er im ersten Moment rübergekommen ist. Scheinbar hat er sich mit seinem Schicksal abgefunden. Wobei der Knogl ja behauptet, der Hafner habe einen gewaltigen Anpfiff von oben bekommen, als er sich über die Stellenbesetzung beschwert hat. Ich tu so, als wüsste ich davon nichts. Jedenfalls kommen wir mittlerweile so einigermaßen miteinander aus und mit der Zeit wird er es auch akzeptieren, dass ich eine Frau bin. Vielleicht stimmt ihn auch milder, dass er meinen guten Willen sieht und ich Dienst schiebe wie alle anderen auch.
Wenige Tage nach dem Auffinden der Leiche ist der Befund aus der Rechtsmedizin da. Todesursache, wie vermutet, ein Sturz aus großer Höhe auf dem kantigen Stein mit daraus resultierendem Schädelbruch.
„Fremdeinwirkung konnte nicht nachgewiesen werden“, liest der Hafner laut aus dem Obduktionsbericht vor und nickt zur Bekräftigung in meine Richtung, so als wolle er damit sagen: „Ich habe es ja gleich gesagt!“
Kurz darauf werden der Knogl und ich zu einem Einsatz am Friedhof gerufen. Nichts Aufregendes, Verkehrsunfall ohne Personenschaden. Trauergäste einer Beerdigung sind beim Ausparken zusammengestoßen. Die Sachlage ist eindeutig, man klärt die Sache unter sich.
Eigentlich sitzen wir schon im Wagen und fahren gerade los Richtung Dienststelle, als eine ältere schwarz gekleidete Frau durch das Friedhofsportal tritt. Sie muss eine der Angehörigen sein, denn der Knogl hält noch mal an und steigt aus, um zu kondolieren. Ich bleibe im Wagen sitzen, schließlich kenne ich sie nicht. Durch die offene Autotür höre ich: „Jetzt müssen wir halt fest zusammenhalten, dann packen wir auch das noch.“
„Wer war das?“, frage ich, nachdem er wieder bei mir im Wagen sitzt.
„Die Mutter vom Schachtner.“
„Dem Schachtner?“ Er nickt.
„Hat’s nicht leicht, die alte Frau. Erst die Schwiegertochter, jetzt der Sohn. Es ist ein Elend bei denen.“
Die Turmuhr schlägt zwölf. Mittagszeit. Eigentlich warte ich darauf, dass er mit seinen Ausführungen fortfährt, was denn mit der Schwiegertochter war. Stattdessen fragt er: „Fahren wir noch zum Standl?“
„Wohin?“
Er schaut mich überrascht an. „Jetzt sag bloß, du kennst das Standl noch nicht?“
Ich zucke ratlos die Schultern. „Ich bin ja erst seit ein paar Tagen in der Stadt!“, füge ich erklärend hinzu.
Er schüttelt verständnislos den Kopf. „Das Standl ist der Treffpunkt in Schnaipfing. Da holt man sich sein Mittagessen und am Nachmittag den Kuchen. Da erfährt man, wer mit wem und wann und wo. Da trifft sich praktisch die halbe Stadt.“
„Aha. Was gibt’s da zum Essen?“
„Immer dasselbe.“
„Wie? Immer dasselbe?“
Dem Knogl ist es zu umständlich, mir das zu erklären. Er meldet uns per Funk beim Hafner ab, wendet den Wagen und fährt los. „Weißt du was, schau‘s dir selber an.“
Mitten am Stadtplatz, relativ zentral gelegen, steht eine Holzhütte und davor zwei Stehtische. Was aber das Ganze interessant macht, es stehen da auch jede Menge Menschen.
Der Knogl parkt den Wagen mitten im Halteverbot und wir steigen aus. Neugierig steuere ich auf das Treiben zu. Je näher wir kommen, umso besser riecht es. Ich schließe die Augen und atme den Duft - es duftet wirklich - tief ein. Fleischpflanzerl! Mir läuft das Wasser im Mund zusammen.
„Siehst du, das ist das Standl!“, erklärt der Knogl feierlich.
Ohne zu überlegen, reihe ich mich hinter ihm ein. Was so dermaßen herrlich riecht, kann nur gut schmecken. Die lange Warteschlange bekräftigt meinen Verdacht. Überraschend zügig kommen wir voran und eher als erwartet bin ich an der Reihe. Jetzt verstehe ich auch, was der Knogl mit immer dasselbe gemeint hat. Es gibt nur ein Gericht. Heute sind es Fleischpflanzerl. Was aber nicht heißen soll, dass man keine Auswahl hätte. Man kann sie mit Kartoffelsalat haben, oder in der Semmel. Mit Senf oder ohne, zum Mitnehmen oder gleich hier am Stand verspeisen. Ich entscheide mich für eine Portion mit Kartoffelsalat.
Gemeinsam mit dem Knogl begebe ich mich an einen der Stehtische. Süßen und scharfen Senf gibt es in einem Glas mit Dosierspender. Erinnert mich vom Ausschauen her ein bisschen an Handwaschseife, schmeckt aber hoffentlich besser.
Einmal, zweimal, ich drücke den Hebel so oft, bis eine ordentliche Portion Senf auf dem Teller landet. Und dann beiße ich in die besten Fleischpflanzerl meines Lebens. Jedenfalls erinnere ich mich nicht daran, jemals etwas Köstlicheres gegessen zu haben.
Die Mama ist küchentechnisch gesehen eine einzige Katastrophe. Das kann man leider nicht anders bezeichnen. Böse Zungen behaupten sogar, dass mein Vater aufgrund ihrer Kochkunst so früh verstorben ist. Aber Gott sei Dank wohnt jetzt die Tante Rosa bei ihr und hat das Zubereiten der Nahrung übernommen. Sie kann wirklich ganz gut kochen, aber diese Fleischpflanzerl hier sind einfach unschlagbar. Der blanke Wahnsinn.
Saftig, würzig, kein bisschen trocken oder angebrannt. Der Senf ist hundertprozentig selbst gemacht.
„Schmeckt’s?“, erkundigt sich der Knogl grinsend.
„Spitzenmäßig“, bestätige ich zwischen zwei Bissen.
„Macht alles die Hilde selbst.“
Ich schaue mir zum wiederholten Male die Warteschlange an. Jetzt versteh ich gut den Andrang, der hier herrscht.
Die Frau im Standl ist mir bislang gar nicht aufgefallen. Bedient hat uns ein Mann. Ich entdecke sie im hinteren Teil der Hütte. Flink bringt sie immer wieder Nachschub in einer flachen Edelstahlschale herbei, um dann wieder zurück zum Herd zu flitzen und die nächste Ladung zu braten. Scheinbar gibt es einen unendlichen Vorrat an Fleischteig. Es geht zack, zack, zack. Ich höre nur: „Mit?“ oder „Ohne?“, was heißen will, mit Kartoffelsalat oder in der Semmel und wusch, hat der Kunde die Ware schon in der Hand.
Neben dem Standl steht ein langer Biertisch mit Wannen drauf. Eine kleine für das Besteck, eine große für das Geschirr.
Ich putze meinen Teller bis auf den letzten Rest leer. Dann stelle ich ihn, wie alle anderen, in den Sortierbehälter. Das System scheint reibungslos zu funktionieren. Wir warten ab, bis sich der Ansturm gelegt hat.
„Komm mit, ich stell dich vor“, beschließt der Knogl und zieht mich zum Standl.
Die Besitzer Hilde und Heinz sind ein sympathisches älteres Ehepaar. Im Gespräch stellen wir überrascht fest, dass sie in der Nachbarschaft nur eine Querstraße weiter von mir wohnen. Bis dato waren wir uns noch nicht begegnet. Beide kannten die Fanny und freuen sich, dass ihr Haus jetzt wieder bewohnt ist. Im Gegenzug lobe ich ihr Essen.
„Ja, kochen kann sie, meine Hilde“, meint der Heinz und legt stolz den Arm um seine bessere Hälfte.
Kapitel 4
Der Ali war immer noch nicht da und langsam werde ich echt sauer. Unzuverlässigkeit ist eines der Dinge, die ich absolut nicht leiden kann. Außerdem vermisse ich meinen Fernseher und die Wäsche wird auch langsam knapp. Die Nummer vom Döner kenne ich auswendig.
„Ali, wo bleibt mein Umzug?“, blaffe ich schlecht gelaunt ins Telefon, nachdem er abgehoben hat.
„Umzug kommt. Süleyman sagt, diese Woche oder nächste Woche oder nächsten Monat.“
„Dein Süleyman hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ali, ich brauche die Kartons jetzt! Diese Woche, spätestens nächste. Ich hab nichts zum Wechseln dabei, verstehst du? Nichts!“ Ich hasse es, wenn Männer meinen, bei Frauen können sie sich alles leisten.
„Ich verstehe schon“, entgegnet der Ali. Er hört sich auch ganz verständnisvoll an, „aber Süleyman sagen, er fährt erst, wenn er kriegt Hammel.“
„Der Süleyman bekommt zweihundert Euro von mir. Das war so ausgemacht. Von einem Hammel war nie die Rede.“
„Braucht Hammel für türkisches Opferfest. Ist schon bestellt.“
Ich hole tief Luft. „Hör zu, Ali, sag deinem Süleyman, er bekommt dreihundert Euro von mir, aber dafür brauche ich meinen Umzug bis Mittwoch. Nächste Woche! Ist das klar? Sonst nehme ich mir eine Umzugsfirma und der Süleyman kriegt gar nichts!“
„Ich sprechen Süleyman. Du rufen in eine Stunde noch mal an?“
Eine Stunde später verspricht mir der Ali dann hoch und heilig, oder bei Allah - wie man das sehen mag –, dass ich am Mittwoch meine Sachen bekomme. Vorsichtshalber frage ich noch mal nach, ob er schon den Mittwoch der kommenden Woche meint und auch in diesem Jahr. Man weiß ja nie. Weil er mir jedoch keine konkrete Uhrzeit sagen will, gebe ich ihm sicherheitshalber die Adresse vom Revier. Nicht dass der Süleyman vor mir eintrifft und dann wieder alles mitnimmt, weil niemand da ist.
Den ganzen Mittwoch schüttet es wie aus Kübeln. Bis zum Nachmittag war weit und breit kein Türke zu sehen. Um fünf endet endlich mein Dienst. Ich schaue zu, dass ich nach Hause komme.
Gerade will ich ins Haus gehen, da hält vor dem Gartentor ein Kleintransporter. „Import - Export Süleyman Öztürk“ steht in Großbuchstaben auf der Seitenplane. Darunter die Handynummer des Unternehmers.
Man glaubt es nicht. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Es sah ganz danach aus, als würde Ali mich wieder versetzen.
Erfreut marschiere ich zum Wagen.
Ein drahtiger kleiner Südländer springt vom Fahrersitz und läuft flink um den Wagen. „Hallo! Bist du Polizei Meise? Ich Süleyman. Schwager von Schwester von Frau von Ali.“
„Meisinger!“, korrigiere ich ihn.
„Hab isch alles dabei. Alles hundert Prozent sischer, tipptopp. Aber Vorsicht, dass nix springt raus, wenn isch öffne Wagen.“
Was soll da bitte schön herausspringen, wenn er alles so tipptopp verstaut hat? Er öffnet die Ladeklappe.
Ein unbeschreiblicher Gestank strömt mir entgegen. Ich halte entsetzt die Nase zu und stecke vorsichtig den Kopf ins dunkle Heck des Fahrzeugs. Leichter Würgereiz macht sich bemerkbar. Ich schlucke.
Hat der außer dem Umzug etwa auch noch eine Leiche im Transporter? Wundern würde mich gerade gar nichts. Was ich zuerst sehe, sind nicht meine ersehnten Kisten, sondern ein stinkender, dreckiger Schafbock, der mich aus funkelnden Augen wütend anstarrt.
„Das ist Achmed!“, erklärt mir der Süleyman freudestrahlend, so als hätte ich gerade den Hauptgewinn in einer Lotterie gezogen. Dann hüpft er in den Wagen.
Mutig! Bei der Laune, die das Tier ausstrahlt, rechne ich damit, dass der Süleyman in der nächsten Sekunde hochkant wieder herausfliegt. Aber nichts dergleichen passiert.
„Das ist ein Hammel!“, berichtige ich ihn fassungslos. Meine Stimmung sinkt schlagartig. „Sag mal, bist du übergeschnappt?“, fahre ich ihn an. „Du kannst doch nicht einfach einen Schafbock zwischen meiner Kleidung transportieren!“
„Ach das macht Achmed nix“, entgegnet er gelassen. „Achmed braucht nix viel Platz. Ist gut gepolstert.“ Er lacht glucksend und klopft dem verdreckten Tier auf den stinkenden Pelz. Kleine Staubwölkchen steigen dabei auf.
Das kann ich, obwohl es im Laderaum ziemlich dunkel ist, gut sehen. Jede weitere Diskussion erscheint mir zwecklos. Der Süleyman kapiert einfach nicht, was ich meine, und ich werde immer grantiger. Außerdem bin ich wegen des blöden Regens schon patschnass und habe keine Lust mehr, länger als nötig hier draußen herumzustehen.
Zuallererst muss der Achmed aus dem Karren, sonst kommen wir nicht an meine Kisten. Aber so gereizt, wie das Vieh mittlerweile ist, könnte es sein, dass es mir beim Ausladen einen Tritt verpasst. Dann müsste ich ihn leider erschießen.
Da hätte der Süleyman ein Problem, weil er den Hammel lebend für irgendein Ritual braucht, das zu einem türkischen Opferfest gehört, bei dem das Tier feierlich geschlachtet wird.
Ich schau das Vieh böse an und denke mir: „Recht geschieht dir! So was wie du gehört auf den Grill und nicht zwischen meine Umzugskartons.“
Neben der Bordwand zieht Süleyman ein etwa zwei Meter langes Brett hervor. Es ist gerade so breit, dass der Hammel darauf laufen kann. Nachdem er damit eine Rampe gebaut hat, bindet er das Tier los und wirft mir die Leine zu. „Du ziehen, isch schieben!“, verteilt er die Aufgaben.
Leider ist Achmed damit ganz und gar nicht einverstanden. Er wehrt sich aus Leibeskräften und so bleibt dem Süleyman nichts anderes übrig, als über den Hammel zu steigen und ihn mit einem kräftigen Schwung in Richtung Rampe zu bewegen. Achmed kommentiert das mit einem kräftigen Stoß seiner Hinterläufe gegen meine Kartons.
Ich bete, dass darin nicht der Fernseher ist.
Auch jetzt ist das Tier kaum von der Stelle zu bewegen. Wir stehen uns fast Auge in Auge gegenüber und ich kann nicht sagen, wer von uns beiden wütender ist. Ich ziehe, was das Zeug hält, an der Leine.
Mit den Vorderbeinen steht er schon auf dem Brett, doch mit den Hinterläufen findet er immer noch Halt und spreizt sich stur dagegen. Erst als ihm Ali mit einem lauten „hareket!“ einen festen Tritt in den Hintern verpasst, kommt Bewegung in die Sache.
Beinahe sachte gleitet er auf dem nassen Brett wie auf einer Rutschbahn zu Boden.
Wir binden den Achmed an eine Straßenlaterne, was der wiederum gar nicht gut findet, und er fängt aus Leibeskräften an zu schreien. So etwas hab ich noch nicht gehört. Vielleicht ist er ja wasserscheu. Jedenfalls bekommt jetzt auch der letzte Bewohner dieser Straße mit, dass hier jemand einzieht. Ich warte nur darauf, dass das Fenster der alten Friedl wieder aufgeht. Vielleicht schickt sie auch gleich die Kollegen vorbei. Hurra, das gäbe ein Gerede auf der PI. Darauf kann ich gut verzichten.
„Halts Maul!“, brülle ich den Hammel an, aber den interessiert das nicht. Es ist zwecklos.