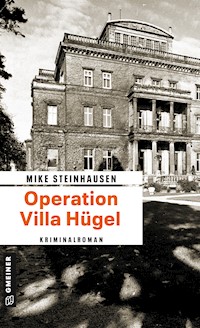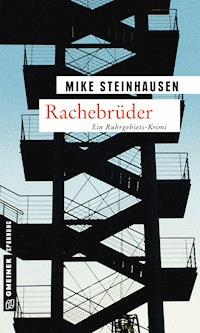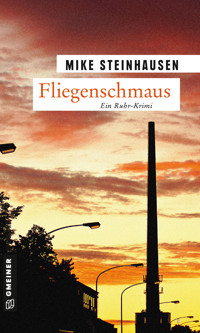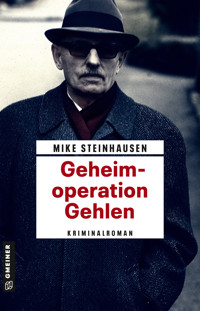Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Zeitgeschichtliche Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Ruhrgebiet 1942. Während Deutschland im Gleichschritt marschiert, träumen der 16-jährige Egon Siepmann und sein Freund Fritz Gärtner von Freiheit und Abenteuer. Hin und her gerissen zwischen dem Kampf ums Überleben, den Schikanen der Hitlerjugend und der Verfolgung durch die Gestapo, suchen sie nach ihrer Identität. Doch wer sich in dieser Zeit auflehnt, wird bestraft. Und die Schergen des NS-Regimes kennen keine Gnade.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mike Steinhausen
Ruhrpiraten
Roman
Impressum
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Fliegenschmaus (2017), Rachebrüder (2015),
Schlagwetter (2014), Operation Villa Hügel (2013)
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2018
Lektorat: Sven Lang
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild – mauritius
Alle Innenfotos stammen von: © Stiftung Hambacher Schloss
ISBN 978-3-8392-5672-5
Widmung
Für meinen Vater
Du hast Großartiges geleistet
Zitat
»Nichts ist schwieriger und nichts erfordert mehr Charakter, als sich im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen: Nein!«
(Kurt Tucholsky)
Frühjahr 1942
Es sah alles aus, wie sonst auch. Bis auf die Ruine neben ihrem Haus. Das Gebäude, welches vor einigen Tagen einen Treffer abbekommen hatte. Die Bilder der Toten, die man geborgen hatte, verblassten bereits. Es waren ohnehin nur Körperteile, die man aus den Trümmern gezogen hatte und als solche nicht mal mehr richtig zu erkennen. Zerfetzte Leiber, verbrannte Überreste, durch die Wucht der Bomben ihrer Persönlichkeit, ihrer Identität beraubt. Zu viele Opfer hatten die Angriffe auf das Ruhrgebiet in den letzten Monaten bereits gefordert, als dass sich das Entsetzen hätte dauerhaft in die zunehmend abgestumpften Seelen der Menschen brennen können. Wie durch ein Wunder war ihr Haus nur leicht beschädigt worden. Es zogen sich seitdem dicke Risse durch das Mauerwerk und der Putz blätterte ab, aber es stand und sein Dach war einigermaßen dicht. Mit langsamen Schritten ging Egon Siepmann an dem zerstörten Gebäude vorbei, dessen Reste der Ziegelfassade sich bizarr in die Höhe reckten und deren verrußte Steine nahtlos in das schwere Grau des Himmels übergingen, als gäbe es in dieser Welt keine Farben mehr. Eine Welt der Grautöne. Egon stand früh morgens auf, betrat eine graue Welt, fuhr durch die Schwärze der Erde hinunter zu den Stollen, deren Decken und Wände im Licht der Grubenlampen grau und silbern schimmerten, um nach zähen Stunden quälender Schufterei mit Kohlenstaub bedecktem Gesicht nach oben zu kommen. Nun lief er zurück in seiner grauen Kleidung, durch die graue Dämmerung, über das dreckig-graue Kopfsteinpflaster vorbei an den grauen Fassaden, über denen der Mond stand, dessen Gelb in diesen Zeiten ebenso farblos wirkte wie die ausgemergelten Gesichter der Menschen. Die Welt bestand nur aus der Eintönigkeit der Arbeit, fernab jeglichen Vergnügens und jeglicher Sehnsüchte. Das Leben war nichts weiter als eine jämmerliche, banale Existenz, bestehend aus dem fortwährenden Kampf nach einer Mahlzeit und dem verzweifelten Versuch, nicht vor die Hunde zu gehen. Hässlich, freudlos, ohne Offenbarung oder gar Gnade. Wie jeden Abend, wenn Egon mit müden Beinen und schweren Schritten nach Hause kam, blickte er hoch zu dem kleinen Fenster unterhalb des alten Giebels. Er betrachtete das schummrige Licht der Kerze hinter dem schweren Leinenvorhang. Es war kaum zu erahnen und wurde von dem Zug der Luft, der durch die Spalten der Wände und unter den Türen zog und den er in der Nacht unangenehm auf seinem Gesicht spürte, in ein unruhiges Flackern versetzt.
Und wie an den Abenden davor, an den Abenden der vielen Wochen und Monate, auf die er zurückblickte, verspürte er auch jetzt noch dieses Unbehagen, diese Beklemmung, die sich stets eingestellt hatte, wenn er zu diesem Fenster hochgesehen hatte. Gefühle, die sich mit jedem Schritt auf den ausgetretenen Holzstufen des heruntergekommenen Hausflurs verstärkt und die ihn zielgerichtet dorthin geführt hatten, wo sein Zuhause war. Ein Ort voller Boshaftigkeit, voller Gewalt und von dem er sich trotzdem nicht hatte lösen können. Aber das war nun vorbei. Für immer vorbei.
Zu keinem Zeitpunkt hatte er es verstanden, wie Mutter ausgerechnet ihn hatte aufnehmen können: Erich Balzer. Ein nichtsnutziger Versager, der soff und sie schlug. Und dann auch ihn. Irgendwann täglich. Zunächst mit der flachen Hand, teils ins Gesicht, später immer öfter mit der Faust. Es war zu einem abendlichen Ritual geworden, bis zu dem Tag, an dem er sich gewehrt, an dem er sich aus dem tiefen Tal der Demütigung erhoben und ihm die Stirn geboten hatte. Die schweißtreibende Plackerei auf der Zeche hatte Egons Arme stark werden lassen. Seit einem Jahr arbeitete er auf Bonifacius als Hauerlehrling. Zunächst in den verschiedensten Werkstätten, seit einem halben Jahr unter Tage. Eine Stelle, die er der Tatsache zu verdanken hatte, dass sein Vater mit dem Steiger gut ausgekommen war. Außerdem war Vater in der Gewerkschaft gewesen, bevor man sie verboten hatte, und später in der Partei. Egons Arme waren die eines Mannes. Und auch in seinem Gesicht zeigten sich die ersten Anzeichen eines Bartwuchses. Egon beobachtete, wie sich jedes einzelne Flaumhaar nach und nach in eine kräftige Borste verwandelte. Er genoss das raue Gefühl, wenn er mit den Fingerspitzen gegen die Wuchsrichtung strich. Egon hatte erkennbar die Welt der Männer betreten und er fühlte sich ihr zugehörig. Doch er hatte Balzer noch nicht besiegen können. Trotz des steifen Beins, das diesem Säufer einen stets schwankenden Gang verlieh. Ein Überbleibsel von der Front und der Grund, warum er nicht erneut eingezogen wurde. Aber er war kampferfahren. Hinterhältig hatte er auf seine Chance gewartet. Anders als Egon, der unüberlegt nach vorn gestürmt war. Das hatte Balzer den Sieg gebracht. Doch unabhängig dieser Niederlage hatte Egon ihm gezeigt, dass er trotz seiner 16 Jahre nicht mehr gewillt war, sich verprügeln zu lassen. Mutter hatte ihm das Blut aus dem Gesicht gewaschen und die Prellungen mit Kohlblättern verbunden, während Erich sich in einer Ecke hatte volllaufen lassen. Ihr Gesicht vom inneren Schmerz gezeichnet, hatte sie doch nichts gesagt. Nie hatte sie etwas gesagt. Das war der Teil an ihr, den er hasste. Seit diesem Tag jedoch hatte Erich nicht mehr versucht, Egon zu schlagen, beschränkte sich aufs Fluchen. Auf Beleidigungen und Drohungen. Mutter verprügelte er trotzdem weiter. Sie hatte es ihm nicht gesagt. Aber die blauen Flecken an den Handgelenken waren nicht zu übersehen. Wenn sie die Wäsche im Hof auf die Leinen hing, rutschten ihre Ärmel nach oben. Nur Annemarie hatte er nicht angerührt. Weil er wohl geahnt hatte, dass er damit eine Grenze überschritten hätte.
Wenn Egon nachts mit Annemarie im Bett lag, das er mit ihr teilte, in dem leeren und trostlosem Zimmer, das in den Wintermonaten so kalt und klamm gewesen war, dass die Fensterscheibe beschlug, drückte sie sich ganz eng in der Dunkelheit des Raumes an ihn. Und wie jeden Abend fragte sie ihn, wann Vater nach Hause kommen würde und dass sie ihn fürchterlich vermisste. Annemarie wusste nicht, dass Vater nicht mehr nach Hause kommen würde. Die Benachrichtigung über den heldenhaften Tod, den Vater an der Ostfront im Februar 1942 in der Nähe der ihm unbekannten russischen Stadt Rschew für den Führer und dem deutschen Vaterland gefunden hatte, erfolgte in aller Frühe, als Annemarie noch geschlafen hatte. Mutter hatte nicht geweint. Auch nicht, als man ihr die Briefe überreicht hatte, die er ihr in den Schützengräben geschrieben hatte. Die einzige Regung, die Egon an ihr wahrgenommen hatte, war das Aufeinanderpressen ihrer Lippen, bis diese ihm beinahe blutleer erschienen waren. Sonst war da nichts gewesen. Etwas, was Egon zutiefst verletzt hatte. Nicht mal zwei Minuten hatte das Überbringen der Nachricht gedauert. Zwei Minuten gespielten Bedauerns. Dann waren die Kameraden der NSDAP wieder weg gewesen. Schon im Hausflur hatte er sie bereits wieder lachen gehört. Es war erst wenige Wochen her und mehrmals schon hatte ihn Panik übermannt, weil er sich manchmal das Gesicht des Vaters nicht mehr vorstellen konnte. Es verblasste in seinen Träumen wie die Gesichter der Toten aus dem Nachbarhaus. Und das der unzähligen Toten, die er auf den Straßen gesehen hatte. Und so nahm er jeden Abend nach dem Zubettgehen Annemaries kleine Hände, streichelte in der Dunkelheit jeden einzelnen ihrer winzigen, so zerbrechlichen Finger und erzählte ihr von den wenigen Erlebnissen mit ihrem Vater, an die er sich erinnern konnte, und erfand Geschichten, um sie zu beruhigen. Um sich zu beruhigen. Anschließend zündeten sie eine Kerze in der kleinen Blechlaterne an, die auf der schmalen Fensterbank vor ihrem Giebelfenster stand, und betrachten gemeinsam in ihrem unruhigen Schein das vergilbte Foto ihres Vaters. Das Foto, welches man ihnen von der Front mitgebracht hatte und welches der Vater in seiner Jacke an seinem Herzen getragen hatte, als er gestorben war. Die Aufnahme zeigte, wie sie alle hinter dem Haus im Garten standen, Vater voller Stolz in seiner Wehrmachtsuniform, und gemeinsam malten sie sich aus, was sie nur alles unternehmen würden, wenn der Krieg aus wäre und Vater endlich heimkehrte. Dann löschte er mit angenässten Fingerkuppen die Kerze, damit sie seine Tränen nicht sah. Und jedes Mal lag er lange wach und lauschte ihrem vertrauten Atem.
Egon lief vorbei an der Erdgeschosswohnung des alten Wolfram Gaßner und seiner Frau, die schon seit langer Zeit einen schwindenden Geist hatte und niemanden mehr erkannte. Der alte Gaßner war früher Goldschmied gewesen und erzählte bei jeder Gelegenheit langatmige Geschichten darüber, sodass Egon ihm nach Möglichkeit aus dem Weg ging. Im ersten Stock lebte der kriegsversehrte Hartmut Glöckner, der im Ersten Weltkrieg ein Bein verloren hatte und immerzu davon sprach, dass er es noch spürte und dass es ihm schmerzte. Er bekam eine kleine Invalidenrente, aber die reichte ihm hinten und vorn nicht, sodass seine Mutter immer wieder mal etwas brachte.
Hinter der Tür hörte Egon Frauenstimmen. Er klopfte, vernahm Schritte auf den alten Holzbohlen, und augenblicklich wurde der Sperrriegel umgelegt.
Gertrud Schiller, die Nachbarin, lugte durch den Spalt, öffnete die Tür ganz und sah ihn an, als wäre sie von seinem Auftauchen überrascht. Dabei kam Egon immer zur gleichen Zeit. Er trat in die bescheidene, kleine Wohnung, vorbei an der Freundin seiner Mutter, die ihm die Tür noch immer aufhielt und ihm dabei nachsah, als hätte sie nicht mit seinem Erscheinen rechnen können. Mutter stand am Herd. Als sie ihn erblickte, schöpfte sie lächelnd dampfenden Haferschleim aus einem alten, schwarzen Topf und befüllte einen Teller. Der Hafer war mit Wasser aufgesetzt, bis er weich geworden war. Anschließend fügte sie immer einen Schuss Büchsenmilch hinzu. Und manchmal auch etwas Zucker, wenn es welchen gab. Meist war es Birkenzucker oder brauner Zucker aus Rüben, den sie selbst ausgekocht hatte. Er war nicht so süß wie richtiger Zucker und er hatte einen eigentümlichen Nachgeschmack nach Erde, wie er fand. Egon trat ein, ignorierte Gertrud, die er nicht ausstehen konnte, gab seiner Mutter einen Kuss auf die Wange und stellte den Beutel mit den Kohlebruchstücken und seinen blechernen Henkelmann neben den Ofen. Obwohl es in der letzten Zeit kaum etwas anderes gab als Haferschleim, verspürte Egon einen unbändigen Hunger. Die harte Arbeit unter Tage forderte seinen wachsenden Körper und wenn er nicht an Schlaf dachte, bestimmte Appetit sein Denken. Er setzte sich, legte seine Schirmmütze aus schwerem Kord auf den Stuhl und streute etwas grobes Salz über sein Essen, welches er anschließend wortlos in sich hineinschaufelte.
»Sieh dir an, wie dein Egon schlingt. Der futtert dir noch die Haare vom Kopf. Will er denn nicht den Erich begrüßen?« Gertrud sah den jungen Mann vor sich kopfschüttelnd an, wobei sie ihre Hände in die Hüften gestemmt hatte. Egon tat ihr nicht den Gefallen und sah nicht zu ihr auf. Er wusste auch so, dass ihre Augen tadelnd auf ihm ruhten.
Gertrud Schiller wischte ihre Hände an der Schürze ab und fuhr sich anschließend über ihr schulterlanges, braunes Haar, in dem deutliche graue Strähnen durchschimmerten und sie deutlich älter erscheinen ließen, als sie möglicherweise war. Noch ein paar Jahre und sie würde genauso grau gelockt wie Mutter sein. Gertrud hatte keinen Mann mehr. Er war nicht im Krieg gefallen, sondern hatte Tuberkulose gehabt. Egon vermutete, dass sie Balzer nur pflegte, weil sie voller Hoffnung war. Im Krieg waren Männer rar. Da konnte eine Frau nicht sonderlich wählerisch sein.
»Der arme Mann. Liegt in seinem Fieber …« Ihr Blick wandte sich von Egon ab und richtete sich zu der kleinen Kammer aus, in welcher der Erkrankte lag.
Egon erwiderte nichts. Hoffentlich verreckt das Schwein,dachte er sich. Er aß auf, brachte seinen Teller zum Waschtrog und kratzte anschließend mit dem Löffel die Reste aus dem Topf.
Die Tür ging auf und Annemarie kam herein. Sie sah ihren Bruder und rannte mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu, wobei sie lächelte und den Blick auf die breite Zahnlücke im Oberkiefer freigab. Egon legte den Löffel beiseite, fing sie auf, hob sie hoch und drehte sich mit ihr im Kreis. »Da ist ja mein Liebchen! Ja, sag mal, wo warst du denn?«
Sie gab Egon einen dicken Kuss auf die Wange, wobei sie ihre Lippen mit aller Kraft gegen ihn drückte. Dabei schlang sie ihre dünnen Ärmchen um seinen Hals und drückte so fest, wie sie nur konnte. Egon grunzte und tat, als erwürgte sie ihn.
»Bei Margot! Sie näht mir ein Kleid für Lula.« Margot Schiller war Gertruds Tochter und kümmerte sich oft um Annemarie, wenn Mutter sich mit den Lebensmittelmarken anstellte, einer Tagelöhnerarbeit nachging oder auf dem Schwarzmarkt die Kohle, die er heimbrachte, gegen Essen tauschte. Margot hatte ihr eine Puppe aus alten Lumpen gebastelt, die Augen aus Knöpfen. Annemarie hütete sie wie einen Schatz. Lula war ihre beste Freundin. Sie verstand Annemarie, tröstete sie und öffnete ihr ein Tor zu einer Fantasiewelt, die ihre kindliche Seele vor der unbarmherzigen Wirklichkeit schützte. In letzter Zeit sprach Annemarie viel mit Lula. Über Vater und dass die Bomben ihr Angst machten. Egon wurde immer ganz mulmig zumute, wenn er auf Margot traf, und jedes Mal, wenn sie auf der Türschwelle erschien, hüpfte sein Herz. Regelmäßig trat ihr Bild in seine Gedanken, dessen Zauber körperlich spürbar war. Sie hatte grüne, anziehend unschuldige Augen und kräftiges, haselnussbraunes Haar, welches sie unter einem Tuch verbarg. Wenn sie es ablegte, fielen ihre schweren Locken um die Schultern. Einmal hatten sie sich geküsst. Es war an einem Sonntag gewesen. Die anderen waren auf den Äckern auf der Suche nach gekeimten Saatkartoffeln gewesen. Neben der Kohleförderung war der Stadtteil durch Landwirtschaft geprägt und beinahe jeder nutzte diesen Umstand aus. Zahlreiche Höfe in der nahen Umgebung betrieben Ackerbau und nach der Ernte sammelte die Bevölkerung das auf, was zurückgeblieben war, obwohl die Knechte die Äcker mittlerweile mit Hunden bewachten. Als Fliegeralarm ertönte und kurz darauf die Bomber gekommen waren und die Einschläge die Gegend erzittern hatten, waren sie in den Keller gelaufen. Der Donner war ohrenbetäubend gewesen. Die Erde hatte gebebt und Dreck und Putz war von der Decke gerieselt. Margot hatte sich, die Hände vor die Ohren gepresst, ängstlich eng an ihn gelehnt und als der Lärm abgeebbt war, waren sich ihre Gesichter ganz nah gewesen. Als sich ihre Lippen berührten, hatte sie ihre Zunge fordernd zwischen seine Zähne geschoben, in seinen Mund gedrängt. Egon war darüber total überrascht gewesen und hatte nicht gewusst, wie er darauf reagieren sollte. Schließlich hatte er sich entschlossen, die Bewegungen mitzumachen. Anschließend hatte sie seine Hand ergriffen und sie sich auf die Brust gelegt, wobei sie zart gestöhnt hatte, während er sie massiert hatte. Egon erinnerte sich an die weiche, pralle Form, daran, wie sie sich ihm entgegengedrängt und wie sein Herz im Hals getrommelt hatte. Und wie sich dieses angenehm unanständige Gefühl in seiner Hose ausgebreitet hatte. Ein Gefühl, was sich auch heute noch einstellte, wenn er an die Situation dachte. Eigentlich dachte er immer daran, wenn er sie sah. Oft hatte er ihre Nähe gesucht. Margot jedoch tat stets so, als wäre nie etwas gewesen. Sie war mittlerweile 17 und sah bereits mehr wie eine Frau aus. Egon hatte sich gefragt, ob Gertrud auch einmal hübsch gewesen war. Vor dem Krieg. Sie hatte auch einen großen Busen. Und er hatte sich schon oft dabei ertappt, dass er darauf starrte, wenn sie den Holzfußboden auf den Knien schrubbte. Aber er hatte sich dann immer vor sich selbst geschämt. Weil er es als unanständig empfunden hatte, wenn es ihn erregte. Vielleicht war er Margot zu jung, dachte Egon und jedes Mal wurde er wütend über diesen Gedanken. Er war kein Kind mehr. Immerhin ernährte er die Familie. Er verdiente nicht viel, aber er trug dazu bei, dass sie über die Runden kamen. Außerdem brachte er täglich einen Beutel Kohle mit, mit dem Mutter kochen oder die Stube heizen konnte. Und im Winter war Kohle bares Geld.
»Guck mal! Wackelt.« Annemarie ergriff einen der Milchzähne im Unterkiefer und rüttelte mit den Fingern daran.
Egon legte die Spitze seines Zeigefingers auf den Zahn und bewegte ihn behutsam hin und her. »Na, mein Liebchen wird groß! Bist beinahe schon ein Fräulein.« Egon setzte seine Schwester ab, gab ihr einen Klaps auf den Hintern und sah ihr lächelnd nach, wie sie aus der Wohnung rannte.
Gertrud kam aus der kleinen Kammer, in der Erich Balzer lag. »Das Tuch ist glühend heiß«, sagte sie besorgt und zeigte auf den Stoff, der in der alten Emailleschale im Wasser lag. »Er braucht einen Doktor.«
Mutter stand mit dem Rücken zu ihr und trocknete Egons Teller ab.
»Hast du verstanden, Martha? Das Fieber steigt.«
»Wir können uns den nicht leisten, Gertrud.«
»Was ist mit dem alten Brockhaus? Schick Egon nach ihm.«
Egons Blick sprang zwischen den beiden Frauen hin und her. »Der alte ist ein Quacksalber. Der verkauft seine eigene Pisse als Medizin! Außerdem ist der bestimmt schon wieder besoffen«, polterte es aus ihm heraus. Egon wusste, Brockhaus war kein Arzt. Man hatte die meisten Ärzte als Offiziere zur Front entsandt. Brockhaus war Arztassistent und nutzte Egons Einschätzung nach die Notlagen der Menschen aus. Er tat so, als ob er eine Diagnose stellen konnte, doch wenn man gezielt fragte, wich er aus. Verlor sich geschickt in allerhand Schilderungen, bei denen er immer lächelte und seine gelbbraunen Zähne entblößte. Als medizinisch Sachkundiger bezeichnete er sich. Für Egon stand fest, dass dieser Kerl ein Hochstapler war.
Egon drängte sich rüde an Gertrud vorbei. Das Wasser schwappte aus der Schüssel und sie schimpfte ihn. Vor dem Zimmer blieb Egon stehen, zögerte, dann schob er den provisorischen Vorhang beiseite und schritt in die fensterlose Kammer. Sie war gerade so winzig, dass ein schmales Bett und ein kleines, wurmstichiges Beistelltischchen hineinpassten. Auf ihm lag eine Bibel. Es handelte sich um ein ausgesprochen kleines Buch, welches bei genauerer Betrachtung alt und abgegriffen wirkte. Es war in einem festen, lederbezogenen Karton gebunden, auf dessen Vorderseite ein schlichtes Kreuz geprägt worden war. An der Längswand, mittig über der Lagerstätte, hatte Mutter ein ebenso schlichtes Holzkreuz angebracht. Erich lag auf dem Rücken. Der Raum war unangenehm warm, die Luft stickig. Es roch nach Schweiß und Eiter. Egon trat an das Kopfende des schmalen Bettes. Beinahe hätte er Erich nicht erkannt. Das Gesicht war aschfahl, wirkte stark eingefallen und die dünnen Lippen hoben sich farblich kaum ab. Egon trat einen Schritt näher heran. Erichs Atmung war flach und ging schnell, auf seiner Stirn stand der Schweiß, und er hatte das Gefühl, die Hitze fühlen zu können, die von diesem Körper ausging. Als hätte er die Anwesenheit gespürt, schlug Erich die Augen auf. Ihre Blicke trafen sich. Obwohl er sehr schwach war, wirkten seine Augen klar. Egons Mimik blieb regungslos. Selbst jetzt noch wirkte Balzers Gesicht trotz der Schmerzen überheblich und unerschütterlich, dachte Egon. Womit hatte er es verdient, dass man sich um ihn kümmerte? Dieser Säufer, der nie für etwas gut war. Mit welchem Recht lag er hier und machte seiner Mutter das Leben schwerer, als es ohnehin schon war? Nur wenige Tage nach Vaters Todesnachricht war er zu ihnen gezogen. »Mein Bruder wohnt ab jetzt bei uns«, war das Einzige, was Mutter gesagt hatte. Egon hatte es nicht gewollt, aber sie hatte ihm jede weitere Erklärung verweigert. Sogar Vaters Sachen hatte er an sich genommen. Seinen guten Mantel. Den Mantel, den Egon bekommen hätte und der ihm in wenigen Monaten sicher gepasst hätte, wenn er weiter so wuchs. Egon hasste den Anblick, ihn in Vaters Kleidung zu sehen. Seine Augen wanderten nach unten. Betrachteten das bandagierte Bein. Der Unfall war vor einer Woche passiert. Mutter hatte gesagt, Erich wäre auf dem Schwarzmarkt gewesen, als die Polizei gekommen war. Wahrscheinlich hatte sich dieser Säufer wieder Schnaps besorgen wollen, dachte Egon. Bei der Flucht war er in einen Sprengtrichter gestürzt und eine rostige Metallstrebe, die aus einem der Trümmerteile geragt hatte, hatte sich tief in das Fleisch seines linken Unterschenkels gebohrt. Die Wunde entzündete sich. Gertrud drängte sich an Egon vorbei, legte ihre Hand hinter Erichs Nacken und hob den Kopf etwas an, während sie ihm in kleinen Schlucken Wasser einflößte. »Steh nicht im Weg!«, fuhr sie ihn harsch an.
Egon kehrte in die Stube zurück. Seine Mutter saß am Tisch. Sie sah erschöpft aus. Er setzte sich zu ihr, nahm ihre Hand, drückte sie kurz und lehnte sich dann zurück. Mutter fuhr sich über ihre Stirn, stützte den Kopf, den sie mit geschlossenen Augen schüttelte. Anschließend lehnte auch sie sich zurück und streifte ihr Kleid mit den Händen glatt, während sie ihren Sohn sorgenvoll anschaute.
»Du siehst müde aus, Mutter.«
»Was erwartest du«, bemerkte Gertrud, die aus der Kammer trat. »Was haben wir eine Arbeit gehabt, in den letzten Tagen. Wir haben seine Wunde versorgt, ihn gewaschen, das Bett gesäubert und ihn angekleidet.«
Egon sah sie missbilligend an. »Er schafft es ohnehin nicht.«
Gertrud verengte die Lippen zu einem Schlitz. »Solange er lebt, soll es ihm wenigstens an nichts fehlen.«
Mutter legte Egon eine Hand auf den Unterarm. »Lass gut sein, Junge. Gertrud ist mir eine große Hilfe. Uns allen. Der liebe Gott weiß, was sie alles getan hat.« Sie sah Gertrud an. »Du wirst deinen Lohn gewiss in der Ewigkeit empfangen, meine Liebe.«
Egons Augen ruhten wieder auf dem Gesicht seiner Mutter. »Wir können uns keinen Arzt leisten. Brockhaus ist ein Betrüger.«
»Dann stirbt er!« Wieder war es Gertrud, die sprach.
»Wir haben Krieg«, antwortete Egon knapp. »Jeden Tag sterben Menschen sinnlos.«
Mutter schüttelte den Kopf. »Trotzdem müssen wir ihm helfen.«
Egon sprang wutentbrannt auf und erhob die Stimme. »Nach all dem, was er dir angetan hat?« Er zeigte in Richtung der Kammer, während er seine Mutter anstarrte. »Nach all dem, was er uns angetan hat?«
Seine Mutter sprach mit leiser Stimme. »Das entbindet uns nicht von unseren christlichen Pflichten, mein Sohn. Außerdem ist und bleibt er mein Bruder.« Er spürte den Tadel in ihren Augen, doch vermochte dieser Blick es nicht, seine Wut zu mildern.
»Komm mir nicht wieder mit Gottes Wille! Ich kann es nicht mehr hören. Sieh nach draußen. Sie auf diese verdammten Trümmer. Auf die unzähligen Toten. Sieh es dir an!«
Mutter erhob sich, trat auf ihn zu und hob die Hand. Leicht zog er seinen Kopf ein, als fürchtete er, sie würde ihn ohrfeigen. Stattdessen streichelte sie seine Wange und lächelte milde. »Mein großer Egon.« Sie legte den Kopf leicht schief und betrachtete ihn, wie nur eine Mutter schauen konnte.
»Du hast es so unsagbar schwer, mein Junge. Dieser Krieg hat dich deiner Kindheit beraubt. Dir deinen Vater genommen. Und du bist so tapfer.« Generell war es Egon unangenehm, wenn sie ihn wie einen kleinen Jungen behandelte, aber davon ließ wohl keine Mutter ab, egal wie alt man war.
Sie nahm die Hand zurück und setzte sich wieder. »Ich kann dir nicht sagen, wo wir in all dem Gottes Willen erkennen sollen. Aber ich weiß, dass er deinen Zorn versteht.«
»Dann hol einen Pfarrer. Vielleicht kann der ihm ja helfen. Zumindest kostet er kein Geld.« Egon wich dem enttäuschten Gesicht seiner Mutter aus. Er war zu weit gegangen, das wusste er, und augenblicklich tat es ihm leid. Sie erhob sich, drehte sich um und ging zur Kochnische. Dort nahm sie einen blechernen Henkelmann und öffnete ihn. »Hier«, sagte sie und hielt Egon eine Brosche hin. Es war die Brosche der Großmutter. »Gib das dem Brockhaus. Er soll zu uns kommen.«
Egons Augen weiteten sich. »Mutter! Das kannst du nicht tun. Das ist …«
»Ich habe dich nicht um deine Meinung gebeten, Egon Siepmann.« Resolut trat sie an ihn heran, nahm seine Hand, legte das Schmuckstück hinein und sah ihn streng an.
»Geh, und tu, was ich dir aufgetragen habe. Und widersprich deiner Mutter nicht.« Ihr ernster Ton war nicht misszuverstehen.
Das angespannte Schweigen, welches sich im Zimmer ausbreitete, verbündete sich mit dem tadelnden Ausdruck in den Augen seiner Mutter. Egon sah sie mit pulsierenden Kaumuskeln an. Wortlos drehte er sich um und verließ den Raum.
*
Der Lohdiekweg in Kray, in der Nähe zu Königssteele, war eine eher ruhige Straße. Egon kletterte vorsichtig über den Schuttberg eines Hauses, das in einer der letzten Nächte offenbar einen Volltreffer erhalten hatte. Egon überlegte, ob er nicht einen anderen Weg wählen sollte, entschloss sich dann aber, weiterzugehen. Er musste aufpassen, wo er seinen Fuß hinsetzte. Der Mond war nicht mal halb voll und die kompakte Wolkendecke machte die Sicht nicht besser. Spätestens, seit die Briten sich mit ihren Luftangriffen mehr und mehr auf das Ruhrgebiet konzentrierten, befolgten die meisten Menschen die Anweisungen und ließen ihre Stuben im Dunkeln. Egon sah abwägend nach oben. Die Gebäudefront konnte jeden Moment in sich zusammenfallen, ihn begraben, und die schwer beschädigten Nachbarhäuser sahen nicht besser aus. Noch immer stieg Rauch aus den Trümmern und der Brandgeruch lag wie eine schwere Decke über dem Viertel. Das Ruhrgebiet wurde seit Wochen arg gebeutelt und beinahe jeden Abend, wenn die Dämmerung einsetzte, begannen die großen Suchscheinwerfer die Schwärze des Himmels mit ihren dicken Lichtstrahlen zu durchschneiden. Ein Kutscher versuchte unaufhörlich, sein Pferd durch die Wucht seiner Peitsche dazu zu bewegen, einen Karren mit Habseligkeiten aus einem der Trichter zu ziehen, in dem sich der Wagen festgefahren hatte. Er drosch auf das ausgemergelte Tier, das sich mit angstvoll aufgerissenen Augen und schmerzerfülltem Wiehern aufbäumte. Egon vermutete, dass der Mann ein Plünderer war und seine Beute so schnell wie möglich beiseiteschaffen wollte. Wie wild schlugen die Vorderhufe des Rappen auf das Pflaster, doch so sehr sich das schweißnasse Tier unter den Hieben auch bemühte, der Karren bewegte sich nicht. Egon erkannte im Vorbeigehen feuchte Kleider, einen Kinderwagen und andere Sachen. Dinge, die ihren ehemaligen Besitzern vertraut gewesen waren, behaftet mit Erinnerungen, und die nun hastig und unordentlich auf die Ladefläche geschmissen worden waren.
Am Ende der Straße, kurz vor der Kreuzung zum Lohmühlental, blieb er vor einem sechsstöckigen Haus stehen. Es hob sich in der Häuserzeile nicht von den anderen ab, und wie die übrigen Gebäude sah auch dieses ihn mit skeptischem, rußgefärbtem Gesicht an. Die Fenster des Erdgeschosses hatte jemand mit Brettern zugenagelt. Höchstwahrscheinlich waren die Fensterscheiben aufgrund der Druckwellen herausgeschlagen worden und die Bewohner wollten sich so vor Diebstählen schützen. Und der kalten Luft, die zum Abend hin in die ungeheizten Stuben und wenig später in die Knochen der hungrigen und immer frierenden Menschen kroch. Drei Treppen waren es bis zur kunstvoll verzierten Haustür. Egon drückte gegen das raue und spröde Türblatt und stellte fest, dass sie nicht verschlossen war. Im Hausflur empfing ihn muffige Luft, angereichert mit Schimmelsporen, die sich aus den feuchten Wänden gelöst hatten und den typischen Geruch alter verfallener Gebäude verbreiteten. Rechts klaffte ein großes Loch in der Wand und gab einen Blick auf die roten Ziegel frei. Die Briefkästen hatte man herausgestemmt und das Metall in irgendetwas Brauchbares getauscht. Egons schlurfende Schritte hallten an den nackten Wänden wider, als er über den schuttbedeckten Steinboden ging. In der Stille des Hauses kam er sich wie ein Eindringling vor. Langsam schritt er die alten, ausgetretenen Stufen hinauf. Das dumpfe Geräusch seiner Schuhe erinnerte ihn bei jedem Schritt an das weit entfernte Einschlagen von Fliegerbomben. Vielleicht lag es auch daran, dass ihm in den Zeiten des Krieges die Fähigkeit zu differenzieren abhandengekommen war. Es gab nur das unerträgliche Geräusch der Detonationen, das hohe Brüllen der Bomben. Mark und Bein erschütternde Geräusche der Sirenen. Das Trommeln der Flugabwehrgeschütze, die sich im gesamten Stadtgebiet befanden, das hohe Kreischen und Pfeifen ihrer Geschosse, wenn sie die Luft durchschnitten und die omnipräsente Stille, die sich danach über die gelähmte Stadt ausbreitete und die nur von den Signalhörnern der Feuerwehren unterbrochen wurde. Das Geländer hatte man abmontiert und höchst wahrscheinlich verfeuert. Auf der Zwischenetage sah er durch ein zerstörtes Fenster in den Hof, in dem Reste eines ehemaligen Gartens zu erkennen waren. Die alten Obstbäume hatte man gefällt, sodass die Stämme wie amputierte Stümpfe wirkten. Ein leichter Wind trieb ihm den Geruch stinkenden Abfalls und menschlicher Fäkalien in die Nase, der sich mit dem allgegenwärtigen Duft verbrannten Kokses verband.
Egon schritt die letzten Stufen empor und blieb an der Türschwelle stehen. Dreimal klopfte er mit den Knöcheln seines Mittelfingers.
»Die Tür ist auf. Tretet ein!«
Egon drehte den Knauf und die Tür öffnete sich erstaunlich leicht.
Günter Brockhaus saß an einem Tisch und speiste. Er war ein großer und schlanker Mann, der, zumindest aus einer gewissen Entfernung betrachtet, durchaus eine imposante Erscheinung war. Trat man näher heran, sah man violettes Venengeflecht auf der Nase und unterhalb der Augen durch die Haut schimmern, wie es die Kerle hatten, die regelmäßig zu viel Alkohol tranken. Brockhaus hatte einen schlechten Leumund. Trotzdem hatte er es mit einer gewissen Geschicklichkeit und Beredsamkeit fertiggebracht, dass die Leute seinen Rat suchten. Und dafür bezahlten. Nur wenige gebildete Leute verfügten über solche Fähigkeiten. Vor Brockhaus stand ein Tablett, auf dem ein herrlich knusprig gebratenes Huhn lag. Der Duft stieg Egon in die Nase. Sofort schoss ihm Speichel in den Mund und sein Magen zog sich rhythmisch zusammen. Egon hatte beinahe vergessen, wie köstlich gebratenes Fleisch roch. Das Geflügel war zur Hälfte verspeist. Brockhaus würdigte Egon keines Blickes. Er legte in aller Ruhe das Besteck auf den Teller, tupfte sich mit einem Tuch vornehm den Mund und seinen gezwirbelten Schnauzer ab, um anschließend ein edles Stielglas anzuheben. Er drehte das Glas einige Male unter seine Nase, betrachtete den Inhalt fachmännisch, bevor er es zum Mund führte und von der dunkelroten Flüssigkeit kostete. Egon war sich sicher, dass es sich um Wein handelte. Er hatte noch nie Wein getrunken. Nur Bier. Und selbst gemachten Schnaps, den einige Kumpel aus Kartoffelresten brannten und heimlich auf der Zeche anboten. Egon fand den Geschmack widerlich. Das Zeug brannte sich förmlich in seine Schleimhäute, aber er wollte sich keine Blöße vor den anderen geben. Nachdem Brockhaus das Glas abgestellt hatte, drehte er sich zu seinem ungebetenen Gast. Egon, der noch immer wie gebannt auf dieses unwirkliche Mahl starrte, riss sich aus seinen Gedanken und nahm seine Mütze ab, die er verlegen mit beiden Händen vor sich hielt und unbewusst durchwalkte.
Brockhaus lehnte sich zurück und überschlug die Beine. »Junger Mann. Es wäre angebracht, wenn du deinen Mund schließen und mir mitteilen würdest, warum du mich um diese Zeit bei meiner Mahlzeit störst.« Seine Tonfarbe klang hochtrabend.
»Meine Mutter schickt mich. Martha Siepmann. Aus dem Sammelband.«
»Siepmann, sagst du?« Brockhaus tat nachdenklich und legte den Kopf leicht schief. »Siepmann. Siepmann …«
»Der Erich hat sich verletzt. Er hat Fieber. Mutter glaubt, er stirbt.«
»Erich? Das sagt mir nichts. Ist das dein Vater?«
Egon fühlte, wie eine Welle der Wut in ihm aufstieg. »Er ist nicht mein Vater!« Es gelang ihm nicht, den Anflug der Empörung aus seiner Stimme zu drängen.
»Mäßige deinen Ton! Wenn du flapsig wirst, kannst du dich direkt verabschieden. Und nun sag: Was willst du genau?«
Egon nahm sich zusammen. »Wie gesagt. Meine Mutter schickt mich. Sie lässt fragen, ob Sie sich den Erich mal ansehen könnten.«
Brockhaus schmatzte einige Male und fuhr sich mit einem Fingernagel zwischen die gelben Zähne.
»Was hat er denn, euer Erich?« Er betrachtete das, was er mit seinem Nagel erbeutet hatte, und wischte sich den Finger anschließend an der Hose ab.
»Er hat sich das Bein verletzt. Und nun hat er Fieber. Schreckliches Fieber.«
Der große Mann nickte selbstgefällig. »Die Wunde. Riecht sie? Ist sie entzündet? Also, fühlt sie sich heiß an?«
Egon zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Hab sie nicht gesehen. Aber es stinkt in der Kammer. Wie … nach einer toten Katze.«
Brockhaus stellte die Beine wieder nebeneinander und drehte sich seinem Teller zu. »Es tut mir leid. Ich kann nichts für ihn tun.«
»Aber … Sie haben ihn sich doch noch gar nicht angesehen. Sie sind doch … Arzt.«
Brockhaus wandte sich wieder dem jungen Besucher zu. Sein überheblicher Ausdruck ließ nicht erkennen, dass er die Anrede ihm gegenüber möglicher Weise als unangemessen empfand.
»Na, was soll er schon haben? Wenn sich die Wunde entzündet hat und er fiebrig ist, wird er sich Wundbrand eingehandelt haben.«
»Können Sie denn nichts dagegen tun?«
»Sicher. Aber das kostet. Und du machst mir nicht den Eindruck, als ob du mich bezahlen könntest.«
Egon fasste in seine Hosentasche und holte die Brosche hervor. »Meine Mutter gibt Ihnen das. Als Bezahlung.«
Brockhaus griff in die aufgesetzte Tasche seines Rocks und beförderte ein Monokel hervor, das an einer Kette aus Messing hing und das er sich auf das linke Auge setzte. »Na komm schon. Lass mich mal sehen.«
Egon trat einige Schritte vor und überreichte ihm das Schmuckstück. Brockhaus betrachtete es zunächst ausgiebig von allen Seiten, bis er es nahe an sein Sehglas führte. Anschließend wog er es in seiner Hand. »Na ja«, sagte er schließlich. »Nichts Besonderes.« Brockhaus steckte die Brosche in seine Brusttasche und wandte sich wieder seinem Essen zu.
»Was soll das?« Egon blickte irritiert.
Günter Brockhaus sah ihn finster an. »Was meinst du denn, Junge?«, tat er verwundert. »Ich benötige Medikamente, um euren Erich helfen zu können. Glaubst du, die bekomme ich kostenlos? Oder sehe ich aus wie ein dreckiger Jud, bei dem man sich Geld leihen kann?« Missbilligend schüttelte er den Kopf und drehte sich wieder zum Tisch. Egon wusste nichts zu erwidern. Daran hatte er tatsächlich nicht gedacht. Brockhaus nahm das Glas und tat einen kräftigen Schluck. »Sag deiner Mutter, ich werde mich bei ihr vorstellen, sobald ich die Medizin habe. Es sei denn, du bestehst auf die Herausgabe dieses wertlosen Metalls. Es wird ohnehin schwer, das dafür zu bekommen, was ich benötige.«
»Aber …«, begann Egon stotternd. »Sie wissen doch gar nicht, wo wir wohnen.«
Brockhaus fuhr zur Seite und sein Blick legte sich tadelnd auf Egons Gesicht. »Du hast gesagt, dass ihr im Sammelband wohnt. Es werden wohl nicht unzählige Familien mit dem Namen Siepmann dort hausen, bei denen ein Erich lebt, oder?« Brockhaus machte eine abwehrende Handbewegung, als verscheuchte er ein lästiges Insekt. »Und nun stör mich nicht weiter, unverschämter Bengel.«
Egon hatte ein mulmiges Gefühl, als er die Treppe des Hausflures nach unten schritt. Mehrmals blieb er stehen und drehte sich um. Aber was blieb ihm übrig? Brockhaus hatte wohl recht. Egal, was Egon von ihm hielt. Erich hatte offenbar tatsächlich Wundbrand. Er hatte schon davon gehört, dass so etwas vorkam, wenn sich eine Wunde entzündete. »Das kommt von dem Dreck«, hatte ihm ein Knappe auf Bonifacius mal gesagt, als ein Kumpel gestorben war, der sich unter Tage versehentlich mit der Spitzhacke in den Fuß geschlagen hatte. Man hatte ihm erst den Unterschenkel amputiert, aber der Wundbrand hatte schon den ganzen Körper vergiftet. Egon hatte beobachtet, wie man einem Mann, der sich in der Werkstatt ein rostiges Werkzeug in die Hand getrieben hatte, mit einem glühenden Eisen behandelte, das man ihm direkt auf die Wunde presste. Der Mann hatte fürchterlich geschrien und es hatte drei gestandener Kumpels bedurft, um ihn festzuhalten. Das wäre zur Desinfizierung, hatte man ihm gesagt, damit sich die Wunde nicht entzündet. Trotzdem war ihm unwohl zumute. Er traute diesem Brockhaus nicht.
Egon verließ das Gebäude und stieg erneut über den Schuttberg. Der Pferdekutscher war nicht mehr zu sehen. Seine Augen wanderten nach oben. Die Flakabwehr hatte begonnen, den Himmel mit ihren großen Scheinwerfern abzutasten. In wilden Zickzackbahnen suchten die breiten Lichtstrahlen den schwarzen Himmel ab. Offiziell begann die Ausgangssperre um 20 Uhr und endete gegen 5 Uhr in der Früh. Es sei denn, man hatte eine Sondergenehmigung. Die Polizei wollte damit Plünderungen verhindern. Einmal war Egon angehalten worden. Der Polizist hatte ihm gesagt, dass die Polizei die Befugnis hätte, Verdächtige zu erschießen. Aber das mit der Ausgangssperre wurde nicht so genau genommen. Schlimmer war es, wenn man gegen die allabendliche Verdunklung verstieß. Er hatte mal von einem Soldaten gehört, dass man so ein beleuchtetes Fenster noch in einem Kilometer Höhe sehen konnte.
Egon lief die Krayer Straße ein Stück hinauf, vorbei an zerstörten Häusern, über die Trümmer auf dem schmutzigen Gehweg und konzentrierte sich auf das rhythmisch monotone Geräusch seiner Schuhe. Bis nach Hause war es mindestens eine halbe Stunde. Seine Laune sank. Er war hundemüde, es begann zu nieseln und das allgegenwärtige Gefühl des Hungers drängte sich in sein Denken. Er schlug den Kragen seines abgewetzten Mantels hoch und zog sich die Mütze tiefer ins Gesicht. Nach ungefähr einem Kilometer bog er in die Joachimstraße. Er würde die Abkürzung über die Gleise nehmen. Er war noch nicht um die Eck, als er eine Männerstimme rufen hörte: »Stehen bleiben! Polizei.«
Egon erstarrte vor Schreck. Er vernahm sich schnell nähernde Schritte. Jemand rannte. Direkt auf ihn zu. Schon schälte sich aus der Dunkelheit eine Gestalt. Egons Herz klopfte ihm bis zum Hals. Er trat etwas zurück und drückte sich in einen dunklen Hauseingang. Die Gestalt war im Nu auf seiner Höhe, rannte an ihm vorbei und blieb stehen. Wieder schrie jemand, diesmal aus der anderen Richtung und unmittelbar darauf ertönte das schrille Geräusch einer Schutzmannspfeife. Sie nahmen den Flüchtenden in die Zange. Die Person sah sich wie ein gehetztes Wild hektisch in alle Richtungen um, drehte sich und rannte zurück. Seine Schlägermütze flog ihm vom Kopf. Egon sah, dass es ein junger Kerl war. Vielleicht in seinem Alter. Vielleicht etwas älter. Seine Kleidung war schäbig und die Jacke zu groß. Einen kurzen Moment zögerte er, überlegte offenbar, ob er seine Kopfbedeckung aufheben sollte. Er entschloss sich, stattdessen zur gegenüberliegenden Einfahrt zu laufen. Wenige Wimpernschläge später war er auf dem dahinterliegenden Hof verschwunden. Egon blieb in dem Hauseingang stehen. Er hoffte, dass man ihn nicht sah. Doch schon bald war er sich da nicht so sicher. Von allen Seiten hörte er plötzlich das Pfeifen der Schutzmänner lauter werden. Hier würde man ihn finden. Er wurde von einer plötzlichen Angst erfasst, die mit jeder Sekunde wuchs, obwohl er sich nichts vorzuwerfen hatte. Egon nahm all seinen Mut zusammen, stieß sich ab und rannte ebenfalls hinüber zu der Toreinfahrt. Zu seinem Entsetzen kam er nicht weiter. Der Hof endete in einer Sackgasse. Umgeben von Mauern, die viel zu hoch waren, als dass man sie ohne Leiter hätte überwinden können.
»Hände hoch!«, hörte er plötzlich einen Mann. Ganz langsam hob Egon die Arme. Hinter ihm erhellte ein Lichtschein die Umgebung. »Umdrehen, Freundchen!«, bellte die Stimme. Egon war starr vor Angst.
»Umdrehen! Wird’s bald?«
Egon hob die Hände noch höher. So hoch er konnte. Vorsichtig, darauf bedacht, keine falsche Bewegung zu machen, drehte er sich. Für einen winzigen Moment fiel der Strahl der Lampe dabei auf eine niedrige Hecke direkt vor ihm und erhellte das Gesicht des Jungen, der dort kauerte und ihn mit weit aufgerissenen Augen anstarrte.
»Haben wir dich!«
Egon vollendete die Drehung. Das Licht blendete ihn und er sah nichts. Plötzlich erfasste ihn jemand am Revers und drückte ihn hart gegen die Mauer. »Hände an die Wand und Beine breit!«
Egon gehorchte. Mehrere Hände tasteten ihn ab. Jemand zog ihm seine Papiere aus der Jacke, eine andere Hand erfasste ihn an der Schulter und riss ihn rüde herum. Drei Polizisten grinsten ihn an. Einer richtete eine Maschinenpistole auf ihn und ließ ihn nicht aus den Augen. Ein anderer blätterte langsam und sorgfältig in seiner Kennkarte.
»Dann wollen wir mal sehen, wen wir hier haben.« Der dritte Beamte richtete seine Lampe weiter auf Egon, der mit halb zugekniffenen Augen versuchte, etwas zu erkennen. »Egon Siepmann. Schön, Egon. Dann erzähl mal. Wer war noch mit von der Partie?«
»Ich weiß gar nicht, worum …«
Die Ohrfeige riss Egons Kopf zur Seite. Seine Lippe schwoll in Sekundenbruchteilen an und in der gesamten Gesichtshälfte machte sich ein brennendes Gefühl breit.
»Hältst dich wohl für einen ganz Schlauen, was? Mal sehen, ob du noch so ’ne große Schnauze hast, wenn wir dich aufs Revier bringen.«
»Aber ich weiß es doch wirklich nicht.« Schützend hielt Egon die Arme hoch.
»Ach ’ne? Und warum biste dann abgehauen?«
Egon blinzelte über seine Hände, die er noch immer vor seinem Gesicht hielt. »Wissen Sie, Herr Wachtmeister …«
Wieder traf ihn eine Ohrfeige. Dieses Mal nicht so hart.
»Oberwachtmeister Leineweber! Schreib dir das gefälligst hinter die Ohren, du Rotzbengel. Also. Noch mal. Warum bist du flitzen gegangen?«
»Na, weil ich die Pfeifen gehört habe. Und weil da so ein Kerl auf mich zugerannt kam.«
»Was für ein Kerl?«
»Na der, der von da unten kam. Vom Bahnhof. Ich hatte Muffensausen.«
Der Schutzpolizist vor ihm senkte die Lampe etwas, sodass sie Egon nicht mehr blendete. Der Beamte vor ihm war schon älter. Er hatte einen breiten Schnauzer wie der von Kaiser Wilhelm. Er betrachtete Egon misstrauisch und immer wieder wanderten seine Augen zwischen dem Bild auf Egons Kennkarte und dem Gesicht des Jungen hin und her.
»Du kannst mir viel erzählen«, sagte er schon nicht mehr ganz so streng.
»Es stimmt aber. Ich war bei dem Brockhaus. Im Lohdiekweg. Kennen Sie den? Mutter hat mich geschickt, weil ihr Bruder krank ist. Sie können ihn ja fragen.«
Der Schutzpolizist vor ihm sah ihn abwägend an. »Brockhaus? Wer soll das sein?«
Erst jetzt bemerkte Egon, dass er seine Arme noch immer schützend erhoben hatte. Langsam senkte er sie. »Der Kerl ist so etwas wie ein Arzt. Zumindest sagt er das.«
»Jetzt weiß ich, wen er meint«, fuhr der Beamte links des Alten dazwischen. Er war deutlich jünger und Egon meinte, ihn schon einmal gesehen zu haben. »Der Kerl ist ein Betrüger und zieht den Leuten das Geld aus der Tasche.«
Egon nickte eifrig.
Der ältere Polizist warf seinem Kollegen einen fragenden Blick zu, bevor er sich wieder Egon zuwandte. »Ist dir das bekannt?«
»Schon.« Egon zuckte mit den Schultern. »Aber Mutter bestand darauf. Weil der Erich … das ist ihr Bruder … nun, dem geht es nicht gut. Wenn Sie mich fragen, schafft er’s nicht.«
Der Schupo klappte Egons Kennkarte zusammen, hielt sie aber weiter fest. »Du sagst also, du hättest dir beinahe in die Hose geschissen und hast dich deshalb versteckt?«
Egon rieb seine gerötete Wange. Der Schmerz war in ein unangenehmes Taubheitsgefühl übergegangen. »Klar. Weiß ich, was der angestellt hat? Umsonst werden Sie ihm ja nicht hinterher sein.«
»Wo ist er denn hin?« Der Beamte schlug Egon mit dem Ausweis auf die Kappe.
»Na, da hoch. Richtung Krayer.«
Der Polizist zog eine Augenbraue nach oben und beließ sie in dieser Position. »Hermann. Du bist doch von der Krayer Straße gekommen. Ist dir da jemand entgegengelaufen?« Er sah seinen Kollegen nicht an, während er ihn fragte.
»Hätte ich gesehen«, antwortete der Beamte mit der Maschinenpistole.
Der Ältere sah Egon mindesten zehn Sekunden lang an, ohne ein Wort zu sagen. Eine Ewigkeit, in der Egons Unbehagen derart stieg, dass er kurz davor war, in Panik zu geraten.
»Gut, Egon. So wie ich das sehe, gibt es nicht viele Möglichkeiten. Du lügst uns an, versuchst, jemanden zu decken, oder der Flüchtige hat sich in Luft aufgelöst. Da ich an Letzteres nicht glaube, muss er dann noch hier im Hof sein.«
Erst jetzt merkte Egon, dass er die Luft angehalten hatte. Er versuchte normal zu atmen, damit er seine Unsicherheit nicht verriet, aber es gelang ihm nicht. »Was ist denn überhaupt passiert?«, platzte es aus ihm heraus, um Zeit zu gewinnen.
»Der Täter hat eine verräterische Parole an das Gebäude des Bahnhofes gepinselt. Ein aufmerksamer und anständiger Bürger hat ihn dabei beobachtet und uns angesprochen. Wir verweilten zufällig in der Nähe.«
»Zeig mir deine Hände!«, befahl der Beamte mit der Maschinenpistole.
Langsam streckte Egon sie aus.
»Und jetzt umdrehen.«
Egon tat, was ihm befohlen wurde.
»Und jetzt zeig mir deine Schuhe. Ich will deine Sohlen sehen.«
Egon drehte sich, stützte sich mit den Händen an der Mauer ab und hob nacheinander die Füße an.
»Er hat keine Farbe an den Händen. Und seine Sohlen sind auch sauber«, hörte er hinter sich den bewaffneten Schupo. Egon drehte sich wieder vorsichtig um.
Der Beamte mit dem Kaiser-Wilhelm-Bart überlegte. Er schien sich nicht mehr so sicher.
»Muss nichts heißen. Er kann mit diesem Pack trotzdem unter einer Decke stecken. Vielleicht hat er Schmiere gestanden. Dieter! Hermann! Durchsucht den Hof«, befahl er, wobei er weiter auf den jungen Burschen vor sich starrte. »Wehe, Freundchen, wenn wir hier was finden.«
Egons Herz schlug ihm bis zum Hals. Seine Därme verkrampften und er hatte das Gefühl, sich jeden Moment in die Hose zu machen. Er setzte alles auf eine Karte.
»Sehen Sie ruhig nach, Herr Wachtmeister. Aber ich glaube nicht, dass Sie hier was finden. Der ist nämlich noch ein Stück die Straße hoch.«
»Du glaubst doch wohl nicht, dass ich so dumm bin und dir einfach so glaube.«
Egon zuckte mit den Schultern. »Ich meine ja nur. Der hat weiter oben seine Mütze verloren. Müsste bestimmt noch da liegen.«
Der mit dem Kaiserbart kniff wie zu einer Warnung die Augen zusammen. »Hermann! Sieh nach.«
Sofort setzte sich der Mann in Bewegung, während der andere Beamte das Licht seiner Lampe über den Hinterhof gleiten ließ. Egon schielte zur Seite. Er sah, wie der Lichtschein zitternd, beinahe tanzend langsam die Hecke des Hofes abtastete und sich dabei dem Punkt näherte, wo der Junge sich versteckt hielt. Egon spürte, wie sich seine Kiefermuskeln verspannten und er innerlich erschauderte. In einer solchen Situation konnte eine Sekunde eine Ewigkeit sein. Und diese wenigen Augenblicke fühlten sich schrecklich lang an. Genau in dem Moment, als der Polizist die Lampe auf die Stelle richtete, wo der Junge saß, ertönte der gellende Pfiff aus der Schutzmannspfeife. Der Beamte auf dem Hof fuhr herum.
Der Lichtstrahl glitt über Egons Gesicht und richtete sich auf die Straße aus. Der eine Beamte drückte ihm seine Kennkarte vor die Brust und noch ehe Egon reagierte, fiel sie zu Boden. Unmittelbar darauf rannten die beiden Schutzpolizisten los.
Egon atmete einige Male tief ein und aus. Das flaue Gefühl im Magen wollte nicht abebben und seine Därme baten eindringlich um Erleichterung. Mit zittrigen Knien hob Egon den Ausweis auf, ging zur Straße und sah in die Richtung, in welche die Schupos gerannt waren. Sie waren nicht mehr zu sehen. Egon drehte sich um und winkte in Richtung Hecke. Der Hof war stockdunkel, er erkannte nichts. Fast wie aus dem Nichts bildeten sich plötzlich Konturen ab. Nochmals spähte Egon in alle Richtungen.
»Keiner zu sehen«, flüsterte er. Der Junge trat aus der Dunkelheit. Einen flüchtigen Moment sahen sich die beiden jungen Männer an. Egon konnte sich nicht daran erinnern, ihn jemals zuvor gesehen zu haben. Er hatte eine Narbe, die sich neben dem rechten Auge befand und eine Form hatte, die Egon an eine Mondsichel erinnerte.
»Danke«, nickte der andere und lächelte. Dann lief er los und wurde nach wenigen Metern von der Nacht verschluckt.
*
Mit einem geradezu Angst einflößenden Donnern kam der Förderkorb an die Oberfläche. Ein metallenes Monster, das Bergleute und tonnenschweres Material tief in den Schoß von Mutter Erde brachte. Obwohl Egon schon beinahe sechs Monate täglich einfuhr, hatte sich der Respekt, den er beim Betrachten des imposanten, 1910 errichteten und beinahe 35 Meter hohen Malakowturms empfand, nicht gelegt. Noch immer sah er beim Betreten des Zechengeländes ehrfurchtsvoll auf die riesige Treibscheibe, die auf ihrem stählernen Gerüst wie ein Mahnmal wirkte und das Gesicht dieser Gegend prägte.
An seinem ersten Tag war ihm das Gelände als der Vorhof zur Hölle erschienen. Die rußgeschwärzten Gesichter der Kumpel. Überall Flammen, ein unerträglicher Krach, Dreck, Kohlenstaub.
Nachdem Egon seine Kleidung in der Weißkaue an dem Püngelhaken unter die Decke gezogen hatte, dicht an dicht neben unzähligen Bündeln anderer Kumpels, hatte er sich seine Bergmannskluft aus schwerem Leinen in der Schwarzkaue angezogen. Dazu sein Arschleder und seine Knieschoner. Anschließend war er zunächst zur Lampenstube gegangen und hatte sein Geleucht, seine persönliche Grubenlampe, abgeholt. Nun stand er mit den Kumpel der Frühschicht zur Seilfahrt an. Zur Förderung wurden vier Körbe übereinander mit je zwei hintereinanderstehenden Wagen verwendet, in denen bei jeder Seilfahrt bis zu 68 Bergleute pro Korb transportiert werden konnten.
Die Tür aus Metalldraht wurde geöffnet und eine schier unerschöpfliche Anzahl an pechschwarzen Bergleuten drang hinaus. Nur ihre Zähne, das Weiß ihrer Augäpfel und die tiefen Falten in ihren Gesichtern hoben sich bizarr ab. Die Nachtschicht begrüßte die Kumpel der Folgeschicht mit erschöpften Gesichtern und einem ehrlichen »Glück auf!«. Die gierige Rüstungsindustrie verlangte allen Übermenschliches ab und viele waren der Meinung, dass es pures Glück war, dass ihnen in der zurückliegenden Schicht nichts passiert war. Aber auch ohne die vielen Gefahren waren die meisten Kumpel mit Mitte 40 bergfertig. Ihre geschundenen Körper und Lungen alterten durch die Strapazen, dass selbst junge Kerle nach wenigen Jahren wie alte Männer wirkten. Egon und die anderen machten Platz und das Klappern der Grubenlampen und der Henkelmänner, die in der Enge aneinanderstießen, begleitete die Männer hin zur Waschkaue. Es roch nach Schweiß, nach Dreck und Kohle, deren Staub sich über alles und jeden legte. Schon drängte die Menge der eigenen Schicht Egon von hinten weiter. Der Kumpel, der sie einwies, stieß sie rüde zurück und winkte einen nach dem anderen in die Kabine. Egon betrat den Korb und versuchte seine Schultern breit zu machen, um sich etwas vor der Enge zu schützen, die sich nicht nur gegen seinen Körper richtete. Sie legte sich nach wie vor noch immer auf sein Gemüt und formte eine Empfindung tiefer Beklemmung. Das Tor wurde mit einem lauten Poltern zugeschlagen. Ketten rasselten und sicherten es mit einem mächtigen Schloss, das der Einweiser nochmals kontrollierte. Anschließend ertönte eine Schelle und der Förderkorb setzte sich mit einem Ruck in Bewegung. Sogleich erfasste ihn beinahe das Gefühl des freien Falls und ihm war, als würden seine Füße vom Boden abheben. Der Korb raste mit beängstigender Geschwindigkeit durch die schwarz-silberne Röhre. Jedes Mal war es ihm, als fiele er in die Schwärze eines bodenlosen Loches. Wie immer sprachen die Männer kein Wort, standen still, fast unbeweglich. Die Kabine schwankte und das Stahlseil über ihnen ächzte unter der Last. Der Fahrtwind erfasst ihn, fuhr ihm von unten ins Gesicht, sodass seine Augen tränten. Zunächst noch kühl, verwandelte er sich mit jedem weiteren Meter in einen warmen und zuletzt stickigen Strom. Egon hielt sich die Nase zu und presste Luft, um seine Ohren von dem stetig zunehmenden Druck zu befreien, der sich wie festgestopfte Watte in seinen Gehörgängen anfühlte. Nach gefühlt unendlich langer Zeit griffen die Bremsen kurz vor Erreichen der Sohle und Egons Gewicht schien sich zu verdoppeln. »Wenn du dir bei der Seilfahrt in die Hose scheißt, kommt es dir spätestens beim Anschlag am Kragen wieder raus«, hatte ihm ein Hauer gesagt, als er vor seiner ersten Seilfahrt gestanden hatte.
Das stählerne Gatter wurde geöffnet und die Männer strömten aus dem Förderkorb. Einige Male holte Egon tief Luft. Es war heiß, das Thermometer zeigte über 30 Grad an und die Luftfeuchtigkeit war so hoch, dass die ersten Kumpel bereits damit begannen, ihre Oberbekleidung für den folgenden Marsch auszuziehen. Egon tat es den anderen Männern gleich und schaltete seine Lampe ein. Gemeinsam liefen sie, wie eine lange Schlange leuchtender Lichter, vom Füllort aus in Richtung der Flöze. Egon war gerade mal 16 Jahre alt und eigentlich hätte er nach den Schutzbestimmungen noch nicht unter Tage Arbeiten eines Hauers verrichten dürfen. Grubenjungs wurden durchaus von erfahrenen Hauern mitgenommen, aber höchstens als Pferdejunge, Wagenstößer oder als Helfer in der Förderung. Aber mit den Bestimmungen nahm man es seit einiger Zeit nicht mehr so genau. Jeder wehrfähige Mann wurde zur Ostfront entsandt und die Reihen der Bergleute lichteten sich in einem atemberaubenden Tempo. Die Zechen im Ruhrgebiet fuhren Sonderschichten, um den Hunger der Rüstungsindustrie nach dem schwarzen Gold zu befriedigen. Außerdem waren junge Burschen gefragt. Sie konnten in die engen Flöze, teils liegend und über Kopf arbeitend, und das schon, bevor man die Grubenstempel eingebracht hatte, um das Hangende über ihren Köpfen zu sichern.
Seit einiger Zeit fuhren vermehrt Polen und Russen ein. Sie waren getrennt von den anderen. Verbrecher, Bastarde seien es, so hatte man ihnen gesagt, die eigentlich an den Galgen gehörten. Sie trugen andere Kleidung. Keine Bergmannskluft. Viele hatten gestreifte Sträflingskleidung an, andere normale Straßenkleidung. Sie schufteten zusammen mit einigen Juden, die sogar unter Tage ihre Judensterne trugen. Egon hatte gesehen, wie sie die großen Kohlestücke im Kohlebunker zerschlagen mussten, damit der Bruch durch den Gitterrost passte. Sie waren dünn. Nur Haut und Knochen. Egon hatte sich gewundert, wie sie die harte Arbeit überhaupt durchhalten konnten. Egons Vorarbeiter, Fred Messerschmidt, nannten alle wegen seines Namens nur Mackie Messer. Und weil er mit seiner Brille so ähnlich wie der junge Berthold Brecht aussah, obwohl Egon eigentlich nicht wusste, wer Berthold Brecht war und was das wiederum mit einem Mackie Messer zu tun hatte. Ursprünglich hatte er als Hauer auf Zeche Centrum in Wattenscheid malocht, hatte sich dort aber mit dem Steiger verworfen und war nach Bonifacius gewechselt. Mackie war ungefähr 25 Jahre alt und hatte hellblondes Haar, was nass, wie bei fast allen Blonden, beinahe schütter wirkte, dazu trug er in der Regel einen rotblonden Dreitagebart. Unter Tage setzte er seine Lederkappe immer lässig zur Seite auf. »Die Frauen lieben meine unschuldigen Augen«, hatte er immer angegeben und in der Tat konnte er dreinblicken wie ein geprügelter Hund. Egon mochte ihn, weil er ihn nicht anders behandelte als die anderen Männer und er ihn auch nicht fortschickte, wenn er von nackten Frauen sprach und davon, was er mit ihnen so anstellte. Er wusste nur, dass Mackie gern trank und dabei wohl öfter über die Stränge schlug. Auf jeden Fall hatte Mackie ihm gesagt, dass die Juden aus Steele kamen. Im April war auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Johann Deimelsberg, am Holbecks Hof in Königssteele, ein Barackenlager errichtet worden. Dort mussten auf Anweisung der Gestapo alle Juden aus Essen hin. Zumindest hatte Mackie ihm das gesagt. Warum sie dort leben mussten, wusste Mackie angeblich nicht. Vielleicht wollte er es nicht sagen. Außerdem, hatte er immer gesagt, mache er sich eigentlich nichts aus Politik. Hier zählte nur, ob einer seinen Mann stehen konnte. Das reichte, um als guter Kerl zu gelten. Die da oben wüssten schon, was zu tun wäre. Es müsste ja einen Grund geben. Egon wusste nur, dass das Lager mit Stacheldraht eingezäunt war und dass die Gestapo es bewachte. Es gab unter den Kumpel Gerüchte. Man munkelte, dass alle Juden nach Osten gebracht wurden und dass man das sicher nicht tat, um ihnen einen Urlaub zu spendieren. Egon selbst hatte schon mehrfach mitbekommen, wie einige jüdische Familien aus der Nachbarschaft mit Koffern auf Lkw klettern mussten und von der Polizei weggebracht wurden. Die Beamten waren dabei nicht gerade zimperlich mit ihnen umgegangen. Auch nicht mit den Frauen und den Kindern. Er war erst elf Jahre alt gewesen, als man überall die Fensterscheiben der jüdischen Geschäfte eingeschlagen und die Läden in Brand gesetzt hatte. Sogar die alte Synagoge an der Steeler Straße hatte gebrannt. Und überall hatte man Schilder gesehen, auf denen gestanden hatte, dass man sich wehren und nicht bei Juden kaufen sollte. In der Schule hatte man ihnen gesagt, dass die Juden die gerechte Strafe für ihre Schandtaten erhalten hätten. Sie hätten es zu weit getrieben und das deutsche Volk hätte sich erhoben. Egon wusste allerdings nicht genau, was man ihnen konkret vorwarf. In der fünften Klasse der Volksschule hatte ihnen der Lehrer etwas über Rassenkunde erzählt. Über Blutreinheit und Volksentartung und darüber, dass Juden nicht der arischen Rasse angehörten. Sie waren von Natur aus hinterlistig und feige. In der Regel dunkelhaarig mit ebenso dunklen Augen und Hakennasen. Obwohl Egon selbst nach dem Rassenatlas, den seine Schule besaß, nicht in allen Punkten arisch zu sein schien – er hatte keine blauen Augen, sie waren mehr grünbraun, und sein Haar war eher braun als dunkelblond –, hatte ihn der Lehrer vor der Klasse als typischen Arier ausgewiesen. Etwas, was Egon zugegebenermaßen stolz gemacht hatte. Er hatte mit Vater darüber geredet. Er hatte gemeint, dass sicher nicht alle Juden schlecht wären, aber man generell keinen Umgang mit ihnen pflegen sollte, da die meisten von ihnen nicht dem Vaterland dienen würden. Sie wären generell ein eigenartiges Volk. Wie sie sich kleideten, mit ihren schwarzen Hüten, unter denen diese für Männer inakzeptablen Locken hervorlugten, ihrer schwarzen Kleidung und ihrer seltsamen Art, mit wippendem und vorgebeugtem Oberkörper zu beten. Vater war überzeugt, dass es erheblich zu viele Juden gab. Viel mehr, als für die Heimat gut war. Deutschland sei ein christlich geprägtes Land und da könnte man fremdartige religiöse Ansichten nur bedingt tolerieren. Außerdem wären die Juden Schuld an dem Krieg. Stets hatte das zu einem heftigen Streit mit Mutter geführt, die den politischen Ansichten des Vaters stets mit Skepsis entgegengetreten war. Egon hatte dann die Stube verlassen müssen, wenn sie darüber gestritten hatten. Wenn es darauf ankam, konnte Mutter eine wahre Kämpfernatur sein. Egon hatte nur den alten Leew Weizmann gekannt, der auf der Krayer Straße einen Laden gehabt hatte. Er hatte ihn als freundlichen Mann in Erinnerung. Sein Alter hatte man schlecht schätzen können, da er einen grauen Rauschebart trug, der Teile seines Gesichtes verdeckte. Egon hatte mit seinen Schulkameraden dort öfter für einige Pfennige, die sie zusammengeschmissen hatten, eine Tüte gemischte Bonbons gekauft. Es war nie leicht gewesen, das Richtige für alle auszusuchen, und manchmal hatten sie lange überlegen müssen. Weizmann aber war nie ungeduldig geworden und hatte immer freundlich gelächelt. Und meist hatte er ein Lied gesummt, während sie sich nicht hatten entscheiden können. Seine Frau, die er immer Zimmes genannt hatte, was wohl ein Kosename gewesen war, hatte dort manchmal selbst gebackenes Brot angeboten, das Challa hieß und das voller Sultaninen gewesen war. Zumindest hatte das der alte Leew immer erklärt, wenn er ein Stück über die Theke gereicht hatte, damit die Jungs davon kosten konnten. Egon erinnerte sich noch daran, dass es warm gewesen war und herrlich süß geschmeckt hatte. Auch Weizmanns Geschäft war vor ein paar Jahren zerstört worden. Egon hatte die Weizmanns danach nie wieder gesehen.
Hier unten, in mehreren hundert Metern Tiefe, spielte Politik keine große Rolle. Obwohl einige der Überzeugung waren, dass der Einfluss der Gestapo bis in den letzten Winkel eines Flözes reichte. Nur der Steiger war derjenige, der anstelle von Glück auf »Heil Hitler« zur Begrüßung benutzte oder es zumindest hinten dranhängte. Egon folgte dem schwankenden Tross. Bis zum Flöz waren es gut und gern 15 Minuten Fußmarsch. Schon der Weg in dieser sauerstoffarmen Luft war mühsam und der Schweiß strömte den Männern aus allen Poren. Der Boden war feucht, in einigen Senken stand das Wasser knöcheltief und manchmal tropfte es von oben.
Neben Egon ging ein alter Bergmann. Sein Kreuz war breit, doch er lief gebückt und hustete immerzu. Wie viele alte Kumpel war er durch den jahrelangen, körperlichen Raubbau gezeichnet. Alle alten Bergleute, die er kannte, husteten. Auch Vater hatte bereits gehustet, obwohl er nicht so alt gewesen war. Das komme von dem Staub, hatte er gesagt. Von dem Steinstaub. Die Kohle konnte man leicht abhusten. Aber der Steinstaub setzte sich in der Lunge fest. Außerdem wäre da etwas in dem Staub, das die Lunge auflöste, hatte Vater ihm gesagt. Irgendein Zeug, was in den Steinen war und von dem man Silikose oder so ähnlich bekam und das sich auch nach Jahren noch durch das Gewebe fraß.
Egon war übel gelaunt. Zunächst hatte es geheißen, dass er zum Band sollte. Im Schacht II hatte man 1935 eine elektrische Fördermaschine in Betrieb genommen, die bis zu 14 Tonnen Kohle bei einer Geschwindigkeit von 20 Metern pro Sekunde abtransportieren konnte. Er war von solcher Technik begeistert und wünschte sich insgeheim, später einmal solche Maschinen entwickeln zu können. Oder Sprengmeister zu werden. Das war auch etwas, was ihm später gefallen könnte. Er hatte beinahe eine Woche zur Unterstützung ausgeholfen und obwohl er die ersten Tage höllischen Respekt vor dem Dynamit gehabt hatte, hatte er mehr und mehr Gefallen an der Arbeit gefunden. Der Sprengmeister hieß Justus Braun. Er war ein sehr umsichtiger Mann, der Egon viel über die Gefahren des Bergbaus berichtet hatte. Die rechte Gesichtshälfte des alten Sprengmeisters war verbrannt. Eine große Narbenfläche, die, wie erkaltetes Wachs wirkend, mit der Umgebungshaut verschmolzen schien. Es war damals gewesen, hatte Justus ihm geschildert. Am 31. August 1936. Auf der 9. Sohle der Zeche Vereinigte Präsident in Bochum-Hamme.