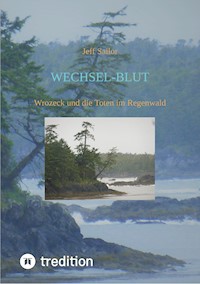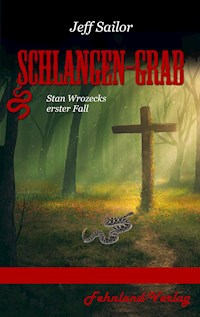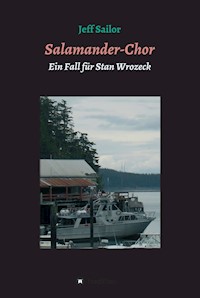
5,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: ´US-Krimis mit Stan Wrozeck`
- Sprache: Deutsch
Da gibt es diese Bruderschaft von Althippies, die Sheriff O´Connor ein Dorn im Auge sind, allesamt nichtsnutzige Trinker und Kiffer, wie er sagt. Er duldet nun mal keine Drogenkriminalität in "seiner" nordkalifornischen Stadt Eureka. Und wenn die sich regelmäßig in aller Heimlichkeit treffen und Absprachen halten, kann man dann nicht schon von einem Drogenkartell oder -syndikat sprechen? Stan Wrozeck, sein Deputy, fragt sich, ob es nicht vielleicht noch einen tieferen Grund für O´Connors stets zur Schau getragene Abneigung gegen diesen lockeren Verbund von Kleinkriminellen gibt, den sein Vorgesetzter den "Salamander-Chor" nennt. Schließlich entdeckt man einen Toten am Strand begraben, der aus dem erlauchten Kreis der Salamander stammt, und Stan findet mithilfe von Lucy, der cleveren Leiterin der forensischen Abteilung, heraus, dass einem konspirativen Bestattungsritual ein veritabler Mord vorausgegangen ist. Nicht genug damit. Man kommt sogar dahinter, dass ein paar Jahre zuvor schon einmal jemand im Sand verscharrt wurde, und der findet sich dann ebenfalls wieder - auf einem anderen Strandabschnitt. Kapitalverbrechen rufen selbstverständlich sogleich die FBI-Agentin Alice auf den Plan, die auf die Einhaltung von Zuständigkeiten drängt, dann aber mal wieder auf Stans Unterstützung angewiesen ist. Ob der damit glücklich wird, steht auf einem anderen Blatt. Schließlich tritt im Zuge der Ermittlungen so einiges zutage, was der Deputy lieber nicht gewusst hätte und was ihm seinen Job gehörig verleidet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jeff Sailor
Salamander-Chor
Kriminalroman aus Nordkalifornien Ein Fall für Stan Wrozeck
© 2021 Jeff Sailor
Lektorat, Korrektorat: Norbert Tossing
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-18540-1
Hardcover:
978-3-347-18541-8
e-Book:
978-3-347-18542-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Jeff Sailor
Salamander-Chor
Kriminalroman aus Nordkalifornien
- Ein Fall für Stan Wrozeck -
A existencia do mal nao pode ser negada, mas a maldade da existencia do mal pode nao ser acerite.
(Die Existenz des Bösen kann man nicht abstreiten, wohl aber, dass die Existenz des Bösen böse ist.)
Fernando Pessoa
Über den Autor
Jeff Sailor wurde am 31.8.1956 in Salinas, Kalifornien, als Sohn eines US-amerikanischen Ozeanologen und einer deutschen Chemikerin geboren.
Nach der Trennung seiner Eltern zog er bereits als Fünfjähriger mit seiner Mutter nach Deutschland und lebte mit ihr in Düsseldorf. Er studierte Germanistik an der Universität zu Köln, brach das Studium nach einigen Jahren aber ohne Abschluss ab und kehrte zurück in den Westen der USA zur Familie seines Vaters. Dort nahm er im Folgenden etliche Gelegenheitsjobs an. So betätigte er sich als Erntehelfer im Steinbeck-Country, als Werftarbeiter in Monterey sowie als Zeitungsredakteur in Astoria, Oregon.
Als freier Schriftsteller schrieb er unter anderem die Romane „Jenseits von Jenen“, „Stark-Sturm“, „Schlangen-Grab“, „Tot-Schlaf“ und „Fern-Endlichkeit“. Außerdem verfasste er die Kurzgeschichtensammlung der „Tossing Tales“ sowie viele weitere Storys, Gedichte, Essays, Theaterstücke und Satiren. Er schreibt in deutscher Sprache und übersetzt hin und wieder eines seiner Werke ins Englische. Häufig publiziert er unter Heteronym, nennt sich dabei Alissa Carpentier oder Gudrun Tossing.
Nach fünf gescheiterten Ehen, unter anderem mit einigen Protagonistinnen seiner Romane, lebt er inzwischen zurückgezogen und Pfeife rauchend in seiner vom Vater ererbten Villa in Carmel bei Monterey. Sein apricot-farbener Pudel heißt Carli V.
Teil I: Stan als Beichtvater
1) Im Schattenreich des Selbst
Der Tag, an dem Dan Keats, genannt Danny, ein Gespenst erschien, begann völlig harmlos: mit einigen Einkäufen im Supermarkt und den Vorbereitungen für das abendliche Treffen mit den Jungs seiner Gang.
Jener Tag sollte für ihn und seine Freunde schließlich im Gefängnis enden, dem City Jail der nordkalifornischen Küstenstadt Eureka.
Aber selbst das hätte ihn kaum erschüttert, wäre da nicht zuvor diese unheimliche Vision gewesen: der Geist des längst verblichenen Pawnee, der ihm den Tod vorhersagte. Die Prophezeiung seines baldigen Ablebens traf Danny bis ins Mark.
Doch es soll der Reihe nach berichtet sein, ab dem Beginn der konspirativen Zusammenkunft im kleinen Klippenhaus über dem Pazifik:
„Liebe Freunde, hiermit eröffne ich unsere heutige Sitzung“, erklärte Danny würdevoll und blickte in die Runde. Die Männer erhoben die Gläser und prosteten ihm zu.
„Darf ich dich, Jeff, als unseren Schriftführer bitten, das Protokoll zu übernehmen“, wandte er sich mit ausgesuchter Höflichkeit an seinen Gefährten zur Linken. Der Angesprochene nickte, zückte Block und Kugelschreiber und begann, die Anwesenheitsliste aufzustellen.
Dan Keats thronte als Vorsitzender am Kopfende des Sitzungstischs und fühlte sich wie König Artus in seiner legendären Tafelrunde der edlen Ritter.
Nun, die Tafel war lediglich ein ausziehbarer Esstisch mit acht Stühlen, und der stand in einem ziemlich kleinen Wohnraum, in dem ansonsten nur eine alte, durchgesessene Couch vom Sperrmüll nebst einem wackligen Beistelltischchen Platz fand.
In der Ecke bullerte ein mit Holz beheizter Kanonenofen. Für Ende März war es noch merklich kühl im nordkalifornischen Humboldt Distrikt.
Während Jeff Steinberg, ein Journalist ohne festen Job, aber mit schriftstellerischen Ambitionen, mit der Anwesenheitsliste beschäftigt war, prosteten die anderen ein weiteres Mal ihrem Anführer am Kopf der Tafel zu.
„Danke für die freundliche Einladung“, tönte Abel Crawls sonore Stimme durch den Raum. Der frühere Schiffsführer wurde von ihnen respektvoll „der Käpt`n“ genannt.
„Und danke auch für die großzügige Bewirtung“, ergänzte Ernie neben ihm. Der war Abels Adlatus und stammte wie der Käpt´n aus der Hafenstadt Astoria in Oregon, wo er seinerzeit eine Fischimbissbude am Hafen betrieb. Ernie Earl`s Eatery hatte als grellblauer Neonschriftzug auf ihrem Dach geleuchtet, bis sie kurzerhand von Amts wegen geschlossen wurde.
Es war schon eine handverlesene Gesellschaft, die sich zu Dannys abendlicher Diskussionsrunde versammelte, einem philosophisch-anthroposophischen Treffen, wie sie es nannten. Neben Ernie hockte noch Howie auf dem rechten Flügel, ein etwas tumber Tor. Was aber die Aufzucht und Pflege von Cannabis-Pflänzchen anging, hatte er geradezu einen grünen Daumen.
Zur Linken von Jeff, dem Ex-Journalisten, saß Lester Moore als Neuling in der Runde. Der war freiberuflicher Produktmanager, damit zwar kein Arbeitsloser wie die anderen, allerdings mit so wenig Aufträgen, dass er zumindest so etwas wie erwerbslos war.
Hinter ihm, ein wenig abgerückt und emsig mit ihren Stricknadeln klappernd, hockte Lulla Adorna als einzige Frau mit am Tisch. Die junge, blonde Schönheit war Gelegenheitsfriseuse und zurzeit Dannys Lebensgefährtin. Neben dem Stricken und Frisieren sagte man ihr noch Fertigkeiten und Qualitäten auf anderem Gebiet nach, aber nicht in Dannys Gegenwart.
Als früher der Frankokanadier Paul-André Lejeune, genannt Pawnee, die Gruppe angeführt hatte, war Lulla dessen Freundin gewesen. Da durfte sie nicht mit den Männern am Tisch sitzen, sondern musste sich mit ihrem Strickzeug in die Sofaecke verkriechen.
Das wäre ihr eigentlich auch jetzt lieber gewesen, doch Danny stellte gerne seine anti-chauvinistische Gesinnung zur Schau, indem er sie mit in die Runde bat.
Pawnees Platz am Ende der Tafel blieb seit seinem plötzlichen Ableben aus Pietätgründen unbesetzt. Danny warf zuweilen einen melancholischen Blick zum leeren Stuhl seines verstorbenen Vorgängers. Manchmal hätte es dessen souveräner Hilfe bedurft, die Diskussionsabende zu leiten, aber das ging ja nun nicht mehr …
„Unser heutiges Thema heißt ´Instinkte und Gefühle im Schattenreich des Selbst`“, erinnerte Keats seine Mannen. Den ersten Beitrag erwartend schaute er in die Runde.
„Ein Mensch, dessen Instinkte wach sind, ist zumeist auch recht gefühlvoll. Das weiß ich von meinen Erfahrungen auf hoher See“, ergriff der Käpt’n als Erster das Wort und war dann auch nicht gewillt, es so rasch wieder abzugeben.
Weitschweifig berichtete er von zuverlässigen Wetterprognosen seines früheren Maats, der damit den Kahn mehr als einmal vor Unwetter, Unbill und Untergang bewahrt habe.
„Dank seiner wachen Instinkte“, wie der Käpt’n betonte. „Und dieser begnadete Spökenkieker, war auch ein feinfühliger Mensch. Er spielte wunderbar das Schifferklavier – zumeist hörte es sich jedenfalls ganz gut an.“ Crawl holte tief Luft, um es weiter auszuführen.
Jeff, der Protokollführer, merkte auf und stellte eine rasche Zwischenfrage: „Wenn dein Maat sich auf den Tasten seines Akkordeons vergriff, gab es am nächsten Tag den besagten Wetterumschwung, nicht wahr?“
Abel nickte erstaunt, und Jeff fuhr fort: „Somit scheint mir klar, dass ´die wachen Instinkte` deines ´Spökenkiekers` wohl nur auf einer Arthrose in seinen Fingergelenken beruhten, eine ganz simple Wetterfühligkeit.“ Der Käpt`n brach den Bericht beleidigt ab und strich – vorerst - die Segel.
Sein Adlatus Ernie fühlte sich verpflichtet, den nächsten Beitrag zu leisten: „Wenn man einer gebratenen Fischfrikadelle anmerkt, dass sie schon drei Tage alt ist, obwohl sie noch gar nicht übel riecht, so nenne ich eine solche Wahrnehmung einen wachen Instinkt.“
„Du meinst, den hatten die Leute vom Ordnungsamt, die deine Fischbraterei am Hafen dicht machten“, feixte Howie. Ernie blickte betreten drein, und die anderen schauten strafend zum vorlauten Tölpel vom Dienst. Hoffentlich würde das sein einziger Diskussionsbeitrag bleiben.
Lester, der Neue, äußerte sich als Nächster: „Wenn ich als Produktmanager eine Ware bewerbe, muss ich beides bedienen, Instinkt und Gefühl. Zusammengenommen erzeugt es beim Kunden den Impuls, die Ware zu kaufen. Und das ist das Einzige, was zählt – zumindest in meiner Branche.“
„Das ist mir alles zu profan“, schüttelte Jeff den Kopf und seine Missbilligung galt nicht nur dem letzten Beitrag. Er überlegte einen Moment, um dann mit gewohnter Souveränität kurz und prägnant zusammenzufassen: „Gefühle entwickelt man über dem Menschsein, während man Instinkte über dem Menschsein verliert.“
Die anderen nickten zustimmend, und Keats rief erleichtert: „Ja, nimm das zu Protokoll, Jeff!“ Ein wunderbares Wort, ein gutes Ergebnis des heutigen Zusammenseins. Er brauchte dem nichts mehr hinzuzufügen.
Letztendlich fühlte Danny sich so gar nicht als anthroposophisch-philosophische Natur. Sein Vorgänger Pawnee hatte diese Diskussionsabende einst eingeführt, an denen man inzwischen lediglich festhielt, um die Tradition zu wahren.
Einmal mehr erhob Dan Keats feierlich den Pokal, und all seine Noblen taten es ihm gleich. Mit tiefem Zug leerten sie ihre Gläser.
Lulla ließ ihr Strickzeug sinken, erhob sich lasziv und nahm zwei leere Karaffen mit in die Küche. Frisch aufgefüllt mit Wein, einem Roten der billigen Sorte, den Danny heute Morgen beim Discounter besorgt hatte, stellte die junge Frau sie zurück auf den Tisch. Sie selbst begnügte sich wie immer mit einem Aufguss aus frischem Ingwer.
Einige der Freunde steckten sich eine Tüte an. Lulla ebenfalls, denn einem Joint war sie nie abgeneigt. So begann der gemütliche Teil des Abends.
Der Käpt’n, dem Cannabis völlig abhold, doch härteren Drinks sehr zugetan, stellte zwei mitgebrachte Flaschen Jack Daniels auf den Tisch des Hauses.
Danny sorgte rasch für zusätzliche Gläser. Man sprach ein vollmundiges Wohl auf den edlen Spender der Spirituose aus, und alle nahmen einen guten Schluck.
Als Dan sein Glas gerade wieder absetzen wollte, sah er doch tatsächlich, dass ihm jemand, vom anderen Ende der Tafel aus zuprostete. Er traute seinen Augen kaum: Es war Pawnee, ihr verblichener Anführer.
Wie konnte das sein? Entsetzt starrte er den Geist an. Dampfschwaden der Tüten, die sich die Kumpels gedreht hatten und nun genüsslich rauchten, erfüllten den Raum. Eine optische Täuschung, also …
Doch nun fing Pawnee an zu reden. Hoffentlich eine akustische Täuschung!
Verstört sah Danny in die Runde. All seine Gefährten schienen nichts zu merken, schwatzten unbekümmert und prosteten sich zu. Nur er, Danny, er sah und hörte …
„Was war das denn nun, Dan? Leitet man so eine Sitzung? Und wieso soll die jetzt schon zu Ende sein? Das ist hier schließlich eine Diskussion und kein seichtes Plauderstündchen!“
„Wir haben alles ausdiskutiert, Pawnee“, rechtfertigte sich Dan im Stillen, und zum Glück nahmen die anderen diese stumme Zwiesprache nicht wahr. „Wie du weißt, bin ich nicht so der intellektuelle Typ. Und immerhin sind wir ja heute Abend zu einem Resultat gekommen.“
„Ihr habt das Thema längst nicht ausgeschöpft, mein Lieber, Instinkte und Gefühle, okay, aber das ´Schattenreich des Selbst`, wo ist das bitte abgeblieben?“
Danny stierte angestrengt durch die Rauchschwaden, um weiterhin zu Pawnee Blickkontakt zu halten.
„Ich muss mir jetzt unbedingt auch eine Tüte drehen - zur Bewusstseinserweiterung. Sonst bin ich ihm einfach nicht gewachsen“, überlegte er, aber dummerweise konnte Pawnee ja Gedanken lesen: „Du meinst wirklich, das hilft dir weiter, Keats? Eine Bewusstseinserweiterung? Genieße dein Gras, ohne irgendeine Erhellung zu erwarten. Und was das Schattenreich angeht, dort herrsche immer noch ich – ich daselbst. Und bald schon wirst du folgen.“
Er hörte Pawnees höhnisches Gelächter, versuchte, mit seinen Augen den Dunst zu durchdringen, der sich nun wie eine Wolke am anderen Ende der Tafel zusammenballte, genau an der Stelle, woher das Lachen ganz unheimlich nachhallte.
Endlich lichtete sich der Nebel, und er sah wieder klar: Da stand der Stuhl ihm gegenüber, auf den sich nach Pawnees Tod keiner mehr setzen durfte, – und dieser Platz war leer.
2) Razzia
„Danny, du schaust ja ganz verdattert drein. Bekommt dir der Jackie nicht?“ Jeff stupste ihn am Arm. „Nein, wieso? Wäre doch das erste Mal, dass mir ein ordentlicher Schluck Jack Daniels nicht bekommt“, wiegelte der Angesprochene ab und versuchte, sich wieder auf die Ritter seiner Tafelrunde zu konzentrieren, zumindest auf diejenigen aus Fleisch und Blut.
Unheimlich war ihm zumute, doch er musste sich zusammenreißen. So bemerkte er, dass Lester gerade aufstand. „Bin gleich wieder da“, rief der in den Raum und wandte sich zum Sofa, wo eben alle ihre Jacken und Mäntel abgelegt hatten, weil im Flur kein Platz für eine Garderobe war.
Aus dem Gewühl fischte sich Less seinen Ulster, zog ihn schwungvoll über und ging hinaus. „Der feine Herr zieht seinen Mantel an, wenn er pinkeln geht“, lästerte Ernie über den Neuen.
Und so war es auch. Draußen wandte sich Less zum schmalen Pfad, der in den äußersten Winkel des Gartens hinter der Kate führte, und lenkte seine Schritte zu einem Häuschen mit aufgemaltem Herz an der Außentür.
Die anderen pinkelten einfach an den nächsten Baum, wenn sie austraten, doch er hielt da mehr auf sich. Ein solches Verhalten empfand er als schlichtweg ordinär, hing damit wohl noch einem eher bürgerlichen Habitus an.
Nun ja, die Toilette am Ende des Gartens war ein Plumpsklo ohne Wasserspülung, und als er den Verschlag betrat, bereute er bereits, dass er stets so viel auf sich hielt.
Die Reue war allerdings nur von kurzer Dauer. Denn plötzlich hörte er drinnen, wie im vorderen Gartenbereich laut auf die Tür der Kate geklopft wurde, die er soeben verlassen hatte. Er vernahm den energischen Ruf: „Aufmachen, Polizei!“, augenblicklich gefolgt von wütendem Gebell.
„Grundgütiger“, dachte er entsetzt. „Da ist wohl O`Connor mit seiner Hundestaffel aufgetaucht.“ Und wer mochte denn dem Sheriff und seinen wackeren Mannen nebst deren Hunden, erstklassigen German Shepherds, in die Hände beziehungsweise Pfoten fallen, wenn man gerade ein Tütchen geschmaucht hatte?
Schon verließ Lester diskret seinen Verschlag und schlich, ohne auf ein trockenes Zweiglein zu treten, aus der hinteren Gartenpforte heraus. Er strebte eilig durchs Grüne dem nahegelegenen Highway zu, wo sein Wagen am Rande geparkt stand. Da hatte ihn seine verfeinerte Lebensart in der Tat vor einer der gefürchteten Rauschgiftrazzien bewahrt.
Seinen Kumpels in der Kate erging es indes übel. Schon hatte Sheriff Craig O`Connor mitsamt seinen drei Hundeführern und deren deutschen Schäferhunden die Bude gestürmt, und alles drängte sich nun in Dannys Wohnraum, der fürwahr aus allen Nähten zu platzen drohte.
O`Connor schickte in dem Chaos dann auch rasch zwei seiner Leute nebst ihren Kötern wieder hinaus, als Wache vor dem Haus. So behielt er nur Andy mit seinem Rauschgiftsuchhund Fleet bei sich im Inneren der Hütte.
Fleet jaulte auf und bellte im Folgenden unentwegt. Zuviel auf einmal drang ihm in sein feines Näschen. Da waren die Aschenbecher mit den Resten der Tüten auf dem Tisch verteilt. Howie, der Idiot, hatte sein Haschpfeifchen noch im Maul. Der Hund sprang kläffend an ihm hoch. Das arme Tier war wirklich reizüberflutet. Bemüht, ihn zu bändigen, zerrte Andy an der Leine.
Fleet strebte jetzt immerhin der Küche zu, wo er eine blecherne Gebäckdose verbellte. O´Connor öffnete die sperrige Dose, in der er mindestens ein Kilo schönes weißes Heroinpulver vermutete.
Doch darin befanden sich nur Lullas selbstgebackene Cookies. Fachkundig schnüffelte der Sheriff nun selbst. „Haschplätzchen“, knurrte er und konfiszierte das Corpus Delicti, solange sich nichts Besseres fand.
Aus dem Einsatzwagen ließ er Handschellen herbeiholen, die er alsdann den Delinquenten routiniert anlegte. Bei dieser Prozedur wurde außer dem Käpt’n, der nur Whiskey getrunken und kein Hasch geraucht hatte, auch das Mädchen Lulla verschont, die jetzt erschrocken und verschüchtert auf der Sofacouch kauerte. Die hatte zwar ebenfalls einen Joint geraucht, aber auf dem Revier stand für die junge Frau keine Einzelzelle zur Verfügung.
Die anderen wurden abgeführt. „Wir leisten keinerlei Widerstand“, beeilte sich Danny beim Hinausgehen zu versichern, da er sich für seine Gruppe verantwortlich fühlte. „Das möchte ich euch auch nicht raten“, knurrte O´Connor und ließ die Festgenommenen von seinen Hundeführern bereits in einen der beiden Mannschaftswagen verladen.
Draußen hatte das polizeiliche Rollkommando – wie üblich – eine kleine Plantage von Cannabis aufgetan, im benachbarten Gärtchen von Howie. Die Pflanzen wurden allesamt ausgerupft und mitgenommen.
„Das bauen wir auf medizinische Induktion an“, versuchte es Howie, der im Gebrauch von Fremdwörtern nicht sehr firm war. „Und was bitte schön ist eure Indikation? Druckschmerzen an der Leber?“, höhnte der Sheriff.
Die edlen Ritter der Tafelrunde waren Kummer gewohnt und kannten das weitere Procedere: O´Connor nahm sie mit, steckte sie für den Rest der Nacht in eine große Gemeinschaftszelle mit einem singulären Latrinenloch in der Mitte und ließ sie im Laufe des nächsten Vormittags nach umfangreichen Verhören wieder laufen.
Im Eureka Sunset stand dann morgen Abend mal wieder ein Artikel zum energischen Vorgehen des Sheriffs gegen das lokale „Drogenkartell“, derweil die genervte Staatsanwaltschaft die Sache im Nachhinein wegen Geringfügigkeit niederschlug.
Heute wurde allerdings mit besonderer Gründlichkeit vorgegangen. „Ich bleibe noch vor Ort und recherchiere“, bellte Craig seine Leute an. „Ihr wisst, was zu tun ist.“
Die drei Hundeführer Arthur, Ken und Andy wussten es, obwohl sie nicht die hellsten waren. Aber aus der Routine vieler ähnlicher Einsätze wurden sie dieser Herausforderung gerecht.
So blieb O´Connor nun alleine am Tatort zurück, mit den beiden nicht Festgenommenen. Er würde später mit seinem Rover heimfahren.
Noch hatte er zu tun, sah sich prüfend im Raum um und dann mit gestrengem Blick auf die beiden Anwesenden.
Abel, der Käpt’n, hielt es unter den gegebenen Umständen für opportun, den Betrunkenen zu spielen. Mit vornüber hängendem Kopf stellte er sich schlafend. Dann streckte er sich und stand umständlich auf. „Bin ich hier noch vonnöten?“, fragte er und bemühte sich zu lallen.
„Gehen Sie nachhause und schlafen Sie Ihren Rausch aus. Ich werde Sie morgen gegebenenfalls in der Präfektur verhören“, bestimmte Craig O`Connor souverän. Den Käpt’n wollte er zunächst einmal aus den Füßen haben.
Nun, wo es hier in der Kate etwas übersichtlicher geworden war, knöpfte er sich die alleingebliebene junge Frau vor. „Es stehen sechs Whiskeygläser auf dem Tisch. Sie haben aber angeblich nur Ingwertee verkonsumiert. Da wir nur vier Leute festnahmen und der fünfte gerade wegging, stellt sich die Frage, wo der sechste abgeblieben ist?“
Lulla fand es zwecklos, ihm vorzutäuschen, es sei ihr eigenes Whiskeyglas gewesen: Der ließ sie sonst noch pusten und stellte 0,0 Promille im Atemtest fest. „Ja, die Männer waren zu sechst“, gab sie zu. „Aber den sechsten kannte ich nicht, weiß nicht einmal seinen Namen“, log sie tapfer. „Der war neu in der Gruppe.“
„Aha, der Salamander-Chor rekrutiert also neue Mitglieder“, schnaubte der Sheriff. „Salamander-Chor“, so nannte er stets den philosophisch-anthroposophischen Freundeskreis. Warum, das wusste keiner so genau, Lulla natürlich auch nicht.
„Wieso sprechen Sie von meinen Bekannten eigentlich immer als ´den Salamandern`?“, fragte sie in einem vagen Ablenkungsmanöver, aber dem Sheriff war es zurzeit nicht danach, Erklärungen abzugeben.
Das junge Ding blieb ungeschoren, weil er zurzeit keine Einzelzelle zur Verfügung hatte, und dafür sollte sie, verdammt noch mal, dankbar sein und keine kesse Lippe riskieren. Er sagte es ihr, und sie wurde kleinlauter.
„Ich muss jetzt das Haus durchsuchen“, blaffte er. Sie war zu eingeschüchtert, um sich einen Durchsuchungsbefehl zeigen zu lassen. Sie zuckte nur die Achseln und sagte: „Dann tun Sie eben Ihre Pflicht.“ Küche und Wohnraum waren von Schäferhund Fleet schon hinreichend beschnüffelt und verbellt worden. Dort hatte man eben auch alle verfügbaren Schubladen aufgerissen und durchsucht.
Der Sheriff beabsichtigte, sich jetzt die Schlafkammer anzusehen. Denn wo sonst versteckte man Dinge, die andere nicht finden sollten?
Lulla stieß eine Tür auf und wies ihm seufzend die Lokalität, ein beengter Raum, in dem ein Kingsize-Bett fast die gesamte Fläche einnahm. Lulla und Danny lagen gerne bequem.
O´Connor stemmte die Matratze hoch, und zwängte sich, als er nichts fand, noch mühsam mit Kopf und Schulter unter das Bett, wo er mit einer Taschenlampe herumleuchtete, ohne etwas zu entdecken außer Staub und Flusen.
Für einen Kleiderschrank befand sich kein Platz mehr im Schlafgemach. Es gab nur ein längliches Ständergestell mit auf Bügeln hängenden Klamotten. Dieses Konstrukt riss der Sheriff nun mit Schwung herab und durchsuchte den auf dem Boden liegenden Textilhaufen – ergebnislos.
Dann blieb sein Blick an einer hohen und solide aussehenden Eichenkommode in der Ecke hängen. „Unsere Wäschekommode“, sagte Lulla fast flehentlich. Würde er tatsächlich auch noch ihre Dessous durchwühlen? Aber gewiss doch!
„Warum haben Sie das eben nicht von dem Hund erledigen lassen?“, fragte sie, als er die Schubladen auf ihrem Bett auskippte und dann in der Wäsche herumwühlte. „Der hätte doch schon gerochen, wenn dort Gras versteckt gewesen wäre.“
„Aus lauter Rücksichtnahme habe ich den Hund nicht in Ihr Schlafzimmer geschickt“, heuchelte O`Connor. „Es gibt schließlich Leute, die sind Allergiker und können Hundehaare in ihrem Schlafzimmer nicht abhaben. Die kriegen dann Asthmaanfälle und jagen uns nach so einer Durchsuchung ihre Anwälte auf den Hals.“
„Danny und ich sind keine Allergiker, und Anwälte können wir uns sowieso nicht leisten“, meinte Lulla resigniert.
„Die obere Schublade klemmt“, stellte der Sheriff fest, nachdem er bereits heftig daran gerüttelt hatte. „Sie klemmt nicht, sie ist abgeschlossen“, erklärte Lulla wahrheitsgemäß.
„Dann breche ich sie jetzt auf.“
„Nein, warten Sie. Ich gebe Ihnen den Schlüssel.“ Der war mit einem Klebestreifen auf den unteren Bodenrand der Lade geklebt und von der Schublade darunter zu erreichen. „Ein tolles Versteck“, kommentierte der Sheriff, aber das war sicher nur zynisch gemeint. Mit einem Seufzen schloss Lulla die Lade auf.
Schriftsachen lagen darin, die seine besondere Aufmerksamkeit zu erwecken schienen. Sein Interesse daran war groß, deutlich größer als an Lullas Wäsche. Er kippte die Lade immerhin nicht aus, sondern nahm sich die Papiere stapelweise vor und legte sie nach Durchsicht oben auf die Kommode.
Er ärgerte sich, weil der größte Teil, der da zum Vorschein kam, aus Blanko-Briefpapier bestand. „Schreibt Ihr Freund tatsächlich so viel“, fragte er hämisch.
„Offenbar nicht, sonst läge das Papier nicht unbenutzt da“, wurde das Mädchen renitent. Er hatte eine Identity Card Dannys entdeckt, sowie dessen Stammbuch und ein paar Familienfotos.
Von Lulla gab es in der Dokumentenlade nichts Persönliches. Die bewahrte ihre Habseligkeiten in ihrem eigenen Haus in Mendocino auf. Das wusste O´Connor. Er kannte alle seine schwarzen Schäfchen, sogar diejenigen mit Hauptwohnsitz im Nachbardistrikt.
Dann endlich ein Triumph: „Was haben wir denn hier?“ In einem der Briefumschläge hatte er tatsächlich Dollarnoten in 50er Scheinen hervorgezogen, zehn an der Zahl, wie er beim raschen Durchblättern feststellte.
Lulla hatte das Geld noch nie gesehen, ließ sich ihr Erstaunen aber nicht anmerken. „Das ist mein Haushaltsgeld, und es muss noch für den ganzen Monat reichen“, antwortete sie rasch und bestimmt.
O´Connor wusste, dass er hier nicht einfach Geld konfiszieren konnte. Er hatte nicht einmal eine Befugnis, das Haus zu durchsuchen. Die Rauschgifthunde hätten hier schnüffeln dürfen, er selbst nicht.
„Wieso bewahren Sie Ihr Geld in einer Kommode auf? Haben Sie kein Bankkonto?“, fiel ihm noch dazu ein.
„Das schon, da ich aber im Moment keinen Job als Friseuse habe, wird dort nichts mehr eingezahlt“, meinte sie in patzigem Ton. „Suchen Sie nicht eigentlich nach Rauschgift?“
Dieses Geplänkel machte ihn wütend. Weiterführend war es auch nicht. Also verabschiedete er sich mürrisch und ließ das junge Ding allein zurück.
„War der heute verbissen“, dachte sie. „Irgendwie schien mehr dahinterzustecken als eine seiner üblichen Razzien.“ Doch mochte sie nicht länger darüber nachdenken. Man musste schließlich mit dem Aufräumen beginnen. Lulla war kein grüblerischer Mensch.
3) Dan und die Jungs
Dannys Leute wurden häufig Nichtsnutze oder Hühnerdiebe gescholten, von den Bürgern Eurekas und so auch vom Sheriff. Der hatte sich darüber hinaus noch einen besonderen Ehrennamen für sie ausgedacht und bezeichnete die Gemeinschaft als „Salamander-Chor“.
„Weil sie einem immer zwischen den Fingern durchflutschen, wenn man sie zu fassen kriegen will“, erklärte er die Namensgebung. „Schlüpfrige Reptilien sind das, ekelhafte Molche“, redete er sich gerne in Rage. So genau vermochte O`Connor die Spezies „Salamander“ wohl selbst nicht einzuordnen.
Dass man sie nach jeder Festnahme zügig wieder freiließ, lag allerdings an der Staatsanwaltschaft, die eine Anklageerhebung als für zu nichtig erachtete.
Seit in Kalifornien im Jahre 1996 Cannabis weitgehend legalisiert und sogar Eigenanbau „bei nachgewiesenem medizinischem Bedarf“ erlaubt war, sah man vielerorts kaum noch eine rechtliche Handhabung, gegen die Kiffer vorzugehen.
Während der letzten Dekade setzte O´Connor nun alles daran, dass diese bundesstaatliche Liberalisierungswelle ja nicht auf sein Zuständigkeitsgebiet, die beiden Countys Humboldt und Del Norte im hohen kalifornischen Norden, überschwappte.
Als gewählter Sheriff fühlte er sich seiner erzkonservativen Wählerschaft verpflichtet. Doch ausgerechnet „sein“ Distrikt bot einen besonders guten Nährboden für dieses Pack.
Unweit der Stadt Eureka befand sich über den Klippen eine verlassene ehemalige Holzarbeitersiedlung. Die alten Häuschen wurden von niemandem mehr beansprucht, und so hatten einige aus Mendocino verdrängte Alt-Hippies die leerstehenden Bauten mitsamt ihren kleinen Gärten okkupiert und sich dort eingenistet.
Den ehrbaren Steuerzahlern des Küstenstädtchens waren diese - in den frühen 80igern - Zugezogenen von jeher ein Dorn im Auge. Solange ein klares Cannabis-Verbot bestanden hatte, konnten die jeweiligen Ordnungshüter sie drangsalieren, was tatsächlich etliche von ihnen wieder vertrieben hatte. Damit waren die meisten bereits in andere Regionen abgehauen, in Gegenden, in denen sie sich liberalere Verhältnisse und weniger Restriktionen erhofften.
Die wenigen, die in der Klippensiedlung am Stadtrand verharrten, stellten ein paar Typen dar, die so gar nicht wussten, wo sie anderswo unterkommen sollten, praktisch eine negative Selektion. Und mit ihnen musste sich heutzutage O`Connor herumschlagen und glaubte, es damit schwerer zu haben als sämtliche seiner Amtsvorgänger.
Wegen Hausbesetzung konnte man sie inzwischen nicht mehr drankriegen. Bei manchen von ihnen handelte es sich inzwischen sogar um „Besitzständler“, wie zum Beispiel Danny, dessen Großmutter ihm das kleine Steinhaus auf der Klippe ganz legal und ordnungsgemäß vererbt hatte.
Andere profitierten vom Gewohnheitsrecht. Schließlich kam kein Mensch mehr vorbei, der Rechte an der zweifelhaften Immobilie anmeldete. Und wo kein Kläger, da kein Richter.
Also verblieben die „Renitenten“ weiterhin in ihren Katen und bauten in den kleinen Gärten mehr oder weniger diskret Hanf an. Da wurde regelmäßig gehascht, bisweilen gekokst und stets übermäßig Alkohol getrunken.
„Das reinste Sündenbabel“, gifteten die Bürger von Eureka über diesen Lebensstil. Man grenzte die „Tagediebe“ aus, wo es nur ging, und die suchten ihrerseits auch gar keinen Anschluss an die Spießer.
Gemeinhin nannte man sie Verlierer, Trinker, Lumpenpack. Ein John Steinbeck hätte sie allerdings als Lebenskünstler, Philosophen oder gar als Heilige bezeichnet. Alles eine Frage des Blickwinkels, und O´Connor neigte natürlich zu ersterer Ansicht. Einen John Steinbeck kannte der überhaupt nicht.
„Was würde mein Boss nur ohne die Salamander machen?“, fragte sich der Deputy und Undersheriff Stanislaw Wrozeck des Öfteren. Er selbst teilte die nonchalante Sicht von John Steinbeck auf trinkfreudige und weinselige Außenseiter der Gesellschaft. Der hatte solchen Leuten in seinem Roman Die Straße der Ölsardinen ein Denkmal gesetzt: fröhliche Bacchanten mit sympathischer Lebensphilosophie.
Der liberal gesonnene Wrozeck betitelte sie als „das verbliebene Fähnlein der sechs Aufrechten“ und machte sich darüber lustig, wenn O´Connor mal wieder zu einem Jagdzug auf die eingeschworene Trinkbruderschaft ins Horn blies.
Dem Deputy verdarb es allerdings die Laune, wenn sein Vorgesetzter verlangte, dass er die drei Deppen der Hundestaffel in ihrem wenig prospektiven Vorgehen gegen die Kleinkriminellen unterstützten sollte.
„Was macht das für einen Sinn, gegen ein Häufchen harmloser Spinner vorzugehen?“, hielt er seinem Chef entgegen – und stieß auf taube Ohren.
Dabei handelte es sich zumeist noch um Leute, die einstmals einem guten Beruf nachgegangen waren, wie Jeff, der frühere Journalist, oder Abel, der Ex-Schifffahrtskapitän.
„Deren Wege haben sich hier auf ihrem sozialen Abstieg gekreuzt, und sie halten sich nun aneinander fest“, überlegte sich der Deputy. Da veranstalteten sie eben Rauch- und Trinkgelage und bezeichneten sie als anthroposophische Sitzungen – wenn es denn dem Erhalt ihrer Selbstwürde diente.
Unzweifelhaft wurden da Themen intellektuell hintergründiger diskutiert, als es O`Connor an seinem Mittwochsstammtisch mit den drei Führern der Hundestaffel tat. Zu diesem Treff in der Kneipe Red Rooster war auch Stan von seinem Chef herzlich eingeladen. Allerdings hatte er sich noch nie beim dortigen Feierabendbier blicken lassen. „Ich habe eine Hundehaarallergie“, log er den Sheriff an.
„Wegen deiner Unpässlichkeit kann ich die Jungs aber nicht zwingen, ihre Schäferhunde zuhause zu lassen“, meinte O´Connor dann und lachte schallend, wenn er hinzufügte: „Die finden nämlich ohne ihre German Shepherds nachts nicht mehr den Heimweg.“
Ein Grund mehr für Stan, sich diesen Besäufnissen fernzuhalten, während er im Inneren nicht abgeneigt gewesen wäre, mal bei einem Haschpfeifchen und einer Flasche Rotwein der Gegenseite einen Besuch abzustatten. Aber von denen lud ihn natürlich keiner ein.
4) Ein Verlierer packt aus
Im Wohnraum schrillte das Telefon. Stan Wrozeck erschrak so sehr, dass er fast sein Abendessen fallen ließ. Er hatte sich gerade eine Fertigpizza in der Micro Wave erhitzt, sie auf einen großen Teller geschoben und wollte diesen zum Esstisch hinübertragen.
„Warum bin ich denn so schreckhaft?“, schoss es ihm durch den Kopf, und im selben Augenblick freute er sich und nahm rasch den Hörer ab. Das war bestimmt Martha, seine Verlobte aus dem fernen Florida. Die rief ihn des Öfteren samstagabends auf Festnetz an. Sie hatten bereits seit Tagen nicht miteinander gesprochen, und also gab es viel zu erzählen. Es machte ihm gar nichts, wenn seine Pizza darüber kalt wurde.
Aber da meldete sich gar nicht Martha am Apparat. Aus dem Hörer drang eine andere Stimme, ihm wohl bekannt, aber zurzeit nicht sehr erwünscht. Es war Lester Moore, der Typ aus der Etage unter ihm. „Was gibt es, Less?“, fragte Stan ein wenig kurz angebunden, da enttäuscht. „Ich hoffe, ich störe dich nicht“, begann der vorsichtig.
Er war der klassische Verlierertyp und trug auch die Attitüde eines Losers ständig zur Schau. Schließlich nannte er sich selbstironisch stets „Less More“, also „wenig mehr“. „Was meint er damit?“, fragte sich Stan. „Etwas mehr als eine Null?“
Und schon tat ihm der andere wieder leid. Also zwang er sich zur Höflichkeit. „Nein, du störst mich nicht“, beschwichtigte er, und Less bat: „Ich wollte dich nur fragen, ob du mal kurz auf ein Bier zu mir runterkommen kannst. Ich muss dir was erzählen.“
Der Typ wohnte ein Stockwerk unter ihm, genau das gleiche triste Appartement wie sein eigenes, aber weniger gut aufgeräumt. Stans Blick auf sein vor sich hin kühlendes Abendessen wurde noch eine Nuance trauriger. „Okay, in 20 Minuten“, hörte er sich antworten. In der Zeit hätte er die lauwarme Pizza verschlungen und ein Glas Chianti dazu hinuntergekippt.
„Ich schieb uns dann noch zwei Fertigpizzas in die Röhre, wenn du auch noch nichts gegessen hast“, klang es aus dem Hörer zurück. „Ach, dann komm ich sofort“, meinte Stan, dessen Laune sich etwas hob. Er lachte sogar in sich hinein, als er auflegte.
Lester war schon ein besonderer Fall, eigentlich ein intelligenter Mensch mit Ideen, recht eloquent und immerhin als freiberuflicher Produktmanager tätig. Eine Weile ging es ihm ganz gut, auch wirtschaftlich. Aber inzwischen befand er sich auf dem sozialen Abstieg. Seit er sein Alkoholproblem nicht mehr in den Griff bekam, konnte er sich kaum noch Aufträge an Land ziehen.
„Andere Leute mit seiner Veranlagung trinken ebenfalls, aber die vertuschen es geschickter. Da geht es über Jahre und Jahrzehnte hinweg gut“, dachte Stan im Stillen. „Bei Less merkt es allerdings ein jeder. Der ist nicht verschlagen genug, um sich zu verstellen.“
Ein paar Male hatte der Stan bereits angepumpt, um am Ersten des Monats die Miete überweisen zu können. Wrozeck hatte ihm ausgeholfen und sein Geld auch jeweils zurückgekriegt – mit etwas Verspätung.
„Ich hoffe, er will sich nicht wieder was leihen“, dachte er jetzt, als er im Treppenhaus zu Lesters Appartement hinunterstieg. Sein Gehalt als Police Officer und Undersheriff der Countys Humboldt und Del Norte konnte man nicht als üppig bezeichnen. Momentan war er selbst klamm.
„Komm nur rein“, rief Less von innen, sobald er Schritte draußen im Gang hörte. Er hatte die Tür für seinen Gast angelehnt und hantierte weiter hinten in der Kitchenette.
„Willst du eine Pizza mit Thunfisch oder mit Salami?“, tönte es von dort. „Mit Salami ist schon recht“, antwortete Stan vom Wohnungsflur aus, und Less rief zurück: „Setz dich schon mal ins Wohnzimmer. Ich komme auch sofort.“
Er bewohnte exakt das gleiche Appartement wie Stan selbst. Die Einheiten von 48 Quadratmetern waren in diesem Block alle gleich geschnitten: Wohnraum mit abgetrennter Kitchenette, Schlafzimmer und ein Bad, alles ziemlich einfach.
Stans einziger Luxus stellte die teure Musikanlage dar, die er sein Eigen nannte, sowie seine umfangreiche CD-Sammlung von Mahler, Brahms, Rachmaninow, Tschaikowsky & Co.
„Bei Less befindet sich überhaupt kein Luxus mehr“, überlegte er, als er in dessen Wohnzimmer den Blick ein wenig schweifen ließ. Es war mal wieder ziemlich unaufgeräumt. Alte, zerblätterte Journale flogen auf dem Couchtisch und dem Sofa herum. Auf besagtem Tisch standen auch mehrere Flaschen mit geistigen Getränken: Wodka, Whiskey und Gin der billigeren Marken und jeweils angebrochen.
Less kam herein und räumte die Flaschen genant zur Seite. Auch die Journale häufte er zu einem Stapel. „Willst du vielleicht noch einen Whiskey oder Wodka vor dem Essen?“
Stan lehnte dankend ab. „Dann lass uns am Esstisch Platz nehmen“, meinte der Gastgeber, woraufhin Stan sich aus dem Cocktailsessel schälte und mit in den Nebenraum ging. Hier war der Tisch immerhin ordentlich eingedeckt, und sie ließen sich die Pizzas bei einem kühlen Bier schmecken.
„Wo drückt denn nun der Schuh“, ermunterte Stan sein Gegenüber und zerknüllte die Papierserviette. Jetzt, wo er ordentlich gegessen hatte, fühlte er sich gewappnet, sogar für eine Bitte um Geld. Aber weit gefehlt. Es ging um etwas ganz anderes.
„Ich verrate nicht gerne Kumpels“, fing Less zögerlich an. „Aber da gibt es was, das scheint mir, eine Sache für die Polizei zu sein.“
Stan beobachtete ihn. Lester machte sich gerne schon mal wichtig, einfach um seinen steten Verliererstatus hie und da zu kompensieren, aber momentan wirkte er eher bedrückt.
Gerade nahm er noch einen großen Zug aus seiner Budweiser-Flasche, bevor er anfing zu reden: „Du weißt doch von den Leuten meiner Clique, mit denen ich seit einiger Zeit öfters chille“, sah er seinen Gast fragend an.
Stan nickte. Klar kannte er die und zwar in erster Linie aus den ständigen Klagen seines Vorgesetzten O´Connor. „Hier geht es um die Drogenkriminalität im nordkalifornischen Humboldt Distrikt“, vernahm er den Sheriff, der jetzt vor seinem inneren Ohr tönte und vor seinem inneren Auge vor Wut und Ärger auf die verdammten Salamander mal wieder purpurrot anlief.
„Mein Chef nennt diese Typen, die mit dir abhängen, die Salamander-Bande, aber frag mich bitte nicht warum. Wenn ich ihm dann entgegne, dass seien lediglich ein paar harmlose Kiffer, rastet er ganz aus.“
„Ich habe gar nicht viel mit denen zu schaffen. Für mich ist das nur ein wenig Ausspannen: After-Work eben“, meinte Less, sich rechtfertigen zu müssen.
„Soviel ich weiß, sind die alle ohne Job – außer dir“, merkte Stan an und dachte im Stillen, dass es bei Less momentan ebenfalls etwas mau aussah, was dessen Arbeit anging.
„Manche arbeitslos, andere tot“, murmelte der nun vor sich hin. Das ließ den Deputy in der Tat aufhorchen. „Schieß mal endlich los“, drängte er.
„Nun, es ist da etwas vorgefallen“, begann sein Nachbar mit der eigentlichen Beichte. „Wir haben vorgestern Danny tot am Strand gefunden, und die Jungs haben beschlossen, ihn dort auch zu begraben.“
Stan glaubte, seinen Ohren nicht zu trauen. „Was habt ihr gemacht?“, raunzte er Moore so heftig an, dass der erschrocken zurückwich.
„Ich sollte ihn jetzt wirklich nicht einschüchtern“, rief er sich im Stillen sofort selbst zur Räson. Immerhin fiel dem sein Bericht ja alles andere als leicht.
„Zuerst habe ich da mitgemacht, aber je mehr ich drüber nachdachte, kam es mir so gar nicht mehr als eine gute Idee vor“, hob Lester recht kläglich wieder an. Wrozeck hatte sich inzwischen im Griff und ließ seinem Gegenüber Zeit.
Und das war schon ganz unerhört, was er hier nach einer Pizza und einer Flasche Bud zu hören bekam:
Danny, der Anführer der Gruppe, wurde vorgestern tot auf dem Strand an der Humboldt Bay aufgefunden, gleich unterhalb der Klippe, wo die Häuschen der bizarren Genossenschaft standen.
Es handelte sich dabei um einen sehr abgelegenen Strandabschnitt, zu dem man gelangte, wenn man an den Hütten der Jungs vorbeiging, und da ging eben keiner aus Eureka gerne vorbei.
Erschwerend kam hinzu, dass man die eigentliche Strandbucht nur von der Klippe aus auf einem steil abwärts führenden Ziegenpfad erreichte, der von Poisonous Ivy, also Giftefeu, flankiert war.
Große Schilder hielten Touristen davon ab, diesen Weg einzuschlagen. Die standen gleich am Highway-Rand und noch vor den Katen der „Asozialen“, diese Warntafeln.
„Wäre ja auch hochpeinlich für unsere Gemeinde, wenn Auswärtige dort herumscharwenzeln, vielleicht noch Familien mit Kindern, die zum Strand wollen“, hatte es im Gemeinderat geheißen, und dann waren die Schilder aufgestellt worden, weniger wegen des Giftefeus, der der Maßnahme eher als Vorwand diente, als vielmehr wegen der „asozialen Elemente“.
Und Letzteren bescherte die Aktion dann sogar eine Art von Privatstrand, weil sich nun gar niemand mehr dahin traute.
„Jetzt ist er genauso gestorben wie sein Vorgänger Pawnee“, riss Lesters Stimme Stan aus seinen Gedanken hoch. Der blickte erstaunt auf, und der andere versuchte zu beschwichtigen.
„So sagten es jedenfalls die Jungs. Ich selbst bin ja noch nicht so lange dabei.“ Nur dass Danny schließlich dessen Nachfolge angetreten hatte, das wusste Lester immerhin genau. Stan war verwirrt, wollte sich aber zunächst auf den akuten Fall konzentrieren: „Warst du vorgestern denn dabei, als die Leiche gefunden wurde?“
Less gestikulierte aufgeregt und redete plötzlich ohne Punkt und Komma: „Nein, das war Abraham, der ihn dort liegen sah, ihm den Puls fühlte und somit seinen Tod feststellte. Er ist dann sofort gelaufen gekommen, rief schon, als er auf die Hütten zu rannte: ´Kommt ganz schnell mit! Dan liegt tot am Strand`. Der hat sich nicht lange da unten bei dem Toten aufgehalten, hat ja noch nicht einmal die Klapperschlange gesehen.“
„Die – was?“, rief Stan aus.
„Nun, neben Dannys Leiche lag noch ein toter Rattler“, bemerkte Less jetzt, als sei es für ihn das Normalste von der Welt. „Wir haben doch gleich gemutmaßt, dass er an einem Schlangenbiss gestorben ist. Es war immerhin eine Western Diamond Back. Mit denen ist nicht zu spaßen.“
Das wusste Wrozeck selbst. Er war schließlich ein ausgewiesener Reptilienexperte. Schlangen in der Natur zu beobachten war sein großes Hobby und seine liebste Freizeitbeschäftigung.
„Klar kann der Biss einer Western Diamond Back tödlich sein, aber eigentlich nur bei kleineren Kindern oder bei alten und gebrechlichen Menschen. Ein gesunder Mensch verkraftet das Gift“, wandte er ein.
„Ich weiß nicht, wie gesund Danny war. Der hatte es, glaube ich, mit der Leber, sah manchmal richtig gelb aus im Gesicht.“
Das wunderte den Deputy nicht sehr. Die ganze Gruppe befand sich schließlich in irgendwelchen Stadien oder Vorstadien der Zirrhose. Wenn Dan sich tatsächlich bereits sporadisch unter akuter Hepatitis gelb färbte, hatte er sogar schon das Spätstadium erreicht. Die Nieren wollen dann häufig auch nicht mehr so recht, und da schien es durchaus schlüssig, dass man Toxine nicht gut abbaut, wenn die Ausscheidungsorgane gestört sind, überlegte er sich.
„Und bei der Schlangenart wart ihr euch sicher? Die ist doch hier nur äußerst selten – wenn überhaupt - anzutreffen.“
„Na klar, wir haben sie von Hand zu Hand gereicht. Dass es ein verdammter Rattler war, sahen wir an der Rassel. Es handelte sich um ein ausgewachsenes Tier, das schon acht Häutungen hinter sich hatte.“ Das Alter einer Klapperschlange konnte jeder Laie bestimmen, weil durch jede Häutung ein Hornhautring mehr am Schwanzende übrigblieb.
„Die Western Diamond Back gibt es nur im Süden und Südwesten der Vereinigten Staaten, allenfalls noch in Zentralkalifornien. Wie sah sie genau aus?“, hakte Stan nach.
„Beige-weiß mit dunkelbraunen Zickzacklinien auf dem Rücken“, kam die Antwort, wie aus der Pistole geschossen. „Unser Kumpel Jeff erkannte sogleich, um welche Sorte es sich handelte. Der hat schon mal eine Reportage über Klapperschlangen geschrieben, wie er sagte.“
Jeff Steinberg, ein Ex-Journalist, der ebenfalls irgendwann einmal bei den Jungs landete, war Stan bekannt. Der brüstete sich gerne seiner Namensähnlichkeit mit John Steinbeck, hatte aber sonst nicht viel mit dem großen amerikanischen Schriftsteller gemein, außer dass John Steinbeck sich auch bisweilen als Journalist versucht hatte, bevor er zum großen Durchbruch gelangte.
Ein großer Durchbruch war Jeff eher nicht zuzutrauen, eventuell aber seine Expertise, was die Schlange betraf. Die Beschreibung passte jedenfalls.
Less fuhr fort: „Das Vieh wird Danny gebissen haben, und der hat es wahrscheinlich noch totschlagen können, hätte den Kadaver wohl mitgenommen, um sich in der Ambulanz ein Gegengift geben zu lassen. Aber das hat er ja leider nicht mehr geschafft.“
Auch das schien eine klare Sache zu sein. Jeder, der von einer Schlange gebissen wurde, war in den USA angehalten, das Tier, wenn irgend möglich, mit zur Notfallambulanz zu bringen, und dafür eignete es sich eigentlich eher im toten als im lebenden Zustand, ein Fakt, den Stan als Schlangenliebhaber persönlich sehr bedauerte.
„Das leuchtet mir ein. Was habt ihr mit dem Rattler gemacht?“, wollte er nun von Lester wissen.
„Abel hat den vor Wut weit in die See geschleudert. Das Biest war ja zu nichts mehr nutze, wo Danny schon tot war, und begraben mochten wir es nun wirklich nicht mit ihm zusammen. Das wäre ihm sicher nicht recht gewesen.“
Stan rollte die Augen. „Wie seid ihr nur auf die hirnrissige Idee gekommen, die Leiche im Sand einzubuddeln, statt seinen Tod ordnungsgemäß den Behörden zu melden?“
„Genau weiß ich das selbst nicht. Mit den Behörden haben die es allgemein nicht so, die Jungs, und sie erklärten, dass das sein letzter Wille gewesen sei, am Strand beerdigt zu werden.“
„Er hatte also ein Testament hinterlassen?“
„Das nicht, aber er hatte doch schließlich Pawnees Erbe angetreten.“
Stans Gesichtsausdruck stellte nun wirklich ein reines Fragezeichen dar, und Lester bemühte sich zu erklären: „Pawnee war der frühere Kopf unserer Gruppe, das heißt, ich bin noch nicht lange genug dabei, um ihn gekannt zu haben. Ich weiß nur, dass er eigentlich Paul-André hieß, Kanadier war und aus Quebec stammte - sehr frankophil.“
„Das soll da drüben vorkommen.“
„Der hatte einen Lieblingssänger, einen französischen Chansonnier, und der sang ein Lied über einen Geist am Strand, ein Phantom.“
Stan konnte sich noch immer keinen Reim darauf machen. Er kannte nur das „Phantom der Oper“, und die Story spielte nicht am Strand, sondern in der Pariser Kanalisation, wenn er sich recht erinnerte.
„Wie auch immer. Morgen früh führst du mich hin zu diesem Grab am Strand, und vorher sprichst du zu keiner Menschenseele mehr davon.“ Less gab sein Einverständnis, ziemlich betreten, aber auch eine Spur erleichtert, dass Stan sich vorerst alleine der Sache annahm. Sie verabschiedeten sich voneinander.
5) Angenagt
Zurück in seinem Appartement schaute sich Stan ein paar CDs mit französischen Chansons an, die zu seiner umfangreichen Musiksammlung gehörten: Brel, Bécaud, Aznavour, Piaf, Ferré, die üblichen Verdächtigen. Er mochte sie alle ganz gerne hören, schon wegen der Sprache, die er einst erlernt hatte und auch heute noch fließend beherrschte.
Zunächst wurde er nicht fündig, doch wozu gab es das Internet. Er googelte dann „Begräbnis am Strand, französisches Chanson“ und hatte Erfolg.
Ein Titel von George Brassens tauchte da auf: eine Bitte, am Strand von Sète beerdigt zu werden. Und als er nun wusste, wonach zu suchen war, fand er den Song sogar auf einer alten Vinylplatte seiner Sammlung. Als er sie auflegte, erinnerte er sich wieder, wie gerne er die Musik von Georges Brassens in seiner Studentenzeit in Warschau gehört hatte, und auch dessen Texte waren nicht so ohne:
„Geradewegs am Meeressaum
nicht fern von kühler Welle,
grabt mir – es fehlt ja kaum an Raum,
genau an dieser Stelle,
eine feine, kleine Nische.
Nah meinen Freunden den Delfinen,
die ich noch kenn` aus Kinderzeit,
endlich zurückgekehrt zu ihnen,
ruh ich am Strand
in feinem Sand, voll Würde und Erhabenheit
- ein Totenbett in Sommerfrische.“*
Über dem Text musste er in sich hineinlächeln, und bei der Gitarrenmusik fiel ihm seine damalige Studentenbude wieder ein, das reinste Matratzenlager mit einer Konsole in der Ecke, auf der ein Plattenspieler stand, und seiner Gitarre, die griffbereit an der Wand hing.
Er nahm den Telefonhörer ab und versuchte, Martha im fernen Naples zu erreichen. Sie meldete sich nicht. Wahrscheinlich musizierte sie heute Abend wieder im Konzert und war noch nicht zuhause. Schade, sie hätte ihm sagen können, ob er den Song damals selbst auf der Gitarre gespielt hatte – in ihrer gemeinsamen Warschau-Zeit.
* Französischer Originaltext :
« Juste au bord de la mer / À deux pas des flots bleus, / Creusez, si c`est possible, / Un petit trou moelleux, /
Une bonne petite niche. / Auprès de mes amis /
D`enfance, les dauphins, / Le long de cette grève /
Où le sable est si fin, / Sur la plage de la Corniche. » Supplique pour être enterré à la plage de Sète, George Brassens
Erst am nächsten Morgen klang fröhlich Marthas Lachen durch den Hörer und versüßte ihm das Aufstehen. Es war ein Sonntagmorgen, und da gab es noch diese Verabredung für ihn: mit Lester zum Leichenausbuddeln.