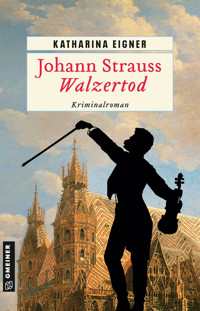Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Arzthelferin Rosmarie Dorn
- Sprache: Deutsch
Nachhaltigkeit am Laufsteg? Die Modeschule Hallein zeigt, wie’s geht. Auch Rosmaries Tochter Susi präsentiert ihren Dirndl-Entwurf. Aber von der Modeschau im Salzburger Freilichtmuseum bleibt vorerst nur eine Leiche. Susi hat ihrer Konkurrentin kurz zuvor noch den Tod gewünscht - und somit ein Problem. Das wertvolle „Ur-Dirndl“, ein Sensationsfund aus dem 17. Jahrhundert, ist ebenfalls verschwunden, die Polizei auf Susis Fersen. Arzthelferin Rosmarie Dorn ermittelt. In ihrem neuen Fall dreht sich alles um das Herzstück der österreichischen Tracht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Katharina Eigner
Salzburger Dirndlstich
Kriminalroman
Zum Buch
Alles Dirndl! »Dirndl goes Nachhaltigkeit«: DAS Ereignis der Modeschule Hallein. Bei einer Modeschau im Salzburger Freilichtmuseum soll das schönste nachhaltige Dirndl gekürt werden. Aber erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Noch bevor Rosmaries Tochter Susi über den Laufsteg stöckeln kann, stiehlt ihre schärfste Konkurrentin allen die Show: Ella Krumbichler bricht zusammen und stirbt wenig später. Als hätte sich Susis Wunsch erfüllt: »Kannst du nicht einfach tot umfallen?« Hat Rosmaries Tochter tatsächlich mit dem Mord zu tun? Und wer hat das »Ur-Dirndl«, ein archäologischer Sensationsfund aus dem 17. Jahrhundert, aus dem Freilichtmuseum gestohlen? Schneller als gedacht ist die Grödiger Arzthelferin Rosmarie Dorn mittendrin in ihrem neuen Fall. Außerdem kreuzen viel zu viele Männer ihren Weg, und Rosmaries Ehe steht auf der Kippe. Dass Susi plötzlich untertaucht, macht die Sache nicht besser.
Katharina Eigner, Jahrgang 1979, ist in Salzburg aufgewachsen und flirtete an der Uni Wien zwei Semester lang mit Publizistik und Kunstgeschichte, bevor sie nach Salzburg zurückkehrte. Dort absolvierte sie eine kaufmännische Ausbildung. In einem der letzten lederverarbeitenden Betriebe Österreichs entwarf und fertigte sie Trachtentaschen. Neben ihrer Arbeit schreibt sie Krimis, Thriller und Kurzgeschichten. Sie ist Mitglied der Salzburger Autorengruppe und der Mörderischen Schwestern, für die sie monatlich Kolumnen verfasst. Katharina Eigner lebt mit ihrer Familie am südlichen Stadtrand von Salzburg.
Mehr Informationen zur Autorin unter: www.katharina-eigner.at
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: © U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung einer Stickerei von Katharina Eigner
ISBN 978-3-8392-7378-4
Prolog
18.08 Uhr. Der Museumswärter dreht seine letzte Runde. Sein hellblaues Hemd ist unter den Achseln nass geschwitzt. Er lächelt verlegen und wischt sich über den Nacken. Es ist ein heißer Sonntag, vielleicht der letzte heiße in diesem September. Ich werde beides nicht mehr genießen können, weder den Sonntag noch den September. Dafür steht zu viel auf dem Spiel.
Hier drin ist es feucht und finster. Es riecht nach Moder, Tod und Holz. Kalt ist es auch. Die Welt, draußen vor dem dicken Gemäuer, ist bunt und lebendig. Mein Leben dagegen ist wie ein Fächer voller Grauschattierungen. Ein dunkler Weg, gepflastert mit Heimlichkeiten und Lügen. Eine Abwärtsspirale, die mich hinabzieht, schneller und schneller ins finstere Verderben.
Draußen glänzen hauchdünne Spinnfäden vor dichtem Laub. Filigrane Kunstwerke, die mich an Großmutter erinnern. An ihre ungewöhnlich tiefe Stimme. Die langen weißen Haare. Tagsüber zu einem dicken Zopf geflochten, abends ein seidiger, weiß schimmernder Wasserfall über ihren Schultern. Ich höre die Nähmaschine surren, wenn ich an Großmutter denke. Sehe das gelbe Maßband, wie es von ihrem Nacken baumelt, und rieche ihren unverwechselbaren Duft von Lavendelseife und Nivea-Creme. Ihre einzigen Schönheitselixiere bis ins hohe Alter.
Die Stunden bei ihr waren die schönsten der Woche. Mit anderen Kindern zu spielen, empfand ich als öde und langweilig. Der beste Spielplatz, fand ich, war Großmutters Nähzimmer. Nadeln, Faden und ein Stück Stoff reichten mir, um eigene Welten zu erschaffen. Ich bewegte mich in einer Galaxie aus Schnitten und Stoffrollen. Das Nähzimmer war mein Kosmos, mein Wunderland voller Farben und Muster. Ein Land, zu dem nur Großmutter und ich Zutritt hatten.
Ich schrecke hoch; bin ich schon wieder eingenickt?
Kälte und Moder haben mich in ihren Klauen, drücken immer fester zu und verjagen auch noch das letzte bisschen Wärme aus mir, aus meiner Seele und meinem Herzen.
Da ist wieder diese Stimme, ganz nah bei mir. Eine tiefe, alte Stimme. Großmutter? Nein, der Museumswärter. Ich habe seinen Namen vergessen. Kaum zehn Meter entfernt von mir hinkt er am Haus vorbei. Sein Gang ist unrhythmisch, das Hüftleiden schreitet voran. Er muss Schmerzen haben, trotzdem ist sein Gesicht zerfurcht von Lachfalten.
Zeit, nach Hause zu gehen, ruft er und scheucht die Besucher aus den Häusern. Er tippt auf seine Armbanduhr, winkt die Letzten Richtung Ausgang. Seine Stimme ist freundlich, aber bestimmt. Die Besucher gehorchen. Eltern rufen ihre Kinder, heben Rucksäcke auf und klappen Brotdosen zu. Da und dort liegen Getränkepackungen oder Papiersäckchen im Gras. Der Wärter hebt den achtlos weggeworfenen Müll auf und schüttelt den Kopf.
Das Warten im Troadkasten ist eintönig und kraftraubend, aber solang der Wachmann draußen eifrig Besucher nach Hause scheucht, habe ich keine Wahl. Ich reibe mit den Handflächen über meine Oberarme, um mich zu wärmen. Das Buch, das ich unter meiner Jacke versteckt habe, stört bei der Bewegung. Ich taste durch den Stoff danach und lächle. Es ist meine Versicherung. Kurz schließe ich die Augen. Ich bin müde. Das Planen hat mich ausgelaugt, die Warterei zerrt an meinen Nerven. Aber ich weiß, dass ich es tun muss. Für uns.
Der Innenraum des gemauerten Turms, früher ein Getreidespeicher, misst keine zehn Quadratmeter. Zwei schwere Holztruhen, in denen Korn oder Mehl aufbewahrt wurde; mehr Möbelstücke gibt es hier nicht. Fünf aneinandergereihte Glasvitrinen bedecken in Augenhöhe eine Wand, gegenüber ragt eine Holztreppe, steil wie eine Hühnerleiter, vom Boden in das Obergeschoss. Die massive Eingangstür aus Eichenholz beansprucht den halben Raum, wenn sie nach innen aufschwingt. Für einen Stuhl ist hier kein Platz. Wie lange stehe ich hier schon?
In vier der Vitrinen sind Mordwerkzeuge ausgestellt. Vorrichtungen, die den Tod herbeiführen. Durch Ertränken, Erschlagen, Zerquetschen oder Aufspießen. An manchen klebt noch Blut. Die Texte zu den Mausefallen, sicher 50 an der Zahl, finde ich widerlich. Minutiös wird der blutige Sieg des Menschen über die Nagetiere dargestellt. Eine Chronik der Feigheit, die sowieso niemanden interessiert.
Eine Großfamilie hastet an der offenen Tür vorbei. Im Bollerwagen, den der Vater zieht, sitzen drei Kleinkinder mit gelben Matschhosen, Gummistiefeln und geringelten Hauben. Sie stopfen sich Kekse in den Mund, eines winkt mir zaghaft zu. Das kleinste, noch kein halbes Jahr alt, schlummert in der Bauchtrage der Mutter.
Pünktlich um 18.10 Uhr klickt die Zeitschaltuhr. Das Licht an der Decke und in den Vitrinen erlischt. Es ist das Signal zum Nachhausegehen. Für die Besucher und den Wärter. Nicht für mich. Ich starre dem Wärter nach. Sein hellblaues verschwitztes Hemd leuchtet zwischen den Ästen der Kastanie, bewegt sich immer weiter von mir fort. Er steuert auf ein Bauernhaus mit roten Geranien zu. Gleich wird er hinter dem Hauseck verschwinden, sich weiter Richtung Ausgang vorarbeiten und dann, pünktlich um 18.15 Uhr, das Freilichtmuseum verlassen. Der Wärter, dessen Namen ich vergessen habe, funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk. Er ist pünktlich, verlässlich und verlässt nie seine Bahn. Wie immer wird er nach dem Dienst ohne Umweg nach Hause zu seiner Frau fahren. Vielleicht brät sie ihm Lachs und serviert Salat aus dem eigenen Garten, weil sie auf seine Leberwerte achtet. Gut möglich, dass sie sogar gemeinsam Nacktschnecken aus dem Gras in ihrem kleinen Paradies klauben, sie in einem Glas Bier ertränken und pünktlich um 20.15 Uhr den Fernseher einschalten. Wie immer.
1. Kapitel
Erzählt von drei Weisen und fluoreszierender Eitermasse, von Fußball, der Wilden Jagd und einem Steinmassiv zwischen Österreich und Bayern. Es geht um Pipebands und Handwerk, außerdem um Infotainment. Stufe Rot auf der Macho-Skala. Ich bin geduldig und werde erwartet.
Hämorrhoide und Furunkel winken schon von Weitem und steuern auf mich zu. Nagelpilz ist auch dabei. Sie umringen mich wie die drei Weisen aus dem Morgenland. Statt Weihrauch, Gold und Myrrhe haben sie medizinische Scheußlichkeiten im Angebot.
Zum ersten Mal seit Langem könne sie wieder schmerzfrei sitzen, strahlt Hämorrhoide und singt eine Lobeshymne auf die neue Heilsalbe. Schön, dass wir helfen konnten, nicke ich und will weiter. Aber nix da.
»Moment!« Hämorrhoide zerrt tatsächlich eine Tube Heilsalbe aus ihrer Handtasche. »Hab ich immer dabei.« Es folgt ein Vortrag über ihre arteriovenösen Gefäßpolster an der Enddarmschleimhaut. Über harten Stuhlgang, falsche Diagnosen und Prävention durch ballaststoffreiche Ernährung. Währenddessen hält sie mahnend die Tube in die Höhe. Nach dem Monolog entsteht kurze peinliche Stille, die Hämorrhoide zum Luftholen nutzt. Sie schraubt den Tubenverschluss auf und drückt einen Klecks Paste auf die Kuppe des Zeigefingers.
Ihren knielangen Trenchcoat, der den Weg zum Hinterteil versperrt, lupft sie mit einer Hand und präsentiert mir ihre Kehrseite. Ich bekomme eine detailreiche Einweisung, wie die Salbe an den wunden Stellen aufzutragen ist. Dabei wandert Hämorrhoides Hand mit dem Salbenklecks auf dem Finger immer wieder Richtung Auspuff.
Furunkel, wortkarg wie immer, beschränkt sich auf endloses Kopfnicken. Wie ein Wackeldackel segnet er Hämorrhoides Worte und Taten kommentarlos ab. Auf seiner linken Wange spannt die Haut über einem Hügel gelber Eitermasse, der bis an den unteren Rand der Sonnenbrille reicht. Die Nachmittagssonne lässt sein blasses Gesicht wächsern glänzen und bringt den Eiter unter der dünnen, zum Zerreißen gespannten Hautschicht zum Leuchten wie phosphoreszierendes Gel.
Nagelpilz, der Dritte im Bunde, schielt immer wieder zu Hämorrhoide und knetet peinlich berührt seine beigefarbene Jacke. Unverkennbar ein Modell aus der Vorjahreskollektion vom Kaffeeröster. Modisch wird sich der nie weiterentwickeln. Eine durch und durch blasse Erscheinung. Farbliches Highlight sind die gelbbraunen Zehennägel, die aus den pflanzengegerbten Sandalen ragen. Ein optischer Leckerbissen, der Mann.
Aber optische und andere Herausforderungen gehören zu meinem Berufsalltag wie der Krautsalat zum Schweinsbraten und die Kugel zu Mozart, denn ich bin die rechte Hand der Grödiger Hausärztin.
Grödig ist eine 7.000-Seelen-Gemeinde, eingequetscht zwischen der Stadt Salzburg und Anif, dem Untersberg und unseren deutschen Nachbarn. Der kleine Ort, längst nicht so mondän wie Salzburg, mit nicht halb so vielen Promis wie Anif, liegt dem Untersberg zu Füßen wie hingerotzt. Dafür bietet es ein Fußballstadion, drei Kirchen und eine Schokoladenfabrik.
Manchmal könnte man meinen, Grödig ist ein Ort der Sehnsucht und des Verzichts.
Das Stadion, zum Beispiel, war vor gut zehn Jahren Geburtsstätte eines Fußballwunders. Adi Hütter, ein begnadeter Trainer, schmiedete die Grödiger Elf zum Aufsteiger des Jahres, was sage ich: des Jahrzehnts. Die Dorfmannschaft legte sich mit der Crème de la Crème der österreichischen Klubs an und kletterte die Bundesligatabelle hoch. Spätestens als die Busse von Rapid Wien und Sturm Graz sich den Weg durch die Maisfelder zum Grödiger Fußballplatz bahnten, konnte keiner mehr die vermeintlichen Underdogs ignorieren.
Adi Hütters Mannschaft kämpfte wie David gegen Goliath und erspielte sich den Respekt der Berichterstatter und gegnerischen Klubs. Der Mannschaft am Untersberg flogen die Herzen ebenso zu wie die Spielregeln, an die man sich in der höchsten österreichischen Liga zu halten hat, koste es, was es wolle. Um die Anforderungen der höchsten Spielklasse im Land zu erfüllen, musste das Stadion umgebaut werden. Ein finanzieller und logistischer Kraftakt, aber Grödig war im Fußballhimmel.
Bis zum Wettskandal. Bestochene Spieler, Gier und dubiose Verbindungen zur Wettmafia beutelten den Klub schwer und ließen den Nimbus zusammenbrechen. Die Elf strauchelte, Adi Hütter wurde abgeworben. Der Geist der Unbezwingbaren war dahin, und der Kitt, der die Mannschaft bis dahin geeint hatte, zerbröselte. Grödig fiel fußballmäßig wieder in den Dornröschenschlaf wie all die Jahre zuvor. Die treuesten Fans in Blau-Weiß schwenken zwar immer noch Fahnen und schmettern Parolen, aber der Lack der höchsten Spielklasse ist längst abgeblättert.
Abgesehen vom Fußballwunder besticht Grödig mit seinem einzigartigen Angebot an Vereinen. In Grödig ist das Hobby Programm, fadisieren muss sich hier niemand. Die Traditionsbewussten sind bei den Weihnachtsschützen oder im Krippenbauverein, die Detailverliebten bei der Bastelrunde, die Ischiasgeplagten beim Wohlfühlyoga und die Figurbewussten bei Zumba oder Bauch-Beine-Po. Für alle Unentschlossenen mit Hang zum Fernweh gibt es Pipeband und Offshore-Segelklub, obwohl Grödig weder in den schottischen Highlands noch an einem der Weltmeere liegt. Werbestrategen würden der Gemeinde ob dieses Angebots dringend raten, einen USP herauszuarbeiten. Also ein Alleinstellungsmerkmal. Sich auf das Wesentliche zu besinnen und den Fokus auf die Besonderheiten der Gegend zu legen, anstatt in allen Gewässern zu fischen und sich dabei zu verzetteln. Aber was nach Unentschlossenheit oder sogar Chaos klingt, ist vielleicht sogar Grödigs Stärke. Außerdem enden sowieso alle Fäden, die jemals an Grödig vorbeiführen oder es umgarnen, am großen gemeinsamen Nenner, dem Untersberg. Schon was den Verkehr betrifft, führt an ihm kein Weg vorbei. Vier der fünf Grödiger Ortsteile grenzen direkt an den Kalkriesen mit der markanten Form, und die Verbindung von Fürstenbrunn im Westen nach Sankt Leonhard im Osten führt am Berg entlang.
Überhaupt, der Untersberg. Er ist viel mehr als nur ein Steinmassiv zwischen Österreich und Bayern. Der Untersberg ist Wasserspender, Wanderziel und Forschungsobjekt. Sagenumwoben und geheimnisvoll. Ein Schutzschild im Süden von Salzburg und Grödig, an dem alle Unbill abprallt. Wetterfronten ebenso wie Urlauber mit Wohnwägen, die die Autobahn aus Kostengründen meiden, an der kurvenreichen Straße scheitern und den Verkehr zum Erliegen bringen. Oder Touristen, die an ihrem Wochenendtrip Salzburgs Hausberg mit Sandalen bezwingen wollen und sich dann doch von der Bergrettung aus den Felsen klauben lassen. Wanderfaule erreichen das Hochplateau mit der Seilbahn und lassen sich vom spektakulären Blick über das Salzburger Becken verzaubern.
Aber der Koloss, in dem versteinerte Schnecken und anderes Meeresgetier ebenso schlummern wie Riesen, Zwerge, Bergfrauen und andere Sagengestalten, kann auch anders. Er ist voller Magie. Seine Gegner hält er mit Dolinen, Abgründen und Höhlen in Schach, aus denen man sich selbst nicht mehr befreien kann. Wer die unsichtbaren Grenzen des Untersbergs nicht respektiert, wird verschluckt und kehrt nie wieder zurück.
Einmal im Jahr, in einer Rauhnacht vor Weihnachten, werden die Gestalten der Wilden Jagd zum Leben erweckt und ziehen zu Füßen des Untersbergs von Haus zu Haus, um das Böse zu vertreiben. Bei ebendieser Wilden Jagd konnten meine Freundin Vroni und ich voriges Jahr einen Mord verhindern, man erinnert sich. Wobei verhindern nicht ganz stimmt: Viel eher hat sich der dritte geplante Mord ungünstig verschoben. Wer anderen eine Grube gräbt, kann ich da nur sagen. Aber jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich bin Arzthelferin. Und Arzthelferin in einer 7.000-Seelen-Gemeinde zu sein, erfordert Flexibilität. Multitasking. Keine Scheu vor Arbeit und im Idealfall eine hohe Ekel-Toleranz.
Zu meinen Aufgaben gehört nicht nur organisatorischer Kram wie das Ausdrucken von Rezepten und Jonglieren mit Terminen. Das wäre Understatement und würde meinem Beruf nicht ansatzweise gerecht. Als Arzthelferin ist man quasi Mädchen für alles. Man tauscht Druckerpatronen, rückt die Sessel im Wartezimmer zurecht, schlichtet die Zeitschriftenstapel in der Leseecke und sortiert das Kinderspielzeug nach Alter und Farbe. In der Früh bin ich die Erste in der Ordination, lüfte, stelle genügend Lulubecher ins Patienten-WC, gieße den Gummibaum und kümmere mich um dezente Hintergrundmusik. Darüber hinaus bin ich das linke und rechte Ohrwaschel unserer Kunden. Beim Warten auf Rezepte, beim Ausmachen von Folgeterminen oder bei der Blutabnahme werden die Leute gesprächig und erzählen, wo der Schuh drückt. Die einen mehr, die anderen weniger. Bei einigen fließt der Informationsstrom, kaum dass sie die Praxis betreten haben, und reißt alle anderen Wartenden mit. Andere verlieren nur hin und wieder Worte wie ein gelegentlich tropfender Wasserhahn. Die Selbstbewussten, die in vermeintlichen Good News baden, surfen auf ihrer Gute-Laune-Welle daher. Und wieder andere, wie der Rettenbacher, unser Haus- und Hofhypochonder, sind wie ein Fass, in dem sich Todessehnsucht und Angst sammeln. Denen bleibt man am besten fern, denn wie bei einer Regentonne reißt die Oberflächenspannung bei der kleinsten Berührung, und ehe man zur Seite hüpfen und sich in Sicherheit bringen kann, schwappt der Redefluss über, und man bekommt nasse Füße.
Aber mein Beruf hat auch Vorteile: Ich erfahre Interessantes und Erstaunliches, manchmal völlig überraschend, meistens unter dem Siegel der Verschwiegenheit. So ein Wartezimmer ist ein Informations-Hotspot, es ist Infotainment und Seelsorge in einem. Mir sind keine menschlichen Abgründe fremd, und ich habe längst aufgehört, mich über Dinge zu wundern.
Fürs Putzen hat sich meine Chefin die Pelzinger Miri geangelt, eine wahre Perle. Gott sei Dank, sonst müsste ich mich auch noch um die Staubflusen im Wartezimmer kümmern.
Alles in allem liegen mir – bis auf wenige Ausnahmen – unsere Patienten sehr am Herzen. Sogar am Sonntag, wenn ich privat unterwegs bin. Aber einige bringen mich dann doch dazu, am Hippokrates-Eid zu zweifeln, und daran, ob es sich wirklich lohnt, alle zu heilen.
Leute wie Hämorrhoide, zum Beispiel. Ihr Mitteilungsdrang überschreitet die Grenze des Erträglichen, sie kennt kein Tabu. Selbst intimste Themen posaunt sie in die Welt hinaus, sie erwartet Aufmerksamkeit, Zustimmung und Applaus. Hämorrhoide schert sich nicht um die Interessen ihrer unfreiwilligen Zuhörer und bleibt stur auf Kurs, wenn sie erst in Fahrt ist. Die Frau ist eine Herausforderung für das Schamgefühl. »Das waren ja richtige Kirschen am Auspuff«, trötet sie ungeniert und reißt mich aus meinen Gedanken, »quasi Ring of Fire. Aber jetzt, mit der Salbe … kein Vergleich!«
Ich nicke anerkennend und suche nach einer Fluchtmöglichkeit. Der Status Quo ihres Anus interessiert mich nicht im Geringsten.
»Ja, dann …« Auffällig schiebe ich den Jackenärmel hoch und schaue auf die Uhr. »Jessasmarandjosef, in ein paar Minuten fängt die Modeschau an. Jetzt muss ich mich aber wirklich beeilen!«
Nagelpilz wird hellhörig und nestelt nervös am Zipp seiner Bauchtasche. »Ich wusste gar nicht, dass im Freilichtmuseum Modeschauen stattfinden.« Ausgerechnet er interessiert sich für Kleidung, schau an. Ich deute zum Veranstaltungsort, dem Salinenstadel. »Es ist eine Dirndl-Modeschau.«
Nagelpilz kramt in seiner Bauchtasche und holt ein mehrfach zusammengefaltetes Stück Papier heraus: das aktuelle Tages-Veranstaltungsprogramm des Freilichtmuseums. Nagelpilz fährt mit dem Finger über den Flyer. Seine Brille hat er vergessen oder will sie nicht aufsetzen, also kneift er die Augen zusammen, um besser sehen zu können. »Dirndl goes Nachhaltigkeit?«
So lautet das Motto der Modeschau. Ich nicke und räuspere mich. »Jetzt muss ich aber wirklich. Sie entschuldigen mich …«
Aber Nagelpilz hebt einen Zeigefinger und liest laut: »Heute ist nicht nur Handwerkstag, sondern gleichzeitig Dirndlgwandlsonntag und Modeschau.« Er glubscht glückselig. »Da weiß man ja gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll.« Nagelpilz streckt mir den Flyer hin, aber mir graust. Sogar seine Fingernägel sind braun und splitterig. Für eine Nagelpilz-Übertragung von Mensch zu Mensch genügen schon kleinste Partikel. Ich will mir nichts einfangen, also lehne ich dankend ab und zwinge mich, nicht hinzustarren.
»Ein Event-Jackpot, sozusagen.« Hämorrhoide lächelt gekünstelt. Nagelpilz liest weiter vom Flyer vor. »Die Modeschau ist eine Kooperation der Modeschule Hallein und des Designers Alexis K.«
»Alexis K.?« Endlich hört Furunkel mit dem Kopfwackeln auf. Seine Sonnenbrille, durch den abrupten Wackelstopp aus dem Gleichgewicht gebracht, rutscht nasenabwärts und liegt auf der Eiterbeule auf. Furunkel verzieht schmerzhaft das Gesicht und stupst die Brille mit dem Zeigefinger zurück nach oben.
»Alexis K. ist doch der mit den Dirndln?«
Ich nicke. »Früher hat er Haute Couture entworfen und ist rund um den Globus gejettet. Vor ein paar Jahren hat er das Reisen an den Nagel gehängt, ein Haus in Salzburg gekauft und designt seitdem nur noch Trachten.«
Furunkel betupft mit dem Zeigefinger vorsichtig die Eiterbeule und blickt Nagelpilz über die Schulter, um mitzulesen.
»Meine Nichte besucht auch die Modeschule Hallein!« Nagelpilz wedelt mit dem Flyer vor meiner Nase herum. »Allerdings erst seit ein paar Wochen.« Daher also sein plötzliches Interesse an Mode. Vielleicht hat die Nichte Erbarmen, denke ich und starre auf seine beigefarbenen Jeans mit der Bügelfalte. Noch ist nicht alles verloren. Vielleicht leuchtet für den geschmacksverirrten Onkel doch noch Licht am Ende des beigen Tunnels.
»Die Modeschau ist ein Projekt der vierten Klassen«, meldet sich Hämorrhoide gelangweilt zu Wort, und auf Furunkels fragenden Blick: »Eine meiner Freundinnen unterrichtet an der Modeschule.«
Sie steckt mit frostiger Miene ihre Heilsalbe wieder ein und streicht den Trenchcoat überm Hintern glatt. Der große Auftritt von vorhin ist endgültig vorbei.
»Die Schülerinnen haben Alternativen zu Konsumzwang und Wegwerfgesellschaft erarbeitet. Die Aufgabenstellung war, alte und gebrauchte Dirndl aufzupeppen und umzuschneidern«, erkläre ich.
»Upcycling ist ja jetzt ganz in.« Nagelpilz wippt aufgeregt mit den Zehen. Englische Ausdrücke stehen ihm nicht, finde ich.
»Bei der Modeschau präsentieren alle ihre eigenen Entwürfe. Am Ende wird ein Siegermodell gekürt.« Wobei für mich längst feststeht, wer das Rennen macht. Das Modell meiner Tochter ist unangefochten der Hammer! Finde ich. Susi hat ein Dirndl aus dem Recyclingcontainer gefischt, es umgeschneidert und mit ihrem Entwurf des Original Glanegger-Dirndls kombiniert. Eine handwerkliche Meisterleistung!
»Und was ist der Preis?« Hämorrhoide hat den Aufmerksamkeitsschwund verkraftet und zeigt sich jetzt doch interessiert. Offenbar hat ihre Freundin nicht alle Infos preisgegeben.
»Der Hauptgewinn ist ein zweimonatiges Praktikum im Atelier von Alexis K.«
Nagelpilz pfeift anerkennend durch die Zähne. »Macht sich gut im Lebenslauf, so ein Praktikum! Alexis K. hat ausgezeichnete Referenzen in der Branche.«
Während ich mich frage, woher er das weiß, gibt auch Furunkel seinen Senf dazu. »Das Freilichtmuseum ist genau die richtige Bühne für eine Dirndl-Modeschau.«
Was für eine rauchige Stimme er hat! Warum ist mir das bisher nie aufgefallen?
»Bei so viel Tradition auf einem Haufen passt eine Trachtenmodeschau haarscharf dazu! Und erst recht am Dirndlgwandlsonntag! Das nenn ich Timing!« Furunkel nimmt richtig Fahrt auf und faselt etwas von Eventmanagement. Klingt, als hätte er tatsächlich Ahnung davon. Als ich es endlich schaffe, mehr auf sein rauchiges Timbre zu achten als auf die Eiterbeule, meldet sich eine andere Stimme.
»Rosmarie, kommst du jetzt endlich?« Laurenz, mein Mann. Er steht auf der Brüstung des Salinenstadels und strotzt vor Ungeduld. Wie ein Herrscher, der seinem Gefolge zum wiederholten Male die Grundregeln des Gehorsams erklären muss. Jedes Mal dasselbe, wenn ich bei Events nicht an seiner Seite bin. Der Laurenz ist ein handfester Macho, muss man so sagen. Ohne tägliche Dosis an Bewunderung, Hofstaat und Pflege geht gar nix. Er gibt sich gern als Patriarch und Besserwisser. Aber hinter dem ganzen prähistorischen Gehabe steckt pure Unsicherheit. Das ist jetzt nicht nur so dahingesagt, um ihn zu verteidigen. Ich weiß das aus jahrelangen Beobachtungen. Wäre er tatsächlich der Macho, der er gern wäre, hätte ich ihn nie geheiratet. Im tiefsten Innern ist der Laurenz warmherzig, liebevoll und sehr aufmerksam. Immer auf der Suche nach Bestätigung und alles andere als selbstsicher. Nur leider – weiß der Himmel warum – kann er das geschickt verbergen. Jetzt zum Beispiel. Sein Gesichtsausdruck ist eine Mischung aus Gereiztheit, Empörung und, beim Blick auf Furunkels Eiterbeule, Abscheu. Ich hab ja diesen ganzjährigen Pool an Verständnis für seine Allüren und Minderwertigkeitskomplexe, aus dem ich unseren Ehealltag speise. Aber jetzt, mit diesem Auftritt, kann er mich mal. So eine geballte Ladung aus Imponiergehabe, übersteigertem Selbstbewusstsein und Besitzdenken, wie er sie gerade auf mich abfeuert, muss ich mir nicht gefallen lassen! Dazu noch in diesem Kommandoton, der alles im Umkreis von 100 Metern übertönt. Damit hat er eindeutig Alarmstufe rot auf der Macho-Skala erreicht. Normalerweise ein Grund, ihm so richtig den Kopf zu waschen. Oder, weit wirkungsvoller: ihn zu ignorieren. Aber diesmal tut er mir sogar einen Gefallen mit seinem Machismo. Laurenz ist mein Ticket aus den Fängen der drei Weisen. Eine Szene kann ich ihm später immer noch machen. Werde ich auch. Aber nicht jetzt.
Nagelpilz bringt es diplomatisch auf den Punkt. »Ich glaub’, da wartet jemand auf Sie, Frau Dorn.«
Ich schicke ein »Komme gleich« Richtung Laurenz in die laue Abendluft, die sogleich zerrissen wird. Von einem Schrei. Ohrenbetäubend, empört und schrill.
2. Kapitel
Erzählt von Wutausbrüchen, Siegesfackeln und Klappsesseln, von Glamour, Trachtenjacken und Florian Silbereisen. Es geht um Spuckeflecken, Gentlemen und Herzrhythmusstörungen. Der Laurenz schämt sich, und die Hermi will endlich in See stechen.
»Du Trutschn!«
Auf den Schrei folgt dumpfes Rumpeln und hektisches Klack-Klack. Schnelle Schritte mit Absätzen auf Metall. Der Lärm kommt vom Salinenstadel, aber nicht von der Balkonseite, sondern von der Außenstiege, die in den ersten Stock führt.
Zwei Mädchen im Dirndl, beide stark geschminkt, mit Zopffrisuren und schwarzen High Heels, stehen auf den Stufen. Modeschülerinnen in ihren Laufstegmodellen wahrscheinlich. Stimmungsmäßig definitiv Konflikt statt Kuschelkurs.
Eine der beiden versucht, die andere abwärts zu stoßen. Kampflustig und angespannt wie eine Sehne funkelt sie unter ihren aufgeklebten Wimpern hervor und macht wieder einen Schritt nach unten, auf ihre Rivalin zu.
»Schleich dich, hast eh keine Chance!«
Ich kenne die beiden. Nicht persönlich, aber von Susis Schulfotos. Sie sind in derselben Klasse wie meine Tochter, und von der oberen, die keift wie eine Furie, kenne ich sogar den Namen. Krumbichler Ella. Laut Susi Inbegriff des Bösen, zumindest soweit das bei einer 19-Jährigen möglich ist. Mittelmäßig begabt, scheut keine Intrigen, um sich bei Wettbewerben nach vorne zu mogeln. Ein Gemüt wie ein Metzgerhund, trampelt empathiebefreit auf ihren Mitschülern herum und rückt sich selbst ins beste Licht. Sagt die Susi. Ihren Spitznamen hat sich die Krumbichler Ella, aufgedonnert wie eine Drag-Queen, redlich verdient: Kruella, nach der dunklen Gestalt mit Vorliebe für Dalmatinerfell aus dem Disney-Film.
Wieder ein Rumpeln: Die beiden Mädchen haben das untere Ende der Stiege beinahe erreicht, Kruella legt der anderen die Hände auf die Schultern und gibt ihr einen kräftigen Stoß. Die strauchelt, steigt mit dem hohen Absatz ins Leere, knickt mit einem Fuß um, kippt nach hinten und purzelt die restlichen drei Stufen abwärts. Mit einem dumpfen Aufprall landet sie rücklings im Kies. Kruella stöckelt ungerührt wieder zurück in den Veranstaltungsraum, als wäre nichts gewesen.
In zwei Sätzen bin ich bei der Gefallenen und ziehe sie vom Boden hoch. »Geht’s?«
Das Mädchen steht wackelig auf ihren schwarzen Sky Heels und verzieht das Gesicht vor Schmerz. Wahrscheinlich ein verknackster Knöchel oder eine Bänderzerrung. Ihre Frisur ist zerzaust, und am Dirndl ist der Saum heruntergerissen. Alles in allem schlechte Bedingungen für den großen Auftritt.
»Jetzt bin ich am Arsch!« Sie wischt mit dem Handrücken über die Nase, reißt sich die Pumps von den Füßen und humpelt die Treppe hoch. »Diese Bitch, ich bring sie um!«
»Kommstdujetztendlichoderwas? Rosmarie!« Wieder Laurenz. Den hätte ich beinahe vergessen.
Hämorrhoide, Nagelpilz und Furunkel winken meinem charmebefreiten Göttergatten freundlich zu.
»Schöne Grüße an das Fräulein Tochter! Wir drücken ganz fest die Daumen!« Nagelpilz hält den Flyer wie eine Siegesfackel in die Höhe und zeigt Laurenz mit der anderen Hand einen gedrückten Daumen, aber der winkt nur majestätisch von der Brüstung herab und dreht sich um. Also erinnere ich die drei Weisen an ihre Kontrolltermine kommende Woche, verabschiede mich hastig und eile in den ersten Stock, Richtung Laurenz und Modeschau.
*
18.12 Uhr. Ich stehe schon zu lange hier, die Zeit wird knapp. Bald muss ich am anderen Ende des Geländes sein, mich unter die Menge mischen und tun, als würde ich dazugehören. Als hätte ich nichts anderes im Sinn als den roten Teppich, das Scheinwerferlicht und den Applaus.
Ich zähle von zehn rückwärts und reibe die Fingerkuppen von Daumen und Ringfingern aneinander, um mich zu beruhigen.
Das Einatmen durch die Nase fällt schwer, trotzdem lausche ich meinem eigenen Rhythmus. Starre durch das dichte Laub der Kastanie und suche das helle Blau des Wachmannhemdes. Seit Tagen fiebere ich diesen Minuten entgegen.
Ein Schweißtropfen löst sich im Nacken, rieselt vom Haaransatz zwischen den Schulterblättern zum Träger des BHs hinab. Es ist kein Angstschweiß. Schuld ist die Septemberhitze. Kein Platz für Angst, auch keinen Grund. Und selbst wenn: Es gibt kein Zurück.
Das Gesicht des Wachmannes taucht auf. Leuchtet zwischen dem Grün der Kastanienblätter zu mir herüber.
Jetzt muss es schnell gehen.
Ich fische eine Rolle Paketband aus dem umgehängten Stoffbeutel. Taste mit den Fingernägeln die Rolle ab und zupfe den Anfang des klebrigen Streifens hoch. Ich halte inne – außer meinem galoppierenden Herzschlag ist nichts zu hören.
Weiter! Vorsichtig presse ich den ersten braunen Streifen ans Glas der Vitrine, reiße ihn an der Kante ab und ziehe den nächsten Streifen von der Rolle. Presse wiederum Klebeband an die Scheibe und reiße es akkurat ab. Zigmal wiederhole ich das. Meine Bewegungen sind schnell und fließend. Eine Seite des Glasquaders ist komplett mit Klebeband bedeckt. Ein Blick auf die Uhr: Bestzeit. Kaum zwei Minuten sind vergangen. Ich stopfe die Rolle zurück in den Beutel und taste nach dem Stiel des Hammers. Den Kiesweg draußen lasse ich dabei nicht aus den Augen. Die Besucher, der Wachmann und die humpelnde Dame von der Tageskassa sind längst gegangen, aber ich darf mich nicht in Sicherheit wiegen. Eine einzige Sekunde Unachtsamkeit könnte alles zerstören.
Zwischen Taschentuchpackungen, einer Stoffmaske und einem kleinen Handtuch ertasten meine Finger den glatt polierten Holzgriff des Werkzeugs. Das kleine Handtuch wickle ich um den Kopf des Hammers, fixiere es mit einem Gummiband und beginne mit dem heikelsten Teil meiner Arbeit. Vorsichtig klopfe ich gegen die Scheibe, von rechts oben beginnend nach links unten, immer an jede Stelle zweimal. Klack-klack, klack-klack. Im Geiste teile ich die Scheibe in ein Raster, arbeite Reihe für Reihe ab. Klack-klack, klack-klack. Jedem dumpfen Geräusch folgt ein leises Splittern. Ich lasse den Hammer zurück in die Tasche gleiten, löse die Klebestreifen von der Vitrine. Das Sicherheitsglas hat sich in einen klebrigen Scherbenteppich verwandelt. Vorsichtig und beinahe lautlos lässst sich die zerbrochene Scheibe aus dem Rahmen entfernen. Nur als der Scherbenteppich den Holzboden berührt, klirrt es leise.
Aus der Vitrine strömt modriger Geruch. Ich hebe den mitgebrachten Pizzakarton auf, lege die Stoffteile vorsichtig hinein und klappe den Deckel zu. Dann verlasse ich, pünktlich um 18.15 Uhr, das Freilichtmuseum durch den Haupteingang.
*
Durch das Salzburger Freilichtmuseum am Fuß des Untersbergs weht der Geist aus sechs Jahrhunderten und nimmt die Besucher mit auf eine Reise in die Vergangenheit.
Auf 50 Hektar Grundfläche in der Gemeinde Großgmain sind 100 Bauten ausgestellt, die Lebens- und Schicksalsort der einfachen Bevölkerung waren. Sieben Kilometer Spazierwege machen die entstaubten Chroniken der einzelnen Gaue erlebbar, und obwohl das Leben der Bauern, Knechte und Mägde frei von jeder Romantik war, ist das Museum für viele zum Sehnsuchtsort nach der »guten alten Zeit« geworden. Die idyllische Kombination aus gepflegter Landschaft und authentisch restaurierten Höfen macht das Museum zur Traumkulisse für Feiern und Filmteams.
Der Salinenstadel, ursprünglich ein Holzlager im deutschen Bad Reichenhall, wurde abgetragen, renoviert und auf österreichischem Boden wieder aufgebaut. Sein neuer Standort ist, keine zehn Kilometer entfernt von Bad Reichenhall, der Flachgauer Teil des Freilichtmuseums Großgmain, wo er seit dem Jahr 2004 steht. Ebenerdig altern landwirtschaftliche Großgeräte vor sich hin, der erste Stock wird für Veranstaltungen vermietet. Der Stadel ist oben wie unten an einer Längsseite offen. Feiern und Veranstaltungen sind also an das Kälteempfinden der Gäste gekoppelt, denn bei niedrigen Temperaturen wird’s schnell ungemütlich und zugig. Zudem fehlt dem Stadel die Nachmittagssonne, was selbst an warmen Herbsttagen wie heute zum Problem werden kann.
Die Stiege aus großmaschigem Metallgitter, die an der Hinterseite in den ersten Stock führt, erlaubt keine Höhenangst. Wer den Blick in die Tiefe fürchtet, scheitert genau hier und bleibt der Feier fern. Außerdem scheppert die Stiege bei jedem Schritt blechern. Zuspätkommen wird hier akustisch bestraft. Ich zähle die Schrauben, mit denen die Stiege am Stadel befestigt ist, und frage mich, wie viel von Laurenz’ kritischem Architekten-Adleraugenblick ich schon übernommen habe.
Im großen fensterlosen Raum sind hölzerne Klappsessel in Reihen aufgestellt. Die runden Holztischchen, sonst wie kleine Inseln lose im Raum verstreut, sind weggeräumt.
An den Holzwänden hängen Entwurfzeichnungen der Schülerinnen. Der hölzerne Laufsteg, über den meine Tochter Susi und die anderen bald stöckeln werden, versprüht nur ein Mindestmaß an Glamour. Gute zehn Meter lang, mit rotem Spannteppich ausgekleidet und von Plastik-Buchskugeln mit bauschigen Schleifen flankiert.
Im Saal sind nur mehr einzelne Sessel frei, den Rest besetzen Familienangehörige der Schülerinnen und Schüler. Eltern, Geschwister, einige Großeltern und zwei Hunde. Ausnahmslos alle Frauen tragen Dirndl. Bei den älteren sind die Schürzenstoffe konservativ Ton-in-Ton zum Kleid, die jüngeren haben ihr Outfit mit Lederjacken und außergewöhnlichen Musterkombinationen aufgepeppt. Da und dort sind Schürzen mit indigoblauem Ikat-Muster oder der Silhouette der Salzburger Altstadt zu sehen.
Die Männer tragen karierte Hemden zu ihren Trachtenjacken und Lederhosen. Bei einigen Paaren sind sogar Dirndlschürze und Trachtenhemd farblich aufeinander abgestimmt. Jetzt ist einer der Momente, in dem sich mein Desinteresse an Elternnetzwerken rächt: Ich fühle mich, als ob ich nicht dazugehöre. Einigen der Anwesenden bin ich auf Elternabenden oder Sprechtagen begegnet, aber ich kenne niemanden namentlich. Und niemand kennt mich, geschweige denn nimmt Notiz von mir.
Laurenz und Hermi haben in der dritten Reihe Platz genommen. Ich schlängle mich, so gut es geht, zu ihnen durch und setze mich zwischen meinen Mann und meine Schwiegermutter.
»Die Susi als Fetzentandlerin. Wenn ich das gewusst hätt’!« Hermi, links von mir, verschränkt die Arme unter der dirndlverpackten Brust und presst die Lippen fest zusammen. Ihre Kiefer mahlen aufeinander, auf der Stirn schwillt eine Ader an. Ich ahne Schlimmes: Das hier ist die Ouvertüre zu einer Katastrophe.
»Wenn du was gewusst hättest?« Laurenz, rechts von mir, schüttelt ungeduldig den Kopf und legt eine Hand an die Ohrmuschel. Die laute Musik hat einen Teil der Botschaft übertönt. Statt einer Antwort deutet Hermi zum Laufsteg, aber Laurenz zuckt ahnungslos die Schultern. »Dann, was?«
»Dann wäre ich daheim geblieben und hätte mir das Traumschiff angeschaut.«
»Mama, bitte!« Laurenz schließt genervt die Augen.
»Was, bitte?« Hermi beugt sich über mich nach rechts und funkelt ihren Sohn wütend an. »Ich hab gleich gesagt, dass ich nicht mitkommen will. Da!« Sie reckt ihr Kinn zur offenen Seite des Stadels. »Da draußen scheint die Sonne! Im Radio haben sie gesagt, heut ist der letzte Abend, an dem man draußen sitzen kann. Ich wär’ jetzt lieber im Garten, aber nein …! Wir hocken herinnen in dieser Bruchbude, dieser windigen! Es zieht wie in einem Vogelhaus, und die Lautsprecher schnalzen einem das Trommelfell durch.«
»Im Freilichtmuseum gibt’s keine Bruchbuden.«
Wie immer, wenn es um Bauwerke geht, hat er diesen überheblichen Ton drauf, mein Göttergatte. An Gesprächspartner, die ihm in Sachen Architektur unterlegen sind, verschwendet er nur ungern seine Zeit. Und wenn, dann im Oberlehrer-Modus. »Das sind Original-Bauernhöfe. Liebevoll abgetragen, restauriert und wieder aufgebaut.«
»Liebevoll abgetragen, dass ich nicht lach’!« Hermi winkt ab. »Lauter alte Schupfen sind das, die tragt man am besten warm ab. Und ich sag dir noch was …!«
Ihr Zeigefinger piekst über mich hinweg in Laurenz’ Brust.
»Deinen Architekten-Klugschiss kannst dir sparen! Was hab ich davon, dass ich in einem Original-Bauernhof aus dem 16. Jahrhundert hock, wenn ich mir dafür eine Lungenentzündung und einen Gehörschaden hol?«
So weit wie möglich nach hinten gelehnt, schaue ich zwischen den beiden hin und her. Links, rechts, links, rechts. So muss sich das Publikum in Wimbledon fühlen.
»Du übertreibst maßlos.« Laurenz fischt einen Zettel in Postkartengröße aus der Innentasche seines Sakkos. Hermi holt zum nächsten verbalen Gegenschlag aus, aber Laurenz’ ganze Aufmerksamkeit gilt bereits dem zerknitterten Flyer, den er liebevoll glatt streicht.
»Wirst sehen, morgen bin ich krank. Aber bitte, wenn du mich unter die Erde bringen willst …« Understatement war noch nie Hermis Stärke. Außerdem ist sie eine Rossnatur, das muss an dieser Stelle gesagt werden. An meiner Schwiegermutter beißen sich Magen-Darm-Viren, Schafblattern und sogar ganze Pandemien die Zähne aus. Aber im Grunde hat sie recht: Es ist zugig und saukalt herinnen, und das bei mindestens 25 Grad Außentemperatur. Der einseitig offene Stadel, in dem die Modeschau stattfindet, ist nach Norden ausgerichtet. Die Abendsonne streift das Bauwerk nicht einmal mehr. Auch in Sachen Gehörschaden hat Hermi nicht übertrieben: Die Bässe wummern so laut, dass der Sessel unter meinem Hintern vibriert.
Ich wickle mein Wolltuch enger um die Schultern und recke den Kopf nach hinten, zur Lärmquelle. Neben dem Mischpult steht ein Endvierziger mit Lederjacke und Sidecut. Auf der rechten Kopfseite trägt er die grau melierten, kinnlangen Haare hinters Ohr geklemmt, die linke Kopfseite bedecken millimeterkurz getrimmte Stoppeln. Bart und Schläfen sind ebenfalls angegraut, die Augenpartie faltig. Um seinen Hals ist ein Palästinenserschal geknotet. Ein Berufsjugendlicher, denke ich und drehe mich wieder um. Der DJ nickt zur Musik, hat die rechte Hand am Kopfhörer und tobt sich mit der Linken am Lautstärkenregler aus.
»Ich könnte den Verantwortlichen dort hinten bitten, dass er die Musik leiser dreht«, schlage ich vor. Hermi schaut mich an, als wäre ich ein hoffnungsloser Fall.
»Den Diedschäi, meinst? Glaubst, ich weiß nicht, wie das heißt? Ich bin alt, aber nicht deppert.« Dann beugt sie sich wieder über mich nach rechts und redet auf den Laurenz ein. »Kann ich halt morgen nicht zum Aquajogging, wenn ich mir jetzt eine Lungenentzündung hol’.«
»Das Leben ist kein Wunschkonzert, Mama. Vielleicht wird’s ja auch nur ein Schnupfen.« Der Laurenz zuckt nicht einmal mit der Wimper. »Außerdem sind Schwimmbäder eh grauslich.« Er wischt und scrollt auf seinem Smartphone und checkt seine Mails. »Glaub mir, du willst gar nicht wissen, was in so einem Becken alles schwimmt«, murmelt er gnädig in Richtung Hermi. »Am schlimmsten ist es nach den Mutter-Kind-Gruppen und den Seniorenkursen. Haare, Popel, Körperflüssigkeiten.« Kurzer Blick Richtung Hermi über den Rand seiner Nickelbrille. »Vom Chlor mag ich gar nicht erst anfangen!«
In der Hoffnung auf Unterstützung wendet sich Hermi an mich. »Der Arzt hat mir Schwimmen dringend empfohlen, und es tut mir gut.« Ich weiche ihrem Hypnoseblick aus. Es ist eindeutig, worauf sie hinaus will: Ich soll Partei für sie ergreifen. Ihre Verbündete sein. Laurenz überreden, seine Mutter nach Hause zu fahren, damit sie nicht weiter im zugigen Stadl sitzen muss, sondern mit Florian Silbereisen auf große Fahrt gehen kann. Hermi starrt unerbittlich weiter. Ich schlucke und zupfe nervös meinen Dirndlrock zurecht, sie hebt abwartend die Augenbrauen. Dieses uralte Spiel ist simpel, aber effektiv: Wer zuerst wegschaut, verliert. Hermi weiß das natürlich und schafft damit jedes Mal eine Punktlandung auf meinem schlechten Gewissen. Allein der Gedanke daran, Mitschuld an ihren Rückenschmerzen zu haben, ist mir unerträglich. Genau da setzt Hermi regelmäßig den Hebel an. Aber nicht heute, nehme ich mir vor und starre tapfer zurück. Zumindest so lang, bis ich blinzeln muss. Also räuspere ich mich und winke einer imaginären Freundin, die in der Nebenreihe sitzt. Wegschauen, um jemanden zu begrüßen, hat nichts mit Niederlage zu tun, rede ich mir ein.
Die angelächelte Dame, die ich noch nie zuvor gesehen habe, winkt natürlich nicht zurück, sondern hebt ratlos die Schultern und schaut nach links und rechts. Wahrscheinlich denkt sie, ich hätte sie mit jemandem verwechselt.
»Die kennt dich wohl nimmer, oder?« Hermi winkt nun ebenfalls der Dame zu, quasi, um deren Erinnerung aufzufrischen.
»Lang nicht mehr gesehen«, murmle ich als Erklärung und höre auf zu winken, »außerdem hat die immer schon ein miserables Personengedächtnis gehabt.«
Hermi schüttelt den Kopf und wechselt die Taktik. Mitleidsmasche und Vorwürfe bringen nicht den gewünschten Erfolg, also geht sie in die nächste Runde. Sie kramt umständlich in ihrer Tasche.
»Was suchst du denn?«, flüstere ich unsinnigerweise, denn die Discobeats übertönen sowieso alles.
Statt einer Antwort flucht Hermi vor sich hin. Sie holt einen Schlüsselbund, eine Packung Mund-Nasen-Masken und eine kleine Trinkflasche aus den Untiefen ihres Lederbeutels und legt alles auf meinen Knien ab.
»Irgendwo müssen die doch sein.« Sie schüttelt zuerst den Kopf, dann schaut sie anklagend zur miserablen Deckenbeleuchtung. »So ein finsterer Kobel da herinnen, da kann man ja nix finden.« Sie hält die Tasche an ihr Ohr, schüttelt sie immer wieder und lauscht dann. Suchen nach Gehör. Ganz leise ist ein Klack-klack zu hören. »Ah!« Hermi fischt eine kleine grüne Schachtel aus ihrer Tasche. »Kräuterzuckerl.« Sie hält mir die Packung verheißungsvoll unter die Nase. »Magst auch eines?«
Ich schiebe den Karton mit dem Hustinettenbären sachte, aber bestimmt von mir weg. »Nein, danke.« Gott bewahre! Nichts ist schlimmer als das langsame Auswickeln von Zuckerln während einer Veranstaltung, bei der Stille geboten ist. Verhaltenes Knistern und Zusammenfalten von raschelndem Papier, das jede Lautlosigkeit durchbrich, bereitet mir Herzrhythmusstörungen. Hermi ist diesbezüglich unbelastet: Nahrungsaufnahme und Kulturgenuss schließen einander nicht aus, findet sie. Und Anstandsregeln sind sowieso dazu da, um gebrochen zu werden, lautet ihr Credo. Dem Laurenz wiederum, Spezialist in Sachen Fremdschämen, bereiten peinliche Situationen Höllenqualen. Was Hermi zu nutzen weiß. Ihre Faustregel: Peinlichkeit proportional zum verfrühten Aufbruch. Bevor Laurenz strafende Blicke der anderen Zuschauer ertragen muss, zieht er die Reißleine und verlässt die Veranstaltung. Das Zuckerlprinzip hat Hermi schon oft große Dienste erwiesen. Egal ob Kabarett, Kino oder Konzert: Meine Schwiegermutter beendet langweilige Events gerne auf ihre Art und Weise.
Aber nicht heute. Denn Laurenz kennt die Tricks seiner Mutter mittlerweile und tippt unbeeindruckt auf den Flyer. »Du findest einen unechten Kapitän und eine pensionierte Bordkellnerin besser als deine Enkelin auf dieser Modeschau?«
»Sicher!« Hermi stopft sich ein Zuckerl in den Mund. »Alles ist besser, als sich ein paar Fetzen aus der Altkleidersammlung anschauen zu müssen«, schmatzt sie laut. Ein paar Zuschauer drehen sich zu uns um und senden tödliche Blicke, aber Hermi räumt mit stoischer Ruhe ihre Handtasche wieder ein. Hinter uns schwenkt der Techniker zwei Scheinwerfer zum Laufsteg; der rote Sisalteppich ist jetzt grell beleuchtet. In meiner Magengrube kribbelt es. Als würde nicht Susi, sondern ich gleich über den Laufsteg schweben. Es wird ernst.
»Das sind keine alten Fetzen, sondern Kreationen, das weißt du genau«, wispert Laurenz verhalten über mich hinweg. »Upcycling nennt man das. Die Susi hat Blut und Schweiß geschwitzt für dieses Projekt, weil sie unbedingt gewinnen will. Und wenn deine Enkelin dran ist, dann tu mir einen Gefallen und …« Weiter kommt er nicht; er wird durch abgehacktes Knacksen unterbrochen.
»… darf ich … herz… zur diesjährigen Mo…d…sch… der Modeschule Ha… begrüßen!« Ganz vorne, auf einem winzigen Podest, kämpft eine Frau im Kleinen Schwarzen mit dem Mikrofon. Immer wieder setzt sie zu ihrer Rede an, aber das Mikro streikt und sendet nur Fiepen, Quietschen und Rückkopplungen. Hermi stößt mir ihren Ellbogen in die Rippen.
»Wer ist das jetzt wieder? Die Direktorin?«
»Nein, die sitzt dort drüben.« Laurenz deutet auf eine gepflegte Mittvierzigerin im Blaudruckdirndl am Ende der ersten Sitzreihe. »Die Dame am Mikro ist Alumna.«
»Red’ Deutsch mit mir!« Hermi boykottiert Fachausdrücke.
»Eine Absolventin der Modeschule«, wispere ich gegen die lauten Wortfetzen an und werfe einen Blick in das Programmheft.
»Moderation: Bine Hummelbrunner«, lese ich Hermi vor. »Heute helfen viele mit, die selbst die Modeschule besucht haben. Anders wäre die Organisation gar nicht möglich. Sagt zumindest die Susi.«
»Pscht!« Laurenz hätte gern Ruhe.
Die Moderatorin schaltet das Mikro ein und wieder aus, pustet darauf und zerrt am Kabel. Außer einem Summen jenseits der erträglichen Dezibelgrenze tut sich nichts. Der Herr im Trachtenjanker vor mir zuckt zusammen, presst sich die Hand aufs rechte Ohr und schaltet hektisch sein Hörgerät aus. Vorne, auf dem Mini-Podest, seufzt die Bine Hummelbrunner genervt, blinzelt gegen das Scheinwerferlicht und schirmt die Augen mit der rechten Hand ab. »Technik, bitte!«
Aus dem hintersten Winkel des Saals wuselt ein zerstrubbelter Teenager mit schwarzem Hoodie zwischen Scheinwerfern und Stühlen hervor. Zweimal stolpert er über seine viel zu langen Schuhbänder und schafft es dann doch bis ganz nach vorn, zur Moderatorin. Er drückt ihr ein neues Mikro in die Hand. Das andere nimmt er an sich, schaltet es ab und wickelt das Kabel auf. Sekundenlang ist es mucksmäuschenstill.
»Und warum trägt die kein Dirndl?«, fragt Hermi in das Konversationsleck hinein. »Gelten für die Gottoberste andere Regeln?« Sie zeigt mit dem Finger auf Bine Hummelbrunner. »Ist die besser, oder was?«
Neben mir sinkt Laurenz tief in seinen Sessel, stellt den Kragen seiner Jacke auf und schämt sich. Gegen Hermis Metzgergemüt ist er ein Seelchen. Währenddessen trollt sich der Kapuzenpulli wieder zu den Schweinwerfern und zeigt der Moderatorin von hinten ein Daumen hoch.
»Vielleicht«, räuspere ich mich, »will sie den Schülerinnen nicht die Show stehlen?«