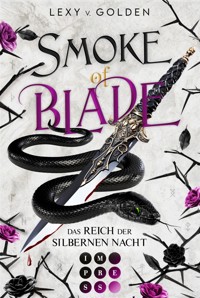4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
NIEDRIGER AKTIONSPREIS NUR FÜR KURZE ZEIT! **Die Geheimnisse der Krone** Jedes Jahr zur Sommersonnenwende soll in einem abgeschiedenen Dorf eine junge Frau dem Dämonengott geopfert werden, um ihn gnädig zu stimmen. Jede von ihnen wird am Waldrand an ein Holzkreuz gebunden und Nodir dargeboten, bis er sie zu sich holt. Voller Entsetzen hört Sóley, wie bei dem diesjährigen Fest ihr Name vom König ausgerufen wird. Doch kurz vor der Opfergabe gelingt ihr das Unmögliche: Sie kann sich mithilfe ihrer Freundin Layla befreien und flieht in die Tiefen des Waldes. Dort kann nur einer Sóley vor dem Zorn des Dämonengottes retten: der Herrscher des Siebten Reiches, dessen Dunkelheit die junge Frau ebenso fasziniert wie fürchtet. Denn sie scheint ihm ähnlicher zu sein als sie glaubt … Kämpfe gegen die dunkle Seite in dir. Textauszug: Als hätte er sich auch nicht länger im Griff, verließ keine Antwort seinen Mund. Stattdessen glitten seine Lippen über meinen Mundwinkel. Wir standen so kurz vor einem Kuss. Einem Kuss, den ich vor wenigen Augenblicken mit Lesander teilen wollte. Bei ihm hatte ich kaum gezögert, warum bei Chester? Weil er ein Dämon war? So war es nicht. In mir loderte die tiefgehende Neugier, wie es wohl wäre, Chester zu küssen. Noch intensiver zu spüren als ohnehin schon. Und da war diese Sekunde vollkommener Klarheit, die mir offenbarte, dass ich es wirklich wollte. Ich, Sóley, und nicht das teuflische Etwas in mir. //Dies ist der erste Band der Royal-Fantasy-Buchserie »Scepter of Blood«. Alle Romane der Dämonen-Fantasy: -- Scepter of Blood: Kuss der dunkelsten Nacht -- Shades of Bones: Im Bann der Nachtschatten -- Smoke of Blade. Das Reich der silbernen Nacht//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
ImpressDie Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Lexy v. Golden
Scepter of Blood. Kuss der dunkelsten Nacht
** Kämpfe gegen die dunkle Seite in dir **
Jedes Jahr zur Sommersonnenwende soll in einem abgeschiedenen Dorf eine junge Frau dem Dämonengott geopfert werden, um ihn gnädig zu stimmen. Jede von ihnen wird am Waldrand an ein Holzkreuz gebunden und Nodir dargeboten, bis er sie zu sich holt. Voller Entsetzen hört Sóley, wie bei dem diesjährigen Fest ihr Name vom König ausgerufen wird. Doch kurz vor der Opfergabe gelingt ihr das Unmögliche: Sie kann sich mithilfe ihrer Freundin Layla befreien und flieht in die Tiefen des Waldes. Dort kann nur einer Sóley vor dem Zorn des Dämonengottes retten: der Herrscher des Siebten Reiches, dessen Dunkelheit die junge Frau ebenso fasziniert wie fürchtet. Denn sie scheint ihm ähnlicher zu sein als sie glaubt.
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
© privat
Lexy v. Golden, 1988 geboren, lebt als freie Autorin in der Nähe von Dresden. Seit ihrem Studium schreibt sie Fantasyromane für junge Erwachsene mit neuen, einzigartigen Wesen und einem Hauch an Romantik, Liebe und Spannung.
KAPITEL 1
SÓLEY
Blut rann meinen Unterarm entlang, als ich meine Hände im Wasser des kleinen Baches wusch. Vorsichtig glitt ich mit den Fingern über die scharfe Jagdklinge, um sie von den letzten Blutresten zu säubern.
Um mich herum wurde der Wald in ein Farbenspiel aus Purpur und Flamingorot getränkt. Das vertraute Zirpen der Zikaden verstummte mit jeder Minute, die ich zu lange am Bachufer hockte. Es war beinahe so, als wüssten die Insekten, dass heute Nacht das alljährliche Fest stattfand.
Mich interessierte nicht, ob sich alle Bewohner des Dorfes und der benachbarten Siedlungen bereits eingefunden hatten. Alles, woran ich in diesem friedlichen Moment dachte, war, nicht mit leeren Händen zurückzukommen. Ich blickte zu den drei gefangenen Kaninchen, die immer noch die Drahtschlingen um ihre Hälse trugen. Drei Tiere waren nicht schlecht, wenn man bedachte, welcher Lärm die letzten Tage vom Dorf ausgegangen war. Es war beinahe unmöglich gewesen, etwas zu fangen, da Posaunen, Pauken und Hörner sämtliche Waldbewohner tiefer in die Berge getrieben hatten.
Weiter als nötig wollte ich nicht ins Gebirge ziehen, um Kaninchenfallen aufzustellen. Denn je tiefer man den Wald betrat, desto geringer waren die Chancen, dass man ihn jemals wieder lebend verließ.
Um nicht zu spät zurückzukehren, schob ich den Dolch eilig in meinen Ledergürtel, schüttelte die Hände flüchtig trocken und sammelte meine Beute vom Felsen neben mir ein. Mit den drei Wildkaninchen in der Hand lief ich zu meinem Pferd, das ich nahe dem Bachlauf angebunden hatte. Eine friedliche Stille legte sich über mich. Jedem anderen würde gerade mulmig zumute werden, aber ich mochte die Ruhe. Die letzten Tage waren das Getöse und die Hektik um die Vorbereitungen für die Bekanntgabe der Schicksalsträgerin kaum auszuhalten gewesen. Obwohl viele Menschen im Dorf Hunger litten, hatten sie ihre letzten Vorräte herausgeholt, damit es dem König während seiner Durchreise an nichts fehlte.
Wenn man es genau betrachtete, fraß sich der König in jedem Dorf mit seinem Gefolge und seinen Soldaten durch. Für ihn waren die Wochen um die Sommersonnenwende die perfekte Gelegenheit, um sein Land zu bereisen, seine Bewohner um ihre letzten Nahrungsmittel zu bringen und die Gefangenen öffentlich hinzurichten. König Minhêlon Tríton war gekommen, um die diesjährige Schicksalsträgerin zu ernennen.
Als ich bei Ophram, meinem schwarz-weiß gescheckten Hengst, ankam, band ich die Kaninchen am Sattel fest und prüfte dreimal, ob die Knoten sicher saßen. Danach strich ich über seine Stirn.
»Kehren wir zurück. Es wird Zeit«, flüsterte ich ihm zu, als ich im selben Moment sehr nah an meinem rechten Ohr ein Knistern vernahm. Augenblicklich hielt ich in meiner Bewegung inne, bevor ich den Umhang zurückschwang und mich umdrehte. Doch da war nichts. Ophram schnaubte und drehte seine Ohren in alle Richtungen. Er hatte es ebenfalls bemerkt.
Das Zirpen der Zikaden verstummte, und ich hörte erneut ein Geräusch, das mich an Flammen, die über feuchte Holzscheite leckten, erinnerte. Eigentlich glaubte ich nicht an die ganzen Erzählungen und Mythen, die über das Gallônes-Gebirge berichtet wurden. Wenn es stimmte, was die Dorfältesten, die Seher, sagten, lag ein Fluch über diesem Wald. Ein Fluch, der immer mächtiger wurde, je tiefer man ins Gebirge vordrang. Ich ging seit mehr als zwei Jahren regelmäßig jagen und hatte in keinem Augenblick Fluchmagie spüren oder sehen können. Allerdings war ich bisher nie so weit in den Wald vorgedrungen wie heute.
Um nicht noch mehr Zeit zu vergeuden, band ich Ophram los, stieg in den Sattel und bewegte meinen alten Hengst dazu, die leichte Böschung zu überwinden. Ich hörte das leise Knistern kein weiteres Mal, obwohl jeder meiner Sinne geschärft war. Ich ritt wachsam und mit einer inneren Anspannung weiter.
Als wir den schmalen, staubigen Pfad erreichten, waren bloß noch die letzten rotgoldenen Lichtstreifen des Sonnenuntergangs zu erkennen.
Doch kaum dass das Schimmern zwischen den Fichtenkronen verblasste, entdeckte ich bläuliche Blitze – Lichterscheinungen, die flüchtig zwischen den kleinen Wölkchen auftraten und gleich wieder verblassten.
Sieht so aus, als würde es heute Abend gewittern und das Fest ins Wasser fallen.
Nicht dass ich etwas dagegen gehabt hätte. Ganz und gar nicht. Jedoch war keine Spur von Gewitterwolken zu sehen. Ich schaute in den Himmel hinauf.
Wie merkwürdig.
Ophram schnaubte, als im selben Moment das tiefe Dröhnen eines Waldhorns erklang. Wie ein unheilvolles Omen drang es durch den Wald. Es war der erste Ruf. Es würden neun weitere folgen, bevor die Verkündung der Schicksalsträgerin stattfand. Mir tat bereits in diesem Moment das Mädchen leid, auf das dieses Jahr das Los fiel. Sie würde herausgeputzt und einen Tag lang wie eine Königin behandelt und am darauffolgenden Abend an einem Holzkreuz am Waldrand festgebunden werden. Dort musste sie darauf warten, dass der Dämon sie holte. Kein anderer Mensch durfte in ihrer Nähe sein. Ich wollte mir nicht ausmalen, welche Ängste sie in dieser Nacht durchstehen musste.
Mich schüttelte es allein bei der Vorstellung, wie dieser Dämon, den niemand je gesehen hatte, sie holte und auffraß. Denn ein Wesen, das nur Unheil über die Siedlungen der Magielosen brachte, verdiente es in meinen Augen nicht, besänftigt zu werden, indem man ihm Menschenopfer darbot.
Die Ältesten hatten zwar selbst auch noch nie einen Dämon zu Gesicht bekommen, schworen aber auf ihr Leben, dass diese Monster existierten. Sie waren sich sicher, dass es den Bewohnern der magielosen Landstriche, zu denen mein Zuhause gehörte, wesentlich schlimmer ergehen würde, wenn nicht jährlich eine junge Frau geopfert würde.
In Gedanken vertieft, bemerkte ich nicht, wie mit einem Mal schwere Tropfen vom Himmel fielen. Zwei landeten auf meinen Händen, mit denen ich die Zügel locker umgriffen hielt. Anders als gewöhnlicher Regen waren die Tropfen pechschwarz.
Augenblicklich hob ich das Gesicht zum Himmel. Er verdunkelte sich. Und das ziemlich rasant. Durch große Wolken brach die Nacht herein, viel schneller als sonst.
Ein heftiges Beben ließ einen Moment den Erdboden erzittern und Ophram tänzelte unruhig hin und her.
Was ist das? Woher kommt dieses Beben und wieso ist der Regen pechschwarz?
Ohne lange zu zögern, umfasste ich die Zügel fester und drückte die Fersen in Ophrams Bauch. Was auch immer hier passierte, es schien, als würde in diesem Wald etwas ganz und gar nicht stimmen. Als hätte jemand Hand an die natürlichen Gesetzmäßigkeiten gelegt.
Ich war keine hundert Meter weit geritten, als ein zweites, wesentlich heftigeres Beben den Waldboden erzittern ließ.
Der Fluch! Gibt es ihn wirklich?
Plötzlich entdeckte ich einige Meter entfernt aus den Augenwinkeln eine schwarz umschattete Kreatur. Zuerst sah es aus, als würde ein Wildschwein oder etwas Größeres parallel neben uns herlaufen. Doch dann nahm es an Geschwindigkeit zu, verschmolz mit den Baumstämmen und erschien wie ein Schatten einige Meter weiter vor mir.
Um das Tier genauer zu betrachten, kniff ich im stetig zunehmenden Regen angestrengt die Augen zusammen. Das schwarze Zeug, das vom Himmel fiel, brannte in den Augenwinkeln, verursachte ein Jucken auf der Haut und roch nach Schwefel und Fäulnis.
Das Tier, das mit großen Schritten durch den Wald lief, rannte nicht, es wirkte konzentriert, beherrscht – es sah aus, als würde es eine Fährte aufnehmen, ohne mich zu bemerken. Sein Kopf war zum Boden gerichtet, während es ein tiefes Grunzen und Schnauben von sich gab.
Ein zweites Mal ertönte das Waldhorn. Der Hall war dieses Mal so laut, dass das Tier ruckartig den Kopf hob und im selben Augenblick mächtige Schwingen ausbreitete. Der Kopf erinnerte an den eines Greifvogels, wohingegen seine Flügel denen eines Drachen glichen. Es besaß keine Federn, dafür einen langen, von Schuppen überzogenen Schwanz, der angespannt hin- und herpeitschte.
Bei den heiligen Priestern Wârdorás, was ist das für ein Tier?
War es überhaupt ein Tier oder eine besondere Spezies?
Sehr clever schien es nicht zu sein, denn obwohl es einen guten Geruchssinn zu haben schien, bemerkte es mich nicht. Ich befand mich nicht einmal dreißig Fuß von ihm entfernt. Kein einziges Mal blickte es in meine Richtung.
Obwohl ich unerkannt blieb, hörte ich mein Blut in den Ohren rauschen und spürte meinen schnellen Puls in der Kehle klopfen. Instinktiv griff ich nach meinem Dolch, um mich auf einen Kampf vorzubereiten. Gegen solch eine große Kreatur zu bestehen war aussichtslos. Daher verhielt ich mich ruhig und ritt nicht weiter. Nein, ich würde warten, bis es verschwand.
Als das Horn erneut zu hören war, funkelten die gelbgoldenen Augen der Kreatur, und sie gab einen grellen, lauten Schrei von sich, der ein Klingeln in meinen Ohren verursachte. Wie konnte ein Tier nur solch einen hohen Ton erzeugen? Leise keuchend kniff ich die Augen zusammen.
Nach dem Schrei reckte es den Kopf in meine Richtung.
Es hat mich gesehen!
Doch statt mich anzugreifen, erschien eine hochgewachsene Gestalt wie ein schwarzer Nebelsturm zwischen der Kreatur und mir. Sie war kaum erkennbar inmitten des wabernden Rauchs.
Augenblicklich erstarrte ich und mein Magen verknotete sich schmerzhaft.
Die Gestalt stand mit dem Rücken zu mir. Sie müsste sich nur umdrehen und hätte mich entdeckt. Ich konnte silberfarbene Schulterklappen und pechschwarzes Haar erkennen – und wie sich eine gewaltige schwarze Schlange um die Füße des Wesens schlängelte. Ich blinzelte mehrmals, um auszuschließen, dass ich mir all das nicht nur einbildete.
Bei den Heiligen Nephistos! Ich muss etwas Falsches gegessen haben … halluzinieren.
Schon mit zwölf Jahren hatte ich diesen Wald durchstreift und kein einziges Mal war ich auf sonderbare Wesen wie diese getroffen. Sie konnten nicht real sein. Sie konnten bloß in meinem Kopf existieren. Als litte ich unter Kopfschmerzen, fasste ich mir an die Schläfe, schloss die Augen und öffnete sie wieder. Aber die Kreaturen waren immer noch da.
Die Gestalt zischte in einem bedrohlichen Tonfall, als wäre sie angewidert von dem bloßen Anblick der geflügelten Kreatur. Es waren drei Worte in einer fremden Sprache, die ich sehr gut hören konnte: »Néhphdân aka-Tár Ríat!«
Es klang wie ein Befehl, eine Anweisung an einen niederen Diener, der ihm lästig war. Danach geschah etwas Merkwürdiges: Die geflügelte Kreatur senkte den Schnabel zu Boden, kniff die Augen zusammen, legte steif die mächtigen Flügel an und gab einen gequälten Laut von sich, als würde sie ergeben nicken. Im immer dichter werdenden Regen verschmolz die Gestalt mit der Umgebung und war nicht mehr zu sehen.
Nervös und vollkommen überfordert mit dem, was ich gesehen hatte, richtete ich mich im Sattel auf und drehte meinen Kopf in alle Richtungen. Wenn diese schwarzhaarige Gestalt wie aus dem Nichts erscheinen konnte, konnte sie sicher auch direkt vor mir auftauchen. Die Vorstellung ließ mich schaudern.
Aber nachdem ich mehrmals die Umgebung abgesucht hatte, entdeckte ich keine Schattengestalt, auch keine geflügelte Kreatur mit Drachenschwanz. Nichts. Beide waren fort.
Alles, was blieb, war der schwere prasselnde Regen, der meinen Körper wie eine schmierige Ölschicht von oben bis unten überzog.
KAPITEL 2
SÓLEY
Ich ritt wie eine Wahnsinnige. Mit jedem Meter, den ich hinter mir ließ, legte sich der Regen und lichteten sich die Bäume.
Die Seher hatten recht. Sie hatten mit allem recht. Denn was ich gesehen hatte, gehörte nicht in die Welt der Magielosen. Ich konnte noch immer den nach Tod und Krankheit stinkenden Geruch des Regens einatmen. Er umgab mich von Kopf bis Fuß. Allerdings ekelte er mich nicht an.
Es war wohl ein Dämon gewesen, den ich da gesehen hatte. Oder ein Magier – auf jeden Fall etwas, das viel mächtiger war als ein gewöhnlicher Mensch. Schließlich hatte sich die Gestalt mit der Kreatur verständigen und wie aus dem Nichts erscheinen und wieder verschwinden können.
Im Dorf angekommen starrten mich die angeheiterten Bewohner, denen ich begegnete, wie meistens merkwürdig an. Für sie war ich selbst nach Jahren eine Fremde, die nicht in die Siedlung gehörte, die anders aussah und sich nicht wie eine junge Frau meines Alters verhielt.
»Bist wohl in den Dreck gefallen, was?«, rief mir Niklas hämisch zu, der seine Freundin enger an seine Seite zog und mir absichtlich die Straße versperrte.
Nein, bitte nicht er.
Der eingebildete Sohn des Bürgermeisters war wie die Pest. Er würde sicher eines der Kaninchen einfordern, sobald er sie entdeckt hatte. Schnell versteckte ich mit dem Mantel meine Beute, damit er sie nicht sah.
»Geh beiseite!«, forderte ich den rothaarigen Kerl auf.
»Wieso denn? Hast du es eilig? Während sich alle auf das Fest vorbereiten, die Stände herrichten und die Rede des Bürgermeisters, meines Vaters, wie du weißt, angehört haben, suhlst du dich im Dreck.«
»Verschwinde, du Torfkopf!« Ich riss die Zügel herum, als der Blödmann Anstalten machte, mein Pferd zu verunsichern, indem er mit der rechten Hand hektisch in der Luft herumfuchtelte. »Hör auf damit und geh dich mit deiner Freundin amüsieren. Vielleicht ist es euer letzter gemeinsamer Abend, wenn das Los auf sie fällt.« Für diese scharfen Worte konnte ich mir immens viel Ärger einhandeln.
Er schnappte nach Luft, griff nach dem Halfter und starrte mich mit einem bösartigen Funkeln, das in seine schmalen Schweinsaugen getreten war, an.
»Wetten, dass nicht? Und falls doch, wäre es für Isa eine Ehre, ihre Pflicht zu erfüllen.«
Wer’s glaubt … Ich musste mir ein Lachen verkneifen. »Es ist keine Pflicht. Wie kannst du von Ehre sprechen, wenn ein Mensch von einem Dämon gefressen wird, damit du nachts unbesorgt schlafen kannst? Wenn es solch eine Ehre ist, warum bietest du dich nicht an?«
Sein rundliches Gesicht nahm ein gefährliches Rot an, während es um seine Nase herum blass blieb. Auf seiner rechten Wange zuckte ein Muskel. Jedes Mal, wenn ich an seinem Ehrgefühl kratzte, wurde er rot und war kurz vor dem Platzen.
»Weil es immer Weiber sind. Ich würde mich selbstverständlich sofort freiwillig melden, um mich für mein Dorf zu opfern, wenn es möglich wäre. Aber da der Dämonengott nur jungfräuliche Frauen bevorzugt, kann ich ihm mein Leben nicht opfern.«
Was für ein Heuchler. Er war es doch, der jedes Mal die Hosen gestrichen voll hatte, wenn im Dorf ein unerklärlicher Vorfall eintrat.
Er deutete mit dem Zeigefinger eine Kreisbewegung neben seiner Schläfe an und verdrehte die Augen, als stünde er kurz vor einem Kollaps. »Aber was soll man auch von dir erwarten, Kuckuckskind! Du bist einfach verrückt, durchgeknallt – wie deine Eltern. Vielleicht trifft das Los dich? Dann könntest du dem Dorf zum ersten Mal nützlich sein.«
Mieser …
Ein durchtriebenes Grinsen bildete sich auf seinen feucht glänzenden Lippen, nachdem er bemerkt hatte, dass es ihm gelungen war, mich zu verletzen. Das Grinsen ließ ihn drei Jahre jünger und noch dümmer aussehen. Niemand beleidigte meine Familie. Ich mochte anders sein, das traf jedoch nicht auf meine Eltern und Geschwister zu.
Ich würde, falls das Los wirklich auf mich fiel, mein Schicksal ganz sicher nicht hinnehmen. Um meine Familie nicht warten zu lassen, beugte ich mich an Ophrams Hals vorbei, um Niklas’ Hand vom Halfter zu zerren.
Im selben Moment rutschte meine rechte Mantelhälfte über die erbeuteten Kaninchen. Die herausgeputzten Menschen, die an uns vorbeiliefen, bildeten eine Traube um uns herum. Die wenigsten Bewohner trauten sich in die Wälder, um selbst Wild zu erlegen. Die Angst war viel zu groß, Flüche auszulösen oder sich im Dunkel der Bäume zu verirren. So mancher Mann kam nach einer Jagd nicht mehr zurück. Aus dem Grund rissen sie mir die gejagten Tiere auf dem Markt förmlich aus den Händen. Für die Bewohner waren sie selten, eine Rarität.
»Oh, was haben wir denn da? Du hast dich ja doch nützlich gemacht.«
Niklas gab augenblicklich das Halfter frei, um sich anschließend den Kaninchen zu widmen und die schüchterne Isa links liegen zu lassen. Blitzschnell zog ich meine Klinge und hielt sie ihm an den Hals. Isa schrie gedämpft, während Niklas die Augen vor Schreck aufriss. Das hatte er nicht kommen sehen. Die Kaninchen ließ ich mir nicht abnehmen. Sie waren für meine Familie und meine kranke Mutter.
»Versuch es gar nicht erst. Ich habe keine Schulden bei dir. Geh selbst in den Wald und fang dir was! Aber wir wissen beide, dass dir dazu der Mut fehlt, Niklas!«
Von meiner Reaktion schockiert sprang er mit einem Satz zurück, trat ungeschickt mit dem Stiefelabsatz auf seinen Saum und ruderte mit den Armen in der Luft, um nicht umzukippen. Isa rief seinen Namen und griff mit beiden Händen nach ihm, um ihn vor dem Sturz zu bewahren. Dabei stieß er sie fast zur Seite.
Welch ein Rohling!
»Lass los, Isa! Ist halb so wild«, fuhr er sie an.
Wo zuvor Furcht und Entsetzen in seinen Augen gestanden hatten, wurden sie jetzt von Wut und Hass verdrängt. Er schämte sich, als Sohn des Bürgermeisters vor einer jüngeren Frau zurückgeschreckt zu sein wie ein elender Feigling. Zu Recht. Seine Nasenflügel weiteten sich vor Zorn, während er die bebenden Lippen fest aufeinanderpresste, als er in einem gesunden Abstand vor mir stehen blieb. Um mich herum begannen die glotzenden Bewohner zu tuscheln oder gingen mit gesenkten Köpfen eilig vorüber. Ja, richtig, niemand mischte sich bei Auseinandersetzungen mit den Söhnen des Bürgermeisters ein. Besonders nicht, wenn Niklas wieder andere Bewohner schikanierte, beleidigte oder herunterputzte.
»Niklas, ihre Mutter ist krank. Lass ihr die Kaninchen«, redete Martis auf ihn ein. Er war einer der Dorfältesten, den ich beinahe unter der großen Kapuze seiner dunkelblauen Robe nicht erkannt hätte. Seine milchigen Augen huschten unruhig von mir zu Niklas, als könnte er uns ganz genau sehen, obwohl er schon vor langer Zeit erblindet war. Er legte seine Hand auf Niklas’ Schulter, während ich durchatmete und das Messer sinken ließ.
»Ich kann einen Anteil einfordern, ganz egal, ob ihre Mutter krank ist oder nicht.«
Wütend funkelte ich ihm entgegen. Nein, kannst du nicht!
Als er endlich merkte, dass ich sicher nicht nachgab, lenkte er mit einem schäbigen Grinsen ein: »Aber ich will mal nicht so sein. Behalte sie!«
Ja, heuchele Güte und Großzügigkeit vor, du Widerling!
Vor den Dorfältesten wollte er bloß keinen Aufstand machen, weil sie hoch angesehen waren. Weit höher als der Bürgermeister.
Wäre Martis nicht hier, würde Niklas mir am liebsten den Kopf abschlagen und sich anschließend mit den Kaninchen aus dem Staub machen. Diese Botschaft konnte ich eindeutig in seinem pausbackigen Gesicht ablesen.
»Sehr freundlich von dir«, gab ich gepresst zurück, um nicht unhöflich zu wirken, und atmete erleichtert durch.
»Sei pünktlich, Sóley«, ermahnte mich Martis, der weiterhin Ophrams Hals tätschelte. »In einer Stunde solltest du dich auf dem Festplatz einfinden. Ich rieche etwas …«, Martis trat näher an mein Pferd heran, »… Ungewöhnliches an dir. Diesen Geruch habe ich lange nicht mehr eingeatmet.«
Meine Augenbrauen zuckten nervös. Er konnte den Duft des schwarzen Regens ebenfalls wahrnehmen?
Niklas beugte sich vor und schnüffelte vor mir in der Luft wie ein Ferkel an seinem Muttertier. »Ich rieche nichts. Sie stinkt wie immer nach Tiermist und Sumpf.«
Am liebsten wäre ich aus dem Sattel gesprungen, um ihn an den Schultern zu packen und in seiner festlichen Robe in der nächsten Pfütze zu ertränken. Protzig zupfte er an der goldenen Kordel am Hals seines seidenweichen roten Umhangs.
Isa trug dieselbe Robe, was mir verriet, dass Niklas sie ihr geschenkt hatte. Ihre Eltern hatten nicht das Geld, sie in diese Stoffe zu hüllen. Darunter trug sie, wie es von allen Mädchen und jungen Frauen zwischen dreizehn und neunzehn Jahren erwartet wurde, ein weißes knielanges Kleid, während ihr Ausschnitt einige Zentimeter tiefer ausfiel, als es erlaubt war. Sie verzog während der Auseinandersetzung keine Miene. Ganz so, als hätte Niklas ihr das Sprechen verboten, wenn sie zusammen gesehen wurden.
Bevor Martis auf die Idee kam, dass ich im Wald womöglich einen Dämon gesehen hatte, entschuldigte ich mich bei ihm und ritt weiter. Während Niklas mir spöttisch hinterhergaffte, Grimassen zog und sich dabei den Hals verdrehte wie ein Uhu, blieb Martis wie zur Salzsäule erstarrt stehen. Er überlegte offenbar immer noch, woher er den Geruch kannte. Hoffentlich kam er nicht darauf, ansonsten würde mir eine Befragung vor dem Rat bevorstehen.
Es war kein gutes Zeichen, wenn ein Mensch einen Dämon traf. Eigentlich sah man die Person, die einem übernatürlichen Geschöpf begegnet war, nie wieder. Kam heraus, was ich beobachtet hatte, hätte man mich befragt und für eine Hexe gehalten. Oder man hätte mir unterstellt, einen geheimen Pakt mit einem Dämon eingegangen zu sein, um mir Vorteile zu verschaffen und vom Ritual verschont zu bleiben.
Zwischen den schiefen Fachwerkhäusern aus Holz, Lehm und Schiefer durchritt ich die sich schlängelnde Straße den Hügel hinauf. An den Rändern des Weges flackerten Fackeln, die die Nacht vertrieben. Musik erklang unweit aus der Senke, wo sich der Marktplatz befand. Und erneut, zum sechsten Mal, ertönte das kräftige Horn.
Nachdem ich die Gebäude der Stadtmitte hinter mir gelassen und einen flüchtigen Blick auf den Marktplatz erhascht hatte, wo alle auf die Ankunft des Königs warteten, erreichte ich das abgelegene Haus meiner Familie. Es befand sich nahe der Felder und Wiesen am oberen Rand des Hügels direkt neben einer altersschwachen Mühle.
Am Gartenzaun angekommen stieg ich aus dem Sattel, griff nach den drei Kaninchen und führte Ophram auf die Weide zu unseren beiden anderen Pferden: einem verrückten gescheckten Pony und einem rostbraunen sanftmütigen Wallach.
Ich nahm Ophram den Sattel ab, rieb seinen Rücken trocken und begab mich anschließend zum Haus. In jedem der Fenster brannte Licht. Meine Familie war wie jedes Jahr vor dem Fest in hellem Aufruhr. Aber nicht, weil sie sich auf die Sommersonnenwende freute, sondern weil jedes Jahr die Möglichkeit bestand, dass eines ihrer Mädchen zur Schicksalsträgerin bestimmt werden würde. Ich hatte drei jüngere Schwestern und einen älteren Bruder.
Meine Schwestern waren zehn, vierzehn und sechzehn Jahre alt. Ich war mit achtzehn die älteste Tochter und die einzige, die nicht das leibliche Kind meiner Eltern war.
Ich war vor knapp siebzehn Jahren vor der Tür der Familie mit der Bitte abgelegt worden, mich großzuziehen, weil es meine leiblichen Eltern nicht schaffen konnten. Bis heute wusste ich weder, wer meine Eltern waren, noch, woher ich kam. Immer wieder malte ich mir in Gedanken aus, dass meine Eltern sehr verzweifelt und arm gewesen sein mussten. Vielleicht hatte meine Mutter auch meinen Vater verloren und mich nicht allein großziehen können. Es war eine Schande, wenn man als alleinstehende Frau ein Kind zur Welt brachte. Solche Frauen kamen in eine Besserungsanstalt, die Kinder wurden ihnen weggenommen. Man munkelte sogar, dass sie anschließend getötet wurden, da sie ungeweihte Kinder waren, die in keiner sittsamen Ehe gezeugt worden waren. Aus Verzweiflung begingen viele Frauen, die ungewollt schwanger wurden, die seltsamsten Dinge. Legten ihre Kinder vor Klöstern ab, verließen das Königreich oder brachten ihr Kind um, bevor jemand von seiner Existenz erfuhr.
Ich verurteilte meine Mutter nicht für das, was sie getan hatte. Sie hatte versucht, mir ein gutes Leben zu ermöglichen. Mit der Wahl der Familie Leotarx hatte sie es sehr gut getroffen, auch wenn mein weißblondes Haar zwischen den dunkelhaarigen Familienmitgliedern hervorstach. Selbst der Dümmste unter den Dorfbewohnern erkannte sofort, dass ich nicht das leibliche Kind von Felippa und Paulson sein konnte.
Mit drei Jahren waren die Dorfältesten auf mich aufmerksam geworden. Bevor sie mich der jungen Familie hatten wegnehmen können, hatten sich Felippa und Paulson mit allem, was ihnen zur Verfügung stand, dafür eingesetzt, dass ich bei ihnen bleiben durfte. Sie hatten sogar zugesichert, weitere Mädchen zu bekommen, damit es immer genügend junge Frauen im Dorf gab, die man opfern konnte.
Ich verdankte ihnen viel. Viel mehr, als ich jemals zurückgeben konnte.
Nun, da meine Mutter schwer krank geworden war und die meiste Zeit im Bett verbringen musste, versorgte ich die Tiere unseres kleinen Hofs. Meine zwei Jahre jüngere Schwester Joydan pflegte den Gemüsegarten, Maidlen und Saray kümmerten sich um den Haushalt.
Mein Vater bereiste viele Dörfer, sogar fremde Königreiche, um die geschnitzten und bemalten Holzwaren, wie Teller, Löffel, Krüge, Eimer und sogar kunstvoll gestaltete Götterfiguren, zu verkaufen, die er zusammen mit meinem Bruder Arwen produzierte.
Jeder hatte seinen Platz, und zu keiner Zeit ließ mich jemand der Familie spüren, nicht dazuzugehören. Nur die Dorfbewohner erinnerten mich öfter daran.
Ich stieß die Haustür auf, wurde meine schweren Stiefel los und blickte mich um. Saray und Maidlen rannten in ihren hellen Leinenröcken die Treppe herunter, da sie mich sicher schon durch die Fenster beobachtet hatten.
»Oh, oh, Sóley, du bist spät dran. Wir gehen in einer halben Stunde los. Beeil dich besser«, rief mir Maidlen im Gehen zu, bevor sie barfuß in die Küche stürmte. Saray blieb mit ihrem von Sommersprossen übersäten Gesicht vor mir stehen. Ihr kastanienbraunes Haar lag zu einem perfekt geflochtenen Zopf um ihren Kopf. Sie schaute an mir vorbei. »Hast du was gefangen?«
»Ja, habe ich. Kaninchen. Sogar drei Stück.«
Ihre karamellbraunen Augen wurden groß. »Das wird Papa freuen. Die bereiten wir gleich morgen zu.«
»Nicht alle auf einmal. Und zuvor muss ich sie noch häuten und ausnehmen.« Was ich an diesem Abend lieber getan hätte, als mir ein weißes Kleid überzustreifen und eine rote Robe umzulegen.
»Ich nehme sie dir ab. Geh nach oben und wasch dich, Sóley, Mama hat sich schon Sorgen gemacht, wo du bleibst.«
Saray fasste nach meiner Beute und trug sie in den Keller. Ich machte mich sofort auf den Weg nach oben, um nach meiner Mutter zu sehen.
Anders, als ich heute Vormittag ihr Schlafzimmer verlassen hatte, lag sie nun nicht im Bett, sondern saß aufrecht hinter Joydan in den zerwühlten Laken und flocht deren Haar.
Das kurze Haar meiner Mutter stand büschelweise von ihrem Kopf ab. Früher hatte sie so wunderschönes, dickes haselnussbraunes Haar besessen, das ihr bis zur Hüfte gegangen war, wenn sie es offen getragen hatte. Aber seit sie erkrankt war, fiel ihr das Haar aus. Ihr ehemals so leuchtendes Gesicht hatte einen grünlich wächsernen Teint angenommen. Das einst so strahlende Bernsteinbraun ihrer Iriden war einem milchigen Schlammton gewichen. Um ihre Augen lag ein kränklicher Schatten. Die Seuche zehrte nun schon ein Jahr an ihr, mit jedem Tag mehr. Sie war sehr schwach und dünn geworden.
Ein weiches und zugleich erleichtertes Lächeln huschte über Mutters Gesicht, als sie mich in der Tür stehen sah.
»Da bist du ja, ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Du triffst sonst nie nach der Dämmerung ein«, nuschelte sie, zog eine goldene Nadel zwischen ihren spröden Lippen hervor und schob sie in Joydans glänzendes Haar.
»Tut mir leid. Ich musste tiefer in den Wald vordringen als sonst. Ich beeile mich und bin pünktlich fertig. Versprochen.«
Joydans Augen wanderten über meine verdreckte braune Leinenhose, die moosgrüne Tunika und meinen schwarzen Umhang. »Zuvor solltest du dich waschen. Du bist von oben bis unten voller Erde.«
Dass es keine Erde war, wollte ich ihnen nicht sagen. Nicht an diesem Tag.
»Klar, hatte ich auch vor. Dafür habe ich drei Kaninchen gefangen. Somit hat sich die Jagd gelohnt. Was hast du heute gefangen?«, neckte ich meine Schwester, die mir einen gespielt verärgerten Blick schenkte und nach einer Nadel vor sich griff, um sie nach mir zu werfen. Geschickt duckte ich mich lachend unter dem kleinen Geschoss hinweg.
Für eine Sekunde blieb ich im Türrahmen stehen, da ich Joydan zuvor nie so schön gesehen hatte. Sie besaß weiche, zarte Gesichtszüge und braun glänzendes Haar. Ihre Lippen waren sogar rot nachgemalt worden, was sie erwachsener und noch schöner aussehen ließ. Wie eine Prinzessin.
Doch der einzige Gedanke, der mir durch den Kopf ging, war: Lass das Los heute Nacht nicht auf sie fallen. Bitte, bitte nicht!
Das hätte meine Mutter nicht verkraftet. Denn anders als die anderen Familien beugte sich unsere zwar den Bestimmungen und erschien auf dem Fest, jedoch teilte sie nicht die Meinung der anderen Dorfbewohner. Für sie war die Zeremonie eine Opferung an die Dämonen und kein glorreiches Ritual.
In meinem Dachzimmer angekommen, fand ich auf meinem alten Holztisch neben einer bemalten Laterne eine Schüssel mit frischem Wasser, ein Stück Seife und zwei Baumwolltücher vor. Eine meiner Schwestern musste mir alles gebracht haben.
Ich wurde meine Kleidung los, legte sie auf einen Haufen, um sie morgen zu reinigen, und begann damit, mich zu säubern.
Immer wieder ertappte ich mich dabei, wie meine Gedanken zu der großen Kreatur im Wald abschweiften.
Vor dem beschlagenen Spiegel, der über dem Tisch hing, flackerte die kleine Laterne. Zwar war mein Körper nicht mehr komplett von dem schwarzen öligen Film überzogen, trotzdem hingen immer noch Reste in meinen Haaren und Augenbrauen. Es klebte auch an meinem Hals und auf meinen Händen. Das verfluchte Zeug ging selbst mit der Bürste kaum ab. Ich musste sehr lange über die Stellen schrubben und mein Haar dreimal waschen und ausbürsten, bis die schwarze Substanz verschwunden war. Zwischen den Fingern zerrieb ich die Farbe. Sie war klebrig und pudrig zugleich.
Als ich mein Gesicht näher zum Spiegel bewegte, um zu prüfen, ob ich den Dreck losgeworden war, erzitterte die kleine Flamme der Laterne. Für den Bruchteil einer Sekunde flackerten weiße Linien im Spiegel auf. Nein, nicht im Spiegel, in meinen Augen. Wieder hörte ich das summende Knistern, dieses Mal an meinem linken Ohr.
Ruckartig drehte ich mich auf dem Holzhocker um, konnte aber nichts ausmachen, was dieses Geräusch erzeugte. Mit dem Knistern hatte alles im Wald begonnen. Was, wenn die Dämonen im Dorf sind? Was, wenn sie bei der Zeremonie zusehen?
Ich strich über meine Wangen, während ich einige Sekunden lang den Spiegel betrachtete. Doch die weißen Linien zeichneten sich nicht mehr in meinen Iriden ab. Ich hatte sie mir bloß eingebildet. Wie wohl das meiste an diesem Tag.
Plötzlich klopfte es an meiner Tür. »Ich bin es und bringe dir dein Kleid.« Saray öffnete die Tür, um mir einen Stapel zusammengefalteter Kleidung auf das schmale Bett, das unter der Dachschräge stand, zu legen. »Soll ich dir bei deinem Zopf helfen?«
Sie trat hinter mich und kämmte mit ihren Fingern mein hellblondes langes Haar durch.
»Wenn du möchtest?« Ich schenkte ihr ein Lächeln.
»Ja, ich finde deine Haarfarbe so besonders. Keiner im Dorf hat so helles Haar wie du.«
Was mir sehr oft zum Verhängnis wurde. Denn so ziemlich jeder reduzierte mich auf das Haar, mein Aussehen, mein Verhalten und hielt mich für kein menschliches Wesen.
Nachdem ich mich umgezogen hatte, fühlte ich mich wie jedes Jahr unwohl in dem scheußlichen knielangen Kleid mit den langen Ärmeln, dem V-Ausschnitt und den nackten Beinen und ließ mir von Saray die Haare frisieren. Jedes Mädchen zwischen dreizehn und neunzehn Jahren musste zu diesem Anlass dieselbe Kleidung und Frisur tragen.
»Der König soll schon auf dem Festplatz eingetroffen sein«, erwähnte Saray beiläufig, als ich die Robe überstreifte und sie am Hals und über der Brust mit Spangen schloss. Nur die reichen Dorfbewohner konnten sich goldene Verzierungen, Bordüren und Kordeln leisten wie dieser aufgeblasene Niklas.
»Seine Gefolgsleute und Soldaten auch?«, hakte ich nach.
»Ja, sie sind alle da, tanzen und essen. Es stehen dieses Mal über fünfzehn Zelte um den Festplatz. Mehr als die Jahre zuvor. Somit sind sehr viele Soldaten anwesend. Im letzten Dorf fiel angeblich das Los auf zwei Schicksalsträgerinnen. Glaubst du, dass … dass vielleicht zum ersten Mal unser Dorf verschont bleibt?«
Gleich zwei? Wie schrecklich. Das ist eine absolute Seltenheit.
»Ich würde es mir wünschen, glaube es aber nicht, Saray.«
Meine Schwester hatte Angst. Das spürte und las ich in ihrem zarten Gesicht. »Falls es dich trifft oder Maidlen oder Joydan, werde ich euch helfen zu verschwinden. Du musst keine Angst haben. Ich habe vorgesorgt.«
»Ich weiß. Trotzdem ist es verboten. Die Soldaten werden uns töten, wenn sie davon erfahren, das weißt du. Sie würden unsere gesamte Familie hinrichten. Jedes Nachbardorf würde uns melden und festnehmen lassen, sobald sie uns entdeckten. Wir können nicht fliehen, Sóley.«
»Doch, das können wir. Ich kenne die Wälder besser als unsere besten Jäger. Es gibt in ihnen Bereiche, die sicher sind. In denen man Tage oder Wochen überleben kann. Ich habe solche Orte gefunden und bereits für Proviant, Decken und warme Kleidung gesorgt. Diese Verstecke werden die Soldaten nicht finden.«
Weil keiner mutig genug ist, tiefer in die verfluchten Wälder vorzudringen.
Saray blinzelte hoffnungsvoll und ängstlich zugleich. »Ich wünschte, ich wäre so mutig wie du. Aber das bin ich nicht. Meine Angst wäre viel zu groß, von einem Bären angegriffen oder von den Soldaten des Königs gefunden zu werden. Sie haben heute zwei weitere Bewohner gehängt. Die Eltern von Dena und Misome.«
»Wieso?«, wollte ich schockiert wissen. »Was ist passiert?«
Sie schlug die Augen nieder und kämpfte gegen aufkommende Tränen an. »Sie haben sich geweigert, ihre Töchter an der Zeremonie teilnehmen zu lassen, und wollten gestern Nacht fliehen. Ein Nachbar hat sie aufgehalten, in ihrem Stall eingesperrt und es dem Bürgermeister gemeldet.«
Mich traf ihre Erzählung wie ein Schlag ins Gesicht. Denas und Misomes Eltern hatten nie den Anschein erweckt, dass sie die Zeremonie ebenfalls für falsch hielten. Es war besser, wenn man nicht damit prahlte, gegen die Gesetze zu verstoßen. Aber sofort dafür gehängt zu werden, war … Es war falsch. Es fühlte sich nicht richtig an, sie mit dem Tod zu bestrafen, nachdem sie ihre Töchter hatten beschützen wollen.
»Stimmt das wirklich?«, fragte ich flüsternd und zog die Brauen zusammen.
Saray nickte. »Es ist wahr. Während du im Wald warst, hie…hielt«, sie holte zittrig Luft, »der Bürgermeister seine übliche Rede wie in jedem Jahr. Anschließend ließ er … ließ er Denas und Misomes Eltern vor den Augen aller Bewohner hängen. Es war s…so grausam.«
Saray hatte noch nie eine Hinrichtung gesehen, ich hingegen bereits drei. Man gewöhnte sich nie an den Anblick. Aber das erste Mal war einfach furchtbar. Ein Anblick, den man nie vergaß, wenn ein Mensch mit dem Tod kämpfte und anschließend das Leben in seinen Augen erlosch.
Gänsehaut breitete sich auf meinen Unterarmen aus.
Ich zog Saray in meine Arme, um sie zu trösten. »Es tut mir so leid, dass du das mit ansehen musstest. Wenn es dich tröstet, sie sind für eine gute Sache gestorben. Sie wollten ihre Kinder in Sicherheit bringen.«
Saray schluchzte, während ich über ihr geflochtenes Haar strich und mit einem entschlossenen Gesichtsausdruck zu den Dachbalken aufblickte. Den Dachbalken, die mit grünen Efeuranken bemalt waren, die eine verschneite, märchenhafte Welt mit einem Schloss darstellten. Ein Schloss – so imposant, strahlend und wunderschön, wie es nur in Geschichten vorkam. Es war mein Schloss, in das ich in meinen Vorstellungen einzog, um die finsteren Gedanken auszusperren. Als Kind hatte mir dieser Rückzugsort mehr als heute geholfen.
»Du hast recht. Trotzdem war es so brutal, grausam … so …«
»Uns wird das nicht passieren. Wir werden nicht hingerichtet, wenn wir fliehen. Denn wir lassen uns nicht fangen.«
Ich umfasste Sarays zartes Gesicht mit beiden Händen und schaute mit einem Lächeln tief in ihre Augen. Sanft wischte ich die Tränen auf ihren Wangen fort. »Versprochen.«
Zögerlich erwiderte sie ein schwaches Lächeln.
Zuerst wollte ich abwarten, auf wen das Los an diesem Abend fiel, danach blieb immer noch ein Tag Zeit, um im Ernstfall die Flucht vorzubereiten. Ich hatte überall im Wald kleine Verpflegungspakete versteckt, die alles Lebensnotwendige enthielten. Meine besten Freunde Layla und Nelio waren eingeweiht. Sie würden mir zur Seite stehen. Ihnen vertraute ich bedingungslos. Somit war eine spontane Flucht jederzeit möglich.
Und lieber würde ich bei dem Versuch zu fliehen erwischt und hingerichtet werden, als am Kreuz angebunden zu enden, um von einem Dämon verschleppt und gefressen zu werden.
* * *
Im Dorfzentrum feierte ausnahmslos jeder ausgelassen. Ein Orchester spielte fröhliche Musik. Schauspieler, Akrobaten und Tänzer versammelten sich auf der Bühne im Zentrum des Platzes, um den König und sein Gefolge zu unterhalten. Der junge Herrscher, nicht älter als Mitte zwanzig, saß neben einer bildschönen dunkelhaarigen Frau auf einem erhöhten, überdachten Podest. Links und rechts reihten sich seine engsten Vertrauten um ihn. Hinter ihm standen zwanzig Soldaten in einer Reihe und behielten in ihren rot polierten Rüstungen und schiefergrauen Umhängen das Fest im Auge. Dieses Jahr waren ungewöhnlich viele Soldaten anwesend. Mehr als sonst, was mir Sorgen bereitete.
Auf dem Festplatz tanzte das Volk, sang und betrank sich. Zum achten Mal erklang das Horn.
Mir verschaffte dieser tiefe, lang gezogene Ton Gänsehaut. Doch noch viel schlimmer war der selbstgefällige Gesichtsausdruck des Königs. Er saß in seiner majestätischen Robe, den polierten schwarzen Stiefeln und der goldenen Krone in einer lässigen Haltung auf dem gepolsterten Stuhl mit seiner gewaltigen Lehne. Und er hatte nichts weiter zu tun, als die Frau neben sich überall unsittlich zu berühren. Sie war nicht seine Königin. Er hatte bisher nicht geheiratet. Aus dem Grund munkelte man, dass ihn dieses Jahr eine seiner Konkubinen durch das Königreich begleiten würde.
Mir war es gleichgültig. Ich hielt wenig vom König und noch weniger von seinen Gesetzen, die die Dorfbewohner ausbeuteten und die Stadtbewohner immer reicher werden ließen.
Ich wandte mich von der Szene ab, bevor mir schlecht wurde, und suchte weiter nach Layla. Sie musste irgendwo in einem Stand vor dem Podest arbeiten. Genau dort, wo die meisten roten Rüstungen sich versammelten.
Ich entdeckte sie am Ausschank hinter einer gewaltigen Menschentraube, die sich vor dem Stand versammelt hatte. Mit schnellen Schritten ging ich auf sie zu, drängte mich zwischen die halb betrunkenen Soldaten und Dorfbewohner und schob mich zum klebrig feuchten Eichentresen.
Wie die anderen Mädchen trug sie eine rote Robe, darunter ein schneeweißes Kleid und darüber eine Schürze, um die Robe nicht zu beschmutzen. Da ihr Vater ein Gasthaus besaß, war er für die Bewirtung verantwortlich.
Layla eilte zwischen ihren fünf Brüdern hinter dem Holztresen hin und her wie ein Wiesel, um jeden Gast zu bedienen.
»Hast du einen Moment?«, fragte ich meine Freundin, die, als sie mich sah, mit einem Weinkrug in der Hand zu mir eilte.
»Eigentlich nicht. Es gibt viel zu tun. Aber … Torry, kann ich kurz zehn Minuten Pause machen?«, rief sie ihrem drittältesten Bruder zu, der mürrisch zu ihr blickte, dann mich entdeckte. Sie schenkte ihm ihr einstudiertes unschuldiges Gesicht. »Ich muss mal für kleine Mädchen.« Torry sah mich, schüttelte den Kopf und rief ihr zu: »Zehn Minuten!«
»Danke, du bist ein Schatz … Lieblingsbruder«, schmeichelte sie ihm.
Torry verdrehte bloß knapp lachend die Augen. »Morgen nicht mehr, wetten?«
Layla kicherte, füllte zwei Tonbecher mit Wein, schnappte sich beide und huschte durch die Hintertür des Standes, wo ich auf sie wartete.
»So, jetzt, endlich. Du erlöst mich. Die Leute saufen heute wie in keinem Jahr zuvor.«
»Glaube ich dir. Die Hälfte ist bereits betrunken«, gab ich zurück und betrachtete drei torkelnde und singende Männer, die Arm in Arm die Menge unsicher machten.
»Hier, für dich. Wenn ich jemandem gern Wein umsonst einschenke, dann dir.«
»Ich trinke nicht«, erwiderte ich.
»Mach schon. Nur heute. Er ist wirklich lecker. Viel zu schade für die stinkenden Trunkenbolde und Solis.« Layla schaute mir erwartungsvoll aus ihren grünen Augen entgegen. Auch sie trug ihr hellbraunes gesträhntes Haar zu einem Zopf gebunden.
Ja richtig, ihr Geheimwort für Soldaten. Solis.
»Ist dieses Jahr keiner dabei, der dir gefällt? Meistens hast du dir recht schnell einen Liebling ausgesucht.«
»Nein, sie sind alle unverschämt und schmierig. Sie lassen dieses Jahr mehr unanständige Bemerkungen fallen als früher. Hier! Nun trink schon. Für mich. Nur einen Schluck«, bettelte sie.
»Na gut. Weil du ihn mir schenkst.« Ich zwinkerte ihr zu.
»Auf dass wir nicht auserwählt werden«, prostete sie mir hinter der Hütte stehend zu und grinste frech.
»Auf dass keine ausgewählt wird«, antwortete ich ihr traurig lächelnd, stieß mit ihr an und nahm einen Schluck vom Johannisbeerwein. Er schmeckte süß und sauer zugleich.
Ich nahm nur wenige Schlucke, trotzdem breitete sich nach nur einer Minute eine wohlige Wärme in meinem Körper aus.
»Ich muss dir etwas erzählen, Layla.« Sie war die Einzige, der ich von den Dämonen im Wald berichten konnte. Meine Familie wollte ich nicht beunruhigen.
Mehrmals blickte ich mich um, um auszuschließen, dass wir beobachtet oder belauscht wurden.
Meine Freundin schaute mich fragend an. »Was ist los? Du siehst aus, als würde dich etwas beschäftigen. Das erkenne ich an diesem klitzekleinen Grübchen hier.« Sie tippte auf meine rechte Wange und lachte leicht beschwipst.
»Ich habe …« Ich legte beide Hände um ihr rechtes Ohr. »Ich habe heute im Wald einen Dämon gesehen.«
Als sie meine Worte hörte, erstarrte sie. Danach schlug sie mir flapsig auf die Schulter und lachte amüsiert. »Nicht dein Ernst. Hör auf, Späße zu machen!«
Meine Gesichtszüge veränderten sich nicht und blieben ernst. Stattdessen hob ich die Brauen. Schlagartig fror ihr Lachen ein. »Es ist … dein Ernst«, brachte sie unter gesenkten Lidern hervor und zog die Brauen zusammen. »Kein Witz? Wirklich nicht?«
»Nein, es ist mein voller Ernst.« Wir entfernten uns vom Zentrum des Festplatzes, um nicht belauscht zu werden. Sie wusste ebenfalls, was auf dem Spiel stand, wenn man unser Gespräch hörte.
»Ich habe zuerst ein etwa zehn Fuß großes massiges Tier gesehen mit einem Adlerkopf und Flügeln wie die eines Drachen. Das Ding bewegte sich auf allen vieren und war komplett schwarz. So schwarz, dass es kaum im Wald zu erkennen war. Es hörte das Horn aus dem Dorf und kreischte wie ein Raubvogel. Danach erschien eine dunkle, hochgewachsene Gestalt, ein Mann, glaube ich, mit breiten Schultern und dunklem Haar. Er sagte etwas zu der Kreatur und … Es war so gruselig. Eine große Schlange wand sich um seine Beine.«
Laylas Gesichtszüge gerieten ins Wanken, nachdem sie mir mit offenem Mund an den Lippen gehangen hatte. Sie sah aus, als wüsste sie nicht, ob sie laut losprusten oder mich ernst nehmen sollte.
»Hört sich alles wie ein Märchen an, das du dir ausgedacht hast.«
»Ja, ich weiß. Aber glaub mir, ich weiß, was ich gesehen habe.«
»Und dann?«, fragte sie neugierig und blinzelte erwartungsvoll, als würde sie auf ein glückliches Ende warten. »Hat dich diese schwarze Person gesehen?«
»Nein. Das Tier konnte wohl sehr gut riechen, hat aber meine Witterung nicht aufgenommen. Wieso, weiß ich auch nicht.« Nachdenklich zuckte ich mit den Schultern.
»Sóley, es war sicher ein Jäger und das Tier vor ihm ein Schwein.«
Meine Gesichtszüge verdüsterten sich. Machte sie Scherze?
»Sehr komisch. Ich weiß, wie ein Wildschwein aussieht. Würde ich dich jemals anlügen?«
»Nein.« Sie schüttelte den Kopf, nahm noch einen Schluck aus ihrem Becher und schaute mir über den Rand hinweg entgegen. »Aber du musst zugeben, dass es ziemlich verrückt klingt.«
»Ja, das tut es …« Meine Augen wanderten zu den tanzenden Menschen. Zwischen ihnen entdeckte ich große Pranken. Sah ich einen peitschenden Schwanz, der sich inmitten der Dorfbewohner hin und her bewegte und wieder verschwand. Dunkle Kuttenträger mischten sich unter die Feiernden.
Es geht wieder los.
Kamen sie bei der bloßen Erwähnung? Weil ich Layla von ihnen erzählt hatte? Unmöglich. Es hatte ganz sicher etwas mit der Zeremonie der Schicksalsträgerin zu tun.
Ich blinzelte mehrmals angestrengt.
Layla folgte meinem Blick und drehte sich um. »Was ist? Warum schaust du so komisch?« Vor meinem Sichtfeld wedelte sie mit der flachen Hand hin und her.
»Siehst du sie? Sie sind … hier«, wisperte ich und ließ beinahe den Tonbecher fallen.
»Was? Wo denn?« Layla drehte sich in alle Richtungen, bis ihre Augen an einem der Tische hängen blieben. »Oh, ich sehe unseren niedlichen Heniro, der zu dir starrt. Der Junge hat nur Augen für dich. Wenn die Zeremonie vorbei ist, solltest du ihm eine Chance geben. Seine Familie ist gut aufgestellt und er sieht wirklich …«
Ich ließ Layla wortlos stehen, als ich weitere dunkle Kreaturen zwischen den Menschen entdeckte. Sieht sie denn keiner? Sie sind doch mitten unter uns.
Je näher ich auf sie zuging und zum König aufblickte, der den Wesen auch keine Beachtung schenkte, desto mehr begriff ich, dass ich die Einzige war, die sie sehen konnte.
»Äußerst interessant«, hallte eine Stimme in meinem Kopf, der sich mit einem Mal leer, taub und kalt anfühlte. »Du siehst sie also?«
Mit einem Schlag war die Welt um mich herum eingefroren. Dunkle Wolken waberten wie pechschwarzer Nebel über dem Marktplatz auf. Keiner der Menschen bewegte sich mehr. Die Musik drang bloß noch verzerrt und eine Oktave tiefer an meine Ohren.
Was ist hier los?
Erschrocken drehte ich mich zu Layla um, die mir folgen wollte und die Hand nach mir ausgestreckt hatte, ganz so, als wollte sie mich aufhalten.
Direkt vor sie schob sich eine hochgewachsene dunkle Gestalt mit einem Gewand, das ich so noch nie gesehen hatte. Es erinnerte an matt schimmernde schwarze Echsenhaut, die zu einer Art Tunika verarbeitet worden war. Ihr schwarzer Umhang segelte in der Luft und verschmolz mit der reinen Finsternis. Rabenschwarze Augen, in denen das absolut Böse blau aufloderte, starrten mir unverhohlen entgegen. Da das Gesicht des Wesens von Schatten verdeckt wurde, konnte ich bloß seine Konturen erahnen, nicht aber seine Miene. Von dieser Gestalt gingen eine flimmernde Kälte und so viel erdrückende Energie aus, dass sie mir das Atmen erschwerte.
»Antworte schon! Ich habe dich etwas gefragt!«
Dieses Mal drangen seine Worte an meine Ohren und waren nicht in meinem Kopf.
Ich holte flach Luft, kratzte jedes Fünkchen Mut zusammen und nickte. »Ja, ich sehe dich und die Kreaturen.« Die … sich plötzlich um uns versammelt hatten. Ich entdeckte nun zehn solcher Wesen, die mit langen Klauen, großen lederartigen Flügeln und spitzen Schnäbeln ausgestattet waren. Sie glichen dem Untier im Wald. Sofort krampfte sich mein Magen zusammen. Es waren so viele. Zu viele.
»Das ist unmöglich. Du bist eine Magielose. Du bist nicht imstande, uns zu sehen, wenn wir es nicht wollen. Kein junger Sterblicher besitzt die Gabe des Mântas-Auges.«
Eine fließende Bewegung von ihm und sein Handballen legte sich auf meine Stirn. Bevor ich zurückweichen oder mich zur Wehr setzen konnte, durchströmten mich Wellen aus pechschwarzen Gefühlen. Neid, Missgunst, Habgier, Zorn und Wut regierten in einer Mischung aus lodernden Flammen und eiskalten Klingen meinen Körper. Meine Haut brannte, während mein Innerstes gefror.
Diese Gefühle waren so … übermächtig. Blaue Magiebögen flossen über meinen Körper. Ich war nicht einmal in der Lage, meine Fingerspitzen zu bewegen.
Was geschieht hier?
Meine Gedankengänge verlangsamten sich, während diese inbrünstigen niederen Empfindungen mich verschlangen, mich auffraßen. Es tat so weh und zerriss mich in tausend Stücke. Als ich glaubte, meine Knochen würden unter seinem Einfluss brechen, meine Haut sich in Fetzen von meinem Körper lösen und meine Eingeweide zerreißen, zog er die Hand zurück. Ein feines Blinzeln ging von seinen glühenden Iriden aus.
Als er fertig war, hörte ich ein Schnalzen mit der Zunge. »Einfacher Diener, vom untersten Rang, mit einem armseligen Fünkchen Magie in sich, was hast du unter den Sterblichen zu suchen?«
Einfacher Diener mit einem armseligen … Fünkchen Magie? Hat er mich gerade so bezeichnet?
»Antworte endlich, oder ich überlasse das deiner Zunge, nachdem ich sie dir aus dem Mund gerissen habe.«
Dornenranken umschlangen meine Kehle, hoben mich vom Boden und rissen mich in die Luft, als ich keinen Ton hervorbrachte. Ich griff instinktiv nach meiner Hüfte, um meinem Dolch zu ertasten. Doch ich trug das verdammte Kleid und nicht wie sonst meine Jagdkluft. Verflucht, was soll ich jetzt machen?
»Ich wohne … hier«, presste ich verärgert hervor, riss die Hände zu den schwarzen Ranken an meinem Hals und kniff die Augen zusammen. Obwohl er mir die Kehle mit dieser fremdartigen Macht zuschnürte, konnte ich dennoch atmen. Wieso?
»Du wohnst hier? Tatsächlich. Unter den Magielosen? Unmöglich. Bist du aus Nŏsfera geflohen? Hast du eine Mission?«
Die Kreaturen mit den Adlerköpfen zischten und rissen mit ihren Vorderläufen, die den Klauen einer Wildkatze ähnelten, den Boden auf.
»Ich bin nicht geflohen. Ich lebe hier, seit … ich denken kann.«
Diese Schattengestalt neigte interessiert den Kopf. Zumindest sah es so aus, da seine blau lodernden Augen zur Seite kippten. Von ihm ging ein anderer Geruch aus als von den Bestien. Er roch nicht nach Verwesung und Tod, sondern nach Nachtregen und etwas rätselhaft Angenehmem, das mich, auch wenn es dumm klang, an Meeresstille und Winterkälte erinnerte. Er roch wie der Reif, der in den Wintermonaten die Bäume, Wiesen und Wälder überzog, obwohl dieser Geruch kein Wesen umgeben sollte.
Ich erschauderte.
»Du lebst hier und trägst die Kleidung einer gewöhnlichen Magd? Du willst dich sogar als Auserwählte aufstellen lassen …« Er schien zu überlegen, wie alles zusammenhing. Kurzzeitig spürte ich, wie etwas auf meine Gedanken zugriff, sie in Unordnung brachte und darin las. Es schmerzte höllisch, sodass ich angestrengt keuchte und wild zappelte.
Plötzlich riss die Dunkelheit neben ihm auf, und eine weitere verhüllte Gestalt erschien, die das Wesen mit den blauen Augen ansprach. Augenblicklich stoppten die Schmerzen in meinem Kopf. Wieder hörte ich diese fremdartigen zischenden Worte. Gleich darauf verschwand die zweite Schattengestalt wieder.
»Jemand kümmert sich später um dich. Du stehst weit unter meinem Rang. Jetzt weiß ich, wo du bist, und kenne deine Aura.«
Mit einem Ruck gaben die Ranken nach, lösten sich um meinen Hals und sorgten dafür, dass ich aus gefühlt drei Metern Höhe im Gras landete. Meine Knochen schmerzten, als ich hart auf der gemähten Wiese aufkam. Gerade als ich mich aufrichten wollte, wurde ich nach vorn gedrückt und auf den Boden gepresst. Meine Nägel gruben sich in die Erde.
»Nächstes Mal verbeugst du dich sofort, wertloser Dareph! Und sprichst mich gefälligst mit meinem Titel an, nicht wie einen verachtenswerten Sterblichen! Merk dir das!«
Bevor ich fragen konnte, wie sein Titel lautete, lichteten sich die wabernden Schatten. Ohne weitere Worte an mich zu vergeuden, verschwand die Gestalt. Und mit ihr die fremdartigen teuflisch aussehenden Kreaturen.
KAPITEL 3
SÓLEY
Bei den Heiligen Nephistos, was war das?
Der Lärm des Festplatzes drang an meine Ohren, Posaunen erklangen, Menschen lärmten, jubelten, sangen und Layla stürzte auf mich zu.
Verdutzt schüttelte sie den Kopf. »Was …? Wie …? Gerade noch bist du vor mir gelaufen. Jetzt liegst du im Gras. Ich habe keine Sekunde weggesehen.«
Wie sollte ich ihr erklären, was geschehen war, wenn ich es selbst nicht verstand?
Leise schnaufend richtete ich mich in der Wiese auf und atmete tief durch. Mit beiden Händen klopfte ich trockene Halme und losen Staub von meiner verdreckten Robe.
Als ich damit fertig war und Layla weiterhin auf eine Antwort wartete, hob ich das Gesicht breit lächelnd. »Sag mal, wie viel hast du schon getrunken? Hast du nicht gesehen, dass ich gestürzt bin?«
Es bereitete mir kein Vergnügen, Layla anzulügen, aber mir fiel auf die Schnelle nichts Besseres ein. Ich würde sie einweihen, sobald ich mehr wusste.
Überlegend blinzelte sie und wägte ab, ob sie oder ich geträumt hatte. »Zwei oder drei Becher vielleicht?« Sie fasste sich an den Kopf.
Wenn nur ich die Dämonen und ihre Begleiter sehen konnte, musste ich Layla, so weit es ging, von ihnen fernhalten.
Als wir den Marktplatz erreicht hatten, ertönte der lang gezogene Ruf des Horns zum neunten und vorletzten Mal. Das bedeutete, dass sich alle Mädchen im Alter zwischen dreizehn und neunzehn Jahren in einer Reihe vor der Tribüne aufstellen mussten. Auch Layla und ich. Kurzzeitig herrschte eine wilde Unruhe unter den Bewohnern. Jüngere Mädchen wollten sich nicht von ihrer Familie trennen. Ältere Mädchen riefen nach ihren Geschwistern. Wieder andere starrten zum jungen König hinauf, der kerzengerade wie eine Statue auf das Treiben unter sich herabblickte. Jeden Moment erhob er sich, um den Namen der Betroffenen aus der Urne zu ziehen.
Während Layla und ich uns hinter unseren Geschwistern aufstellten, hielt ich Sarays Hand. Sie war nervöser als das letzte Jahr. Ihre Hand war schwitzig, ihr Gang unsicher. Sie musste nicht aufgeregt sein. Ich würde sie retten, ganz gleich was passierte.
»Ich bin da«, flüsterte ich ihr ins Ohr und strich über ihre Arme. Sie nickte zitternd und rückte auf. Aus den Augenwinkeln entdeckte ich zwischen den Dorfbewohnern und den Männern, die hinter einem roten Band warten mussten, meinen Vater und meinen Bruder. In beiden Gesichtern konnte ich Sorge und Anspannung lesen. Wenige Meter entfernt sah ich Niklas mit vorgerecktem Kinn, die Arme stolz vor der Brust verschränkt, seiner Freundin Isa zunickend. Sie befand sich irgendwo vor uns in der Schlange. Joydan wirkte wie eine Marionette. So verhielt sie sich jedes Jahr. Distanziert, abgekapselt und innerlich darum betend, nicht gezogen zu werden.
Ganz vorn standen für gewöhnlich die Mädchen, für die es eine Freude war, an der Zeremonie teilzunehmen. Spätestens wenn das Ritual vollzogen wurde, schluchzten, wimmerten und flehten aber auch diese um ihre Freilassung. Auch die stolzesten verließ irgendwann der Mut.
Angespannt rieb ich mit dem Daumen über die Gravur der Bronzemünze. Jedes Mädchen besaß eine dieser Münzen, auf der ihr Name stand. Jedes Mädchen erhielt an seinem dreizehnten Geburtstag dieses Ding – feierlich vom Bürgermeister persönlich überreicht. Die Münze durfte nicht verkauft und verschenkt werden. Sie war Eigentum des Königs und diente ausschließlich dafür, sie in die schwarze Kristall-Urne zu werfen.
»Gleich haben wir es hinter uns. Dieses Mal sind hundertsiebenunddreißig Mädchen dabei«, erklärte Layla leicht beschwipst, hickste und schlang ihre Arme um mich. »Die Chance, gezogen zu werden, ist so gering. So winzig klein.« Mit Daumen und Zeigefinger deutete sie eine kleine Spanne an, damit Saray sich beruhigte und über sie lachte. Aber meine jüngere Schwester lächelte nicht einmal.
Saray holte zittrig Luft und nickte mit blassem Gesicht. »Was ist, wenn es dich trifft?«, fragte ich Layla wie jedes Jahr. Jedes Jahr hatte sie andere Antworten parat. Von »Dann werde ich Hals über Kopf mit einem Soldaten durchbrennen« über »Wenn es die Dämonengötter so wollen, dann ist es eben so«, bis hin zu »Die hässlichen Dämonen haben keine Ahnung, wie ungenießbar ich bin«. Dieses Mal überlegte sie, bevor sie in mein Ohr tuschelte: »Wir verschwinden natürlich gemeinsam. Wenn es dich oder mich treffen sollte.«
Das in unmittelbarer Nähe der Soldaten des Königs auszusprechen, war Hochverrat und hätte sie den Kopf kosten können.
Sofort presste ich meine Hand auf ihren Mund und schaute mich vorsichtig um. Keiner schien sie über den Tumult hinweg gehört zu haben. »Am besten, du sagst kein Wort mehr, bis es vorbei ist. Du bist so was von betrunken«, lachte ich aufgesetzt, während meine Blicke zu den Soldaten wanderten. Manche von ihnen patrouillierten auf der Bühne, auf der sich der König aus seinem Stuhl erhob und die Hände von der Frau neben sich löste.
Als Nächstes musste Saray die sieben Stufen zur Bühne hochsteigen und ihre Münze in die Urne werfen. Meine Münze fühlte sich zwischen meinen Fingern heiß und glatt an. Mittlerweile war mir jede eingravierte Linie, jeder Winkel der Lorbeerblätter, die meinen Namen kunstvoll umgaben, vertraut. Auf der Vorderseite stand mein Vorname, auf der Rückseite der meiner Familie. Am liebsten hätte ich sie weit weggeschleudert.
Mit kühler Miene betrat ich nach meiner Schwester die Bühne.
»Münze!«, wurde ich von einem Soldaten aufgefordert, der seine Hand ausstreckte. Ich gab sie ihm.
Er betrachtete sie und fragte dann schroff: »Name?«
»Sóley Leotarx«, antwortete ich wahrheitsgemäß, aber ruhig.
»Wie?« Der Bürgermeister ging gleichzeitig in seinem Buch die Liste der Mädchen durch und schaute mit seinen grau-blassen Augen, die rot umrandet waren, auf.
Ich wiederholte meinen Namen. »Sóley Leotarx.«
Der Soldat schaute zum Bürgermeister, dieser nickte und setzte einen Haken hinter meinen Namen.
»Kannst gehen.« Nicht ich warf die Münze in die Urne, sondern der schroffe Soldat, dessen Gesicht ich unter dem Helm in Form eines Drachenkopfes nicht erkennen konnte. Doch seine Stimme klang jung. Er konnte nicht älter als fünfundzwanzig sein.
Ich verließ die Tribüne. Im Gehen zog ich die Kapuze über den Kopf, wie jedes Mädchen, das die Tribüne verlassen hatte.
Als schließlich von jedem Mädchen die Münze in die Urne gelegt worden war, trat der König hinter das Gefäß, um seine alljährliche Ansprache herunterzubeten.