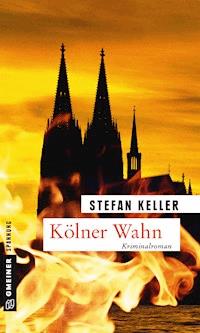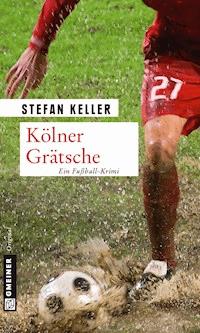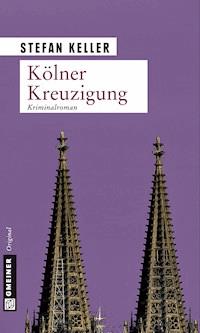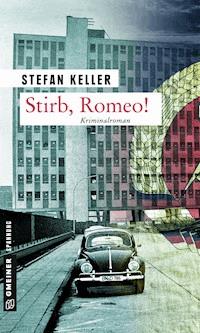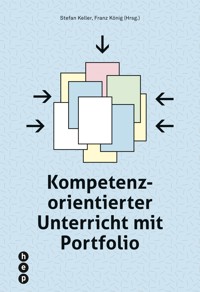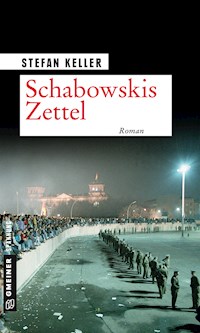
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Zeitgeschichtliche Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Die DDR ist in Aufruhr, aber der junge Volkspolizist Juri Hoffmann glaubt noch fest an den Sozialismus. Als er die Oppositionelle Nadja kennenlernt, gerät sein Weltbild ins Wanken. Die junge Journalistin recherchiert schmutzige Machenschaften der Stasi und gerät dabei in Lebensgefahr. Es gibt nur einen Weg, Nadja in Sicherheit zu bringen: Sie muss das Land verlassen. Aber wie kann ein einfacher Volkspolizist ihr dabei helfen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Keller
Schabowskis Zettel
Roman
Zum Buch
Berlin, November 1989 Seit den offenkundigen Wahlfälschungen bei den Kommunalwahlen im Mai dauern die Proteste an, gleichzeitig fliehen DDR-Bürger zu Tausenden über Ungarn und Prag in den Westen. Der junge Volkspolizist Juri Hoffmann hingegen glaubt noch fest an die DDR. Nadja Worzin wollte eigentlich studieren. Weil sie sich jedoch in Bürgerbewegungen engagiert, bleibt ihr dies verwehrt. Mittlerweile schreibt sie für eine Zeitung der Opposition. Ohne Furcht recherchiert sie die finsteren Geschäfte einiger Funktionäre und bringt sich damit in Lebensgefahr. Eines Nachts trifft Juri auf die verängstigte und blutende Nadja. Sie erzählt ihm, wie sie ein Lagerhaus mit Wertsachen gefunden hat, in dem Volkseigentum lagert, das Stasi-Kader an den Westen verscherbeln wollen. Nadja wurde entdeckt und entkam mit knapper Not. Juri zweifelt am Wahrheitsgehalt dieser Geschichte. Doch bei einer Sitzung des Politbüros fallen ihm teure Westanzüge und guter Wein auf. Woher stammt das Geld dafür? Und wie kann er Nadja helfen?
Stefan Keller lebt und arbeitet als Schriftsteller, Dozent und Dramaturg in Düsseldorf. Nach seiner Tätigkeit als Wirtschaftsjournalist und Theaterdramaturg schrieb er unter anderem Hörspiele, Fernsehshows, Drehbücher und Bühnenstücke. Zudem lektorierte er für Filmproduktionen und Fernsehsender. Seit mehreren Jahren unterrichtet er Schreiben an den Universitäten in Köln und Düsseldorf. »Schabowskis Zettel« ist sein siebter Kriminalroman im Gmeiner-Verlag.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Stirb, Romeo! (2016)
Düsseldorf - Porträt einer Stadt (2017)
Kölner Wahn (2015)
Kölner Grätsche (2014)
Kölner Luden (2013)
Kölner Persönlichkeiten (2012)
Kölner Totenkarneval (2011)
Kölner Kreuzigung (2010)
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
3. Auflage 2020
Lektorat: Sven Lang
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild – Röhrbein
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-5956-6
Vorbemerkung
Dieses Buch ist kein historisches Werk, sondern ein Roman, in dem Fakten und Fiktion eine Einheit eingehen. So tragen zwar manche der handelnden Personen ihre historisch richtigen Namen, aber die individuelle Figurenzeichnung und sämtliche Dialoge sind erfunden …
… vermutlich.
Was in jedem Fall wahr ist: Liebe versetzt nicht nur Berge, sondern bringt auch Mauern zu Fall.
Donnerstag, 9. November 1989
1
Internationales Pressezentrum der DDR, Mohrenstraße, Berlin (Hauptstadt der DDR)
Juri Hoffmann wippte unruhig mit dem Fuß. Nachdem er Günter Schabowski in den Pressesaal gefolgt war, hatte er sich auf der rechten Seite des Raumes hinter den Kameras der Fernsehanstalten positioniert. Hier, im Gedränge vor der holzvertäfelten Wand, würde er niemandem auffallen, so hoffte er. An den Objektiven vorbei sah er auf die Journalisten in den rot gepolsterten Stühlen und auf das Podest mit den eingebauten Lautsprechern, hinter dem fünf Sessel bereitstanden. Von nun an lag ihr Schicksal in der Hand des Parteisekretärs, der neben dem Podium stand und diskutierte.
Freundlich lächelnd machte Juri einer jungen Kameraassistentin Platz, die verzweifelt versuchte, dem Kabelwust in ihren Händen Herr zu werden. »Mein erster Tag«, flüsterte sie entschuldigend, als sie ihm auf den wippenden Fuß trat. Er nickte, wollte etwas sagen, brachte aber kein Wort heraus. Stattdessen beobachtete er das Podium, auf dem sich nichts tat. Anders im Saal: Hier wurde gemurmelt und aufgebaut, leise zwischen den Stuhlreihen debattiert. Manche Journalisten studierten Unterlagen, die auf ihrem Schoß lagen. Wenn das Mädchen Glück hatte und sein Plan aufging, würde ihr erster Tag gleich ein historischer Tag werden. Wenn nicht …
Er wollte gar nicht daran denken.
Juri überblickte zwischen den schwarzen Kameras hindurch die voll besetzten Reihen. Noch nie hatte er so viele Menschen aus dem Westen auf einmal gesehen. Sicher kannte er Westdeutsche und hatte als Volkspolizist mit einigen gesprochen, Besucher vor allem, die sich verlaufen hatten und glaubten, die Berliner Polizei sei eine Auskunftei. Doch so zahlreich wie im Pressezentrum waren sie ihm noch nie begegnet. Dutzende Vertreter westdeutscher Medien füllten den Raum. Sogar die Logos britischer, italienischer und amerikanischer Fernsehsender, Radiostationen und Zeitungen konnte er auf den Kameras und Mikrofonen erkennen.
Die Assistentin vor ihm hatte ihre Kabel inzwischen zusammengerollt und hielt sie in der Hand, ihr Blick war konzentriert auf die Kamera vor ihr gerichtet. Günter Schabowski, der nun das Podium betrat, beachtete sie gar nicht. Auch die anderen Journalisten, Briten, Franzosen, Amerikaner, schauten kaum auf, nur langsam kehrte Ruhe im Saal ein.
Der Sekretär für Informationswesen nahm in der Mitte der Bühne Platz, legte Tasche und Zettel vor sich auf die Ablage und richtete ein Mikrofon. Er sah müde aus, fand Juri. Eben war ihm das gar nicht aufgefallen. Vielleicht betonte der blassgrüne Vorhang hinter ihm das Fahle in Schabowskis Gesicht.
Pünktlich um 18 Uhr begann der Sekretär seine Pressekonferenz. Mit klopfendem Herzen hörte Juri seinen Ausführungen zu, wartete auf die alles entscheidende Mitteilung. Auf der anderen Seite des Raumes sah er den italienischen Journalisten, der ihn vor einigen Tagen vor dem ZK-Gebäude angesprochen hatte. Er wirkte gelangweilt, hielt die Arme verschränkt vor dem Körper, den Kopf leicht gesenkt, als würde er dösen. Juri betrachtete dessen Kollegen auf den Sitzen. Kaum jemand schien dem, was Schabowski zu sagen hatte, größere Bedeutung beizumessen.
Tatsächlich verlor der Sekretär kein Wort über das neue Reisegesetz. Juri hatte gedacht, dass er diese Neuigkeit als Erstes bringen würde. Immerhin war sie deutlich spektakulärer als die Themen, über die der frühere Journalist stattdessen redete. Weitschweifig referierte er zu Fragen der Parteireform und der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lage in der DDR. Die Zeit schritt voran, Juris Fuß wippte immer schneller. Mittlerweile war es zehn vor sieben, er wusste, dass Schabowski seine Pressekonferenz pünktlich beenden würde. Hatte er alles bemerkt, seinen Plan durchschaut und gar nicht mehr die Absicht, sich zur Reiseregelung zu äußern?
*
Günter Schabowski setzte sich auf den mittleren Platz des Podiums und sortierte die Unterlagen für die anstehende Pressekonferenz. Kurz runzelte er die Stirn, als er den Beschluss las, den der junge Volkspolizist ihm soeben in die Hand gedrückt hatte. Er wusste, dass der Zettel von Krenz kam, ihm klangen noch die Ohren wegen des Sturms der Kritik, den die Veröffentlichung des ersten Entwurfes für ein neues Reisegesetz ausgelöst hatte, dennoch las er ihn jetzt staunend:
»Zur Veränderung der Situation der ständigen Ausreise von DDR-Bürgern nach der BRD über die CSSR wird festgelegt:
Die Verordnung vom 30. November 1988 über Reisen von Bürgern der DDR in das Ausland (GBl. I Nr. 25 S. 271) findet bis zur Inkraftsetzung des neuen Reisegesetzes keine Anwendung mehr.
Ab sofort treten folgende zeitweilige Übergangsregelungen für Reisen und ständige Ausreisen aus der DDR in das Ausland in Kraft:
a) Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen (Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse) beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Versagungsgründe werden nur in besonderen Ausnahmefällen angewandt.
b) Die zuständigen Abteilungen Pass- und Meldewesen der VPKÄ in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Die Antragstellung auf ständige Ausreise ist wie bisher auch bei den Abteilungen Innere Angelegenheiten möglich.
c) Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. zu Berlin (West) erfolgen.
d) Damit entfällt die vorübergehend ermöglichte Erteilung von entsprechenden Genehmigungen in Auslandsvertretungen der DDR bzw. die ständige Ausreise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten.
Schabowski schüttelte unmerklich den Kopf. Er wusste, dass eine neue Reiseregelung im Politbüro diskutiert worden war und dass der Ministerrat darüber entscheiden sollte. Aber wann diese Entscheidung nun getroffen worden war, erschloss sich ihm nicht, schon gar nicht, ab wann sie gelten sollte. Wo war der übliche Sperrvermerk? Er blätterte in den Papieren. Darin fand sich nichts. Nachdenklich notierte er sich in großen Buchstaben »ZEIT« auf einen Zettel. Noch einmal betrachtete er das Dokument. Es war zweifelsohne echt. Für die Richtigkeit bürgte das Sekretariat des Ministerrates mit einer Unterschrift.
Er musste darüber nachdenken, wie er diese Nachricht verkünden konnte. Das würde am besten gelingen, wenn er ausführlich von etwas anderem redete. Am liebsten würde er sie übergehen. Sie erschien ihm reichlich übereilt und zusammengestümpert. Aber einen Beschluss zu verschweigen, der ihm eigens für diese Pressekonferenz übergeben worden war, verstieß gegen alle Gepflogenheiten.
»Wir müssen anfangen«, zischte jemand neben ihm. Schabowski nickte und packte den Beschluss des Ministerrates mit seinem Zettel ganz nach unten.
*
Juri hielt es nicht länger auf seinem Platz hinter den Kameras. Schabowskis Pressekonferenz neigte sich dem Ende zu und der Sekretär für Informationswesen schwieg weiter eisern über die neue Reiseregelung. Als hätte er alle seine Themen abgehakt, begann Schabowski nun sogar, Fragen der Journalisten zu beantworten, immer noch ein unerhörter Vorgang in einer offiziellen Pressekonferenz der SED. Als Schabowski dies bei seinem ersten Auftritt vor den Journalisten eingeführt hatte, war die Verblüffung groß gewesen. Für Juri bedeutete sein Schweigen, dass der Sekretär nicht die Absicht hatte, über die neue Regelung zu sprechen. Lautlos ging er nach hinten, hörte die sonore Stimme, die weiter nicht sagte, was er hören wollte. Er verließ den Saal, aber nur, um ihn auf der anderen Seite wieder zu betreten. Der italienische Journalist saß direkt vor dem Podium. Es sah aus, als habe er die Augen halb geschlossen.
Juri beugte sich zu ihm hinunter. Kaum jemand beachtete ihn, die Journalisten stellten ihre Fragen, Schabowski antwortete weitschweifig. Der Journalist brauchte einen Augenblick, ehe er ihn erkannte. »Wir haben gesprochen«, flüsterte er, »vor dem ZK-Haus. Sie waren der diensthabende Polizist, oder?«
»Ja, schön, dass Sie sich an mich erinnern. Sie sollten Schabowski nach der Reisefreiheit fragen. Es gibt Neuigkeiten.«
Der Italiener zog zweifelnd die Augenbrauen zusammen. »Reisefreiheit?« Er schnaubte, als habe Juri etwas Unerhörtes gesagt. Dem fiel jetzt auch der Name des Journalisten ein: Riccardo Ehrman. Er hatte sich über diesen für einen Italiener untypischen Familiennamen gewundert. Riccardo hatte ihm erklärt, dass seine Eltern jüdische Polen aus Lemberg waren. Ihre Hochzeitsreise hatte sie nach Florenz geführt und sie waren dort geblieben. Ein Detail, das Juri sich gemerkt hatte: Polen, die ihre Hochzeitsreise in Florenz verbrachten. Vielleicht würde das bald auch für Bürger der DDR Normalität sein. Zumindest wenn der Italiener Juris Aufforderung folgte. Der aber blieb zögerlich.
»Es gibt eine neue Regelung für Ausreisen aus der DDR. Frag Schabowski!«
Um sie herum breitete sich Unruhe aus. Ihr Gespräch störte die anderen Journalisten.
»Woher weißt du davon?«, zweifelte der Journalist weiterhin.
Konnte er nicht einfach Schabowski fragen? Juris Zeit lief ab. Nur noch wenige Minuten, dann würde Schabowski das Podium verlassen. Außerdem wusste Juri nicht so recht, was er auf die Frage erwidern sollte. Der Journalist würde ihm kaum glauben, dass er den Beschluss direkt von Krenz in die Hand gedrückt bekommen hatte, damit er, Juri Hoffmann, ein einfacher Volkspolizist, Schabowski den Zettel übergab. Seine kleine Veränderung oder besser Auslassung würde er ihm noch viel weniger glauben. Am Ende des Saales entdeckte er ein bekanntes Gesicht, das er in den letzten Tagen öfters im Zentralkomitee gesehen hatte: Günter Pötschke, Chef der DDR-Nachrichtenagentur ADN und Mitglied im Zentralkomitee. War es riskant, ihn als Quelle anzugeben? Ohne weiter nachzudenken, nannte Juri ihn. Besser nicht zu lange über die möglichen Konsequenzen grübeln. Wenn alles schiefging, hatte er ohnehin Probleme genug. Riccardo schien der Name Pötschke zu genügen, denn er hob die Hand. Schabowski nickte ihm auffordernd zu. Juri zog sich rasch zurück.
»Ich heiße Riccardo Ehrman, ich vertrete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Herr Schabowski, Sie haben von Fehlern gesprochen. Glauben Sie nicht, dass es war eine große Fehler, diese Reisegesetzentwurf, das Sie haben vorgestellt vor wenigen Tagen?«
Am liebsten hätte Juri ihn geschüttelt. Noch sieben Minuten blieben, um sein Ziel zu erreichen, und Ehrman stellte seine Frage derart umständlich und ging mit keinem Wort auf Juris Informationen ein. Doch anstatt zu antworten, kramte Schabowski den Ministerbeschluss hervor und las daraus vor. Juri erkannte die Stelle sofort. Sein Herz machte einen Sprung.
»Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen (Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse) beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Die zuständigen Abteilungen Pass- und Meldewesen der Volkspolizeikreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Ständige Ausreisen können über alle Berliner Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD beziehungsweise zu West-Berlin erfolgen.«
»Wann tritt das in Kraft?«, fragte der Italiener gleichzeitig mit einem westdeutschen Journalisten, der vor ihnen saß.
»Ab sofort?«, rief ein anderer Pressevertreter in den Raum. Juri spürte die Aufregung, die plötzlich herrschte.
Irritiert blickte Schabowski auf den Zettel vor ihm. Er zögerte, stammelte. Offenkundig hatten die beiden Journalisten ihn auf dem falschen Fuß erwischt. »Also Genossen, mir ist das mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon …«, er setzte sich die Brille auf die Nase, um wieder zu lesen, »… verbreitet worden ist. Sie müssten die … Die müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Das tritt nach meiner Kenntnis… ist das sofort… unverzüglich.«
Juri fielen tausend Steine vom Herzen. Ohne weiter zu warten, eilte er aus dem Saal. Jetzt musste er Nadja aus der Datsche holen, bevor es zu spät war. Hinter sich hörte er noch aufgeregtes Gemurmel, dann verließ er das Pressezentrum.
Unter den Säulen des klassizistischen Vordachs wandte er sich in Richtung Spittelmarkt. Über den menschenleeren Hausvogteiplatz, für dessen farbige Kunststeinplatten er keinen Blick hatte, lief er weiter in die Niederwallstraße, vorbei an dem alten Krankenhaus der Grauen Schwestern. Für einen Moment zweifelte Juri an dem, was er gerade erlebt hatte. Hatte er Schabowskis Worte nur geträumt? Berlin, das in den letzten Wochen manchmal eine andere Stadt geworden zu sein schien, frei, voller Hoffnung für die einen, voller Bedrohungen für die anderen, wirkte heute Abend unverändert wie lange nicht mehr. Die enge Straße mit den grauen Fassaden und Baulücken war menschenleer. Niemand außer ihm war auf der Straße unterwegs. Der heimelige Geruch von Braunkohlebriketts verhieß Wärme hinter den Fenstern und Fassaden, wohin sich die Menschen an diesem trüben Novemberabend zurückgezogen hatten. Aber was hatte er erwartet? Menschenmassen, die zur Mauer strömten? Die Nachricht von der Grenzöffnung würde sich erst nach 19 Uhr verbreiten, die »Aktuelle Kamera« frühestens ab halb acht darüber berichten. Dennoch, irgendwie hatte Juri geglaubt, dass sich augenblicklich Tausende aufmachen würden, um zu sehen, wie die Mauer geöffnet wurde. Aber die Niederwallstraße lag friedlich da. Auch der Spittelmarkt wirkte verlassen. Nicht einmal die Schaufenster des Exquisit-Ladens lockten viele Menschen an. Dabei war das Wetter im Verlauf des Tages ein wenig freundlicher geworden. Zeitweise hatte sogar die Sonne geschienen, doch jetzt leuchteten in den Fenstern der Wohnungen des Spittelecks die Lichter hinter den Betonbalustraden der Balkone. Alles schien unverändert. Nur Juri nicht.
Niemand hätte bei seiner Geburt gedacht, dass ausgerechnet er eines Tages die Berliner Mauer öffnen würde, in deren unmittelbarer Nachbarschaft er aufgewachsen war und bis heute lebte. Bis vor wenigen Tagen hätte er selbst das ebenfalls für unmöglich gehalten. Seine Eltern waren Arbeiter und Parteimitglieder, der Vater bis zu seinem Tod Schichtführer bei den Volkseigenen Betrieben Kabelwerk Oberspree in Oberschöneweide, die Mutter bis zu ihrer krankheitsbedingten Pensionierung Näherin in einem Bekleidungskombinat unweit ihrer Wohnung. Juri hätte eine Ausbildung im Kabelwerk beginnen können, aber schon als kleiner Junge stand sein Berufswunsch fest: Er wollte Volkspolizist werden. Im Kindergarten hatten sie immer ein Lied gesungen:
»Ich hab mich verlaufen, die Stadt ist so groß,
Die Mutti wird warten, wie find ich sie bloß?
Der Volkspolizist, der es gut mit uns meint,
Der bringt mich nach Hause, er ist unser Freund!«
Er hatte nicht eher Ruhe gegeben, bis sein Vater mit ihm ins Haus des Kindes am Strausberger Platz gegangen und die Schallplatte für ihn gekauft hatte. Monatelang lief sie rauf und runter, immer bis zur letzten Zeile, die der kleine Juri voller Inbrunst mitschmetterte:
»Und wenn ich mal groß bin, damit ihr es wisst,
Dann werde ich auch so ein Volkspolizist.«
Dank seines Großvaters, eines Generalobersts der Nationalen Volksarmee hätte ihm eine wesentlich leichtere Karriere bei der NVA offengestanden, aber der heranwachsende Juri Hoffmann sah seine Aufgabe im sozialistischen Staat weiterhin bei der Polizei und so ließ seine Familie ihn gewähren. In seinem Diensteid schwor er »die sozialistische Staats-, Gesellschafts- und Rechtsordnung zu schützen«. Heute hatte er seinen Eid gebrochen und die sozialistische Staats-, Gesellschafts- und Rechtsordnung in ihren Grundfesten erschüttert, vielleicht sogar endgültig zu Fall gebracht. Auch wenn seine Umgebung davon in diesem Augenblick nichts erahnen ließ.
Als er die Treppen der U-Bahn-Station hinunterlief, fragte er sich, wann alles begonnen hatte. Wann waren ihm Zweifel gekommen? War es in Leipzig gewesen? An jenem regnerischen Oktoberabend, als er mit Hunderten anderer aus der ganzen Republik abkommandierter Volkspolizisten bei einer Demonstration der Opposition für Ordnung sorgen sollte? Ihnen war erklärt worden, bei den Demonstranten handele es sich um »gewissenlose Elemente« und »Rowdys«. Ihr Kommandeur hatte zuvor eine kurze, lautstarke Ansprache gehalten. »Wir sind bereit und willens, das von uns mit unserer Hände Arbeit Geschaffene wirksam zu schützen, um diese konterrevolutionären Aktionen endgültig und wirksam zu unterbinden«, hatte er erklärt und einen Satz nachgeschoben, der Juri damals schaudern ließ: »Wenn es sein muss, mit der Waffe in der Hand.« Nie zuvor hatte er als Volkspolizist von der Waffe Gebrauch machen müssen.
So standen sie an diesem 2. Oktober behelmt und bewaffnet vor der Thomaskirche in Leipzig, als sich ihnen der Demonstrationszug näherte. Hunde bellten an knappen Leinen. Aus den Augenwinkeln sah Juri Wasserwerfer aus den Nebenstraßen kommen. »Wir sind das Volk«, skandierten die Demonstranten. Manche riefen auch: »Wir bleiben hier!« Was ihn als Erstes erschreckte, war die schiere Zahl der Demonstranten. Es mussten Tausende sein, und keiner von ihnen sah aus, wie sich Juri einen Rowdy oder ein gewissenloses Element vorgestellt hatte. Ihnen gegenüber standen ganz normale Menschen, DDR-Bürger wie sie auch. Unter den Polizisten spürte Juri dennoch – oder vielleicht umso mehr – die Angst wachsen. Wie sollte man dieser Menge Herr werden? Wie sollte man den Auftrag, diese Demonstration aufzulösen, erfüllen, ohne dass Menschen starben?
Er wusste nicht mehr, wann die Krawalle losgegangen waren, geschweige denn wer daran die Schuld trug. Irgendwann hörte er das Zischen der Wasserwerfer, sah Demonstranten, die von deren Fontänen zu Boden geworfen wurden, sah behelmte Kameraden, die auf die Fallenden zurannten, den Knüppel in der Hand, und losprügelten. Als Antwort flogen Steine auf die Polizisten, die notdürftig versuchten, sich hinter ihren Schilden zu verstecken.
Auch Juri verbarg sich hinter seinem Schild, rannte mit einer Gruppe Kameraden orientierungslos durch die fremde Stadt, in der Hoffnung, weder Steine werfenden Demonstranten noch einem Vorgesetzten in die Arme zu laufen. Nach einiger Zeit sammelten sie sich im Schatten einer alten Kirche. Vor ihnen tobte weiter die Straßenschlacht. Seine Aufmerksamkeit galt jedoch einer jungen Frau, die zwischen den Demonstranten stand und zu ihnen herüberblickte. An ihre linke Hand klammerte sich ein Kind, kaum vier Jahre alt, hielt die freie Hand vor sein Gesicht und weinte. Juri meinte, sein Schreien in dem Tumult hören zu können. Das waren die gewissenlosen Elemente, von denen ihr Kommandeur gesprochen hatte? Eine Mutter mit ihrem vierjährigen Sohn? Juri wollte dem Chaos Einhalt gebieten, aber natürlich brachte er kein Wort heraus. Es hätte ja auch nichts genützt. Er sah noch, wie die Frau das Kind auf den Arm nahm, sah, wie es sein Köpfchen an ihre Schulter presste. Dann drehte sich die Frau um und verschwand in der Menge. Juri musste sein eigenes Gesicht bedecken, um nicht von den Schwaden des Tränengases erwischt zu werden, das in die Menge geschossen worden war. Mit ein paar Kameraden drängte er sich an die Mauer der Kirche, bemüht, nicht in die Auseinandersetzung hineingezogen zu werden. Andere Polizisten und Demonstranten rannten an ihnen vorbei. Dumpf dröhnten die Schläge zu ihm herüber, greller und durchdringender hörte er die Schreie der Getroffenen.
Eine Woche später stand Juri wieder in Leipzig, wieder behelmt und den Schlagstock an der Seite. Unter den jungen Polizisten hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass es dieses Mal ernst werden würde, richtig ernst. Als ob die Ausschreitungen vom 2. Oktober nicht ernst genug gewesen waren. In den Leipziger Krankenhäusern sei angeblich medizinisches Personal für die Nacht zwangsverpflichtet, sogar Blutkonserven seien bereitgestellt worden. Mehrere Stunden rang Juri mit sich, um eine Lösung zu finden, wie er diese Nacht überstehen sollte, ohne auf seine Mitbürger einprügeln zu müssen. Im Lkw, der ihn nach Leipzig brachte, im Lager, wo sie auf ihren Einsatz warteten, und selbst noch auf der Straße, als die Parolen der Opposition wie ein fernes Grollen auf sie zurollten, dachte er darüber nach, sprach kein Wort mit den Kameraden, die allerdings ähnlich schweigsam waren wie er. Er würde nicht schlagen, hatte er irgendwann für sich beschlossen. Ohne eine Idee, wie er das bewerkstelligen wollte, stieg er vom Lkw.
Doch er musste sich darüber keine Gedanken machen. Zu viele Menschen demonstrierten an diesem Montagabend in Leipzig. 70.000, hatte er später gehört. Viel zu viele, um sie mit dem Knüppel auseinanderzutreiben. Viel zu viele, um sie aufzuhalten.
Als er nach Berlin zurückkehrte, wusste er, dass Veränderungen unausweichlich waren. Er wusste, dass sie auch ihn treffen würden. Gerade ihn. Den Volkspolizisten. Er hatte Angst davor. Deswegen hatte die Veränderung vielleicht erst später begonnen. Vor nicht einmal einer Woche. Als Nadja auftauchte. Nadja, derentwegen er den Staat, in dem er groß geworden war, an den er geglaubt und dem er einen Eid geschworen hatte, gerade zu Fall gebracht hatte. Nadja, die in Lebensgefahr schwebte.
Freitag, 3. November 1989
2
Christinenstraße, Berlin, sechs Tage zuvor …
Nadja Worzyn fluchte, als sie von der Fehrbelliner Straße in die Christinenstraße einbog. Der Koffer mit ihren Büchern und Platten wog schwer. Irgendwann hatte sie es aufgegeben, ihn zu tragen, stattdessen zerrte sie ihn wie ein störrisches Kind hinter sich her. Ein übergewichtiges, störrisches Kind! Rene Bintrup ging vor ihr, die unvermeidliche Kamera um die Schulter gehängt, in beiden Händen zwei Tüten, eine mit ihrem Hausrat, die andere mit ihren Klamotten. Ein Jutebeutel hing über der anderen Schulter. Er begutachtete neugierig die alten, düsteren Fassaden rechts und links der abschüssigen Straße, erzählte etwas über Jugendstil und Gründerzeit, was sie nicht verstand, weil er nach vorne sprach. Außerdem war Nadja mehr damit beschäftigt, den schweren Koffer festzuhalten, damit er nicht die Straße herunterpolterte und seinen Inhalt, von dem nicht weniges ihr eine Menge Ärger einbringen konnte, auf dem Kopfsteinpflaster verteilte. Die Schwerkraft überzeugte schließlich selbst das störrischste Kind.
Rene drehte sich zu ihr um, ergriff mit einer Hand den Koffer und half ihr, ihn zu halten. Die Tüte, es war die, in der sie heute Morgen ihre Klamotten gestopft hatte, baumelte lose am Handgelenk. Vor dem dritten Haus auf der rechten Seite blieb sie stehen.
»Hier ist es?«, fragte er.
Nadja nickte. Vorgestern Abend hatte sie die Wohnung im Dachgeschoss entdeckt, dunkle Fenster ohne Vorhänge, kein Licht. Auf dem obersten Klingelschild am Eingang stand kein Name. Sie war ins Haus gegangen und das alte hölzerne Treppenhaus hinaufgestiegen, dessen Stufen unter ihren Schritten knarzten und die so ausgetreten waren, dass sie einmal fast ausgerutscht wäre. Oben hatte sie an der Tür gelauscht, geklingelt, geklopft. Niemand hatte ihr geöffnet. Sie hatte durch das Schlüsselloch geschaut und nichts gesehen, nicht einmal Gerümpel. Die Wohnung stand wie so viele in den Innenstadtvierteln Berlins leer. Offiziell galt sie vermutlich als unbewohnbar, aber Wohnraum war knapp, und Nadja, allein lebend, von Abitur und Studium ausgeschlossen, stattdessen unfreiwillig Arbeiterin in einer chemischen Fabrik, befand sich auf der Warteliste des Amtes für Wohnungswesen gewiss nicht an vorderster Stelle. Ganz im Gegenteil: Ihre Chancen auf eine legale Wohnung in Berlin standen gleich null. Was ihr blieb, war nur diese illegale Besetzung, schwarzwohnen. Streng genommen beging sie damit eine Straftat. Aber gegen »streng genommen« hatte sie schon immer rebelliert.
Gemeinsam mit Rene schleppte sie den Koffer in das Dachgeschoss des alten und maroden Gebäudes. Über die Mittagszeit war alles ruhig. Nur im dritten Stock hörte sie ein Husten hinter dem dünnen hölzernen Türblatt einer Wohnung. Ansonsten herrschte Stille im Haus, überhörte man die gurrende Taube hinter dem alten Fenster in den Hinterhof, in dessen verblichenem Holzrahmen eines der vier Fenstergläser fehlte. Nadja mochte Tauben.
Sie stellten den Koffer auf dem obersten Treppenabsatz ab und die beiden Plastiktüten vorsichtig daneben. Die Kamera baumelte vor Renes Bauch. Er grinste sie noch einmal an, legte ihr die Hand auf den Arm. Sie trat einen Schritt nach vorne, drückte den Türknauf, obwohl sie wusste, dass sich die Tür so einfach nicht öffnen ließ, allein, um die Hand loszuwerden, doch Rene ließ sie dort. Nadja dachte an seine Frau Gerda und den kleinen Leo, die in einer Wohnung auf der nahen Schönhauser Allee auf ihren Mann und Vater warteten, und streifte die Hand langsam ab.
»Du musst mehr Kraft einsetzen«, erklärte Rene, ihre Geste unkommentiert lassend, und deutete auf die Tür.
»Einfach gesagt!«
»Versuch’s!«
Sie stellte sich vor die Tür, lehnte sich mit der Schulter dagegen, schob dann den Oberkörper ein Stück weit zurück und warf sich gegen das Holz.
Die Tür rappelte leicht, als wollte sie ihr freundlich zu verstehen geben, dass sie ihren Versuch durchaus wahrgenommen hatte.
Sie versuchte es erneut, diesmal mit mehr Schwung.
Die Tür rappelte ein wenig lauter, hielt weiter stand.
Auch Nadjas dritter Versuch scheiterte.
Die Tür blieb verschlossen. Nur ihre Schulter schmerzte.
Sie sah Rene an. Sie hasste es, von Männern abhängig zu sein. Noch mehr hasste sie es, von Rene abhängig zu sein, bei dem sie in den letzten drei Wochen Unterschlupf gefunden hatte. Eine Situation, die für alle Beteiligten – außer vielleicht für Leo, der mindestens ebenso sehr in sie verliebt war wie sein Vater – unerträglich geworden war. Nicht zuletzt deswegen war sie an den letzten Abenden regelmäßig durch die Straßen gewandert, um eine leer stehende Wohnung zu finden. Natürlich wollte sie unbedingt in der Nähe bleiben, im Prenzlauer Berg, wo Künstler, Literaten, Oppositionelle lebten und wirkten, wo sie sich das erste Mal in ihrem Leben willkommen und angenommen gefühlt hatte.
»Ich fürchte, du musst mir helfen.«
Rene trat einen Schritt nach vorn, schlug mit der flachen Hand einmal fest gegen die Tür oberhalb des Schlosses. Mit einem lauten Krachen flog sie auf, als wollte sie ihren Protest gegen Renes Aggression ins Treppenhaus hinausschreien. Der Fotograf nahm davon unbeeindruckt den Koffer, grinste zufrieden und trug ihn hinein. »Turner«, erklärte er betont gelassen. »Da steckt mehr Kraft drin, als man denkt.«
»Du hast geturnt?«
»Turbine Potsdam, am Reck«, erwiderte er von drinnen. Sie nahm die beiden Tüten vom Boden, lauschte noch einmal das Treppenhaus hinunter, ob irgendwer außer der Taube von dem Lärm der auffliegenden Tür aufgeschreckt worden war, und folgte Rene in ihr neues Heim.
»Beneidenswert! Ich bin über das Reck kaum rübergekommen.«
»Ich war froh, als ich aufhören konnte«, sagte er nur. Es war klar, dass er das Thema nicht weiter vertiefen wollte.
Als Erstes drückte sie den Lichtschalter neben der Tür. Manchmal hatte man ja ein wenig Glück. Sie juchzte bester Stimmung, als eine Glühbirne flackernd ansprang und die einzige Kammer erhellte.
Rene schüttelte grinsend den Kopf. »Nicht zu fassen, du hast Strom!«
Sie schauten sich um. Vergilbte, von Rahmen verschwundener Bilder verfärbte Tapeten mit einem kaum mehr zu erkennenden Blumenmuster, fleckige Streifen roter Rosen, durch grüne Banderolen voneinander getrennt, ein an manchen Stellen offen einzusehendes Ziegeldach, zwei kleine Fenstergauben zur Straße hin. Immerhin schienen die Fenster dicht zu sein.
Sie stellte die Tüten ab, ließ den Raum auf sich wirken. Wer hatte hier zuletzt gelebt? Vor ihrem inneren Auge sah Nadja eine alte Frau in dieser Kammer sitzen, eine Frau, die vielleicht Jahrzehnte hier gewohnt hatte, zuletzt allein, die vielleicht auch hier gestorben war. Sie sah Beamte des Amtes für Wohnungswesen, die etwas verlegen in dem niedrigen Zimmer standen, sich umsahen und entschieden, dass hier niemand mehr leben konnte, ehe sie die Tür von außen zuzogen.
»Du hast Glück«, sagte Rene und zog sich eine Fluse aus dem dichten roten Vollbart, die er mit einer lässigen Bewegung wegschnippte.
Nadja sah, wie sie in dem Licht der Glühbirne tanzte und langsam zu Boden sank.
»Möbliert.« Er deutete auf den kleinen Tisch an der einen Wand und das Bett auf der anderen Seite. Sogar eine Matratze fand sich noch darin. Weder das eine noch das andere hatte sie am Vorabend durch das Schlüsselloch erkennen können. Sie hatte wirklich Glück. Rene setzte sich demonstrativ darauf, wippte, der Lattenrost unter der Matratze quietschte. »Und bequem! Probier’s aus!« Er rückte ein Stück zur Seite und klopfte mit der Hand auf den Platz neben sich.
Nadja bückte sich nach den Tüten und zog zwei Vorhänge heraus. »Ich kümmere mich mal lieber um die Wohnlichkeit«, antwortete sie und lief zu den Gauben, um den Stoff zu befestigen.
Rene erhob sich und kramte in seinem Jutebeutel. Nach einigem Suchen zog er ein Türschloss hervor und hielt es hoch. »Das müsste passen.« Er holte noch einen Schraubenzieher aus dem Beutel, legte die Kamera beiseite und ging zur Wohnungstür. Binnen fünf Minuten hatte Nadja ihr eigenes Türschloss. Rene drückte ihr den Schlüssel in die Hand.
Gemeinsam gingen sie hinaus. Nadja schloss die Tür und schloss sie zur Probe gleich wieder auf. Alles funktionierte tadellos. Zufrieden steckte sie den Schlüssel in die Tasche ihrer Jeans. Dann zog sie ein Klingelschild hervor und befestigte es über der alten, runden Klingel neben der Tür.
»Worzyn«, las Rene, »jetzt ist es deine Wohnung. Vergiss aber nicht, die Miete zu bezahlen.«
Sie vermied es, mit den Augen zu rollen. Nadja wusste selbst, dass sie die Miete für die Wohnung einfach überweisen musste – zumindest einen Betrag, den sie für angemessen und realistisch hielt –, um sie irgendwann legalisieren zu können.
»Noch nicht ganz«, antwortete sie stattdessen.
Gemeinsam gingen sie die Treppe hinunter. Rene trug nur noch seine Kamera und den Jutebeutel. Am Hauseingang brachte Nadja ein weiteres Namensschild an. Niemand lief auf der Straße an ihnen vorbei, der misstrauisch werden könnte. Und selbst wenn: Vermutlich sahen sie aus wie ein junges Paar, das seine erste gemeinsame Wohnung bezog.
»Du weißt, was du als Nächstes zu tun hast?«, fragte Rene, während Nadja das Schild prüfend musterte.
Sie seufzte. »Natürlich. Als Erstes besuche ich heute Abend den Hausbuchverwalter und lasse mich ins Hausbuch eintragen.«
»Der wird aber feststellen, dass du keine Zuweisung für die Wohnung hast.«
»Aber natürlich habe ich eine Zuweisung!«, spielte Nadja ihre einstudierte Rolle. Sie hatten das in den letzten Tagen regelrecht geprobt. »Die liegt nur gerade zu Hause bei meinen Eltern.«
»Hoffen wir, dass er dir glaubt.«
»Wenn nicht, gehe ich morgen zur Polizei und lass mich ummelden.«
»Geh spät, dann haben die VoPos keine Lust mehr auf solche Sachen und stempeln schneller.«
»Ich weiß.« Oft behandelte Rene sie wie ein Kind. Bei Gerda verhielt er sich nicht anders. Das machte es nicht besser. Auch wenn er es nicht böse meinte. Wie er vielleicht auch seine Schwärmerei für sie nicht böse meinte, es irgendwie schaffte zu ignorieren, dass er Frau und Kind hatte, und sich vielleicht in der Sicherheit wiegte, dass Nadja seinem Werben nie nachgeben würde.
»Dann geh ich jetzt mal«, sagte er. »Doch zuvor …« Er nahm den Beutel von der Schulter, wandte sich ab und kramte darin. Nach kurzem Suchen zog er etwas hervor, drehte sich wieder zu ihr und hielt einen kleinen Topf in der Hand, den er ihr reichte. »Aus der Gärtnerei«, sagte er. Nadja nahm die Pflanze mit den hängenden Blättern und den winzigen roten Blüten entgegen, die in ihrem Topf dem Wind trotzte, der kalt die Christinenstraße hinunterwehte. »Herzlichen Glückwunsch zur neuen Wohnung, Schwarzwohnerin«, sagte Rene, grinste und umarmte sie. Sie ließ ihn gewähren, machte sich erst von ihm los, als ihr seine Umarmung zu lang wurde.
»Denk daran, dass du spätestens in zwei Wochen zum Wohnungsamt musst«, schärfte ihr Rene zum Abschied ein. Sie nickte bloß, drehte sich um und lief die Treppe hinauf in ihr neues Heim. Die Pflanze wackelte mit den Blütenköpfchen, als tadelte sie Rene für seine letzten mahnenden Worte. Woher sollte er wissen, dass Nadja in zwei Wochen keine Chance mehr haben würde, beim Amt für Wohnungswesen vorstellig zu werden?
Den Nachmittag über verbrachte sie damit, ihre Sachen auszupacken und sich einzurichten. Zunächst probierte sie, ob das Wasser in der Wohnung noch lief. Fast hätte sie erneut laut aufgejauchzt, als sich eine braune Brühe aus dem einzigen Hahn ergoss, die nach einiger Zeit erst gelb und dann klar wurde. Anschließend wischte sie den staubigen alten Holzboden mit einem Tuch, bezog das Bett, sortierte ihre Klamotten in Stapeln darunter. Dann klappte sie den Koffer auf, stellte ihre Schallplatten vorsichtig an die Wand. Auch wenn sie keinen Plattenspieler besaß, mit dem sie die Scheiben hören konnte, hatte sie sie nicht bei Rene lassen wollen. Genauso wenig wie ihre Bücher, die ihr noch heiliger waren und die sie in Ermangelung eines Regales in zwei weiteren Stapeln neben dem Bett aufbaute. Zuletzt stellte sie Renes Pflanze auf das Fensterbrett der linken Gaube. So sahen die Fenster zur Straße hin bewohnter aus und niemand anderes würde auf die Idee kommen, diese, nun ihre Wohnung zu besetzen.
Gegen vier Uhr nachmittags wurde es bereits so dunkel, dass sie eine Kerze anzünden musste. Sie trug den kleinen Tisch in die Mitte des Raumes, um dort an ihrem Artikel schreiben zu können, den sie heute Abend auf der Redaktionssitzung vorstellen wollte. Es ging um einen 20-Jährigen, der im Februar an der Mauer erschossen worden war. Ihrer Meinung nach war in der Öffentlichkeit viel zu wenig über diese Schicksale bekannt. Seit Monaten schon trug sie sich mit dem Gedanken darüber zu schreiben, hatte aber lange zu viel Respekt vor den drohenden Konsequenzen gehabt. Zu lange vielleicht.
Bei Rene hatte sie für solche Arbeiten Gerdas Schreibmaschine benutzen dürfen, nun musste sie wieder mit der Hand vorschreiben und den Beitrag später in der Redaktion abtippen. Sie sah ihre Unterlagen und Gesprächsnotizen durch. Dann schlug sie eine neue Seite in ihrem Notizbuch auf und strich sie glatt. Als sie das nächste Mal hochschaute, war es halb sieben. Erschrocken sprang sie auf, packte das Notizbuch, warf sich ihre Jacke über und rannte zur Tür hinaus. Die anderen warteten wahrscheinlich schon auf sie.
Sie flog die Stufen hinunter, es brauchte ein paar Treppenabsätze, ehe sie die schweren Schritte wahrnahm, die sich von unten näherten. Neugierig schaute sie über das Geländer hinab und erschrak. Die Hand eines Volkspolizisten lag auf dem Geläuf, der Arm mit der grünen Uniform deutlich zu sehen. Er war auf dem Weg nach oben. Hatte sie jemand verpfiffen?
Instinktiv drehte sie sich um und wollte wieder nach oben gehen, um sich irgendwo zu verstecken. Dann entschied sie sich anders. Sie hob den Kopf, straffte die Schultern und lief weiter die Treppe hinunter. Sollte ihr der Volkspolizist erst einmal nachweisen, dass sie etwas Verbotenes getan hatte.
*
Juri Hoffmann stieg die dunkle Treppe hinauf. Durch das Fenster zum Hof zog der Geruch von Holz- und Kohleöfen durch das Haus. Die Stufen quietschten unter seinen Schritten. Er lief vorbei an dem Kinderwagen, den die Brinkhofs aus dem ersten Stock vor ihrer Wohnungstür parkten. Von oben hörte er eilige Schritte. Als er um den Treppenabsatz herumbog, stieß er fast mit einer jungen Frau zusammen, die er noch nie gesehen hatte. Ein Notizbuch fiel zu Boden, Papiere folgten, wehten die Stufen hinunter, verfingen sich in den Stäben des Geländers, torkelten zurück und landeten auf dem Boden. Manche kamen erst auf dem Treppenabsatz unter ihnen zur Ruhe. Das Mädchen sah ihn erschrocken an. Dann reckte sie ihr Kinn trotzig nach oben. Juri kannte den Typ. In den letzten Monaten hatte er sich rasend schnell vermehrt. Aber er wusste auch, dass hinter dem trotzig hochgereckten Kinn Unsicherheit versteckt werden sollte. Gegenüber einem Volkspolizisten zeigte man die heute nur nicht mehr. Sie hatten jetzt also eine Oppositionelle im Haus. Na, besten Dank! Als ob im Kiez in den letzten Jahren nicht schon genug los gewesen wäre.
»Entschuldigung«, rief sie, lief an ihm vorbei und sammelte hastig die Papiere ein, stopfte sie ohne Rücksicht in das Notizbuch zurück, sodass einige Seiten einrissen.
Juri eilte drei Stufen zu ihr hinunter und ging neben ihr in die Hocke. »Lassen Sie mich Ihnen helfen. Es war doch meine Schuld.« Am besten half Freundlichkeit gegen Trotz. Und helfen musste man doch … Er streckte ihr die Hand entgegen. »Juri.«
»Nadja«, zischte sie so leise, dass Juri sie kaum verstand. Sie drängte sich zwischen ihn und die noch nicht eingesammelten Zettel, dass er kaum nach einem greifen konnte. Vielleicht half Freundlichkeit in diesem Fall doch nicht. Er hob eines der Papiere auf. Sie riss es ihm fast aus der Hand und stopfte es zu den anderen in das ohnehin schon zerfetzte Büchlein. »Sie müssen sich keine Mühe machen. Ich komme schon zurecht.« Beinahe schlug sie ihm die Hand weg, als er sich nach einem anderen Blatt bücken wollte.
Verärgert erhob er sich. »Na, wenn Sie nicht wollen«, murrte er.
Sie hatte jetzt alles beisammen und hielt das Notizbuch wie einen Schutzschild vor der Brust. »Wohnen Sie hier?«, fragte sie ihn.
»Im dritten Stock«, antwortete er. »Und Sie?« Sie strich sich nervös eine dunkelblonde Strähne aus dem eigentlich sehr hübschen Gesicht.